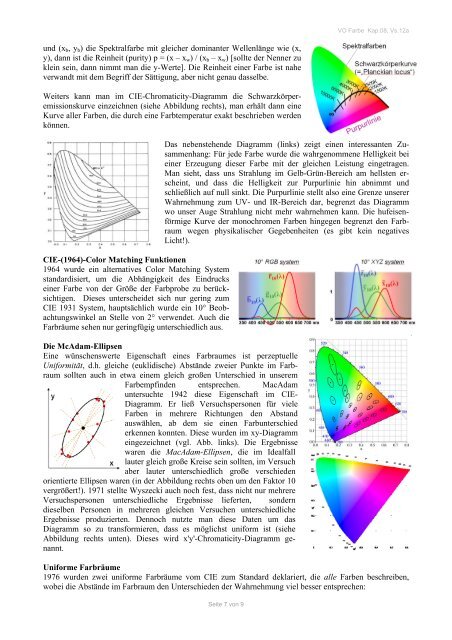8 Kolorimetrie
8 Kolorimetrie
8 Kolorimetrie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
und (xb, yb) die Spektralfarbe mit gleicher dominanter Wellenlänge wie (x,<br />
y), dann ist die Reinheit (purity) p = (x – xw) / (xb – xw) [sollte der Nenner zu<br />
klein sein, dann nimmt man die y-Werte]. Die Reinheit einer Farbe ist nahe<br />
verwandt mit dem Begriff der Sättigung, aber nicht genau dasselbe.<br />
Weiters kann man im CIE-Chromaticity-Diagramm die Schwarzkörperemissionskurve<br />
einzeichnen (siehe Abbildung rechts), man erhält dann eine<br />
Kurve aller Farben, die durch eine Farbtemperatur exakt beschrieben werden<br />
können.<br />
CIE-(1964)-Color Matching Funktionen<br />
1964 wurde ein alternatives Color Matching System<br />
standardisiert, um die Abhängigkeit des Eindrucks<br />
einer Farbe von der Größe der Farbprobe zu berücksichtigen.<br />
Dieses unterscheidet sich nur gering zum<br />
CIE 1931 System, hauptsächlich wurde ein 10° Beobachtungswinkel<br />
an Stelle von 2° verwendet. Auch die<br />
Farbräume sehen nur geringfügig unterschiedlich aus.<br />
Seite 7 von 9<br />
VO Farbe Kap.08, Vs.12a<br />
Das nebenstehende Diagramm (links) zeigt einen interessanten Zusammenhang:<br />
Für jede Farbe wurde die wahrgenommene Helligkeit bei<br />
einer Erzeugung dieser Farbe mit der gleichen Leistung eingetragen.<br />
Man sieht, dass uns Strahlung im Gelb-Grün-Bereich am hellsten erscheint,<br />
und dass die Helligkeit zur Purpurlinie hin abnimmt und<br />
schließlich auf null sinkt. Die Purpurlinie stellt also eine Grenze unserer<br />
Wahrnehmung zum UV- und IR-Bereich dar, begrenzt das Diagramm<br />
wo unser Auge Strahlung nicht mehr wahrnehmen kann. Die hufeisenförmige<br />
Kurve der monochromen Farben hingegen begrenzt den Farbraum<br />
wegen physikalischer Gegebenheiten (es gibt kein negatives<br />
Licht!).<br />
Die McAdam-Ellipsen<br />
Eine wünschenswerte Eigenschaft eines Farbraumes ist perzeptuelle<br />
Uniformität, d.h. gleiche (euklidische) Abstände zweier Punkte im Farbraum<br />
sollten auch in etwa einem gleich großen Unterschied in unserem<br />
Farbempfinden entsprechen. MacAdam<br />
untersuchte 1942 diese Eigenschaft im CIE-<br />
Diagramm. Er ließ Versuchspersonen für viele<br />
Farben in mehrere Richtungen den Abstand<br />
auswählen, ab dem sie einen Farbunterschied<br />
erkennen konnten. Diese wurden im xy-Diagramm<br />
eingezeichnet (vgl. Abb. links). Die Ergebnisse<br />
waren die MacAdam-Ellipsen, die im Idealfall<br />
lauter gleich große Kreise sein sollten, im Versuch<br />
aber lauter unterschiedlich große verschieden<br />
orientierte Ellipsen waren (in der Abbildung rechts oben um den Faktor 10<br />
vergrößert!). 1971 stellte Wyszecki auch noch fest, dass nicht nur mehrere<br />
Versuchspersonen unterschiedliche Ergebnisse lieferten, sondern<br />
dieselben Personen in mehreren gleichen Versuchen unterschiedliche<br />
Ergebnisse produzierten. Dennoch nutzte man diese Daten um das<br />
Diagramm so zu transformieren, dass es möglichst uniform ist (siehe<br />
Abbildung rechts unten). Dieses wird x'y'-Chromaticity-Diagramm genannt.<br />
Uniforme Farbräume<br />
1976 wurden zwei uniforme Farbräume vom CIE zum Standard deklariert, die alle Farben beschreiben,<br />
wobei die Abstände im Farbraum den Unterschieden der Wahrnehmung viel besser entsprechen: