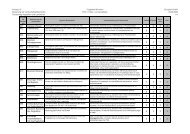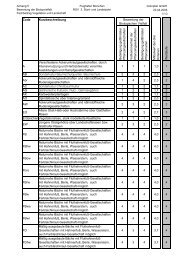Machbarkeitsuntersuchung einer bodengebundenen gesonderten ...
Machbarkeitsuntersuchung einer bodengebundenen gesonderten ...
Machbarkeitsuntersuchung einer bodengebundenen gesonderten ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Machbarkeitsuntersuchung</strong> <strong>einer</strong><br />
<strong>bodengebundenen</strong> <strong>gesonderten</strong> Schnellverbindung<br />
für Personen und Gepäck zwischen den<br />
Flughäfen Wiesbaden-Erbenheim und Frankfurt<br />
Auftraggeber: Mediationsgruppe Flughafen Frankfurt / Main<br />
Auftragnehmer: VIEREGG-RÖSSLER GmbH<br />
Innovative Verkehrsberatung<br />
Sendlinger Str. 46<br />
80331 München<br />
Airport Research Center GmbH<br />
Dennewartstr. 27<br />
52068 Aachen<br />
Ansprechpartner: Dr. Martin Vieregg<br />
Raimo Jacobson<br />
München / Aachen, im Januar 2000<br />
Inhaltsverzeichnis
1. Problemstellung<br />
Im Mediationsverfahren Flughafen Frankfurt/Main werden mehrere Möglichkeiten behandelt, um die für die<br />
kommenden Jahre drohenden Kapazitätsengpässe des Flughafens Frankfurt/Main (FRA) zu vermeiden. Neben<br />
dem Ausbau in FRA in Form <strong>einer</strong> 4. Landebahn und eines weiteren Terminals gibt es noch eine andere Option:<br />
die Umwandlung des rund 20 km entfernten amerikanischen Militärflughafens Wiesbaden-Erbenheim (WIE) in<br />
einen Zivilflughafen mit Bau eines eigenen Terminals und die Schaffung eines Flughafen-Verbundes zwischen<br />
diesem Flughafen und dem Flughafen Frankfurt/Main (FRA) mit Hilfe eines <strong>bodengebundenen</strong> schnellen<br />
Verkehrsmittels als "Airport-Link". Die Start- und Landebahn in Wiesbaden-Erbenheim verfügt theoretisch über<br />
eine Kapazität von 160.000 Flugbewegungen pro Jahr, rund ein Drittel der möglichen Bewegungen im<br />
bestehenden Drei-Bahnen-System Flughafen Frankfurt.<br />
Bei <strong>einer</strong> oberflächlichen Betrachtung könnte man die vorhandene Start- und Landebahn des Flughafens<br />
Wiesbaden-Erbenheim als mögliche 4. Bahn des Flughafens Frankfurt bezeichnen, vergleichbar mit der von der<br />
FAG geplanten Landebahn am Standort Frankfurt [1]. Doch eine solche Gleichsetzung ist strenggenommen nicht<br />
statthaft, denn anders als bei <strong>einer</strong> 4. Runway in FRA, die über Taxiways mit allen Terminals, Abstellpositionen<br />
und Wartungsanlagen in FRA direkt verbunden ist, kann zwischen der Bahn in WIE und den genannten<br />
Einrichtungen in FRA keine Rollweg-Verbindung für Flugzeuge geschaffen werden. Bezüglich des Flugbetriebs<br />
wird somit die räumliche Trennung von WIE und FRA dauerhaft bestehen bleiben. Deshalb ist eine volle<br />
betriebliche Integration des Flughafens Wiesbaden-Erbenheim in den Flughafen Frankfurt prinzipiell nicht<br />
möglich, sondern lediglich ein - wenn auch sehr enger - Verbund beider Flughäfen.<br />
Gegen eine solche Verbund-Lösung wird bislang das Argument vorgebracht, Wiesbaden-Erbenheim sei vom<br />
Flughafen Frankfurt relativ weit entfernt, so daß der Transfer von Fluggästen, Gepäck und Fracht zwischen<br />
beiden Flughäfen sehr zeitaufwendig und möglicherweise auch zu kostenintensiv wäre. Aus diesem Grunde<br />
scheide die Einbeziehung von WIE in den Hub FRA grundsätzlich aus, was zur Folge habe, daß die in WIE<br />
vorhandene Kapazität an Flugbewegungen gar nicht ausgeschöpft werden könne.<br />
Um dennoch eine Einbeziehung des Flughafens Wiesbaden-Erbenheim in den Hub Flughafen Frankfurt zu<br />
erreichen, ist also zwischen beiden Flughäfen ein bodengebundener Airport-Link notwendig, der für<br />
umsteigende Fluggäste incl. Fluggepäck ähnlich kurze Übergangszeiten schafft, wie sie bisher innerhalb des<br />
Flughafens Frankfurt erreicht werden. Heute beträgt die Minimum Connection Time beim Umsteigen in FRA 45<br />
min und darf beim Transfer von WIE nach FRA und umgekehrt keineswegs überschritten werden. Zugleich muß<br />
ein kostengünstiger und zuverlässiger Frachttransfer mit relativ kurzen Transportzeiten zwischen den beiden<br />
Flughafen-Teilen gewährleistet sein.<br />
Es ist somit zu untersuchen, ob bei einem Flughafen-Verbund von WIE und FRA mit Hilfe <strong>einer</strong><br />
<strong>bodengebundenen</strong> <strong>gesonderten</strong> Schnellverbindung die genannte Minimum Connection Time eingehalten werden<br />
kann. Nur wenn die Machbarkeit dieser relativ kurzen Transferzeit nachgewiesen werden kann, stellt die Startund<br />
Landebahn in Wiesbaden-Erbenheim einen echten Ersatz für einen weiteren Ausbau des Flughafens<br />
Frankfurt dar.<br />
2. Grundlagen, Aufgabenstellung und Methodik der Untersuchung<br />
Im folgenden werden die Grundlagen der Untersuchung incl. ihrer Prämissen dargestellt und die<br />
Aufgabenstellung wird präzisiert. Es werden die wichtigsten Inputdaten genannt, welche für die<br />
Dimensionierung der Abfertigungsanlagen in WIE, der Shuttle-Fahrzeuge und der Infrastruktur des Airport-<br />
Links notwendig sind. Außerdem wird ein Überblick über die Struktur der Untersuchung gegeben und es werden<br />
die verwendeten Methoden beschrieben.<br />
2.1 Aufgabenstellung der Studie<br />
Der Schwerpunkt der Untersuchung besteht darin, die Machbarkeit <strong>einer</strong> Minimum Connection Time (auch<br />
Transferzeit, Übergangszeit genannt) von maximal 45 min bezüglich Passagiere und Gepäck bei einem<br />
Flughafenverbund von Wiesbaden-Erbenheim und Frankfurt zu überprüfen. Hierbei werden "Worst-case"-<br />
Szenarien zugrunde gelegt. Das bedeutet: extrem periphere Vorfeld- bzw. Gebäude-Positionen des Zubringer-<br />
Flugzeugs wie auch des Anschlußflugzeuges, relativ große Flugzeuge mit hoher Zahl an umsteigenden<br />
Fluggästen und entsprechend großem Gepäckaufkommen, maximale Wartezeit bis zur Abfahrt des Shuttle-
Fahrzeugs von einem Flughafen-Teil zum anderen usw. Nur indem von solchen ungünstigen Bedingungen<br />
ausgegangen wird, kann gewährleistet werden, daß der zu untersuchende Airport-Link tatsächlich den<br />
Ansprüchen der Airlines genügt, die es aufgrund der heutigen Gegebenheiten in FRA gewohnt sind, daß die<br />
garantierte Transferzeit von Passagieren und Gepäck auch im ungünstigsten Fall keinesfalls länger als 45 min<br />
dauert. Andernfalls droht die Gefahr, daß sich bestimmte Airlines von diesem Flughafen-System zurückziehen<br />
und sich verstärkt Konkurrenz-Flughäfen zuwenden.<br />
Zusätzlich wird die erreichbare Connection Time (Transferzeit) für eher normale, durchschnittliche Fälle<br />
ermittelt: relativ zentrale Gebäude-Positionen des Zubringer-Flugzeugs wie auch des Anschlußflugzeuges,<br />
mittelgroße Flugzeuge mit <strong>einer</strong> mittleren Zahl von umsteigenden Fluggästen.<br />
Des weiteren werden für alle Lösungsmöglichkeiten des Flughafen-Verbundes von WIE und FRA die<br />
Investitions- und Betriebskosten überschlägig ermittelt.<br />
Ebenso wird der Frage nachgegangen, wie der Flughafen-Verbund WIE + FRA bezüglich der tatsächlich<br />
erzielbaren Übergangszeit im Vergleich mit den Ausbauvarianten des Standorts FRA inkl. 3. Terminal<br />
abschneidet. In diesem Zusammenhang ist es auch von Interesse, die Transferzeiten im heutigen Flughafen<br />
Frankfurt exemplarisch für einen worst case zu ermitteln. Anhand dieses Status quo lassen sich dann beide<br />
Lösungen eines Flughafen-Verbundes von WIE und FRA wie auch Ausbaulösungen des heutigen Flughafens<br />
Frankfurt bewerten.<br />
Schließlich gilt es, den Flughafen Wiesbaden-Erbenheim hinsichtlich der Rollzeiten mit dem Flughafen<br />
Frankfurt zu vergleichen, wobei in FRA die Rollzeiten sowohl von <strong>einer</strong> möglichen Nordbahn als auch von <strong>einer</strong><br />
möglichen Südbahn zum Terminal 1 und zu einem möglichen Terminal 3 auf dem Gelände der heutigen US-<br />
Airbase zu berücksichtigen sind. Diese Rollzeiten sind zwar Bestandteil der Flugzeit und nicht der<br />
Übergangszeit, aber falls sich in FRA durch den Bau <strong>einer</strong> neuen Nord- bzw. Südbahn die Rollzeiten verlängern<br />
sollten, ohne daß der Flugplan entsprechend verändert würde, nimmt die Verspätungsanfälligkeit der Flüge von<br />
und nach FRA zu.<br />
2.2 Zum Begriff "Minimum Connection Time"<br />
Die Minimum Connection Time (im folgenden abgekürzt: MCT) gibt die Zeitspanne an, die zwischen der<br />
Ankunft eines Flugzeuges und dem Abflug eines Anschluß-Flugzeuges vergeht, so daß ein Fluggast incl. seines<br />
Gepäcks diesen Anschluß-Flug gerade noch erreichen kann. Diese Zeitspanne liegt heute in FRA in der Regel<br />
bei 45 min und in einigen ausgewählten Transfer-Beziehungen sogar bei nur 35 min. Diese MCT wird von der<br />
Flughafen Frankfurt Main AG gegenüber den Airlines garantiert und ist in den Buchungs-Systemen der Airlines<br />
berücksichtigt. Diese Garantie gilt auch für Extremfälle, beispielsweise bei <strong>einer</strong> Umsteige-Beziehung von<br />
einem Flugzeug mit Vorfeldposition im äußersten Westen des Flughafens Frankfurt zu einem Flugzeug mit<br />
Vorfeldposition im äußeren Osten und auch bei großen Flugzeugen mit entsprechend hohem Passagier-und<br />
Gepäckaufkommen.<br />
Da die garantierte MCT von 45 min also auch einen "worst case" umfaßt, darf auch beim Airport-Link die<br />
gesamte Transferzeit von Passagieren und Gepäck selbst im ungünstigsten Fall nicht länger als 45 min dauern.<br />
Andernfalls gilt der Flughafen-Verbund von WIE und FRA als gescheitert.<br />
Die Minimum Connection Time schließt den Zeitbedarf für das Arretieren des gelandeten Flugzeugs mit Hilfe<br />
von Bremsklötzen (on-block) sowie das Entfernen dieser Bremsklötze vor dem Start des Flugzeugs (off-block)<br />
mit ein.<br />
Es gibt jedoch auch heute in FRA einzelne Umsteigeverbindungen, bei denen die genannte MCT von 45 min<br />
keinesfalls eingehalten werden kann. An erster Stelle zu nennen sind hierbei die Relationen, bei denen der<br />
Anschlußflug Israel zum Ziel hat und der Zubringerflug nach FRA nicht mit der Fluggesellschaft EL AL erfolgt.<br />
Wegen der extrem aufwendigen Grenz- und Sicherheitskontrollen ist in diesem Fall mit <strong>einer</strong> mehrstündigen<br />
Minimum Connection Time zu rechnen. Umgekehrt wird die MCT von 45 min weit überschritten, wenn das<br />
Zubringerflugzeug aus Staaten kommt, bei denen eine erhöhte Gefahr besteht, daß Terroristen, Kriminelle,<br />
Drogenkuriere oder Wirtschaftsflüchtlinge versuchen, nach Deutschland oder in andere Staaten einzureisen, die<br />
dem Schengener Abkommen angehören. In diesen Fällen werden sehr strenge und somit zeitintensive<br />
Grenzkontrollen durchgeführt und auch die Zollkontrollen, die sich sonst nur auf Stichproben beschränken, sind<br />
wesentlich aufwendiger [2].
2.3 Fluggast- und Fluggepäck-Relationen zwischen WIE und FRA und prinzipielle Möglichkeiten ihrer<br />
Bedienung<br />
Im Flughafen-Verbund "WIE + FRA" sind insgesamt 12 unterschiedliche Fluggast-bzw. Fluggepäck-<br />
Bewegungen möglich, die Abb. 1a dargestellt sind. Für die Fragestellung der <strong>Machbarkeitsuntersuchung</strong> sind<br />
jedoch nur zwei Relationen von Bedeutung:<br />
(A) Umsteiger mit Landung in WIE und Weiterflug ab FRA<br />
(B) Umsteiger mit Landung in FRA und Weiterflug ab WIE.<br />
Alle anderen Relationen sind für die Frage der Machbarkeit <strong>einer</strong> MCT von 45 min irrelevant, weil sie keine<br />
Umsteiger-Beziehungen betreffen, sondern die Wege von Originärpassagieren oder aber von Transfer-<br />
Fluggästen, die entweder innerhalb von WIE oder innerhalb von FRA umsteigen.<br />
Um die beiden relevanten Passagier- und Gepäck-Relationen zwischen WIE und FRA zu bedienen, bestehen drei<br />
prinzipielle Möglichkeiten (siehe Abb. 1b):<br />
(1) Jede Flugzeug-Position in WIE wird mit jeder Flugzeug-Position in FRA durch relativ kleine Fahrzeuge<br />
verbunden.<br />
(2) Das Terminal in WIE wird mit jeder Flugzeug-Position in FRA durch Fahrzeuge mittlerer Größe verbunden.<br />
Hierbei werden die in WIE gelandeten Passagiere im Terminal WIE gesammelt bzw. auf die hier startenden<br />
Flugzeuge verteilt.<br />
Prinzipiell wäre auch die umgekehrte Vorgehensweise denkbar: Sammeln bzw. Verteilen der Umsteiger in<br />
den Terminals in FRA und direkte Bedienung der einzelnen Flugzeug-Positionen in WIE. Doch wegen der<br />
langen Fußwege innerhalb der Frankfurter Terminals und der langen Fahrtstrecken auf dem Vorfeld würde bei<br />
diesem Verfahren vermutlich die geforderte MCT von 45 min weit überschritten.<br />
(3) Das Terminal WIE wird mit den Terminals in FRA durch relativ große Fahrzeuge verbunden. Die in WIE<br />
gelandeten Passagiere werden hierbei im Terminal WIE gesammelt, fahren gemeinsam nach FRA und werden in<br />
den Frankfurter Terminals auf die hier startenden Flugzeuge verteilt. In der Gegenrichtung findet das Sammeln<br />
in FRA und das Verteilen in WIE statt.<br />
Die Möglichkeit (1) bedeutet, daß eine sehr große Anzahl an kleinen Shuttle-Fahrzeugen eingesetzt werden muß,<br />
bei denen es sich in der Regel um PKWs und allenfalls um Kleinbusse handelt. Dies führt dazu, daß das<br />
Flughafen-Vorfeld in FRA, das ohnedies unter <strong>einer</strong> hohen Verkehrsdichte an Bodenbewegungen leidet,<br />
vermutlich einen limitierenden Engpaß darstellt und daß die große Fahrzeug-Flotte hohe Betriebskosten<br />
verursacht. Aus diesem Grunde scheidet diese Variante zumindest für den Regelbetrieb bei der weiteren<br />
Betrachtung aus. Dagegen kommen die Optionen (2) und (3) für den Airport-Link in Betracht, und das heißt:<br />
Bus- bzw. Zug-Lösung.<br />
2.4 Wahl des <strong>bodengebundenen</strong> Verkehrsmittels<br />
Prinzipiell sind für die bodengebundene Verbindung der beiden Flughäfen zum Transfer von Passagieren und<br />
Fluggepäck folgende Verkehrssysteme denkbar:<br />
(1) straßengebundene Fahrzeuge wie Busse oder Mobile Lounges, die auf das Vorfeld zu den Feeder- und<br />
Anschluß-Flugzeugen, zu Vorfeld-Gebäuden oder zu den Terminals fahren und entweder über das bestehende<br />
Autobahnnetz oder über eine neu zu bauende Straße die Verbindung zwischen WIE und FRA herstellen<br />
(2) Hochgeschwindigkeits-Züge in der klassischen Rad-Schiene-Technik<br />
(3) unkonventionelle spurgebundene Verkehrsmittel wie z.B. die heutige Sky Line, die innerhalb des Flughafens<br />
Frankfurt verkehrt, aber mit höherer Geschwindigkeit<br />
(4) Magnetschwebebahnen wie z.B. der Transrapid für sehr hohe Geschwindigkeiten<br />
(5) spurgebundene Verkehrsmittel, die auch das Vorfeld befahren können (straßenbahnartige Fahrzeuge, bimodale<br />
Fahrzeuge für Straße und Schiene, Spurbusse).
Zwei Lösungen erscheinen besonders naheliegend und sind Gegenstand der vorliegenden Untersuchung:<br />
þ das System Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn, denn mit der im Bau befindlichen ICE-Strecke Köln -<br />
Rhein/Main und deren beiden Äste nach Wiesbaden und Flughafen Frankfurt kann möglicherweise auf eine<br />
schon vorhandene Infrastruktur zurückgegriffen werden (siehe Abb. 5)<br />
þ der Einsatz von vorfeld-gängigen Bussen, die die Fluggäste aus WIE direkt an die Flugzeug-Positionen in<br />
FRA bringen bzw. von dort nach WIE befördern.<br />
Inwieweit die genannten sonstigen Verkehrsmittel für die vorliegende Aufgabenstellung geeignet sind, müßte in<br />
weiteren Stufen der Untersuchung geklärt werden.<br />
2.5 Prämissen<br />
Das Konzept <strong>einer</strong> <strong>bodengebundenen</strong> Schnellverbindung zwischen WIE und FRA in Form eines Zug- und eines<br />
Bus-Systems baut auf mehreren Prämissen auf:<br />
þ Beim Zugsystem ist für alle Flugzeuge, die in WIE landen, eine Vorsortierung des Umsteigergepäcks für<br />
Anschlußflüge ab FRA erforderlich.<br />
þ Umgekehrt muß beim Bus-System als Airport-Link zwischen WIE und FRA in allen Flugzeugen, die in FRA<br />
landen, das Umsteigergepäck für Anschlußflüge ab WIE vorsortiert sein.<br />
þ Die Einbindung der für das Zugsystem neu zu schaffenden Infrastruktur in den Terminalbereich des<br />
Flughafens Frankfurt ist bautechnisch möglich.<br />
þ Die Kapazität des Vorfeldes im Flughafen Frankfurt reicht aus, um die zu erwartende große Zahl von<br />
Shuttlebussen bei der Variante Bus-System aufzunehmen.<br />
þ Soweit erforderlich, werden beim Zugsystem die Grenz- und Zollkontrollen während der Fahrt im Zug von<br />
WIE nach FRA und umgekehrt durchgeführt.<br />
þ Beim Bus-System finden die Grenz- und Zollkontrollen, soweit erforderlich, stationär in WIE statt.<br />
Diese Prämissen werden im folgenden erläutert.<br />
2.5.1 Gepäck-Vorsortierung im Flugzeug, das in WIE landet<br />
Das Fluggepäck ist in einem Flugzeug üblicherweise nach Umsteigern und Aussteigern vorsortiert. Für die<br />
Flugzeuge, die WIE direkt anfliegen, ist es anstelle dieser Vorsortierung erforderlich, daß das Fluggepäck nach<br />
den beiden Kategorien vorsortiert wird:<br />
(1) Fluggepäck mit dem Zielflughafen WIE plus Fluggepäck, das innerhalb von WIE in ein Anschlußflugzeug<br />
umgeladen wird<br />
(2) Fluggepäck, das nach der Landung in WIE nach FRA befördert und dort in ein Anschlußflugzeug umgeladen<br />
wird.<br />
Bei größeren Flugzeugen bzw. bei entsprechender Kooperation der Airlines wäre es auch denkbar, das<br />
Fluggepäck nach drei Gruppen aufgeteilt, im Flugzeug nach WIE zu verstauen, nämlich<br />
(1) Fluggepäck mit dem Zielflughafen WIE<br />
(2) Fluggepäck mit Anschlußflug ab WIE<br />
(3) Fluggepäck mit Anschlußflug ab FRA.
Unabhängig davon, welche der beiden genannten Lösungen gewählt wird, muß bei der Beschriftung der Gepäck-<br />
Banderolen bei Flügen nach WIE danach unterschieden werden, ob der Anschlußflug in WIE oder in FRA<br />
startet. Dazu wird - abweichend von der sonst üblichen Praxis - bei Umsteigergepäck nicht der Flughafen<br />
aufgedruckt, in dem das Flugzeug zunächst landet, sondern immer der Flughafen, in welchem der Anschlußflug<br />
beginnt.<br />
Dies bedeutet beispielsweise für Fluggepäck von Edinburgh nach Augsburg mit Landung des von Edinburgh<br />
kommenden Flugzeugs in Wiesbaden-Erbenheim und Start des Anschlußflugzeugs in Frankfurt, daß die Gepäck-<br />
Banderole die Beschriftung "FRA-AGB" erhält und nicht "WIE-AGB", wie dies nach der bisherigen Praxis zu<br />
erwarten wäre.<br />
Beim Gepäcktransport in der Gegenrichtung, also Landung des Zubringerflugzeugs in Frankfurt und Start des<br />
Anschlußflugzeugs in Wiesbaden-Erbenheim, wird das übliche Verfahren der Gepäck-Vorsortierung und der<br />
Beschriftung der Gepäck-Banderolen beibehalten. Denn in diesem Fall nimmt die Gepäckförderanlage (GFA) in<br />
FRA erst die Trennung zwischen in FRA verbleibendem und nach WIE zu transportierendem Gepäck vor.<br />
Die Möglichkeit zum Check-Out in FRA nach der Landung in WIE wird nicht angeboten.<br />
In einem Arbeitsgespräch am 20.10.1999 in Frankfurt wurde von seiten der FAG die genannte Gepäck-<br />
Vorsortierung in allen Flugzeugen, die in WIE landen, als machbar bezeichnet. Die FAG-Vertreter machten<br />
hierbei sogar die Aussage, bei Flugzeugen, die in FRA landen, würde heute schon teilweise bis zu 18 (!)<br />
verschiedene Kriterien bei der Gepäck-Vorsortierung berücksichtigt.<br />
2.5.2 Gepäck-Vorsortierung im Flugzeug, das in FRA landet<br />
Im Gegensatz zur Zug-Lösung, bei der eine Vorsortierung des Gepäcks bei allen Flugzeugen, die in WIE landen,<br />
erforderlich ist, erfordert das Bus-System eine entsprechende Gepäck-Vorsortierung in FRA und dafür nicht in<br />
WIE. Dies betrifft somit bei der Bus-Lösung eine größere Anzahl von Flugzeugen als bei der Zug-Lösung.<br />
Aufgrund der oben erwähnten Aussage der FAG ist davon auszugehen, daß es möglich ist, Fluggepäck für<br />
Anschlußflüge ab WIE in den in FRA landenden Flugzeugen separat zu verstauen.<br />
2.5.3 Machbarkeit der Einbindung der zusätzlichen Eisenbahn-Infrastruktur in den Terminalbereich FRA<br />
Um Fußwege für umsteigende Passagiere, die in den Shuttle-Bahnhöfen in FRA ein- oder aussteigen, innerhalb<br />
der Terminals 1 und 2 in FRA zu minimieren, ist es erforderlich, daß die neu zu schaffenden Bahnhofsanlagen in<br />
das Terminal 1 integriert und in enger Parallellage zum Terminal 2 gebaut werden. Da eine spezielle<br />
Untersuchung der bautechnischen Machbarkeit <strong>einer</strong> solchen Lösung aus Zeit- und Kostengründen im Rahmen<br />
der vorliegenden Studie ausschied, wurde im bereits erwähnten Arbeitsgespräch am 20.10.1999 in Frankfurt<br />
diese Frage mit der FAG besprochen. Die Vertreter der FAG erklärten hierzu, daß keine prinzipiellen Probleme<br />
bei der Einbindung der neu zu schaffenden Bahn- und Bahnhofsanlagen in die Gebäudekomplexe der Terminals<br />
1 und 2 und ihres Umfeldes zu erwarten seien. Eine bautechnische Lösung dieses Problems sei immer machbar.<br />
Deshalb sei es nicht notwendig, die neue Eisenbahn-Infrastruktur beispielsweise aufgeständert über der Straße<br />
Abflugring bzw. über dem Regionalbahnhof zu konzipieren.<br />
2.5.4 Belastbarkeit des Vorfeldes in FRA durch Shuttlebusse beim Bus-System<br />
Im Rahmen der vorliegenden Studie war es wiederum wegen des zu knappen Zeit-und Kostenbudgets nicht<br />
möglich, die Machbarkeit des Bus-Systems hinsichtlich der Belastung des Vorfeldes in FRA durch eine große<br />
Anzahl zusätzlicher Shuttlebusse zu überprüfen. Diese Frage kann nur durch aufwendige Simulationen des<br />
gesamten Vorfeldverkehrs geklärt werden.<br />
2.5.5 Grenz- und Zollkontrollen während der Fahrt im Zug<br />
Beim Airport-Link per Zug werden Grenz- und Zollkontrollen während der Fahrt im Zug. In einem mehrstufigen<br />
Abstimmungsprozeß mit dem Bundesgrenzschutzamt Flughafen Frankfurt (Main) und dem Hauptzollamt<br />
Frankfurt am Main-Flughafen wurde ein im Prinzip machbares Konzept für die Grenz- und Zollabfertigung im<br />
fahrenden Shuttlezug entwickelt, das gegenüber dem im sonstigen Eisenbahnverkehr üblichen Verfahren (BGS-
Beamte gehen durch den Zug) dahingehend modifiziert ist, daß die Fluggäste Abfertigungsschalter passieren, die<br />
in einem der Waggons fest installiert sind (siehe Kapitel 6.3.4).<br />
2.5.6 Stationäre Grenz- und Zollkontrollen in WIE beim Bus-System<br />
Für die stationäre Grenz- und Zollkontrollen beim Bus-System muß in WIE eine ausreichend große Zahl von<br />
besetzten Abfertigungsschaltern vorhanden sein, um auch Spitzenbelastungen abfangen zu können. Die<br />
angesetzten Zeiten für die stationäre Paßkontrolle beim Bus-System sind auf der Grundlage <strong>einer</strong> vollständigen<br />
Besetzung der geplanten Kontrollstellen während der Spitzenzeiten bemessen. Bautechnisch ist es<br />
unproblematisch, in den neu zu erstellenden Bus-Terminals in WIE die entsprechende Anzahl von<br />
Kontrollstellen zu installieren. Wie hoch die daraus resultierenden Personalkosten sind, wenn zu Spitzenzeiten<br />
alle Kontrollschalter mit Beamten des Bundesgrenzschutzes bzw. mit Zollbeamten besitzt sind, kann allerdings<br />
in der vorliegende Studie noch nicht geklärt werden, weil hier mit ungünstigen Einzelereignissen gerechnet wird,<br />
während exakte Angaben nur anhand von Betriebssimulationen eines vollständigen Flugplantages mit den stark<br />
schwankenden Belastungen gemacht werden sollten.<br />
2.6 Zur Struktur der gesamten Studie<br />
Die umfassende Untersuchung <strong>einer</strong> <strong>bodengebundenen</strong> <strong>gesonderten</strong> Schnellverbindung zwischen WIE und FRA<br />
wurde in zwei Stufen durchgeführt, wobei der vorliegende Bericht die Ergebnisse beider Stufen umfaßt.<br />
Stufe 1: Grundlegende Klärung der Frage, ob eine Minimum Connection Time von 45 min bei einem Flughafen-<br />
Verbund WIE + FRA überhaupt machbar ist; diese <strong>Machbarkeitsuntersuchung</strong> erfolgt anhand des Rad-Schiene-<br />
Systems als bodengebundenes Schnellverkehrssystem, wobei eine Mitnutzung der im Bau befindlichen ICE-<br />
Strecke Köln - Rhein/Main im Abschnitt vom Wiesbadener Kreuz bis Frankfurt Flughafen ("Frankfurter Ast"<br />
der ICE-Strecke) unterstellt wird.<br />
Stufe 2: Überprüfung der Machbarkeit <strong>einer</strong> Minimum Connection Time von 45 min alternativ anhand von<br />
vorfeldgängigen Bussen; hierbei wird zusätzlich zur Mitnutzung der im Bau befindlichen bzw. Schienen- und<br />
Straßeninfrastruktur auch der Bau separater Gleise und separater Bus-Fahrspuren zugrunde gelegt. Außerdem<br />
werden weitere Fragestellungen bearbeitet, wobei insbesondere eine erste Abschätzung der Investitionskosten<br />
für die einzelnen Lösungen und die Ermittlung von Transfer-Zeiten in durchschnittlichen Fällen zusätzlich zu<br />
Worst-case-Szenarien sowie ein Vergleich der tatsächlich erreichbaren Übergangszeit (Connection Time) beim<br />
Flughafen-Verbund WIE + FRA (Zug- und Bus-System) und beim Ausbau allein von FRA inkl. 3. Terminal<br />
vorgenommen wird. Des weiteren sind Rollzeiten in WIE und in FRA zu ermitteln.<br />
Die gesamte Untersuchung findet in enger Kooperation der VIEREGG-RÖSSLER GmbH (VR) mit der Airport<br />
Research Center GmbH (ARC) statt. Hierbei ist VR in inhaltlicher Hinsicht zuständig für alle Fragen<br />
hinsichtlich Eisenbahn- bzw. Bus-Infrastruktur, -Fahrzeuge, -Betrieb, -Fahrzeiten und -Kosten. ARC behandelt<br />
alle flughafen-spezifischen Fragen wie z.B. Konfiguration des Terminals in Wiesbaden-Erbenheim und<br />
flughafen-interne Wege von Gepäck in WIE und FRA sowie Rollzeiten. Darüber hinaus ist VR für die<br />
Koordination der Arbeiten sowie die Schlußredaktion des Abschlußberichts verantwortlich.<br />
2.7 Analyse Szenarioflugpläne<br />
2.7.1 Szenarioflugplan Wiesbaden-Erbenheim<br />
Die Analyse des Szenarioflugplans für Wiesbaden-Erbenheim mit der Bezeichnung "Szenario A, Variante 11a<br />
der Mediation" dient folgenden Zwecken:<br />
þ Abschätzung der Anzahl der notwendigen Abfertigungspositionen auf dem Vorfeld<br />
þ Dimensionierung der Positionen für verschiedene Flugzeugklassen<br />
þ Dimensionierung der Abfertigungseinrichtungen im Flughafenterminal<br />
þ Abschätzung der Passagier- und Gepäckvolumina, welche zwischen den Flughäfen transportiert werden<br />
müssen.<br />
Der von der FAG gelieferte Flugplan enthält folgende Informationen:
þ Flugzeugtyp,<br />
þ Geplante Abflug- / Ankunftszeit,<br />
þ Ziel- / Herkunftsregion des Fluges.<br />
Nicht enthalten sind Informationen über die betreffenden Airlines bzw. über die Art des Fluges (Charter / Linie).<br />
Dadurch können nur Annahmen über die durchschnittlichen Umsteigerraten gemacht werden, die dann für alle<br />
Flüge in WIE gelten.<br />
Die Abb. 2 zeigt die Bewegungen am Tag, getrennt nach Starts und Landungen. In der absoluten Spitzenstunde<br />
(14:20 - 15:15 Uhr) würden demnach 43 Starts und Landungen durchgeführt.<br />
Aus diesen Angaben wird zunächst die notwendige Anzahl der Abstellpositionen abgeleitet. Als weitere<br />
Annahme wird davon ausgegangen, daß die Flugzeuge, die in Erbenheim landen, durchschnittlich 45 min am<br />
Flughafen verbleiben und anschließend wieder starten. Diese Annahme erscheint realistisch, da der größte Teil<br />
des Verkehrs mit kl<strong>einer</strong>em Fluggerät abgewickelt wird und die bedienten Destinationen im europäischen Raum<br />
liegen, wodurch der Aufwand für die Abfertigung vergleichsweise kurz ist. Hieraus ergeben sich maximal 20<br />
notwendige Positionen. In dieser Zahl sind jedoch noch keine Sicherheitsreserven (z.B. für längere<br />
Umkehrzeiten) berücksichtigt.<br />
Für die Anordnung der Positionen ist weiterhin die zu erwartende Größe der Flugzeuge von Bedeutung. In Abb.<br />
3 sind die ankommenden Flüge pro Stunde nach Flugzeugkategorien aufgeteilt, die dem ICAO Aerodrome<br />
Reference Code entsprechen, wobei die Einteilung nur nach den Spannweiten und nicht nach der<br />
Fahrwerksbreite vorgenommen wurde.<br />
Nach dem vorliegenden Szenarioflugplan machen Flugzeuge der Kategorie C (Spannweite 24 m bis 36 m) 81%<br />
der Bewegungen aus. Auf Flugzeuge der Kategorie D (Spannweite 36 m bis 52 m) entfallen 15% der<br />
Bewegungen. Die restlichen 4% der Bewegungen werden durch Flugzeuge der Kategorie B (Spannweite 15 m<br />
bis 24 m) verursacht.<br />
Weiterhin wurde bei der Auslegung des Terminals berücksichtigt, daß einige Flugzeugtypen nicht an "Standard"-<br />
Flugzeugbrücken abgefertigt werden können. Hierzu zählen Turboprop-Flugzeuge und einige kl<strong>einer</strong>e Jet-<br />
Flugzeuge (z.B. Canadair Regional Jet). Für Flugzeugtypen, die heute noch nicht in Betrieb sind, aber bei der<br />
Erstellung des Flugplan berücksichtigt wurden, mußten Annahmen getroffen werden. Zu diesen Flugzeugtypen<br />
zählt zum Beispiel die neue Fairchild Dornier Jet-Flugzeuggeneration.<br />
Anzahl der Passagiere<br />
Im genannten Flugplan ist nicht die Anzahl der Passagiere je Flug enthalten. Um diese Zahl zu ermitteln, wurde<br />
folgende Vorgehensweise gewählt: Zunächst wird für die angegebenen Flugzeugtypen eine typische<br />
Sitzplatzanzahl angenommen. Hierbei können die größeren Unterschiede, die sich für die einzelnen Airlines<br />
ergeben, nicht berücksichtigt werden, da bezüglich der Airlines keine Informationen im Flugplan enthalten sind.<br />
Hier sind als Beispiel die sehr dichten Bestuhlungen der Touristik-Airlines im Vergleich zu den übrigen Carriern<br />
zu nennen.<br />
Zur Berechnung der tatsächlichen Passagierzahl muß zusätzlich ein durchschnittlicher Auslastungsfaktor<br />
angenommen werden. Um möglichst einen "worst case" zu erzeugen, wird in den folgenden Berechnungen ein<br />
Auslastungsgrad der Flugzeuge von durchschnittlich 80% angesetzt.<br />
Für die Dimensionierung der Passagierströme muß weiterhin bekannt sein, wie hoch der Anteil der Fluggäste<br />
von und nach "Schengen-Staaten" (S) versus "Non-Schengen-Staaten" (NS) ist, da das Transportsystem für diese<br />
unterschiedlichen Passagiergruppen ausgelegt werden muß. Ebenso müssen die Geh- und Wartebereiche der<br />
"Schengen-Passagiere" von den Bereichen der "Non-Schengen-Passagiere" völlig abgetrennt sein.<br />
Der Flugplan gibt jedoch nur Regionen wieder und nicht einzelne Länder, so daß diesen Regionen Länder<br />
zugeordnet werden müssen. Da hier ein Prognosefall untersucht wird, werden auch heutige Non-Schengen-<br />
Länder bzw. -Regionen als zukünftig zum Schengen-Bereich gehörig angenommen (z.B. Großbritannien,<br />
Schweiz). Folgende Regionen bzw. Länder werden somit dem Schengen-Bereich zugeordnet<br />
AEU: Alpenländer<br />
EEU: Großbritannien, Irland<br />
GDE: Deutschland
IEU: Iberio Europa<br />
MEU: Mediterranes Europa<br />
NEU: Nordeuropa<br />
Die Abb. 4 zeigt die Verteilung der ankommenden "Sitze" nach Schengen- / Non-Schengen-Staaten und Inland.<br />
Ein durchschnittlicher Auslastungsgrad ist in diesem Diagramm noch nicht berücksichtigt. Es wird deutlich, daß<br />
der Anteil des Schengen-Verkehrs dominierend ist (68% des Gesamtaufkommens incl. Inlandsverkehr).<br />
Für die Bemessung der Kapazität des Transfersystems zwischen den beiden Flughäfen sind jedoch nicht die<br />
"Stundenlasten" von Interesse, sondern die kurzfristigen Spitzen, die sich durch Einzelereignisse ergeben. Diese<br />
Einzelereignisse sind "gehäufte" Ankünfte von Flügen in Erbenheim in kurzen Abständen. Da die Personen nicht<br />
alle gleichzeitig in das Terminal gelangen können, werden hier die im Flugplan ausgewiesenen Ankunftszeiten<br />
jeweils über einen Zeitraum von 10 min geglättet. Dies ergibt für den Schengen- bzw. Non-Schengen Bereich<br />
maximale Werte von 660 Passagieren innerhalb eines Zeitraums von 10 min bzw. 330 Passagiere bezogen auf 5<br />
min.<br />
Diese Daten umfassen den gesamten ankommenden Verkehr in Erbenheim. Für die Verbindung zu den<br />
Terminals in Frankfurt sind jedoch nur die dorthin umsteigenden Passagiere von Interesse. Doch für die<br />
Umsteigeranteile in Erbenheim liegen keine Informationen vor. Auch können keine airlineabhängige Annahmen<br />
getroffen werden, da die Airline-Informationen, wie bereits genannt, im Flugplan nicht vorliegen. Um für die<br />
Bemessung des Systems auch bezüglich der Belastung mit Fahrgästen und Gepäck einen "worst case" zu<br />
erzeugen, werden folgende Annahmen getroffen:<br />
þ Umsteigeranteil in WIE insgesamt 60%,<br />
þ davon Anteil der nach FRA umsteigenden Passagiere 75%.<br />
Der Anteil von 60% in WIE leitet sich aus dem derzeitigen Umsteigeranteil in FRA ab, der hier insgesamt knapp<br />
50% beträgt, wobei der Umsteigeranteil der Star Alliance Airlines bis zu 70% erreicht.<br />
Von den oben genannten 60% WIE-Umsteiger bleiben 25% in WIE und 75% benutzen den Airport-Link nach<br />
FRA, um dort einen Anschlußflug zu erreichen. Mit dieser Annahme wird der "worst case" weiter verschärft.<br />
Aus den genannten Inputdaten und Annahmen ergibt sich eine maximales Aufkommen von 150 Passagieren pro<br />
5-Minuten-Intervall für den Airport-Link. Diese Spitzen können sowohl bei den Schengen- als auch bei den<br />
Non-Schengen-Reisenden auftreten, aber nicht gleichzeitig bei beiden Gruppen. Deshalb wird die Gesamtzahl an<br />
Schengen-Passagieren + Non-Schengen-Passagieren im 5-Minuten-Intervall nicht größer als 170 sein. Der<br />
Durchschnittswert über den gesamten Tag beträgt bei der Gruppe Schengen 44 und bei der Gruppe Non-<br />
Schengen 35 Passagiere pro 5-Minuten-Intervall. Für den Airport-Link liegt das gesamte Aufkommen im<br />
Tagesdurchschnitt pro 5-Minuten-Intervall bei 58 Passagieren und nicht bei 79, da die Spitzen dieser beiden<br />
Verkehrssegmente zu unterschiedlichen Zeiten liegen.<br />
Gepäckaufkommen<br />
Die Anzahl der Gepäckstücke leitet sich direkt aus dem Passagieraufkommen ab. Da auch hier keine detaillierten<br />
Informationen über die Flugart vorliegen, aus denen sich dann differenziertere Gepäckquoten ableiten ließen,<br />
wird vereinfacht mit <strong>einer</strong> durchschnittlichen Anzahl von 1,5 Gepäckstücken je Passagier ausgegangen. Dieser<br />
Wert ist wiederum als hoch anzusehen und gilt im allgemeinen nur im Touristik- und Langstreckenverkehr.<br />
Daraus ergibt sich eine Spitzenlast von 255 Gepäckstücken im 5-Minuten-Intervall.<br />
2.7.2 Szenarioflugplan Frankfurt<br />
Zur Berechnung der für die Bus-Lösung relevanten Mengen im Gepäck- und Passagier-Transfer wird zusätzlich<br />
der Szenarioflugplan für den Flughafen Frankfurt analysiert.<br />
Dieser Flugplan hat die selbe Struktur wie der des Flughafens Wiesbaden-Erbenheim und gibt die in Frankfurt<br />
abzuwickelnden Flugbewegungen wieder. Die Aufteilung der Verkehre zwischen Frankfurt und Erbenheim<br />
wurde von der FAG vorgenommen und wird im weiteren Verlauf dieser Studie als fix betrachtet.
Durch die Analyse des Flugplans können die Lasten für das Bus-System abgeschätzt werden. Die<br />
Passagierströme werden wieder aus dem WIE-Flugplan entnommen, da hierdurch das Aufkommen in WIE<br />
bestimmt wird. Da jedoch bei der Bus-Lösung die Flugzeuge in FRA zum Teil einzeln "angefahren" werden ist,<br />
muß die Anzahl der notwendigen Busse ermittelt werden, was sich aus dem Flugplan von FRA ergibt.<br />
Bewegungen in FRA<br />
Die Abbildung 2 zeigt das Profil der Starts und Landungen an dem Szenario-Flugplantag in Frankfurt. In der<br />
absoluten Spitzenstunde werden demnach 100 Starts und Landungen durchgeführt. Die Spitzen für die einzelnen<br />
Richtungen betragen 59 Starts und 57 Landungen in der Stunde. Das Profil der Bewegungen zeigt auch deutlich<br />
die vier Ankunfts- und Abflugwellen, die das Hubsystem am Flughafen verdeutlichen.<br />
Für die Bemessung des Bus-Systems bedeutet dies, daß in den Spitzenzeiten fast alle 60 sec ein Flugzeug am<br />
Flughafen FRA ankommt bzw. den Flughafen verläßt.<br />
An welchen Positionen die Flugzeuge abgefertigt werden, kann hier nicht festgestellt werden, da kein verketteter<br />
Flugplan vorliegt und auch keine Angaben über die Airlines bekannt sind. Daher muß im folgenden von <strong>einer</strong><br />
rein zufälligen Verteilung der Positionen ausgegangen werden. Durch die Analyse des Flugplanes des typischen<br />
Tages 1998 werden jedoch die Bereiche identifiziert an denen es zur Flugzeugabfertigung kommt.<br />
Analyse Flugplan typischer Tag 1998<br />
Die Analyse des typischen Spitzentages im Jahr 1998 dient dazu, die Verteilung der Positionsnutzung auf dem<br />
Vorfeld des Flughafens Frankfurt zu ermitteln. Daraus werden anschließend die für den Airport-Link relevanten<br />
Positionen abgeleitet und es wird eine "Durchschnittsposition" bestimmt.<br />
An dem zugrunde gelegten Flugplantag (30.7.1998) waren in FRA 1.126 Bewegungen für den Passagierverkehr<br />
zu verzeichnen. Dabei wurden 110 verschiedene Positionen zur Flugzeugabfertigung genutzt. Im Durchschnitt<br />
fanden pro Position 10,2 Bewegungen statt, d.h. daß eine Position am Tag durchschnittlich von 5 Flugzeugen<br />
genutzt wurde.<br />
Unterscheidet man zwischen Gebäude- und Vorfeld-Positionen, so wird deutlich, daß die Belegung der<br />
Gebäude-Positionen höher ist. An den 50 Gebäude-Positionen werden durchschnittlich 12,6 Bewegungen am<br />
Tag abgefertigt und auf den genutzten Vorfeldpositionen nur 8,3 Bewegungen (siehe auch Abb. 4a und 4b). Bei<br />
den Vorfeldpositionen muß zusätzlich beachtet werden, daß alleine 7 Positionen nur für eine Bewegung am Tag<br />
genutzt werden. Dies sind die Positionen V252 und F239 am westlichsten Ende des Vorfeldes und<br />
Frachtpositionen südlich des LCC.<br />
Für das zukünftige Flugplanszenario mit 1.400 Bewegungen am Tag in FRA muß der Positionsbedarf bekannt<br />
sein. Da der Flugplan nicht verkettet ist und auch keine Airline-Bezeichnungen für die Flüge vorliegen, kann<br />
keine Positionierung vorgenommen werden. Hier wird daher der zukünftige Bedarf auf der Basis 1998<br />
abgeschätzt.<br />
Zukünftig würden am typischen Spitzentag ca. 275 zusätzliche Bewegungen gegenüber 1998 stattfinden. In den<br />
Spitzenzeiten würde sich die Anzahl der Ankünfte bzw. Abflüge von 50 auf ca. 60 erhöhen.<br />
Wird für die Gebäude-Positionen unterstellt, daß die Kapazität heute schon erschöpft ist, dann könnten hier keine<br />
zusätzlichen Flugzeuge abgestellt werden. Die Nutzung der Vorfeldpositionen kann jedoch verdichtet werden.<br />
Aus der Annahme, daß die Kapazität der Gebäude-Positionen schon heute erschöpft ist läßt sich ableiten, daß die<br />
maximale durchschnittliche Auslastung der Positionen 12,5 Bewegungen am Tag beträgt. Wird von heute 55<br />
genutzten Vorfeldpositionen ausgegangen (Positionen mit heute weniger als 2 Bewegungen werden hierbei nicht<br />
berücksichtigt), dann besteht eine Reserve von mindestens 170 Bewegungen am Tag. Durch die höhere<br />
Bewegungen zu den Spitzenzeiten müssen zusätzliche Positionen bereitgestellt werden. 1998 waren noch nicht<br />
die Positionen an dem verlängerten Finger A fertiggestellt, hier werden bis zu 10 neue Gebäude-Positionen<br />
geschaffen, die den zusätzlichen Verkehr in den Spitzenzeiten aufnehmen können. Wird für diese Positionen<br />
wieder eine tägliche Kapazität von 12,5 Bewegungen unterstellt, so sind dies weitere 125 Bewegungen am Tag.<br />
In der Summe wären demnach 295 zusätzliche Bewegungen zu bewältigen.<br />
Diese Berechnung kann nur als Abschätzung angesehen werde, jedoch zeigt sich hierdurch, das die am typischen<br />
Tag 1998 genutzten und am Terminal A geplanten Positionen ausreichen können den zukünftigen Verkehr<br />
abzuwickeln. In Spitzenzeiten kann jedoch die Nutzung einzelner zusätzlicher Positionen erforderlich sein.
Für den Airport Link ist jedoch festzustellen, daß die Nutzung der Positionen im äußersten Westen (V251 -<br />
V270, F236 - F240) unwahrscheinlich ist. Diese wird daher in den weiteren Planungen nicht mehr<br />
berücksichtigt.<br />
Weiterhin sind für die folgenden Wegeketten die "durchschnittlichen" Positionen von Interesse. Hier wird nach<br />
Gebäude- und Vorfeldpositionen unterschieden.<br />
Die Berechnung erfolgt nach dem gewichteten Mittel der Position. In die Berechnung geht die Entfernung von<br />
einem Referenzpunkt und die Häufigkeit der Nutzung an dem typischen Flugplantag 1998 ein. Als<br />
Referenzpunkt für die Positionen am Terminal 1 und die Vorfeldpositionen dient ein Punkt im Bereich B (ca.<br />
Ausgang People Mover) und im Terminal 2 der Zentrale Punkt zwischen den Bereichen D und E in der Check-In<br />
Halle.<br />
Für die untersuchten Bereiche ergeben sich somit als typische Positionen folgende Ergebnisse:<br />
Terminal 1: Position B42<br />
Terminal 2: Position D8<br />
Vorfeld: Position V154.<br />
Für die Positionen am Terminal 1 wird sich in Zukunft keine Veränderungen ergeben, da hier davon<br />
ausgegangen wird, daß keine zusätzlichen Abfertigungen möglich sind. In den Terminal 1 wird sich die<br />
Wegelänge wahrscheinlich nur unwesentlich verändern, da im Zuge der Verlängerung des Flugsteiges A auch<br />
eine zusätzliche People Mover Station hier gebaut wird und somit die Flußwege in diesem Pier verkürzt werden.<br />
Auf dem Vorfeld müssen in Zukunft auch weiter entfernt liegende Positionen stärker genutzt werden. Hier sind<br />
insbesondere die Positionen V171 - V178 zu nennen.<br />
Bei der angesetzten durchschnittlichen Nutzung von 12,5 Bewegungen am Tag ergibt sich dann die<br />
durchschnittliche Position auf dem Vorfeld zur Position V163.<br />
2.8 Methodik der <strong>Machbarkeitsuntersuchung</strong><br />
Bei der Untersuchung der Machbarkeit <strong>einer</strong> MCT von maximal 45 min wurde ein mehrstufiges iteratives<br />
Verfahren verwendet. Hierbei wurde in einem ersten Schritt ein Logistik-Grobkonzept für den Passagier- und<br />
Gepäcktransfer entwickelt. In einem zweiten Schritt wurde, orientiert an diesem Logistik-Konzept, je eine<br />
Wegekette für Passagier- und Gepäck-Bewegungen für die Richtung von WIE nach FRA und auch für die<br />
Gegenrichtung modelliert. Diese Wegekette umfaßt eine Vielzahl von Infrastruktur- und fahrzeug-seitigen<br />
Elementen, beispielsweise den Weg vom gelandeten Flugzeug über eine Fluggastbrücke in das Terminal. Zum<br />
Teil mußten die erforderlichen Infrastruktur-Komponenten völlig neu entworfen werden, weil sie noch gar nicht<br />
existieren, was insbesondere für das Terminal in WIE gilt. Für jedes einzelne Glied dieser Wegekette wurde der<br />
benötigte Zeitaufwand bestimmt und bei neuartigen Komponenten wurde auch die technische Machbarkeit<br />
überprüft. Hierbei waren auch Fragen zur Kapazitätsauslegung zu berücksichtigen, denn beispielsweise führt ein<br />
Terminal in WIE, das aufgrund großer Fluggastströme auch selbst groß sein muß, zu langen Fußwegen und<br />
somit zu langen Transferzeiten. Sodann wurde der gesamte Zeitaufwand des Transfer-Vorganges ermittelt. In<br />
einem zweiten Durchgang und ggfs. weiteren Schritten wurden einzelne Elemente bzw. Phasen der Wegekette<br />
modifiziert bzw. durch Alternativen ersetzt, sobald sich die betreffenden Elemente durch zu großen Zeitbedarf<br />
auszeichneten oder eine mangelnde technische Machbarkeit zu erwarten war. Im Extremfall mußten ganze<br />
Abschnitte der konzipierten Wegekette verworfen und durch geeignetere ersetzt werden. Zum Schluß bildete<br />
sich sowohl für den Passagier- als auch Gepäck-Transfer eine technisch realisierbare, minimale Zeit-Wege-Kette<br />
heraus, welche das Kriterium der MCT von 45 min erfüllte bzw. diesem relativ nahe kam.<br />
Bezüglich der Zeit-Wege-Ketten des Zugsystems wurden in der Untersuchungsstufe 2 gegenüber der Stufe 1 im<br />
Detail weitere Differenzierungen vorgenommen. So wurde als zusätzliches Kettenglied - als weitere Zeile in den<br />
entsprechenden Tabellen - die Orientierung der Transfer-Fluggäste eingeführt, die zuvor nur unzureichend<br />
berücksichtigt worden war. In einigen Zeit-Wege-Ketten kommt das Kettenglied "Orientierung" sogar mehrmals<br />
vor, zum Teil wird ein Pauschalwert für in der Praxis mehrfache Orientierungsvorgänge, z. B. innerhalb eines<br />
Terminals, angesetzt. Für andere Phasen des Umsteige-Vorgangs, die in der Stufe 1 nur pauschal betrachtet<br />
worden waren, wurden je nach zu untersuchendem Fall unterschiedliche Werte für den Zeitaufwand angesetzt,
eispielsweise für das Boarding. Ebenso wurde eine Unterscheidung zwischen dem Zeitbedarf des schnellsten<br />
und des langsamsten Fluggastes beim Umsteigen vorgenommen.<br />
Alle Minuten-Angaben innerhalb der Zeit-Wege-Ketten wurden zum Zweck <strong>einer</strong> übersichtlicheren Darstellung<br />
zur nächsten<br />
halben bzw. ganzen Minute aufgerundet, beispielsweise der Wert 2,2 min zu 2,5 min oder der Wert 3,7 min zu<br />
4,0 min. Bei der Bildung <strong>einer</strong> Summe für den gesamten Transfer-Vorgang addieren sich naturgemäß die<br />
"Rundungsfehler" der einzelnen Kettenglieder, so daß die ausgewiesenen Transfer-Zeiten gegenüber den<br />
mathematisch exakten Werten in der Tendenz leicht überhöht sind.<br />
3. Infrastruktur und Fahrzeuge beim Zugsystem<br />
Für den Flughafen-Verbund WIE + FRA mit Hilfe von schnellfahrenden Zügen sind folgende Infrastruktur-<br />
Maßnahmen erforderlich: ein neues Terminal in Wiesbaden-Erbenheim, ein separater Shuttle-Bahnhof in WIE<br />
incl. Abstell- und Wartungsanlagen, die Anbindung von WIE an die im Bau befindliche ICE-Strecke in Richtung<br />
FRA und zwei neue Shuttle-Bahnhöfe in FRA. Im Flughafen Frankfurt selbst werden dagegen nur geringe<br />
Anpassungsmaßnahmen notwendig.<br />
3.1 Terminal Wiesbaden-Erbenheim<br />
Um für die Erstellung der Zeitketten zwischen den Flughäfen Wiesbaden-Erbenheim und Frankfurt die Fußweg-<br />
Entfernungen im Terminal Erbenheim und die Wegelängen auf dem Vorfeld in Erbenheim zu quantifizieren,<br />
sind einfache Dimensionierungen der Terminal- und Vorfeldanlagen am Standort WIE notwendig. Als Basis<br />
dieser Dimensionierung dienen zum einen Layoutpläne des Areals in Erbenheim und zum anderen ein<br />
Szenarioflugplan für Erbenheim. Diese Daten wurden von der Flughafen Frankfurt AG (FAG) für diese Studie<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Der Layoutplan des Areals in WIE enthält die Lage der Start- und Landebahn, die im folgenden als fest<br />
angesehen wird, sowie die Nutzung der Flächen um das Flughafengelände. Die Start- und Landebahn ist in<br />
diesen Plänen (Plan Nr. erb 2800 Oa) bereits auf 2.800 m verlängert.<br />
Vom Typus her entspricht das Terminal am ehesten einem Zentralterminal mit 3 luftseitigen Fingern (siehe Abb.<br />
6 und 7). Ziel dieser Anlage ist es, die internen Wegebeziehungen zu verkürzen. Das Terminal wurde in s<strong>einer</strong><br />
Passagierfunktion als Ein-Ebenen-Terminal geplant. Indem sich die Vorfahrt und die Abfertigungsebene auf der<br />
Ebene +1 befinden, steht zumindest auf der Luftseite eine weitere Ebene zur Verfügung. Das Terminal läßt sich<br />
aufgrund s<strong>einer</strong> Lage und s<strong>einer</strong> Funktion somit nicht direkt <strong>einer</strong> klassischen Konfiguration zuordnen.<br />
Auf der Ebene 0 sind auf der Landseite der Fernbahnhof mit 420,00m Länge und 4 Gleisen, die Technikbereiche<br />
des Terminals, der 160,0 m lange Shuttle-Bahnhof mit seinen Einrichtungen, die Busgates, die luftseitige<br />
Gepäcksortieranlage, die Vorfelddienste, die Vorfeldstraßen und die Flugzeug-Positionen untergebracht.<br />
An den drei luftseitigen Fingern sind insgesamt 28 Gates mit Brücken für die Flugzeuganbindung vorgesehen.<br />
Diese hohe Anzahl wurde aufgrund der nicht redundant vorliegenden Umkehrzeiten gewählt, um sämtliche<br />
Engpässe abdecken zu können. Im Bedarfsfall lassen sich die Finger selbstverständlich auch mit weniger<br />
Positionen und somit kürzer ausbilden. Das Grundsystem erscheint somit begrenzt ausbaufähig und ist in s<strong>einer</strong><br />
möglichen Endausbaustufe (an den beiden äußeren Fingern je zwei weitere Positionen) auf eine Maximallast bei<br />
nur <strong>einer</strong> Start- und Landebahn ausgelegt.<br />
Rechts und links des Terminals sind 12 mittelgroße und 12 kleine Vorfeldpositionen geplant, welche in dieser<br />
Anzahl jedoch für den vorliegenden Prognoseflugplan nicht notwendig sind. Auch hierbei wurde eine spätere<br />
Erweiterung berücksichtigt.<br />
Die Ebene +1 wurde auf den vorhandenen Erdwall zur Fernbahntrasse aufgelagert, und beinhaltet die Zuführung<br />
der öffentlichen Straßenanbindung, die Terminalvorfahrt, die landseitige Abfertigungsebene und die luftseitigen<br />
Passagierbereiche mit 2 Zugängen zum Shuttle-System für Umsteiger zum Flughafen FRA. Die maximalen<br />
Wegestrecken für die Passagiere im Terminal WIE betragen 300 m für Originärpassagiere und 340 m für<br />
Transferpassagiere nach Frankfurt. Die tatsächlichen Wegstrecken beim Umsteigen am Standort Wiesbaden-<br />
Erbenheim sind abhängig von der Verteilung der angebotenen Ziele und der Verteilung der Airlines im<br />
Terminal. Momentan kann dazu noch keine Aussage gemacht werden.
Auf ein Tiefgeschoß kann bei dieser Konfiguration wahrscheinlich verzichtet werden.<br />
3.2 Bahnanlagen im Terminal Wiesbaden-Erbenheim<br />
Am Flughafen Wiesbaden-Erbenheim sind umfangreiche Bahnanlagen neu zu erstellen. Hierzu gehört nicht nur<br />
der für den Airport-Link unverzichtbare Shuttle-Bahnhof, sondern es sind auch Gleise bzw. Gebäude zum<br />
Abstellen und Warten der einzusetzenden Züge erforderlich. Hinzu kommt ein Fern- und Regionalbahnhof zur<br />
Anbindung von WIE an das Schienennetz. Zur lokalen Erschließung des neuen Flughafens, insbesondere von der<br />
Wiesbadener Innenstadt aus, bietet es sich auch an, Stadtbahn-Haltestellen einzurichten.<br />
3.2.1 Shuttle-Bahnhof<br />
Der Shuttle-Bahnhof erhält im Terminal WIE eine zentrale Lage, die besonders kurze Fußwege für Fluggäste,<br />
aber auch für die Vorfeldfahrzeuge gewährleistet (siehe Abb. 7). Die Höhenlage dieses Bahnhofs (Ebene 0)<br />
entspricht der des Vorfeldes, der in Bau befindlichen ICE-Strecke und der Autobahn A 66. Über den<br />
Gleisanlagen befindet sich die Fußgänger-Ebene des Terminals (Ebene 1).<br />
Passagier-Bereich des Bahnhofs<br />
Der Zu- bzw. Abgang der Passagiere zum bzw. vom Bahnsteig in WIE erfolgt auf zweierlei Weise, und zwar mit<br />
Vorfeldbussen und über Treppen:<br />
þ Die Vorfeldbusse fahren den Shuttle-Bahnhof an, wobei sie direkt auf dem -entsprechend breiten - Bahnsteig<br />
zwischen den beiden Gleisen des Airport-Links halten (siehe Abb. 8), damit Fluggäste zwischen Bus und<br />
Shuttlezug ohne Zeitverlust umsteigen können.<br />
þ Die Fluggäste im Transfer WIE - FRA, welche ihre Flugzeuge in WIE über Fluggast-Brücken verlassen,<br />
erreichen den Bahnsteig (Ebene 0) über Treppen vom Fußgänger-Bereich des Terminals aus (Ebene 1).<br />
Über diese Zugänge erreicht noch eine zweite Personengruppe die Ebene 0, nämlich Fluggäste, die im Terminal<br />
WIE einchecken und mit Vorfeldbussen zu ihrem Flugzeug gefahren werden. Obwohl diese Passagiere die<br />
Shuttlezüge gar nicht benutzen, betreten sie dennoch den Bahnsteig, weil sich hier die Haltstellen der<br />
Vorfeldbusse befinden. Genau spiegelbildliche Wege gelten für Passagiere im Transfer von FRA nach WIE<br />
sowie für die Fluggäste, die nach der Landung in WIE mit Vorfeldbussen zum Bahnsteig befördert werden und<br />
anschließend im Terminal WIE aus-checken.<br />
Der Shuttle-Bahnhof WIE verfügt über separate Bahnsteig-Bereiche für Fluggäste aus Schengen- und aus Non-<br />
Schengen-Staaten. Diese Bahnsteig- Sektionen sind durch Wände voneinander getrennt und haben jeweils eigene<br />
Zufahrten für die Vorfeldbusse (siehe Abb. 8). Auch die Treppenanlagen sind in jedem der beiden Bahnhöfe für<br />
Passagiere aus Schengen- und aus Non- Schengen-Staaten separat vorhanden.<br />
Gepäckbereich des Bahnhofs<br />
Da die Shuttlezug-Fahrten regulär im Bahnhof WIE am Bahnsteig enden und hier auch beginnen, wobei<br />
abwechselnd die beiden Gleise benutzt werden, wird die Fortsetzung der Gleise in Richtung der noch zu<br />
beschreibenden Abstellanlage und zum Bahnbetriebswerk im Regelbetrieb von Zügen nicht befahren (siehe Abb.<br />
10). Deshalb ist es zulässig, daß hier ein Gleis von Trolleys und Dolleys mit Fluggepäck beim Anfahren bzw.<br />
Verlassen des Bahnsteigs niveaugleich gequert wird. Bei diesem Gleis handelt es sich um ein sogenanntes<br />
"Nebengleis", das von Shuttlezügen im Ausnahmefall (Fahrten von und zur Abstellanlage und zum<br />
Bahnbetriebswerk) und auch nur mit niedriger Geschwindigkeit befahren wird, so daß die sonst bestehenden<br />
Einschränkungen bzw. Verbote für niveaugleiche Straßenquerungen beim Bau neuer Bahnanlagen ( 11 EBO, 2<br />
EKrG) nicht gelten, zumal es sich um eine nicht-öffentliche Straße handelt ("Privatweg ohne öffentlichen<br />
Verkehr").<br />
Eine Unterführung dieses Weges für Gepäck-Fahrzeuge unter dem Gleis scheidet aus, da Trolleys und Dolleys in<br />
der Regel ungebremst sind und deshalb keine Rampen befahren dürfen.<br />
Die Wendezeit der Züge am Bahnsteig beträgt 7 Minuten.
3.2.2 Abstellanlagen und Bahnbetriebswerk in WIE<br />
Für Shuttlezüge, die als Reserve bei Spitzen-Belastungen des Airport-Links, beim Ausfall von eingesetzten<br />
Zügen und bei Verspätungen dienen, ist in Wiesbaden-Erbenheim westlich des Endbahnhofs WIE der Bau<br />
mehrerer Abstellgleise erforderlich (siehe Abb. 10). Außerdem wird ein Bahnbetriebswerk benötigt, in welchem<br />
die regelmäßige Wartung der Züge und bei Bedarf auch deren Reparatur stattfindet. Dieses Bahnbetriebswerk<br />
befindet sich westlich des Endbahnhofs WIE (siehe Abb. 10).<br />
In WIE werden die Abstellgleise wie auch die Gleise des Bahnbetriebswerks im Regelbetrieb nicht befahren.<br />
Vielmehr führen die in WIE aus FRA ankommenden Shuttlezüge eine sogenannte "Bahnsteigwende" durch: Sie<br />
fahren bei ihrer Ankunft abwechselnd auf das nördliche und das südliche Bahnsteiggleis ein und ebenso in<br />
Richtung FRA später wieder ab. Deshalb werden die beiden Gleise, welche den Bahnsteigbereich WIE mit der<br />
Abstellanlage und dem Bahnbetriebswerk verbinden, nur dann benutzt,<br />
þ wenn ein überzähliger Zug aus dem Verkehr gezogen oder ein zusätzlicher Zug benötigt wird<br />
þ wenn ein schadhafter Zug in die Reparaturwerkstätte gebracht werden muß<br />
þ wenn ein Zug s<strong>einer</strong> routinemäßigen Wartung unterzogen werden muß.<br />
Aus diesem Grunde kann das südliche Verbindungsgleis einen niveaugleichen Bahnübergang erhalten, so daß<br />
eine ebenerdige Zufahrt für Trolleys und Dolleys zum Gepäckbereich des Bahnsteigs in WIE zulässig ist, wie<br />
oben bereits dargestellt wurde (vgl. Kapitel 3.2.1).<br />
3.2.3 Fern- und Regionalbahnhof sowie Stadtbahn-Haltestellen in WIE<br />
Es bietet sich außerdem an, den Flughafen WIE an den Schienen-Fern- und Regionalverkehr anzuschließen.<br />
Hierfür ist ein separater Bahnhof erforderlich, der sich nördlich des Shuttle-Bahnhofs WIE befindet und über 4<br />
Bahnsteiggleise und zwei Mittelbahnsteige verfügt (siehe Abb. 10). Somit besitzt dieser Bahnhof dieselbe Größe<br />
wie der neue ICE-Bahnhof des Flughafens Frankfurt. Die beiden im Bau befindlichen Gleise des ICE-<br />
Streckenasts Wiesbaden - Köln bilden die beiden mittleren Gleise des neuen Fern- und Regionalbahnhofs WIE.<br />
Das bedeutet, daß die derzeit erstellte Infrastruktur des Wiesbadener Ast der ICE-Strecke in vollem Umfang<br />
weiter genutzt werden kann.<br />
Eine weitere Zukunftsoption ist die Anbindung des Terminals WIE an die Wiesbadener Stadtbahn, deren<br />
Realisierung derzeit diskutiert wird. Hierzu sollte im Bereich des Terminals bzw. des DB-Bahnhofs eine<br />
entsprechende Fläche für die spätere zweigleisige Stadtbahn-Trasse freigehalten werden, die von Stadtbahnlinien<br />
Wiesbaden - WIE - Niedernhausen und Wiesbaden - WIE - Wallau -Hofheim genutzt werden könnte. Um die<br />
Wege der Fluggäste zu minimieren, die im Zubringerverkehr nach WIE die Stadtbahn benutzen, können anstelle<br />
<strong>einer</strong> zentrale Haltestelle gleich zwei Haltestellen geschaffen werden, die im Westen und im Osten nördlich des<br />
Terminals liegen.<br />
3.3 Bahnanlagen und Baumaßnahmen in FRA<br />
3.3.1 Vorhandene Bahnhofs-Infrastruktur in FRA<br />
Der Flughafen Frankfurt verfügt bereits über zwei Personenbahnhöfe: den Regionalbahnhof und den<br />
Fernbahnhof für den IC- und ICE-Verkehr. Beide Bahnhöfe sind mit dem zukünftigen Zugverkehr vollkommen<br />
ausgelastet, so daß der Airport-Link eine zusätzliche, eigene Bahnhofs-Infrastruktur benötigt.<br />
Im einzelnen ist in diesen beiden Bahnhöfen mit folgenden Verkehrsbelastungen zu rechnen:<br />
þ Während der Regionalbahnhof heute von <strong>einer</strong> S-Bahn-Linie im 15-Minuten-Takt, von RE-Zügen im<br />
Stundentakt und im Berufsverkehr auch noch von einigen Verstärkungszügen bedient wird, soll der zukünftige<br />
Zugverkehr hier wesentlich dichter sein: Neben <strong>einer</strong> Verdichtung des Angebots im RB-und RE-Verkehr soll<br />
eine zusätzliche S-Bahn-Linie sowie die geplante Stadtbahnlinie "Regionaltangente West" eingerichtet werden.
Der nur dreigleisige Bahnhof hat dann keine Kapazitätsreserven mehr, um die in sehr dichter Folge zwischen<br />
WIE und FRA verkehren verkehrenden Shuttlezüge zu bewältigen.<br />
þ Der Fernbahnhof wird in Zukunft von zahlreichen ICE-Linien bedient, und zwar nach derzeitigen DB-Plänen<br />
für 2015 von 7 Zügen pro Stunde und Richtung [3]. Hinsichtlich Kapazitäten sind besonders bis zu 4 Züge pro<br />
Stunde kritisch, die in Frankfurt Flughafen Fernbahnhof ihre Fahrtrichtung wechseln [4]. Jeder dieser Züge muß<br />
bei diesem "Kopfmachen" ein Gleis der Gegenrichtung auf Weichen am Ostkopf des Bahnhofs kreuzen, was die<br />
Zahl der Zugfahrten der Gegenrichtung stark einschränkt (sogenannte "Fahrplanausschlüsse"). Die daraus<br />
resultierende Engpaß-Situation wird weiter verschärft, denn die DB AG erwägt u.a., die Zugläufe des<br />
zukünftigen ICE-T aus Richtung München -Nürnberg -Würzburg am Flughafen Frankfurt enden und in der<br />
Gegenrichtung hier beginnen zu lassen [5]. Da hierfür k<strong>einer</strong>lei Wende- oder Abstellgleise in Frankfurt<br />
Flughafen Fernbahnhof vorhanden sind, müssen die betreffenden Züge relativ lange am Bahnsteig halten<br />
(sogenannte "Bahnsteigwende").<br />
Für einen Shuttle-Verkehr zwischen WIE und FRA stehen deshalb die beiden bestehenden Personenbahnhöfe<br />
allein mangels Kapazitäten nicht zur Verfügung. Hinzu kommt noch die ungünstige Lage des Fernbahnhofs weit<br />
vom Terminal 1 und erst recht vom Terminal 2 entfernt, was zur Erreichung der MCT kontraproduktiv wäre. Für<br />
den Flughafen Frankfurt wird deshalb der Bau von zwei neuen Shuttle-Bahnhöfen vorgeschlagen.<br />
3.3.2 Neue Shuttle-Bahnhöfe und Abstellanlagen in FRA<br />
Für den Shuttle-Verkehr erhält der Flughafen Frankfurt einen "Bahnhof T1", der in das Terminal 1 integriert ist,<br />
und einen "Bahnhof T2" in Seitenlage zu Terminal 2 (siehe Abb. 11).<br />
Bahnhof T1<br />
Der zweigleisige Bahnhof T1 wird parallel zum Sky-Line-Bahnhof B und in gleicher Höhenlage wie dieser<br />
angelegt. Im Bahnhof T1 steigen die Transfer-Fluggäste von und nach Flugsteig A, B und C auf<br />
Seitenbahnsteigen in die Züge des Airport-Links ein bzw. aus und hier wird auch Transfer-Gepäck<br />
umgeschlagen (siehe Abb. 12). Deshalb ist jeder Bahnsteig in zwei Bereiche unterteilt, von denen der eine für<br />
Passagiere und der andere für Gepäck reserviert ist. Hierbei dient der südliche Seitenbahnsteig dem Aussteigen<br />
von Fluggästen sowie dem Ausladen von Gepäck und der nördliche dem Einsteigen bzw. Einladen.<br />
Auf der Ebene 0 unterhalb des Bahnhofs T1 liegen die Haltestellen der Vorfeldbusse, welche die Vorfeld-<br />
Positionen bedienen. Mit direkten Rolltreppen und/oder mit Aufzügen von der Bahnsteig-Ebene zur Ebene 0<br />
wird eine kurze Übergangszeit zwischen Shuttlezug und Vorfeldbus hergestellt.<br />
Da die Flugzeug-Positionen an der zur Zeit im Bau befindlichen Verlängerung des Flugsteigs A bis zu 1100 m<br />
vom Shuttle-Bahnhof T1 entfernt liegen werden, bietet es sich an, daß die Transfer-Fluggäste von und nach<br />
WIE, die zu den entfernt liegenden A-Positionen unterwegs sind oder von dort kommen, die Sky Line benutzen,<br />
die entsprechend dem Flugsteig A ebenfalls verlängert wird. Hierfür sollte das Umsteigen zwischen Shuttlezug<br />
und Sky Line bahnsteiggleich möglich sein, was durch eine entsprechende Anordnung der Gleise im Shuttle-<br />
Bahnhof T1 bzw. Sky-Line-Bahnhof B realisiert werden kann. Ein bahnsteiggleiches Umsteigen wird im<br />
allgemeinen von Fahrgästen im IC-Verkehr (z. B. Mannheim Hbf) oder im Nahverkehr (z. B. Frankfurt<br />
Konstablerwache) als bequem angesehen, im Gegensatz zu dem sonst üblichen Umsteigen über Treppen und mit<br />
langen Wegen. Falls erforderlich, müßten hierfür die Sky-Line-Fahrspuren im Bahnhof B entsprechend<br />
umgebaut werden, was jedoch nur anhand <strong>einer</strong> detaillierten Studie bestimmt werden kann.<br />
Bahnhof T2<br />
Der Bahnhof T2 (siehe Abb. 13) ist dreigleisig angelegt und verfügt im Vergleich zu Bahnhof T1 über<br />
geräumigere Bahnsteige für den Gepäckumschlag. Betrieblich ähnelt der Bahnhof T2 dem Bahnhof WIE: Er<br />
wird im Regelbetrieb wie ein Kopfbahnhof verwendet; die sich östlich anschließende Abstellanlage wird nur<br />
zum Ein- und Aussetzen, aber nicht zum Wenden von Zügen benutzt. Dieses findet vielmehr am Bahnsteig statt,<br />
wobei die Wendezeit 8 Minuten beträgt.<br />
Im Unterschied zum Bahnhof T1 ist der Gepäck-Abschnitt des Bahnsteiges von T2 über einen trolley/dolleygängigen<br />
Frachtaufzug mit dem internen Straßensystem des Flughafens Frankfurt verbunden. Dies ist zwar für<br />
die erforderlichen Wegeketten nicht zwangsläufig erforderlich, doch eröffnet es zahlreiche Optionen, z. B. ein
Austausch von Leercontainern, Dolleys und Trolleys zwischen FRA und WIE. Auch Fracht, die nicht der MCT<br />
von 45 min unterliegt, kann hier möglicherweise ein- und ausgeladen werden.<br />
Abstellgleise in FRA<br />
Östlich des Bahnhofs T2 befindet sich eine Abstellanlage für Shuttlezüge (siehe Abb. 9, 13). Wie beim Bahnhof<br />
WIE werden diese Abstellgleise jedoch nicht im Regelbetrieb zum Wenden der Züge benutzt.<br />
3.3.3 Anbindung der Shuttle-Bahnhöfe in FRA<br />
Unmittelbar östlich des Tunnels bei der Autobahn-Anschlußstelle Kelsterbach wird die 2-gleisige Trasse des<br />
Airport-Links zu den Bahnhöfen T1 und T2 in FRA kreuzungsfrei aus der ICE-Strecke in <strong>einer</strong> Rechtskurve<br />
ausgefädelt. Die beiden Gleise der Shuttlezüge queren auf <strong>einer</strong> Brücke zunächst die A 3 und dann den Airport-<br />
Ring. Das Brückenbauwerk setzt sich in <strong>einer</strong> Linkskurve fort, die zwischen den Flughafen-Gebäuden 209 und<br />
302 verläuft, um anschließend in das Terminal 1 einzumünden, wo sich parallel zum Haltepunkt B der Sky Line<br />
der Bahnhof T1 des Airport-links befindet.<br />
3.3.4 Weitere Baumaßnahmen innerhalb von FRA<br />
Optimierungen zur Verkürzung der Umsteigezeiten für Personen und Gepäck werden überwiegend am noch<br />
nicht existierenden Terminal Wiesbaden-Erbenheim durchgeführt und nicht am bestehenden Flughafen<br />
Frankfurt. Einige wenige Maßnahmen innerhalb von FRA sind jedoch trotzdem erforderlich.<br />
Anpassung des Terminals 1<br />
Damit der Shuttle-Bahnhof T1 statisch in das Terminalgebäude integriert werden kann, müssen Anpassungen<br />
vorgenommen werden, inbesondere der nachträgliche Einbau von Stützen. Statisch gesehen dürfte der Bahnhof<br />
ein Brückenbauwerk darstellen. Hierbei sind größere Lasten abzufangen als bei der eher filigranen Sky Line.<br />
Neben den statischen Anpassungen müssen Zugänge zum Bahnhof T1 geschaffen werden, die für den Fluggast<br />
keinen Zeitverlust bedeuten. So ist beispielsweise eine direkte Rolltreppe oder ein Lift vom Bahnsteig auf die<br />
Ebene 0 zum Haltebereich der Vorfeldbusse erforderlich.<br />
Anpassung des Terminals 2<br />
In Terminal 2 sind die Anpassungen weniger aufwendig, da der Shuttle- Bahnhof T2 in Seitenlage zum Gebäude<br />
liegt. Die schon vorhandene Aufständerung für die Sky Line muß entsprechend erweitert und verstärkt werden.<br />
Bau <strong>einer</strong> kreuzungsfreien Straße vom Terminal 1 in das westliche Vorfeld<br />
Während das Vorfeld des Flughafens Frankfurt im Osten mit Terminal 2 endet, erstreckt es sich sehr weit nach<br />
Westen: So sind die westlichsten Flugzeug-Vorfeldpositionen bis zu 4 km vom Terminal 1 entfernt. Da die<br />
Geschwindigkeit der Dolleys und Trolleys, die ungebremst auf dem Vorfeld nur mit max. 15 km/h fahren dürfen,<br />
und der Busse, für die auf dem Vorfeld nur max. 25 km/h erlaubt sind, relativ gering ist und zugleich die<br />
Vorschrift besteht, Flugzeugen Vorrang zu gewähren, würde der Gepäcktransport zwischen Terminal 1 und den<br />
westlichsten Vorfeldpositionen bis zu 20 min und die Personenbeförderung bis zu 12 min dauern. Dies würde zu<br />
<strong>einer</strong> Überschreitung der MCT von 45 min führen.<br />
Im folgenden wird eine Lösung skizziert, mit deren Hilfe die langen Fahrzeiten von Terminal 1 zum westlichen<br />
Vorfeld signifikant verkürzt werden können. Dieser Optimierungsvorschlag ist im Prinzip unabhängig vom hier<br />
diskutierten Flughafen-Verbund WIE-FRA zu sehen und verkürzt auch die FRA- internen Umsteigezeiten.<br />
Es wird vorgeschlagen, eine kreuzungsfreie Straße vom Terminal 1 zum westlichen Vorfeld zu bauen, und zwar<br />
mit folgender Streckenführung: Vom Terminal 1 aus wird die unterirdische Tiefgaragenzufahrt "P40" genutzt<br />
und um 180 m bis zum Südrand der Autobahn A 3 verlängert. Von hier aus verläuft die neue Straße ebenerdig
entlang der A 3 auf deren Südseite. Die neue Straße schwenkt kurz nach Tor 26 in das Flughafengelände ein und<br />
verläuft auf Tor 97 zu, wo sie wieder in das Vorfeld mündet (Abb. 15).<br />
Da es sich um eine flughafeninterne Straße handelt, die aber z. T. außerhalb des Flughafengeländes verläuft,<br />
muß sie vollständig eingezäunt sein und ständig überwacht werden.<br />
Längerfristig sollten auf dieser Straße Vorfeldfahrzeuge zum Einsatz kommen, die in kreuzungsfreien und<br />
entsprechend großzügig trassierten Abschnitten eine Geschwindigkeit von 50 km/h erreichen dürfen. Gegenüber<br />
gebremsten Fahrzeugen über das Vorfeld können so rund 4 min Fahrzeit eingespart werden. Da sich die<br />
vorliegende Studie auf einen längerfristigen Planungshorizont bezieht, sollte die Einschränkung auf<br />
entsprechend schnelle Vorfeldfahrzeuge zur Bedienung der westlichsten Vorfeldpositionen akzeptabel sein.<br />
Alternativ könnte auch eine Trasse entlang des Airport-Rings, aber innerhalb des Flughafen-Geländes errichtet<br />
werden. Diese Straße hätte allerdings an den Tor-Einfahrten niveaugleiche Kreuzungen, was entweder zu<br />
Geschwindigkeitseinbrüchen der Fahrzeuge auf der neuen Straße oder zu Fahrzeitverlusten anderer Fahrzeuge<br />
führt. Der Airport-Ring incl. Flughafen-Umzäunung müßte, um die benötigte Fläche für die neue Straße<br />
überhaupt zu schaffen, um eine Straßenbreite nach Norden verschoben werden, was relativ aufwendig wäre.<br />
3.4 Eisenbahnstrecke ab WIE bis zum Wiesbadener Kreuz<br />
Die beiden Flughäfen Frankfurt und Wiesbaden-Erbenheim liegen unmittelbar an der im Bau befindlichen ICE-<br />
Strecke Köln - Rhein/Main: der Flughafen Wiesbaden-Erbenheim am "Wiesbadener Ast" und der Flughafen<br />
Frankfurt am "Frankfurter Ast" der neuen Trasse. Im Prinzip wird zwischen diesen beiden Streckenästen nur<br />
noch eine kurze Verbindungsspange am Wiesbadener Kreuz benötigt, um Züge mit hoher Geschwindigkeit<br />
zwischen den beiden Flughäfen verkehren lassen zu können. Doch aus mehreren Gründen sind für den Airport-<br />
Link separate Gleise sowohl ab WIE bis zum Wiesbadener Kreuz als auch ab hier bis FRA naheliegend.<br />
3.4.1 Separate Gleise für den Airport-Link bis zum Wiesbadener Kreuz<br />
Der im Bau befindliche Wiesbadener Ast der ICE-Strecke kann für den Airport-Link nicht sinnvoll genutzt<br />
werden, da aufgrund der großen Länge der hierfür erforderlichen Ein- und Ausfädelungsbauwerke nur noch etwa<br />
1000 m Streckenlänge zwischen Wiesbaden-Erbenheim und Wallau übrig bliebe. Stattdessen wird, vom<br />
Terminal Wiesbaden-Erbenheim kommend, die Trasse des Airport-Links mit separaten Gleisen bis zum<br />
Wiesbadener Autobahnkreuz geführt. Diese zusätzlichen Gleise queren mit einem Kreuzungsbauwerk<br />
unmittelbar nach dem Terminal WIE die beiden ICE-Gleise (siehe Abb. 14) und verlaufen bis zum Westportal<br />
des Tunnels "Wandersmann Süd" der ICE-Strecke zwischen dieser Trasse und der Autobahn A 66, der sie bis<br />
zum Wiesbadener Kreuz auf der Autobahn-Südseite in enger Trassenbündelung folgen. Sieht man davon ab, daß<br />
sich dadurch die Investitionskosten gegenüber <strong>einer</strong> Mitnutzung der beiden ICE-Gleise nicht wesentlich erhöhen,<br />
so hat diese Lösung den Vorteil, daß die Airport-Shuttle-Züge zumindest vom ICE-Verkehr von und nach<br />
Wiesbaden unabhängig sind, auch wenn hier (vorläufig) nur ein bis zwei ICE-Züge pro Stunde und Richtung<br />
verkehren sollen.<br />
3.4.2 Modifizierung der Planung "Wiesbaden-Spange"<br />
Für eine Verbindungsspange zwischen dem "Wiesbadener Ast" und dem "Frankfurter Ast" liegen zumindest<br />
Planungsskizzen vor, wenn auch die Planfeststellung und der Bau selbst auf unbestimmte Zeit aufgeschoben<br />
sind. Diese "Wiesbaden-Spange", die südlich am Wiesbadener Kreuz der Autobahnen A 3 und A 66 vorbei<br />
führen wird (siehe Abb. 14), ermöglicht eine Schienen-Schnellverbindung zwischen Frankfurt Flughafen und der<br />
Stadt Wiesbaden und wurde von Politikern der Region gefordert, allerdings fand sich bislang noch kein Weg zur<br />
Finanzierung dieser Baumaßnahme.<br />
Für die Belange des Airport-Links muß die Trassierung der Wiesbaden- Spange gegenüber der bisherigen DB-<br />
Planung hinsichtlich der Strecken-Höchstgeschwindigkeit modifiziert werden: Statt <strong>einer</strong> Auslegung für 140 bis<br />
150 km/h ist nun eine Trassierung für 220 km/h erforderlich. Hierbei weicht die neue Linienführung um bis zu<br />
80 m von der bisher geplanten Trasse ab.<br />
3.5 Eisenbahnstrecke ab Wiesbadener Kreuz bis FRA
Zwischen dem Wiesbadener Kreuz und FRA lassen sich prinzipiell auf rund 12 km Länge die vorhandenen bzw.<br />
im Bau befindlichen ICE-Gleise nutzen. Alternativ hierzu ist im genannten Abschnitt der Bau separater Gleise<br />
möglich, so daß der Airport-Shuttle-Betrieb völlig unabhängig vom ICE-Verkehr stattfinden kann.<br />
Auf der ICE-Strecke verkehren pro Stunde 4 ICE-Züge in einem Pulk. In diesen Zugpulk, der sich über eine<br />
Dauer von 18 min erstreckt, fahren die Züge im Zeitabstand von nur 4 1/2 min hintereinander her. Sofern keine<br />
separaten Gleise gebaut werden, muß während der 18-minütigen Pulkdauer jeweils zwischen zwei ICE-Zügen<br />
ein Airport-Shuttle-Zug die Strecke befahren. Das bedeutet eine Zugfolgezeit von 2 min 15 sec oder 135 sec,<br />
wobei sich ICE und Airport-Shuttle abwechseln.<br />
Ob angesichts dieser kurzen Zugfolgezeit eine Mitnutzung der ICE-Gleise durch die Shuttlezüge zwischen WIE<br />
und FRA sinnvoll ist, soll im folgenden behandelt werden.<br />
3.5.1 Mitnutzung der ICE-Gleise versus separate Gleise bis FRA<br />
Argumente für die Mitnutzung der ICE-Gleise<br />
Für die Mitnutzung der ICE-Strecke im Abschnitt vom Wiesbadener Kreuz bis FRA lassen sich die folgenden<br />
Argumente anführen:<br />
þ Angesichts der Tatsache, daß in München auf der S-Bahn-Stammstrecke demnächst der Fahrplantakt auf 60<br />
sec verdichtet werden soll - obwohl hier die Züge an Bahnsteigen halten müssen - dürfte der Mischbetrieb von<br />
Airport-Shuttle- und ICE-Zügen auf dem Frankfurter Ast der ICE-Strecke bei <strong>einer</strong> mehr als doppelt so langen<br />
Zugfolgezeit, nämlich von 135 sec, und ohne Zwischenhalt von Zügen an Bahnsteigen betrieblich weitaus<br />
entspannter sein. Hinzu kommt, daß sich vom Wiesbadener Kreuz aus gesehen, die 2-gleisige "Engpaß"-Strecke<br />
im Bereich Frankfurt Flughafen auf 6 Bahnsteiggleise erweitert (4 Gleise im Flughafen-Fernbahnhof, 2 Gleise in<br />
den Shuttle-Bahnhöfen), so daß hier für den Verspätungsfall Pufferungsmöglichkeiten bestehen, welche im<br />
Münchner S-Bahn-System nicht gegeben sind.<br />
þ Die genannte Mindest-Zugfolgezeit von 4 1/2 min für die ICE-Züge zwischen Köln und dem Rhein/Main-<br />
Gebiet wird von der DB AG mit der hohen Geschwindigkeit von 300 km/h und den Abschnitten mit Gefälle von<br />
bis zu 4% begründet. Beide Faktoren erfordern angeblich aus Sicherheitsgründen den relativ großen Zeitabstand<br />
von 4 1/2 min zwischen zwei aufeinander folgenden Zügen. Doch in dem fraglichen Abschnitt vom Wiesbadener<br />
Kreuz bis FRA wird zum einen die Höchstgeschwindigkeit der ICE-Züge von 300 km/h überhaupt nicht erreicht:<br />
So beträgt die Geschwindigkeit der ICE-Züge in der Richtung FRA -Köln (leichte Steigung) lediglich max. 230<br />
km/h und in der Gegenrichtung (leichtes Gefälle) max. 250 km/h. Zum anderen findet sich hier keine Rampen<br />
mit <strong>einer</strong> Gradiente von 4%. Deshalb dürfte es sehr wohl vertretbar sein, zwischen dem Wiesbadener Kreuz und<br />
FRA die Zugfolgezeit auf 2 1/4 min zu reduzieren.<br />
þ Die kürzeste aufgrund der herkömmlichen Signaltechnik mögliche Zugfolgezeit dürfte bei ungefähr 90 sec<br />
liegen und somit weit unter der genannten Zeitspanne von 2 1/4 min. Doch selbst eine minimale Zugfolgezeit<br />
von 90 sec ist im Vergleich zum Flugverkehr immer noch relativ lang. Denn in FRA landen Flugzeuge in einem<br />
noch dichterem Zeitabstand, nämlich alle ca. 70 sec, und dies bei Problemen, welche im Eisenbahn-Verkehr<br />
unbekannt sind, wie beispielsweise aerodynamische Wirbelschleppen oder bezüglich ihrer Flugeigenschaften<br />
sehr unterschiedliche Flugzeugtypen. Außerdem besteht die Notwendigkeit zur 3-dimensionalen Steuerung der<br />
Flugzeuge, während die Steuerung des Zugverkehrs nur in <strong>einer</strong> einzigen Dimension erforderlich ist.<br />
þ Es ist nicht auszuschließen, daß nach <strong>einer</strong> Anlaufphase mit entsprechenden Betriebserfahrungen sich die DB<br />
AG entgegen den ursprünglichen Planungen durchaus in der Lage sehen wird, im Verspätungsfall oder sogar im<br />
Regelbetrieb die Zugfolgezeit der ICE-Züge zwischen Köln und dem Rhein/Main-Gebiet auf deutlich unter 4 1/2<br />
min zu reduzieren. Denn diese Zugfolge bedeutet bei <strong>einer</strong> Geschwindigkeit von 300 km/h, daß die Züge<br />
einander im Abstand von 22,5 km folgen - und dies bei einem Bremsweg von nur 3,5 km. Im übrigen können auf<br />
der TGV-Strecke Paris - Lille (Höchstgeschwindigkeit ebenfalls 300 km/h, Gefälle von bis zu 3,5%) schon seit<br />
Jahren Zugfahrten im Zeitabstand von lediglich 2 1/2 min beobachtet werden [6].<br />
Doch damit ein solcher Mischverkehr tatsächlich funktionieren kann, muß der bereits heute auf dem Frankfurter<br />
Ast erkennbare Engpaß beseitigt sein, der durch die eingleisige und zugleich niveaugleiche Abzweigung<br />
"Raunheimer Kurve" verursacht wird. Auf dieser Strecke werden in Zukunft voraussichtlich die beiden IC/ICE-<br />
Linien Mannheim - FRA - Mainz - Wiesbaden - Köln und Frankfurt Hbf - FRA - Koblenz - Bonn - Köln<br />
verkehren, wobei die Züge bei der Fahrt in Richtung Mainz grundsätzlich das ICE-Gleis der Richtung Köln -<br />
FRA auf Weichen queren müssen. Die daraus resultierende Fahrstraßenkreuzung bedeutet, daß hier immer dann
kein Airport-Shuttle- bzw. ICE -Zug fahren darf, wenn ein IC- bzw. ICE-Zug von FRA nach Mainz abzweigt.<br />
Dieser Engpaß dürfte zu schweren Einschränkungen bei der Konzeption des Fahrplans führen und ein Auslöser<br />
gravierender Verspätungen sein, selbst ohne Mitnutzung der ICE-Strecke durch den Airport-Link.<br />
Diese niveaugleiche Abzweigung ist auch unter Sicherheitsaspekten äußerst problematisch und hätte durch den<br />
Bau eines Kreuzungsbauwerkes mit zusätzlichen Investitionen von rund 35 Mio. DM [7] von vornherein<br />
verhindert werden können. Der Verzicht auf diese Baumaßnahme ist, gemessen an den Gesamtkosten der ICE-<br />
Strecke Köln - Rhein/Main von rund 9,5 Mrd. DM, nur eine marginale Ersparnis von weniger als 4 Promille.<br />
Der genannte Engpaß läßt sich beseitigen, indem hier nachträglich das fehlende Kreuzungsbauwerk geschaffen<br />
wird, mit dessen Hilfe das Gleis der Fahrtrichtung FRA - Mainz die ICE-Gleise von und nach Köln unterqueren<br />
kann, was aufgrund der Höhenlagen und der Gleisgeometrie realisierbar ist. Hierfür ist die Inanspruchnahme von<br />
Privatgrund erforderlich (Ticona, ehem. Höchst AG), nicht jedoch der Eingriff in Bausubstanz. Die VIEREGG-<br />
RÖSSLER GmbH führte hierfür bereits genauere Recherchen anhand von Detailplänen im Maßstab 1:1000<br />
durch [8].<br />
In der Untersuchungsstufe 1 wurde diese Mitnutzung der ICE-Gleise durch den Airport-Shuttle-Verkehr<br />
unterstellt.<br />
Argumente gegen die Mitnutzung der ICE-Gleise<br />
Gegen den Mischbetrieb von Airport-Shuttle-Zügen und ICE-Zügen im Abschnitt vom Wiesbadener Kreuz bis<br />
FRA sprechen folgende Argumente:<br />
þ Jeder einzelne Airport-Shuttle-Zug muß insbesondere im Bahnhof WIE, aber auch im Bahnhof T1 zu einem<br />
ganz bestimmten Zeitpunkt abfahren, um sich in die Reihe der im 4 1/2-Minuten-Zeitabstand verkehrenden ICE-<br />
Zügen exakt einzureihen. Dies ist mit der althergebrachten, 150 Jahre alten Signaltechnik (Blockstellen)<br />
überhaupt nicht realisierbar. Denn würde ein ICE-Zug, gemessen am nachfolgenden Shuttlezug, auch nur leicht<br />
verspätet sein, müßte dieser Shuttlezug vor s<strong>einer</strong> Einfahrt in die ICE-Strecke vor einem Halt zeigenden Signal<br />
stehenbleiben. Wenn er dann endlich weiterfahren dürfte, würde er wegen s<strong>einer</strong> relativ niedrigen<br />
Anfahrgeschwindigkeit auf der ICE-Strecke den nachfolgenden ICE-Zug behindern.<br />
þ Bei <strong>einer</strong> Mitnutzung der ICE-Gleise durch den Airport-Shuttle-Verkehr würde die extrem dichte Zugfolge im<br />
Abschnitt vom Wiesbadener Kreuz bis FRA zu einem weiteren Engpaß führen, der zu den vielen schon<br />
vorhandenen Engpässen im Eisenbahnnetz im Raum Knoten Frankfurt hinzu käme.<br />
þ Im Fall des Mischverkehrs von Airport-Shuttle- und ICE-Zügen im Abschnitt vom Wiesbadener Kreuz bis<br />
FRA übertragen sich Verspätungen aus dem störanfälligen ICE-System auf den Airport-Link, der somit ebenfalls<br />
störanfällig wird. Es besteht somit die Gefahr, daß die Minimum Connection Time von 45 min im Flughafen-<br />
Verbund von WIE + FRA im Fall der hier unterstellten Worst-Case-Flugzeug-Positionen immer wieder<br />
überschritten wird, da sich die Zugfolgezeit des Airport-Shuttles bei Verspätungen in der Größenordnung von 3<br />
Minuten erhöhen kann.<br />
Als Ergebnis der obigen Pro- und Contra-Diskussion kann festgehalten werden, daß separate Gleise nicht nur<br />
zwischen dem Shuttle-Bahnhof WIE und dem Wiesbadener Kreuz, sondern auch vom Wiesbadener Kreuz bis<br />
FRA notwendig sind. Das bedeutet, daß der Airport-Link beim Zugsystem durchgehend eigene Gleise benötigt.<br />
Die Mischnutzung ist zwar technisch im Prinzip machbar, setzt jedoch einen sehr pünktlichen ICE-Verkehr<br />
voraus.<br />
3.5.2 Streckenführung der separaten Gleise vom Wiesbadener Kreuz bis FRA<br />
Die separaten Gleise des Airport-Links (Abb. 14, grün) stellen die direkte Verlängerung der "Wiesbadener<br />
Spange" in Richtung Frankfurt Flughafen dar. Südlich des Wiesbadener Kreuzes wird das neue Gleispaar mit der<br />
ICE-Strecke verknüpft, so daß hier Züge auch zwischen den beiden Gleispaaren wechseln können (Abb. 21). Die<br />
beiden zusätzlichen Gleise verlaufen anschließend direkt neben dem Gleispaar der zukünftigen ICE-Strecke<br />
Köln - Rhein/Main (Abb. 23). Südlich Eddersheim, kurz vor der Mainquerung, beginnt eine großzügig trassierte<br />
Linkskurve, mit der die Bahnstrecke Frankfurt-Sportfeld - Mainz am Ostrand des ehemaligen Caltex-Geländes<br />
erreicht wird, wobei dieses Gelände im Süden gequert wird. In der genannten Linkskurve liegt auch die neue<br />
Brücke über den Main, rund 50 bis 150 m entfernt von der Brücke der ICE-Strecke Köln - Rhein/Main (siehe<br />
Abb. 23).
Das ehemalige Caltex-Gelände wird derzeit im Rahmen eines neuen Flächennutzungsplanes neu geordnet.<br />
Hierbei ist ohnehin eine Veränderung bzw. Neuordnung der Eisenbahninfrastruktur vorgesehen. Falls die hier<br />
vorgestellte neue Streckenführung als verfolgenswert erachtet wird, sollte dies umgehend in die laufende<br />
Flächennutzungsplanung des Caltex-Geländes einfließen (Abb. 22 und 23).<br />
Auf <strong>einer</strong> Länge von 1,5 km verlaufen die beiden neuen Gleise südwestlich von Kelsterbach rechts und links der<br />
bestehenden Bahnlinie Mainz -Frankfurt-Sportfeld, mit der die Trasse des Airport-Links in beiden<br />
Fahrtrichtungen verknüpft ist (siehe Abb. 22). Diese Streckenverknüpfung dient mehreren Zwecken, die unten<br />
ausführlich beschrieben werden (siehe Kapitel 3.5.4).<br />
Die zur Zeit im Bau befindliche eingleisige Verbindungskurve von der ICE-Trasse Köln - Frankfurt Flughafen<br />
zur Bahnstrecke Mainz -Frankfurt-Sportfeld, von der DBProjekt GmbH Köln-Rhein/Main als "Kurve Caltex"<br />
(nach dem ehemaligen Caltex-Gelände) bezeichnet, wird dadurch überflüssig und kann wieder abgebaut werden,<br />
um die aus städtebaulichen Gründen ungünstige Mehrfach-Zerschneidung des ehemaligen Caltex-Geländes<br />
durch Bahntrassen zu minimieren. Ohnedies wäre diese Verbindungsstrecke für ICE-Züge in der Fahrtrichtung<br />
von Köln nach Kelsterbach und weiter nach Frankfurt kaum verwendbar, da zweimal ein Gleis der<br />
Gegenrichtung mit Hilfe von Weichen gekreuzt werden müßte. Dagegen erlauben es die im Rahmen des Airport-<br />
Links zu schaffenden Gleisverbindungen, daß die Zugfahrten in allen Fahrtrichtungen ohne<br />
Fahrstraßenkreuzungen stattfinden können.<br />
Die weitere Trassenführung des Airport-Links ähnelt dem Verlauf der im Raumordnungsverfahren für die ICE-<br />
Strecke Köln - Rhein/Main diskutierten "Variante Klaraberg", welche südlich an Kelsterbach und am Nordrand<br />
des Mönchwaldes entlang führt (Abb. 23) und hierbei <strong>einer</strong> breiten Stromtrasse folgt.<br />
Bei der Autobahn-Anschlußstelle Kelsterbach wird die ICE-Trasse Köln -Frankfurt erreicht. Hier muß das<br />
nördliche Gleis des Airport-Links auf <strong>einer</strong> Brücke über mehrere Straßen geführt werden, die in diesem Bereich<br />
die A 3 und die B 43 selbst auf Brücken queren, so daß sich für dieses Gleis eine Höhenlage in der Ebene +2<br />
ergibt. Das Gleis der Gegenrichtung kann hingegen, nachdem es auf <strong>einer</strong> Brücke die B 43 gekreuzt hat, in<br />
Bündelung mit der A 3 auf der Ebene 0 geführt werden (siehe Abb. 23).<br />
Die Verknüpfung der separaten Strecke des Airport-Links mit der ICE-Strecke wie auch die Fortsetzung in<br />
Richtung Bahnhof T1 in FRA erfolgt durch Überwerfungs-Bauwerke und somit ohne Fahrstraßenkreuzungen<br />
(siehe Abb. 9).<br />
3.5.3 Betriebskonzept für den Airport-Link vom Wiesbadener Kreuz bis FRA<br />
Dem zukünftigen Fahrplankonzept der ICE-Strecke Köln - Rhein/Main liegt der "Integrale Taktfahrplan"<br />
zugrunde: Frankfurt Flughafen bildet einen Knotenbahnhof, in den fast alle Nahverkehrs-, Regional- und<br />
Fernzüge, welche diesen Bahnhof bedienen, einmal pro Stunde aus allen Richtungen kurz nacheinander in der<br />
genannten Reihenfolge einfahren und in umgekehrter Reihenfolge wieder abfahren. Dadurch entsteht ein<br />
Taktknoten, der zwischen allen hier haltenden Zügen kurze Übergangszeiten ermöglicht. Dieses Prinzip ähnelt<br />
dem luftseitigen Zeitknoten im Hub-and-Spoke-System des Flughafens Frankfurt.<br />
Der Eisenbahn-Taktknoten im Fern- und Regionalbahnhof Frankfurt Flughafen erfordert zwangsläufig, daß auch<br />
die ICE-Züge nicht über eine Stunde gleichmäßig verteilt verkehren, sondern gebündelt. Dadurch ergibt sich je<br />
Richtung jeweils ein Pulk von 4 ICE-Zügen (vgl. Kapitel 5.4).<br />
Dies bedeutet, daß jedes Gleis der ICE-Strecke in jeder Stunde durch ICE-Züge fast 20 min lang sehr stark<br />
frequentiert wird, was die Mitnutzung durch die Airport-Shuttle-Züge erschwert. In der übrigen Zeit, rund 40<br />
min je Stunde, fahren dagegen fast keine ICE-Züge - die teuer erstellte Infrastruktur liegt dann weitgehend brach<br />
und könnte durchaus von Zügen des Airport-Links genutzt werden.<br />
Der hier skizzierte Vorschlag zur Streckenführung separater Gleise des Airport-Links und zur Verknüpfung<br />
dieser Gleise mit anderen Bahnlinien stellt betrieblich ein Viergleis-System zwischen dem Wiesbadener Kreuz<br />
und dem Flughafen Frankfurt dar. Im Prinzip könnten deshalb sowohl die Airport-Shuttle- als auch die ICE-<br />
Züge beide Strecken befahren, was dazu genutzt werden kann, beide Strecken optimal auszulasten. Das bedeutet,<br />
daß <strong>einer</strong>seits ein Engpaß und andererseits auch eine mangelnde Auslastung in bestimmten Zeitabschnitten<br />
vermieden werden kann.
Für den Abschnitt vom Wiesbadener Kreuz bis zum Flughafen Frankfurt bietet sich konkret folgendes<br />
Betriebskonzept an:<br />
þ Die ICE-Züge in der Relation Köln - FRA benutzen grundsätzlich die ICE-Gleise, zumindest im Regelbetrieb.<br />
þ Die Airport-Shuttle-Züge befahren zu bestimmten Zeitabschnitten ebenfalls die ICE-Gleise, und zwar immer<br />
dann, wenn kein Pulk von ICE-Zügen verkehrt, und zu anderen Zeitabschnitten hingegen die separate Strecke.<br />
þ Die Regionalzüge der zukünftigen Relation Wiesbaden - FRA - Frankfurt benutzen grundsätzlich die<br />
separaten Gleise, da für diesen Verkehr eine Gleisverbindung auf die ICE-Strecke fehlt. Dieser Regionalzug-<br />
Verkehr findet nur in den Zeitabschnitten statt, wenn die Airport-Shuttle-Züge die ICE-Gleise benutzen.<br />
Die vorgeschlagene separate Strecke ist zwischen dem Wiesbadener Kreuz und dem Flughafen Frankfurt<br />
lediglich 160 m länger als die im Betrieb/im Bau befindliche ICE-Trasse. Da beide Streckenabschnitte für<br />
dieselbe Geschwindigkeit ausgelegt sind, bedeutet die Fahrt auf den separaten Gleisen eine vernachlässigbare<br />
Fahrzeitverlängerung von 2,5 sec.<br />
Die Nutzung von alternativen Eisenbahnstrecken durch ein und denselben Zuglauf ist gerade im Raum Frankfurt<br />
nicht außergewöhnlich. So fahren beispielsweise IC-/ICE-Züge zwischen Frankfurt Süd und Hanau wahlweise<br />
über die nordmainische oder die südmainische Bahn. Zwischen Frankfurt-Sportfeld und Frankfurt Hbf wird von<br />
den IC-/ICE-Zügen zwar meist die Strecke über Louisa benutzt, aber zeitweilig verkehren diese Züge auch auf<br />
der Alternativroute über Frankfurt-Niederrad.<br />
3.5.4 Zusätzliche Vorteile der separaten Gleise vom Wiesbadener Kreuz bis FRA<br />
Zusätzlich zu der genannten flexiblen Betriebsweise bieten die separaten Gleise vom Wiesbadener Kreuz bis<br />
FRA mehrere Vorteile gegenüber <strong>einer</strong> Lösung, bei der auf den Bau dieser Gleise verzichtet wird:<br />
þ Sprinter-ICE-Züge auf der Fahrt von Köln bzw. Düsseldorf zum Frankfurter Hauptbahnhof können auf der<br />
direkten Strecke Kelsterbach -Frankfurt-Sportfeld am Flughafen-Fernbahnhof Frankfurt vorbeifahren. Die<br />
bislang geplante Durchfahrt an der Bahnsteigkante des Flughafen-Fernbahnhofs mit 160 km/h ist wegen der<br />
Gefährdung von Fahrgästen, die zum Teil dicht gedrängt auf den Bahnsteigen stehen, kaum verantwortbar.<br />
þ Eine Regional-Schnellverbindung von Wiesbaden über den Regionalbahnhof Flughafen Frankfurt nach<br />
Frankfurt Hbf kann eingerichtet werden, ohne daß die Gleise der ICE-Strecke Köln - Frankfurt benutzt werden<br />
müssen. Eine solche Regionalverkehrs-Linie ist längst überfällig und kann dazu beitragen, die hoch belastete<br />
Autobahn A 66 zwischen Wiesbaden und Frankfurt, eine der am stärksten befahrenen Autobahnen in ganz<br />
Deutschland, spürbar zu entlasten. Zwischen dem Wiesbadener Kreuz und dem Flughafen WIE (6 km) muß sich<br />
dieser Zug allerdings die Gleise mit dem Airport- Shuttle teilen und sich hierbei dem Fahrplan des Airport-<br />
Shuttle unterordnen.<br />
þ Angesichts zu erwartender Engpässe im Flughafen-Fernbahnhof stellt die beschriebene separate Strecke eine<br />
Umleitungsmöglichkeit dar, die vor allem bei Störfällen vorteilhaft ist. In einem Fachaufsatz, der sich mit der<br />
mangelhaften Streckenkapazität der Eisenbahn-Neubaustrecke Köln -Rhein/Main auseinandersetzt, wird sogar<br />
stillschweigend von <strong>einer</strong> leistungsfähigen Umfahrungsroute des Flughafen-Fernbahnhofs ausgegangen [9].<br />
þ Der separate Streckenabschnitt von FRA bis südwestlich Kelsterbach schafft für die IC/ICE-Züge vom<br />
Flughafen-Fernbahnhof nach Mainz - Wiesbaden und nach Mainz - Koblenz - Bonn wie auch für die<br />
Gegenrichtung einen fahrplantechnisch hervorragenden Leitweg, der gravierende Betriebsprobleme beseitigt,<br />
welche beim bisherigen Konzept der DB AG unvermeidlich sind. Denn nach den DB-Plänen befahren die<br />
genannten Züge ebenfalls die ICE-Gleise, und zwar vom Flughafen Frankfurt bis zur Abzweigung der<br />
"Raunheimer Kurve". Obwohl es sich hierbei, gemessen an der gesamten ICE-Strecke von Frankfurt bis Köln,<br />
nur um ein relativ kurzes Streckenstück handelt, werden die entsprechenden Fahrplantrassen dennoch<br />
durchgängig bis Köln blockiert. Bei der nicht kreuzungsfreien Abzweigung der "Raunheimer Kurve", die<br />
ohnedies nur eingleisig ist, behindern die Züge der Fahrtrichtung Mainz sogar die aus Richtung Köln auf der<br />
Neubaustrecke verkehrenden ICE-Züge.<br />
þ Nach Plänen der DB AG soll zumindest eine ICE-T-Linie, aus Richtung München - Nürnberg - Würzburg<br />
kommend, in Frankfurt Flughafen-Fernbahnhof enden bzw. in der Gegenrichtung hier beginnen. Da in diesem<br />
Bahnhof jedoch k<strong>einer</strong>lei Wende- oder Abstellgleise vorhanden sind, müßten die betreffenden Züge im<br />
Flughafen Fernbahnhof eine sogenannte "Bahnsteigwende" machen (vgl. Kapitel 3.3.1), was aber dazu führen
würde, daß in diesem Fall eines der 4 Bahnsteiggleise relativ lange für andere Zugfahrten blockiert wäre. Die<br />
ohnedies sehr begrenzte Kapazität dieses ICE-Bahnhofs würde dadurch unzumutbar reduziert. Die einzige<br />
praktikable Alternative besteht darin, die betreffenden Zugläufe über den Flughafen-Fernbahnhof hinaus bis<br />
Wiesbaden Hbf zu verlängern. Die Voraussetzung hierfür sind ausreichende Streckenkapazitäten zwischen FRA<br />
und Wiesbaden Hbf, die nur dann gegeben sind, wenn die alternative Streckenführung vorbei an Kelsterbach zur<br />
Verfügung steht.<br />
þ Wenn die separate Strecke realisiert wird, entfällt die Notwendigkeit, bei der Abzweigung der Raunheimer<br />
Kurve nachträglich das fehlende Kreuzungsbauwerk zu schaffen wird, weil dessen Funktion vom neuen Airport-<br />
Link-Gleis aus Richtung FRA und der kreuzungsfreien Verknüpfung mit der Bahnstrecke Frankfurt - Mainz<br />
(siehe Abb. 22) übernommen wird. Dadurch werden sonst erforderliche Investitionsmittel von rund 40 Mio. DM<br />
(siehe Kapitel 8.2.1) für dieses entbehrliche Bauwerk eingespart.<br />
Angesichts des großen Mehrfach-Nutzens der skizzierten Lösung bei zugleich maßvollen Kosten (siehe Kapitel<br />
8.1) empfiehlt es sich, falls der Flughafen-Verbund WIE + FRA mit Hilfe eines Zugsystems realisiert werden<br />
sollte, von Anfang an die Raumordnungs- und Planfeststellungs-Verfahren für die zusätzliche Schienen-<br />
Infrastruktur vom Wiesbadener Kreuz bis Frankfurt Flughafen durchzuführen, selbst wenn man sich in <strong>einer</strong><br />
ersten Realisierungsstufe für die Mitnutzung der ICE-Gleise entscheiden sollte. Wegen der bereits laufenden<br />
Planungen zur Nutzung des ehemaligen Caltex-Geländes ist eine baldige Raumordnung der separaten Trasse mit<br />
anschließendem Planfeststellungsverfahren angezeigt.<br />
3.6 Maßnahmen bezüglich Luftsicherheit und Grenzschutz<br />
Beim herkömmlichen Transfer innerhalb eines Flughafens verlassen die Fluggäste, die von einem Flugzeug zum<br />
anderen umsteigen, den Sicherheitsbereich des betreffenden Airports nicht. Sofern es sich hierbei um Passagiere<br />
zwischen solchen Staaten handelt, die nicht dem Schengener Abkommen angehören, finden auch keine<br />
Grenzkontrollen statt. Aus grenzpolizeilicher Sicht findet der Transfer-Vorgang quasi in einem exterritorialen<br />
Bereich statt, der folglich vom inländischen Territorium durch bauliche Maßnahmen streng getrennt ist.<br />
Der Flughafen-Verbund WIE + FRA, bei dem zwischen beiden Flughäfen eine Distanz von rund 20 km zu<br />
überbrücken ist, muß dieselben hohen Standards bezüglich Luftsicherheit und Grenzschutz erfüllen, die heute<br />
beim Transfer innerhalb von FRA eingehalten werden. So muß beispielsweise gewährleistet sein, daß in die<br />
Shuttle-Fahrzeuge hinein weder Bomben noch Waffen gelangen können, mit denen die Besatzungen von<br />
Anschluß-Flugzeugen bedroht bzw. diese Flugzeug sogar gesprengt werden könnten. Ebenso muß verhindert<br />
werden, daß Personen während der Fahrt mit Shuttlezügen durch einen fingierten Nothalt illegal nach<br />
Deutschland einreisen oder auf diese Weise Drogen eingeschmuggelt werden.<br />
Es ist deshalb zwingend notwendig, daß alle Eisenbahn-Trassen, die fahrplanmäßig von Airport-Shuttlezügen<br />
befahren werden, beidseitig mit hohen Zäunen versehen sind und die Ein- und Ausfahrten dieser Zaunanlagen<br />
überwacht werden. Auch Durchfahrten unter Brücken müssen entsprechend gesichert sein. Dadurch erhält auch<br />
der übrige Eisenbahn-Verkehr auf den betreffenden Streckenabschnitten ein wesentlich höheres<br />
Sicherheitsniveau als heute, da die Möglichkeit für Sabotageakte - eine ständige Gefahr bei allen<br />
Eisenbahnstrecken in Deutschland - fast vollständig eliminiert wird.<br />
3.7 Shuttle-Fahrzeuge<br />
Obwohl der Haltestellenabstand zwischen den Bahnhöfen WIE und FRA T1 nur knapp 20 km beträgt, müssen<br />
die Fahrzeuge des Airport-Links aus zwei Gründen für eine relativ große Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h<br />
ausgelegt werden:<br />
þ Die Mitnutzung der ICE-Gleise erfordert ein "Mitschwimmen" mit den ICE-Zügen, die auf diesem<br />
Streckenabschnitt zum Teil Spitzengeschwindigkeiten von über 200 km/h erreichen.<br />
þ Aufgrund der sehr engen Vorgabe der Einhaltung <strong>einer</strong> MCT von 45 min sind kurze Fahrzeiten von großem<br />
Wert. Die strecken- und fahrzeugseitig mit dem Rad-Schiene-System gut beherrschbaren hohen<br />
Geschwindigkeiten von etwas über 200 km/h sollten für diesen Anwendungsfall nicht grundlos ungenutzt<br />
bleiben.<br />
Es dürfte weltweit keinen Zugtyp geben, der "von der Stange weg" für dieses sehr spezielle Einsatzfeld beschafft<br />
werden kann. Daher wird es notwendig sein, eine schon vorhandene Zugkonfiguration entsprechend zu
modifizieren, insbesondere was die Gestaltung der Passagierwaggons - relativ enge Bestuhlung und große<br />
Stehplatz-Fläche wegen der extrem kurzen Fahrzeit - und der Gepäckwaggons - Ausrüstung mit Rollenfußböden<br />
wie die Frachträume vieler Flugzeuge - betrifft. Neben ausländischen Zügen, die teilweise als Airport-Expreß<br />
konzipiert wurden (z.B. für Oslo oder Stockholm), bieten sich folgende Zugkonfigurationen von deutschen<br />
Herstellern an:<br />
þ E-Lok der Baureihe 101 plus 5 IC-Wagen incl. Steuerwagen; hierbei muß die zulässige<br />
Höchstgeschwindigkeit auf 220 km/h erhöht werden; die Waggon-Inneneinrichtung ist den Erfordernissen des<br />
Airport-Shuttle-Verkehrs anzupassen<br />
þ Triebwagenzüge der Baureihen 424 bis 426, aber mit veränderter Inneneinrichtung und größerer<br />
Höchstgeschwindigkeit (220 km/h statt 160 km/h).<br />
Beide Zugtypen sind sehr stark motorisiert und für den vorliegenden Einsatzzweck nach entsprechender<br />
Modifikation prinzipiell geeignet.<br />
Die zu bewältigen Verkehrsmengen bzgl. Personen und Gepäck sind zwar nicht unerheblich, gemessen am<br />
"Massenverkehrsmittel" Eisenbahn aber trotzdem eher gering. So bedeutet die in Kapitel 2.7.1 ermittelte<br />
absolute Spitzenlast ein Fahrgastaufkommen von 153 Personen und 230 Gepäckstücken pro Zug. Für diese<br />
Gepäckmenge genügen 8 Gepäck-Container, ohne daß diese ganz gefüllt sind. Wenn man davon ausgeht, daß für<br />
den eigentlichen Shuttle-Verkehr nur 3 Personenwaggons und 2 Gepäckwaggons benötigt werden, so bleiben<br />
noch zusätzliche Kapazitäten für andere Passagierbewegungen (vgl. Abb. 1a) frei, beispielsweise für Fluggäste,<br />
die in WIE einchecken und in FRA abfliegen, sowie für Frachttransport.<br />
4. Infrastruktur und Fahrzeuge beim Bus-System<br />
4.1 Terminal Wiesbaden-Erbenheim<br />
Vom Typus her entsprechen die Passagierabfertigungsanlagen in Wiesbaden-Erbenheim einem Zentralterminal<br />
mit einem luftseitigen Satelliten. Ziel dieser Anlage ist es, die internen Wege für die Umsteigebeziehung zum<br />
Flughafen Frankfurt auf ein Minimum zu verkürzen.<br />
Lage des Zentralterminals<br />
Das Zentral-Terminal Wiesbaden-Erbenheim wird beim Bus-System ebenso wie das Terminal beim Zugsystem<br />
nördlich der bestehenden Start- und Landebahn (SLB) und südlich der bestehenden Autobahn A 66 und der im<br />
Bau befindlichen ICE-Strecke Wiesbaden - Köln angeordnet. Dadurch befindet sich das Passagierterminal, für<br />
Originärpassagiere optimal, in direkter Nähe sowohl zur ICE-Strecke, die zu diesem Zweck einen Fern- und<br />
Regionalbahnhof Wiesbaden-Erbenheim erhält (vgl. Kapitel 3.2) als auch zur AB A66 mit den beiden<br />
Anschlußstellen Wiesbaden-Erbenheim und Wiesbaden-Nordenstadt (siehe Abb. 25).<br />
Die Lage des Zentralterminals und sein umgebendes Vorfeld wurde den örtlichen Gegebenheiten der<br />
vorhandenen Bahntrassierung und dem Bogen der Autobahn angepaßt. Dadurch kommt es zu <strong>einer</strong><br />
Verschiebung des Vorfeldes um ca. 300 m nach Westen, verglichen mit dem von der FAG auf der Südseite des<br />
Flughafen-Geländes WIE vorgeschlagenen Standort des Vorfeldes. Grundsätzlich kann festgestellt werden, daß<br />
sich die geplante Terminalkonfiguration in dieser Form auch auf der Südseite der SLB verwirklichen läßt, wobei<br />
allerdings einige Gebäude der heutigen US-Airbase abgerissen werden müßten.<br />
Die Entscheidung für die nördliche Lage des Terminals wird mit der Nähe zu den bestehenden Fahrtrassen und<br />
räumlich weniger problematischen Einbindung begründet.<br />
Konfiguration des Zentralterminals<br />
Das Zentralterminal hat als alleinige Aufgabe die Abfertigung von Passagieren, welche ihre Reise in Wiesbaden<br />
beginnen oder beenden (Originärpassagiere). Das Terminal wurde in s<strong>einer</strong> Passagierfunktion als Ein-Ebenen-<br />
Terminal geplant. Es wurde in der Planung bautechnisch auf den Lärmschutzwall der ICE-Trasse aufgesattelt,<br />
um aufwendige Umbau- und Tiefbaumaßnahmen an dieser kurz vor der Fertigstellung stehenden Bahnstrecke zu
vermeiden. Dadurch befindet sich die Vorfahrt und die Abfertigungsebene auf +1. Auf der Luftseite kann somit<br />
das Erdgeschoß für eine Gepäcksortieranlage und weitere Technikbereiche genutzt werden.<br />
Die Abfertigungsebene (+1) beinhaltet die Anbindung an das Straßennetz, die Terminalvorfahrt, die landseitigen<br />
Abfertigungsbereiche und die luftseitigen Passagierbereiche. Die maximalen Wegestrecken für die Passagiere im<br />
Terminal betragen 200 m. Transferpassagiere durchlaufen das Zentralterminal grundsätzlich nicht, sondern nur<br />
einen auf dem Vorfeld befindliche Satelliten, der unten näher beschrieben wird.<br />
Auf der Ebene 0 des Zentralterminals sind der Fernbahnhof mit 420 m Länge und 4 Gleisen, die<br />
Technikbeteiche, die Gepäcksortierbereiche, eventuell erforderliche Busgates, Teile der Vorfelddienste und eine<br />
gebäudenahe Vorfeldstraße untergebracht. Ein Tiefgeschoß wird bei der vorgeschlagenen Konfiguration mit<br />
großer Wahrscheinlichkeit nicht notwendig werden.<br />
Auf eine detailliertere Beschreibung bezüglich Aufbau und Funktionskonzept des Zentralterminals wird hier<br />
verzichtet, da dies nicht Bestandteil der vorliegenden Aufgabenstellung ist. Zur Veranschaulichung kann jedoch<br />
das ähnlich konzipierte Zentralterminal Stansted bei London dienen.<br />
Verknüpfung von Zentralterminal und Vorfeld-Satellit<br />
Der Satellit auf dem Vorfeld kann durch eine der folgenden Lösungen an das Terminal angeschlossen werden:<br />
þ ein Passagier- und Gepäcktunnel mit Lauf- und Transportbändern<br />
þ ein APM (automatic people mover), ebenfalls unterirdisch<br />
þ ein Bus-Shuttle-Verkehr über das Vorfeld und somit ebenerdig<br />
þ ein Verbindungsgang mit Laufbändern und Gepäcktransportbändern auf Niveau +1, mit Vorfeldfahrzeugen<br />
unterfahrbar<br />
þ ein APM oder Rollbänder auf <strong>einer</strong> Brückenkonstruktion, die eine ausreichende lichte Höhe besitzt, damit sie<br />
von Flugzeugen unterfahren werden kann.<br />
Welche dieser 5 Varianten tatsächlich am geeignetsten ist, kann erst durch eine detaillierte Studie geklärt<br />
werden, bei der auch Fragen der Wirtschaftlichkeit und Störfall-Resistenz dieser Terminal-Verknüpfung zu<br />
berücksichtigen sind.<br />
Vorfeld-Satellit<br />
Ausschlaggebend für die Realisierbarkeit des Flughafen-Standorts Wiesbaden-Erbenheim ist seine<br />
Umsteigebeziehung zum Flughafen Frankfurt, welche für die Spitzenlastfälle eine MCT von 45 min garantieren<br />
soll. Dementsprechend wurde bei dem luftseitigen Satelliten ein hochverdichtetes Logistikkonzept<br />
vorgeschlagen. Grundsätzlich basiert das Konzept auf <strong>einer</strong> zeitlich und distanztechnisch kurzen Abfertigung in<br />
Wiesbaden, wobei Passagiere und Gepäck zwischen den beiden Flughäfen in getrennten Fahrzeugen befördert<br />
werden.<br />
In der Spitzenstunde werden in Wiesbaden laut Prognoseflugplan 20 Flugzeuge der Kategorien B, C und D<br />
abgefertigt (minimaler Stellplatzbedarf). Von diesen 20 Flugzeugen können zwei (Kategorie B) grundsätzlich<br />
nicht über Fluggastbrücken abgefertigt werden, da ihre Einstiegshöhe zu gering ist. Ebenso ist zu erwarten, daß<br />
u.U. einige Flugzeuge der Kategorie C aus demselben Grund nicht über Fluggastbrücken angedient werden<br />
können. Für die Konzeption des Satelliten wurde somit festgelegt, daß keine Flugzeuge der Kategorie B auf<br />
einem Stellplatz am Satelliten abgefertigt werden sollen, aber alle Flugzeuge der Kategorie C und D.<br />
Die meisten dieser 18 Flugzeuge der Kategorien C und D werden mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb <strong>einer</strong><br />
Umkehrzeit von 45 bis 60 min den Flughafen wieder verlassen. Einige dieser Flugzeuge können aber auch länger<br />
am Flughafen verbleiben und erhöhen somit den minimalen Stellplatzbedarf. Aufgrund des vorliegenden<br />
Prognoseflugplans (unverketteter Flugplan) konnte nur unzureichend auf diesen erhöhten Bedarf geschlossen<br />
werden. Laut Aussage der FAG sind aber im vorliegenden Szenario die notwendigen Reserven an zusätzlichen<br />
Stellplätzen bereits enthalten. Aus diesem Grund werden als Sicherheitsreserve nur zwei weitere Gebäude-<br />
Positionen angesetzt. Dabei wird unterstellt, daß bei längeren Standzeiten (ab 2 h) diese Flugzeuge
zwischenzeitlich auf eine Vorfeldposition und kurz vor dem Abflug wieder an das Gebäude geschleppt werden.<br />
Dieser Vorgang ist auch am Frankfurter Flughafen gängige Praxis.<br />
Die Anzahl der direkt an Fluggastbrücken abzufertigenden Flugzeuge beträgt somit 20. Für den Bereich des<br />
Vorfeldes wurden größere Reserven vorgesehen, um dem Aspekt des Langzeitparkens und/oder Übernachtens<br />
von Flugzeugen Rechnung zu tragen. Wichtig bei der vorgeschlagenen Lösung ist jedoch, daß weitgehend alle<br />
Flugzeuge am Satelliten abgefertigt werden können.<br />
In der vorliegenden Planung können 12 Flugzeuge der Kategorien C und 8 der Kategorie D am Satelliten<br />
andocken. Dies garantiert weitgehende Flexibilität bei der Vergabe der einzelnen Gates im Tagesverlauf. Bei<br />
einem weiteren Verkehrswachstum kann der Satellit im Vorfeld linear erweitert werden. Rechts und links des<br />
Satelliten sind 12 mittelgroße und 12 kleine Vorfeldpositionen geplant, welche in dieser Anzahl jedoch,<br />
gemessen an dem vorliegenden Prognoseflugplan, nicht benötigt werden. Auch hierbei wurde eine spätere<br />
Erweiterung berücksichtigt. Die Konfiguration des Satelliten kann der Abb. 26 und 27 entnommen werden.<br />
Passagierabfertigung im Vorfeld-Satelliten<br />
Der Satellit ist in drei Ebenen unterteilt. Im Obergeschoß (+4,70m, Länge 270 m, Breite 74 m) befinden sich die<br />
Passagierbereiche, getrennt nach Schengen-und Non-Schengen-Fluggästen. Von innen nach außen ist diese<br />
Ebene in folgende Zonen eingeteilt:<br />
þ Anbindung an das Zentralterminal, Transferbereich (Wartebereich für den Bus-Shuttle nach Frankfurt),<br />
Bereich für Grenz- und Zollkontrolle sowie Infopunkte<br />
þ Servicebereich (Retail, WC, Service, Büroräume) und Auf- und Abgänge vom / zum Bus-Shuttle-Halt<br />
þ Abflugbereich (Wartezonen getrennt nach Schengen- und Non-Schengen-Bereichen, davon 4 Bereiche als<br />
Swinggates, Boardkartenkontrolle)<br />
Von den insgesamt 20 Gates werden 16 Gates, die fest zum Schengen- oder zum Non-Schengen-Bereich<br />
zugeordnet sind, als Großwarteraum ohne weitere Unterteilung ausgebildet. Die restlichen 4 Gates werden an der<br />
Grenze von Schengen zu Non-Schengen als sogenannte Swinggates konzipiert, um einem unterschiedlichen<br />
Bedarf im Tagesverlauf gerecht werden zu können. Diese Swinggates können einzeln je nach Anforderung<br />
entweder dem Schengen- oder dem Non-Schengen-Bereich zugeordnet gemacht werden.<br />
Der Abflugbereich befindet sich mit den Schaltern für die Boardkartenkontrolle direkt hinter der Fassade. Die in<br />
solitären Baukörpern untergebrachten Teilbereiche Retail, Service und WC trennen optisch den Abflugbereich<br />
vom innenliegenden Transferbereich (Buswartezone). Die Mitte des Satelliten ist gekennzeichnet durch den<br />
Transferbereich (Buswartezone) mit den Zugängen zu den Busstationen, durch die Paßkontrollen als Trennung<br />
zwischen Schengen und Non-Schengen, durch die zentralen Infopunkte und die zentrale Haupterschließung zum<br />
Zentralterminal.<br />
4.2 Anpassung der Terminals im Flughafen Frankfurt<br />
Im Flughafen Frankfurt selbst sind bezüglich des Bus-Systems nur relativ geringfügige Maßnahmen zur<br />
Anpassung der Anlagen durchzuführen. Diese betreffen ausschließlich die Zugänge zu den Gebäude-Positionen<br />
vom Vorfeld aus. Da die Shuttlebusse von bzw. nach WIE direkt an das Flugzeug heranfahren, muß an jeder<br />
Position die Möglichkeit gegeben sein, daß der Passagier von der Vorfeldebene aus das Flugzeug erreicht. Bei<br />
Vorfeldpositionen ist dies unproblematisch, da hier der Passagier ohnehin über Flugzeugbrücken zur Flugzeugtür<br />
gelangt. An den Terminals sind nicht alle Brücken mit Treppen zum Vorfeld versehen. Im Terminal T2 können<br />
zwar sämtliche Fluggastbrücken vom Vorfeld aus erreicht werden, aber im Terminal 1 ist dies nicht immer der<br />
Fall. Daher müssen hier entweder die Brücken modifiziert werden, oder es müssen innerhalb des Gebäudes, in<br />
relativer Nähe zur Position, Aufgänge zum Gate geschaffen werden.<br />
Alle übrigen Anlagen in FRA sind von der Bus-Lösung nicht betroffen, da die Passagiere die Terminals hier<br />
nicht weiter nutzen und das Fluggepäck die GFA in FRA nicht durchläuft.<br />
4.3 Busstrecke zwischen WIE und FRA
4.3.1 Zur Frage der Mitnutzung der bestehenden Straßen-Infrastruktur<br />
Wie zuvor beim Zugssystem stellt sich auch beim Bus-System die Frage, ob für diese Variante des Airport-Links<br />
prinzipiell die vorhandene Infrastruktur genutzt werden kann oder ob eine separate Bus-Straße geschaffen<br />
werden muß.<br />
Der Vorteil <strong>einer</strong> Mitnutzung der bestehenden Straßen und Autobahnen zwischen WIE und FRA liegt darin, daß<br />
keine Investitionen für eine eigene Bus-Infrastruktur außerhalb des Flughafen-Geländes in WIE und FRA<br />
getätigt werden müssen, was zu <strong>einer</strong> Reduktion der Kosten führt und die Zeit bis zur Inbetriebnahme des<br />
Airport-Links verkürzt.<br />
Doch dieser Vorteil wird mit <strong>einer</strong> Fülle von Nachteilen gegenüber <strong>einer</strong> separaten Bus-Straße erkauft, die im<br />
folgenden genannt werden:<br />
þ Da die Shuttle-Busse öffentliche Straßen benutzen, ist ihre zulässige Geschwindigkeit laut StVO auf 100 km/h<br />
begrenzt. Bei <strong>einer</strong> völlig eigenständigen Bus-Trasse hingegen, die eine flughafen-interne Privatstraße<br />
dargestellt, kann eine Ausnahme von der StVO erwirkt werden, so daß eine höhere Maximalgeschwindigkeit<br />
zugrunde gelegt werden kann (siehe Kapitel 4.4). Aus diesem Grunde bedeutet die Mitnutzung der vorhandenen<br />
Infrastruktur zwangsläufig eine längere Fahrzeit als das Befahren <strong>einer</strong> separaten Bus-Trasse.<br />
þ Verglichen mit einem eigenen Bus-Fahrweg zwischen WIE und FRA, bedeutet das Befahren der bestehenden<br />
Straßen und Autobahnen systembedingt eine Fahrzeitverlängerung, da sich die Shuttlebusse an der Autobahn-<br />
Anschlußstelle in WIE bzw. FRA mit relativ langsamer Geschwindigkeit in den Autobahn-Verkehr einfädeln,<br />
am Wiesbadener Kreuz von der A 66 auf die A 3 oder umgekehrt -wieder mit reduzierter Geschwindigkeit -<br />
überwechseln und schließlich an der Anschlußstelle des anderen Flughafens - ebenfalls mit geringerer<br />
Geschwindigkeit - aus der Autobahn ausfahren. Derartige Geschwindigkeitseinbrüche entfallen jedoch, wenn für<br />
die Busse eine eigene Trasse geschaffen wird.<br />
þ Die Airport-Shuttle-Busse "schwimmen" im Verkehr der A 66 und A 3 mit, so daß ihre Geschwindigkeit<br />
ebenso hoch oder niedrig ist wie die Geschwindigkeit der übrigen Fahrzeuge. Das bedeutet, daß bei hohem<br />
Verkehrsaufkommen, wie dies morgens und am Spätnachmittag werktäglich die Regel ist, zeitweise nur<br />
Schrittgeschwindigkeit erreicht wird bzw. ein Stau eintritt. Da die A 66 zwischen Wiesbaden und Frankfurt als<br />
eine der am stärksten belasteten Autobahnen in ganz Deutschland gilt, ist mit <strong>einer</strong> erheblichen<br />
Fahrzeitverlängerung, verglichen mit der Benutzung <strong>einer</strong> eigenen Bus-Straße zwischen WIE und FRA, zu<br />
rechnen.<br />
þ Auf den Autobahnen A 66 und A 3 besteht generell eine hohe Staugefahr durch Unfälle und liegen gebliebene<br />
Fahrzeuge. Dadurch ist die Fahrzeit der Shuttlebusse nicht exakt kalkulierbar. Damit die möglichen Zeitverluste<br />
durch Stauungen nicht sofort zu Verspätungen führen, muß der Fahrplan dieser Busse generell einen relativ<br />
großen Zeitzuschlag für den Fall von Staus enthalten. Dadurch verlängert sich die Transferzeit im Flughafen-<br />
Verbund WIE + FRA entsprechend.<br />
þ Wie beim schienengebundenen Airport-Link gelten auch beim Shuttle-Verkehr per Bus bezüglich<br />
Luftsicherheit und Grenzschutz dieselben strengen Bedingungen. Deshalb muß sicher verhindert werden, daß<br />
Bomben oder Waffen in einen Shuttlebus gelangen, daß Personen illegal nach Deutschland einreisen oder daß<br />
Drogen in das deutsche Territorium geschmuggelt werden. Beispielsweise wäre es durch einen fingierten Nothalt<br />
auf der Autobahn-Standspur, wo ein anderes Fahrzeug mit Komplizen bereitstünde, leicht möglich, derartige<br />
Handlungen vorzunehmen, welche die Sicherheit des Luftverkehrs gefährden und die Grenzen Deutschlands<br />
bzw. der Schengen-Staaten verletzen würden. Da bei <strong>einer</strong> Mitnutzung des bestehenden Straßennetzes eine<br />
Abschirmung des Shuttle-Verkehrs vom übrigen Straßenverkehr undurchführbar ist, scheidet diese Variante des<br />
Airport-Links sogar grundsätzlich aus.<br />
Auch die in der Mediationsgruppe bereits diskutierte Reservierung der Standspuren auf den Autobahnen A 66<br />
und A 3 für den Shuttle-Verkehr kommt aus dem zuletzt genannten Grund nicht in Frage. Hinzu kommen zwei<br />
weitere Ausschlußgründe:<br />
þ Der Zweck der Standspuren besteht darin, daß defekte Fahrzeuge, vor allem Pkws, vorübergehend abgestellt<br />
werden können, bis sie entweder repariert oder abgeschleppt sind, ohne die regulären Fahrspuren zu blockieren.<br />
Bei <strong>einer</strong> Umwidmung der Standspuren zu Busspuren für den Airport-Link müßten entweder als Ersatz neue<br />
Standspuren angelegt werden oder man müßte in Kauf nehmen, daß liegengebliebene Autos den nachfolgenden<br />
Verkehr äußerst stark behindern.
þ Die Standspuren haben, da sie nicht für fahrende, sondern nur für stehende Kraftfahrzeuge konzipiert sind,<br />
eine geringere Breite als die eigentlichen Fahrspuren. So hat jede Fahrspur <strong>einer</strong> 6-spurigen Autobahn laut RAS-<br />
Q [10] eine Breite von 3,75 m, während die Breite der Standspur nur 2,50 m beträgt. Busse mit <strong>einer</strong><br />
Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h wären somit die Standspuren zu schmal, zumal Busse ohnehin schon 2,50<br />
m breit sind.<br />
þ Bei Unfällen auf Autobahnen, bekanntlich ein häufig auftretendes Ereignis, dient die Standspur vielfach zur<br />
behelfsmäßigen Umleitung des übrigen Verkehrs vorbei an der Unfallstelle, sofern die Unfallautos nicht auch die<br />
Standspur blockieren. Somit scheidet das Befahren der Standspuren durch die Shuttlebusse immer dann aus,<br />
wenn sich ein derartiger Unfall ereignet hat, so daß diese Busse wie die übrigen Fahrzeuge in einen Verkehrsstau<br />
geraten, der fast zwangsläufig bei Unfällen auf der Autobahn entsteht.<br />
Als Ergebnis ist festzuhalten, daß der Airport-Link per Bus nur dann realisierbar ist, wenn eine separate Bus-<br />
Straße realisiert wird, die aus Gründen der Luftsicherheit und des Grenzschutzes eingezäunt sein und überwacht<br />
werden muß (vgl. Kapitel 3.6).<br />
4.3.2 Streckenführung der separaten Bus-Straße von WIE bis FRA<br />
Vom Flughafen Wiesbaden-Erbenheim aus betrachtet, verläßt die Bus-Straße das Flughafen-Vorfeld in östlicher<br />
Richtung rund 1,2 km westlich der AS Wiesbaden-Nordenstadt, quert auf <strong>einer</strong> Brücke den Wiesbadener Ast der<br />
ICE-Strecke Köln-Rhein/Main und folgt zunächst der A 66 und ab dem Wiesbadener Kreuz der A 3 in enger<br />
Trassenbündelung auf der Südseite dieser Autobahnen (siehe Abb. 29 und 30). Sämtliche kreuzenden Wege,<br />
Straßen und Bahnstrecken werden auf Brücken überquert oder durch Unterführungen unterfahren. Ebenso sind<br />
alle Einmündungen in die Bus-Trasse bzw. alle Abzweigungen von ihr kreuzungsfrei.<br />
Die Busstraße mündet in das westliche Vorfeld des Terminals 1 (Zone 3) genauso, wie dies schon in Kapitel<br />
3.3.4 unter "Bau <strong>einer</strong> kreuzungsfreien Straße vom Terminal 1 in das westliche Vorfeld" beschrieben ist.<br />
Die Bus-Fahrbahn ist nach Verlassen des Vorfeldes WIE für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h<br />
ausgelegt. Ungefähr ab der AS Wiesbaden-Nordenstadt beträgt die Höchstgeschwindigkeit 120 km/h, bis sich<br />
diese separate Straße in Richtung Zone 1 und Zone 2 (vgl. Kapitel 4.2) verzweigt (siehe Abb. 31). Auf dem<br />
Streckenast zur Zone 3 ist wegen enger Kurvenradien und der Trassenführung im Tunnel die Geschwindigkeit<br />
auf 50 bzw. 25 km/h begrenzt.<br />
Der Streckenast zur Zone Y kreuzt auf Brücken die A 3 und die B 43 und folgt der B 43 auf deren Nordseite<br />
ebenerdig (siehe Abb. 31). Dieser Abschnitt ist für eine Geschwindigkeit von 80 km/h ausgelegt. Anschließend<br />
biegt die Bus-Trasse nach Süden ab, quert auf Brücken die B 43 sowie die A 3 und verläuft weiterhin als<br />
Brücken-Trasse über der Straßenzufahrt zum Tor 3 des Flughafens Frankfurt. Mit engen Kurven, die nur noch 25<br />
km/h erlauben, führt die Bus-Straße an Gebäude 183 vorbei und erreicht neben diesem Gebäude schließlich den<br />
Flugsteig C.<br />
Angesichts der hohen Zahl von Fahrzeugen für den Passagier- und Gepäcktransport ist damit zu rechnen, daß<br />
immer wieder ein Fahrzeug auf der Strecke zwischen WIE und FRA wegen eines technischen Defekts liegen<br />
bleibt und daß es zuweilen sogar zu Auffahrunfällen kommt. Um zu verhindern, daß in solchen Fällen der<br />
gesamte Airport-Link, zumindest in <strong>einer</strong> Richtung, kollabiert, muß an jedem Punkt der Bus-Straße die<br />
Möglichkeit bestehen, ein solches Hindernis zu umfahren. Aus diesem Grunde wird die Fahrbahn 2 Fahrspuren<br />
von je 3,75 m Breite sowie auf beiden Seiten einen befestigten Streifen von je 1,75 m Breite umfassen. Unter<br />
Mitnutzung dieses Seitenstreifens und geringer Inanspruchnahme der Gegenfahrbahn können liegengebliebene<br />
Fahrzeuge oder auch andere Hindernisse umfahren werden.<br />
4.4 Shuttle-Fahrzeuge<br />
Für den Airport-Link werden separate Fahrzeuge zur Gepäck- und zur Personen-Beförderung benötigt.<br />
Shuttle-Fahrzeuge zur Gepäckbeförderung<br />
Die einzusetzenden Gepäck-Fahrzeuge sollen entweder bis zu 2 Gepäck-Container bzw. die entsprechende<br />
Menge an Einzel-Gepäckstücken oder bis zu 4 Gepäck-Container aufnehmen können. Somit werden Fahrzeuge
in zwei unterschiedlichen Größen benötigt: zum einen herkömmliche Kleintransporter und zum anderen um<br />
etwas größere Transport-Fahrzeuge, die quasi Omnibusse ohne Sitze darstellen. In beiden Fällen müssen die<br />
Fahrzeuge entsprechend den Erfordernissen des Airport-Links modifiziert werden. Insbesondere benötigen sie<br />
große Schiebetüren, Hubbühnen zum Verladen der Gepäck-Container und Rollen-Fußböden. Die<br />
Höchstgeschwindigkeit dieser Gepäck-Fahrzeuge wird mit 120 km/h wie bei den Shuttle-Fahrzeugen zur<br />
Personenbeförderung (siehe unten) angesetzt.<br />
Shuttle-Fahrzeuge zur Personenbeförderung<br />
Aufgrund der schwankenden Anzahl an Transfer-Passagieren pro Fahrt sind Busse in zwei Größen sinnvoll:<br />
þ Busse mit 20 Sitzplätzen<br />
þ Busse mit 45 Sitzplätzen.<br />
Hierbei wird der Anteil der Busse mit größerer Kapazität rund 1/3 haben.<br />
Um die geforderte MCT von 45 einhalten zu können, muß die Fahrzeit der Shuttle-Fahrzeuge möglichst kurz<br />
sein. Für den Airport-Link werden deshalb sowohl Personen- als auch Gepäckfahrzeuge benötigt, die eine relativ<br />
hohe Geschwindigkeit erreichen, welche höher als die laut StVO zulässige Geschwindigkeit von 100 km/h für<br />
Busse ist. Da zwischen WIE und FRA nur eine quasi flughafen-interne Privatstraße in Frage kommt (vgl. Kapitel<br />
4.3.1), kann eine Ausnahme von der StVO erwirkt werden. Nach den Angaben von Omnibus-Herstellern liegt<br />
die technisch mögliche Höchstgeschwindigkeit von Reisebussen bei 130 km/h. Diese technische Obergrenze<br />
sollte beim Dauerbetrieb des Airport-Links zwischen WIE und FRA nicht ausgeschöpft werden. Deshalb wird<br />
für den Regelbetrieb die Geschwindigkeit aller Shuttle-Fahrzeuge mit 120 km/h angesetzt.<br />
4.5 Zur Frage "Bus-System oder Light-Rail-System"<br />
Prinzipiell ist es denkbar, anstelle von Bussen auch schienengebundene Fahrzeuge einzusetzen, die sich von<br />
herkömmlichen Eisenbahnzügen und auch von den Fahrzeugen des vorgeschlagenen Zugsystems durch<br />
Leichtbau und durch das Triebwagen-Prinzip auszeichnen. Solche Light-Rail-Fahrzeuge ähneln mehr<br />
Omnibussen als Eisenbahnzügen, aber verkehren dennoch auf Schienen. Straßenbahnen, Stadtbahnen und U-<br />
Bahnen sind nach dem Regelwerk BoStrab (Betriebsordnung Straßenbahn) und nicht nach der EBO (Eisenbahn-<br />
Bau und Betriebsordnung) ausgerichtet und werden im angelsächsischen Sprachraum sehr treffend als "Light<br />
Rail" bezeichnet.<br />
Aufgrund ihrer Spurführung eignen sie sich zum einen für fahrerlosen Betrieb, sofern sie auf eigenen Trassen<br />
verkehren, wie das Beispiel der Dockland Light Railway in London zeigt, und zum anderen lassen sie aufgrund<br />
ihrer Konstruktion höhere Geschwindigkeiten als Omnibusse zu. Die BoStrab legt keine Höchstgeschwindigkeit<br />
fest, allerdings wird ein signalisierter Betrieb (d.h. Fahren nicht auf Sicht) bei Geschwindigkeiten von über 70<br />
km/h vorgeschrieben.<br />
Bei einem Light-Rail-System besteht die Möglichkeit, die Fahrzeit zwischen WIE und FRA im Vergleich zum<br />
reinen Bus-System zu verkürzen und durch den automatischen Betrieb Personalkosten einzusparen. Außerdem<br />
lassen sich bei großem Passagieraufkommen mehrere Fahrzeuge zu einem Zug zusammenkuppeln, so daß bei<br />
gleicher Fahrzeug-Folgezeit die Streckenkapazität erhöht wird.<br />
Man kann davon ausgehen, daß ein solches Light-Rail-System, anders als heutige Straßenbahnen, bezüglich der<br />
Energieversorgung nicht auf Oberleitungen angewiesen ist, zumindest nicht auf den beiden Flughafen-<br />
Vorfeldern in WIE und FRA, wo sonst ein Konflikt zwischen den Fahrdrähten und den Bodenbewegungen der<br />
Flugzeuge entstehen würde. Es bietet sich an, zwar die freie Strecke mit Oberleitungen auszustatten, aber zur<br />
Energieversorgung der Fahrzeuge auf den Vorfeldern Schwungradspeicher zu verwenden, die während der Fahrt<br />
quasi aufgeladen werden. Derartige Fahrzeuge können als Stand der Technik betrachtet werden.<br />
Noch nicht ganz einsatzreif, insbesondere hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, ist der elektrischer Antrieb durch<br />
Wasserstoff-Brennstoffzellen, die an Bord mitgeführt werden. Doch da der Zeithorizont für die mögliche<br />
Realisierung des Airport-Links ohnedies beim Jahr 2015 liegt, kann man davon ausgehen, daß dieser innovative<br />
Antrieb bis zu diesem Zeitpunkt serienmäßig bei Straßen- und Schienenfahrzeugen zum Einsatz kommt.<br />
Doch ein solches Light-Rail-System hat gegenüber Shuttlebussen erhebliche Nachteile:
þ Sowohl auf dem Vorfeld von WIE als auch von FRA müssen straßenbahn-artige Gleise verlegt werden. Dies<br />
stellt in WIE, wo das Vorfeld ganz neu gebaut werden muß, kein unüberwindbares Problem dar, aber in FRA<br />
müßten gewaltige Umbaumaßnahmen im Vorfeld stattfinden.<br />
þ Die Investitionskosten für einen Schienen-Fahrweg sind generell höher als für eine entsprechende Straße.<br />
þ Die aufgrund der Passagierströme zwischen WIE und FRA benötigten Fahrzeuge mit bis zu 45 Sitzen sind<br />
wesentlich kl<strong>einer</strong> als das Fassungsvermögen von typischen Light-Rail-Fahrzeugen, zu denen insbesondere<br />
moderne Straßenbahn-und Stadtbahnzüge mit einem Fassungsvermögen von rund 100 bis 150 Personen zu<br />
rechnen sind. Ein wirtschaftlicher Fahrzeug-Einsatz wäre angesichts der geringen Zahl von Fluggästen, die pro<br />
Fahrt zu befördern sind, somit nicht realisierbar. Aus diesem Grund müßten wesentlich kl<strong>einer</strong>e<br />
Schienenfahrzeuge, die ungefähr die Kapazität der genannten Busse haben, eingesetzt werden. Dies wären<br />
voraussichtlich Sonderkonstruktionen mit nur kleinen Stückzahlen.<br />
Aus den genannten Gründen ist deshalb ein Light-Rail-System als Alternative zum Bus-System vermutlich<br />
weniger geeignet.<br />
5. Fahrzeit und Fahrzeug-Folgezeit beim Zug- und beim Bus-System<br />
5.1 Zugsystem<br />
5.1.1 Randbedingungen und Methodik der Fahrzeitberechnung<br />
Der Berechnung der Fahrzeit zwischen den Shuttle-Bahnhöfen in WIE und FRA lagen folgende<br />
Randbedingungen und Prämissen zugrunde:<br />
Die Streckenlänge vom Shuttle-Bahnhof WIE bis zum Shuttle-Bahnhof T1 in FRA beträgt 19,9 km. Im Bahnhof<br />
T1 findet ein Zwischenhalt mit <strong>einer</strong> Zeitdauer von 75 sec statt. Es schließt sich noch eine Fahrtstrecke von 0,9<br />
km zum Shuttle-Bahnhof T2 an.<br />
Zur Fahrzeitberechnung für den Airport-Link wurde ein Zug unterstellt, der aus 5 IC-Waggons besteht und mit<br />
<strong>einer</strong> E-Lok der Baureihe 101 bespannt ist (vgl. Kapitel 3.6). Die Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges wurde<br />
mit 220 km/h und die Anfangsbeschleunigung wie auch die Bremsverzögerung mit 0,85 m/s2 festgesetzt.<br />
Die technisch mögliche Fahrzeit zwischen zwei benachbarten Bahnhöfen wurde um einen Fahrzeit-Zuschlag von<br />
12% erhöht, damit Verspätungen bei der Abfahrt im Startbahnhof sowie zeitweilige<br />
Geschwindigkeitsbeschränkungen aufgrund von Baustellen an den Gleisen nicht zu <strong>einer</strong> verspäteten Ankunft<br />
am Zielbahnhof führen. Dieser Zuschlag gilt nicht für die Haltezeit im Zwischenbahnhof T1.<br />
Die Fahrzeiten wurden mit Hilfe von Fahrsimulationen per Computer bestimmt. In diese Simulation gingen die<br />
technischen Daten des Shuttlezuges (Leistung, Masse, Luftwiderstandsbeiwert usw.) sowie die Daten der Strecke<br />
(Länge, zulässige Geschwindigkeit an jedem Punkt der Strecke, Steigungen, Kurvenradien usw.) ein. Hierbei<br />
wurden auch Details wie der Luftdruck abhängig von der Meereshöhe berücksichtigt.<br />
5.1.2 Ergebnis der Fahrzeitberechnung<br />
Die computergestützten Simulationen von Fahrten des Shuttlezuges erbrachten die in der Tab. 1 dargestellten<br />
Fahrzeiten:<br />
Tab. 1: Fahrzeiten des Airport-Links (in Minuten'Sekunden")<br />
technisch Fahrzeit<br />
mögliche incl. 12%<br />
Fahrzeit Zuschlag<br />
Fahrzeit von WIE nach FRA T1: 7'08" 8'00"<br />
Fahrzeit von FRA T1 nach T2: 1'10" 1'18"
Haltezeit in T1: 1'15" 1'15"<br />
Fahrzeit von WIE nach FRA T2: 9'33" 10'33"<br />
Fahrzeit von FRA T2 nach T1: 1'10" 1'18"<br />
Fahrzeit von FRA T1 nach WIE: 7'00" 7'50"<br />
Haltezeit in T1: 1'15" 1'15"<br />
Fahrzeit von FRA T2 nach WIE: 7'25" 10'23"<br />
Somit liegt die Fahrzeit im Airport-Link zwischen Wiesbaden-Erbenheim und dem Terminal 1 des Flughafens<br />
Frankfurt nicht wesentlich über der Fahrzeit der Sky Line innerhalb des Flughafens Frankfurt von Terminal 1 zu<br />
Terminal 2. Denn die Sky-Line-Fahrzeit beträgt von der Haltestelle A zur Endhaltestelle D/E rund 4 min 20 sec<br />
und in der Gegenrichtung fast 5 min. Die Gesamtfahrzeit vom Endbahnhof WIE zum Endbahnhof T2 und<br />
umgekehrt ist mit rund 10 min 30 sec gut doppelt so groß wie die Sky-Line-Fahrzeit.<br />
5.1.3 Zugfolgezeit<br />
Was den Zeitbedarf für die Zugfahrt von WIE bis FRA und umgekehrt betrifft, so ist neben der Fahrzeit der<br />
Shuttlezüge auch die Wartezeit in den Bahnhöfen WIE, T1 und T2 zu berücksichtigen. Diese Wartezeit ist im<br />
ungünstigsten Fall -und nur dieser ist für die <strong>Machbarkeitsuntersuchung</strong> relevant - so groß wie der Zeitabstand<br />
zwischen zwei aufeinander folgenden Zügen des Airport-Links. Für diese Zugfolgezeit gelten die nachstehenden<br />
Überlegungen:<br />
Die in der ersten Untersuchungsstufe unterstellte Mitnutzung des Frankfurter Asts der ICE-Strecke Köln -<br />
Rhein/Main ab dem Wiesbadener Kreuz bis FRA (vgl. Kapitel 3.5.1) impliziert einen Mischbetrieb von Airport-<br />
Shuttle- und ICE-Zügen. Bei dem genannten Abschnitt handelt es sich um eine Bahnlinie, die jede Stunde pro<br />
Richtung für knapp 20 min eine hohe Spitzenbelastung aufweisen wird: Laut aktuellem Fahrplanentwurf soll<br />
jede Stunde in jeder Richtung ein Pulk von 4 Zügen verkehren, die einander im Abstand von jeweils nur 4 min<br />
30 sec folgen sollen [11]. Die Airport-Shuttlezüge müssen sich genau dazwischen bewegen, also 2 min 15 sec<br />
vor bzw. nach <strong>einer</strong> ICE-Fahrt. Damit diese sehr dichte Zugfolge überhaupt möglich ist, müssen die Shuttlezüge<br />
auf dem gesamten Mischbetriebs- Abschnitt nahezu mit der gleichen Geschwindigkeit fahren wie die ICE-Züge,<br />
die nach dem Start in Frankfurt Flughafen Fernbahnhof auf eine Maximalgeschwindigkeit von 230 km/h<br />
beschleunigen, die sie am Wiesbadener Kreuz gerade erreichen [12]. Damit die Shuttlezüge folglich im ICE-<br />
Verkehr "mitschwimmen" können, muß ihre Höchstgeschwindigkeit bei annähernd 230 km/h liegen.<br />
Für den Airport-Link ergibt sich somit eine fahrplan-technisch mögliche minimale Zugfolgezeit von 2 min 15<br />
sec + 2 min 15 sec = 4 min 30 sec. Daraus errechnet sich eine theoretische Frequenz von über 13,3 Zugfahrten<br />
pro Stunde und Richtung.<br />
Im Rahmen der Qualitätskontrolle wird von SMA der Einwand vorgebracht, ein Zeitabstand von lediglich 2 min<br />
15 sec zwischen Shuttlezügen und ICE-Zügen und umgekehrt sei in der Fahrtrichtung von WIE nach FRA zu<br />
kurz, weil bei der Einmündung des von WIE kommenden Gleises die ICE-Züge aus Richtung Köln mit <strong>einer</strong><br />
Geschwindigkeit von 300 km/h verkehrten. Wenn man sich an der in Frankreich bei derartigen Einfädelungen<br />
üblichen Praxis orientiere, müßte die Zugfolgezeit hier größer als 2 min 15 sec sein [13].<br />
Dieser Einwand ist jedoch nicht stichhaltig. Richtig ist zwar, daß die ICE-Strecke Köln - Rhein/Main im<br />
Abschnitt zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Mainbrücke bei Raunheim für eine Höchstgeschwindigkeit<br />
von 300 km/h ausgelegt ist [14]. Doch aus physikalischen Gründen ist es im Normalbetrieb ausgeschlossen, daß<br />
ICE-Züge aus Köln kommend, bei der Einfädelung des Gleises aus Richtung WIE noch eine Geschwindigkeit<br />
von 300 km/h besitzen. Denn bereits nach rund 4,5 km, nämlich am Nordkopf der genannten Mainbrücke, muß<br />
die Geschwindigkeit auf nur 220 km/h reduziert sein [15]. Für den notwendigen Bremsvorgang kommt<br />
erschwerend hinzu, daß es sich hier um eine Gefällestrecke mit einem Höhenunterschied von über 50 m handelt.<br />
In diesem Abschnitt könnten ICE-Züge nur im Falle <strong>einer</strong> Notbremsung, die jedoch zu einem hohen Verschleiß<br />
an Fahrzeugen und Schienen sowie zu einem starken Komfortverlust der Passagiere führen würde, von 300 km/h<br />
auf 220 km/h abbremsen. Aus diesem Grunde dürfte die tatsächliche Geschwindigkeit der ICE-Züge aus<br />
Richtung Köln bei der Einfädelung der Wiesbaden-Spange bei etwa 250 km/h liegen, also kaum höher als die<br />
Geschwindigkeit der Shuttlezüge, die hier schon eine Geschwindigkeit von 220 km/h erreicht haben (vgl. Abb.<br />
16). Deshalb liegt an dieser Einfädelungs-Stelle eine Zugfolgezeit zwischen Airport-Shuttle- und ICE-Zügen von<br />
2 min 15 sec durchaus im Bereich des Möglichen.<br />
5.1.4 Zeitbedarf des Airport-Links
Der gesamte Zeitbedarf der Airport-Links, gemessen ab dem Erreichen des Bahnsteigs im Shuttle-Startbahnhof<br />
bis zur Ankunft im Shuttle-Zielbahnhof umfaßt im "worst case" die Zug-Fahrzeit plus die maximale Wartezeit<br />
bis zur Abfahrt des Zuges, welche identisch ist mit der Zugfolgezeit. Somit verlängert sich der Zeitaufwand für<br />
den gesamten Airport-Link gegenüber den genannten Fahrzeiten um die Wartezeit von 4,5 Minuten auf 12,5<br />
Minuten zwischen WIE und dem Bahnhof T1 in FRA bzw. auf 15 Minuten zwischen WIE und dem Bahnhof T2.<br />
5.2 Bus-System<br />
5.2.1 Randbedingungen und Methodik der Fahrzeitberechnung<br />
Die Busfahrzeiten werden getrennt ausgewiesen nach Fahrzeiten auf dem Vorfeld und Fahrzeiten auf der neuen<br />
Bus-Straße.<br />
Die Fahrzeitberechnung für die Fahrzeiten auf dem Vorfeld entsprechen der Methodik, wie sie später in Kapitel<br />
6.2.3 "Zeitbedarf der einzelnen Elemente der Wegeketten" ausführlich beschrieben wird: Die Geschwindigkeit<br />
auf dem Vorfeld beträgt 30 km/h in WIE und 25 km/h in FRA. Zu den reinen Fahrzeiten werden noch Zuschläge<br />
in Höhe von 25%, mindestens jedoch 1 Minute, addiert.<br />
Für die Fahrzeuge auf der Bus-Straße wurden Fahrsimulationen per Computer durchgeführt. Die<br />
zugrundeliegende Methodik ist dieselbe wie bei der Ermittlung der Fahrzeiten für das Zugsystem. In folgenden<br />
Ausgangsdaten unterscheidet sich die Bus-Fahrsimulation jedoch von der des Zugsystems:<br />
þ Die Anfahrbeschleunigung und Bremsverzögerung wurde auf 1,1 m/s2 heraufgesetzt (Bahnsystem 0,8 m/s2).<br />
þ Es wurde ein Fahrzeug gewählt, das die vorgesehene Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h bequem erreicht<br />
und selbst nach Erreichen dieser Geschwindigkeit noch über eine Restbeschleunigung von 0,15 m/s2 verfügt.<br />
þ Der Fahrzeit-Zuschlag zur Kompensation von Verspätungen wurde mit 20% etwas höher angesetzt als beim<br />
Zugsystem, bei dem ein Zuschlag von 12% zugrunde gelegt wurde. Dies trägt der Tatsache Rechnung daß das<br />
System "Straße" selbst bei <strong>einer</strong> separaten, nicht öffentlichen Bus-Trasse stärker äußereren Einwirkungen - z.B.<br />
Witterungsbedingungen - ausgesetzt ist als das System "Schiene". So kann ein Schienenfahrzeug auch bei<br />
schlechter Sicht oder bei überfrierender Glätte seinen Fahrplan einhalten, was der Bus nicht mehr immer leisten<br />
kann.<br />
þ Den Fahrsimulationen liegt eine Trassenführung der Bus-Straße zugrunde, wie sie in Kapitel 4.3.2<br />
beschrieben wurde. Geschwindigkeitsbeschränkungen aufgrund von engen Kurven und Abzweigungen wurden<br />
entsprechend berücksichtigt.<br />
5.2.2 Ergebnis der Fahrzeitberechnung<br />
Die Fahrsimulation lieferte für die separate Bus-Straße die folgenden Ergebnisse:<br />
WIE - FRA Zone 1/2: 11,5 min<br />
WIE - FRA Zone 3: 13,4 min<br />
WIE - FRA Zone 4/5: 14,8 min.<br />
In diesen Fahrzeiten ist der erwähnte Fahrzeitzuschlag schon enthalten. Die auf der Bus-Straße erreichte<br />
Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt incl. Fahrzeitzuschlag 85 bis 87 km/h.<br />
In Abb. 24 sind die tatsächlich realisierten Geschwindigkeiten auf der Bus-Straße graphisch dargestellt.<br />
5.2.3 Fahrzeug-Folgezeit<br />
Der Verkehr auf der Bus-Straße findet ganz konventionell mit Fahrzeugen statt, deren Fahrer auf Sicht fahren. In<br />
diesem Konzept ist vorgesehen, daß alle zum Einsatz kommenden Fahrzeuge in etwa dasselbe<br />
Beschleunigungsvermögen und dieselbe Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Es handelt sich somit um einen<br />
geschwindigkeitshomogenen Verkehr. Prinzipiell wäre hier nach der Regel "halber Tacho" ein Abstand von 60
m ausreichend, was <strong>einer</strong> Fahrzeug-Folgezeit von nur 2,5 Sekunden entspräche. Da jedoch der tatsächlichen<br />
Bedarf an Fahrzeugen pro Stunde bei lediglich 60 Bussen zur Personenbeförderung plus 30 Transportern für<br />
Gepäck liegt, als bei 90 Fahrzeugen pro Stunde, ergibt sich eine Fahrzeug-Folgezeit von 40 sec. Die Kapazität<br />
der Straße ist somit sehr reichlich bemessen, so daß selbst beim Auftreten von Verkehrsspitzen keine Stauungen<br />
zu erwarten sind.<br />
6. Zeit-Wege-Ketten Zugsystem<br />
6.1 Zu untersuchende Fälle<br />
Die Zeit-Wege-Ketten des Transfers von Gepäck und Passagieren beim Zugsystem wurden anhand von 6<br />
ungünstigen Fällen untersucht, wobei es sich bezüglich der erzielbaren Connection Time in zweifacher Hinsicht<br />
um worst cases handelt: zum einen um relativ große Flugzeuge, bei denen folglich das Aus- bzw. Einsteigen<br />
wegen der großen Zahl an Fluggästen relativ lange dauert, und zum anderen um Flugzeug-Positionen, die beim<br />
Umsteigen lange Fußwege im Terminal oder zeitaufwendige Fahrten über das Vorfeld erfordern. Bei den in WIE<br />
startenden und landenden Flugzeugen wurden Maschinen vom Typ Airbus A 320 mit 150 Sitzplätzen unterstellt;<br />
bei den Flugzeugen in FRA wurde grundsätzlich vom Typ Boeing 747 mit 350 Sitzplätzen ausgegangen.<br />
Außerdem wird grundsätzlich das letzte Gepäckstück bzw. der letzte Fluggast betrachtet.<br />
Diese 6 Transfer-Fälle lassen sich hinsichtlich der Flugzeug-Positionen folgendermaßen charakterisieren:<br />
Fall 1: äußere Remoteposition des Flugzeugs in WIE; westliche Vorfeldposition V270 in FRA<br />
Fall 2: äußere Remoteposition in WIE; Gebäude-Position D12 in FRA, die über den Shuttle-Bahnhof T1 bedient<br />
wird<br />
Fall 3: äußere Remoteposition in WIE; Gebäude-Position D11 in FRA, die über den Shuttle-Bahnhof T2 bedient<br />
wird<br />
Fall 4: Gebäude-Position in WIE (äußerer Pier); westliche Vorfeldposition V270 in FRA<br />
Fall 5: Gebäude-Position in WIE (äußerer Pier); Gebäude-Position D12 in FRA, die über den Shuttle-Bahnhof<br />
T1 bedient wird<br />
Fall 6: Gebäude-Position in WIE (äußerer Pier); Gebäude-Position D11 in FRA, die über den Shuttle-Bahnhof<br />
T2 bedient wird.<br />
Ausgehend von den Worst-Case-Positionen werden außerdem noch Durchschnittspositionen behandelt (Kapitel<br />
6.3.7). Hierfür werden keine vollständigen Zeit-Wegeketten dargestellt, sondern nur die Unterschiede zu den<br />
Worst-Case-Positionen diskutiert.<br />
6.2 Zeit-Wege-Ketten Gepäck<br />
6.2.1 Gepäck-Vorsortierung im Flugzeug, das in WIE landet<br />
Das Fluggepäck ist in einem Flugzeug üblicherweise nach Umsteigern und Aussteigern vorsortiert. Für die<br />
Flugzeuge, die WIE direkt anfliegen, sollte ein neues Gepäck-Sortierprinzip eingeführt werden:<br />
(1) Fluggepäck mit dem Zielflughafen WIE plus Fluggepäck, das innerhalb von WIE in ein Anschlußflugzeug<br />
umgeladen wird<br />
(2) Fluggepäck, das nach der Landung in WIE nach FRA befördert und dort in ein Anschlußflugzeug umgeladen<br />
wird.<br />
Sofern WIE nicht ohnedies der Zielflughafen des Fluggepäcks ist, muß bei der Beschriftung der Gepäck-<br />
Banderolen bei Flügen nach WIE danach unterschieden werden, ob der Anschlußflug in WIE oder in FRA<br />
startet. Dazu wird - abweichend von der sonst üblichen Praxis - bei Umsteigergepäck nicht der Flughafen<br />
aufgedruckt, in dem das Flugzeug zunächst landet, sondern immer der Flughafen, in welchem der Anschlußflug<br />
beginnt.
Dies bedeutet beispielsweise für Fluggepäck von Edinburgh nach Augsburg mit Landung des von Edinburgh<br />
kommenden Flugzeugs in Wiesbaden-Erbenheim und Start des Anschlußflugzeugs in Frankfurt, daß die Gepäck-<br />
Banderole die Beschriftung "FRA-AGB" erhält und nicht "WIE-AGB", wie dies nach der bisherigen Praxis zu<br />
erwarten wäre.<br />
Beim Gepäcktransport in der Gegenrichtung, also Landung des Zubringerflugzeugs in Frankfurt und Start des<br />
Anschlußflugzeugs in Wiesbaden- Erbenheim, wird das übliche Verfahren der Gepäck-Vorsortierung und der<br />
Beschriftung der Gepäck-Banderolen beibehalten. Denn in diesem Fall nimmt die Gepäckförderanlage (GFA) in<br />
FRA erst die Trennung zwischen in FRA verbleibendem und nach WIE zu transportierendem Gepäck vor.<br />
Bei größeren Flugzeugen bzw. bei entsprechender Kooperation der Airlines wäre auch eine Dreifach-Sortierung<br />
des Gepäcks bei Flügen nach Wiesbaden-Erbenheim vorstellbar:<br />
(1) Anschlußflug ab FRA (-> Umladen in den Zug)<br />
(2) Anschlußflug ab WIE<br />
(3) Check-Out in WIE.<br />
Die Möglichkeit zum Check-Out in FRA nach der Landung in WIE wird nicht angeboten.<br />
6.2.2 Übersicht über die Gepäck-Wegekette<br />
Die hier erarbeitete Konzeption <strong>einer</strong> <strong>bodengebundenen</strong> Schnellverbindung per Zug hat bezüglich der Gepäck-<br />
Wegekette die folgenden Kennzeichen:<br />
þ Das Umsteiger-Gepäck wird in WIE zwischen Flugzeug und Bahnhof per Trolley/Dolley transportiert,<br />
während es innerhalb von FRA ganz bzw. auf <strong>einer</strong> Teilstrecke mit der vorhandenen GFA befördert wird.<br />
þ Die Fahrzeit im Shuttlezug zwischen WIE und FRA wird dazu genutzt, das Transfer-Gepäck zu sortieren,<br />
insbesondere nach dem Kriterium "zeitkritisch oder nicht zeitkritisch", wobei das zeitkritische Gepäck bei der<br />
Fahrt von WIE nach FRA für die Zielbahnhöfe T1 und T2 und in der Gegenrichtung sogar nach den Anschluß-<br />
Flugzeugen aufgeteilt wird. Dadurch verursacht der Airport-Link, mit dem eine Distanz von rund 20 km<br />
überbrückt werden muß, gegenüber dem Gepäck-Transfer innerhalb des Flughafens Frankfurt nur einen geringen<br />
Zeitverlust.<br />
þ Die mit Transfer-Gepäck beladenen Container bzw. Trolley-Ladeflächen werden in WIE in den Zug<br />
hineingerollt und während der Fahrt nach FRA entladen. Mit einem späteren Zug gelangen sie wieder zurück<br />
nach WIE, wobei sie wieder mit Gepäck gefüllt werden.<br />
þ Für den Airport-Link sind sowohl in WIE wie auch in FRA kombinierte Personen- und Gepäck-Bahnhöfe<br />
vorgesehen.<br />
Für die technische Umsetzung der skizzierten Lösung zur Gepäcksortierung im Zug wurde ein wenig<br />
automatisierter, dafür aber mehr arbeitsintensiver Ansatz gewählt. Die Realisierung eines solchen technisch<br />
wenig anspruchsvollen Systems dürfte deshalb auf jeden Fall gegeben sein, weist jedoch den Nachteil eines<br />
zweimaligen Scannens der Gepäckstücke auf. In <strong>einer</strong> späteren vertiefenden Untersuchung könnte alternativ<br />
hierzu ein modernes, weitgehend automatisches System ausgearbeitet werden.<br />
6.2.3 Beschreibung der Wegekette von WIE nach FRA<br />
Bei der Landung in WIE und einem Anschlußflug ab FRA (Bewegung A in Abb. 1a) wird das Gepäck wie folgt<br />
behandelt:<br />
Die im Flugzeug vorsortierten Container bzw. die Bellies werden aus dem Flugzeug heraus auf Dolleys bzw. auf<br />
Trolleys geladen, wobei sich auf der Ladefläche der letzteren jeweils eine Kleinpalette befindet. Die Dolleys und<br />
Trolleys, deren Ladefläche einen während der Fahrt arretierbaren Rollenboden besitzt, werden über das Vorfeld<br />
direkt auf den Bahnsteig in WIE gebracht, wo der Shuttlezug nach FRA schon bereit steht (siehe Abb. 8). Wegen
der niveaugleichen Zufahrt zum Bahnsteig brauchen die Trolleys/Dolleys bei ihrer Fahrt vom Vorfeld zum Zug<br />
keine Höhenunterschiede zu bewältigen, so daß sie ungebremst sein können. Die Gepäck-Container bzw. -<br />
Kleinpaletten werden in die Gepäckwaggons des Zuges gerollt und vor der Zugabfahrt arretiert. Hierfür verfügt<br />
der Gepäckwaggon ebenfalls über einen Rollenfußboden.<br />
Noch bevor der Zug abfährt, beginnt das Sortieren des Gepäcks - ein Vorgang, der während der Zugfahrt bis zur<br />
Ankunft im Bahnhof T1 in FRA andauert. Es werden 4 Gruppen von Gepäck gebildet, wobei die Gepäckstücke<br />
auf mindestens 4 verschiedene Großpaletten gestapelt werden:<br />
(1) zeitkritisches Gepäck für Terminal 1<br />
(2) zeitkritisches Gepäck für Terminal 2<br />
(3) nicht zeitkritisches Gepäck für Terminal 1<br />
(4) nicht zeitkritisches Gepäck für Terminal 2.<br />
Die Gepäck-Paletten können ähnlich einem Regal auch mehrstufig aufgebaut sein können oder es können ULD-<br />
Container hierfür eingesetzt werden. Damit sie nach der Ankunft des Zuges in FRA im Bahnhof in kürzester Zeit<br />
ausgeladen werden können, besitzen die Bahnsteige in T1 und T2 jeweils einen Rollenfußboden. Somit reicht für<br />
das Entladen des Gepäcks im Zwischenbahnhof T1 die Haltezeit aus, die zum Aussteigen der Fahrgäste ohnedies<br />
erforderlich ist, nämlich 75 sec.<br />
Auf dem Bahnsteig T1 wird zuerst das zeitkritische Gepäck in die GFA von FRA gespeist, indem die<br />
Gepäckstücke kodiert und in die Schalen der GFA gelegt werden. Anschließend werden die bezüglich der MCT<br />
unkritischen Gepäckstücke der GFA zugeführt.<br />
Nach dem Zwischenhalt in T1 fährt der Zug zum Bahnhof T2. Hier werden mit höchster Priorität die für T2<br />
bestimmten Großpaletten mit dem zeitkritischen und danach die mit dem unkritischen Gepäck auf den Bahnsteig<br />
gerollt. Sofort werden die zeitkritischen Gepäckstücke in die GFA gespeist und im Anschluß daran nach und<br />
nach die restlichen Stücke. Inzwischen werden die nun leeren Container und Paletten entladen und dort<br />
zwischengelagert.<br />
Das zeitkritische Gepäck für Anschluß-Flugzeuge in den westlichen, weit von T1 entfernt liegenden<br />
Vorfeldpositionen wird zwar auch im Bahnhof T1 in die GFA von FRA gespeist, aber erfährt die folgende<br />
Sonderbehandlung: Es wird bereits nach einem sehr kurzen und somit wenig zeitaufwendigen Förderweg wieder<br />
aussortiert. Dieses Gepäck wird dann mit Vorfeldfahrzeugen direkt zu den Flugzeugen transportiert, ohne den<br />
sonst üblichen Weg per GFA über das Vorfeldgebäude V3 zu nehmen.<br />
Die zeitliche Pufferung des Fluggepäcks bei sehr langen Umsteigezeiten geschieht in der GFA in FRA.<br />
6.2.4 Beschreibung Wegekette von FRA nach WIE<br />
Im Fall Landen in FRA und Anschlußflug ab WIE (Bewegung B in Abb. 1a) wird das Umsteigergepäck<br />
weitestgehend spiegelbildlich behandelt und befördert:<br />
Das Gepäck wird in FRA wie üblich vom Flugzeug aus zum Terminal 1 bzw. 2 transportiert und hier in die GFA<br />
eingespeist.<br />
Die weitere Behandlung des Gepäcks hängt nun davon ab, wieviel Zeit bis zum Abflug in WIE noch bleibt.<br />
Hierfür gibt es drei Möglichkeiten:<br />
(1) Bei einem sehr großen zeitlichen Spielraum bis zum Abflug in WIE wird das Gepäck im jeweiligen Terminal<br />
in FRA auf Großpaletten gestapelt, die auf den Bahnsteigen T1 und T2 bereitstehen und in den nächsten Zug<br />
kurz vor dessen Abfahrt gerollt werden. Nach der Ankunft in WIE wird dieses Gepäck in die dortige GFA<br />
eingespeist. Dort geschieht dann ggfs. die zeitliche Pufferung. Das Gepäck wird später zusammen mit dem in<br />
WIE aufgegebenen Gepäck zum Flugzeug transportiert.<br />
(2) Bei <strong>einer</strong> mittleren Zeitspanne wird das Gepäck, das durch die GFA in FRA entsprechend fein sortiert wurde,<br />
im Bahnhof T2 in Container bzw. auf Kleinpaletten geladen, die bereits für ganz bestimmte in WIE startende<br />
Flugzeuge bereitgestellt sind. Kurz vor Abfahrt des Shuttlezuges werden die Container bzw. Paletten in den Zug<br />
gerollt.
(3) Bei <strong>einer</strong> sehr kurzen Zeitspanne bis zum Start des Anschlußflugzeugs in WIE wird das Gepäck in FRA<br />
wieder auf Großpaletten gestapelt, die in den Bahnhöfen T1 bzw. T2 bereitstehen. Unmittelbar vor Abfahrt nach<br />
WIE werden diese Paletten in den Zug verladen. Während der Fahrt im Zug werden die zeitkritischen<br />
Gepäckstücke auf die entsprechenden Container bzw. Kleinpaletten verteilt, die für einzelne Anschlußflugzeuge<br />
ab WIE bestimmt sind.<br />
In WIE werden die Container bzw. die Paletten mit Einzelgepäck aus den Gepäckwaggons auf die Ladeflächen<br />
der unmittelbar neben dem Zug auf dem Bahnsteig bereitgestellten Dolleys bzw. Trolleys gerollt und sodann<br />
vom Bahnsteig über das Vorfeld direkt zum Anschlußflugzeug gefahren.<br />
Im Zug ist eine Unterscheidung von zwei verschiedenen Containern-Arten pro Flug, nämlich nach Umsteigerund<br />
nach Aussteiger-Gepäck am Zielflughafen, nicht erforderlich, da das Gepäck im Zug von FRA nach WIE<br />
ohnehin aus einem Umsteigevorgang stammt und ein nochmaliges Umsteigen extrem selten auftritt.<br />
Falls in WIE ein relativ kleines Anschlußflugzeug bestückt wird, so kann es vorkommen, daß ein fast leerer<br />
Container aus FRA und ein ebenfalls fast leerer Container aus WIE am Flugzeug ankommt. In diesem Fall ist es<br />
sinnvoll, die Gepäckstücke in einen einzigen Container umzuladen. Dies dürfte nicht zeitkritisch sein, da die<br />
Beladung bei kleinen Flugzeugen ohnehin weniger Zeit beansprucht als bei großen Flugzeugen, bei denen nicht<br />
nur ein einziger, sondern mehrere Container in den Laderaum transportiert werden müssen.<br />
6.2.5 Zeitbedarf der einzelnen Elemente der Wegeketten<br />
Entladung des Gepäcks aus dem Flugzeug<br />
Die Abfertigung des Umsteigegepäcks erfolgt unabhängig von der Position des Flugzeuges, da das Gepäck bei<br />
Remote-Positionen im vorliegenden Entwurf genauso behandelt wird wie bei Gebäude-Positionen. Der<br />
Unterschied liegt nur in der Länge der Wege, welche vom Flugzeug zur Gepäckanlage bzw. zum Bahnhof<br />
zurückzulegen sind.<br />
Im Fall der vom Terminal WIE am weitesten entfernten Position beträgt der Weg zum Bahnhof 1040 m.<br />
Die Gepäckentladung beginnt nach dem Halt des Flugzeuges mit der Positionierung der Abfertigungsfahrzeuge.<br />
Für die Gepäckentladung sind dies entweder Hebebühnen zur Entladung der Gepäckcontainer oder Förderbänder<br />
zur Entladung der Einzelgepäckstücke aus dem Frachtraum des Flugzeuges.<br />
Die Verteilung der Flugzeuge, welche nach dem Szenarioflugplan Container nutzen können und diejenigen, die<br />
nur über einen Frachtraum für Einzelgepäck verfügen, ist in Abb. 17 dargestellt. Der Anteil der Flugzeuge,<br />
welche keine Container aufnehmen können, beträgt knapp 60%. Demnach müssen beide Formen der<br />
Entladevorgänge berücksichtigt werden.<br />
Die Zeit zur Positionierung der Abfertigungsfahrzeuge für Container beträgt 1 min. Für den Entladevorgang für<br />
Container wird mit <strong>einer</strong> durchschnittlichen Entladezeit von 2 min für zwei "halfsize" Container gerechnet.<br />
Diese Zeit setzt sich wie folgt zusammen:<br />
þ Heranschieben der Container im Flugzeugbauch an die Frachtraumtür<br />
þ Positionieren der Container auf der Hebebühne<br />
þ Absenken der Hebebühne<br />
þ Beladen der Container auf dem Dolley.<br />
Während die Container im Flugzeugbauch zurechtgeschoben werden, kann die Hebebühne schon auf die Höhe<br />
der Ladeluke gebracht werden.<br />
Es wird davon ausgegangen, daß spätestens mit dem zweiten Entladevorgang (4. Container) die<br />
Umsteigecontainer für FRA entladen sind. Diese Annahme erscheint realistisch, da schon heute die Flugzeuge so<br />
beladen werden, daß das Umsteigergepäck vor dem Gepäck der Aussteiger und somit relativ schnell aus dem<br />
Flugzeug entladen werden kann.<br />
In der Summe bedeutet dies, daß nach 5 min die relevanten Container entladen sind. Dieser Wert setzt sich wie<br />
folgt zusammen:<br />
Erhebungen am Flughafen FRA haben folgende Zeiten ergeben: [16]
þ Positionierung und Vorbereitung der Abfertigungsfahrzeuge: 2 min<br />
þ Erster Entladevorgang für 2 LD3 Container: 1,5 min<br />
þ Zweiter Entladevorgang für 2 LD3 Container: 1,5 min.<br />
Die Angaben der Flugzeughersteller für die Abfertigung sind ähnlich, wobei die Daten von Boeing denen von<br />
Airbus entsprechen, so daß sich auch hier eine Zeitspanne von 5 Minuten ergibt:<br />
þ Positionierung und Vorbereitung der Abfertigungsfahrzeuge: 1 min<br />
þ Erster Entladevorgang für 2 LD3 Container: 2 min<br />
þ Zweiter Entladevorgang für 2 LD3 Container: 2 min.<br />
Die Entladung von Einzelgepäck aus dem Flugzeugbauch (Bulk Cargo) setzt sich wieder aus der Positionierung<br />
der Fahrzeuge und dem eigentlichem Entladevorgang zusammen.<br />
Für die weiteren Berechnungen wird mit <strong>einer</strong> Bearbeitungszeit von 2 min je Schritt gerechnet (Positionierung,<br />
1. Entladespiel, 2. Entladespiel). Insgesamt ergibt sich somit eine Entladezeit für 4 Containern von 6 min.<br />
Für die Entladeraten gibt es unterschiedliche Angaben. In der Stückgutverladung wird für das Entladen eine Zeit<br />
von 5 Sekunden je Koffer gerechnet. Hier wird eine zusätzliche Sicherheitsreserve von 20% eingerechnet,<br />
wodurch sich die Entladezeit zu 6 Sekunden je Gepäckstück ergibt. Dies bedeutet, daß in 5 min 50 Koffer<br />
entladen werden können. Da von dieser Form des Gepäcktransport nur kl<strong>einer</strong>e Flugzeugmuster betroffen sind,<br />
ist diese Anzahl der Gepäckstücke als obere Grenze dessen anzusehen, was nach FRA transportiert werden muß.<br />
Ausnahmen sind hier nur größere Versionen der Boeing 737 und die Boeing 757. Diese Flugzeugmuster können<br />
bis zu 252 Passagiere transportieren (Condor). Für diesen Fall, der jedoch als unwahrscheinlich anzusehen ist, da<br />
Condor zum größten Teil Originärpassagiere an Bord hat, muß das Gepäck auf verschiedene Ladeluken verteilt<br />
werden und kann dann parallel entladen werden.<br />
Sollte eine solche Verteilung auf zwei Ladeluken aufgrund der Gepäckmengen nicht möglich sein, dann muß<br />
eine Möglichkeit zur weiteren Trennung des Gepäcks in den Gepäckräumen geschaffen werden.<br />
Eine Möglichkeit ist hier die gezielte Beladung des Frachtraumes in der Form, daß zum Schluß das<br />
Umsteigergepäck nach FRA beladen wird. Somit kann dieses Gepäck als erstes entladen werden. Dies würde<br />
eine deutliche Abtrennung dieses Gepäcks im Frachtraum erfordern, was durch Netze geschehen kann.<br />
Durch eine solche Beladung kann auch für Flugzeuge mit Bulk Gepäck sichergestellt werden, daß das<br />
Umsteigegepäck nach FRA zuerst entladen wird. Der Logistikaufwand am Ausgangsflughafen entspricht dem<br />
der getrennten Beladung verschiedener Container am Ausgangsflughafen.<br />
Fahrt zum Bahnhof über das Vorfeld<br />
Nach dem Entladevorgang erfolgt die Fahrt zum Bahnhof. Der Transport erfolgt auf Trolleys/Dolleys mit<br />
Traktoren. Diese Zugmaschinen sind in der Regel für Fahrgeschwindigkeiten bis 25 km/h ausgelegt. Stärker<br />
motorisierte Fahrzeuge können, bei geringerer Achslast, auch Fahrgeschwindigkeiten über 30 km/h erreichen,<br />
wie dies in München üblich ist. [17] Da hier ein Planfall betrachtet wird, kann davon ausgegangen werden, daß<br />
stärker motorisierte Fahrzeuge genutzt werden. Als Sicherheitszuschlag wird ein zusätzlicher Faktor von 25 %<br />
angesetzt, der mögliche Verlustzeiten durch anderen Verkehr berücksichtigt.<br />
Für die vom Bahnhof am weitesten entfernte Position (1040 m) ergeben sich somit Fahrzeiten von 2,5 min incl.<br />
Verlustzeiten. Der Großteil der Wege wird jedoch kürzer sein, da die meisten Flugzeuge (28 Gebäude-<br />
Positionen) direkt am Terminal abgefertigt werden können, wodurch die Wege maximal 650 m betragen.<br />
Verladung am Bahnhof<br />
Die maximale Wartezeit am Bahnhof beträgt 4,5 min, da die Shuttlezüge in diesem Takt verkehren. Bis<br />
unmittelbar vor der Abfahrt des Zuges können noch Container bzw. Kleinpaletten mit Einzelgepäck eingeladen<br />
werden. Da der Shuttle-Bahnhof WIE betrieblich wie ein Kopfbahnhof genutzt wird, steht immer ein Zug bereit.<br />
Das Einladen erfolgt analog zum Verladeverfahren zwischen Dolley und Hebebühne. Mit einem Rollensystem<br />
werden die Container in den entsprechenden Waggon geschoben und dort verankert. Hierfür verfügt der<br />
Gepäckwagen des Shuttlezuges über einen Rollenfußboden, genauso wie die Frachträume der Flugzeuge.
Zugfahrt nach FRA<br />
In Kapitel 2.3.3 wurde beschrieben, daß pro 5-Minuten-Intervall im Extremfall 255 Gepäckstücke sortiert<br />
werden müssen, während die Durchschnittsbelastung weit darunter liegt. Auf die Zugfolgezeit von 4,5 min<br />
umgerechnet, bedeutet dies ein Maximum von 230 Gepäckstücken pro Zug.<br />
Bevor der Zug losfährt, steht er schon ca. 5 min im Bahnhof WIE bereit. In diesem Zeitraum können die ersten<br />
ankommenden Container in die Gepäckwaggons gerollt und sofort geöffnet werden, um mit dem Sortiervorgang<br />
zu beginnen. Entsprechendes gilt für Einzelgepäck auf Kleinpaletten. Mit Ankunft des Zuges im Bahnhof T1 in<br />
FRA muß das Gepäck schon sortiert sein. Somit stehen 13 min Gepäck-Sortierzeit zur Verfügung. Pro Minute<br />
müssen somit durchschnittlich 17,7 Gepäckstücke sortiert werden. Unterstellt man für diese händische Arbeit<br />
denselben Zeitaufwand pro Gepäckstück wie beim Kodieren, so kann das Entleeren der Container/Paletten von 3<br />
Personen bewältigt werden. Aufgrund der länglichen Form des Gepäckwagens dürften kleine zug-interne<br />
Gepäckbänder ohne Schalen praktikabel sein. Das Gepäck sollte dann von 3 weiteren Personen auf Paletten<br />
gestapelt werden, die nach den Kriterien T1, T2, zeitkritisch und nicht zeitkritisch unterschieden sind.<br />
Entladung im Bahnhof T1 in FRA<br />
Nach dem Öffnen der Frachttüren des Zuges wird zuerst die für T1 bestimmte, mit zeitkritischem Gepäck<br />
bestückte Großpalette von Hand an die Kodieranlage gerollt.<br />
Für die Betrachtung der MCT ist nun die Menge des zeitkritischen Gepäck für T1 von Interesse. Von den oben<br />
genannten 230 Containern sind ca. 60% für T1 und 40% für T2 bestimmt. Unterstellt man, daß 10% der<br />
Gepäckstücke zeitkritisch sind, so ist zu Spitzenzeiten mit einem Aufkommen von 23 zeitkritischen<br />
Gepäckstücken zu rechnen. Geht man zusätzlich davon aus, daß eine relativ große Reisegruppe die MCT von 45<br />
min in Anspruch nimmt, so könnten bis zu 60 Gepäckstücke zeitkritisch sein.<br />
Nach Halt des Zuges vergeht max. 1 min, bis diese Gepäckmenge ausgeladen und mit Hilfe der Großpaletten zu<br />
den Kodierstationen gerollt ist. Für das Kodieren selbst und das Einspeisen in die GFA des Flughafens Frankfurt<br />
werden weitere 2 min benötigt. Hierbei wird unterstellt, daß 4 parallele Kodierstationen vorhanden sind, von<br />
denen jede bis zu 10 Gepäckstücke pro Minute bewältigen kann. Für die Kodierarbeit sind in diesem Fall 6<br />
Personen erforderlich. Im Normalbetrieb dürfte jedoch die halbe Zahl von Personen ausreichend sein, während<br />
die bei Spitzenlast erforderliche "Verstärkung" des Kodier-Personals anhand der konkreten Buchungen<br />
kurzfristig disponiert werden könnte.<br />
Das zeitkritische Gepäck für die entfernt liegenden Vorfeldpositionen und bei Bedarf auch für ungünstig<br />
liegende, an sich auch über die GFA erreichbare Positionen am Terminal wird zu "Sonderausgabestellen"<br />
geführt, die sich direkt im Zentralbereich des Terminal 1 befinden sollten, und zwar eine Ausgabestelle pro<br />
zeitkritischem Flug. Eine konkrete räumliche Planung für diese Ausgabestellung kann in diesem<br />
Bearbeitungsschritt noch nicht erfolgen, aber wird als realisierbar angenommen. An der Sonderausgabestelle<br />
wird das Gepäck auf die zeitkritischsten Flüge bei entfernten Flugzeug-Positionen verteilt und auf die Dolleys<br />
und Trolleys für diesen Flug geladen.<br />
Der Zeitbedarf für den Weg des zeitkritischen Gepäcks vom Bahnsteig bis zur <strong>gesonderten</strong> Gepäckausgabestelle<br />
wird mit 3 min angesetzt. Eine Förderanlage für den Weg dieses Gepäcks zur Ausgabestelle wäre neu zu<br />
schaffen, da die Nutzung der bestehenden Anlagen den schnellen Transport nicht gewährleisten könnte. Der<br />
Weg vom Bahnhof bis zur Ausgabe würde ca. 300 m incl. Ebenenwechsel betragen. Gepäckförderbänder können<br />
eine Geschwindigkeit bis zu 5 m/s erreichen. Im Sortierbereich werden 2 m/s erreicht.<br />
Transport zum Flugzeug in FRA<br />
Der Transport des Gepäcks zu den westlichen, ca. 4 km entfernt stehenden Flugzeugen über die Vorfeldstraßen<br />
bedeutet einen hohen zeitlichen Aufwand. Zum einen fahren die Fahrzeuge relativ langsam und zum anderen<br />
treten immer wieder Verkehrsstörungen durch die hohe Verkehrsdichte auf den Vorfeldstraßen auf. Mit <strong>einer</strong><br />
Fahrgeschwindigkeit von wiederum 25 km/h (derzeit maximal zulässige Geschwindigkeit auf den<br />
Vorfeldstraßen in FRA) und dem Sicherheitszuschlag von 25 % würde die westlichste Position nach 13 min<br />
Fahrzeit erreicht werden. In Kapitel 3.5 wurde deshalb der Bau <strong>einer</strong> kreuzungsfreien Straßenverbindung für
Vorfeldfahrzeuge vorgeschlagen. Durch die Realisierung dieser Baumaßnahme werden mindestens 4 min<br />
Fahrzeit eingespart.<br />
Für die Fahrt von Terminal 1 über die neue Vorfeld-Straße zur Position V270 ergibt sich eine Wegstrecke von<br />
3,0 km mit 50 km/h auf der neuen Straße (ohne Verzögerungszeiten) und 1,24 km mit 25 km/h (mit 25%<br />
Verzögerungszeiten), was zu <strong>einer</strong> Fahrzeit von 6,5 min und 1,0 min Verzögerungszeiten führt.<br />
Starten Flüge in FRA von Gebäude-Positionen aus, die direkt an die GFA angeschlossen sind, dann kann auch<br />
der herkömmliche Weg durch die GFA gewählt werden. Für die Förderdauer durch die GFA in FRA liegen<br />
unterschiedliche Aussagen vor. Hier werden 9 min Förderdauer vom Zentralbereich (dem Shuttle-Bahnhof) zu<br />
den äußeren Gebäude-Positionen angesetzt. Beim Transport vom Shuttle-Bahnhof T1 zur Position D12 würde<br />
hierfür schon eine durchschnittliche Fördergeschwindigkeit (incl. Sortieren) von 1,4 m/s ausreichen, für die im<br />
Bau befindlichen äußersten Positionen am Flugsteig A wäre eine Geschwindigkeit von 2,2 m/s ausreichend.<br />
Vom Shuttle-Bahnhof T2 zu den entlegensten Positionen von T2 wurden 6 min Förderzeit unterstellt, was <strong>einer</strong><br />
Geschwindigkeit von 1,4 m/s entspräche. Da nicht immer auf direktem Weg Förderbänder vorhanden sind,<br />
liegen die tatsächlich erforderlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten allerdings etwas höher. Aussagen seitens<br />
der FAG gehen dahin, daß ein Gepäckstück nicht mehr als 15 min durch die gesamte GFA benötigt - also von<br />
einem entlegenen westlichen zu einem entlegenen östlichen Flugsteig, was <strong>einer</strong> Durchschnittsgeschwindigkeit<br />
von 2,3 m/s entspräche. Im hier zu betrachtenden Fall hingegen würde nur die Hälfte des genannten Weges<br />
zurückgelegt, so daß die unterstellten 9 min für Terminal 1 bzw. 6 min innerhalb des kompakteren Terminals 2<br />
plausibel erscheinen.<br />
Bislang wird allerdings von der FAG für die Gepäckförderanlage in FRA nur eine allgemeine Förderzeit von 15<br />
Minuten garantiert, unabhängig davon, wie groß die Entfernung ist. Um die oben genannten kurzen Förderzeiten<br />
auch auf den hier zu betrachtenden kürzeren Förderwegen zuverlässig zu erreichen, sind entsprechende<br />
Modifikationen an der GFA erforderlich. Im Einzelfall können Stichstrecken zur Verstärkung oder als Bypass<br />
nötig werden, so daß die zurückzulegenden Strecken ohne große Umwege befahren werden können. Auch sind<br />
möglicherweise Veränderungen an der Softwaresteuerung erforderlich.<br />
Anschließend muß noch der Transport von der Ausgabestelle zum Flugzeug und die Beladung selbst<br />
berücksichtigt werden.<br />
Beladung des Flugzeuges in FRA<br />
Der Beladevorgang des startbereiten Flugzeuges ist im wesentlichen bereits abgeschlossen, bevor die relativ<br />
geringe Menge an Umsteigergepäck aus Wiesbaden-Erbenheim angeliefert wird. Dieses wird entweder in<br />
separaten Containern oder als Einzelgepäck verladen.<br />
Der Zeitbedarf für den Beladevorgang entspricht dem beim Entladen. Es wird wieder von maximal 4 Containern<br />
ausgegangen, die innerhalb von 5 min beladen werden können. Anschließend erfolgt noch der Abbau der<br />
Abfertigungseinrichtungen, insbesondere das Entfernen der Fluggastbrücken, sowie der "Engine Start". Diese<br />
letzte Phase dauert bis zu 2,5 min.<br />
6.2.6 Erzielbare Connection Time bzgl. Gepäck<br />
Die Zeitkette des Gepäcks wird anhand verschiedener Umsteigerbeziehungen beschrieben, wobei der<br />
Schwerpunkt der Untersuchungsstufe 1 auf Transfer-Relationen liegt, die "worst cases" darstellen. Bei der<br />
Untersuchungsstufe 2 kommt zu diesen 6 ungünstigen Fällen noch eine Betrachtung von Durchschnittsfällen<br />
hinzu.<br />
Worst-case-Szenario<br />
Die Zeitketten der nachfolgenden Umsteigebeziehungen werden immer in beiden Richtungen berechnet und<br />
ausgewiesen.<br />
Zur Optimierung des Gesamtsystems werden in FRA die relativ zeitkritischen Positionen D13 und D12, die<br />
eigentlich zum Terminal 2 gehören, dem Shuttle-Bahnhof T1 zugeordnet.<br />
In der Richtung von WIE nach FRA wird in FRA keine Wartezeit für den Übergang des Gepäcks von der GFA<br />
zum Vorfeldfahrzeug angesetzt. Diese Annahme wurde deshalb so gewählt, weil aus der Perspektive des
"letzten" Gepäckstückes - und nur dieses Gepäckstück ist für die Fragestellung "Erreichung MCT" von Interesse<br />
- logischerweise gar keine Wartezeit auftritt. Denn das Vorfeldfahrzeug fährt dann ab, wenn das letzte<br />
Gepäckstück, nachdem es die GFA verlassen hat, eingeladen ist, bzw. das Fahrzeug wartet noch auf dieses letzte<br />
Gepäckstück. Diese Vorgehensweise erfordert allerdings sinnvollerweise eine "intelligente GFA", welche den<br />
Fahrer des Vorfeldfahrzeuges bzw. die Mannschaft, die den letzten Container bestückt, über den Verbleib des<br />
letzten Gepäckstückes informiert. Angesichts des weiten Zeithorizonts der vorliegenden Studie sollte dies im<br />
Bereich des technisch Machbaren liegen.<br />
Tab. 2: Zug-System: Übersicht über die möglichen Beziehungen des Gepäcktransfers<br />
Fall von bzw. nach von bzw. nach<br />
Nr.<br />
1 Äußere Remoteposition in WIE Westliche Vorfeldposition in FRA (V270)<br />
2 Äußere Remoteposition in WIE D12 in FRA über Shuttle-Bahnhof T1<br />
3 Äußere Remoteposition in WIE D11 in FRA über Shuttle-Bahnhof T2<br />
4 Gebäudeposition in WIE (äußerer Pier) Westliche Vorfeldposition in FRA (V270)<br />
5 Gebäudeposition in WIE (äußerer Pier) D12 in FRA über Shuttle-Bahnhof T1<br />
6 Gebäudeposition in WIE (äußerer Pier) D11 in FRA über Shuttle-Bahnhof T2<br />
Tab. 3: Zug-System: Zeit-Wegekette Gepäck von WIE nach FRA<br />
Prozesse Bemerkungen Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6<br />
Entladevorgang Positionierung Fahrzeuge 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0<br />
Entladen (4 Cont. für FRA) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0<br />
Transport zum Terminal max. 1040 m bei 30 km/h 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0<br />
Verzögerung 25%,mind. 1min 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Airport-Link Beladung und Wartezeit 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5<br />
Fahrzeit 8,0 8,0 10,5 8,0 8,0 10,5<br />
Entladung Zug 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Weg durch GFA in FRA Kodieren am Bahnsteig 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0<br />
Sortierung / Transport 3,0 9,0 6,0 3,0 9,0 6,0<br />
letztes Gepäckst. in Cont. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Transport zum Flugzeug max. 4250 m bei 25 km/h 6,5* 2,0 2,0 6,5* 2,0 2,0<br />
Verzögerung 25%,mind. 1min 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Beladevorgang nur Gepäck Umsteiger 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0<br />
Engine Start und Entfernung Brücken 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 43,5 45,0 44,5 42,5 44,0 43,5<br />
* Nutzung der neuen Zubringerstraße für westliches Vorfeld wie in Kapitel 3.5 beschrieben. Ohne neue<br />
Zubringerstraße verlängert sich die Fahrzeit um 4 min.<br />
Tab. 4: Zug-System: Zeit-Wegekette Gepäck von FRA nach WIE, Variante 1<br />
mit möglichst weitgehender Nutzung der GFA in FRA,<br />
jedoch Bestückung der Vorfeldfahrzeuge für das westliche Vorfeld im Zentralbereich T1<br />
Prozesse Bemerkungen Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6<br />
Entladevorgang Positionierung Fahrzeuge 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0<br />
Entladen (4 Cont. für WIE) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0<br />
Transport zum Terminal max. 4250 m bei 25 km/h 6,5* 2,0 2,0 6,5* 2,0 2,0<br />
Verzögerung 25%,mind.1 min 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Entladung Container 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0<br />
Sortierung / Transport 3,0 9,0 6,0 3,0 9,0 6,0<br />
Airport-Link Beladung und Wartezeit 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5<br />
Fahrzeit 8,0 8,0 10,5 8,0 8,0 10,5<br />
Sortierung im GFA WIE Entladung Zug 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Sortierung / Transport<br />
Transport zum Flugzeug max. 1040 m bei 30 km/h 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0
Verzögerung 25%,mind. 1min 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Beladevorgang nur Gepäck Umsteiger 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0<br />
Engine Start und Entfernung Brücken 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 44,5 46,0 45,5 43,5 45,0 44,5<br />
* Nutzung der neuen Zubringerstraße für westliches Vorfeld wie in Kapitel 3.5 beschrieben. Ohne neue<br />
Zubringerstraße verlängert sich die Fahrzeit um 4 min.<br />
Als Ergebnis kann festgehalten werden, daß in fast allen Relationen die MCT bzgl. Gepäck von 45 Minuten<br />
eingehalten werden kann. In zwei Fällen in Richtung von FRA nach WIE dauert der Transport jedoch mit 46<br />
bzw. 45,5 min geringfügig zu lange, weil das Gepäck über relativ lange Strecken in der relativ langsamen GFA<br />
in FRA von D12 bzw. D11 zum Shuttle-Bahnhof T1 bzw. T2 gefördert werden muß. Aber wenn hier<br />
Vorfeldfahrzeuge zum Einsatz kommen, die eine kürzere Transportzeit ermöglichen, kann die MCT dennoch<br />
eingehalten werden.<br />
Mit Hilfe der in Kapitel 3.5 beschriebenen neuen Straße in das westliche Vorfeld sind beim Gepäcktransport die<br />
Positionen im äußersten westlichen Vorfeld ungefähr genauso schnell erreichbar wie äußere Gebäude-Positionen<br />
am Terminal 1. Ohne diese Straße würde die MCT jedoch für die äußersten Vorfeldpositionen um ca. 3 min<br />
überschritten werden.<br />
Bei Nutzung der GFA für entfernt liegende Positionen am Terminal 1 (Tab. 4) wird die MCT von 45 min<br />
weitgehend ausgeschöpft. Als Rückfallebene bietet sich hier ein nur kurzer Transport in der GFA in den<br />
Zentralbereich von T1 an, wo Vorfeldfahrzeuge das Gepäck übernehmen. Für die Gebäude-Positionen können so<br />
noch einmal bis zu 4 min eingespart werden.<br />
Die Richtung WIE - FRA ist beim Gepäcktransport tendenziell schneller als die Gegenrichtung. Denn hier kann<br />
das zeitaufwendige Öffnen der Container während der Fahrt im Zug geschehen, während in der Gegenrichtung<br />
das Öffnen der Container stationär erfolgt und dafür das weniger zeitaufwendige Bestücken der Container im<br />
Zug stattfindet.<br />
6.2.7 Mögliche Abkürzung der Zeit-Wege-Kette<br />
Im folgenden wird die Frage beantwortet, ob in der Wegekette des Worst-Case-Szenario einzelne Glieder durch<br />
teilweise aufwendigere, aber schnellere Glieder ersetzt werden können. Es handelt sich dann quasi um<br />
"Feuerwehr-Einsätze", die zu <strong>einer</strong> Beschleunigung des Transfers führen.<br />
Die Wegekette Gepäck besteht beim Zugsystem aus folgenden Gliedern:<br />
þ Vorfeldfahrt in WIE zwischen Flugzeug und Zug per Dolley bzw. Trolley<br />
þ Zugfahrt incl. Entleeren bzw. Bestücken der Flugzeug-Container<br />
þ Feinsortierung und Förderung des Gepäcks in der GFA in FRA<br />
þ Vorfeldfahrt in FRA zwischen Flugzeug und Zug per Dolley bzw. Trolley<br />
Die Fahrt über das Vorfeld in WIE direkt vom Flugzeug zum Zug und umgekehrt ist schon mit <strong>einer</strong><br />
"Feuerwehr-Fahrt" vergleichbar. Eine weitere Verkürzung des Zeitaufwandes ist hier nicht mehr möglich.<br />
Die Zugfahrt kann kaum mehr weiter beschleunigt werden, auch dann nicht, wenn satt der Rad-Schiene-Technik<br />
die Magnet-Schwebe-Technik (Transrapid) verwendet würde. Eine noch dichtere Zugfolge zur Reduktion der<br />
maximalen Wartezeit bis zur Zugabfahrt im Startbahnhof wäre nur durch einen unverhältnismäßig hohen<br />
Zusatzaufwand realisierbar, nämlich durch ein Vervielfachung der Bahnsteiggleise in WIE, T1 und T2<br />
gegenüber dem vorliegenden Konzept. Ein schnelleres Gepäck-Vorsortieren im Zug bringt auch keinen Vorteil,<br />
da die Fahrzeit und nicht der Sortiervorgang dieses Zeit-Kettenglied bestimmt.<br />
Auch die Vorfeldfahrt in FRA zwischen Flugzeug und Zug per Dolley bzw. Trolley stellt bereits eine<br />
"Feuerwehr-Fahrt" dar, die nicht noch weiter beschleunigt werden kann.
Somit verbleiben als "Manöveriermasse" noch die Gepäck-Feinsortierung und -Förderung in der GFA in FRA.<br />
Es bietet sich an, die relativ langen Gepäck-Förderzeiten der GFA in FRA (siehe Tab. 4), welche bei peripheren<br />
Flugzeug-Positionen am Terminal 1 (Fälle 2 und 5) entstehen, durch entsprechend verlängerte Fahrten per<br />
Dolley bzw. Trolley auf dem Vorfeld zu ersetzen (Tab. 5). Das Gepäck muß in diesem Fall nur noch einen<br />
relativ kurzen Weg auf der GFA zwischen Bahnsteig und zentralen Express-Ausgabestellen bewältigen. Dies<br />
verkürzt die Zeitkette des Gepäcks um bis zu 4 Minuten, wie die folgende Tabelle zeigt:<br />
Tab. 5: Zug-System: Zeit-Wegekette Gepäck von FRA nach WIE mit Vorfeldfahrzeugen in FRA statt GFA<br />
(Variante 2)<br />
Prozesse Bemerkungen Fall 2 Fall 5<br />
Entladevorgang Positionierung Fahrzeuge 1,0 1,0<br />
Entladen (4 Cont. für WIE) 4,0 4,0<br />
Transport zum Terminal max. 4250 m bei 25 km/h 4,0 4,0<br />
Verzögerung 25%, mind. 1min 1,0 1,0<br />
Entladung Container 5,0 5,0<br />
Sortierung / Transport 3,0 3,0<br />
Airport-Link Beladung und Wartezeit 4,5 4,5<br />
Fahrzeit 8,0 8,0<br />
Sortierung im GFA WIE Entladung Zug 1,0 1,0<br />
Sortierung / Transport<br />
Transport zum Flugzeug max. 1040 m bei 30 km/h 2,0 1,0<br />
Verzögerung 25%,mind. 1min 1,0 1,0<br />
Beladevorgang nur Gepäck Umsteiger 5,0 5,0<br />
Engine Start und Entfernung Brücken 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 42,0 41,0<br />
Einsparung gegenüber Transport per GFA 4,0 4,0<br />
Mit der weitgehenden Umgehung der GFA in FRA durch den Einsatz von Vorfeldfahrzeugen reduziert sich die<br />
Connection Time um bis zu 4 Minuten, so daß auch im bisher kritischen Fall 2 die Transferzeit von ursprünglich<br />
46 min auf 42 min und im Fall 5 von 45,5 min auf 41 min, also deutlich unter 45 min, verkürzt werden kann.<br />
6.2.8 Zeit-Wege-Ketten bei durchschnittlichen Flugzeug-Positionen<br />
Bei durchschnittlichen Flugzeug-Positionen kann davon ausgegangen werden, daß die zu entladenden<br />
Gepäckmengen kl<strong>einer</strong> sind als in den worst cases. Dies gilt sowohl für das Einzelgepäck als auch für Gepäck in<br />
Containern.<br />
Für den Transport des Gepäcks in der Richtung von WIE nach FRA ergeben sich folgende Änderungen<br />
gegenüber der Worst-case-Betrachtung:<br />
Die Anzahl der Umsteiger nach FRA bei einem in WIE ankommenden Flug beträgt 22 Personen (86 Pax, 25%<br />
Umsteiger-Anteil). Somit ergibt sich eine Anzahl von ca. 33 zu entladenen Gepäckstücken. Falls es sich hierbei<br />
um Einzelgepäck handelt, können die genannten Gepäckstücke in 3 min entladen werden. Der Zeitaufwand zur<br />
Entladung der Container ist bei den Durchschnittsfällen ebenfalls kürzer als im worst case, da aufgrund der<br />
Vorsortierung des Umsteiger-Gepäcks (vgl. Kapitel 2.5.1) davon auszugehen ist, daß bereits beim ersten<br />
Entladevorgang das für den Airport-Link bestimmte Gepäck entladen ist.<br />
Die Zeit für den anschließenden Transport innerhalb von WIE wird sich gegenüber dem worst case nur<br />
unwesentlich verkürzen, da der Shuttle-Bahnhof WIE ohnehin so angelegt, daß die Entfernungen zu den<br />
Flugzeug-Positionen möglichst gering sind.<br />
Dagegen verkürzt sich in FRA die Transportzeit zu den Flugzeug-Positionen, und zwar sowohl zu den Vorfeldwie<br />
auch zu den Gebäude-Positionen. Allerdings liegen die Einsparungen hier maximal bei 2 min. Weiterhin<br />
verkürzt sich im Durchschnittsfall auch die Beladung des Flugzeuges, da auch hier von nur einem<br />
Beladevorgang bzw. von wenigen Einzelgepäckstücken ausgegangen werden kann.
Insgesamt beträgt die Differenz zwischen den ungünstigen Fällen und den Durchschnittsfällen rund 5 min.<br />
In der Gegenrichtung von FRA nach WIE bestehen die Einsparungspotentiale an den gleichen Gliedern der<br />
Prozeßkette wie für die Richtung WIE - FRA (Entladung in FRA, Transport innerhalb von FRA, Beladung in<br />
WIE). Dadurch ergibt sich ebenfalls eine um 5 min kürzere Wegekette für die Durchschnittsfälle.<br />
6.3 Zeit-Wege-Ketten Passagiere<br />
6.3.1 Unterschiede zur Wegekette Gepäck<br />
Im Gegensatz zum Umsteiger-Fluggepäck haben umsteigende Fluggäste zwar den Vorteil, "sich selbst verladen"<br />
zu können, aber ihre Geschwindigkeit ist, da sie sich in den Terminals zu Fuß fortbewegen, niedriger als die des<br />
Gepäcks auf Förderbändern bzw. auf Trolleys/Dolleys. Insgesamt ist die Wegekette für die Passagiere<br />
hinsichtlich der MCT etwas zeitkritischer als die Wegekette des Gepäcks.<br />
Mehrere Aspekte der Passagier-Wegekette bedürfen <strong>einer</strong> näheren Betrachtung:<br />
þ Aussteigen aus dem Flugzeug<br />
þ Wege im Flughafen Frankfurt<br />
þ Grenz- und Zollkontrollen.<br />
Dagegen wurde das Thema "Wege im Flughafen Wiesbaden-Erbenheim" im Zusammenhang mit dem Shuttle-<br />
Bahnhof bereits ausführlich behandelt.<br />
In der im folgenden dargestellten Wegekette der Passagiere sind zwar teilweise Orientierungszeiten<br />
berücksichtigt, etwa beim Aussteigen aus dem Zug, aber diese Wegekette erfordert insgesamt ein konsequentes<br />
"Mitdenken" des Fluggastes. Es wäre sehr vorteilhaft, wenn ein "Passenger Positioning System" (in Anlehnung<br />
an "GPS Global Positioning System") installiert würde, das zwei Funktionen hat: zum einen den umsteigenden<br />
Fluggast durch elektronische Hilfen auf seinem Weg zu unterstützen und zum anderen das Personal am Gate des<br />
Anschlußfluges über den Verbleib eines verspäteten Fluggastes zu informieren. Ein solches System dürfte unter<br />
Berücksichtigung der neuesten Entwicklungen in der EDV-Technik realisierbar sein. Vorstellbar wäre, daß jeder<br />
Fluggast nach s<strong>einer</strong> Landung einen Transponder ausgehändigt bekommt, also eine Chipkarte, die alle bezüglich<br />
des Transfer-Weges relevanten Daten (beispielsweise Nummer des Flugtickets, Flug-Nummer des<br />
Anschlußfluges) enthält und diese Daten an bestimmten Stellen des Umsteige-Weges per Funk die<br />
Informationen aus <strong>einer</strong> Distanz von bis zu 2 m an Baken übermittelt, die am Wegesrand stehen. Hochwertige<br />
Fracht wird heute schon auf ähnliche Weise verfolgt. Hat der Fluggast auf seinem Transfer-Weg die<br />
Orientierung verloren, so kann er einen Bildschirm aufsuchen, auf dem für ihn bestimmte Anweisungen<br />
bezüglich des weiteren Weges erscheinen.<br />
6.3.2 Aussteigen aus dem Flugzeug<br />
Der Aussteigevorgang beginnt, nachdem die Fluggastbrücken positioniert und die Flugzeugtüren geöffnet<br />
wurden. Der Zeitbedarf für diesen Vorgang wird in der Literatur mit 1 bis 2 min angegeben. In der vorliegenden<br />
Untersuchung wird der Mittelwert angenommen (1,5 min).<br />
Es schließt sich der eigentliche Aussteigevorgang an. Auch hier ergeben sich je nach Flugzeugtyp und<br />
Flugzeugkonfiguration unterschiedliche Aussteigeraten. Airbus gibt eine Aussteigerate von 22 Personen pro<br />
Minute für Flugzeuge mit nur einem Gang (z.B. Airbus A 320) an. Für WIE wird ein Flugzeug mit 150<br />
Passagieren angesetzt. Für den hier skizzierten Fall mit 150 Personen entspricht dies einem Zeitaufwand von<br />
knapp 7 min. Die unterstellte Anzahl an Fluggästen ist höher als beim durchschnittlichen Flugzeug, das der<br />
Szenarioflugplan für Wiesbaden-Erbenheim wiedergibt (127 Sitze/Flugzeug).<br />
Auf der Seite FRA muß mit größerem Fluggerät gerechnet werden. Für dieses Szenario wird ein<br />
Referenzflugzeug mit 350 Passagieren angesetzt. Für größere Flugzeuge, welche dann auch zwei Gänge haben,<br />
gelten höhere Aussteigerraten. Boeing und die IATA geben für die Boeing 747 Raten bis zu 30 Personen pro<br />
Minute an. Aber aufgrund der größeren Zahl von Fluggästen ergibt sich trotzdem gegenüber kl<strong>einer</strong>en
Flugzeugen eine größere Zeitspanne für das Aussteigen. Simulationen der Aussteigevorgänge mit <strong>einer</strong> am ARC<br />
für die DASA Hamburg entwickelten Software haben Aussteigezeiten von gut 10 min ergeben. Da die Zeiten der<br />
weiteren Elemente der Wegeketten unverändert bleiben, sind die langen Aussteigezeiten das kritischste Element.<br />
Auf Vorfeldpositionen besteht die Möglichkeit, die Zeiten dadurch zu reduzieren, daß auch die hintere Tür des<br />
Flugzeugs zum Aussteigen genutzt wird, wodurch sich die Zeiten wieder auf 7 min reduzieren können. An den<br />
Terminalpositionen ist das Aussteigen über die hintere Tür nicht möglich, da in Frankfurt Flughafen keine "over<br />
the wing" Brücken vorhanden sind, anders als zum Beispiel in Amsterdam Schiphol.<br />
6.3.3 Wege im Flughafen Frankfurt<br />
Für Fußwege wird eine Geschwindigkeit von 1 m/s (3,6 km/h) angenommen, und zwar unabhängig davon, ob<br />
mit Laufband oder ohne. Auch hier wird ein "worst case" zugrunde gelegt, denn die Geschwindigkeit eines<br />
Fußgängers beträgt im Alltag 5 bis 6 km/h. Laufbänder werden üblicherweise mit 0,75 m/s betrieben und sind<br />
nur dann schneller als ein Fußgänger aus eigener Kraft, wenn zumindest teilweise auf dem Laufband nicht<br />
gestanden, sondern gegangen wird.<br />
Innerer Bereich Flugsteig A, Flugsteige B, C, Gates D13 und D12<br />
Die Fluggäste steigen im Bahnhof T1 aus und erreichen die Flugzeug-Position zu Fuß bzw. sie kommen über<br />
eine Fluggastbrücke vom Zubringerflugzeug und gehen zum Bahnhof T1. Die maximale Weglänge beträgt hier<br />
ca. 600 m, was einem Zeitaufwand von 10 min entspricht.<br />
Wie schon beim Gepäcktransport beschrieben, liegen die Positionen D13 und D12 für den Airport-Link nach<br />
WIE zeitlich näher am Shuttle-Bahnhof T1 als am Shuttle-Bahnhof T2. Da die Fahrt mit dem Shuttlezug von<br />
und nach Bahnhof T2 um 2,5 min länger dauert als von und nach T1, werden die Positionen D13 und D12, die<br />
zum Terminal 2 gehören, dem Bahnhof T1 zugeordnet. Bei ungefähr gleich langer Fußwegzeit wie von und nach<br />
T2 werden so bis zu 2,5 min eingespart.<br />
Äußerer Bereich Flugsteig A<br />
Da die Flugzeug-Positionen am derzeit in Bau befindlichen Erweiterungsbau von Flugsteig A mit bis zu 1100 m<br />
vom Shuttle-Bahnhof T1 extrem weit entfernt liegen (Zeitaufwand für reinen Fußweg: 18 min 20 sec), müssen<br />
die Fluggäste, um die MCT von 45 min überhaupt einhalten zu können, zu diesen peripheren Positionen die Sky<br />
Line benutzen, für die eine Streckenverlängerung geplant ist. Hierfür wird im Bahnhof T1 ein Umsteigen mit<br />
sehr kurzen Wegen, evtl. bahnsteiggleich, vorgesehen. Eine Detailplanung für diese Verknüpfung von Airport-<br />
Shuttle- und Sky-Line-Zügen bleibt der Stufe 2 vorbehalten.<br />
Für Sky-Line-Fahrt plus Fußweg zur äußersten Position am Flugsteig A ergibt sich der folgende Zeitaufwand:<br />
Bahnsteiggleiches Umsteigen auf Sky Line 0,5 min<br />
max. Wartezeit Sky Line 2,0 min<br />
Fahrzeit Bahnhof B nach Bahnhof "A außen"<br />
incl. Zwischenhalt in heutigen Bf A 3,7 min<br />
200 m verbleibender Fußweg 3,3 min<br />
ÄÄÄÄÄÄÄ<br />
9,5 min<br />
Der Zeitaufwand für diese Wegekette ist somit etwas geringer als für den oben beschriebenen reinen Fußweg<br />
von ca. 600 m in den heutigen Flugsteigen A, B und C sowie von zu den Gates D13 und D12, bezogen auf den<br />
Bahnhof T1.<br />
Flugsteige D und E<br />
Die entferntesten Flugzeug-Positionen der Flugsteige D (ohne Gates D13 und D12) und E liegen maximal 440 m<br />
vom Shuttle-Bahnhof T2 entfernt, der gegenüber den Positionen D3 und D5 liegt. Diesen Weg müssen die<br />
Fluggäste zu Fuß überwinden, was einen Zeitaufwand von 7,5 min bedeutet. Hierbei wurde ein neu zu
errichtender diagonaler Fußweg auf der Fluggastebene vom Bahnhof T2 zum Flugsteig D10 außerhalb des<br />
Terminals unterstellt, der den Fußweg um gut 1 Minute verkürzt.<br />
Westliche Vorfeldpositionen<br />
Unterhalb des Bahnhofs T1 liegen auf der Null-Ebene die Haltestellen der Vorfeldbusse für die westlichen<br />
Vorfeld-Positionen. Mit <strong>einer</strong> direkten Rolltreppe und/oder mit Aufzügen wird eine kurze Übergangszeit<br />
zwischen Shuttlezug und Vorfeldbussen hergestellt. Die Fahrt zum Vorfeld geschieht auf der in Kapitel 3.5<br />
beschriebenen neuen Vorfeld-Straße. Die Fahrzeiten entsprechen denen des Gepäcktransports.<br />
Östliche Vorfeldpositionen<br />
Die östlichen Vorfeldpositionen werden mit Bussen angebunden, die von Terminal 2 aus starten. Auch hier sollte<br />
ein kurzer Fußweg zwischen Bahnsteig T2 und den Vorfeldbussen angestrebt werden. Allerdings ist hier<br />
aufgrund der eher kurzen Bus-Fahrtstrecken auf dem Vorfeld die Erreichung der MCT weniger kritisch als bei<br />
den westlichen Vorfeldpositionen.<br />
6.3.4 Grenz- und Zollkontrollen<br />
Die umsteigenden Fluggäste umfassen im Hinblick auf die Herkunfts- und die Zielstaaten ihrer Reise 4 Gruppen:<br />
S: Ankunft aus einem Schengen-Staat, Weiterflug in einen Schengen-Staat<br />
NS: Ankunft aus einem Non-Schengen-Staat, Weiterflug in einen Non-Schengen-Staat<br />
S Ä> NS: Ankunft aus einem Schengen-Staat, Weiterflug in einen Non-Schengen-Staat<br />
NS Ä> S: Ankunft aus einem Non-Schengen-Staat, Weiterflug in einen Schengen-Staat.<br />
Da bei den Gruppen S Ä> NS und NS Ä> S die Personen vom Schengen- in den Non-Schengen-Bereich<br />
überwechseln oder umgekehrt vom Non-Schengen- in den Schengen-Bereich, sind hier Grenzkontrollen<br />
erforderlich. Für die Transfer-Passagiere der Gruppen S und NS ist dagegen keine Grenzkontrolle erforderlich.<br />
Generell gilt, daß im Reiseverkehr zwischen den EU-Staaten keine Zollkontrollen stattfinden. Derartige<br />
Kontrollen werden nur noch dann durchgeführt, wenn die Einreise in ein EU-Land vom Nicht-EU-Bereich aus<br />
erfolgt oder wenn umgekehrt die Ausreise aus der EU in einen Staat führt, welcher der EU nicht angehört.<br />
Da nicht alle EU-Staaten dem Schengener Abkommen angehören,sind beim Flughafen-Verbund WIE + FRA im<br />
Prinzip insgesamt mehr umsteigende Fluggäste von Grenzkontrollen betroffen als von Zollkontrollen.<br />
Andererseits sind jedoch den Grenzkontrollen sämtliche Transfer-Passagiere unterworfen, die den Gruppen S Ä><br />
NS und NS Ä> S angehören, während die Zollkontrollen nur stichprobenartig bzw. nur bei solchen Personen<br />
durchgeführt werden, die bezüglich möglicher zollrechtlicher Vergehen verdächtig erscheinen [18]. Bei <strong>einer</strong><br />
Gesamtbetrachtung ist deshalb die Zollkontrolle weniger zeitaufwendig als die Grenzkontrolle, auch wenn im<br />
Einzelfall die Durchsuchung von Gepäck und Kleidung eines Fluggasts durch Zollbeamte wesentlich länger<br />
dauern kann als die Kontrolle des Passes oder Personalausweises durch die Grenzpolizei.<br />
Um zu vermeiden, daß durch diese Grenz- und Zollkontrollen die Connection Time der betreffenden Passagiere<br />
im Transfer zwischen WIE und FRA über die MCT von 45 min hinaus verlängert wird, werden diese Kontrollen<br />
im Shuttlezug und somit ohne zusätzlichen Zeitaufwand stattfinden.<br />
Es muß gewährleistet sein, daß die beiden Passagiergruppen S und NS während des gesamten Transferprozesses<br />
streng voneinander wie auch von den übrigen Fußgänger-Bereichen der Flughäfen Wiesbaden-Erbenheim und<br />
Frankfurt getrennt sind. Das bedeutet, daß in den Terminals beider Flughäfen für beide Gruppen separate Wege<br />
vorhanden sein müssen, daß die Bahnsteige der Shuttle- Bahnhöfe durch bauliche Maßnahmen entsprechend<br />
unterteilt sind (siehe Abb. 8, 12 und 13) und daß die Shuttlezüge getrennte Personenwaggons für Schengen- und<br />
Non-Schengen-Passagiere haben müssen (siehe Abb. 18), wie dies heute bei der Sky Line in FRA der Fall ist.<br />
Grenzkontrollen
Zur Durchführung der Grenzkontrollen sind im Shuttlezug an der Trennlinie der Sektionen S und NS, auf halber<br />
Länge des mittleren Waggons, mehrere Abfertigungs-Schalter zu installieren, und zwar je zwei für die Richtung<br />
S Ä> NS und NS Ä> S (siehe Abb. 19). Diese Abfertigungs-Schalter entsprechen baulich und bezüglich ihrer<br />
Ausrüstung weitgehend den üblichen stationären Grenzkontrollstellen innerhalb der Flughafen-Terminals. Zur<br />
Durchführung der Grenzkontrolle passieren die Fluggäste der Gruppe S Ä> NS, welche zuvor in den für die<br />
Personengruppe S reservierten Zugteil eingestiegen sind, während der Zugfahrt die Abfertigungs-Schalter und<br />
nehmen nach erfolgter Grenzkontrolle im Zugteil der Gruppe NS ihre Plätze ein. Umgekehrt verlassen die<br />
Fluggäste der Gruppe NS Ä> S den Non-Schengen-Zugteil, in den sie ursprünglich eingesteigen sind, gehen<br />
durch die Kontrollstelle und begeben sich anschließend in den Zugteil S (siehe Abb. 19).<br />
Bei sehr großem Andrang vor den Schaltern <strong>einer</strong> Richtung, also bei unpaarigem Verkehr, welcher die Regel<br />
darstellen wird, ist es möglich, einzelne Abfertigungs-Schalter für die Gegenrichtung "umzupolen", so daß<br />
beispielsweise für die Richtung S Ä> NS drei Kontrollstellen und für die Gegenrichtung nur eine Kontrollstelle<br />
zur Verfügung steht.<br />
Dieses Konzept der Grenzkontrolle wurde in einem mehrstufigen Abstimmungsprozeß mit dem<br />
Bundesgrenzschutzamt Flughafen Frankfurt (Main) entwickelt. Hierzu wurden zum einen zahlreiche Gespräche -<br />
aus terminlichen Gründen nur telefonisch - geführt und zum anderen fand ein umfangreicher Schriftwechsel per<br />
Post und per Telefax statt, wobei die Abb. 18 und 19 dem Bundesgrenzschutzamt mehrmals vorgelegt und<br />
aufgrund des erhaltenen Feedbacks in mehreren Schritten auch modifiziert wurden.<br />
Zollkontrollen<br />
Da nicht alle EU-Staaten dem Schengener Abkommen angehören, beispielsweise Großbritannien nicht, kann<br />
sich die Fluggast-Gruppe NS durchaus aus Personen zusammensetzen, die aus dem Nicht-EU-Bereich<br />
kommend, in ein EU-Land weiterreisen oder die aus der EU in einen Nicht-EU-Staat weiterfliegen. Aus diesem<br />
Grunde sind im Zugteil NS Zollkontrollen durchzuführen. Es liegt nahe, genauso zu verfahren, wie dies im<br />
internationalen Eisenbahnverkehr zwischen EU- und Nicht-EU-Ländern praktiziert wird, indem nämlich die<br />
Zollbeamten durch den Waggon gehen und hierbei das Gepäck der Fahrgäste kontrollieren. Dieses Verfahren<br />
dürfte auch angesichts des erforderlichen Zeitaufwandes im fahrenden Zug machbar sein, denn die<br />
Zollkontrollen werden im Gegensatz zu den Grenzkontrollen nur stichprobenartig vorgenommen [19].<br />
Allerdings ist es erforderlich, daß ein mit <strong>einer</strong> Sichtblende versehener Tisch vorhanden ist, auf dem zu<br />
kontrollierendes Handgepäck dargelegt werden kann. Diese Sichtblende dient zur Wahrung des<br />
Steuergeheimnisses und zu <strong>einer</strong> diskrete Zollkontrolle [20]. Es bietet sich an, diesen abgeschirmten Bereich<br />
unmittelbar neben den Grenzkontroll-Schaltern einzurichten (siehe Abb. 19). Zur Abstimmung dieses Konzepts<br />
der Zollabfertigung fanden zahlreiche Telefongespräche und ein Schriftwechsel mit dem Hauptzollamt Frankfurt<br />
am Main-Flughafen statt.<br />
Anpassung an die Zahl der Schengen- und Non-Schengen-Passagiere<br />
Da die Größe der beiden Passagier-Gruppen S und NS stark schwankt, ist eine flexible Unterteilung jedes Zuges<br />
in einen Schengen- und einen Non-Schengen-Abschnitt notwendig. Zu diesem Zweck ist es denkbar, den<br />
mittleren Waggon, in welchem sich der Abfertigungs-Schalter befindet, als Doppelstock-Wagen zu bauen,<br />
dessen Untergeschoß durch diesen Schalter hinsichtlich S und NS zweigeteilt ist und dessen Obergeschoß, je<br />
nach Bedarf entweder der Gruppe S oder der Gruppe NS vorbehalten ist. Da jeder Doppelstock-Waggon über<br />
jeweils eine Treppe an den Wagenenden verfügt, ist immer nur eine Treppe als Verbindung zwischen dem<br />
Unter- und Obergeschoß offen (siehe Abb. 18), entweder vom Schengen-Abteil oder vom Non-Schengen-Abteil<br />
aus nach oben. Die jeweils andere Treppe ist verriegelt, so daß sich die beiden Passagier-Gruppen nicht mischen<br />
können.<br />
6.3.5 Erzielbare Connection Time bzgl. Passagiere<br />
Wie schon beim Gepäcktransport wird auch bei der Wegekette der Passagiere eine Aneinanderreihung von<br />
Worst-Case-Ereignissen unterstellt: äußerste Gebäude-oder Remoteposition in WIE, Shuttlezug fährt dem<br />
Fahrgast "vor der Nase weg", ungünstigste Positionen und großes Flugzeug in FRA. Die angenommenen<br />
konkreten sechs Fälle entsprechen genau denen beim Gepäck.
Die Zeile "Orientierung" enthält ggfs. auch einen Zuschlag für den Ebenenwechsel sowie den Aussteigevorgang<br />
aus dem Shuttle-Zug.<br />
Tab. 6: Zug-System: Übersicht über die möglichen Beziehungen des Personentransfers<br />
Fall von bzw. nach von bzw. nach<br />
Nr.<br />
1 Äußere Remoteposition in WIE Westliche Vorfeldposition in FRA (V270)<br />
2 Äußere Remoteposition in WIE D12 in FRA über Shuttle-Bahnhof T1<br />
3 Äußere Remoteposition in WIE D11 in FRA über Shuttle-Bahnhof T2<br />
4 Gebäudeposition in WIE (äußerer Pier) Westliche Vorfeldposition in FRA (V270)<br />
5 Gebäudeposition in WIE (äußerer Pier) D12 in FRA über Shuttle-Bahnhof T1<br />
6 Gebäudeposition in WIE (äußerer Pier) D11 in FRA über Shuttle-Bahnhof T2<br />
Tab. 7: Zug-System: Zeit-Wegekette Passagiere von WIE nach FRA<br />
Prozesse Bemerkungen Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6<br />
Positionierung Brücken 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5<br />
Deboarding 150 Pax bei 22 Pax/min 4,5** 4,5** 4,5** 7,0 7,0 7,0<br />
Weg zum Bus 0,5 0,5 0,5<br />
Bustransfer (Vorfeld) 600 m bei 30 km/h 1,5 1,5 1,5<br />
Verzögerung mind. 0,5 min 0,5 0,5 0,5<br />
Wege im Terminal Fußweg zum Bahnsteig 5,0 5,0 5,0<br />
Aussteigen Bus 1,0 1,0 1,0<br />
Ebenenwechsel 0,5 0,5 0,5<br />
Orientierung 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Fußweg zum Zug 0,5 0,5 0,5<br />
Airport-Link Warten am Bahnhof 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5<br />
Fahrzeit (incl.Grenzkontr.) 8,0 8,0 10,5 8,0 8,0 10,5<br />
Aussteigen aus Zug 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5<br />
Wege im Terminal Orientierung 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Ebenenwechsel 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5<br />
Weg zum Gate 1,5 10,5 8,0 1,5 10,5 8,0<br />
Bustransfer (Vorfeld) Einsteigen (letzter Pass.) 0,5 0,5<br />
i.d.R. 25 km/h 6,5* 6,5*<br />
Verzögerung 25%,mind.1min 1,0 1,0<br />
Aussteigen Bus (letzter P.) 1,0 1,0<br />
vom Bus zur Flugzeugtür 0,5 0,5<br />
Boarding letzter Passagier 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0<br />
Engine Start und Entfernung Brücken 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 42,5 39,5 39,5 46,5 43,5 43,5<br />
Tab. 8: Zug-System: Zeit-Wegekette Passagiere von FRA nach WIE<br />
Prozesse Bemerkungen Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6<br />
Positionierung Brücken 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5<br />
Deboarding 350 Pax 7** 10,5 10,5 7** 10,5 10,5<br />
Ebenenwechsel 0,5 0,5<br />
Bustransfer (Vorfeld) i.d.R. 25 km/h 6,5* 6,5*<br />
Verzögerung 25%,mind.1min 1,0 1,0<br />
Aussteigen Bus 1,0 1,0<br />
Wege im Terminal Weg zum Bahnsteig 1,5 10,5 8,0 1,5 10,5 8,0<br />
Orientierung 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Ebenenwechsel 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5<br />
Airport-Link Warten am Bahnhof 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5<br />
Fahrzeit (incl.Grenzkontr.) 8,0 8,0 10,5 8,0 8,0 10,5<br />
Aussteigen aus Zug 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Wege im Terminal Ebenenwechsel 0,5 0,5 0,5<br />
Orientierung 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Vom Bahnsteig zum Gate 0,5 0,5 0,5 5,0 5,0 5,0<br />
Bustransfer (Vorfeld) Einsteigen (letzter Pass.) 0,5 0,5 0,5<br />
600 m bei 30 km/h 1,5 1,5 1,5<br />
Verzögerungszeiten 0,5 0,5 0,5<br />
Aussteigen Bus (letzter P.) 1,0 1,0 1,0<br />
Ebenenwechsel 0,5 0,5 0,5<br />
Boarding letzter Passagier 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0<br />
Engine Start und Entfernung Brücken 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 45,0 48,0 48,0 44,0 47,0 47,0<br />
* Nutzung der neuen Zubringerstraße für westliches Vorfeld wie in Kapitel 3.5 beschrieben. Die<br />
Verzögerungszeiten beziehen sich nur auf das Vorfeld selbst, nicht aber auf die neue Zubringerstraße. Ohne neue<br />
Zubringerstraße verlängert sich die Fahrzeit um 4 min.<br />
** Aussteigevorgang auf dem Vorfeld über zwei Brücken<br />
In der Richtung von WIE nach FRA kann die MCT von 45 min, abgesehen von Fall 4, eingehalten werden. In<br />
diesem Fall kann jedoch die MCT von 45 min erreicht werden, wenn mindestens zwei Vorfeldbusse in FRA zum<br />
Flugzeug fahren und der letzte Bus nicht mehr als 25 Passagiere befördert. In der Richtung von FRA nach WIE<br />
wird dagegen die MCT in 4 der 6 Fälle überschritten, und zwar um bis zu 3 min, was auf sehr ungünstige<br />
Gebäude-Positionen in FRA mit extrem langen Fußwegen zwischen Gate und Shuttle-Bahnhof zurückzuführen<br />
ist. Deshalb sind hier zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um die geforderte MCT von 45 min dennoch<br />
erreichen zu können. Diese Maßnahmen werden im folgenden diskutiert.<br />
6.3.6 Maßnahmen zur Verkürzung der Connection Time<br />
Langsamster und schnellster Fluggast<br />
Die vorgestellten Zeit-Wegeketten sind nicht nur hinsichtlich der Flugzeug-Positionen ungünstigste Fälle,<br />
sondern auch hinsichtlich des Verhaltens der Passagiere. Denn es wird grundsätzlich der "langsamste Fluggast"<br />
betrachtet, der sich durch vier Merkmale auszeichnet:<br />
þ Er steigt zuletzt aus dem Flugzeug aus<br />
þ Er bewegt sich im Durchschnitt nur mit 1,0 m/s (3,6 km/h), was beispielsweise bei Eltern mit Kleinkind oder<br />
einem<br />
älterer Fluggast mit schwerem Handgepäck der Fall ist.<br />
þ Er ist orts-unkundig und benötigt also die veranschlagte Orientierungszeit in voller Länge.<br />
þ Ihm fährt der Shuttlezug "vor der Nase weg", so daß er die volle Zugfolgezeit (4 min 30 sec) bis zur Abfahrt<br />
des<br />
nächsten Zuges warten muß.<br />
Den Kontrast hierzu bildet der Fluggast mit den genau entgegengesetzten Merkmalen, also der "schnellste<br />
Fluggast":<br />
þ Er steigt als erster aus dem Flugzeug aus.<br />
þ Er bewegt sich innerhalb des Terminals mit <strong>einer</strong> Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,3 m/s. Üblicherweise<br />
wird zwar die Gehgeschwindigkeit eines normalen Erwachsenen, der nur leichtes Handgepäck mit sich führt, mit<br />
1,7 m/s angesetzt, aber aufgrund der Situation im Terminal, insbesondere wegen Behinderung durch querende<br />
oder im Weg stehende einzelne Fußgänger oder ganze Personengruppen, muß mit der genannten, reduzierten<br />
Geschwindigkeit gerechnet werden.<br />
þ Er ist ortskundig, und zwar bezüglich aller Wege beim Umsteigen.<br />
þ Er erreicht den Shuttlezug unmittelbar bevor dieser abfährt, und hat somit k<strong>einer</strong>lei Zeitverlust durch Warten<br />
auf den nächsten Zug.<br />
In Abb. 20 werden diese beiden Extremfälle von Umsteigern anhand der längsten Umsteigeverbindung (Fall 5)<br />
veranschaulicht. Der Vergleich zeigt, daß der schnellste Fluggast den Sitzplatz im Anschlußflugzeug 20,5 min<br />
vor dem letzten Fluggast erreicht. Die Umsteige-Fluggäste verteilen sich somit auf insgesamt 5 Shuttlezüge. Es<br />
entsteht für gut 20 min am Abflug-Gate ein fast kontinuierlicher Strom ankommender Fluggäste. Die
durchschnittliche Umsteigezeit liegt hierbei zwischen der des schnellsten und des langsamsten Fluggastes. Somit<br />
wird deutlich (siehe Abb. 20), daß nur ein kl<strong>einer</strong> Teil der umsteigenden Fluggäste überhaupt die MCT von 45<br />
min verfehlt.<br />
Einzelfahrten für langsame Passagiere ("Feuerwehr-Einsätze")<br />
In dem oben beschriebenen Fall, wenn also ein Fluggast den letzt möglichen Shuttlezug von FRA nach WIE<br />
verpaßt, sind Einzelfahrten über das Vorfeld zweckmäßig. Diese Sonderfahrten, die man als "Feuerwehr-<br />
Einsätze" bezeichnen kann, beginnen immer im Bahnhof WIE und führen zum abflugbereiten Flugzeug. Die<br />
umgekehrte Richtung, nämlich vom gelandeten Flugzeug zum Shuttle-Bahnhof, ist irrelevant, weil die<br />
betreffende Zeit-Wege-Kette wesentlich entspannter ist.<br />
Diese Sonderfahrten könnten wie folgt organisiert werden: Mit dem in Kapitel 6.2.1 erwähnten "Passenger<br />
Positioning System" müssen Passagiere im Zug identifiziert werden. Das vorhandene Computer-System erkennt<br />
selbständig, daß ein Fluggast den letzten Zubringerzug verfehlt hat, mit dem er noch problemlos das Flugzeug<br />
erreichen könnte, und er nun im nachfolgenden Zug sitzt. Diese Information liegt spätestens dann dem System<br />
vor, wenn der Fluggast den nachfolgenden Zug betritt. Es bleibt dann die Zeitspanne der Zug-Fahrzeit von<br />
mindestens 8 min (von T1 nach WIE), um einen PKW auf dem Bahnsteig in WIE bereitzustellen. Im Zug wird<br />
der verspätete Fluggast vom Zugbegleitpersonal persönlich angesprochen und gezielt zum PKW geleitet.<br />
Diese Sonderbehandlung für verspätete Fluggäste kann sowohl bei entfernten Gebäudepositionen als auch bei<br />
Vorfeldpositionen zur Anwendung kommen. Bei Gebäude-Positionen liegt die hauptsächliche Einsparung von<br />
Zeit im Ersatz von Fußwegen durch PKW-Fahrten, während bei Vorfeldpositionen die Einsparung im<br />
weitgehenden Wegfall der Boarding-Zeit liegt. Denn fährt ein vollbesetzter Bus an eine Vorfeldposition,<br />
benötigen die Fluggäste relativ lange, bis sie nacheinander einsteigen.<br />
Mit dieser Sonderbehandlung in Form <strong>einer</strong> PKW-Vorfeldfahrt wird das Anschlußflugzeug noch sicher erreicht:<br />
In der konventionellen Wegekette (Tab. 8 Fall 5) stehen von der Ankunft des Shuttlezuges in WIE bis zum Off-<br />
Block 10,5 min zur Verfügung. Benutzt der Fluggast dagegen einen Zug, der um 4,5 bzw. 5 min später verkehrt,<br />
so bleiben nur noch 5,5 bzw. 6 min übrig. Mit der direkten Betreuung des verspäteten Fluggastes und der<br />
"Feuerwehr-Fahrt" reicht dieser Zeitraum jedoch immer noch aus:<br />
0,5 min Fußweg vom Zug zum PKW<br />
1,5 min für 300 m Fahrtstrecke per PKW incl. Verzögerungszeiten<br />
1,0 min Boarding allerletzter Fluggast<br />
2,5 min Off-Block<br />
ÄÄÄÄÄÄÄ<br />
5,5 min von der Ankunft des Zuges bis Off-Block<br />
Im Falle der Sonderbehandlung von Vorfeldpositionen in WIE (Tab. 8 Fall 2) ergibt sich ein ähnlicher<br />
Zeitbedarf. Unterstellt man im Normalfall von der Ankunft des Zuges bis Off-Block einen Zeitaufwand von 11,5<br />
min, so ergibt sich bei der PKW-Vorfeldfahrt die folgende Zeitspanne:<br />
0,5 min Fußweg vom Zug zum PKW<br />
2,0 min für 600 m Fahrtstrecke per PKW incl. Verzögerungszeiten<br />
1,0 min Boarding allerletzter Fluggast<br />
2,5 min Off-Block<br />
ÄÄÄÄÄÄÄ<br />
5,5 min von der Ankunft des Zuges bis Off-Block<br />
Die hier dargestellten "Feuerwehr-Fahrten" sind nur bei extremen Worst-Case-Positionen erforderlich. Wenn der<br />
Fluggast beispielsweise in FRA an <strong>einer</strong> um 120 Meter günstiger liegenden Gebäude-Position ankommt oder das<br />
in FRA landende Flugzeug nicht die maximale Größe und Besetzung hat, ergibt sich schon keine Notwendigkeit<br />
von derartigen Einsätzen mehr, so lange die in FRA landenden Flugzeuge pünktlich sind.<br />
6.3.7 Zeit-Wege-Ketten bei durchschnittlichen Flugzeug-Positionen<br />
Bislang wurden nur die Flugzeug-Positionen mit jeweils maximaler Wegelänge in den Flughäfen WIE und FRA<br />
betrachtet. Viele Flugzeug-Positionen liegen jedoch nicht so weit von den Shuttle-Bahnhöfen entfernt wie in den<br />
"Worst-Case"-Zeit-Wegeketten (vgl. Tab. 7 und 8) dargestellt.
Die günstigste Position in FRA ist für die Zug-Lösung der Flugsteig C2 mit nur 150 m Fußweg bis zum<br />
Bahnsteig. Gegenüber den in Tab. 7 und 8 unterstellten sehr langen Fußwegen ergibt sich hier eine Verkürzung<br />
der Zeit-Wege-Kette um 8 min. Hinzu kommt eine kürzere Deboarding-Zeit (4 min statt 10,5 min), da sich diese<br />
Flugzeug-Position nur für kleine Flugzeuge eignet. Somit ergibt sich für die denkbar günstigste Flugzeug-<br />
Position in FRA eine Reduzierung der Connection Time gegenüber den ausgewiesenen Werten in Tab. 7 und 8<br />
von 14,5 min für den langsamsten Fluggast.<br />
Bei der größten Zahl der Flugzeug-Positionen dürften jedoch die Zeit-Wege-Ketten näher bei den in Tab. 7 und<br />
8 unterstellten "Worst-Case-Positionen" als bei der soeben beschriebenen Best-Case-Position C2 liegen. Denn<br />
der Schwerpunkt der Flugsteige in FRA umfaßt Gebäude-Positionen für mittlere und große Flugzeuge, die von<br />
den beiden Shuttle-Bahnhöfen aus über einen Fußweg von jeweils 400 bis 500 m erreichbar sind.<br />
Vergleicht man Durchschnittspositionen in WIE mit den in den Tabellen unterstellten Worst-Case-Positionen, so<br />
ergibt sich nur eine geringe Reduzierung der Connection Time, denn die meisten Gebäude-Positionen in WIE<br />
liegen vom Shuttle-Bahnhof aus in <strong>einer</strong> Entfernung, die weitgehend den unterstellten Worst-Case-Fällen<br />
entspricht. Deshalb ist in WIE mit <strong>einer</strong> Verkürzung der Fußwege von nur rund 1 min zu rechnen. Des weiteren<br />
ergeben sich Verkürzungen gegenüber dem worst case beim Deboarding, indem ein Mix aus kl<strong>einer</strong>en und<br />
mittelgroßen Flugzeugen angenommen wird.<br />
Die Zeit-Wege-Kette von WIE nach FRA wird somit gegenüber Fall 5 in Tab. 7 bei Durchschnitts-Positionen<br />
und -Flugzeuggrößen wie folgt verkürzt:<br />
43,5 min Connection Time bei Worst-Case Fall 5<br />
-1,5 min verkürztes Deboarding<br />
-0,5 min verkürzter Fußweg in WIE<br />
-3,0 min verkürzter Fußweg in FRA<br />
ÄÄÄÄÄÄÄÄ<br />
38,5 min durchschnittliche Connection Time (langsamster Fluggast)<br />
In der Richtung von FRA nach WIE ergibt sich gegenüber Fall 5 in Tab. 8 folgendes Bild:<br />
47,0 min Connection Time bei Worst-Case Fall 5<br />
-3,5 min verkürztes Deboarding<br />
-3,0 min verkürzter Fußweg in FRA<br />
-0,5 min verkürzter Fußweg in WIE<br />
ÄÄÄÄÄÄÄÄ<br />
40,0 min durchschnittliche Connection Time (langsamster Fluggast)<br />
Somit ergibt sich beim Zugsystem eine Connection Time in der Richtung FRA -WIE von 40 min und in der<br />
Gegenrichtung sogar von unter 40 min. Das bedeutet, daß bei durchschnittlichen Flugzeug-Positionen und<br />
durchschnittlicher Flugzeuggröße selbst der langsamste Fluggast eine Transferzeit erreicht, die um 5 min bzw.<br />
um bis zu 6,5 min unter der geforderten MCT liegt.<br />
7. Zeit-Wege-Ketten Bus-System<br />
7.1 Zu untersuchende Fälle<br />
Die Zeit-Wege-Ketten werden für sechs verschiedene Umsteigebeziehungen untersucht. Dabei repräsentieren die<br />
ersten drei Transfer-Relationen sehr ungünstige Fälle (worst cases) und die drei anderen Relationen<br />
Durchschnittsfälle.<br />
Die folgende ausführliche Darstellung der Wegeketten erfolgt anhand der ersten ungünstigen Relationen (Fall 1).<br />
Für die folgenden fünf Relationen werden nur die sich ergebenden Unterschiede erläutert.<br />
Die Angaben seitens der FAG zu dem Szenarioflugplan lauten, daß die durchschnittliche Anzahl von<br />
Passagieren je Flug 86 beträgt. Weiterhin wird ein durchschnittlicher Umsteigeranteil von 25% in Erbenheim<br />
angegeben, dies würde <strong>einer</strong> Anzahl von 22 Umsteigern je Flug in Erbenheim entsprechen. Dabei ist nicht<br />
gesagt, wie hoch der Anteil der dann nach Frankfurt umsteigenden Passagiere ist.
In der Berechnung der Zeitketten der Fälle 1 - 3 wird jedoch von ungünstigeren Lastfällen ausgegangen. Für<br />
Gebäude-Positionen wird daher ein Flugzeug mit 150 Passagieren angesetzt. Dies entspräche einem Flugzeugtyp<br />
der Größe Boeing 737-400 oder Airbus A320 bei 100% Auslastung. Des weiteren wird der Umsteigeranteil des<br />
Lastfalles auf 60% erhöht und der Anteil der Umsteiger nach Frankfurt zu 75% angenommen. Dieses ergibt eine<br />
Umsteigeranzahl von 68 Passagieren. Dies ist mehr als das dreifache des Durchschnittsfalles und soll einen<br />
ungünstigen Spitzenfall repräsentieren.<br />
Auch für die Lasten in Frankfurt wird ein ungünstiger Fall angenommen. Die Durchschnittsanzahl der Fluggäste<br />
je Flug beträgt nach Angaben der FAG 132 Passagiere je Flug. Für das hier untersuchte Szenario werden für den<br />
Aussteigefall 350 Passagiere angesetzt (das 2,5 fache des Durchschnittfalles) und entspricht damit in etwa der<br />
Sitzplatzanzahl <strong>einer</strong> Boeing 747 mit Dreiklassenbestuhlung (LH B747-400 368 Plätze). Die zuvor erläuterten<br />
Durchschnittslasten werden in den Fällen 4 - 6 bearbeitet.<br />
Weiterhin werden ungünstige Positionen angesetzt, an denen die Flugzeuge abgefertigt werden. Dies sind solche,<br />
bei denen lange Wege in den Terminals bzw. auf dem Vorfeld anfallen. Die ungünstigen Kombinationen der<br />
Wege zwischen den Positionen wird durch die Fälle 1 - 3 wiedergegeben. Die Mehrzahl der Umsteige-<br />
Relationen wird jedoch auf kürzeren Wegen stattfinden, so daß zusätzlich auch Durchschnittsfälle betrachtet<br />
werden (Fälle B4 - B6).<br />
Fall B1:<br />
þ äußerste Gebäude-Position am Satellitenterminal in WIE<br />
þ Flugzeug mit 150 Passagieren in WIE (aus Non-Schengen)<br />
þ davon 60 Umsteiger von/nach FRA (nach Schengen)<br />
þ ungünstigste Gebäude-Position in FRA (E9)<br />
þ Flugzeug mit 350 Passagieren in FRA<br />
þ davon 40 Umsteiger von/nach WIE; diese WIE-FRA-Umsteiger-Quote ist relativ gering, da die meisten<br />
Passagiere dieses<br />
Fluges Originärpassagiere von/nach FRA bzw. Umsteiger innerhalb von FRA sind.<br />
Fall B2:<br />
þ Vorfeldposition am Satellitenterminal in WIE<br />
þ Flugzeug mit 150 Passagieren in WIE (aus Non-Schengen)<br />
þ davon 60 Umsteiger von/nach FRA (nach Schengen)<br />
þ ungünstigste Gebäude-Position in FRA (E9)<br />
þ Flugzeug mit 350 Passagieren in FRA<br />
þ davon 40 Umsteiger von/nach WIE<br />
Fall B3:<br />
þ Äußerste Gebäude-Position am Satellitenterminal in WIE<br />
þ Flugzeug mit 150 Passagieren in WIE (aus Non-Schengen)<br />
þ Davon 60 Umsteiger nach FRA (nach Schengen)<br />
þ ungünstigste Vorfeldposition in FRA (V92)<br />
þ Flugzeug mit 90 Passagieren in FRA<br />
þ davon 20 Einsteiger von WIE<br />
Fall B4:<br />
þ durchschnittliche Gebäude-Position am Satellitenterminal in WIE<br />
þ Flugzeug mit 86 Passagieren in WIE (aus Non-Schengen)<br />
þ davon 22 Umsteiger nach FRA (nach Schengen)<br />
þ durchschnittliche Vorfeldposition in FRA (V162)<br />
þ Flugzeug mit 132 Passagieren in FRA<br />
þ davon 20 Einsteiger von / nach WIE<br />
Fall B5: Gebäude-Position B42<br />
Fall B6: Gebäude-Position D9
Abgesehen von dieser unterschiedlichen Position in FRA, unterscheiden sich die Fälle B5 und B6 nicht vom Fall<br />
B4.<br />
Der Anteil der Umsteiger, die zwischen Schengen und Non-Schengen wechseln wird zu 100% angenommen.<br />
7.2 Zeit-Wege-Ketten Gepäck<br />
7.2.1 Übersicht über die Gepäck-Wegekette<br />
Wie eingangs erläutert, wird bei der Lösung Bus-System von der Prämisse ausgegangen, daß eine<br />
Gepäckvorsortierung in jedem Flugzeug mit Zielflughafen FRA nach den beiden Kategorien Umsteigergepäck<br />
ab WIE und ab FRA vorgenommen wird. Beim Bus-System wird das Fluggepäck jedoch - im Gegensatz zum<br />
Zugsystem -stationär im Terminal Wiesbaden-Erbenheim behandelt, indem es hier aus den Containern entladen<br />
und in die hier vorhandene GFA zum Sortieren und zur weiteren Förderung eingespeist wird. Um insbesondere<br />
den Zeitaufwand für das Entladen der Container gegenüber der Zug-Lösung zu kompensieren, müssen die Wege<br />
zur GFA in WIE so kurz wie möglich sein und die Zeit in der GFA muß auf das Minimum reduziert werden.<br />
Durch die GFA in WIE werden bereits Container für die Anschluß-Flugzeuge mit Umsteigergepäck bestückt.<br />
Bei der umgekehrten Transfer-Richtung werden die Gepäck-Container, die Gepäck für Anschluß-Flugzeuge in<br />
WIE enthalten, nach WIE transportiert, hier entladen. Das Umsteiger-Gepäck durchläuft dann die GFA in WIE<br />
in umgekehrter Richtung.<br />
7.2.2 Beschreibung der Wegekette von WIE nach FRA<br />
Entladung des Flugzeugs<br />
Hier wird wieder grundsätzlich unterschieden zwischen Flugzeugen mit Gepäck-Containern und solchen, in<br />
denen das Gepäck lose in den Gepäckräumen verstaut ist.<br />
Bei Flugzeugen mit Containern wird davon ausgegangen, daß sich das Umsteigergepäck für Anschlußflüge ab<br />
Frankfurt in getrennten Containern befindet. Diese Container werden zuerst entladen, da der Transport des<br />
weiteren Gepäcks (Originär, Umsteiger innerhalb WIE) als zeitlich unkritisch angesehen werden kann. Für<br />
dieses Szenario wird davon ausgegangen, daß spätestens mit dem 4. Container (ULD3) die Entladung des<br />
Umsteigergepäcks nach FRA beendet ist. Der Zeitbedarf zur Entladung der 4 Container wird zu 6 Minuten<br />
angesetzt. Darin enthalten sind 2 Minuten zur Positionierung des Abfertigungsgerätes und jeweils 2 Minuten zur<br />
Entladung von 2 Containern.<br />
Wie bereits für das Zug-System erläutert, ist die Entladung des Gepäcks bei Flugzeugen ohne Container kritisch,<br />
solange kleine Flugzeugtypen davon betroffen sind (z.B. 50 Sitzer). Bei größeren Flugzeugen muß ein System<br />
geschaffen werden, daß es ermöglicht, daß das kritische Umsteigergepäck in dem Gepäckraum zuvorderst liegt<br />
(siehe Kapitel 6.2.1). In diesem Fall ist eine Entladung des kritischen Gepäcks in 5 Minuten zu verwirklichen.<br />
Bei Flugzeugen mit loser Beladung in Gepäckräumen gestaltet sich die Aufteilung des Gepäcks schwieriger. Bei<br />
Flugzeugen mit nur geringem Passagieraufkommen (z.B. 50 Sitzplätze) ist die Situation unkritisch, da hier das<br />
gesamte Gepäck in kurzer Zeit entladen werden kann und anschließend in der GFA das Umsteigegepäck nach<br />
FRA identifiziert wird.<br />
Bei größeren Flugzeugen, die keine Containerbeladung ermöglichen (Boeing 737, Boeing 757) ist dies nicht<br />
möglich, da die komplette Gepäckentladung zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Diese Flugzeuge verfügen<br />
über jeweils zwei Gepäckräume. Hier würde somit die Möglichkeit bestehen, daß Gepäck getrennt auf die beiden<br />
Frachträume zu verteilen. Bei <strong>einer</strong> ungünstigen Aufteilung der Gepäckmengen, kann sich jedoch die Verteilung<br />
auf zwei Gepäckraume als nicht ausreichend erweisen, daher müssen weitere Möglichkeiten zur Vorsortierung<br />
getroffen werden.
Eine Möglichkeit ist hier die gezielte Beladung des Frachtraumes in der Form, daß zum Schluß das<br />
Umsteigergepäck nach FRA beladen wird. Somit kann dieses Gepäck als erstes entladen werden. Dies würde<br />
eine deutliche Abtrennung dieses Gepäcks im Frachtraum erfordern, was durch Netze geschehen kann.<br />
Durch eine solche Beladung kann auch für Flugzeuge mit Bulk Gepäck sichergestellt werden, daß das<br />
Umsteigegepäck nach FRA zuerst entladen wird. Der Logistikaufwand am Ausgangsflughafen entspricht dem<br />
der getrennten Beladung verschiedener Container.<br />
Der Zeitbedarf der Gepäckentladung bei losen Gepäckstücken wird zu 6 Minuten angesetzt. Darin enthalten ist<br />
die Positionierung des Förderbandes (1 min) und der Entladevorgang für 50 Gepäckstücke (ca. 30 % des<br />
Gepäcks <strong>einer</strong> vollbesetzten Boeing 737) mit 5 Minuten (6 sec. je Gepäckstück).<br />
Anschließend erfolgt der Transport zur GFA im Satellitenterminal. Der Weg hierfür beträgt maximal 100 m.<br />
Inklusive Verlustzeiten durch kreuzenden Verkehr wird hierfür ein Bedarf von 1 min angesetzt<br />
(Durchschnittsgeschwindigkeit 6 km/h). Die Verlustzeiten durch kreuzenden Verkehr können in WIE nicht so<br />
hoch wie in FRA sein, da der Gesamtverkehr in WIE geringer ist und bei der Neuplanung eines Flughafen die<br />
Möglichkeit besteht, das Konzept für den Vorfeldverkehr zu optimieren.<br />
Gepäcksortierung und -förderung in Wiesbaden-Erbenheim<br />
Im Erdgeschoß des Satelliten (+/-0,00m, Durchmesser 64,00m) befinden sich zwei Gepäcksortierbereiche, je<br />
<strong>einer</strong> Hälfte des Satelliten zugeordnet. Ziel ist auch hierbei eine größtmögliche Wegeverkürzung der<br />
langsamsten Kettengleider. Die Gepäcksortierbereiche sind getrennt in Vorfeldabfertigung,<br />
Transporterabfertigung und Sortieranlage. Von innen nach außen ist diese Ebene in folgende Zonen eingeteilt:<br />
þ Abgeschlossener Technikbereich<br />
þ Zuführung Vorfeldabfertigung und Transferbänder (Zentralterminal, zweiter Gepäckkreisel)<br />
þ Kippschalensorter<br />
þ Zuführung Transporterabfertigung, manuelle Korrekturstation der Gepäcklabel bei fehlerhaften Schildern und<br />
Brandschutztreppen aus dem OG und UG<br />
þ Haltespur und Durchfahrtspur der Gepäcktransporter (Schnellverbindung nach FRA)<br />
þ Außenwand mit Ein- und Ausfahrten<br />
þ Aufnahme- und Abgabebänder der Vorfeldabfertigung<br />
þ Gebäudenahe Vorfeldstraße<br />
þ Rotunden der Fluggastbrücken<br />
þ Standplatzbereich der Flugzeuge<br />
þ Vorfeldseitige Servicestraße.<br />
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, daß die Be- uns Entladebereiche für die Vorfeldabfertigung in Wiesbaden<br />
und die Abfertigung der Gepäcktransporter (Schnellverbindung nach FRA) räumlich voneinander getrennt<br />
worden sind. Auf diese Weise wird eine fahrtechnische Entkopplung der unterschiedlichen Fahrzeuge, eine<br />
Trennung ihrer unterschiedlichen Abfertigungstechniken und -zyklen und der notwendige Durchsatz erreicht.<br />
Das Gepäck der in Wiesbaden ankommenden Passagiere wird in der Reihenfolge<br />
þ Transfer nach Frankfurt<br />
þ Transfer in Wiesbaden<br />
þ Sonstige<br />
entladen und mittels Dolleys /Trolleys zu den Abgabebändern an der Fassade gebracht. Diese Entladeplätze sind<br />
durch die 5 m weite Auskragung des Obergeschosses weitgehend vor Witterung geschützt. Über das<br />
Abgabeband wird das unkodierte Gepäck zuerst unterirdisch zum Kippschalensorter transportiert und vor der<br />
Übergabe durch eine Scanner-Dusche (Leserate ca. 90-95% bei Transfergepäck) auf seine Zielrichtung kodiert.<br />
Danach wird das Gepäckstück mit seinem Zielcode auf den Kippschalensorter übergeben. Über diesen wird das<br />
Gepäckstück bis zu s<strong>einer</strong> Ausgabestelle gebracht und an das Aufnahmeband übergeben. Die dabei<br />
zurückgelegte Strecke pro Gepäckstück kann im ersten Gepäckkreisel maximal 150 m betragen. Sofern sich<br />
seine Ausgabestelle aber im zweiten Gepäckkreisel befindet, muß es über eine unterirdische<br />
Hochgeschwindigkeitsstrecke zu diesem transportiert werden. Die Gesamtstrecke kann in diesem Fall bis zu 230<br />
m in den beiden Gepäckkreiseln (1m/s) und 200m in der Hochgeschwindigkeitsstrecke (5-10 m/s) betragen.<br />
Sofern die Label mit der Zielinformation am Gepäckstück nicht automatisch lesbar sind (durch Beschädigung<br />
oder Schmutz) wird das Gepäckstück trotzdem an den Kippschalensorter übergeben und an der nächsten der drei
Korrekturstationen abgeworfen. Nach der dort erfolgten manuellen Korrektur wird das Gepäckstück wieder an<br />
den Kippschalensorter übergeben und zur betreffenden Ausgabestelle transportiert.<br />
Pro Gepäcktransporter können maximal 6 Gepäckeinheiten in <strong>einer</strong> Ebene transportiert werden. Die<br />
Gepäckeinheiten bestehen wahlweise und flugzeugabhängig aus Containern, Paletten oder losem Gepäck in<br />
Verladenetzen etc.. Es wird davon ausgegangen, daß ausschließlich Container der Größen LD1, LD2, LD3 oder<br />
kl<strong>einer</strong> zum Einsatz kommen. Diese Annahme wird durch die Tatsache unterstützt, daß in Wiesbaden-Erbenheim<br />
nur kleines und mittelgroßes Fluggerät abgefertigt wird und das der Container LD3 zu den am häufigsten<br />
eingesetzten Containern weltweit gehört (ca. 140.000pcs.). Die Maße des LD3 sind: 1,534 m in der Breite, 1,562<br />
m in der Länge und 1,626 m in der Höhe. Der Container kann demzufolge längs zur Fahrtrichtung in den<br />
Gepäcktransporter eingebracht werden.<br />
Das Verladen der Gepäckeinheiten in den Gepäcktransporter soll analog zu den Verladeeinrichtungen im<br />
Flugzeug organisiert sein. Der Gepäcktransporter fährt parallel an einen Beladetisch heran, der zuvor mit den<br />
entsprechenden Transporteinheiten (Containern etc.) bestückt worden ist. In diese Container etc. auf dem<br />
Beladetisch wurden zwischenzeitlich die betreffenden Gepäckstücke von den Aufnahmebändern verladen.<br />
Sobald der Gepäcktransporter vor dem Beladetisch geparkt hat und die Container etc. beladen worden sind,<br />
können die Container über Rollen in den Gepäcktransporter geschoben werden. Die Justierung der<br />
Übergabeplattform soll möglichst am Anfang der Containerbeladung abgeschlossen sein.<br />
Arretiert werden die Container mit dem im Flugzeug üblichen System aus Halteklammern. Diese<br />
Vorgehensweise soll eine schnellstmögliche und standardisierte Beladung ermöglichen.<br />
Sobald alle Container in den Gepäcktransporter verladen worden sind fährt dieser zum Flughafen Frankfurt.<br />
Je nach Umfang des Transfergepäcks und des Verladezeitpunkts kann der Gepäcktransporter in Frankfurt<br />
mehrere Flugzeuge mit <strong>einer</strong> Fahrt andienen.<br />
Um das Verladen der Gepäckstücke zu vereinfachen und zu beschleunigen sollte der Vorgang des Ein- und<br />
Ausbuchens aus der Gepäcksortieranlage weiter automatisiert werden. Ein zukünftiger Aspekt ist dabei der<br />
Einsatz von elektronischen Datenträgern (SmartCard / Transponder), wie er in der Industrie bereits zur<br />
Materialflußsteigerung seit geraumer Zeit eingesetzt wird. Mittels dieser SmartCard / BaggageCard wird neben<br />
der Speicherung von Ziel- und Besitzerdaten auch die Speicherung von Gepäckdaten wie Größe, Gewicht,<br />
Material etc. angestrebt. Neben <strong>einer</strong> 100%-igen Verfolgung des Gepäckstücks lassen sich anhand der<br />
gespeicherten Daten die einzelnen Bearbeitungsschritte in der Gepäcksortieranlage weiter automatisieren und<br />
somit beschleunigen.<br />
In der Gegenrichtung verläuft die Prozeßkette anders. Das Gepäck der in Wiesbaden abfliegenden<br />
Transferpassagiere wird unsortiert aus Frankfurt in den Transfercontainern etc. angebracht. Der<br />
Gepäcktransporter fährt zu <strong>einer</strong> der drei Abgabestationen und hält parallel am Beladetisch. An dieser<br />
Abgabestation werden die Container auf den Beladetisch gezogen. Danach fährt der Gepäcktransporter zu <strong>einer</strong><br />
der drei Aufnahmestationen, wo er für die Rückfahrt beladen wird.<br />
Das unkodierte Gepäck wird am Beladetisch aus den Containern auf ein Abgabeband entladen, über dieses zum<br />
Kippschalensorter transportiert und vor der Übergabe durch eine Scanner-Dusche (Leserate ca. 90-95% bei<br />
Transfergepäck) auf seine Zielrichtung kodiert. Danach wird das Gepäckstück mit seinem Zielcode auf den<br />
Kippschalensorter übergeben.<br />
Sofern die Label mit der Zielinformation am Gepäckstück nicht automatisch lesbar sind (durch Beschädigung<br />
oder Schmutz) wird das Gepäckstück trotzdem an den Kippschalensorter übergeben und an der nächsten der drei<br />
Korrekturstationen abgeworfen. Nach der dort erfolgten manuellen Korrektur wird das Gepäckstück wieder an<br />
den Kippschalensorter übergeben. Über diesen wird das Gepäckstück bis zu s<strong>einer</strong> Abwurfstelle gebracht und an<br />
das betreffende Aufnahmeband im Vorfeldbereich übergeben. Die dabei zurückgelegte Strecke pro Gepäckstück<br />
kann im ersten Gepäckkreisel maximal 150m betragen. Sofern sich seine Ausgabestelle aber im zweiten<br />
Gepäckkreisel befindet, muß es über eine unterirdische Hochgeschwindigkeitsstrecke zu diesem transportiert<br />
werden. Die Gesamtstrecke kann in diesem Fall bis zu 230m in den beiden Gepäckkreiseln (1m/s) und 200m in<br />
der Hochgeschwindigkeitsstrecke (5-10 m/s) betragen.<br />
Von dem Aufnahmeband an der Fassade wird das Gepäck auf einen Dolley / Trolley / Container etc. verladen<br />
und zum Flugzeug gebracht. Diese Beladeplätze sind durch die 5m weite Auskragung des Obergeschosses<br />
weitgehend vor Witterung geschützt.
Das Gepäck der Originärpassagiere in Wiesbaden und das der in Wiesbaden umsteigenden (ohne FRA)<br />
Passagiere soll über eine einfachste Gepäcksortieranlage im Zentralterminal auf die entsprechenden Ziele<br />
und/oder die Gepäckausgabe sortiert werden.<br />
Bereitstellung von Containern und Paletten sowie deren Lagerhaltung<br />
Grundsätzlich sind die inneren wie äußeren Fahrtrassen der Gepäckfahrzeuge dem zu erwartenden<br />
Verkehrsaufkommen entsprechend dimensioniert worden. Aufgrund der extrem dichten Zeitstaffelung der<br />
Gepäckabfertigung werden aber zumindest die inneren Fahrtrassen der Gepäcksortieranlage hoch belastet sein.<br />
Vor allem die Bereitstellung von neuen Verladeeinheiten bzw. der Abtransport an den Beladetischen<br />
beansprucht die Zeitkette zusätzlich. Aus diesem Grund soll die Lagerhaltung der Verladeeinheiten (Container,<br />
Paletten, Boxen etc.) über einen Kreislauf mit einem unterirdischen Lager weitgehend von den üblichen<br />
Vorfeldverkehren abgekoppelt werden. Verladeeinheiten, welche durch die Gepäcktransporter aus Frankfurt<br />
nach Wiesbaden gebracht und entladen worden sind, werden über den Beladetisch ins UG transportiert. Der<br />
Beladetisch fungiert also zusätzlich als Hubplattform um leere Verladeeinheiten abzutransportieren und neue<br />
bereitzustellen. Im UG werden die Verladeeinheiten in einem Lager zwischengeparkt. Kommt eine neue<br />
Anforderung für einen der Beladetische senkt dieser sich ins UG ab und wird dort mit den Verladeeinheiten für<br />
den betreffenden Flug neu bestückt. Danach fährt der Beladetisch in seine Ausgangsposition im EG zurück und<br />
die Gepäckstücke werden in der Verladeeinheit verstaut.<br />
Das unterirdische Lager läßt sich weitgehend automatisieren. Es soll vor allem für die Zwischenlagerung von<br />
Verladeeinheiten benutzt werden, welche sich beim Flugverkehr auf beiden Flughäfen permanent einsetzen läßt.<br />
Für einen trotzdem zu erwartenden Austausch von Verladeeinheiten, welche über bestimmte Zeiträume nicht<br />
oder nur wenig genutzt werden, muß ein vorfeldnahes Lager eingerichtet bzw. in bestimmten Zeiträumen ein<br />
Austausch mit Frankfurt vorgenommen werden. Durch die unterschiedliche Verkehrsstruktur beider Flughäfen<br />
(Großflugzeuge in Frankfurt / nur mittlere Größen in Wiesbaden) wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu<br />
keinem dauerhaft gleichmäßigem Austausch von Verladeeinheiten zwischen Frankfurt und Wiesbaden kommen.<br />
Die erforderlichen Überkapazitäten müssen zum Einen bereitgestellt und zum Anderen abgepuffert werden<br />
können.<br />
Die äußere Anbindung an die beiden unterirdischen Lager kann über einen entsprechenden Lastenaufzug (LKWfähig)<br />
neben dem Busgatebereich und eine unterirdische Querverbindung zwischen beiden Lagern sichergestellt<br />
werden.<br />
Zuzüglich zu diesem Abfertigungssystem muß eine ähnliche Gepäcksortieranlage wie die der Phase I für das<br />
Terminal in FRA konzipiert und aufgebaut werden. Da dieser Punkt in beiden Szenarien aber identisch ist und<br />
im derzeitigen Arbeitsumfang eine detaillierte Planung nicht Bestandteil ist, wurde auf eine differenzierte<br />
Betrachtung und Bemessung an dieser Stelle verzichtet.<br />
Diese Gepäcksortieranlage dient in erster Hinsicht der Gepäckabfertigung der Originärpassagiere. Gepäck<br />
jeglicher Umsteiger in WIE soll nicht durch diese Anlage verarbeitet werden. Dadurch sind kaum zeitkritische<br />
Abfertigungsketten zu erwarten. Aus diesem Grund kann die Gepäcksortieranlage im Zentralterminal auf eben<br />
diese normalen Belange zugeschnitten werden. In der Umsetzung bedeutet dies, daß abhängig vom<br />
Verkehrsaufkommen und Investitionsvorhaben eine rein mechanisch-manuelle, eine teilautomatisierte oder eine<br />
vollautomatisierte Anlage zum Einsatz kommen kann. Die Pflicht, sich von vornherein für eines dieser System<br />
bindend festlegen zu müssen, besteht in diesem Fall nicht.<br />
Zeiten in der GFA des Flughafens Wiesbaden-Erbenheim<br />
An der GFA in WIE wird zunächst das kritische Umsteigergepäck aus den Containern entladen, während<br />
Container mit Originär- bzw. Umsteigegepäck innerhalb von WIE erst im Anschluß abgefertigt werden. Der<br />
Zeitbedarf für diesen Entladevorgang wird dadurch verkürzt, daß da die Container bzw. Trolleys parallel von<br />
mehreren Personen entladen werden. Die Entladung des letzten Koffers aus den Containern / Trolleys kann<br />
somit nach 4 min angeschlossen sein (40 Gepäckstücke je Container und 5 sec Zeitbedarf je Gepäckstück).<br />
Nach 10,5 Minuten ist das letzte Gepäckstück ausgeladen und es erfolgt der Transport und die Sortierung des<br />
Gepäcks in der GFA.<br />
Die Zeit in der Sortieranlage beträgt 2 min, da der auf den Bändern und Sorter zurückzulegende Weg maximal<br />
120 m betragen kann (ein vollständiger Umlauf). Die Fördergeschwindigkeit beträgt durchschnittlich 1 m/s.<br />
Durch den Ansatz dieser relativ langsamen Förderzeit ist die Berücksichtigung der häufigen Sortierstellen
(Zulaufbänder und Abwurfstellen) im System gewährleistet. Zusätzlich wird eine Reserve von 30 Sekunden<br />
berücksichtigt, für den Fall, daß die automatische Einrichtung zum Lesen der Labels ("Scannerdusche") kein<br />
Ergebnis liefert und das Gepäckstück von Hand an <strong>einer</strong> Sonderstelle nachgelabelt werden muß (heute haben<br />
diese Einrichtungen eine Fehlerquote von ca. 7%). Demnach erreicht das letzte Gepäckstück nach 13 Minuten<br />
dies Ausgabestellen, wo das Gepäckstück nur noch in den Container verladen wird, der Container verschlossen<br />
wird (1 Minute) und der Container auf das Transportfahrzeug geschoben und gesichert wird (1 Minute).<br />
Um den Beladevorgang zu beschleunigen, wird vorausgesetzt, daß das Gepäck durch ein automatisches System<br />
gelesen wird (Smart Card Technik) und nicht von Hand ausgelesen wird. Bei dieser Technik wird dem Gepäck<br />
nach dem Verladen auf die Gepäckanlage durch einen zusätzlichen Mitarbeiter oder <strong>einer</strong> automatischen Anlage<br />
ein Magnetlabel zugeordnet. Nach dem Scanvorgang werden dem Magnetlabel die Informationen über das<br />
Gepäckstück mitgeteilt. Beim verlassen der Anlage wird das Magnetlabel von der Anlage gelesen und kann<br />
gegebenenfalls dem Mitarbeiter durch optische oder akustische Signale mitteilen, daß dies das letzte<br />
Gepäckstück ist. Der Scanvorgang von Hand beim Entladen entfällt somit.<br />
Im Anhang Tab. A1 sind die Eingangsdaten dargestellt, die dem erhöhten Zeitaufwand für die<br />
Gepäckbeförderung in Wiesbaden-Erbenheim bei der Bus-Lösung zugrundeliegen.<br />
Transport von WIE nach FRA<br />
Die Transportzeiten entsprechen denen der Passagiere. Damit kann nach 33,5 Minuten eine ungünstige Position<br />
in FRA erreicht werden.<br />
Beladung des Flugzeugs in FRA<br />
Der Beladevorgang des Flugzeuges kann beschleunigt werden, da das Fahrzeug mit dem Gepäck direkt an die<br />
Verladeeinrichtung am Flugzeug heranfahren kann. Durch Spezialeinrichtungen würde somit die Möglichkeit<br />
bestehen, direkt vom Transportfahrzeug den Container auf den Loader zu verschieben wobei dann Umschlagzeit<br />
auf andere Fahrzeuge entfallen.<br />
Dieser Beladevorgang entspricht dann dem "klassischen" Beladevorgang von Containern. Für die vier Container<br />
wird daher eine Beladezeit von 5 Minuten angesetzt, zusätzlich wird die Positionierung des Transportfahrzeuges<br />
vor dem Loader mit 30 Sekunden berücksichtigt.<br />
Bei Beladung von Einzelgepäck reichen die 5 Minuten aus, um ca. 50 Gepäckstücke zu verladen. Diese Menge<br />
würde wiederum ca. 30% des Gesamtgepäcks <strong>einer</strong> Boeing 737 entsprechen und ist als oberer Wert des<br />
möglichen Umsteigervolumens aus WIE anzusehen.<br />
7.2.3 Beschreibung der Wegekette von FRA nach WIE<br />
Die Entladezeiten sind identisch mit den Angaben für die umgekehrte Richtung (nach 6 min sind die Container /<br />
Gepäck direkt auf das Transportfahrzeug verladen.<br />
Nach <strong>einer</strong> weiteren halben Minute Rangierzeit ist das Fahrzeug abfahrbereit nach Erbenheim. Mit den<br />
bekannten Fahrzeiten zwischen den Flughäfen (von Position E9 in FRA) ist das Fahrzeug nach 25 Minuten in<br />
Erbenheim und es kann mit der Entladung des Gepäcks begonnen werden. Die Zeiten für die Entladung der<br />
Container (4 min), den Aufenthalt des Gepäcks in der Gepäckanlage (2,5 min) und die Beladung der Container /<br />
Trolleys (2 min) in Erbenheim sind absolut identisch zu der umgekehrten Richtung. Demnach kann nach 32<br />
Minuten das Gepäck zum Flugzeug gefahren werden. Die Fahrzeiten für diesen Weg entsprechen der<br />
umgekehrten Richtung (1 Minute inkl. Verluste). Die Beladung benötigt die bekannten 5 Minuten bevor die<br />
Abfertigungsfahrzeuge entfernt werden und der Engine Start vorbereitet wird (2,5 Minuten).<br />
7.2.4 Erzielbare Connection Time bezüglich Gepäck (worst cases)<br />
In die Berechnungen gehen Abfertigungszeiten bei verschiedenen Prozesse ein. Die Zeiten die hier angesetzt<br />
werden, entstammen unterschiedlichen Quellen. Dies sind zum einen Erhebungen, welche im Rahmen <strong>einer</strong><br />
Studie 1995 an den Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf durchgeführt wurden. Dabei wurden die Prozeßzeiten<br />
verschiedener Abfertigungsschritte an Flugzeugen des Typs B747 und weiterer Großraumflugzeuge erhoben.
Weiterhin wurden Angaben zu Prozesszeiten der Flugzeughersteller (Boeing, Airbus) verwendet, sowie Angaben<br />
aus der Literatur übernommen.<br />
Tab. 9: Bus-System: Zeit-Wegekette Gepäck von WIE nach FRA<br />
Prozesse Bemerkungen Fall B1 Fall B2 Fall B3<br />
1 Entladevorgang Gepäck Positionierung Abfert.fahrzeuge 2,0 1,0 2,0<br />
2 Entladen Cont. 1 + 2 (LD3 Cont.) 2,0 2,0<br />
3 Entladen Cont. 3 + 4 (LD3 Cont.) 2,0 2,0<br />
4 Entladung Bulk Cargo (je Gepäckraum) 5,0<br />
5 Transport zum Terminal max. 390 m bei max. 30 km/h 0,5 1,0 0,5<br />
6 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
7 Sortierung im GFA WIE Entladung (max. 40 Stück je Station) 4,0 4,0 4,0<br />
8 Transport in GFA 5,0 5,0 5,0<br />
9 Beladung Container (letztes Gep.stk) 1,0 1,0 1,0<br />
10 Transport WIE - FRA Beladung Transportfahrzeug 1,0 1,0 1,0<br />
11 Fahrzeit Vorfeld WIE 1,0 1,0 1,0<br />
12 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
13 Fahrzeit WIE - FRA auf Busstraße 14,5 14,5 14,5<br />
14 Fahrzeit Vorfeld FRA 1,5 1,5 3,5<br />
15 Verlustzeiten (25%, mind. 1 min) 1,0 1,0 1,0<br />
16 Beladevorgang Gepäck Transport an Flugzeug 0,5 0,5 0,5<br />
17 Beladung Flugzeug 5,0 5,0 2,0<br />
18 Entf.Fahrz., Off Block 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 44,5 45,0 43,5<br />
Tab. 10: Bus-System: Zeit-Wegekette Gepäck von FRA nach WIE<br />
Prozesse Bemerkungen Fall B1 Fall B2 Fall B3<br />
1 Entladevorgang Gepäck Positionierung Abfert.fahrzeuge 2,0 2,0 1,0<br />
2 Entladen Cont. 1 + 2 (LD3 Cont.) 2,0 2,0<br />
3 Entladen Cont. 3 + 4 (LD3 Cont.) 2,0 2,0<br />
4 Entladung Bulk Cargo (je Gepäckraum) 2,0<br />
5 Transport FRA - WIE Fahrzeit Vorfeld FRA 1,5 1,5 3,5<br />
6 Verlustzeiten (25%, mind. 1 min) 1,0 1,0 1,0<br />
7 Fahrzeit FRA - WIE auf Busstraße 14,5 14,5 14,5<br />
8 Fahrzeit Vorfeld WIE (max. 690 m) 1,5 1,5 1,5<br />
9 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
10 Sortierung im GFA WIE Entladung (max. 40 Stück je Station) 4,0 4,0 4,0<br />
11 Transport in GFA 5,0 5,0 5,0<br />
12 Beladevorgang Gepäck Beladung Cont./Trol. (letz.Gep.stk) 1,0 1,0 1,0<br />
13 Transport an Flugzeug (100 m) 0,5 1,0 0,5<br />
14 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
15 Positionierung Dolley / Trolley 0,5 0,5 0,5<br />
16 Beladung Flugzeug 5,0 5,0 5,0<br />
17 Entf.Fahrz., Off Block 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 44,0 44,5 43,0<br />
Die MCT von 45 min läßt sich beim Gepäcktransport im Rahmen des Bus-Systems in allen untersuchten<br />
Transferbeziehungen einhalten, die alle extrem ungünstige Fälle darstellen.<br />
7.2.5 Erzielbare Connection Time bezüglich Gepäck (Durchschnitts-Fälle)<br />
Für die Durchschnitts-Fälle B4 bis B6 ergeben sich die folgenden Zeit-Wegeketten:<br />
Tab. 11: Bus-System: Zeit-Wegekette Gepäck von WIE nach FRA (Durchschnittsfälle)
Prozesse Bemerkungen Fall B4 Fall B5 Fall B6<br />
1 Entladevorgang Gepäck Positionierung Abfert.fahrzeuge 1,0 1,0 1,0<br />
2 Entladen Cont. 1 + 2 (LD3 Cont.)<br />
3 Entladen Cont. 3 + 4 (LD3 Cont.)<br />
4 Entladung Bulk Cargo (je Gepäckraum) 3,0 3,0 3,0<br />
5 Transport zum Terminal max. 390 m bei max. 30 km/h 0,5 0,5 0,5<br />
6 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
7 Sortierung im GFA WIE Entladung (max. 40 Stück je Station) 3,0 3,0 3,0<br />
8 Transport in GFA 5,0 5,0 5,0<br />
9 Beladung Container (letztes Gep.stk) 1,0 1,0 1,0<br />
10 Transport WIE - FRA Beladung Transportfahrzeug 1,0 1,0 1,0<br />
11 Fahrzeit Vorfeld WIE 1,0 1,0 1,0<br />
12 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
13 Fahrzeit WIE - FRA auf Busstraße 11,5 13,5 14,5<br />
14 Fahrzeit Vorfeld FRA 6,0 1,5 0,5<br />
15 Verlustzeiten (25%, mind. 1 min) 1,5 1,0 1,0<br />
16 Beladevorgang Gepäck Transport an Flugzeug 0,5 0,5 0,5<br />
17 Beladung Flugzeug 3,0 3,0 3,0<br />
18 Entf.Fahrz., Off Block 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 41,5 38,5 38,5<br />
Tab. 12: Bus-System: Zeit-Wegekette Gepäck von FRA nach WIE (Durchschnittsfälle)<br />
Prozesse Bemerkungen Fall B4 Fall B5 Fall B6<br />
1 Entladevorgang Gepäck Positionierung Abfert.fahrzeuge 2,0 2,0 2,0<br />
2 Entladen Cont. 1 + 2 (LD3 Cont.) 2,0 2,0 2,0<br />
3 Entladen Cont. 3 + 4 (LD3 Cont.)<br />
4 Entladung Bulk Cargo (je Gepäckraum)<br />
5 Transport FRA - WIE Fahrzeit Vorfeld FRA 6,0 1,5 0,5<br />
6 Verlustzeiten (25%, mind. 1 min) 1,5 1,0 1,0<br />
7 Fahrzeit FRA - WIE auf Busstraße 11,5 13,5 14,5<br />
8 Fahrzeit Vorfeld WIE (max. 690 m) 1,5 1,5 1,5<br />
9 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
10 Sortierung im GFA WIE Entladung (max. 40 Stück je Station) 3,0 3,0 3,0<br />
11 Transport in GFA 5,0 5,0 5,0<br />
12 Beladevorgang Gepäck Beladung Cont./Trol. (letz.Gep.stk) 1,0 1,0 1,0<br />
13 Transport an Flugzeug (100 m) 0,5 0,5 0,5<br />
14 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
15 Positionierung Dolley / Trolley 0,5 0,5 0,5<br />
16 Beladung Flugzeug 3,0 3,0 3,0<br />
17 Entf.Fahrz., Off Block 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 41,0 38,0 38,0<br />
Bei durchschnittlichen Flugzeug-Positionen unterbietet der Gepäcktransfer von WIE nach FRA die MCT um 3,5<br />
bis 6,5 min, in der Gegenrichtung sogar um 4 bis 7 min.<br />
7.2.6 Zeit-Wege-Ketten Gepäck ohne Vorsortierung im Flugzeug nach FRA<br />
Sollte eine Gepäckvorsortierung im Flugzeug mit Zielflughafen FRA nach den beiden Kategorien des<br />
Umsteigergepäcks ab WIE und ab FRA grundsätzlich nicht durchsetzbar sein, so muß über eine Alternative<br />
bezüglich der Gepäcklogistik nachgedacht werden. Eine detailliertere Darstellung dieser alternativen<br />
Logistikkette, vergleichbar den bisherigen Szenarien, kann jedoch aus Zeitgründen im Rahmen der vorliegenden<br />
Studie nicht mehr vorgenommen werden. Vielmehr wird die betreffende Zeit-Wege-Kette für das<br />
Transfergepäck auf der Basis der zuvor beschriebenen Bus-Lösung beschrieben.<br />
Die Richtung WIE - FRA bleibt unverändert, da in diesem Szenario das Gepäck zentral in WIE durch die<br />
Gepäckanlage geleitet wird und von dort aus auf die Flüge nach FRA verteilt wird.
Bisher wird davon ausgegangen, daß das nach WIE zu befördernde Umsteiger-Gepäck bereits im Flugzeug mit<br />
Ziel FRA vorsortiert ist und somit gewährleistet ist, daß nur "WIE-Gepäck" zum anderen Flughafenteil<br />
transportiert werden muß. Wenn diese Lösung ausscheiden sollte, müßte das Gepäck in FRA nach der Landung<br />
des Flugzeugs entsprechend sortiert werden mit dem Ziel, daß das Umsteigergepäck nach WIE an speziellen<br />
Ausgabestationen in FRA für die einzelnen Flüge ab WIE bereitgestellt und dann mit einzelnen Fahrzeugen<br />
direkt zu den betreffenden Flugzeugen in WIE transportiert wird. Die Gepäcksortierung in FRA müßte dann<br />
analog zu der Anlage in WIE funktionieren.<br />
Es muß hierbei gewährleistet sein, daß das Gepäck aus dem gesamten Gepäckfördersystem in FRA zu den<br />
genannten Ausgabestationen transportiert wird, was zur Folge hat, daß ein Anschluß an die bestehenden GFA<br />
geschaffen werden muß. Aufgrund der räumlichen Ausdehnung des Flughafens Frankfurt kommt es hier dann<br />
jedoch zu langen Transportzeiten. Nach Angaben der FAG braucht bereits heute ein Gepäckstück in FRA bis zu<br />
15 min, um per GFA zwischen den ungünstigsten Positionen transportiert zu werden.<br />
Auf Grund der langen Förderzeiten in der bestehenden GFA wäre es daher notwendig, daß das "WIE-Gepäck"<br />
aus der bestehenden GFA ausgeschleift wird und direkt mittels Schnellförderer zur neuen Sortierstation für das<br />
WIE Gepäck transportiert wird. Die Frankfurter GFA ist deshalb entsprechend zu erweitern bzw. zu<br />
modifizieren.<br />
Bezüglich der Lage dieser zusätzlichen Sortierstation gibt es zwei Möglichkeiten:<br />
(1) zwischen den beiden Terminals, um die Wege von jedem Terminal zur Sortierstation zu minimieren<br />
(2) westlich des Terminals 1, um einen möglichst kurzen Transportweg nach WIE zu erhalten.<br />
Eine genaue Lagebestimmung dieser Sortierstation und eine Optimierung des Sortier- und Förderprozesses kann<br />
im Rahmen dieser Studie nicht vorgenommen werden. Jedoch werden auf der Basis des bereits berechneten Bus-<br />
Systems die resultierenden Zeiten eines solchen Szenarios abgeschätzt.<br />
Die Wegekette für das Gepäck ohne Vorsortierung umfaßt von FRA nach WIE folgende Glieder:<br />
1 Entladevorgang Gepäck incl. Positionierung der Abfertigungsfahrzeuge<br />
2 Entladevorgang Container 1 + 2 (LD3 Cont.)<br />
3 Entladevorgang Container 3 + 4 (LD3 Cont.)<br />
4 Entladung Bulk Cargo (je Gepäckraum)<br />
5 Transport über das Vorfeld FRA<br />
6 Verlustzeiten (25%, mind. 1 min)<br />
7 Sortierung in der GFA in FRA<br />
8 Transport in der GFA in FRA<br />
9 Schnell-Link zur neuen Sortierstation<br />
10 Sortierung in der neuen Station für WIE-Gepäck<br />
11 Beladung Container / Trolleys (letztes Gepäckstück)<br />
12 Transport FRA - WIE<br />
13 Fahrt über das Vorfeld in WIE (max. 690 m)<br />
14 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min)<br />
15 Beladevorgang Gepäck incl. Positionierung Dolley / Trolley<br />
16 Beladung Flugzeug<br />
17 Entfernung Fahrzeuge, Off Block.<br />
Den Berechnungen des Zeitaufwandes liegen die folgenden Prämissen zugrunde:<br />
þ Sortiervorgang für das WIE Gepäck in der neu zu schaffenden Sortier- und Ausgabestation 2 min (einfacher<br />
Sorter mit 1 m/s Fördergeschwindigkeit)<br />
þ Fördergeschwindigkeit des Schnellförderer zwischen GFA FRA und der Gepäcksortierung für WIE 5 m/sec<br />
þ Zeit in GFA FRA max. 5 min, dann Transport auf Schnellförderer<br />
þ von V3 direkter Schnellförderer zur Gepäcksortierung WIE<br />
þ eventuell zusätzliches Vorfeldgebäude analog V3 auf dem westlichen Vorfeld.
Bei <strong>einer</strong> solchen Konzeption würde sich dann ein zusätzlicher Zeitaufwand von 5 bis 8 min gegenüber der<br />
ursprünglich konzipierten Gepäck-Behandlung und -Förderung beim Bus-System ergeben. In der Summe wären<br />
dies dann Transferzeiten für das Gepäck von 47 bis 53 min in den worst cases. Nach Aussage des GFA-<br />
Herstellers VanderLande könnte in Zukunft möglicherweise eine Fördergeschwindigkeit von 10 m/sec, was zu<br />
<strong>einer</strong> Einsparung von 2 min führen würde.<br />
7.3 Zeit-Wege-Ketten Passagiere<br />
7.3.1 Vorbemerkung<br />
Das Zugsystem bildet eine Hochgeschwindigkeitsverbindung, bei welcher die Vorfeldpositionen über ein<br />
zweites System (Vorfeldbusse) angebunden werden. Für zeitkritische Verbindungen werden innerhalb von WIE<br />
und FRA "Feuerwehr-Fahrten" angeboten.<br />
Im Gegensatz dazu stellt das Bus-System eine Verbindung mit Normalgeschwindigkeit dar, wobei für die<br />
Anbindung der Vorfeldpositionen ebenfalls Busse benutzt werden. Das Bus-System zwischen WIE und FRA<br />
stellt somit ein System mit Vorfeld-Bussen über eine längere Distanz dar. Zeitkritische Verbindungen treten bei<br />
diesem System nur in der Richtung FRA -WIE auf. Hierbei fahren die Shuttlebusse, nachdem die zeitunkritischen<br />
Passagiere am Satelliten-Terminal ausgestiegen sind, direkt zum Anschluß-Flugzeug weiter. Die<br />
standardmäßige Busfahrt zwischen FRA und WIE verwandelt sich quasi ab dem Satelliten in eine "Feuerwehr-<br />
Fahrt" über das Vorfeld von WIE.<br />
7.3.2 Beschreibung der Wegekette von WIE nach FRA<br />
Aussteigen in WIE<br />
Der Zeitbedarf für den Aussteigevorgang bleibt gegenüber dem "Bahn-Shuttle Szenario" unverändert. Für die<br />
Positionierung der Brücken werden 1,5 min angesetzt und für den anschließenden Aussteigevorgang der<br />
Passagiere 7,0 min (bei 150 Passagier je Flug). Nach 8,5 Minuten verläßt demnach der letzte Passagier das<br />
Flugzeug.<br />
Weg vom Flugzeug zum Shuttlebus bei Position am Satellitenterminal<br />
Das Satellitenterminal in Erbenheim ist so konzipiert, daß die Wege innerhalb dieses Terminals für die<br />
Umsteiger minimiert sind. Dies bedeutet, daß der maximale Weg, den ein Non-Schengen-Passagier im Terminal<br />
zurücklegen muß nur 120 m beträgt. Bei <strong>einer</strong> Gehgeschwindigkeit von 1 m/s ist dieser Weg nach 2 min<br />
zurückgelegt. Der Schengen-Passagier hat eine maximale Fußwegstrecke von 150 m, wenn er nach Frankfurt<br />
umsteigen will. Die etwas größere Wegelänge wird dadurch weitgehend kompensiert, daß die zeitkritischere<br />
Grenzontrolle entfällt. In dem Zentralbereich befinden sich die Informationshinweise zur weiteren Orientierung<br />
des Passagiers. Da auch von unerfahrenen Passagieren ausgegangen wird, muß eine großzügige<br />
Orientierungszeit angesetzt werden (insgesamt 1 Minute).<br />
Demnach hat nach 11,5 Minuten der letzte Passagier das Terminal durchquert.<br />
Weg vom Flugzeug zum Shuttlebus bei Vorfeldposition<br />
Vorfeldpositionen werden nur dann genutzt, wenn die Positionen am Satelliten nicht mehr ausreichen. Dies ist<br />
nach dem vorliegenden Prognoseflugplan in der Spitzenstunde nur für zwei Flüge der Fall. Ansonsten können<br />
Flugzeuge, welche standardmäßig nicht mit Fluggastbrücken abgefertigt werden können (z.B. Turboprop<br />
Flugzuge) am Gebäude abgestellt werden, so daß die Passagiere über ein Treppenbauwerk an der Fluggastbrücke<br />
auf das Vorfeld gelangen und dann den kurzen Weg zum Flugzeug gehen können. Dadurch entfallen die<br />
Busfahrten auf das Vorfeld. Dennoch müssen auch Vorfeldpositionen im Rahmen der worst case Untersuchung<br />
betrachtet werden.<br />
Wenn diese Positionen genutzt werden, dann in der Regel nur von Flugzeugen, welche weniger als 100<br />
Passagiere aufnehmen können (max. AVRO Flugzeugtypen). Dadurch kann zunächst eine relativ geringere<br />
Aussteigezeit angesetzt werden (4,5 min). In dem hier untersuchten Szenario wird allerdings ein größeres<br />
Flugzeug zugrunde gelegt, aus dem die Passagiere dann über zwei Brücken aussteigen können, während sonst
der Ausstieg über eine einzige Brücke erfolgt. Beim Aussteigen über zwei Brücken entsteht bei einem relativ<br />
großen Flugzeug keine Verlängerung der Deboarding-Zeit im Vergleich zu einem kleinen Flugzeug mit Ausstieg<br />
über nur eine Brücke.<br />
Die Fahrtstrecke zum Terminal beträgt maximal 500 m, eine Distanz, die bei <strong>einer</strong> Höchstgeschwindigkeit von<br />
30 km/h in 1,0 Minuten zurückgelegt wird. Hinzu kommt eine Verlustzeit von 0,5 min, welche durch mögliche<br />
Störungen auf dem Vorfeld in Erbenheim verursacht werden kann. Demnach trifft der letzte Passagier nach 7,5<br />
Minuten am Terminal ein. Wird hierbei noch 1 min zum Aussteigen der Fahrgäste angesetzt, so ist der<br />
Zeitbedarf für den letzten Passagier zum Erreichen des Terminals von <strong>einer</strong> Vorfeldposition zum Terminal<br />
genauso groß wie an <strong>einer</strong> Gebäude-Position.<br />
Wege im Satelliten<br />
Im Satellitenterminal durchqueren die Umsteiger auf direktem Weg den Abflugbereich in Richtung<br />
Transferbereich und informieren sich an den rundum angeordneten Informationsdisplays über ihre<br />
Umsteigeverbindung. Gegebenenfalls muß die Einreisekontrolle passiert werden. Zentral und in direkter Nähe<br />
zur Grenzkontrolle sind die Zugänge zu den Busstationen (Busgates) angeordnet. Maximal 8 Zugänge sind je für<br />
den Schengen- und den Non-Schengen-Bereich vorgesehen. In direkter Sichtbeziehung zu den Zugängen der<br />
Busgates können die Reisenden auf den Aufruf ihrer Umsteigeverbindung warten.<br />
Die maximal zu erwartenden Wege betragen für die einzelnen Verbindungen folgende Längen:<br />
þ Non-Schengen-Gate zur Treppe Non-Schengen-Bus: 100 m<br />
þ Non-Schengen-Gate zur Treppe Schengen-Bus: 150 m inkl. Grenzkontrolle<br />
þ Schengen-Gate zur Treppe Schengen-Bus: 170 m<br />
þ Schengen-Gate zur Treppe Non-Schengen-Bus: 220 m inkl. Grenzkontrolle.<br />
Bei erfolgtem Aufruf wird am Zugang zum Busgate wie bei <strong>einer</strong> klassischen Vorfeldanbindung die<br />
Bordkartenkontrolle durchgeführt. Die Transferpassagiere checken hier zu ihrem Weiterflug ab Frankfurt ein.<br />
Sofern durch die aufgerufene Busverbindung mehrere Flüge begedient werden sollen, bekommt an dieser Stelle<br />
jeder Reisende eine seinen Flug und seine Person betreffende elektronische SmartCard ausgehändigt. Diese wird<br />
bei Verlassen des Busses wieder abgegeben. Über diese elektronische Kontrollfunktion kann bei der Bedienung<br />
mehrerer Flugzeuge (mit einem Bus) sichergestellt werden, daß alle betreffenden Passagiere (und nur diese) am<br />
richtigen Flugzeug aussteigen. Die Erfassung dieser Information ist zum einen für die Passagiere als<br />
Orientierungshilfe und zum anderen für den Abgleich der Passagier- und Gepäckdaten im Rahmen des<br />
Sicherheitskonzepts notwendig.<br />
Nach dieser Bordkartenkontrolle sollen die Reisenden direkt den Bus besteigen. Über eine Rolltreppe, feste<br />
Treppe oder einen Aufzug kommen die Passagiere zum Bus im EG (ca. 20 m). Sobald der letzte Passagier den<br />
Bus erreicht hat, gibt es einen letzten Abgleich mit der Bordkartenkontrolle. Danach werden die Türen<br />
geschlossen und der Bus fährt zum Flughafen Frankfurt.<br />
Passagiere mit Endziel Wiesbaden oder <strong>einer</strong> möglichen Umsteigeverbindung in Wiesbaden begeben sich über<br />
die (mittige) Zentralerschließung zu ihrem nächsten Ziel.<br />
Die in Wiesbaden abfliegenden Passagiere (Transfer von FRA aus) durchlaufen die gleiche Wegekette in<br />
entgegengesetzter Richtung. Nach Ankommen des Busses begeben sich die Passagiere über die Rolltreppe etc.<br />
zur Abflugebene auf +4,70 m und unterziehen sich gegebenenfalls der Grenzkontrolle. Über die mittige<br />
Zentralerschließung gelangen sie anschließend zu ihrem betreffenden Gate. Durch die zentralen Infopunkte wird<br />
auch für diese Richtung die Orientierung erleichtert. In der Richtung FRA-WIE checken die Transferpassagiere<br />
erst am Gate in Wiesbaden ein und nicht schon bei Betreten des Busses in Frankfurt. Die Transferpassagiere aus<br />
Frankfurt kommen sozusagen unsortiert in Wiesbaden an (im Gegensatz zur Gegenrichtung).<br />
Grenzkontrolle<br />
Im ungünstigen Fall, daß Passagiere in WIE aus einem Non-Schengen-Land ankommen und in Frankfurt in ein<br />
Schengen-Land weiterreisen (oder umgekehrt), wird bereits in Wiesbaden-Erbenheim die Grenzkontrolle<br />
vorgenommen.
In dem skizzierten Terminal sind 12 Kontrollstellen vorgesehen. Für den hier untersuchten Fall werden 6<br />
Kontrollstellen pro Richtung freigeschaltet. Allerdings können in Spitzenzeiten auch einzelne Kontrollstellen der<br />
Gegenrichtung verwendet werden, so daß zum Beispiel für die Schengen-Passagiere 9 und für die Non-<br />
Schengen-Passagiere 3 Kontrollstellen zur Verfügung stehen.<br />
Die Abfertigungszeit beträgt durchschnittlich 40 Sekunden je Passagier bei der Einreise in die Schengen-Zone;<br />
in der Gegenrichtung kann zwar mit kürzeren Zeiten gerechnet werden, aber dennoch wird wieder der<br />
ungünstige Fall angenommen.<br />
In dem hier untersuchten Fall wird unterstellt, daß 60 Passagiere kontrolliert werden müssen. Diese Anzahl<br />
ergibt sich aus den zuvor erläuterten Annahmen der Umsteigerraten in einem ungünstigen Fall (150 Pax aus dem<br />
Flugzeug, B737; 60 % Umsteiger; davon 75 % nach FRA). Im Durchschnittsfall (86 Pax pro Flug und 25%<br />
Umsteiger) wären nur 22 Passagiere zu kontrollieren.<br />
Mit der Paßkontrolle wird nach dem Eintreffen des ersten Passagiers begonnen. Dieser kann bei <strong>einer</strong> Gebäude-<br />
Position nach 4,5 Minuten die Kontrollen erreichen (1,5 min Positionierung Brücken + 2 min Weg im Terminal<br />
+ 1 min Orientierung). Die Dauer der Kontrolle von 65 Passagieren beträgt in der Summe 7,5 Minuten. Aus<br />
Abbildung 32 wird deutlich, daß hier der Engpaß nicht die Paßkontrolle ist, sondern die Aussteigerate aus dem<br />
Flugzeug, daher kann der letzte Passagier theoretisch direkt kontrolliert werden. Zur Berücksichtigung möglicher<br />
ungleichmäßiger Verteilungen der Passagiere wird jedoch eine zusätzliche Reserve von zwei Minuten<br />
berücksichtigt.<br />
Im Fall eines Bustransfers über das Vorfeld kommen die Passagiere "im Pulk", welcher nur durch die<br />
Aussteigezeit von <strong>einer</strong> Minute entzerrt wird. Daher beträgt die Wartezeit des letzten Passagiers 6 Minuten (1<br />
min Aussteigezeit + 6 min Wartezeit letzter Pax = 7 min Paßkontrolle 60 Pax). In Abbildung 33 sind die<br />
Wegeketten und die Zusammenhänge zwischen den Einzelprozessen grafisch dargestellt.<br />
Sollte der Anstrom an die Paßkontrollen stärker sein (zusätzliche Abfertigung anderer Flugzeuge), dann können<br />
noch weitere Kontrollen für diese Richtung freigeschaltet werden. Es bestehen deshalb noch weitere Reserven.<br />
Zunächst steigen die Passagiere aus dem Bus, dieser Vorgang erfordert maximal 1,0 Minuten und anschließend<br />
müssen die Passagiere über eine Brücke am Flugzeug oder im Gebäude auf die Einstiegsebene gelangen. Hierfür<br />
werden 30 Sekunden veranschlagt.<br />
Diese Zeiten sind jedoch nicht die kritischen. Die Leistungsfähigkeit des Boardingvorganges liegt bei<br />
Flugzeugen mit einem Gang bei ca. 10 Passagier/min und bei Flugzeugen mit zwei Gängen bei ca. 20<br />
Passagier/min. Damit ergibt sich die Boardingzeit zu insgesamt 4 Minuten. Da der letzte Passagier aber schon<br />
nach 1,5 Minuten einsteigebereit ist, hat er noch eine Wartezeit von 3,0 Minuten.<br />
Busfahrt WIE - FRA<br />
Nach der Paßkontrolle legt der Passagier 30 m (30 Sekunden) Fußweg zu den Busgates zurück. Falls das Gate<br />
für den Shuttle-Bus "offen" ist, wovon bei kritischen Anschlußflügen ausgegangen wird, muß der Passagier jetzt<br />
nur noch eine ebene tiefer gelangen um in den Bus einzusteigen.<br />
Für den Ebenenwechsel wird eine halbe Minute angesetzt und für den weiteren Einsteigevorgang in den Bus eine<br />
weitere Minute. In dieser Minute ist neben dem Einchecken in den Bus auch die Zeit zum schließen der Türen<br />
enthalten.Zusätzlich wird eine Orientierungszeit von 0,5 min an den Busgates zur Orientierung angesetzt.<br />
Die Busfahrt führt zunächst über das Vorfeld in WIE. Der zurückzulegende Weg beträgt 420 m und es ist eine<br />
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h vorzusehen. Nach <strong>einer</strong> Minute kann diese Strecke zurückgelegt werden,<br />
zusätzlich wird noch eine Verlustzeit von 30 Sekunden angesetzt. Da auf der Straße in Richtung FRA vom<br />
sonstigen Vorfeldverkehr getrennt ist, und den Bussen Vorfahrt gewährt werden sollte, ist diese Zeit als<br />
ausreichend anzusehen.<br />
Fahrzeiten innerhalb von FRA<br />
An dieser Stelle wird die Fahrzeit zu <strong>einer</strong> ungünstigen Position am Flughafen Frankfurt betrachtet. Dies ist die<br />
am östlichen Ende des Terminal 2 gelegene Position E9. Von der "Schnellstraße" sind noch 600 m auf dem
Vorfeld zurückzulegen. Diese können bei <strong>einer</strong> Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h in 1,5 min bewältigt<br />
werden. Hinzu kommt eine Verlustzeit von 1 Minute, die dem starken Vorfeldverkehr in FRA gerecht wird.<br />
Einsteigevorgang in FRA<br />
Dadurch daß der Shuttle-Bus direkt auf das Vorfeld zum Flugzeug fährt, entspricht der Einsteigevorgang dem<br />
<strong>einer</strong> normalen Vorfeldabfertigung. Allerdings wird hier davon ausgegangen, daß die Passagiere aus Frankfurt<br />
bereits in das Flugzeug eingestiegen sind und nur noch die Umsteiger aus Erbenheim fehlen.<br />
Die Anzahl der in Frankfurt für einen Flug einsteigenden Passagier wird hier zu 40 Passagieren bei Flugzeugen<br />
mit einem Gang angesetzt (max. B757-300 mit ca. 250 Sitzen), was 16 % der Gesamtsitze entspricht. Bei<br />
Flugzeugen mit zwei Gängen (max. B747 oder zukünftig A3XX) werden 80 Passagiere angesetzt. Dies<br />
entspricht dann auch ca. der Kapazität eines Busses und auch ca. 16 % der Sitze des Flugzeuges (Annahme<br />
A3XX mit 500 Plätzen).<br />
Zunächst steigen die Passagier aus dem Bus, dieser Vorgang erfordert maximal 1,5 Minuten und anschließend<br />
müssen die Passagiere über eine Brücke am Flugzeug oder im Gebäude auf die Einstigsebene gelangen. Hierfür<br />
werden 30 Sekunden veranschlagt.<br />
Diese Zeiten sind jedoch nicht die kritischen. Die Leistungsfähigkeit des Boardingvorganges liegt bei<br />
Flugzeugen mit einem Gang bei ca. 10 Passagier/min und bei Flugzeugen mit zwei Gängen bei ca. 20<br />
Passagier/min. Damit ergibt sich die Boardingzeit zu insgesamt 4 Minuten. Da der letzte Passagier aber schon<br />
nach 2 Minuten einsteigebereit ist, hat er noch eine Wartezeit von 2,5 Minuten.<br />
Danach folgt das Schließen der Türen, Starten der Triebwerke und abschließen das Abziehen der Bremsklötze.<br />
Hierfür wird der aus dem vorherigen Szenario bekannte Zeitbedarf von 2,5 min angesetzt.<br />
7.3.3 Beschreibung der Wegekette von FRA nach WIE<br />
Aussteigevorgang FRA<br />
Der Aussteigevorgang in FRA ist länger, da in FRA ein größeres Referenzflugzeug angesetzt werden muß.<br />
Dadurch beträgt die maximale Aussteigezeit 10,5 min.<br />
Anschließend geht der Passagier in das Terminal von wo er als Umsteiger nach WIE direkt wieder auf die<br />
Vorfeldebene geleitet wird um den Bus nach WIE zu erreichen. Für den kurzen Weg in das Terminal werden<br />
maximal 30 Sekunden angesetzt, weiterhin muß er sich im Terminal orientieren um festzustellen von wo aus er<br />
zu seinem Anschlußflug gelangt (0,5 min). Hier wird eine kürzere Orientierungszeit angesetzt, da die<br />
Orientierung nicht in einem zentralen Bereich stattfindet, sondern direkt am Ausgang des Gates individuell für<br />
jeden Flug (eventuell unterstützt durch Flughafenpersonal). Die Zeiten bis zum Schließen der Türen im Bus<br />
werden analog zu dem Weg WIE - FRA angesetzt (0,5 Min auf Busebene, 0,5 Türen schließen / Abfahrt).<br />
Dies bedeutet, daß nach 14 Minuten der letzte Passagier den Bus erreicht hat und die Fahrt nach Erbenheim<br />
beginnen kann.<br />
Fahrt FRA - WIE<br />
Dieser Weg ist analog zu der Fahrt in umgekehrter Richtung bis zum ersten Satelliten in WIE. Hier werden auch<br />
die Zeiten von der ungünstigen Position E9 angesetzt.<br />
In WIE fährt der Bus dann die zentrale Busstation am Satelliten an.<br />
Den Satelliten erreicht der kritische Passagier 32,5 min, nachdem sein Flugzeug in FRA "on block" gegangen ist.<br />
Wege im Terminal WIE<br />
Am Satelliten in WIE steigen die Passagiere aus dem Bus aus (letzter Pax nach max. 1,0 min) und gelangen über<br />
(Roll-) Treppen in den Zentralbereich (0,5 min). Hier wird der Passagier im ungünstigen Fall paßkontrolliert.
Der Zeitbedarf an der Paßkontrolle wird zu 4,5 Minuten ab dem ersten Passagier angesetzt (bei 40<br />
ankommenden Passagieren, 6 Kontrollen und 40 sec. je Pax). Es werden maximal die 40 Passagiere angesetzt, da<br />
die Passagiere aus dieser Richtung gleichmäßiger verteilt in WIE ankommen, als in der Gegenrichtung wo<br />
stärkere Einzelereignisse auftreten, wenn ein Flugzeug ankommt. Sollte es doch zu stärken Belastungen der<br />
Paßkontrollen kommen, so können für die jeweils kritische Richtung noch zusätzlich Kontrollen freigeschaltet<br />
werden.<br />
Da der letzte Passagier erst 2 Minuten die Paßkontrolle erreicht, muß er noch 3,5 Minuten warten bis er sie<br />
durchquert hat.<br />
Abschließend muß der Weg zum Gate zurückgelegt werden (150m bei 2,5 min). Insgesamt wird für die Wege im<br />
Terminal eine zusätzliche Orientierungszeit von 1 min berücksichtigt.<br />
Abschließend erfolgt das Einsteigen der Umsteiger aus FRA. Da hier jedoch die Paßkontrolle der zeitkritische<br />
Faktor ist, kann der letzte Passagier ohne Wartezeit in das Flugzeug einsteigen. Deshalb wird nur eine mögliche<br />
Verlustzeit von 30 Sekunden berücksichtigt.<br />
Abschließend erfolgt das Schließen der Türen, wofür weitere 2,5 Minuten zur Verfügung stehen.<br />
7.3.4 Erzielbare Connection Time bzgl. Passagiere (Worst-Case-Fälle)<br />
Tab. 13: Bus-System: Zeit-Wegekette Passagiere von WIE nach FRA<br />
Prozesse Bemerkungen Fall B1 Fall B2 Fall B3<br />
1 Positionierung Brücken 1,5 1,5 1,5<br />
2 Deboarding max 150 Pax 7,0 4,5 7,0<br />
3 Bustransfer (Vorfeld) 500 m bei 30 km/h 1,0<br />
4 Verzögerungszeiten 0,5<br />
5 Aussteigen Bus 1,0<br />
6 Wege im Terminal (Roll-) Treppe zum OG / Terminal 0,5<br />
7 Wege im Terminal (max. 120 m) 2,0 1,0 2,0<br />
8 Orientierung 1,0 1,0 1,0<br />
9 Paßkontrolle (letz.Pass. von max.60) 2,0 6,0 2,0<br />
10 Weg zu Busgates 0,5 0,5 0,5<br />
11 Orientierung an Busgates 0,5 0,5 0,5<br />
12 Bus Shuttle Boarding Busgate 0,5 0,5 0,5<br />
13 (Roll-) Treppe zum EG / Bus 0,5 0,5 0,5<br />
14 Türen Schließen 0,5 0,5 0,5<br />
15 Fahrzeit Vorfeld WIE (max. 30km/h) 1,0 1,0 1,0<br />
16 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
17 Fahrzeit WIE - FRA auf Busstraße 14,5 14,5 14,5<br />
18 Fahrzeit Vorfeld FRA (max. 25 km/h) 1,5 1,5 3,5<br />
19 Verlustzeiten (25%, mind. 1 min) 1,0 1,0 1,0<br />
20 Boarding Umsteiger FRA Aussteigen Bus 1,0 1,0 1,0<br />
21 Treppe zum Flugzeug 0,5 0,5 0,5<br />
22 Boarding (letzter Pass. von max.40) 3,0 3,0 1,0<br />
23 Entf.Brücken, Off-Block 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 41,5 45,0 41,5<br />
Tab. 14: Bus-System: Zeit-Wegekette Passagiere von FRA nach WIE<br />
Prozesse Bemerkungen Fall B1 Fall B2 Fall B3<br />
1 Positionierung Brücken 1,5 1,5 1,5<br />
2 Deboarding max. 350 Pax 10,5 10,5 4,0<br />
3 Wege zum Bus Shuttle Weg Flugzeugtür bis Orient.bereich 0,5 0,5 0,5<br />
4 Orientierung 0,5 0,5 0,5<br />
5 (Roll-) Treppe zum EG / Bus 0,5 0,5 0,5<br />
6 Türen Schließen (letzter Pax) 0,5 0,5 0,5
7 Bus Shuttle Fahrzeit Vorfeld FRA 1,5 1,5 3,5<br />
8 Verlustzeiten (25%) 1,0 1,0 1,0<br />
9 Fahrzeit FRA - WIE auf Busstraße 14,5 14,5 14,5<br />
10 Fahrzeit Vorfeld WIE 1,0 1,0 1,0<br />
11 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
12 Aussteigen Bus 1,0 1,0 1,0<br />
13 Wege Terminal WIE EG Bus - OG Terminal 0,5 0,5 0,5<br />
14 Orientieren 0,5 0,5 0,5<br />
15 Weg im Terminal (max. 30 m) 0,5 0,5 0,5<br />
16 Paßkontrolle (letz.Pass. von max.40) 3,5 3,5 3,5<br />
17 Orientierung im Terminal 0,5 0,5 0,5<br />
18 Wege im Terminal (max 180 m) 3,0 1,0 3,0<br />
19 (Roll-) Treppe zum EG / Bus 0,5<br />
20 Bustransfer (Vorfeld) Türen Schließen 0,5<br />
21 500 m bei 30 km/h 1,0<br />
22 Verzögerungszeiten 0,5<br />
23 Aussteigen Bus 1,0<br />
24 Weg Boarding Brücke 0,5 0,5 0,5<br />
25 Boarding (letz.Pass. von max.40) 1,0 3,0 1,5<br />
26 Entf. Brücken, Off-Block 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 46,0 49,5 42,0<br />
Während beim Passagiertransfer von WIE nach FRA in allen drei untersuchten worst cases die MCT von 45 min<br />
eingehalten oder sogar um 3,5 min unterboten wird, zeigt die Gegenrichtung ein ungünstigeres Bild: In zwei<br />
Fällen wird die geforderte MCT überschritten, und zwar einmal um 1 min, ein zweites Mal um 4,5 min. Dieser<br />
"Ausreißer" von 4,5 min ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die Fluggäste in WIE nach der Ankunft<br />
des Shuttlebusses aus FRA u.U. noch auf Vorfeldbusse umsteigen müssen und daß das Deboarding von 350<br />
Passagieren aus <strong>einer</strong> vollbesetzten Boeing 747 bei <strong>einer</strong> Gebäudeposition in FRA nur über eine einzige<br />
Flugzeugtür möglich ist. In der Transfer-Richtung von WIE nach FRA ist im betreffenden Fall zwar auch die<br />
Benutzung von Vorfeldbussen in WIE notwendig, aber das Deboarding gestaltet sich hier aus zwei Gründen<br />
weitaus weniger zeitaufwendig: Zum einen landen in WIE nur Flugzeuge, die wesentlich kl<strong>einer</strong> sind als eine<br />
Boeing 747 (nur 150 statt 350 Sitzplätze), und zum anderen findet das Deboarding auf dem Vorfeld statt, wo im<br />
Unterschied zu den Gebäudepositionen in FRA das Aussteigen über zwei Türen möglich ist. Es muß jedoch<br />
berücksichtigt werden, daß bei der Konzeption des Satelliten in WIE ausreichend Positionen an dem Gebäude<br />
vorgesehen wurden, so daß die Fahrt über das Vorfeld nur in den Fällen notwendig ist, wenn es sich um<br />
Flugzeugtypen handelt, die nicht an Flugzeugbrücken abgefertigt werden können. Für diese Fälle besteht jedoch<br />
auch die Option, daß diese Flugzeuge eine Position am Terminal nutzen und daß die Passagiere über die<br />
Flugzeugbrücke auf das Vorfeld gelangen und von dort aus in das Flugzeug steigen. Dadurch würde die<br />
zeitaufwendige Busfahrt entfallen. Diese ist dann nur noch während der Spitzenzeiten notwendig, wenn die<br />
Gebäudepositionen nicht ausreichen. Nach dem vorliegenden Szenarioflugplan sind dies 2 Flüge in der<br />
Spitzenstunde, und zwar mit relativ kleinem Fluggerät.<br />
7.3.5 Erzielbare Connection Time bzgl. Passagiere (Durchschnitts-Fälle)<br />
Tab. 15: Bus-System: Zeit-Wegekette Passagiere von WIE nach FRA (Durchschnittsfälle)<br />
Prozesse Bemerkungen Fall B4 Fall B5 Fall B6<br />
1 Positionierung Brücken 1,5 1,5 1,5<br />
2 Deboarding max 150 Pax 4,0 4,0 4,0<br />
3 Bustransfer (Vorfeld) 500 m bei 30 km/h<br />
4 Verzögerungszeiten<br />
5 Aussteigen Bus<br />
6 Wege im Terminal (Roll-) Treppe zum OG / Terminal<br />
7 Wege im Terminal (max. 120 m) 1,5 1,5 1,5<br />
8 Orientierung 1,0 1,0 1,0<br />
9 Paßkontrolle (letz.Pass. von max.60) 2,0 2,0 2,0<br />
10 Weg zu Busgates 0,5 0,5 0,5<br />
11 Orientierung an Busgates 0,5 0,5 0,5<br />
12 Bus Shuttle Boarding Busgate 0,5 0,5 0,5
13 (Roll-) Treppe zum EG / Bus 0,5 0,5 0,5<br />
14 Türen Schließen 0,5 0,5 0,5<br />
15 Fahrzeit Vorfeld WIE (max. 30km/h) 1,0 1,0 1,0<br />
16 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
17 Fahrzeit WIE - FRA auf Busstraße 11,5 13,5 14,5<br />
18 Fahrzeit Vorfeld FRA (max. 25 km/h) 6,0 2,5 0,5<br />
19 Verlustzeiten (25%, mind. 1 min) 1,5 1,0 1,0<br />
20 Boarding Umsteiger FRA Aussteigen Bus 1,0 1,0 1,0<br />
21 Treppe zum Flugzeug 0,5 0,5 0,5<br />
22 Boarding (letzter Pass. von max.40) 1,0 1,0 1,0<br />
23 Entf.Brücken, Off-Block 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 38,0 36,0 35,0<br />
Tab. 16: Bus-System: Zeit-Wegekette Passagiere von FRA nach WIE (Durchschnittsfälle)<br />
Prozesse Bemerkungen Fall B4 Fall B5 Fall B6<br />
1 Positionierung Brücken 1,5 1,5 1,5<br />
2 Deboarding max. 350 Pax 6,0 6,0 6,0<br />
3 Wege zum Bus Shuttle Weg Flugzeugtür bis Orient.bereich 0,5 0,5 0,5<br />
4 Orientierung 0,5 0,5 0,5<br />
5 (Roll-) Treppe zum EG / Bus 0,5 0,5<br />
6 Türen Schließen (letzter Pax) 0,5 0,5 0,5<br />
7 Bus Shuttle Fahrzeit Vorfeld FRA 6,0 2,5 0,5<br />
8 Verlustzeiten (25%) 1,5 1,0 1,0<br />
9 Fahrzeit FRA - WIE auf Busstraße 11,5 13,5 14,5<br />
10 Fahrzeit Vorfeld WIE 1,0 1,0 1,0<br />
11 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
12 Aussteigen Bus 1,0 1,0 1,0<br />
13 Wege Terminal WIE EG Bus - OG Terminal 0,5 0,5 0,5<br />
14 Orientieren 0,5 0,5 0,5<br />
15 Weg im Terminal (max. 30 m) 0,5 0,5 0,5<br />
16 Paßkontrolle (letz.Pass. von max.40) 2,5 2,5 2,5<br />
17 Orientierung im Terminal 0,5 0,5 0,5<br />
18 Wege im Terminal (max 180 m) 2,5 2,5 2,5<br />
19 (Roll-) Treppe zum EG / Bus<br />
20 Bustransfer (Vorfeld) Türen Schließen<br />
21 500 m bei 30 km/h<br />
22 Verzögerungszeiten<br />
23 Aussteigen Bus<br />
24 Weg Boarding Brücke 0,5 0,5 0,5<br />
25 Boarding (letz.Pass. von max.40) 1,0 1,0 1,0<br />
26 Entf. Brücken, Off-Block 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 41,5 40,0 39,0<br />
Bei durchschnittlichen Flugzeug-Positionen und somit auch nur mittelgroßen bis kleinen Flugzeugen in FRA<br />
wird die MCT von 45 min deutlich unterschritten, und zwar in Richtung von WIE nach FRA um bis zu 10 min<br />
und in der Gegenrichtung um immerhin bis zu 6 min.<br />
7.3.6 Maßnahmen zur Verkürzung der Connection Time<br />
Eine Verkürzung der Connection Time, die beim Passagier-Transfer des Bus-Systems in zwei ungünstigen<br />
Fällen überschritten wird (vgl. Kapitel 7.3.4), ist nur durch die Umgehung des Satelliten-Terminals WIE<br />
möglich, da bereits die Standardkonzeption dieses Systems beinhaltet, daß jeder Shuttlebus von WIE aus die<br />
Flugzeuge in FRA im letzt möglichen Augenblick direkt anfährt und umgekehrt die Passagiere in FRA direkt<br />
vom Flugzeug nach WIE per Shuttlebus zum letzt möglichen Zeitpunkt in das Terminal WIE gebracht werden.
Die Vorgehensweise zur Verkürzung der Transferzeit in den genannten worst cases gestaltet sich<br />
folgendermaßen: Alle Transferpassagiere fahren "unsortiert" aus FRA mit dem Bus zum Satelliten in WIE, wo<br />
an der zentralen Busstation in WIE, wo zuerst alle zeitunkritischen Passagiere aussteigen. Danach werden die im<br />
Bus verbliebenen zeitkritischen Passagiere mit demselben Bus direkt zu dem betreffenden Standplatz ihres<br />
Fluges gefahren. Somit entfällt für diese Passagiere die Abfertigung im Satelliten. Mit solchen anschließenden<br />
"Feuerwehr-Fahrten" kann im Flughafen-Verbund WIE + FRA eine Umsteigezeit von 35 min selbst in den<br />
ungünstigsten Fällen erreicht werden (ohne Paßkontrollen). Dadurch ist auch kein besonderer Mehraufwand an<br />
Fahrzeugen notwendig, wodurch diese Feuerwehrfahrten keine nennenswerten Betriebskosten mit sich bringen.<br />
Sind allerdings bei den umsteigenden Passagieren Grenzkontrollen durchzuführen, so muß die Möglichkeit<br />
geschaffen werden, für diesen Fall gesonderte Kontrollstellen einzurichten. Auf diese Weise werden die sonst<br />
erforderlichen zeitraubenden Wege im Terminal wie auch Wartezeiten an den allgemeinen Grenzkontrollstellen<br />
vermieden. Die Möglichkeit für gesonderte Grenzkontrollen besteht im Terminal WIE bei den Busgates. Diese<br />
zusätzlichen Kontrollstellen stehen dann auch für Aufkommensspitzen zur Verfügung. Zwar werden sich die<br />
Umsteigezeiten im ungünstigsten Fall um die Warte- und Abfertigungszeit am Kontrollschalter auf über 35 min<br />
erhöhen, aber immer noch unter der kritischen Marke von 45 min bleiben.<br />
8. Investitions- und Betriebskosten<br />
8.1 Vorbemerkungen zu den Investitions- und Betriebskosten<br />
Berechnungsmethode<br />
Im folgenden werden die Investitions- und Betriebskosten sowohl des Zugsystems als auch des Bus-Systems<br />
ermittelt, ohne aber von konkreten, detaillierten ingenieurtechnischen Planungen der erforderlichen Infrastruktur<br />
ausgehen zu können. Diese Kostenkalkulation orientiert sich vielmehr an Kostenpauschalen, die aufgrund der<br />
Erfahrungen beim Bau vergleichbarer Bauwerke und Trassen empirisch ermittelt wurden. Auch die<br />
Betriebskosten werden anhand von pauschalierten Erfahrungswerten berechnet.<br />
Diese Kostenkalkulation dient zwei Zielen: Zum einen erhalten die Entscheidungsträger erste Richtwerte<br />
bezüglich des Finanzbedarfs der skizzierten Lösungen eines Flughafen-Verbundes WIE + FRA. Zum anderen<br />
lassen sich diese Lösungen, insbesondere das Zug- und das Bus-System, bezüglich ihrer Wirtschaftlichkeit<br />
miteinander vergleichen.<br />
Sämtliche Kosten beziehen sich auf den Preisstand von 1999.<br />
Investitionskosten fallen einmalig an, während Betriebskosten laufend entstehen. Um Investitionskosten und<br />
Betriebskosten trotzdem addieren zu können, ist die Herstellung <strong>einer</strong> gemeinsamen mathematischen Basis<br />
erforderlich. Dies wird erreicht, indem Investitionskosten per Annuitätenmethode auf die einzelnen<br />
Nutzungsjahre umgelegt werden. In den Annuitäten, also den jährlichen "Raten" zur Finanzierung <strong>einer</strong><br />
einmaligen Investition, sind Abschreibungen und Zinsen enthalten. Der hier zugrundegelegte Zinssatz beträgt<br />
4%, wobei es sich um einen Realzins handelt. Der entsprechende Nominalzins liegt um die Preissteigerungsrate<br />
über dem verwendeten Realzins von 4%.<br />
Prämissen für die Berechnung der Kosten von Infrastruktur und Fahrzeuge<br />
Es gibt zahlreiche Kostenbestandteile, die bei <strong>einer</strong> Bus-Straße in selbem Umfang anfallen wie bei <strong>einer</strong><br />
Eisenbahnstrecke. So entspricht die Breite des reinen Fahrweges der Bus-Straße mit ca. 11 m etwa der Breite<br />
<strong>einer</strong> 2-gleisigen Eisenbahnstrecke. Für Brückenbauwerke beim Bus-System wurde trotz der geringeren<br />
Achslasten (rund 10 t beim Bus statt rund 20 t beim Zug) derselbe Kostenansatz wie für Eisenbahnbrücken<br />
zugrunde gelegt.<br />
Die bei der Kostenermittlung verwendeten Kostenpauschalen berücksichtigen für beide Verkehrssysteme auch<br />
die Kosten für den Grunderwerb sowie für die vollständige Einzäunung des Fahrweges.<br />
Für die Ermittlung der jährlichen Kosten der Infrastruktur wird eine grobe Unterscheidung hinsichtlich der<br />
Nutzungsdauer der zu bauenden Anlagen vorgenommen. Hierbei wird zwischen folgenden Nutzungs-Zeiträumen<br />
unterschieden:
(1) Nutzungsdauer von 4 Jahren: Straßenfahrzeuge (bei <strong>einer</strong> Gesamt-Laufleistung von 700.000 km)<br />
(1) Nutzungsdauer von 15 Jahren: Straßenfahrbahn<br />
(1) Nutzungsdauer von 25 Jahren: Schienenfahrzeuge<br />
(2) Nutzungsdauer von 30 Jahren: Gleise, Weichen, Signale, Oberleitungen<br />
(3) Nutzungsdauer von 60 Jahren: Brücken, Tunnels, Dämme, Einschnitte<br />
Wissenschaftlich korrekt wäre es allerdings, für jeden einzelnen Anlageteil eine eigene Nutzungsdauer<br />
anzugeben, was jedoch aufgrund des sehr engen Zeit-und Kostenbudgets der vorliegenden Studie nicht zu leisten<br />
wäre. Für die Fragestellung in dieser Studie ist diese Vorgehensweise ohnehin ausreichend genau.<br />
Für Straßenfahrbahnen wird sonst z. T. mit <strong>einer</strong> Nutzungsdauer von 20 Jahren gerechnet. Angesichts des hohen<br />
Anteils von Fahrzeugen mit hoher Achslast wird hier jedoch eine Nutzungsdauer von nur 15 Jahren<br />
angenommen.<br />
Prämissen für die Berechnung der Betriebskosten<br />
Die Betriebskosten werden bei beiden Systemen auf ein Jahr bezogen. Es werden die Kosten für Wartung der<br />
Fahrzeuge, für den Energiebedarf der Fahrzeuge sowie für fahrendes und stationäres Personal berücksichtigt.<br />
Hinzu kommen noch Unterhalts- und Betriebskosten für die Infrastruktur.<br />
8.2 Zugsystem<br />
8.2.1 Investitionskosten für das Zugsystem<br />
Eisenbahn-Infrastruktur<br />
Entsprechend den bisherigen Erfahrungen der DB AG wird davon ausgegangen, daß eine 2-gleisige<br />
Eisenbahnstrecke (Planum, Gleise, Oberleitung inkl. Bahnstromversorgung, Signale) pro Kilometer 12 Mio. DM<br />
kostet, sofern keine Kunstbauten sowie keine größeren Dämme und Einschnitte erforderlich sind, und daß für<br />
Eisenbahnbrücken mit zusätzlichen Kosten von 40 Mio. DM pro Kilometer zu rechnen ist, bei der Mainbrücke<br />
sogar von 50 Mio. DM wegen der aufwendigeren Konstruktion. Unter Berücksichtigung auch der<br />
vergleichsweise kleinen Baumaßnahmen wie z.B. Weichen, Verbreiterung von Brücken, Aufschütten von<br />
Bahndämmen (siehe Anhang Tab. A2) betragen die Investitionskosten der Infrastruktur für das Zugsystem ohne<br />
Ausrüstung der Bahnhöfe (Einrichtungen zum Gepäckumschlag, Rolltreppen usw.) 365 Mio. DM, wenn man<br />
keine separaten Gleise entlang der ICE-Trasse zugrunde legt. Berücksichtigt man noch den kreuzungsfreien<br />
Umbau der "Raunheimer Kurve", der für eine Mitnutzung der ICE-Gleise zwingend erforderlich ist und für den<br />
Kosten von 40 Mio. DM anzusetzen sind, so summieren sich die Investitionskosten der Infrastruktur für das<br />
Zugsystem bei Mitnutzung der ICE-Gleise auf 405 Mio. DM (siehe Anhang Tab. A2 und A4).<br />
Wenn der Airport-Link durchgängig eigene Gleisen erhält, sind 617 Mio. DM zu veranschlagen (siehe Anhang<br />
Tab. A2, A3 und A4). Diese Infrastruktur kann dann allerdings möglicherweise auch von anderen Zügen genutzt<br />
werden. Beim Bau durchgängig eigener Gleise ist der oben genannte Umbau der "Raunheimer Kurve" an der<br />
ICE-Strecke nicht erforderlich.<br />
Werden diese Kosten per Annuitätenmethode auf die Nutzungsjahre umgelegt, so ergeben sich 21,7 Mio. DM<br />
pro Jahr für die Infrastruktur ohne separate Gleise und zusätzlich 10,4 Mio. DM pro Jahr, wenn durchgängig<br />
eigene Gleise für den Airport-Link geschaffen werden sollen. Mit separaten Gleisen betragen die Kosten pro<br />
Jahr somit 32,1 Mio. DM.<br />
Im Bahnhof T2 in Frankfurt Flughafen sind für die Gepäck-Behandlung und -Beförderung beim Zugsystem<br />
zusätzliche technische Einrichtungen erforderlich, nämlich ein automatisch betriebenes Leercontainer-Lager<br />
sowie ein Lift für Trolleys und Dolleys. Hierfür wird pauschal ein Investitionsbetrag von 10 Mio. DM berechnet.<br />
Bei <strong>einer</strong> Nutzungszeit von 15 Jahren errechnen sich hieraus jährliche Kosten für Abschreibung und Zinsen von<br />
0,9 Mio. DM.
FRA-interne Straßenverbindung zum Tor 97<br />
Bestandteil des Zugsystems ist auch eine kreuzungsfreie Verbindungsstraße vom Zentralbereich FRA T1 zum<br />
westlichen Vorfeld. Legt man Baukosten von 8 Mio. DM pro Streckenkilometer ohne Sonderbauwerke<br />
zugrunde, so betragen die Investitionskosten 39 Mio. DM incl. eines Tunnels, mehrerer Straßenbrücken und<br />
Anschlußstellen. Die jährlichen Kosten liegen nach der genannten Berechnungsmethode bei 1,9 Mio. DM.<br />
Angesichts der hohen Investitionskosten dieser nur 2,75 km langen Straße dürften die Mehrkosten für schnellere<br />
Vorfeldfahrzeuge vernachlässigbar sein, zumal dieser Lösung auch ein erhöhter Nutzen innerhalb von FRA<br />
gegenübersteht.<br />
Fahrzeuge<br />
Bei <strong>einer</strong> Zugfolge von 4 1/2 min und <strong>einer</strong> Wendezeit von 7 bzw. 8 min in beiden Endbahnhöfen ergibt sich für<br />
den Regelbetrieb ein Bedarf von 8 Zügen. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß zwei zusätzliche Züge als<br />
Reserve benötigt werden: ein Zug, der entweder in WIE oder T2 auf einem Abstellgleis ständig einsatzbereit zur<br />
Verfügung steht, falls <strong>einer</strong> der im Umlauf befindlichen Züge plötzlich ausgefallen oder stark verspätet sein<br />
sollte, und ein zweiter Zug für den Fall, daß <strong>einer</strong> der eingesetzten Züge für einen längeren Zeitraum wegen<br />
Wartung oder Reparatur aus dem Verkehr gezogen werden muß. Daraus ergibt sich ein Bedarf von insgesamt 10<br />
Zügen.<br />
Jeder Zug besteht aus <strong>einer</strong> E-Lok der Baureihe 101 und 5 IC-Waggons (vgl. Kapitel 3.6). Unterstellt man für<br />
die E-Lok einen Einkaufspreis von 5,5 Mio. DM sowie pro Personen- oder Gepäckwaggon einen Preis von 2,0<br />
Mio. DM, so kostet die Anschaffung <strong>einer</strong> Zuggarnitur 15,5 Mio. DM. Somit betragen die Investitionskosten für<br />
die benötigten 10 Züge insgesamt 155 Mio. DM. Dieser Betrag berücksichtigt den jüngsten Preisverfall in der<br />
Bahn-Zuliefererindustrie, aber auch gewisse Mehrkosten für Spezialanfertigungen wie z.B. Rollenfußböden in<br />
den Gepäckwaggons.<br />
Bezogen auf eine Nutzungsdauer von 25 Jahren, entsprechen die genannten Investitionskosten jährlichen Kosten<br />
von 9,9 Mio. DM. Wenn man auch anteilige Investitionskosten für ein Bahnbetriebswerk zur Wartung und<br />
Reparatur der Züge berücksichtigt und hierfür 14% der Fahrzeugkosten ansetzt, so fällt ein zusätzlicher Betrag<br />
von 1,4 Mio. DM pro Jahr an. Insgesamt betragen die Investitionskosten für die Fahrzeuge des Zugsystems 11,3<br />
Mio. DM.<br />
8.2.2 Betriebskosten für das Zugsystem<br />
Fahrzeuge<br />
Die Wartungskosten für den gesamten Zug incl. Lok werden pauschaliert mit 130.000 DM pro Waggon und<br />
Jahr. Die Wartungskosten betragen demnach jährlich 6,5 Mio. DM.<br />
Somit belaufen sich die Gesamtkosten der Airport-Shuttlezüge auf 17,8 Mio. DM pro Jahr.<br />
Energiekosten<br />
Unterstellt man ein ähnlich der ICE-Züge aerodynamisch optimiertes Fahrzeug, so ergibt sich laut Computer-<br />
Fahrsimulation ein Strombedarf von 250 kWh von WIE nach T2 sowie 330 kWh in der Gegenrichtung.<br />
Hochgerechnet auf 16 Stunden Betrieb im 4,5-Minuten-Takt, 426 Zugfahrten pro Tag und 365 Tage pro Jahr<br />
sowie einem Strompreis von 0,10 DM/kWh errechnen sich für die Traktionsenergie Kosten von 4,5 Mio. DM<br />
pro Jahr.<br />
Personalkosten<br />
Folgende Annahmen werden bezüglich der Personalkosten getroffen:<br />
Für die Ermittlung der Personalkosten wird ein Einsatz des Personals über 16 h pro Tag unterstellt. Pro<br />
Arbeitsplatz sind hierfür 3,8 Personen (incl. Reserven für Personalausfälle durch Urlaub und Krankheit)
erforderlich. Für Arbeitsvorbereitung sowie für Beaufsichtigung und Verwaltung des eingesetzten Personals<br />
wird ein Zuschlag von 25% auf die Zahl der Arbeitskräfte berechnet. Die Jahreskosten pro Person werden mit<br />
50.000 DM (einfachste Tätigkeiten) bis 75.000 DM angesetzt. Somit ergeben sich pro 16-h-Arbeitsplatz Kosten<br />
von 0,24 bis 0,36 Mio. DM pro Jahr.<br />
Mit folgendem Bedarf an Personal pro Zug ist zu rechnen:<br />
þ 1 Lokführer<br />
þ durchschnittlich 3 Zugbegleiter, deren Hauptaufgabe es ist, den umsteigenden Flugpassagieren Informationen<br />
und Orientierungshilfen zu geben; hierbei dürften im Schwachlast- und Normalbetrieb 2 Zugbegleiter<br />
ausreichen, während zu Spitzenzeiten (50% der Betriebszeit) 4 Zugbegleiter als erforderlich erscheinen<br />
þ durchschnittlich 4,5 Arbeitskräfte für die Gepäcksortierung (relativ einfache Tätigkeit), davon 3 Personen für<br />
Schwachlast- und Normalbetrieb und 6 zu Spitzenzeiten (50% der Betriebszeit).<br />
Hinzu kommt Personal zur Überwachung des Zugbetriebs (Stellwerk bzw. Leitzentrale) und der Fahrgastströme<br />
(Bahnsteigaufsicht) sowie für Auskünfte. Es ist davon auszugehen, daß zur Zugbetriebs-Überwachung ständig<br />
zwei Personen eingesetzt sind und jeder der 3 Bahnhöfe mit <strong>einer</strong> Aufsichts- und <strong>einer</strong> Auskunftsperson besetzt<br />
ist. Somit werden 8 Arbeitskräfte als stationäres Personal benötigt.<br />
Nach den oben genannten Annahmen betragen die Personalkosten pro Shuttlezug 2,52 Mio. DM pro Jahr. Für<br />
alle 8 im Einsatz befindlichen Züge ergeben sich 20,2 Mio. DM jährlich. Zusammen mit dem stationären<br />
Personal belaufen sich die gesamten Personalkosten des Zugsystems auf 23,0 Mio. DM pro Jahr.<br />
Infrastruktur-Wartung<br />
Für Wartung und Unterhalt der Infrastruktur des Zugsystems wird für die Anteile mit <strong>einer</strong> Nutzungsdauer von<br />
60 Jahren ein Wert von 0,5%, bezogen auf die Investitionskosten, angesetzt. Für die Anteile mit <strong>einer</strong><br />
Nutzungsdauer von 30 Jahren werden 1,5% angenommen. Diese Prozentwerte orientieren sich an den Werten,<br />
die in der "Standardisierten Bewertung von Verkehrsinvestitionen" Anwendung finden. [21] Demnach ergeben<br />
sich Kosten pro Jahr von 2,5 Mio. DM ohne durchgängig zusätzliche Gleise und zusätzlich 2,0 Mio. DM für<br />
durchgängig separate Gleise.<br />
8.2.3 Gesamtkosten des Zugsystems pro Jahr<br />
Die Gesamtkosten für das System Zug betragen pro Jahr 72 Mio. DM, wenn keine durchgängig separaten Gleise<br />
für den Airport-Link geschaffen werden, und 82 Mio. DM mit eigenen Gleisen.<br />
Diese Beträge erscheinen plausibel, wenn sie auf die Anzahl der erwarteten Fahrgäste in Höhe von 8,1 Mio. pro<br />
Jahr bezogen werden. Der kostendeckende Fahrpreis incl. separater Gleise beträgt demnach 10 DM pro<br />
umsteigenden Fluggast, der den Zug benutzt. Die Kosten für Transport und Vorsortierung von 1,5<br />
Gepäckstücken wie auch die Kosten <strong>einer</strong> FRA-internen Straße zur schnelleren Anbindung des westlichen<br />
Vorfeldes sind hierbei schon enthalten.<br />
Aufgabe der vorliegenden Studie ist es nicht, weitere Nutzungsmöglichkeiten des Airport-Links zu<br />
berücksichtigen. Dies könnten beispielsweise Fluggäste sein, die zwar in WIE einchecken, aber in FRA<br />
abfliegen, oder Flughafen- und Airline-Personal. Unterstellt man einmal für derartige Verkehre ein Aufkommen,<br />
das bei der Hälfte der hier betrachteten Transfer-Fluggäste liegt, so reduzieren sich die Kosten für den einzelnen<br />
Fahrgast entsprechend, und zwar auf 6 bis 7 DM für eine Fahrt. Bei der Kapazität der Züge ist dieser zusätzliche<br />
Verkehr schon berücksichtigt.<br />
Verglichen mit dem hoch defizitären klassischen Schienen-Personennahverkehr (SPNV) erscheint dieses<br />
Ergebnis kaum plausibel: Obwohl beim Zugsystem des Airport-Links sogar die Kosten für die Infrastruktur und<br />
zusätzliche Kosten für Gepäcktransport voll berücksichtigt sind, erscheint hier ein kostendeckender Betrieb zu<br />
akzeptablen Preisen realisierbar. Dies ist darauf zurückzuführen, daß das System Eisenbahn in diesem speziellen<br />
Anwendungsfall ökonomisch sehr günstige Randbedingungen vorfindet:<br />
þ relativ kostengünstiger Fahrweg (ohne Talbrücken und ohne lange Tunnels)<br />
þ im Vergleich zum SPNV hohe Geschwindigkeit und somit hohe Produktivität der Züge
þ eine trotz des Hub-and-Spoke-Systems relativ gleichmäßig über den Tag verteilte Nachfrage, während sich<br />
der SPNV durch extreme Spitzenlast zweimal am Tag und durch fast leere Fahrzeuge in den Früh-, Abend- und<br />
Nachtstunden auszeichnet.<br />
Bei der Umlegung der Kosten für den neuen Schienenweg ist die eventuelle Mitnutzung durch weitere Züge<br />
noch nicht berücksichtigt. So könnten auf Teilabschnitten der neuen Infrastruktur auch Regionalzüge der<br />
Relation Wiesbaden - Frankfurt verkehren. Außerdem ist die Verlängerung von ICE-Zugläufen, die nach der<br />
bisherigen DB-Planung in Frankfurt Flughafen Fernbahnhof enden würden, bis Wiesbaden Hbf vorstellbar oder<br />
ein Teil der ICE-Linien in der Relation Köln - Frankfurt Flughafen könnte über den Flughafen Wiesbaden-<br />
Erbenheim geleitet werden, der dadurch weitaus besser in das ICE-System integriert wird als allein durch die<br />
bisher geplante ICE-Linie Mannheim - Mainz - Wiesbaden - Köln. Dadurch reduzieren sich die Infrastruktur-<br />
Kosten, welche dem Airport-Link allein anzulasten sind.<br />
8.3 Bus-System<br />
8.3.1 Investitionskosten für das Bus-System<br />
Infrastruktur für das Bus-System<br />
Wie in Kapitel 4.3.1 beschrieben, scheidet eine Mitnutzung der bestehenden Straßen-Infrastruktur zwischen WIE<br />
und FRA aus zahlreichen Gründen aus. Somit bleibt nur die Möglichkeit, für den Airport-Link eine separate<br />
Bus-Trasse vorzusehen.<br />
Für diese 19 km lange Bus-Straße werden wiederum Kosten pro Streckenkilomter ohne Kunstbauten von 8 Mio.<br />
DM angesetzt. Für Straßenbrücken und -tunnels kommt eine zusätzliche Pauschale von 40 Mio. DM hinzu, bei<br />
der Mainbrücke von 50 Mio. DM wegen der aufwendigeren Konstruktion. Insgesamt ergeben sich somit<br />
Investitionskosten von 246 Mio. DM von WIE bis westlich Terminal 1 in FRA (siehe Anhang Tab. B). Weitere<br />
59 Mio. DM fallen für eine 1,6 km lange Verlängerung der Bus-Trasse bis östlich des Terminal 1 an, wobei hier<br />
die Kostenpauschale für den Strecken-Kilometer ohne Kunstbauten mit 10 Mio. DM anzusetzen ist (siehe<br />
Anhang Tab. C). Dieser höhere Betrag pro Kilometer kommt dadurch zustande, daß die Straßen-Verlängerung<br />
zu einem Großteil aus Dämmen und Rampen besteht, während die bisherige Kostenpauschale von 8 Mio. DM<br />
pro Kilometer eine ebenerdige Trasse voraussetzt.<br />
Auf ein Nutzungsjahr umgerechnet, sind für beide Straßenabschnitte zusammen 15,9 Mio. DM anzusetzen.<br />
Für die zusätzliche Infrastruktur zur Gepäck-Behandlung und -Beförderung (Leercontainer-Lager, Lifte) werden<br />
wie beim Zugsystem 0,9 Mio. DM pro Jahr veranschlagt. Diese technischen Einrichtungen sind beim Bus-<br />
System jedoch im Terminal WIE und nicht - wie beim Zugsystem - in FRA erforderlich.<br />
Fahrzeuge<br />
Für die Mehrheit der einzusetzenden Busse, die jeweils 20 Sitzplätze aufweisen (vgl. Kapitel 4.4), wird ein<br />
Kaufpreis von 350.000 DM angesetzt. Hinzu kommt eine eher geringere Stückzahl von Bussen (rund 1/3 der<br />
gesamten Fahrzeugflotte) mit der Sitzplatz-Kapazität normaler Reisebusse, deren Kaufpreis bei je 450.000 Mio.<br />
DM liegt.<br />
Für die Gepäck-Transporter wird ebenso pauschal ein Stückpreis von 350.000 DM angesetzt.<br />
Sondereinrichtungen wie Rollenfußböden sind in diesem Preis schon enthalten.<br />
Die Fahrzeuge werden über 4 Jahre abgeschrieben, was <strong>einer</strong> Gesamtfahrleistung von 730.000 km entspricht.<br />
Diese hohen Fahrleistungen sind für Nutzfahrzeuge üblich.<br />
Für den dargestellten Betrieb sind 40 kl<strong>einer</strong>e und 20 große Busse sowie 40 Fahrzeuge für den Gepäcktransport<br />
erforderlich. Rechnet man noch eine Reserve von 20% hinzu, ergibt sich ein Bedarf von 120 Fahrzeugen für<br />
Gepäck- und Personentransport mit Investitionskosten von 37 Mio. DM. Dies führt zu jährlichen Kosten<br />
(Abschreibung, Zinsen) in Höhe von 10,2 Mio. DM.
Des weiteren sind anteilige Investitionskosten für einen Betriebshof der Busflotte zu berücksichtigen. Hierfür<br />
werden 26% der Investitionskosten Fahrzeuge bei <strong>einer</strong> Nutzungsdauer von 25 Jahren angesetzt. Dieser<br />
pauschale Prozentsatz stellt einen Erfahrungswert bei Investitionen in Bus-Betriebshöfe des Öffentlichen<br />
Nahverkehrs dar. Die jährlichen Kosten für die Investitionen in Betriebshöfe betragen demnach 0,6 Mio. DM.<br />
8.3.2 Betriebskosten für das Bus-System<br />
Fahrzeuge<br />
Die Wartungskosten für die Busse und Gepäck-Transporter werden bezogen auf die Anzahl der Sitzplätze in<br />
analoger Höhe zum Zugsystem angesetzt. Pro Fahrzeug ergeben sich dann jährliche Wartungskosten von 30.000<br />
DM und für alle 120 Fahrzeuge zusammen von 3,6 Mio. DM pro Jahr.<br />
Energiekosten<br />
Bei <strong>einer</strong> Geschwindigkeit von 120 km/h beträgt der Verbrauch an Dieseltreibstoff für einen normalen Reisebus<br />
36 l/100 km. Auf die etwas kl<strong>einer</strong>en Fahrzeuge bezogen ist mit 24 l/100 km zu rechnen. Bei einem<br />
Treibstoffpreis von 1,30 DM/l und der unterstellten Umläufe ergibt dies Kosten pro Jahr in Höhe von 6,6 Mio.<br />
DM.<br />
Personalkosten<br />
Die Personalkosten bestehen allein aus Kosten für Fahrzeugführer. Es gelten die dieselben Annahmen wie beim<br />
Zugsystem (3,8 Personen pro Arbeitsplatz, 25% Zuschlag für Arbeitsvorbereitung und Kontrolle), allerdings<br />
wird bei Busfahrern ein gegenüber Eisenbahn-Angestellten etwas reduzierter Lohn in Höhe von 65.000 DM pro<br />
Jahr zugrundegelegt.<br />
Neben dem fahrenden Personal wird noch stationäres Personal benötigt, und zwar vier Arbeitsplätze zur<br />
Überwachung und Steuerung des Bus-Systems und im Busbahnhof des Terminals WIE je eine Person für<br />
Aufsicht und für Auskunft. Für jeden dieser stationären Arbeitsplätze wird ein Lohn in Höhe von 75.000 DM pro<br />
Jahr angesetzt.<br />
Für fahrendes und stationäres Personal ergeben sich somit 30,0 Mio. DM pro Jahr, wobei 90 Arbeitsplätze über<br />
16 Stunden pro Tag besetzt sind.<br />
Infrastruktur-Wartung<br />
Wie schon beim Zugsystem wird für Wartung und Unterhalt der Infrastruktur bei den Anteilen mit <strong>einer</strong><br />
Nutzungdauer von 60 Jahren ein Wert von 0,5%, bezogen auf die Investitionskosten, angesetzt. Für die Anteile<br />
mit <strong>einer</strong> Nutzungsdauer von 15 Jahren werden 3% angenommen. Die Wartungs- und Unterhaltskosten der Bus-<br />
Straße betragen dann pro Jahr 2,5 Mio. DM.<br />
8.3.3 Gesamtkosten des Bus-Systems pro Jahr<br />
Die Gesamtkosten für das Bus-System betragen 70 Mio. DM pro Jahr.<br />
Den Großteil dieser Kosten bilden die Betriebskosten. Allein die Personalkosten betragen 43% der<br />
Gesamtkosten. Dagegen haben die Investitionskosten für die Infrastruktur, im wesentlichen die neue Bus-Straße<br />
von WIE nach FRA, mit einem Anteil von nur 22% an der Gesamtsumme von 70 Mio. DM pro Jahr nur ein<br />
relativ geringes Gewicht.<br />
8.4 Kosten für Terminal in Wiesbaden-Erbenheim bei Zug- und Bus-System<br />
Die Zug- und die Bus-Lösung weisen in Wiesbaden-Erbenheim unterschiedliche Terminal-Konfigurationen auf:<br />
Beim Bus-System gibt es zwei Baukörper, nämlich ein Haupt-Terminal mit Eisenbahn-Fernbahnhof und<br />
landseitiger Erschließung sowie das Satelliten-Terminal, an dem die Busse nach FRA abfahren bzw. von FRA<br />
ankommen. Bei der Zug-Lösung gibt es dagegen einen einzigen Terminal-Baukörper, der entsprechend größer<br />
ist.
Die Anlage X "Terminalgebäude Bauaufwand" enthält eine Aufschlüsselung der Quadratmeterflächen, der<br />
Kubikmeter umbauten Raumes sowie der technischen Ausrüstungen für Zug- und Bus-Terminals. Aus den<br />
ermittelten Gebäude-Flächen, -Volumen und -Ausrüstungen ergeben sich für die Terminals der Bus-Lösung<br />
Gesamtkosten von 533 Mio. DM und für das Terminal der Zug-Lösung von 565 Mio. DM. Somit entstehen bei<br />
der Zug-Lösung Mehrkosten von 6% gegenüber der Bus-Lösung.<br />
Die Kosten wurden ermittelt anhand eines konkreten Kostenvoranschlag für ein vergleichbares<br />
Flughafenterminals. Sie entsprechen mit 5.050 DM pro Quadratmeter nutzbarer Gebäudefläche den Kosten<br />
ähnlicher Projekte, die sich im Bereich von 4.500 DM/m2 [22] bis 5.300 DM/m2 bewegen.<br />
Um die Investitionskosten in jährliche Kosten umzurechnen, wird ein Nutzungszeitraum von nur 30 Jahren<br />
unterstellt. Üblicherweise werden Hochbauten über 50 Jahre genutzt bzw. abgeschrieben, was angesichts der<br />
sich schnell ändernden Anforderungen im Flugverkehr zu lange wäre. Für die Unterhaltskosten werden 12 DM<br />
pro m2 angenommen, während die Unterhaltskosten für herkömmliche Bürobauten mit 7 DM pro m2<br />
veranschlagt werden. Dieser deutlich höhere Kostenansatz erscheint gerechtfertigt, wenn man die große<br />
Personenfrequenz und die meist größere lichte Höhe der Räume in Flughafenterminals berücksichtigt. Hinzu<br />
kommen noch 5 DM pro m2 für nicht nutzungsdauer-verlängernde kalkulatorische Instandhaltung. Angesichts<br />
der anspruchsvolleren Bauwerksgestaltung wurde dieser Wert um den Faktor 2 über dem beim Wohnungsbau<br />
üblichen Wert angesetzt.<br />
Die jährlichen Annuitäten und Unterhaltskosten zusammen ergeben für das Terminal der Zug-Lösung jährliche<br />
Kosten von 34,7 Mio. DM und für die Terminals der Bus-Lösung Kosten von 32,7 Mio. DM pro Jahr. Dies<br />
ergibt eine Differenz von 2,0 Mio. DM pro Jahr zugunsten der Bus-Lösung.<br />
Sowohl bei der Zug- als auch bei der Bus-Lösung sind Kosten für Gepäcksortier-und -förderanlagen sowie für<br />
die Ausrüstung der Flugzeug-Standplätze nicht im Kostenvergleich enthalten, da sie bei jeder der beiden<br />
Lösungen ebenso wie auch bei einem weiteren Ausbau des Flughafens FRA in etwa gleicher Höhe anfallen.<br />
Bei Kostenaufstellung des Bus-Systems fehlen außerdem die z. T. erforderlichen relativ kleinen Baumaßnahmen<br />
an den Terminals in FRA, denn hier müssen mehrere Treppenaufgänge von der Vorfeld-Ebene zur Fluggast-<br />
Ebene geschaffen werden. Um die entsprechenden Investitionskosten genau kalkulieren zu können, wäre eine<br />
Analyse sehr detaillierter Pläne der bestehenden Terminals in FRA und entsprechender Umbau-Planungen<br />
erforderlich, was aufgrund des Zeit- und Kostenbudgets der vorliegenden Studie nicht durchführbar ist. Deshalb<br />
wird auf die Ermittlung der genannten Kosten zur Modifikation der Terminals in FRA verzichtet. Bei der Zug-<br />
Lösung sind keine derartigen Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Dies führt zu gewissen Mehrkosten für die<br />
Bus-Lösung, die in etwa den geringen Kostenvorteil der Bus-Lösung aufwiegen dürften. So gesehen, dürften die<br />
Unterschiede in den Kosten der Terminals von Zug- und Bus-System kaum nennenswert sein.<br />
8.5 Vergleich des Zugsystems mit dem Bus-System hinsichtlich Investitions-und Betriebskosten<br />
Die Gesamtkosten des Bus-Systems liegen in <strong>einer</strong> ähnlichen Größenordnung wie die des Zugsystems. Wenn<br />
man das Zugsystem ohne durchgehend eigene Gleise betrachtet, liegen dessen Gesamtkosten fast gleichauf mit<br />
den Kosten des Bus-Systems. Werden für das Zugsystem von WIE bis FRA durchgängig separate Gleisen<br />
unterstellt, so liegen die Kosten um 14% über den Gesamtkosten des Bus-Systems. Doch diese Mehrkosten<br />
relativieren sich wiederum stark, falls diese zusätzlichen Gleise auch von anderen Zügen genutzt werden können.<br />
Das der Kostenberechnung zugrundeliegende Zugangebot ist bezüglich der Kapazität im Personentransfer um<br />
rund 50% überdimensioniert und steht deshalb prinzipiell auch für andere Verkehre zur Verfügung.<br />
Beispielsweise können Originärpassagiere aus Wiesbaden oder Mainz, die mit dem Pkw anreisen, ihren Wagen<br />
in Wiesbaden-Erbenheim parken, um mit den Shuttlezügen zum Check-in nach Frankfurt weiterzufahren.<br />
Ebenso können Flughafen- oder Airline-Mitarbeiter, deren Einsatzort zwischen WIE und FRA wechselt, mit<br />
diesen Zügen zu ihrem Arbeitsplatz gelangen.<br />
9. Connection Time beim weiteren Ausbau in FRA im Vergleich zum Verbund WIE + FRA<br />
Um die drohenden Kapazitätsengpässe in FRA zu vermeiden, gibt es als Alternative zum beschriebenen<br />
Flughafen-Verbund WIE + FRA die "klassische" Lösung, den Flughafen Frankfurt selbst auszubauen, indem er<br />
eine 4. Landebahn und ein drittes Terminal erhält. Als ein möglicher Standort für dieses zusätzliche Terminal<br />
wird das Gelände der US Air Base südlich der Start- und Landebahn Süd diskutiert (im folgenden als "FRA Süd"
ezeichnet). Für einen solchen Ausbau von FRA ist die erreichbare Transferzeit zu ermitteln und anschließend<br />
mit den Transferzeiten zu vergleichen, die beim Flughafen-Verbund WIE + FRA erzielt werden.<br />
9.1 Prämissen des Vergleichs<br />
Um einen exakten Vergleich der Connection Time zwischen den Standorten WIE und FRA zu ermöglichen, wird<br />
für das Terminal 3 (abgekürzt: T3) in FRA eine Konfiguration zugrunde gelegt, welche identisch ist mit der in<br />
WIE, auch wenn interne Planungen der FAG möglicherweise andere Terminalkonfigurationen vorsehen. Auch<br />
das dem Terminal 3 zugeordnete Vorfeld ist deckungsgleich mit dem für WIE skizzierten Vorfeld. Ebenso ist es<br />
erforderlich, daß in den Vergleich Flugzeug-Positionen in T3 einbezogen werden, die genau denen in WIE<br />
entsprechen.<br />
Daraus folgt, daß auch für T3 zwei Lösungen zu untersuchen sind: eine Variante, die baulich identisch ist mit<br />
dem Terminal WIE beim Zugsystem, und eine zweite Version, die dem Terminal WIE beim Bus-System exakt<br />
gleicht. Beide Terminal-Varianten sollen auf dem genannten Gelände der US Air Base liegen.<br />
Für den Transport des Gepäcks wird jedoch sowohl für die Bus- als auch für die Zug-Lösung ein Anschluß an<br />
die GFA mit einem unterirdisch verlaufenden Förderband unterstellt. Hier unterscheiden sich die beiden<br />
Lösungen nur durch die Auswahl der "Worst-Case-Positionen", die sich an den jeweiligen Worst-Case-<br />
Positionen für den Passagiertransport orientieren.<br />
9.2 Terminal 3 in FRA identisch mit Terminal WIE beim Zugsystem<br />
9.2.1 Zeit-Wege-Ketten Gepäck<br />
Für die Zeit-Wege-Kette bezüglich Gepäck bei der Ausbaulösung in FRA wird ein konventioneller Ansatz<br />
gewählt: Das Gepäck wird nicht in einen Zug verladen, sondern die GFA in FRA erhält eine entsprechende<br />
Erweiterung. Dies führt zu zwei wesentlichen Änderungen gegenüber dem Konzept für den Gepäcktransport<br />
beim Zugsystem zwischen Wiesbaden-Erbenheim und Frankfurt:<br />
þ Die Entladung der aus dem Flugzeug kommenden Gepäck-Container findet stationär und nicht in einem<br />
fahrenden Zug statt.<br />
þ Anstelle der Gepäckbeförderung zwischen WIE und T1/T2 mittels Shuttlezug wird nun das Gepäck zwischen<br />
T3 und T1/T2 mit einem Gepäck-Förderband transportiert.<br />
Dieses Förderband nach T3 wird vollständig in die GFA in FRA integriert, die somit entsprechend zu erweitern<br />
ist. Hierfür ist unter dem Taxiway- und Runway-System in FRA ein Tunnel zu bauen, der vom Vorfeldgebäude<br />
V3, wo sich heute eine der Ausgabestellen der vorhandenen GFA befindet, direkt nach Süden zu einem zentralen<br />
Punkt im neuen Terminal 3 verläuft. Dieser Gepäck-Tunnel schneidet in einem sehr flachen Winkel die Rollbahn<br />
F. Die zusätzliche Förderstrecke von V3 nach T3 hat eine Länge von ca. 1,5 km. Bei <strong>einer</strong> Förder-<br />
Geschwindigkeit von 5 m/sec oder 18 km/h - dies ist die Geschwindigkeit der schnellsten Förderbänder - dauert<br />
der Gepäcktransport in diesem Terminal-Link 5 min. Nach Aussagen von VanderLande sind in Zukunft<br />
allerdings auch Förderzeiten von 10 m/s zu erreichen, womit die Zeit noch weiter reduziert werden könnte.<br />
Derzeit gibt es jedoch derartig schnelle Förderbänder noch nicht.<br />
Die Förder- und Sortierzeiten in der GFA T3 können etwas reduziert werden (von 5 auf 3 min), da für den<br />
Beginn des schnellen Förderbandes ein zentraler Punkt ausgewählt werden kann, so daß gegenüber einem<br />
Transport innerhalb von T3 nur maximal der halben Weg zurückgelegt werden muß.<br />
Die Förderzeit in der GFA von T1 und T2 wird grundsätzlich mit 15 min angenommen. Damit wird der<br />
maximale Weg wiedergegeben, welcher in dieser GFA zurückgelegt werden kann.<br />
Sind Vorfeldpositionen mit Zuordnung zu T1 bzw. T2 in FRA abzufertigen, dann werden diese vom<br />
Vorfeldgebäude V3 aus bedient. Die Aufenthaltszeit in der GFA wird dann mit 1 min gesetzt, da das Gepäck<br />
dann direkt im Gebäude V3 aus dem System ausgeschleift werden kann.<br />
Analog zur Zug-Lösung Wiesbaden wurden am Vorfeld von T3 analog zu WIE nur kleine Flugzeuge mit Bulk<br />
Cargo angesetzt.
Tab. 12: Übersicht über die möglichen Beziehungen des Gepäcktransfers<br />
Fall von bzw. nach von bzw. nach<br />
Nr.<br />
1 Äußere Remoteposition in T3 Westliche Vorfeldposition in FRA (V270)<br />
2 Äußere Remoteposition in T3 D12 in FRA über Shuttle-Bahnhof T1<br />
3 Äußere Remoteposition in T3 D11 in FRA über Shuttle-Bahnhof T2<br />
4 Gebäudeposition in T3 (äußerer Pier) Westliche Vorfeldposition in FRA (V270)<br />
5 Gebäudeposition in T3 (äußerer Pier) D12 in FRA über Shuttle-Bahnhof T1<br />
6 Gebäudeposition in T3 (äußerer Pier) D11 in FRA über Shuttle-Bahnhof T2<br />
Tab. 13: Zeit-Wegekette Gepäck von T3 nach T1/T2 in FRA (SkyLine-GFA-Lösung)<br />
Prozesse Bemerkungen Fall T1 Fall T2 Fall T3 Fall T4 Fall T5 Fall T6<br />
1 Entladevorgang Gepäck Positionierung Fahrzeuge 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0<br />
2 Entladen Cont. 1 + 2 (LD3 Cont.) 2,0 2,0 2,0<br />
3 Entladen Cont. 3 + 4 (LD3 Cont.) 2,0 2,0 2,0<br />
4 Entladung Bulk Cargo (je Gepäckraum) 5,0 5,0 5,0<br />
5 Transport zum Terminal max.100 m bei max. 30 km/h 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5<br />
6 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5<br />
7 Sortierung im GFA T3 Entladung (max. 40 Stück je Station) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0<br />
8 Transport in GFA T3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0<br />
9 Transport nach Norden (V3) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0<br />
10 Transport T3 - T1/T2 Zeit in GFA Nord 1,0 15,0 15,0 1,0 15,0 15,0<br />
11 Beladung Cont. /Trol. (letz.Gep.stk) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
12 Transp. an Flugzeug (inkl.Verlustz.) 9,0* 0,5 0,5 9,0* 0,5 0,5<br />
13 Verlustzeiten (25%, mind.1 min) 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0<br />
14 Beladung Flugzeug 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0<br />
15 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 40,0 44,5 44,5 39,5 44,0 44,0<br />
Differenz zu WIE -: T3 schneller +: T3 langsamer -3,5 -0,5 0,0 -3,0 0,0 +0,5<br />
Tab. 14: Zeit-Wegekette Gepäck von T1/T2 in FRA nach T3 (SkyLine-GFA-Lösung)<br />
Prozesse Bemerkungen Fall T1 Fall T2 Fall T3 Fall T4 Fall T5 Fall T6<br />
1 Entladevorgang Gepäck Positionierung Fahrzeuge 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0<br />
2 Entladen Cont. 1 + 2 (LD3 Cont.) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0<br />
3 Entladen Cont. 3 + 4 (LD3 Cont.) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0<br />
4 Transport T1/T2 - T3 Fahrzeit Vorfeld FRA-Nord 9,0* 0,5 0,5 9,0* 0,5 0,5<br />
5 Verlustzeiten (25%, mind. 1 min) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
6 Entladung (max. 40 Stück je Station) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0<br />
7 Zeit in GFA Nord 1,0 15,0 15,0 1,0 15,0 15,0<br />
8 Transport nach Norden (V3) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0<br />
9 Sortierung im GFA T3 Transport in GFA T3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0<br />
11 Beladen Gepäck Beladung Cont./Trol. (letz.Gep.stk) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
12 Transport an Flugzeug (100 m) 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5<br />
13 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5<br />
14 Positionierung Dolley/Trolley 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5<br />
15 Beladung Flugzeug 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0<br />
16 Entf. Fahrz., Off Block 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 39,5 45,0 45,0 39,0 44,5 44,5<br />
Differenz zu WIE -: T3 schneller +: T3 langsamer -5,0 -1,0 0,0 -4,5 -0,5 0,0<br />
* 6,5 min vom Zentralbereich des Terminals 1 zur Vorfeldposition auf neuer Vorfeld-Straße analog Zug-<br />
Lösung Wiesbaden-Erbenheim, 1,5 min Fahrzeit V3 -Zentralbereich Terminal 1 und 1 min Verlustzeit.
Somit beträgt für das Gepäck bei der Lösung "T3 analog Zug-Lösung" die maximale Connection Time genau 45<br />
min. Im Durchschnitt aller Worst-Case-Positionen sind die Connection Times rund 1,5 Minuten kürzer als bei<br />
"Wiesbaden-Erbenheim Zug-Lösung". Diese ähnlich langen Zeiten werden durch die Gegebenheiten des<br />
heutigen Systems in FRA hervorgerufen, da die Förderzeit in der bestehenden GFA 15 Minuten beträgt. Sollte<br />
dann auch das zusätzliche Gepäck aus T3 Süd über diese Anlage geführt werden, kann es allerdings zu<br />
Kapazitätsproblemen kommen, die weitere Ausbaumaßnahmen an dieser Anlage erfordern würden.<br />
Wie aus Tab. 13 hervorgeht, wird bei der Transportkette von T3 nach T1/T2 die geforderte MCT von 45 min<br />
eingehalten bzw. leicht unterschritten. In der Tendenz ist der Zeitaufwand allerdings gegenüber dem Flughafen-<br />
Verbund WIE + FRA kaum verändert; im Durchschnitt aller Worst-Case-Positionen knapp 1 min ab.<br />
Bei Betrachtung der Gegenrichtung, also von T1/T2 nach T3, gibt es leichte Vorteile für die T3-Lösung<br />
gegenüber dem Zugsystem beim Flughafen-Verbund WIE + FRA.<br />
Die sehr ähnlichen Zeiten für den Gepäcktransport beider Lösungen verwundern auf den ersten Blick, zumal die<br />
Entfernung zwischen T3 und T1 nur ein Zehntel der Entfernung zwischen WIE und T1 beträgt. Doch dieser<br />
Nachteil wird bei der Lösung "Verbund WIE + FRA" durch zwei Effekte kompensiert:<br />
þ Während das unterirdische Gepäckband in FRA "nur" eine Transportgeschwindigkeit von 18 km/h hat, fährt<br />
der Shuttlezug mit <strong>einer</strong> Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 km/h, also fast zehn mal so schnell. Die Fahrzeit<br />
des Zuges ist nur eine Minute länger als die Förderzeit auf dem unterirdischen Gepäckband.<br />
þ Zwar ist beim Zugsystem eine Wartezeit bis zur Zugabfahrt anzusetzen, aber dafür wird das zeitaufwendige<br />
Öffnen bzw. Befüllen der Container während der Zugfahrt vorgenommen, so daß der entsprechende Zeitaufwand<br />
eingespart werden kann. Dagegen findet das Öffnen bzw. Befüllen der Container bei der T3-Lösung stationär<br />
statt, was in etwa der genannten Wartezeit beim Zugsystem entspricht.<br />
Der Gepäcktransport erfährt, alles in allem betrachtet, durch den Ausbau des Flughafens Frankfurt incl. drittem<br />
Terminal gegenüber dem Flughafen-Verbund WIE + FRA hinsichtlich der Transferzeit keine nennenswerte<br />
Verbesserung.<br />
9.2.2 Zeit-Wege-Ketten Personen<br />
Im Fall des Ausbaus von FRA könnte das vorhandene Personen-Transport-System Sky Line, das heute T1 mit<br />
T2 verbindet, über die Station D/E in T2 hinaus bis zum neuen Terminal 3 verlängert werden. Diese zusätzliche<br />
Strecke, die am Ostrand des Flughafen-Geländes entlang führt, hätte eine Länge von rund 3,75 km. Wenn man in<br />
D/E dieselbe Haltedauer zugrunde legt wie heute in der Zwischenstation B, nämlich 60 sec so lassen sich<br />
aufgrund der technischen Daten der Sky Line [23] folgende Fahrzeiten ermitteln:<br />
þ von T2 nach T3: 5 min 20 sec<br />
þ von T1 nach T3: 8 min 20 sec.<br />
Die Fahrzeit zwischen T1 und T3 ist somit etwas länger als die entsprechende Fahrzeit beim Airport-Link<br />
zwischen T1 und WIE, zwischen T2 und T3 hingegen ist sie nur ungefähr halb so lang wie zwischen T2 und<br />
WIE.<br />
Bei der Firma ADtranz, dem Hersteller der heutigen Sky Line ist, gibt es Überlegungen, anstelle der<br />
Verlängerung der Sky Line von T2 nach T3 zwischen diesen beiden Terminals ein neues Personen-Transport-<br />
System (PTS) zu bauen, das eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erreichen und somit etwas schneller sein<br />
soll als die Sky Line mit maximal 50 km/h. Durch diese höhere Geschwindigkeit der "Sky Line der 2.<br />
Generation" wird eine um rund 90 sec kürzere Fahrzeit erreicht, so daß die Fahrt von T2 nach T3 nur noch knapp<br />
4 min dauert. Doch dies würde die Fahrzeit zwischen T1 nach T3 nicht ändern, denn in T2 müßten die<br />
Passagiere zwischen der herkömmlichen Sky Line und dem neuen PTS umsteigen, wobei die Umsteigezeit bis<br />
zu 90 sec betragen würde, entsprechend der technisch möglichen minimalen Zugfolgezeit der Sky Line von rund<br />
90 sec [24]. Deshalb ist auch eine solche Lösung nicht zielführend.<br />
Um einen exakten Vergleich zwischen dem Zugsystem beim Flughafenverbund WIE + FRA und <strong>einer</strong> analogen<br />
Lösung für T3 zu erhalten, wird für die Anbindung von T3 im Personentransport folgendes unterstellt: Es wird<br />
eine völlig neue Sky Line-Strecke ab dem Zentralbereich von T1 über T2 bis T3 gebaut, damit Sky Line-Züge
der 2. Generation durchgängig mit <strong>einer</strong> Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h verkehren können. Diese neue<br />
Bahntrasse ergänzt somit zwischen T1 und T2 die vorhandene, langsamere Sky Line und verläuft hier genau auf<br />
der Trasse der im Fall "Zugsystem beim Flughafen-Verbund WIE + FRA" unterstellten Eisenbahnstrecke. Ein<br />
Umbau der bestehenden Sky Line-Strecke zwischen T1 und T2 reicht hingegen nicht aus, da die bestehende<br />
Trassenführung aufgrund mehrerer relativ enger Kurven keine höhere Geschwindigkeit als heute zuläßt, auch<br />
wenn neue Sky Line-Züge für 80 km/h ausgelegt sind.<br />
Die unterstellten neuen Sky Line-Bahnhöfe T1 und T2 sind in ihrer Lage mit den Bahnhöfen des Zugsystems<br />
beim Flughafenverbund WIE + FRA identisch. Das heißt, daß sämtliche Fußwege von und zu den Bahnhöfen T1<br />
und T2 dieselben sind wie bei dem genannten Zugsystem. Dies bedeutet auch, daß für die Personen-Wege<br />
dieselben Optimierungen unterstellt werden, beispielsweise ein mit nur <strong>einer</strong> einzigen Rolltreppe erreichbarer<br />
Busbahnhof direkt unterhalb des Bahnhofs T1 oder ein diagonaler Fußweg auf Fluggastebene vom Bahnhof T2<br />
zum Flugsteig D9.<br />
Mit <strong>einer</strong> von T3 über T2 bis T1 neu gebauten Sky Line für 80 km/h ergeben sich die folgenden Fahrzeiten:<br />
þ von T2 nach T3: 3 min 50 sec<br />
þ von T1 nach T3: 6 min 00 sec.<br />
Während beim Zugsystem als Airport-Link zwischen WIE und FRA Grenz- und Zollkontrollen, soweit sie<br />
überhaupt noch erforderlich, während der Zugfahrt stattfinden und somit keinen zusätzlichen Zeitaufwand<br />
bedeuten, können bei der vorliegenden Ausbaulösung in FRA diese Kontrollen nur stationär erfolgen. Denn zum<br />
einen läßt es die relativ geringe Größe der Sky-Line-Waggons nicht zu, in diese Fahrzeuge auch noch<br />
Abfertigungs-Schalter wie bei den genannten Shuttlezügen einzubauen (vgl. Kapitel 6.3.4), und zum anderen ist<br />
die Fahrzeit der Sky Line zu kurz, um bei mehreren Personen nacheinander die erforderlichen Grenz- und ggfs.<br />
auch Zollkontrollen im Zug durchzuführen. Für die stationären Kontrollen im Terminal ist ein Zeitaufwand von<br />
5 min zu veranschlagen. Für die Vorfeldpositionen sind Grenzkontrollen erforderlich. Diese finden nicht auf der<br />
Ebene 0 (Bahnsteig und Bussteige), sondern auf der Fußgängerebene statt, was zu zwei Ebenenwechsel sowie zu<br />
einem kurzen Fußweg führt.<br />
Die Zeiten für die Grenzkontrolle werden analog zum Bus-System gewählt (vgl. Kapitel 7.3.2 und 7.3.3).<br />
Gegenüber dem Zugsystem beim Flughafen-Verbund WIE + FRA (vgl. Tab. 6) wurden in FRA einige Gebäude-<br />
Positionen als worst cases neu definiert: Der Einzugsbereich der Bahnhöfe T1 und T2 ändert sich, weil im Fall<br />
von T3 die Züge vom Osten in das System T1 + T2 hineinfahren. Positionen, die genau zwischen T1 und T2<br />
liegen, werden jetzt über T2 erschlossen und nicht über T1; die Trennlinie der Einzugsbereiche der Bahnhöfe T1<br />
und T2 verschiebt sich dadurch geringfügig.<br />
Tab. 17: Übersicht über die möglichen Beziehungen des Personentransfers<br />
Fall von bzw. nach von bzw. nach<br />
Nr.<br />
1 Äußere Remoteposition in T3 Westliche Vorfeldposition in FRA (V270)<br />
2 Äußere Remoteposition in T3 C11 in FRA über Shuttle-Bahnhof T1<br />
3 Äußere Remoteposition in T3 D13 in FRA über Shuttle-Bahnhof T2<br />
4 Gebäudeposition in T3 (äußerer Pier) Westliche Vorfeldposition in FRA (V270)<br />
5 Gebäudeposition in T3 (äußerer Pier) C11 in FRA über Shuttle-Bahnhof T1<br />
6 Gebäudeposition in T3 (äußerer Pier) D13 in FRA über Shuttle-Bahnhof T2<br />
Tab. 18: Zeit-Wegekette Passagiere von T3 nach T1/T2 (SkyLine/GFA-Lösung)<br />
Prozesse Bemerkungen Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6<br />
Positionierung Brücken 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5<br />
Deboarding 150 Pax bei 22 Pax/min 4,5** 4,5** 4,5** 7,0 7,0 7,0<br />
Weg zum Bus 0,5 0,5 0,5<br />
Bustransfer (Vorfeld) 600 m bei 30 km/h 1,5 1,5 1,5<br />
Verzögerung mind. 0,5 min 0,5 0,5 0,5<br />
Wege im Terminal 3 Fußweg zum Bahnsteig 5,0 5,0 5,0
Aussteigen Bus 1,0 1,0 1,0<br />
Ebenenwechsel 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5<br />
Grenzkontrolle stationär 6,0 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0<br />
Orientierung 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Fußweg zum Zug 1,5 1,5 1,5<br />
Sky Line Warten am Bahnhof 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0<br />
Fahrzeit 6,0 6,0 4,0 6,0 6,0 4,0<br />
Aussteigen aus Zug 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5<br />
Wege im Terminal 1/2 Orientierung 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Ebenenwechsel 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5<br />
Weg zum Gate 1,5 8,0 10,5 1,5 8,0 10,5<br />
Bustransfer (Vorfeld) Einsteigen (letzter Pass.) 0,5 0,5<br />
i.d.R. 25 km/h 6,5* 6,5*<br />
Verzögerung 25%,mind.1min 1,0 1,0<br />
Aussteigen Bus (letzter P.) 1,0 1,0<br />
vom Bus zur Flugzeugtür 0,5 0,5<br />
Boarding letzter Passagier 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0<br />
Engine Start und Entfernung Brücken 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 46,0 40,5 41,0 44,0 38,5 39,0<br />
Differenz zu WIE -:T3 schneller +:langsamer +3,5 +1,0 +1,5 -2,5 -5,0 -1,5<br />
Tab. 19: Zeit-Wegekette Passagiere von T1/T2 nach T3 (SkyLine/GFA-Lösung)<br />
Prozesse Bemerkungen Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6<br />
Positionierung Brücken 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5<br />
Deboarding 350 Pax 7** 10,5 10,5 7** 10,5 10,5<br />
Ebenenwechsel 0,5 0,5<br />
Bustransfer (Vorfeld) i.d.R. 25 km/h 6,5* 6,5*<br />
Verzögerung 25%,mind.1min 1,0 1,0<br />
Aussteigen Bus 1,0 1,0<br />
Wege im Terminal 1/2 Weg zum Bahnsteig 1,5 8,0 10,5 1,5 8,0 10,5<br />
Orientierung 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Ebenenwechsel 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5<br />
Sky Line Warten am Bahnhof 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0<br />
Fahrzeit 6,0 6,0 4,0 6,0 6,0 4,0<br />
Aussteigen aus Zug 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5<br />
Wege im Terminal 3 Ebenenwechsel 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5<br />
Orientierung 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Grenzkontrolle stationär 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5<br />
Vom Bahnsteig zum Gate 1,5 1,5 1,5 5,0 5,0 5,0<br />
Bustransfer (Vorfeld) Einsteigen (letzter Pass.) 0,5 0,5 0,5<br />
600 m bei 30 km/h 1,5 1,5 1,5<br />
Verzögerungszeiten 0,5 0,5 0,5<br />
Aussteigen Bus (letzter P.) 1,0 1,0 1,0<br />
Ebenenwechsel 0,5 0,5 0,5<br />
Boarding letzter Passagier 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0<br />
Engine Start und Entfernung Brücken 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 46,0 46,5 47,0 43,0 43,5 44,0<br />
Differenz zu WIE -:T3 schneller +:langsamer +1,0 -1,5 -1,0 -1,0 -3,5 -3,0<br />
* Nutzung der neuen Zubringerstraße für westliches Vorfeld wie in Kapitel 3.5 beschrieben. Die<br />
Verzögerungszeiten beziehen sich nur auf das Vorfeld selbst, nicht aber auf die neue Zubringerstraße. Ohne neue<br />
Zubringerstraße verlängert sich die Fahrzeit um 4 min.<br />
** Aussteigevorgang auf dem Vorfeld über zwei Brücken
Insgesamt ergibt sich für die Wegekette Personen beim hier skizzierten Anschluß des Terminals 3 über eine auch<br />
zwischen T1 und T2 völlig neu zu bauende Sky Line im Durchschnitt aller Worst-Case-Positionen ein leichter<br />
Zeitvorteil von rund 1 min gegenüber dem Zugsystem beim Flughafen-Verbund von WIE und FRA.<br />
Somit werden bei der Variante "Terminal 3" selbst in <strong>einer</strong> progressiven Variante mit Neubau der Sky Line auch<br />
zwischen T1 und T2 beim Personentransport keine wesentlich kürzeren Transferzeiten erreicht als beim<br />
Zugsystem des Flughafen-Verbundes WIE + FRA. Die geringere Entfernung innerhalb von FRA führt aufgrund<br />
der geringen Höchstgeschwindigkeit der Sky Line (80 km/h) gegenüber dem Shuttle-Zug (220 km/h) nicht zu<br />
wesentlich kürzeren Fahrzeiten. Weiterhin kommt bei der Lösung "Terminal 3 + Nutzung der Sky Line" hinzu,<br />
daß Grenz- und Zollkontrollen stationär erfolgen müssen, weil die Zeit während der Sky-Line-Fahrt hierfür zu<br />
kurz wäre. Beim Flughafen-Verbund von WIE und FRA hingegen findet die Kontrolle während der<br />
vergleichsweise langen Zugfahrt statt und erscheint so in der Zeit-Wegekette nicht eigens.<br />
9.3 T3 identisch mit Terminal WIE beim Bus-System<br />
Die hier untersuchte T3- Bus-Lösung unterscheidet sich in den Szenario-Annahmen nur wenig vom Bus-System<br />
beim Flughafen-Verbund WIE + FRA. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um diese beiden Szenarien<br />
vergleichbar zu gestalten. Sollte ein Terminal T3 im Süden, auf dem heutigen Gelände der Air Base, entstehen,<br />
dann würde dieses natürlich anders genutzt als die Anlage welche in diesem Szenario unterstellt wird. Weiterhin<br />
würde auch eine der dann zu erwartenden Verkehrsstruktur angepaßte Terminalkonfiguration gewählt.<br />
Die folgenden Fälle S1 bis S3 entsprechen den Fällen B1 bis B3 der Bus-Lösung des Flughafen-Verbundes, aber<br />
mit der Ausnahme, daß als ungünstige Vorfeldposition die Position V178 gewählt wurde und nicht V101. Der<br />
Grund hierfür sind die dadurch entstehenden längeren Wege. Weiterhin kann auf dieser Position ein größeres<br />
Flugzeug abgefertigt werden als auf der Position V101.<br />
Untersuchte Szenariofälle T3 Bus-System (worst cases):<br />
S1: Terminal T3 - FRA Pos A42<br />
S2: Vorfeld T3 - FRA Pos A42<br />
S3: Terminal T3 - FRA Pos V178<br />
9.3.1 Zeit-Wege-Ketten Gepäck<br />
Wie schon bei der Lösung "T3 Zugsystem" wird auch bei der Variante "T3 Bus-System" der Transport des<br />
Fluggepäcks zwischen dem neuem Terminal und den alten beiden Terminals über eine erweiterte GFA<br />
durchgeführt und nicht per Fahrzeug.<br />
Da bei der Bus-Lösung T3 andere worst cases bei T1 und T2 als beim Zugsystem existieren, müssen für das<br />
Bus-Systemeigene Wegeketten bezüglich Gepäck ausgewiesen werden.<br />
Tab. 20: Zeit-Wegekette Gepäck von T3 nach T1/T2 in FRA (Bus-GFA-Lösung)<br />
Prozesse Bemerkungen Fall S1 FallS2 Fall S3<br />
1 Entladen Positionierung Fahrzeuge 2,0 1,0 2,0<br />
2 Entladen Container 1 + 2 (LD3 Cont.) 2,0 2,0<br />
3 Entladen Container 3 + 4 (LD3 Cont.) 2,0 2,0<br />
4 Entladung Bulk Cargo (je Gepäckraum) 5,0<br />
5 Transport zum Terminal max.100 m bei max. 30 km/h 0,5 0,5 0,5<br />
6 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
7 Sortierung im GFA T3 Entladung (max. 40 Stück je Station) 4,0 4,0 4,0<br />
8 Transport in GFA T3 3,0 3,0 3,0<br />
9 Transport nach Norden (V3) 5,0 5,0 5,0<br />
10 Transport T3 - FRA Zeit in GFA Nord 1,0 15,0 15,0<br />
11 Beladung Cont./Trol. (letz.Gep.stk) 1,0 1,0 1,0<br />
12 Transp.an Flugzeug (inkl. Verlustz.) 8,0 0,5 0,5<br />
13 Verlustzeiten (25%, mind.1 min) 2,0 1,0 1,0
14 Beladung Flugzeug 5,0 5,0 5,0<br />
15 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 38,5 44,0 44,0<br />
Differenz zu WIE -: T3 schneller +: T3 langsamer -6,0 -1,0 +0,5<br />
Tab. 21: Zeit-Wegekette Gepäck von T1/T2 in FRA nach T3 (Bus-GFA-Lösung)<br />
Prozesse Bemerkungen Fall S1 Fall S2 Fall S3<br />
1 Entladen Gepäck Positionierung Fahrzeuge 2,0 2,0 2,0<br />
2 Entladen Container 1 + 2 (LD3 Cont.) 2,0 2,0 2,0<br />
3 Entladen Container 3 + 4 (LD3 Cont.) 2,0 2,0 2,0<br />
4 Transport FRA - T3 Fahrzeit Vorfeld FRA 8,0 0,5 0,5<br />
5 Verlustzeiten (25%, mind. 1 min) 2,0 1,0 1,0<br />
6 Entladung (max. 40 Stück je Station) 4,0 4,0 4,0<br />
7 Zeit in GFA Nord 1,0 15,0 15,0<br />
8 Transport nach Norden (V3) 5,0 5,0 5,0<br />
9 Sortierung im GFA T3 Transport in GFA T3 3,0 3,0 3,0<br />
11 Beladung Gepäck Beladung Cont./Trol. (letz.Gep.stk) 1,0 1,0 1,0<br />
12 Transport an Flugzeug (100 m) 0,5 0,5 0,5<br />
13 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5 0,5 0,5<br />
14 Positionierung Dolley / Trolley 0,5 0,5 0,5<br />
15 Beladung Flugzeug 5,0 5,0 5,0<br />
16 Entf. Fahrz., Off Block 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 39,0 44,5 44,5<br />
Differenz zu WIE -: T3 schneller +: T3 langsamer -5,0 0,0 +1,5<br />
Beim Vergleich des Gepäcktransports dieser Bus-Lösung mit dem Bus-System im Fall des Flughafen-Verbundes<br />
von Wiesbaden-Erbenheim und Frankfurt ergeben sich in der Tendenz Zeitvorteile für die Bus-Lösung T3. Im<br />
Durchschnitt aller ungünstigen Fälle beträgt die Einsparung allerdings nur knapp 2 Minuten. Somit wird durch<br />
den Ausbau von FRA gegenüber dem Verbund WIE + FRA kein nennenswerter Vorteil erzielt.<br />
9.3.2 Zeit-Wege-Ketten Personen<br />
Die Prozesskette der Passagiere bei der Lösung T3 mit Bus ist gegenüber der Bus-Lösung des Flughafen-<br />
Verbundes vollkommen identisch. Der Unterschied besteht hier nur in den kürzeren Fahrzeiten zwischen den<br />
Terminalbereichen und auf dem Vorfeld in FRA (Position V178).<br />
Der Bus nutzt als Verbindung zwischen Nord und Süd die östliche Verbindungsstraße und muß somit auch nicht<br />
das Flughafengelände verlassen. Als Höchstgeschwindigkeit werden hier 50 km/h zzgl. <strong>einer</strong> Verlustzeit von<br />
25% der Fahrzeit angesetzt, die als Sicherheitsreserve dient. Damit beläuft sich die Fahrzeit zwischen den<br />
Flughafenbereichen auf 2,5 min.<br />
Tab. 22: Zeit-Wegekette Personen von T3 nach T1/T2 in FRA (Bus-GFA-Lösung)<br />
Prozesse Bemerkungen Fall S1 Fall S2 Fall S3<br />
1 Positionierung Brücken 1,5 1,5 1,5<br />
2 Deboarding max. 150 Pax 7,0 4,5 7,0<br />
3 Bustransfer (Vorfeld) 500 m bei 30 km/h 1,0<br />
4 Verzögerungszeiten 0,5<br />
5 Aussteigen Bus 1,0<br />
6 Wege im Terminal 3 Treppe zum OG/Terminal 0,5<br />
7 Wege im Terminal (max. 120 m) 2,0 1,0 2,0<br />
8 Orientierung 1,0 1,0 1,0<br />
9 Paßkontrolle (letzter Passagier) 2,0 6,0 2,0<br />
10 Weg zu Busgates (30 m) 0,5 0,5 0,5<br />
11 Orientierung an Busgates 0,5 0,5 0,5<br />
12 Bus Shuttle Boarding Busgate 0,5 0,5 0,5
13 (Roll-) Treppe zum EG / Bus 0,5 0,5 0,5<br />
14 Türen Schließen 0,5 0,5 0,5<br />
15 Fahrzeit Ringstraße (max 50 km/h) 2,0 2,0 2,0<br />
16 Verlustzeiten (25%) 0,5 0,5 0,5<br />
17 Fahrzeit Vorfelder (max. 25 km/h) 14,0 9,0 9,5<br />
18 Verlustzeiten (25%, mind. 1 min) 3,5 2,0 2,5<br />
19 Boarding Umsteiger FRA Aussteigen Bus 1,0 1,0 1,0<br />
20 Treppe zum Flugzeug 0,5 0,5 0,5<br />
21 Boarding (letz. Pass. von max.40) 3,0 3,0 3,0<br />
22 Entfernung der Brücken, Off-Block 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 43,0 40,0 37,5<br />
Differenz zu WIE -: T3 schneller +: T3 langsamer +1,5 -5,0 -4,0<br />
Tab. 23: Zeit-Wegekette Passagiere von T1/T2 in FRA nach T3 (Bus-GFA-Lösung)<br />
Prozesse Bemerkungen Fall S1 Fall S2 Fall S3<br />
1 Positionierung Brücken 1,5 1,5 1,5<br />
2 Deboarding max. 350 Pax 7,0 10,5 10,5<br />
3 Wege zum Bus Shuttle Flugzeugtür - Orientierungsbereich 0,5 0,5 0,5<br />
4 Orientierung 0,5 0,5 0,5<br />
5 (Roll-) Treppe zum EG / Bus 0,5 0,5 0,5<br />
6 Türen Schließen (letzter Pax) 0,5 0,5 0,5<br />
7 Bus Shuttle Fahrzeit Ringstraße (max 50 km/h) 2,0 2,0 2,0<br />
8 Verlustzeiten (25%) 0,5 0,5 0,5<br />
9 Fahrzeit Vorfelder (max. 25 km/h) 14,0 9,0 9,5<br />
10 Verlustzeiten (25%, mind. 1 min) 3,5 2,0 2,5<br />
11 Aussteigen Bus 1,0 1,0 1,0<br />
12 Wege Terminal WIE EG Bus - OG Terminal 0,5 0,5 0,5<br />
13 Orientieren 0,5 0,5 0,5<br />
Wege im Terminal (max. 30 m) 0,5 0,5 0,5<br />
14 Paßkontrolle (letz.Pass.von max.40) 3,5 3,5 3,5<br />
16 Orientierung im Terminal 0,5 0,5 0,5<br />
15 Wege im Terminal (max. 180 m) 3,0 1,0 3,0<br />
17 (Roll-) Treppe zum EG / Bus 0,5<br />
18 Bustransfer (Vorfeld) Türen Schließen 0,5<br />
19 500 m bei 30 km/h 1,0<br />
20 Verzögerungszeiten 0,5<br />
21 Aussteigen Bus 1,0<br />
22 Weg Boarding Brücke 0,5 0,5 0,5<br />
23 Boarding (letzter Pass. von 40) 1,0 3,0 1,0<br />
24 Entfernung der Brücken, Off-Block 2,5 2,5 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 44,0 44,5 42,0<br />
Differenz zu WIE -: T3 schneller +: T3 langsamer -2,0 -5,0 0,0<br />
Die Connection Time der worst cases bezüglich Passagiertransport in der Lösung T3 Bus beträgt bis zu 44,5 min<br />
so daß die MCT von 45 min kann in allen Fällen gehalten werden kann. Im Vergleich zum Bussystem beim<br />
Flughafen-Verbund WIE + FRA sind die Zeiten durchschnittlich um knapp 2,5 min kürzer. Dieses Ergebnis<br />
resultiert aus den langen Fahrzeiten auf dem nördlichen Vorfeld in FRA, während bei der Bus-Lösung des<br />
Verbundes WIE + FRA das nördliche Areal des Flughafens FRA durch mehrere kreuzungsfreie Stichstraßen<br />
angebunden wird und so nur kurze Wege auf dem nördlichen Vorfeld von FRA zurückgelegt werden müssen.<br />
9.4 Connection Time in FRA heute<br />
Um den Flughafen-Verbund WIE + FRA mit dem Bau eines zusätzlichen Terminals T3 in FRA fundiert<br />
vergleichen zu können, ist auch eine Betrachtung des Status quo angebracht. Es gilt also, die Frage zu klären,<br />
welche Connection Time sich in einem worst case im heutigen Flughafen Frankfurt ergibt. Allerdings beschränkt
sich diese Untersuchung aus Zeit- und Kostengründen auf einen einzigen Fall des Transfers von Passagieren und<br />
verzichtet auch auf eine Untersuchung des Gepäcktransfers.<br />
A23 und D12 sind die Gebäude-Positionen, zwischen denen sich für Transferpassagiere die Benutzung der Sky<br />
Line gerade noch nicht lohnt, weil der Fußweg genauso schnell bzw. langsam wie die Sky-Line-Fahrt ist. Ein<br />
Umsteige-Vorgang zwischen A23 und D12, der einen Fußweg von 1420 m Länge umfaßt, stellt somit heute<br />
einen worst case dar.<br />
Hierbei wird für die Grenzkontrolle ein Zeitbedarf von 5 min angesetzt, der höher ist als der entsprechende Wert<br />
beim Bus-System, und zwar sowohl beim Flughafen-Verbund WIE + FRA als auch bei <strong>einer</strong> vergleichbaren<br />
Ausbaulösung in FRA mit einem dritten Terminal in Südlage. Dieser Unterschied ist darauf zurückzuführen, daß<br />
die heutigen Anlagen in FRA zur Grenzabfertigung innerhalb des Terminals 1 als Fixum zu betrachten sind. Im<br />
Gegensatz dazu kann das Terminal in WIE wie auch ein Terminal 3 in FRA, da es noch gar nicht existiert und<br />
folglich völlig neu gebaut werden muß, von vorneherein so konzipiert werden, daß eine ausreichend große<br />
Anzahl von parallelen Schaltern zur schnellen Grenzabfertigung einrichtet werden kann.<br />
Tab. 24: Zeit-Wege-Kette FRA heute von A23 nach D12<br />
Positionierung Brücken 1,5<br />
Deboarding 10,5<br />
Grenzkontrolle 5,0<br />
Fußweg 1420 m 24,0<br />
Orientierung<br />
(8% der Fußweg-Zeit) 2,0<br />
Ebenenwechsel 1,0<br />
Boarding 1,0<br />
Off Block 2,5<br />
ÄÄÄÄ<br />
47,5<br />
In diesem exemplarischen Fall wird im Flughafen Frankfurt auch heute die MCT von 45 min überschritten.<br />
9.5 Vergleich des Verbundes WIE + FRA mit dem Standort FRA hinsichtlich der Connection Time<br />
Aus den ermittelten Zeit-Wege-Ketten im Falle eines Ausbaus von FRA mit einem dritten Terminal in Südlage<br />
geht hervor, daß sowohl die Zug- als auch die Bus-Lösung beim Transfer von Gepäck und Passagieren<br />
tendenziell zwar Zeitvorteile erbringt, verglichen mit entsprechenden Lösungen bei einem Flughafen-Verbund<br />
von WIE und FRA, aber diese Zeitgewinne sind nicht gravierend. In den untersuchten Fällen überwiegen<br />
insgesamt die Verkürzungen der Connection Time, aber es gibt auch Fälle, in denen sich der Zeitaufwand leicht<br />
erhöht. Im Durchschnitt aller betrachteten Worst-Case-Positionen ergeben sich die folgenden Veränderungen:<br />
Zeitvorteile der T3-Lösung (FRA Süd) gegenüber dem Standort Wiesbaden-Erbenheim<br />
Zug-Lösung Gepäck -1,5 min<br />
Zug-Lösung Passagiere -1,0 min<br />
Bus-Lösung Gepäck -2,0 min<br />
Bus-Lösung Passagiere -2,5 min<br />
Wenn man den möglichen Flughafen-Verbund von Wiesbaden-Erbenheim und Frankfurt bezüglich der<br />
erreichbaren Transferzeiten mit der heutigen Situation im Flughafen Frankfurt vergleicht und hierbei immer von<br />
Worst-case-Szenarien ausgeht, kann festgestellt werden, daß es auf der Basis der hier angewendeten<br />
Berechnungsverfahren auch heute Umsteige-Relationen gibt, in denen die MCT von 45 min nicht sicher<br />
eingehalten werden kann. Gegenüber diesem Staus quo bedeutet der Verbund der beiden Flughäfen mit einem<br />
Airport-Link per Zug oder Bus nicht zwangsläufig eine Verschlechterung, in mehreren ungünstigen Fällen sogar<br />
eine Verkürzung der Connection Time.<br />
10. Rollzeiten in den Flughäfen WIE und FRA
Um im Rahmen des Mediationsverfahrens die Lösung "Flughafen-Verbund WIE + FRA" mit der Lösung<br />
"Weiterer Ausbau in FRA" vergleichen zu können, ist es zur Ermittlung der tatsächlichen Transferzeit innerhalb<br />
von FRA zielführend, zusätzlich auch Werte für die Rollzeiten der Flugzeuge in FRA und WIE zu bestimmen.<br />
Die Rollzeiten sind zwar unabhängig von der Connection Time zu sehen, aber sie gehen in die Flugzeiten ein.<br />
Selbst wenn sich möglicherweise verlängerte Rollzeiten nicht im Flugplan niederschlagen, die Flugzeiten also<br />
unverändert bleiben, nimmt das Verspätungspotential des Luftverkehrs am Boden durch eine Verlängerung der<br />
Rollzeiten zu. Das im Rahmen dieser Studie vorgebene Zeitbudget erlaubt keine detaillierte Ermittlung der<br />
Rollzeiten mit Hilfe der Simulationsprogramme SIMMOD oder TAAM, die bei ähnlichen Fragestellungen am<br />
Airport Research Center üblicherweise verwendet werden.<br />
10.1 Vorgehensweise<br />
Die Streckenführungen und -längen der zusätzlichen Rollwege bei den verschiedenen Lösungen für FRA wurden<br />
dem "Kompendium über die im Rahmen des Mediationsverfahrens weiter zu untersuchenden Varianten zur<br />
Steigerung der Kapazität des Flughafens Frankfurt", herausgegeben von der FAG, entnommen. Anhand dieser<br />
Unterlagen konnten nur überschlägliche Werte ermittelt werden, was aber für den durchzuführenden Vergleich<br />
ausreichend ist.<br />
Das von der FAG bereitgestellte Zahlenmaterial beinhaltet für jede Lösung nur einen Gesamtwert für den<br />
durchschnittlichen und maximalen Rollzeitbedarf ohne weitere Aufschlüsselung. Auf wiederholte Nachfrage<br />
konnte, bezogen auf den derzeitigen Planungsstand, von der FAG keine weitere Konkretisierung und<br />
Detailierung der Rollwegezeiten vorgenommen werden. Eine Beschreibung über den methodischen Hintergrund<br />
des bereitgestellten Zahlenmaterials lag nicht vor.<br />
Basierend auf den gegebenen Randbedingungen werden die Rollzeiten von Differenzstrecken zum heutigen<br />
Bahnssystem ermittelt und die Unterschiede der Planfälle untereinander als Differenzbetrag rechnerisch<br />
abgeschätzt. Dabei werden keine betriebsbedingten Störungen berücksichtigt wie beispielsweise zusätzliche<br />
Standzeiten oder verminderte Rollgeschwindigkeiten aufgrund von Behinderungen durch den sonstigen<br />
Rollverkehr. Des weiteren werden für die verschiedenen Streckenabschnitte durchschnittliche<br />
Rollgeschwindigkeiten angesetzt, die aufgrund von eigenen Messungen sowie Angaben aus der Literatur als<br />
obere Grenzwerte für die jeweiligen Streckenabschnitte zu sehen sind. Dies erlaubt eine Überprüfung der<br />
Konsistenz der von der vom Flughafen Frankfurt Main AG angegebenen Werte untereinander.<br />
Für den Vergleich der Rollzeiten der einzelnen Varianten und die Prüfung der Zeitangaben auf Plausibilität ist<br />
insbesondere die Rollzeitdifferenz zwischen den einzelnen Versionen für die weitere Bewertung von Bedeutung.<br />
Diese Differenzen ergeben sich primär zwischen den Enden der Schnellabrollwege der neuen<br />
Landebahnvarianten und einem von den Gutachtern fest definierten Punkt im bestehenden Rollbahnsystem, der<br />
das durchschnittliche Ende der Schnellabrollwege im bestehenden Bahnsystem bildet.<br />
Die Rollzeiten bis zum Erreichen des Endes der neuen Schnellabrollwege wurden für alle Varianten gleich<br />
angesetzt und gelten ab dem Aufsetzen auf der Landebahn, so daß sie auch das anschließende Abbremsen<br />
umfassen. Ebenso werden die Rollzeiten ab dem fest definierten Punkt im bestehenden Rollbahnsystem bis zur<br />
eigentlichen Gate- oder Vorfeldposition als gleich angesehen, da der nachfolgende Prozeß des Rollens und<br />
Einparkens in jeder Variante identisch ist. Die Unterschiede, welche durch verschiedene Benutzung der<br />
Rollwege N und A innerhalb der einzelnen Varianten möglicherweise entstehen, müssen an dieser Stelle<br />
vernachlässigt werden, da hierzu keine Unterlagen vorliegen.<br />
Als Basiswerte für den Vergleich wurden die von der FAG angegebenen Werte für das bestehende Bahnsystem<br />
in FRA benutzt.<br />
10.2 Randbedingungen<br />
Für die Berechnung der Rollzeiten werden folgende Annahmen getroffen:<br />
þ durchschnittliche Rollgeschwindigkeit im Vorfeld und auf Strecken mit Kurven: 15 kt<br />
þ durchschnittliche Rollgeschwindigkeit auf langen Geraden: 20 kt<br />
þ Maximalgeschwindigkeit: 30 kt<br />
Untersuchungen zeigen, daß die Rollgeschwindigkeit in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern sehr stark<br />
schwanken kann. Einflußfaktoren sind insbesondere
þ Wetter- / Sichtbedingungen,<br />
þ Fähigkeiten des Piloten<br />
þ Ortskenntnisse des Piloten<br />
þ Risikobereitschaft des Piloten<br />
þ Komplexität des zu fahrenden Rollwegs<br />
þ Konfliktpotential des Rollweges<br />
þ interne Vorschriften der Fluggesellschaft<br />
þ Tageszeit.<br />
Die realen Rollzeiten können daher in einzelnen Fällen stark von den rein rechnerisch ermittelten abweichen. Es<br />
ist jedoch durchaus möglich, durch die getroffenen Annahmen über die Geschwindigkeit eine Rollzeitstruktur zu<br />
ermitteln. Basierend hierauf kann anschließend ein Vergleich verschiedener Konfigurationen und eine<br />
Plausibilitätsprüfung vorgenommen werden.<br />
Bei <strong>einer</strong> Lösung in FRA mit einem zusätzlichen Terminal T3 in Südlage und <strong>einer</strong> Landebahn in Nordlage wird<br />
der Fall eintreten, daß Flugzeuge, von der neuen Nordbahn kommend, auf ihrem Rollweg nach T3 die beiden<br />
vorhandenen Parallelbahnen queren müssen. Dieses Queren der beiden Bahnen auf <strong>einer</strong> Streckenlänge von 900<br />
m findet mit <strong>einer</strong> Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 kt statt. Unterstellt man, daß das Flugzeug hierbei vor<br />
jeder der beiden Bahnen zunächst warten muß, weil gerade ein anderes Flugzeug landet und berücksichtigt man<br />
alle erforderlichen Anfahr- und Abbremsvorgänge, so errechnet sich allein für diese Bahnquerung ein Zeitbedarf<br />
von ca. 4,5 min.<br />
10.3 Rollzeiten bei einem Ausbau in FRA im Vergleich zu den Rollzeiten des bestehenden Bahnsystems<br />
Berücksichtigt man nur den Rollweg vom Ende der Landebahn, so ergibt sich für die Betriebsrichtung West<br />
keine relevante Differenz. Es ist aber davon auszugehen, daß der eigentliche Landevorgang nach ca. 2000 m und<br />
somit vor dem Ende der in Variante 9A geplanten Bahn abgeschlossen ist. Um einen Vergleich mit den anderen<br />
Konfigurationen durchführen zu können, ist das Abrollen über einen gedachten Abrollweg bzw. das Rollen bis<br />
zum Ende der Bahn zu berücksichtigen. An dieser Stelle ist anzumerken, daß zur Ausnutzung der vollen<br />
Bahnkapazität die Anlage eines weiteren Abrollweges sinnvoll erscheint. Für den Weg zum Terminal T1/T2<br />
wurde durch Berücksichtigung der längeren Landebahn eine Rollzeitdifferenz von 1,5 min ermittelt.<br />
Wenn eine nord-östliche Landebahn (Variante 9A) gebaut wird, so verlängern sich gegenüber dem heutigen<br />
Bahnsystem in FRA die Rollzeiten von der neuen Landebahn zu den Terminals T1 und T2 bei der<br />
Betriebsrichtung West um 1,5 min und bei der Betriebsrichtung Ost um ca. 3,5 min. Wenn nach der Landung<br />
eine Position am neuen Terminal in Südlage (T3) bezogen wird, so beträgt die Verlängerung der Rollzeit 6 min<br />
bei der Betriebsrichtung West und 8 min bei der entgegengesetzten Richtung (siehe Anhang Tab. A12).<br />
Der Rollweg zu den Terminals T1 und T2 von <strong>einer</strong> nord-westlichen Landebahn (Variante 9B), für den bei der<br />
Betriebsrichtung West zwei Varianten zu berücksichtigen sind, führt gegenüber dem Status quo in FRA eine<br />
Verlängerung der Rollzeiten von 6 min (Variante 1) bzw. 5 min (Variante 2) und von 3,8 min bei der<br />
Betriebsrichtung Ost. Bei der Anbindung des Terminals T3 an die neue Landebahn entsteht eine Rollzeit-<br />
Verlängerung von 9 min in der Betriebsrichtung West und 8,5 min in der Gegenrichtung, verglichen mit dem<br />
Zustand (siehe Anhang Tab. A13).<br />
Wenn unter Auflassung der heutigen Startbahn West ein neues System mit zwei zusätzlichen Bahnen im Süden<br />
des heutigen Flughafen-Geländes (Variante 12) geschaffen werden, so führt der Rollweg zu den Terminals T1<br />
und T2 zu Rollzeiten, die bei der Betriebsrichtung West um 7 min (Anbindung der Bahn 1) bzw. um ca. 9,5 min<br />
(Anbindung der Bahn 2) länger als heute sind. Bei der Betriebsrichtung West beträgt die Verlängerung 4 bzw. 6<br />
min. Trotz der Nähe dieser beiden neuen Südbahnen zum Terminal T3 bedeutet diese Lösung bei der<br />
Betriebsrichtung West eine Rollzeit-Verlängerung von 2,5 min (Anbindung der Bahn 1) bzw. um ca. 5 min<br />
(Anbindung der Bahn 2). In der entgegengesetzten Betriebsrichtung führt die Anbindung der Bahn 1 nach T3<br />
zwar zu <strong>einer</strong> Reduktion der Rollzeit um ca. 0,5 min, aber die Anbindung der Bahn 2 bewirkt wiederum eine<br />
Rollzeit-Verlängerung, wenn auch nur um 1,5 min. Bei dieser Betrachtung wurde eine Lage des Terminals T3<br />
auf dem Vorfeld der heutigen US-Airbase angenommen. Eine optimierte Platzierung dieses Terminals könnte<br />
die Rollzeiten im Vergleich bestehendes Bahnsystem - neue Südbahnen angeglichen werden.<br />
Tab. 25: Rollzeiten in FRA zu T1/T2 und in WIE (in min) laut "FLUGFAG.DOC-Betriebsrichtung Ost (07)"<br />
[25]
Betriebs- Betriebsrichtung<br />
25 richtung 07<br />
Flughafen FRA:<br />
Nord-Ost Bahn 8 13<br />
Nord-West Bahn 13 11<br />
Nördliche Süd-Bahn (1) 14,3 17,3<br />
Südliche Süd-Bahn (2) 16,5 17<br />
Vorhandenes Bahnsystem 7,5 7,5<br />
Wiesbaden-Erbenheim 2,5 3,75<br />
Die in Tab. 25 ausgewiesenen Rollzeiten stimmen weitgehend überein mit Daten, die von der Airport Research<br />
Center GmbH ermittelt wurden (siehe Anhang Tab. A16 und A17). Vergleicht man hingegen die errechneten<br />
Daten der Tab. A16 und A17 mit den für diese Analyse zur Verfügung gestellten Daten (siehe Anhang Tab.<br />
A15), so sind größere Abweichungen festzustellen. Dies gilt jedoch nicht für die Werte der Rollzeiten bei einem<br />
neuen Terminal T3 auf dem Gelände der US-Airbase. Hier liegen teilweise sogar identische Zahlenwerte vor.<br />
10.4 Ergebnis des Vergleichs der Rollzeiten<br />
Aus Tab. 25 geht hervor, daß die Rollzeiten im Flughafen Wiesbaden-Erbenheim mit nur 2,5 bzw. knapp 4 min<br />
deutlich kürzer sind als bei sämtlichen Bahn-Varianten des Flughafen-Ausbaus in FRA und auch gegenüber dem<br />
heutigen Frankfurter Bahnsystem, das um rund 4 bis 5 min längere Rollzeiten (siehe Anhang Tab. A15 bis A17)<br />
aufweist als in WIE. Allerdings ist in der Tabelle 101 ein mögliches Terminal T3 in Südlage noch nicht<br />
berücksichtigt. Doch selbst dieses würde, gemessen an den in WIE erzielbaren Rollzeiten, trotz s<strong>einer</strong> Nähe zu<br />
den Südbahnen zu durchschnittlichen Rollzeiten von 8 min und bei Landungen auf dem heutigen Parallelbahn-<br />
System von 6 min führen.<br />
Somit kann festgehalten werden: Die Nutzung des Flughafens Wiesbaden-Erbenheim führt an diesem Standort<br />
zu <strong>einer</strong> starken Reduktion der Rollzeiten gegenüber dem Standort Frankfurt, und zwar mit oder ohne dessen<br />
Ausbau.<br />
An dieser Stelle kann nicht gefolgert werden, daß die gegenüber FRA verkürzten Rollzeiten in WIE auch zu<br />
entsprechend reduzierten Flugzeiten bei Starts und Landungen in Wiesbaden-Erbenheim führen werden. Denn<br />
die tatsächlichen Flugzeiten hängen in erheblichem Maß von den durch die DFS festzusetzenden Flugrouten von<br />
und nach WIE ab.<br />
11. Ergebnisse der Untersuchung und Ausblick<br />
11.1 Untersuchungsergebnisse<br />
11.1.1 Transferzeit von Gepäck und Personen beim<br />
Bezüglich des Transfers von Gepäck kann bei fast allen untersuchten Umsteige-Relationen im worst case die<br />
MCT von 45 min erreicht oder sogar unterschritten werden. Doch in zwei Fällen, und zwar beide Male von FRA<br />
nach WIE, dauert der Transport mit 46 bzw. 45,5 min geringfügig zu lange. Durch zusätzliche Maßnahmen,<br />
nämlich den Einsatz von Vorfeldfahrzeugen als Ersatz für lange Transportstrecken in der GFA von FRA, wird<br />
die geforderte MCT jedoch erreicht.<br />
Wenn durchschnittliche Flugzeug-Positionen und -größen betrachtet werden, verkürzt sich die Connection Time<br />
des Gepäcks um rund 5 min, und zwar in beiden Richtungen, so daß die MCT deutlich unterboten wird.<br />
Der Personentransfer überschreitet im Worst-case-Szenario beim Zug-System in der Richtung von WIE nach<br />
FRA die MCT von 45 min bei <strong>einer</strong> weit im Westen liegenden Vorfeldposition in FRA, und dies auch nur in<br />
dem eher unwahrscheinlichen Fall, daß nur ein einziger Vorfeldbus, der zudem voll besetzt ist, zum relativ<br />
großen Anschlußflugzeug fährt, so daß sich beim Einsteigen in das Flugzeug eine Warteschlange bildet (Fall 4).<br />
Doch wenn mindestens zwei Busse zum Einsatz kommen, von denen der letzte höchstens 25 Passagiere<br />
befördert, wird hingegen die geforderte MCT erreicht. In der Gegenrichtung überschreiten hingegen 4 der 6<br />
betrachteten Worst-Case-Positionen die MCT um bis zu 3 Minuten. Die MCT von 45 min ist jedoch auch in
diesen Fällen gewährleistet, wenn für verspätete bzw. sehr langsam gehende Fluggäste innerhalb von WIE<br />
"Feuerwehr-Fahrten" vom Shuttle-Bahnhof zum Flugzeug per PKW durchgeführt werden.<br />
Werden durchschnittliche Flugzeug-Positionen und Flugzeuge mit durchschnittlicher Größe zugrunde gelegt, so<br />
erreicht selbst der langsamste Fluggast in beiden Umsteige-Richtungen eine Connection Time, die rund 5 min<br />
unter der MCT von 45 min liegt.<br />
11.1.2 Transferzeit von Gepäck und Personen beim Bus-System<br />
Die MCT von 45 min läßt sich beim Gepäcktransport im Rahmen des Bus-Systems in allen untersuchten Worstcase-Transferbeziehungen<br />
einhalten; bei durchschnittlichen Flugzeug-Positionen wird die geforderte MCT sogar<br />
um bis zu 7 min unterboten.<br />
Falls in den Flugzeugen mit Zielflughafen FRA eine Gepäckvorsortierung nach Umsteigergepäck ab WIE und ab<br />
FRA - eine Prämisse des Bus-Systems -grundsätzlich nicht durchsetzbar sein sollte, muß die Möglichkeit<br />
geschaffen werden, das gesamte Gepäck in FRA nach der Landung sofort so zu sortieren, daß das<br />
Umsteigergepäck nach WIE an speziellen Ausgabestationen in FRA in einzelne Fahrzeuge geladen werden kann,<br />
um es direkt zu den Anschlußflugzeugen in WIE zu transportieren. Durch dieses System ergeben sich Gepäck-<br />
Transferzeiten von 47 bis 53 min.<br />
Beim Passagiertransfer von WIE nach FRA per Bus wird in allen worst cases die MCT von 45 min eingehalten<br />
oder sogar unterboten. Dagegen wird in zwei - eher unwahrscheinlichen - Fällen der Gegenrichtung die MCT<br />
überschritten, und zwar einmal um 1 min und im zweiten Fall 4,5 min. Dies ist im wesentlichen darauf<br />
zurückzuführen, daß die Fluggäste in WIE nach der Ankunft des Shuttlebusses aus FRA noch auf Vorfeldbusse<br />
umsteigen müssen, weil ein Flugzeug in WIE auf dem Vorfeld abgefertigt werden muß, da alle an den Satelliten<br />
vorhandene Positionen besetzt sind. Um auch unter diesen Bedingungen die MCT zu erreichen, sind wie bereits<br />
bei der Zug-Lösung, "Feuerwehr-Fahrten" unverzichtbar. Hierzu fahren die Shuttlebusse, nachdem zeitunkritische<br />
Fluggäste am Satelliten-Terminal ausgestiegen sind, mit den verbliebenen zeitkritischen Passagieren<br />
direkt weiter zu den Anschluß-Flugzeugen. Falls Grenzkontrollen erforderlich sein sollten, für die dann an den<br />
Busgates spezielle Kontrollstellen in WIE bereitzuhalten sind, erhöht sich zwar die Connection Time um diesen<br />
Abfertigungsvorgang, aber sie bleibt dennoch unter der 45-min-Schranke.<br />
Bei durchschnittlichen Flugzeug-Positionen und -größen in FRA wird die MCT von 45 min deutlich<br />
unterschritten, und zwar beim Umsteigen von WIE nach FRA um bis zu 10 min und in der Gegenrichtung um<br />
immerhin bis zu 6 min.<br />
Bei <strong>einer</strong> Gesamtbetrachtung des Gepäck- und Passagier-Transfers schneidet das Bus-System geringfügig besser<br />
als die Zug-Lösung ab, was die Einhaltung der geforderten MCT betrifft.<br />
11.1.3 Transferzeit beim weiteren Ausbau in FRA und beim Status quo in FRA<br />
Beim Ausbau des Flughafens Frankfurt (4. Landebahn, Terminal T3 in Südlage) ergeben sich bezüglich der<br />
erreichbaren Umsteigezeit geringe Vorteile im Vergleich zum Airport-Link WIE - FRA.<br />
Vergleicht man den Flughafen-Verbund WIE + FRA mit dem Ausbau in FRA anhand der Zug-Lösung, so<br />
werden bei Passagieren und Gepäck innerhalb von FRA Umsteigezeiten erreicht, die um rund 1 min kürzer sind<br />
als beim Transfer zwischen WIE und FRA. Die Bus-Lösung ergibt beim Ausbau von FRA um rund 2 min<br />
kürzere Transferzeiten als beim Flughafen-Verbund.<br />
Wenn man den möglichen Flughafen-Verbund von Wiesbaden-Erbenheim und Frankfurt bezüglich der<br />
erreichbaren Transferzeiten mit der heutigen Situation im Flughafen Frankfurt vergleicht und hierbei immer von<br />
Worst-case-Szenarien ausgeht, kann festgestellt werden, daß es auch heute Umsteigerelationen in FRA gibt, bei<br />
denen die MCT von 45 min nicht sicher eingehalten werden kann. Gegenüber diesem Staus quo bedeutet also<br />
der Verbund der beiden Flughäfen mit einem Airport-Link per Zug oder Bus nicht zwangsläufig eine<br />
Verschlechterung, in mehreren ungünstigen Fällen kommt sogar eine Verkürzung der Connection Time<br />
zustande.<br />
11.1.4 Rollzeiten in den Flughäfen WIE und FRA
Die zivile Nutzung des Flughafens Wiesbaden-Erbenheim ermöglicht Rollzeiten, die mit nur 2,5 bzw. knapp 4<br />
min deutlich kürzer sind als bei sämtlichen Bahn-Varianten des Flughafen-Ausbaus in FRA und auch gegenüber<br />
dem heutigen Frankfurter Bahnsystem. Allerdings führen diese gegenüber FRA verkürzten Rollzeiten in WIE<br />
nicht zwangsläufig zu entsprechend reduzierten Flugzeiten bei Starts und Landungen in Wiesbaden-Erbenheim.<br />
Denn die tatsächlichen Flugzeiten hängen in erheblichem Maß von den durch die DFS festzusetzenden<br />
Flugrouten von und nach WIE ab.<br />
11.1.5 Kosten des Zug- und des Bus-Systems<br />
Um die einmalig anfallenden Investitionskosten und die laufenden Betriebskosten addieren zu können, werden<br />
die Investitionskosten für die Zug-und die Bus-Lösung per Annuitätenmethode auf die einzelnen Nutzungsjahre<br />
umgelegt werden und die Betriebskosten ebenfalls pro Jahr ausgewiesen.<br />
Die Gesamtkosten für das Zug-System betragen, falls keine durchgängig separaten Gleise für den Airport-Link<br />
geschaffen werden, pro Jahr 72 Mio. DM. Wenn den Shuttlezügen eigene Gleise für einen vom ICE-Verkehr<br />
unabhängigen Betrieb zur Verfügung stehen, belaufen sich die Kosten auf jährlich 82 Mio. DM.<br />
Die Gesamtkosten für das Bus-System liegen mit 70 Mio. DM pro Jahr unter denen des Zug-Systems. Hierbei<br />
überwiegen die Betriebskosten, insbesondere die Personalkosten. Dagegen haben die Investitionskosten für die<br />
Infrastruktur, im wesentlichen die neue Bus-Straße von WIE nach FRA, nur einen Anteil von 22% an der<br />
Gesamtsumme.<br />
Die Kosten des Bus-Systems liegen somit gleichauf mit denen des Zug-Systems, wenn dieses die ICE-Gleise der<br />
im Bau befindlichen Bahnstrecke Köln -Rhein/Main mitnutzt. Bei durchgehend separaten Gleisen von WIE bis<br />
FRA sind die Kosten des Zug-Systems hingegen um 14% höher als die des Bus-Systems, was jedoch dadurch<br />
wieder kompensierbar ist, daß diese zusätzlichen Gleise auch anderen Zügen zur Verfügung stehen, die sonst<br />
nicht verkehren könnten. Ohnedies ist das zugrundeliegende Zugangebot bezüglich der Kapazität im<br />
Personentransfer stark überdimensioniert und kann deshalb zusätzlich zu den Transfer-Passagieren auch von<br />
Originärpassagieren aus Wiesbaden oder Mainz sowie von Flughafen- oder Airline-Mitarbeitern genutzt werden.<br />
Beim Bus-System sind für derartige Zusatzverkehre hingegen zusätzliche Busfahrten notwendig, die sich in<br />
entsprechend höheren Kosten niederschlagen. So betrachtet, dürften die Gesamtkosten des Zug-Systems<br />
tatsächlich leicht unter denen des Bus-Systems liegen.<br />
11.1.6 Kosten der Terminals in WIE für das Zug- und das Bus-System<br />
Im Flughafen Wiesbaden-Erbenheim ergeben sich für das Terminal der Zug-Lösung jährliche Kosten von 34,7<br />
Mio. DM und für die Terminals der Bus-Lösung Jahreskosten von 32,7 Mio. DM. Der Unterschied von lediglich<br />
2,0 Mio. DM in den Kosten beider Terminal-Versionen ist vernachlässigbar gering, so daß von <strong>einer</strong><br />
Kostengleichheit ausgegangen werden kann.<br />
11.1.7 Gesamtvergleich von Zug- und Bus-Lösung<br />
Bei <strong>einer</strong> Gesamtbetrachtung erweisen sich das Zug-System und das Busssystem in etwa als gleichwertig, was<br />
den tatsächlichen Zeitaufwand für den Transfer von Passagieren und Gepäck zwischen WIE und FRA betrifft.<br />
Auch hinsichtlich der Investitions- und Betriebskosten zeigt sich eine Gleichwertigkeit der Zug- und Bus-<br />
Lösung.<br />
11.2 Optionen des Airport-Links per Zug<br />
Das beschriebene Zug-System als Grundlage eines Verbunds der Flughäfen WIE und FRA eröffnet zahlreiche<br />
Optionen, die bei einem alleinigen Ausbau des Flughafens Frankfurt nicht gegeben sind und die auch bei<br />
Realisierung eines Bus-Systems als Airport-Link zwischen WIE und FRA ausscheiden:<br />
Zusätzliche Bahnverbindungen mit Hilfe der neuen Infrastruktur<br />
Die neue Schienen-Infrastruktur, die eigens für den Airport-Link von Wiesbaden-Erbenheim bis zur<br />
Einmündung in die ICE-Strecke Köln - Frankfurt südlich des Wiesbadener Kreuzes geschaffen werden muß,
steht nicht exklusiv den Shuttlezügen zwischen WIE und FRA zur Verfügung. Vielmehr dienen die neuen Gleise<br />
mindestens drei weiteren Eisenbahn-Relationen, die sonst nicht möglich wären:<br />
(1) Es entsteht eine Direktverbindung für schnellen Regionalverkehr von Wiesbaden Hbf über den Flughafen<br />
Wiesbaden-Erbenheim zum Flughafen Frankfurt und weiter entweder in Richtung Mannheim, Richtung<br />
Frankfurt Hbf oder Richtung Frankfurt Süd - Hanau. Nach ersten groben Schätzungen wird zwischen Wiesbaden<br />
und FRA eine Fahrzeitverkürzung von fast 30 min im RE-Verkehr gegenüber der heutigen S 8 und von rund 10<br />
min gegenüber <strong>einer</strong> Linienführung auf der kurvenreichen und umwegigen Altstrecke über Mainz-Kastel und<br />
Mainz-Bischofsheim erzielt.<br />
(2) Es bietet sich an, die zukünftige ICE-T-Linie nach München über Nürnberg bereits in Wiesbaden Hbf und<br />
nicht erst im Flughafen Frankfurt/Main beginnen bzw. in Wiesbaden Hbf anstelle von FRA enden zu lassen. Die<br />
schnellen ICE-T-Züge können in diesem Fall über die neue Verbindungsspange am Wiesbadener Kreuz<br />
verkehren. Auf diese Weise erhält die hessische Landeshauptstadt einen sehr attraktiven Anschluß an das ICE-<br />
System in Richtung Bayern.<br />
(3) Aufgrund des zu erwartenden hohen Fluggastaufkommens des Flughafens Wiesbaden-Erbenheim ist die<br />
wirtschaftliche Basis gegeben, um WIE in die ICE-Relation Köln - Rhein/Main einzubinden, zumindest was<br />
einzelne ICE-Linien betrifft. In diesem Fall befahren die ICE-Züge den Frankfurter Ast der Neubaustrecke Köln<br />
- Rhein/Main und benutzen die neuen Gleise der Wiesbaden-Spange bis zum Regional- und Fernbahnhof WIE<br />
(vgl. Kapitel 3.2). Diese Option besteht prinzipiell auch bei der Bus-Lösung eines Flughafens in Wiesbaden-<br />
Erbenheim, doch erfordert dies zusätzliche Investitionen in die Eisenbahn-Infrastruktur, die die Kosten der Bus-<br />
Lösung entsprechend erhöhen würden.<br />
Zweiter Schienen- und Straßenzugang zum Flughafen-System Frankfurt<br />
Da der Flughafen Wiesbaden-Erbenheim ein vollwertiges Terminal erhält, besteht hier die Möglichkeit zum<br />
Check-In für alle Flüge, die von WIE aus starten, aber auch für die Flüge, die in FRA beginnen (vgl. auch Abb.<br />
1a). In letzterem Fall gelangen die Fluggäste nach dem Einchecken in WIE mit Hilfe des Airport-Links nach<br />
FRA. Mit der Anbindung des Terminals WIE an den Schienen-Regional- und -Fernverkehr (vgl. Kapitel 3.2)<br />
entsteht ein zweiter eisenbahn-seitiger Zugang zum Flughafen-System Frankfurt. Auf diese Weise wird zugleich<br />
der erst im Mai 1999 eröffnete Fernbahnhof FRA entlastet, dessen Kapazitätsgrenze vermutlich in absehbarer<br />
Zeit erreicht sein wird, da dieser Bahnhof nicht nur von Fluggästen, sondern auch als wichtiger<br />
Umsteigebahnhof innerhalb des ICE-Systems genutzt werden wird.<br />
Durch seine Nähe zu den Autobahnen A 3, A 61, A 66, A 643, A 671 und zur autobahn-artigen Bundesstraße B<br />
455 ist der Flughafen WIE für Fluggäste, die mit dem Auto anreisen, optimal erreichbar. Somit besteht<br />
straßenseitig ein zweiter Zugang zum Flughafen-System Frankfurt aus Richtung Westen und Norden, so daß im<br />
Pkw-Zubringerverkehr die staugefährdeten und somit unkalkulierbaren Straßen und Autobahnen um den<br />
Flughafen Frankfurt gemieden werden können.<br />
Attraktiver Flughafen der kurzen, übersichtlichen Wegen<br />
Der Flughafen Wiesbaden-Erbenheim erhält ein eigenes, neues Terminal "auf der grünen Wiese". Dieses<br />
Terminal kann zum einen nach den neuesten Erkenntnissen der Airport-Forschung und -Planung konzipiert und<br />
für das zukünftig zu erwartende Wachstum des Passagieraufkommens gleich angemessen dimensioniert werden.<br />
Dagegen wurde insbesondere das Terminal 1 in Frankfurt zu <strong>einer</strong> Zeit entworfen, als die heutigen<br />
Fluggastmengen in k<strong>einer</strong> Weise absehbar waren, so daß hier ständige Modifikationen und Erweiterungsbauten<br />
erforderlich waren und sind, ohne aber die Grundkonzeption des Gebäudekomplexes verändern zu können.<br />
Erschwerend für fluggast-gerechte Anpassungen kommen die beengten Platzverhältnisse des Frankfurter<br />
Terminal-Systems hinzu, das sozusagen eingeklemmt ist zwischen den luftseitigen Anlagen (Vorfeld, Taxiways,<br />
Runways etc.) und der straßen- und schienen-seitigen Infrastruktur. In WIE hingegen stehen für die Lage und<br />
Gestaltung des Terminals viele Optionen in konzeptioneller wie räumlicher Hinsicht offen.<br />
Insbesondere die Fußweglängen beim Übergang Fernbahn - Flugzeug und Auto -Flugzeug, die in FRA teilweise<br />
extrem lang und für Ortsunkundige verwirrend angelegt sind, können in WIE auf ein Minimum reduziert<br />
werden, indem der Regional- und Fernbahnhof sowie die Parkhäuser von Anfang an in das Terminal integriert<br />
werden und der gesamte Gebäudekomplex so kompakt und so übersichtlich wie möglich angelegt wird. Somit<br />
kann in WIE ein Flughafen entstehen, der durch seine kurzen, allein an den Belangen der Fahrgäste orientieren<br />
Wege eine hohe Attraktivität aufweisen wird.
WIE als eigenständiger Flughafen<br />
WIE kann als Flughafen auch eine gewisse Eigenständigkeit erhalten, und zwar im Point-to-Point-Verkehr und<br />
als separater Hub, den sich beispielsweise eine Airline-Allianz zu Nutze macht, welche in Konkurrenz zur Star-<br />
Allianz der Lufthansa steht. In diesem Fall wird nicht nur der Airport-Link entlastet, da weniger Transfer-<br />
Passagiere zwischen den beiden Teilflughäfen zu befördern sind, sondern es dürfte aufgrund der oben genannten<br />
kurzen Wege auch eine wesentlich kürzere MCT als innerhalb des heutigen Flughafens Frankfurt erreichbar sein.<br />
Flughafen der beiden Landeshauptstädte<br />
Indem der Flughafen Wiesbaden-Erbenheim ein vollwertiges Terminal erhält, besteht hier die Möglichkeit zum<br />
Check-In für alle Flüge, die von WIE aus starten, aber auch für die Flüge, die in FRA beginnen. In letzterem Fall<br />
gelangen die Fluggäste nach dem Einchecken in WIE mit Hilfe des Airport-Links nach FRA. Die<br />
Landeshauptstädte Wiesbaden und Mainz erhalten somit einen quasi eigenen Flughafen, der fast vor "ihrer<br />
Haustür" liegt. So beträgt die Luftlininen-Distanz von den Stadtzentren in Wiesbaden und Mainz zum Flughafen<br />
Wiesbaden-Erbenheim jeweils nur rund 6 km, während der Flughafen Frankfurt rund 20 bzw. 25 km entfernt ist.<br />
12. Möglicher weiterer Untersuchungsbedarf<br />
Aufgrund des beschränkten Zeit- und Kostenbudgets, das für die vorliegende Untersuchung zur Verfügung steht,<br />
können bei weitem nicht alle relevanten Aspekte eines Airport-Links zwischen WIE und FRA analysiert werden.<br />
So ist zum einen der Katalog der Fragestellungen dieser Studie relativ begrenzt und zum anderen kann bei<br />
einigen der behandelten Themen nicht der erforderliche Detaillierungsgrad, der eigentlich notwendig wäre,<br />
erreicht werden.<br />
12.1 Weitergehende Fragestellungen zum Airport-Link zwischen WIE und FRA<br />
Der von der Mediationsgruppe erteilte Auftrag für die Untersuchungsstufen 1 und 2 beschränkte sich darauf,<br />
þ die Machbarkeit <strong>einer</strong> MCT von 45 min anhand von Zug- und Bus-System im worst case zu klären<br />
þ zusätzlich die erreichbare Transfer-Zeit für eher normale, durchschnittliche Fälle zu ermitteln<br />
þ für beide Lösungsmöglichkeiten des Flughafen-Verbundes von WIE und FRA die Investitions- und<br />
Betriebskosten abzuschätzen<br />
þ der Frage nachzugehen, wie der Flughafen-Verbund WIE + FRA bezüglich der tatsächlich erzielbaren<br />
Transfer-Zeit im Vergleich mit dem Ausbau des Standorts FRA inkl. 3. Terminal abschneidet.<br />
Hierbei bleiben noch Fragen offen, die aber für die endgültige Entscheidung darüber, ob der Flughafen-Verbund<br />
von WIE und FRA realisiert werden sollte, geklärt werden müßten. Aus diesem Grunde sollten in weiteren<br />
Untersuchungsstufen, die aus Zeitgründen nur außerhalb des Mediationsverfahrens durchgeführt werden können,<br />
diese zusätzlichen Aspekte grundlegend geklärt werden. Hierbei handelt es sich um folgende Themen:<br />
þ Bestimmung der Zuverlässigkeit des Airport-Links incl. Entwicklung von Strategien für den Störfall<br />
þ Vergleichende Untersuchung der für den Shuttle-Betrieb möglichen Zuggarnituren und Auswahl sowie ggfs.<br />
Modifikation der geeigneten Fahrzeuge<br />
þ Detailstudie zur Gestaltung des Fahrplans für den Airport-Link<br />
þ Abschätzung der politischen und juristischen Realisierbarkeit der notwendigen Infrastruktur-Maßnahmen<br />
þ Entwicklung eines Konzepts für zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten der Schienen-Infrastruktur, die eigens für<br />
den Airport-Link geschaffen werden muß<br />
þ Darstellung von möglichen anderen <strong>bodengebundenen</strong> Verkehrsmitteln als Alternativen zum Zug- und zum<br />
Busyystem und Vergleich aller in Frage kommenden Systeme miteinander
þ Anbindung des Flughafens Wiesbaden-Erbenheim auf der Schiene im Regional-und Fernverkehr<br />
þ Detailplanung der Umsteigeanlagen zwischen Airport-Shuttle- und Sky-Line-Zügen im Bahnhof T1 des<br />
Flughafens Frankfurt zur Anbindung der peripheren Flugzeug-Positionen am Flugsteig A<br />
þ Ausarbeitung eines vollautomatischen Systems für die Sortierung des Gepäcks im Zug, das die neuesten<br />
Entwicklungen in der Fördertechnik berücksichtigt<br />
þ Entwurf eines Logistik-Konzepts für den Frachtransfer zwischen WIE und FRA incl. Beschreibung der<br />
möglichen Eisenbahn-Fahrzeuge<br />
þ Entwurf eines Personen-Transport-Systems innerhalb des Terminals Wiesbaden-Erbenheim zur weiteren<br />
Reduzierung der Umsteigezeiten (z. B. "Cable-Liner")<br />
þ Ermittlung der Connection Time für Umsteiger innerhalb von WIE<br />
þ Entwicklung eines Szenarioflugplans für WIE mit dem Ziel, die Umsteigerströme zwischen WIE und FRA zu<br />
minimieren; dieses Ziel könnte beispielsweise dadurch erreicht werden, daß in WIE ein eigenständiger Hub<br />
aufgebaut wird, möglicherweise von <strong>einer</strong> Airline-Allianz unabhängig von der Star-Allianz<br />
þ Vergleich der Lösungen für den Flughafen-Verbund WIE + FRA (incl. neues Terminal in WIE) mit dem<br />
Ausbau von FRA (3. Terminal und 4. Landebahn) hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit<br />
Mit der Behandlung dieser zusätzlichen Themen liegt ein gegenüber der vorliegenden Studie wesentlich breiteres<br />
Spektrum an Informationen bezüglich der Frage der Realisierung des Flughafen-Verbundes WIE + FRA vor.<br />
12.2 Größerer Detailierungsgrad der zu ermittelnden Daten<br />
Die Ermittlung der Zeit-Wege-Ketten ist im Rahmen dieser Studien nur durch Betrachtung von<br />
Einzelereignissen (ein Flug mit <strong>einer</strong> bestimmten Anzahl von Passagieren) möglich. Eine Berücksichtigung der<br />
gesamten Einflüsse, die sich durch Überlagerungen mit anderen Flügen ergeben, ist nur ansatzweise durch<br />
allgemeinen Annahmen möglich. Um genauere Aussagen über die Anzahl der erforderlichen Ressourcen (z.B.<br />
Abfertigungsfahrzeuge, Personal, Flächen, Bus-Shuttle-Fahrzeuge) und um detaillierte Angaben zu den<br />
Durchschnittszeit der Umsteigebeziehungen machen zu können, sind Betriebssimulationen erforderlich. Auf<br />
diese Weise können die Interaktionen zwischen allen Prozessen im Detail berücksichtigt und anstelle von<br />
Einzelereignissen ganze Flugplan-Tage untersucht werden. Dadurch entsteht eine wesentlich differenziertere<br />
Datenbasis, die eine fundierte Entscheidungsgrundlage über die Realisierung des Flughafen-Verbundes WIE +<br />
FRA bietet.<br />
Die durchzuführenden Simulationen betreffen die Prozesse in den Terminals (Passagier- und Gepäck-<br />
Bewegungen) und die Verbindung zwischen den Flughäfen (per Shuttlezug oder -bus) sowie den Vorfeldverkehr<br />
in WIE und in FRA. Auf diese Weise kann insbesondere die noch offene Frage geklärt werden, ob bei der Bus-<br />
Lösung der zusätzliche Verkehr auf dem Vorfeld in FRA zu bewältigen ist.<br />
Ebenso können die bislang eher groben Aussagen zu den Rollzeiten nur mittels Simulationen präzisiert werden.<br />
Denn nur durch solche Verfahren lassen sich angesichts der großen Anzahl von Flugbewegungen neben den<br />
Rollgeschwindigkeiten auch die verschiedenen Betriebsstrategien in den beiden Flughäfen sowie die Einflüsse<br />
der einzelnen Flugzeuge aufeinander (z.B. Warten beim Queren von Runways) berücksichtigen.<br />
Je nach gewünschten Detaillierungsgrad der Simulation werden für solche Arbeiten am Airport Research Center<br />
die Tools SIMMOD und TAAM (in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen) angewendet.<br />
13. Kurzfassung<br />
13.1 Problemstellung<br />
Als Alternative zum Bau <strong>einer</strong> 4. Landebahn und eines weiteren Terminals für den Flughafen Frankfurt/Main<br />
(FRA) kommt prinzipiell ein Verbund zwischen diesem Flughafen und dem heute noch militärisch genutzten<br />
Flughafen Wiesbaden-Erbenheim (WIE) in Frage. Die hier vorhandene Start- und Landebahn ist jedoch nicht mit
<strong>einer</strong> 4. Bahn des Flughafens Frankfurt gleichzusetzen. Vielmehr behält WIE auch in einem möglichen Verbund-<br />
System mit FRA eine gewisse Eigenständigkeit als Flughafen. Voraussetzung für einen solchen Verbund von<br />
WIE und FRA über eine Distanz von rund 20 km ist, daß zwischen beiden Flughäfen ein bodengebundenes<br />
schnelles Verkehrsmittel ("Airport-Link") verkehrt, das dieselbe Transferzeit ermöglicht, wie sie heute innerhalb<br />
von FRA garantiert wird, und zwar sowohl bezüglich Passagiere als auch deren Gepäck. Diese "Minimum<br />
Connection Time" (MCT) beträgt 45 min.<br />
13.2 Aufgabenstellung, Grundlagen und Methodik<br />
13.2.1 Aufgabenstellung<br />
Es war zunächst zu untersuchen, ob bei einem Flughafen-Verbund von WIE und FRA die genannte MCT durch<br />
eine bodengebundene Schnellverbindung auch unter ungünstigen Randbedingungen ("worst case") realisierbar<br />
ist, und zwar anhand des Systems Zug unter teilweiser Mitnutzung der in Bau befindlichen ICE-Strecke Köln -<br />
Rhein/Main (Untersuchungsstufe 1). In diesem Worst-case-Szenario wurden insgesamt 6 Fälle von ungünstigen<br />
Umsteige-Relationen betrachtet, insbesondere periphere Vorfeld- bzw. Gebäude-Positionen und sehr große<br />
Flugzeuge mit einem zeitaufwendigen Boarding- bzw. Deboarding-Prozeß, und zwar in beiden Richtungen<br />
sowohl für Gepäck als auch für Personen.<br />
Nachdem die Machbarkeit <strong>einer</strong> MCT von 45 min bei dieser Lösung prinzipiell nachgewiesen werden konnte,<br />
wurden weitere Untersuchungsschritte durchgeführt (Untersuchungsstufe 2), die sich mit folgenden Fragen<br />
beschäftigten:<br />
(1) Ist als Alternative zum Zug-System ein Airport-Link mit vorfeldgängigen Bussen zwischen WIE und FRA<br />
bei <strong>einer</strong> MCT von 45 min für Personen und Gepäck unter ungünstigen Bedingungen (3 worst cases) machbar?<br />
(2) Wie kann eine vom ICE-Verkehr völlig separate Schienenverbindung zwischen WIE und FRA im dicht<br />
besiedelten Rhein-Main-Gebiet verlaufen?<br />
(3) Wie hoch sind die Investitions- und Betriebskosten der Zug- und der Bus-Lösung?<br />
(4) Welche Umsteigezeiten (Connection Times) werden erzielt, wenn keine worst cases, sondern<br />
Durchschnittsfälle (durchschnittliche Flugzeug-Positionen und -Größen) zugrunde gelegt werden?<br />
(5) Gibt es Möglichkeiten, durch Sonderbehandlungen beim Transfer von Gepäck bzw. Passagieren die<br />
geforderte MCT auch dann zu garantieren, wenn im Normalfall der Zug- bzw. Bus-Lösung die 45-min-Schranke<br />
in extrem ungünstigen Fällen überschritten wird?<br />
(6) Wie schneidet der Flughafen-Verbund WIE + FRA bezüglich der erreichbaren Umsteigezeiten im Vergleich<br />
mit den Ausbauvarianten des Standorts FRA incl. 3. Terminal in FRA und dem Status quo in FRA ab?<br />
(7) Welche Flugzeug-Rollzeiten werden am Standort WIE im Vergleich zu FRA heute und bei mehreren<br />
Ausbau-Varianten des Standorts FRA erzielt?<br />
13.2.2 Szenarioflugpläne als Input<br />
Zur Dimensionierung des Flughafenterminals WIE sowie zur Abschätzung der Passagier- und Gepäckvolumina<br />
im Transfer zwischen WIE und FRA wurde ein Szenarioflugplan für Wiesbaden-Erbenheim und hinsichtlich der<br />
Bus-Lösung zusätzlich ein Szenarioflugplan für den Flughafen Frankfurt analysiert. Bei den Passagier-<br />
Bewegungen war eine Unterscheidung dahingehend notwendig, ob die Herkunfts- bzw. Zielländer dem<br />
Schengen- oder dem Non-Schengen-Bereich angehören.<br />
13.2.3 Mögliche Transportsysteme der Flughafen-Verbindung<br />
Für einen Airport-Link zwischen WIE und FRA sind neben den untersuchten Systemen, nämlich<br />
Hochgeschwindigkeits-Züge und vorfeldgängige Busse, prinzipiell auch andere Transportsysteme denkbar,<br />
insbesondere Magnetschwebebahnen ("Transrapid") oder vorfeldgängige spurgebundene Fahrzeuge wie z.B.
Straßenbahnen oder Spurbusse. Wegen des beschränkten Zeit- und Kostenbudgets der vorliegende Studie mußte<br />
eine Untersuchung derartiger Alternativen und ihr Vergleich mit der Zug- und Bus-Lösung unterbleiben.<br />
13.2.4 Untersuchungsmethode<br />
Für die Untersuchung der Umsteigezeiten wurde ein mehrstufiges iteratives Verfahren verwendet, bei dem<br />
zunächst ein Logistik-Grobkonzept entwickelt wurde und, darauf aufbauend, je eine Wegekette für den<br />
Passagier- und Gepäck-Transfer zwischen WIE und FRA in beiden Richtungen mit <strong>einer</strong> Vielzahl von<br />
Infrastruktur- und fahrzeug-seitigen Elementen. In einem zweiten Durchgang und teilweise in weiteren Schritten<br />
wurden einzelne Elemente dieser Wegekette modifiziert und ggfs. durch Alternativen ersetzt, sobald sich die<br />
betreffenden Elemente durch zu großen Zeitbedarf oder eine mangelnde Machbarkeit auszeichneten. Auf diese<br />
Weise entstand schließlich sowohl für den Passagier-als auch Gepäck-Transfer eine technisch realisierbare Zeit-<br />
Wege-Kette mit <strong>einer</strong> MCT von rund 45 min und weniger.<br />
13.2.5 Konzept des Airport-Links<br />
Es bestehen drei prinzipielle Möglichkeiten, um den Passagier- und Gepäck-Transfer zwischen WIE und FRA<br />
abzuwickeln (siehe Abb. 1b):<br />
(1) Jede Flugzeug-Position in WIE wird mit jeder Flugzeug-Position in FRA durch relativ kleine Fahrzeuge<br />
verbunden.<br />
(2) Das Terminal in WIE wird mit jeder Flugzeug-Position in FRA durch Fahrzeuge mittlerer Größe (=<br />
Omnibusse) verbunden, wobei die in WIE gelandeten Passagiere im Terminal WIE gesammelt bzw. in der<br />
Gegenrichtung auf die hier startenden Flugzeuge verteilt werden.<br />
(3) Die Terminals in WIE und FRA werden durch relativ große Fahrzeuge (= Züge) miteinander verbunden. Die<br />
in WIE gelandeten Passagiere werden hierbei im Terminal WIE gesammelt und in den Terminals von FRA auf<br />
die hier startenden Flugzeuge verteilt. In der Gegenrichtung findet das Sammeln in FRA und das Verteilen in<br />
WIE statt.<br />
Das Prinzip (1) scheidet zumindest im Regelbetrieb aus, da eine extrem große Fahrzeug-Flotte mit entsprechend<br />
hohen Betriebskosten benötigt würde und die Kapazität des Vorfeldes in FRA für die hohe Zahl an Fahrten<br />
vermutlich gar nicht ausreichen würde. Deshalb bleiben für den Airport-Link nur die Möglichkeiten (1) und (2),<br />
also ein Bus- und ein Zug-System übrig.<br />
13.2.6 Prämissen der Untersuchung<br />
Der Airport-Link zwischen WIE und FRA in Form eines Zug- bzw. Bus-Systems baut auf mehreren Prämissen<br />
auf:<br />
(1) Vorsortierung des Umsteigergepäcks: beim Zug-System in allen Flugzeugen, die in WIE landen, beim Bus-<br />
System in allen Flugzeugen, die in FRA landen<br />
(2) bautechnisch machbare Einbindung der für das Zug-System neu zu schaffenden Infrastruktur in den<br />
Terminalbereich in FRA<br />
(3) ausreichende Vorfeld-Kapazität in FRA zur Aufnahme der großen Zahl von Shuttlebussen bei der Bus-<br />
Lösung<br />
(4) Grenz- und Zollkontrollen, soweit erforderlich: beim Zug-System während der Fahrt im Shuttlezug, beim<br />
Bus-System stationär im Terminal in WIE, wie im Luftverkehr üblich.<br />
Die Fragen "Vorsortierung des Umsteigergepäcks in Flugzeugen mit Ziel WIE" und "Machbarkeit der<br />
Einbindung der neuen Eisenbahn-Infrastruktur in FRA" wurden in einem Arbeitsgespräch mit der FAG<br />
abgestimmt. Das Konzept für die Grenz-und Zollabfertigung im Zug wurde in einem mehrstufigen<br />
Abstimmungsprozeß mit dem Bundesgrenzschutzamt Flughafen Frankfurt (Main) und dem Hauptzollamt<br />
Frankfurt am Main-Flughafen entwickelt.
13.3 Funktionsprinzip des Airport-Links<br />
13.3.1 Zug-System<br />
Bei der Zug-Lösung wird das Umsteiger-Gepäck in WIE zwischen Flugzeug und Zug per Trolley/Dolley<br />
transportiert. Die mit Transfer-Gepäck beladenen Container bzw. Trolley-Ladeflächen werden in WIE in den<br />
Zug hineingerollt und während der Fahrt nach FRA entladen und vorsortiert. Innerhalb von FRA wird das<br />
Gepäck mit der vorhandenen Gepäckförderanlage (GFA) befördert. Die Gegenrichtung wird ebenfalls in FRA<br />
die GFA benutzt, während der Fahrt nach WIE werden die Container für in WIE startende Anschluß-Flugzeuge<br />
beladen und in WIE werden die Container per Dolley/Trolley zum Flugzeug gefahren.<br />
Die Passagiere gehen in WIE von der Flugzeugposition zu Fuß zum Bahnhof oder fahren mit einem Vorfeld-Bus<br />
zum Bus-Bahnhof der sich auf dem breiten Bahnsteig des Shuttle-Bahnhofs befindet. Die Fluggäste, die sich<br />
<strong>einer</strong> Grenzkontrolle unterziehen müssen, passieren die im Zug vorhandenen Abfertigungsschalter. Falle<br />
erforderlich, findet hier auch die Zollkontrolle statt. Nach ihrer Ankunft in FRA legen die Fluggäste den Weg<br />
zwischen Bahnhof und Flugzeug-Gate zu Fuß zurück. Ab dem Terminal 1 kann auch die Benutzung von<br />
Vorfeld-Bussen notwendig sein, die dann in einem Busbahnhof direkt unter dem Shuttle-Bahnhof starten. In der<br />
Gegenrichtung von FRA nach WIE wird genau umgekehrt verfahren.<br />
Mit diesem Konzept kann die Zugfahrzeit für die Grenzkontrolle und zumindest teilweise für die<br />
Gepäckbehandlung genutzt werden.<br />
13.3.2 Bus-System<br />
Beim Bus-System liegt der Schwerpunkt der logistischen Aktivitäten in beiden Richtungen im neuen Terminal<br />
WIE (vgl. Abb. 1b): Hier wird das Gepäck wird in der Gepäckförderanlage sortiert und falls erforderlich, findet<br />
hier auch eine stationäre Grenzkontrolle der Passagiere statt. Im Terminal WIE wird das Gepäck in Transport-<br />
Fahrzeuge verladen, die für konkrete Flugzeugpositionen in FRA bestimmt sind, und die Fluggäste betreten<br />
Busse, die dann nonstop über eine neu zu bauende autobahn-parallele Verbindungsstraße direkt an die Vorfeldund<br />
Gebäudepositionen der Anschluß-Flugzeuge in FRA fahren.<br />
Bei der Bus-Lösung wird die Fahrzeit zwar nicht für weitere Tätigkeiten genutzt, aber stattdessen werden die<br />
zum Teil sehr zeitaufwendigen Wege innerhalb des Flughafens FRA durch das direkte Anfahren jeder Flugzeug-<br />
Position extrem abgekürzt.<br />
13.4 Infrastruktur und Fahrzeuge<br />
13.4.1 Zug-System<br />
Für den Flughafen-Verbund WIE + FRA waren neue Infrastruktur-Maßnahmen zu entwerfen: ein neues<br />
Terminal in Wiesbaden-Erbenheim, ein separater Shuttle-Bahnhof in WIE, zwei neue Shuttle-Bahnhöfe T1 und<br />
T2 in FRA und eine neue, kreuzungsfreie Straße vom Terminal 1 zu den peripheren Flugzeug-Positionen im<br />
äußersten westlichen Vorfeld von FRA. Um die betrieblich problematische Mitnutzung der ICE-Strecke Köln -<br />
Rhein/Main durch die Shuttle-Züge zu vermeiden, wurden in der Untersuchungsstufe 2 durchgängig separate<br />
Gleise für den Airport-Link zugrunde gelegt, die überwiegend entlang der im Bau befindlichen ICE-Trasse Köln<br />
- Rhein/Main verlaufen.<br />
Als Fahrzeuge werden lokbespannte Züge mit <strong>einer</strong> Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h und <strong>einer</strong> an die<br />
Erfordernisse des Airport-Links angepaßten Waggon-Inneneinrichtung zugrunde gelegt. Insgesamt werden 10<br />
Züge benötigt. Mit diesen Shuttle-Fahrzeugen wird, wie Fahrsimulationen per Computer ergaben, eine Fahrzeit<br />
von 8 min zwischen WIE und FRA Terminal 1 und von 10 min 30 sec zwischen WIE und FRA Terminal 2<br />
erreicht. Hinzu kommt noch die Wartezeit bis zur Zugabfahrt, die im ungünstigsten Fall genau so lang ist wie die<br />
Zugfolgezeit, welche mit 4 min 30 sec angesetzt wurde. Somit ergibt sich ein maximaler Zeitaufwand von rund<br />
15 min in beiden Richtungen.<br />
13.4.2 Bus-System
Das Bus-System erfordert in Wiesbaden-Erbenheim ein Zentralterminal (für Originär-Passagiere) und ein auf<br />
dem Vorfeld angeordnetes Satelliten-Terminal, in dem die gelandeten Passagiere gesammelt und den<br />
Shuttlebusse nach FRA zugeordnet bzw. in der Gegenrichtung nach Ankunft der Busse aus FRA auf die in WIE<br />
startenden Flugzeuge verteilt werden. Zwischen den Vorfeldern der beiden Flughäfen ist eine separate Bus-<br />
Strasse vorzusehen, die auf der Süd- bzw. Südwestseite der Autobahnen A 66 und A 4 in enger<br />
Trassenbündelung mit der Autobahn geführt wird. Die Mitnutzung der vorhandenen Autobahnen und Straßen<br />
scheidet sowohl wegen der hohen Störanfälligkeit eines solchen Betriebs als auch prinzipiell aus Gründen der<br />
Luftsicherheit und des Grenzschutzes aus, da eine sichere Abschirmung des Shuttle-Verkehrs vom übrigen<br />
Straßenverkehr undurchführbar wäre.<br />
Aufgrund der schwankenden Gepäckmengen und der Anzahl an Transfer-Passagieren pro Fahrt sind für jeden<br />
der beiden Transportzwecke Fahrzeuge mit jeweils zwei Größen sinnvoll: Transport-Fahrzeuge für 2 und für 4<br />
Gepäck-Container, Busse mit 20 bzw. 45 Sitzplätzen. Die Geschwindigkeit aller Shuttle-Fahrzeuge wird mit 120<br />
km/h angesetzt. Es ergibt sich ein Bedarf von 120 Fahrzeugen für den Gepäck- und Personentransport.<br />
Auf der separaten Bus-Straße werden vom Rand des Vorfeldes in WIE bis zum Rand des Vorfeldes in FRA<br />
Fahrzeiten zwischen 11,5 min und knapp 15 min erzielt. Diese Fahrzeiten wurden mit Hilfe von<br />
computergestützten Fahrsimulationen ermittelt.<br />
13.5 Zeit-Wege-Ketten des Zug- und Bus-Systems<br />
Für insgesamt 6 worst cases der Zug-Lösung und 3 der Bus-Lösung wurden Zeit-Wege-Ketten des Gepäck- und<br />
des Passagier-Transfers untersucht, und zwar getrennt nach den beiden Richtungen von WIE nach FRA und<br />
umgekehrt. Somit waren 36 worst-case Zeit-Wege-Ketten zu betrachten. Hinzu kamen noch weitere Zeit-Wege-<br />
Ketten für durchschnittliche Fälle.<br />
Aus dieser großen Zahl von Zeit-Wege-Ketten soll zur Veranschaulichung exemplarisch eine konkrete Kette des<br />
Bus-Systems herausgegriffen und dargestellt werden, wobei auch der Zeitaufwand pro "Kettenglied"<br />
ausgewiesen wird.<br />
Hierbei wird der worst case B1 herangezogen, der folgendermaßen charakterisiert ist:<br />
þ äußerste Gebäude-Position am Satellitenterminal in WIE<br />
þ Flugzeug mit 150 Passagieren in WIE (aus Non-Schengen), davon 60 Umsteiger von/nach FRA (nach<br />
Schengen)<br />
þ ungünstigste Gebäude-Position in FRA (E9)<br />
þ Flugzeug mit 350 Passagieren in FRA, davon 40 Umsteiger von/nach WIE.<br />
Tab. 26: Zeit-Wegekette Passagiere von WIE nach FRA für den Fall B1<br />
Prozesse Bemerkungen Zeitbedarf<br />
in min<br />
1 Positionierung Brücken 1,5<br />
2 Deboarding max 150 Pax 7,0<br />
3 Bustransfer (Vorfeld) 500 m bei 30 km/h<br />
4 Verzögerungszeiten<br />
5 Aussteigen Bus<br />
6 Wege im Terminal (Roll-) Treppe zum OG / Terminal<br />
7 Wege im Terminal (max. 120 m) 2,0<br />
8 Orientierung 1,0<br />
9 Paßkontrolle (letz.Pass. von max.60) 2,0<br />
10 Weg zu Busgates 0,5<br />
11 Orientierung an Busgates 0,5<br />
12 Bus Shuttle Boarding Busgate 0,5<br />
13 (Roll-) Treppe zum EG / Bus 0,5<br />
14 Türen Schließen 0,5
15 Fahrzeit Vorfeld WIE (max. 30km/h) 1,0<br />
16 Verlustzeiten (25%, mind. 0,5 min) 0,5<br />
17 Fahrzeit WIE - FRA auf Busstraße 14,5<br />
18 Fahrzeit Vorfeld FRA (max. 25 km/h) 1,5<br />
19 Verlustzeiten (25%, mind. 1 min) 1,0<br />
20 Boarding Umsteiger FRA Aussteigen Bus 1,0<br />
21 Treppe zum Flugzeug 0,5<br />
22 Boarding (letzter Pass. von max.40) 3,0<br />
23 Entf.Brücken, Off-Block 2,5<br />
Summe Zeitbedarf 41,5<br />
Die beispielhafte Zeit-Wege-Kette (siehe Tab. BB1) umfaßt 19 von 23 möglichen Gliedern, deren zeitliche<br />
Länge von 0,5 min bis 14,5 min variiert, wobei der größte Zeitbedarf für die Fahrt des Shuttlebusses zwischen<br />
beiden Flughäfen anfällt. In den Tabellen wird grundsätzlich der "letzte Fluggast" betrachtet: In der Zeile (9)<br />
wird die Paßkontrolle des "letzten Fluggastes" mit nur 2,0 min berücksichtigt; in der Summe aller Passagiere der<br />
hier betrachteten Zeit-Wege-Kette ist für die Paßkontrolle jedoch ein Vielfaches der hier aufgeführten<br />
Zeitspanne vorgesehen.<br />
Die ausgewiesenen 19 Einzel-Zeiten ergeben zusammen eine Umsteigezeit von 41,5 min, also 3,5 Minuten unter<br />
der geforderten MCT von 45 min.<br />
13.6 Ergebnisse der Untersuchung<br />
13.6.1 Transferzeiten beim Zug-System<br />
Bezüglich des Transfers von Gepäck kann bei fast allen untersuchten Umsteige-Relationen die MCT von 45 min<br />
erreicht oder sogar unterschritten werden. Doch in zwei Fällen, und zwar beide Male von FRA nach WIE, dauert<br />
der Transport mit 46 bzw. 45,5 min geringfügig zu lange. Durch den Einsatz von Vorfeldfahrzeugen als Ersatz<br />
für lange Transportstrecken in der GFA von FRA kann die geforderte MCT jedoch auch in diesen worst cases<br />
erreicht werden.<br />
Beim Personentransfer wird von WIE nach FRA die MCT von 45 min bei <strong>einer</strong> worst case Vorfeldposition in<br />
FRA nicht eingehalten. Wenn hierbei ein zweiter Vorfeldbus mit maximal 25 Passagieren eingesetzt wird, kann<br />
die geforderte MCT jedoch erreicht werden. In der Gegenrichtung überschreiten 4 der 6 betrachteten Worst-<br />
Case-Positionen die MCT um bis zu 3 Minuten. Um die MCT in diesen Fällen dennoch zu gewährleisten,<br />
müssen verspätete bzw. sehr langsam gehende Fluggäste innerhalb von WIE mit "Feuerwehr-Fahrten" vom<br />
Shuttle-Bahnhof zum Flugzeug per PKW bzw. Kleinbus direkt an die Flugzeug-Position befördert werden.<br />
Werden Flugzeug-Positionen in durchschnittlicher Entfernung zu den Shuttle-Bahnhöfen und Flugzeuge mit<br />
durchschnittlicher Größe zugrunde gelegt, so erreicht selbst der langsamste Fluggast in beiden Umsteige-<br />
Richtungen eine Connection Time, die rund 5 min unter der MCT von 45 min liegt. Auch das Gepäck wird<br />
zwischen durchschnittlichen Positionen um rund 5 min schneller befördert als bei Worst-case-Positionen.<br />
13.6.2 Transferzeiten beim Bus-System<br />
Die MCT von 45 min läßt sich beim Gepäcktransport im Rahmen des Bus-Systems in allen untersuchten Worstcase-Beziehungen<br />
einhalten; bei durchschnittlichen Flugzeug-Positionen wird die geforderte MCT sogar um bis<br />
zu 7 min unterboten.<br />
Falls in den Flugzeugen mit Zielflughafen FRA eine Gepäckvorsortierung nach Umsteigergepäck ab WIE und ab<br />
FRA grundsätzlich nicht durchsetzbar sein sollte, bietet es sich als Alternative an, das Umsteigergepäck nach<br />
WIE an neu einzurichtenden Ausgabestationen in FRA in einzelne Fahrzeuge zu laden und direkt zu den<br />
Anschlußflugzeugen in WIE zu transportieren. Durch derartige "Feuerwehr-Fahrten" ergeben sich Gepäck-<br />
Transferzeiten von 47 bis 53 min.
Beim Passagiertransfer von WIE nach FRA per Bus wird in allen worst cases die MCT von 45 min eingehalten<br />
oder sogar unterboten. Dagegen wird in zwei eher unwahrscheinlichen Fällen der Gegenrichtung die MCT<br />
überschritten, und zwar um bis zu 4,5 min. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Fluggäste in WIE nach der<br />
Ankunft des Shuttlebusses aus FRA noch auf Vorfeldbusse umsteigen müssen, weil ein Flugzeug in WIE auf<br />
dem Vorfeld abgefertigt werden muß, da alle an den Satelliten vorhandene Positionen besetzt sind. Um auch<br />
unter diesen Ausnahme-Bedingungen die MCT zu erreichen, sind wie bereits bei der Zug-Lösung, "Feuerwehr-<br />
Fahrten" unverzichtbar. Hierzu fahren die Shuttlebusse, nachdem zeit-unkritische Fluggäste am Satelliten-<br />
Terminal ausgestiegen sind, mit den verbliebenen zeitkritischen Passagieren direkt weiter zu den Anschluß-<br />
Flugzeugen. Falls Grenzkontrollen erforderlich sein sollten, für die dann an den Busgates spezielle<br />
Kontrollstellen in WIE bereitzuhalten sind, erhöht sich zwar die Connection Time um diesen<br />
Abfertigungsvorgang, aber sie bleibt dennoch unter der 45-min-Schranke.<br />
Bei durchschnittlichen Flugzeug-Positionen und -größen in FRA wird die MCT von 45 min beim Bus-System<br />
deutlich unterschritten, und zwar beim Umsteigen von WIE nach FRA um bis zu 10 min und in der<br />
Gegenrichtung um bis zu 6 min.<br />
13.6.3 Vergleich der Transferzeiten des Zug- und Bus-Systems<br />
Bei <strong>einer</strong> Gesamtbetrachtung des Gepäck- und Passagier-Transfers schneidet das Bus-System geringfügig besser<br />
als die Zug-Lösung ab, was die Einhaltung der geforderten MCT betrifft. Sowohl bei der Zug-Lösung als auch<br />
der Bus-Lösung erweist sich der Transport des Gepäcks insgesamt als etwas weniger zeitkritisch, verglichen mit<br />
der Beförderung der umsteigenden Fluggäste.<br />
13.6.4 Transferzeiten beim weiteren Ausbau in FRA und beim Status quo in FRA<br />
Beim Ausbau des Flughafens Frankfurt (4. Landebahn, 3. Terminal in Südlage) ergeben sich bezüglich der<br />
erreichbaren Umsteigezeit geringe Vorteile gegenüber dem Flughafen-Verbund WIE + FRA. Vergleicht man<br />
diesen Flughafen-Verbund mit dem Ausbau in FRA anhand der Zug-Lösung, so werden bei Passagieren und<br />
Gepäck innerhalb von FRA Umsteigezeiten erreicht, die um rund 1 min kürzer sind als beim Transfer zwischen<br />
WIE und FRA. Die Bus-Lösung ergibt beim Ausbau von FRA um rund 2 min kürzere Transferzeiten als beim<br />
Flughafen-Verbund.<br />
Wenn man den möglichen Flughafen-Verbund von Wiesbaden-Erbenheim und Frankfurt bezüglich der<br />
erreichbaren Transferzeiten mit der heutigen Situation im Flughafen Frankfurt vergleicht und hierbei immer von<br />
Worst-case-Szenarien ausgeht, kann festgestellt werden, daß es auch heute Umsteigerelationen in FRA gibt, bei<br />
denen die MCT von 45 min nicht sicher eingehalten werden kann. Gegenüber diesem Staus quo bedeutet also<br />
der Verbund der beiden Flughäfen mit einem Airport-Link per Zug oder Bus nicht zwangsläufig eine<br />
Verschlechterung, selbst wenn die hier ausgewiesenen Transferzeiten in Einzelfällen - ohne Einsatz von<br />
Sonderfahrten - geringfügig über der MCT von 45 min liegen.<br />
13.6.5 Kosten des Zug- und des Bus-Systems<br />
Um die einmalig anfallenden Investitionskosten und die laufenden Betriebskosten addieren zu können, werden<br />
die Investitionskosten für die Zug-und die Bus-Lösung per Annuitätenmethode auf die einzelnen Nutzungsjahre<br />
umgelegt und die Betriebskosten ebenfalls pro Jahr ausgewiesen.<br />
Die Gesamtkosten für das Zug-System betragen, falls durchgängig separate Gleise für den Airport-Link<br />
geschaffen werden, pro Jahr 82 Mio. DM, andernfalls nur 72 Mio. DM.<br />
Die Gesamtkosten für das Bus-System liegen mit 70 Mio. DM pro Jahr unter denen des Zug-Systems. Hierbei<br />
überwiegen die Betriebskosten, insbesondere die Personalkosten. Dagegen haben die Investitionskosten für die<br />
Infrastruktur, im wesentlichen die neue Bus-Straße von WIE nach FRA, nur einen Anteil von 22% an der<br />
Gesamtsumme.<br />
Bei durchgehend separaten Gleisen von WIE bis FRA sind die Kosten des Zug-Systems somit um 14% höher als<br />
die des Bus-Systems. Dem steht ein erhöhter Nutzen gegenüber, da diese Eisenbahn-Infrastruktur auch von<br />
anderen Zügen genutzt werden kann.
Für das Terminal der Zug-Lösung in WIE errechnen sich jährliche Kosten von 34,7 Mio. DM und für die<br />
Terminals der Bus-Lösung Jahreskosten von 32,7 Mio. DM. Der Unterschied beträgt somit 2,0 Mio. DM.<br />
Insgesamt liegen die Kosten des Zug- und Bus-Systems sehr dicht beieinander, so daß der Kosten-Unterschied<br />
für eine Entscheidung Zug-System versus Bus-System nicht ins Gewicht fällt.<br />
13.6.6 Rollzeiten in den Flughäfen WIE und FRA<br />
Die zivile Nutzung des Flughafens Wiesbaden-Erbenheim ermöglicht Rollzeiten, die deutlich kürzer sind als bei<br />
sämtlichen Bahn-Varianten des Flughafen-Ausbaus in FRA und auch gegenüber dem heutigen Frankfurter<br />
Bahnsystem. Allerdings führen diese gegenüber FRA verkürzten Rollzeiten in WIE nicht zwangsläufig zu<br />
entsprechend reduzierten Flugzeiten bei Starts und Landungen in Wiesbaden-Erbenheim. Denn die tatsächlichen<br />
Flugzeiten hängen in erheblichem Maß von den durch die DFS festzusetzenden Flugrouten von und nach WIE<br />
ab.<br />
13.7 Ausblick<br />
Der Airport-Link zwischen WIE und FRA in Form eines Zug-Systems eröffnet zahlreiche Optionen, die bei<br />
einem alleinigen Ausbau des Flughafens Frankfurt wie auch bei der als Alternative möglichen Bus-Lösung nicht<br />
gegeben sind. Zu nennen sind insbesondere zusätzliche Bahnverbindungen mit Hilfe der neuen Infrastruktur,<br />
beispielsweise schnelle Direktverbindungen im Regionalverkehr von Wiesbaden Hbf über WIE nach FRA und<br />
weiter nach Frankfurt Hbf. Des weiteren stellt der Flughafen Wiesbaden-Erbenheim mit seinem neuen Terminal<br />
einen zweiten Schienen- und Straßenzugang zum Flughafen-System Frankfurt dar. Als völlig neu nach<br />
modernsten Erkenntnissen konzipierbares Terminal kann in WIE ein attraktiver Flughafen der kurzen,<br />
übersichtlichen Wege entstehen. Die beiden Landeshauptstädte Wiesbaden und Mainz erhalten somit quasi einen<br />
eigenen Flughafen, der fast vor "ihrer Haustür" liegt.<br />
14. Quellenangaben<br />
1) Flughafen Frankfurt Main AG: Kompendium über die im Rahmen des Mediationsverfahrens weiter zu<br />
untersuchenden Varianten zur Steige-rung der Kapazität des Flughafens Frankfurt, Frankfurt/Main 1999<br />
2) mündliche Auskunft durch Bundesgrenzschutzamt Flughafen Frankfurt (Main) und Hauptzollamt Frankfurt<br />
am Main-Flughafen<br />
3) Intraplan, Fluggastprognose 2015 für den Flughafen Frankfurt am Main unter besonderer Berücksichtung der<br />
Wirkung der Transeuropäischen Netze, Oktober 1999, Abb. 4-2<br />
4) Boltze Manfred u.a., Verkehrsknotenpunkt Frankfurt Flughafen, Auftrag-geber: Deutsche Bahn AG,<br />
Flughafen Frankfurt Main AG, Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Stadt Frankfurt am Main, o.J., Bild 1<br />
5) mündliche Auskunft vom 4.5.1999 durch die DB Reise & Touristik, Netzmanagement<br />
6) Schönfeld, Harald: Schnellverkehr in Frankreich -Die Rennbahn Europas, in: eisenbahn magazin, 11/1999,<br />
Seite 69<br />
7) mündliche Auskunft durch DBProjekt GmbH Köln-Rhein/Main<br />
8) DBProjekt GmbH Köln-Rhein/Main, Planungsabschnitt 35, Planungsstand 19.4.1999<br />
9) Andersen, Sven: Neue Lösungsansätze zu Konflikten der Verkehrsbedie-nung auf der Neubaustrecke Köln -<br />
Rhein/Main, in: Eisenbahn Revue International, 7-8/1999, Seite 304<br />
10) Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), Teil: Querschnitte (RAS-Q), Forschungsgesellschaft für<br />
Straßen- und Verkwehrswesen, 1982<br />
11) mündliche Angaben von SMA, Zürich<br />
12) eigene Berechnungen per Computer-Fahrsimulation<br />
13) SMA und Partner AG: Qualitätskontrolle zu V 13: Schnelle Anbindung von Erbenheim, November 1999,<br />
S.5<br />
14) DBProjekt GmbH Köln-Rhein/Main: Neubaustrecke Köln-Rhein/Main, Streckenkarte, Stand: Januar 1999<br />
15) DBProjekt GmbH Köln-Rhein/Main: Neubaustrecke Köln-Rhein/Main, Streckenkarte, Stand: Januar 1999<br />
16) Studienarbeit am ARC über Entladevorgänge der B747 am Flughafen FRA, 1996<br />
17) Nach den "Verkehrsregeln für den nicht öffentlichen Bereich des Flug-hafens München" beträgt die<br />
Höchstgeschwindigkeit im gesamten nicht öffentlichen Bereich 30 km/h.<br />
18) mündliche Auskunft durch Bundesgrenzschutzamt Flughafen Frankfurt (Main)<br />
19) mündliche Auskunft durch Bundesgrenzschutzamt Flughafen Frankfurt (Main)<br />
20) schriftliche Mitteilung des Hauptzollamtes Frankfurt am Main-Flughafen vom 13.12.1999
21) Heimerl, Gerd, u.a., Standardisierte Bewertung von Verkehrsinvestitio-nen des öffentlichen<br />
Personennahverkehrs, erstellt im Auftrag des Bundesministers für Verkehr, 1988<br />
22) Flughafen Hamburg, Terminal 4, Inbetriebnahme 1994<br />
23) Anfahrbeschleunigung: 1 m/sec2, Bremsverzögerung: 0,9 m/sec2, v-max = 50 km/h<br />
24) schriftliche Mitteilung der FAG vom 23.8.1999<br />
25) Tabelle "5-1 Taxiwayzeiten; Vorgabe für die Emissionsprognose" aus "FLUGGFAG.DOC" vom 02.12.1999<br />
15. Glossar<br />
FRA 3-letter-code Flughafen Frankfurt<br />
WIE 3-letter-code Flughafen Wiesbaden-Erbenheim (derzeit Code für US-Airbase)<br />
T1 FRA Terminal 1 bzw. dessen Shuttle-Bahnhof<br />
T2 FRA Terminal 2 bzw. dessen Shuttle-Bahnhof<br />
BGS Bundesgrenzschutz<br />
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH<br />
SLB Start- und Landebahn<br />
GFA Gepäckförderanlage: Beförderung von Einzelgepäckstücken, in FRA in Schalen<br />
MCT Mimimum connection time: kleinste Zeitspanne, bei der der Buchungscomputer einen Anschlußflug<br />
als erreichbar ausgibt; z. B. MCT 45 min, Ankunft 12.00 Uhr, Abflug 12.40 Uhr Í> Verbindung nicht möglich.<br />
Ankunft 12.00 Uhr, Abflug 12.45 Uhr Í> Verbindung möglich.<br />
Feederflug Zubringerflug<br />
Hub and<br />
Spoke Flugplansystem, das kurze Anschlüsse zwischen Flügen gewährleistet. Dies führt zur Häufung von<br />
Starts und Landung im Tagesverlauf. Z. B. Landungen von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Starts von 13.15 bis 13.45<br />
Uhr.<br />
Hub Flughafen, der räumliches Zentrum eines Hub-and-Spoke-Systems ist<br />
Belly Einzelgepäckstück<br />
Trolley Gepäckwagen zum Transport von Einzelgepäck, wie auf großen Bahnhöfen<br />
Container Gepäck-Container, speziell angepaßt an die Form des Frachtraums eines speziellen Flugzeugtyps;<br />
max. Größe (Boeing 747) 2,33 m lang, 1,53 m breit, 1,63 m hoch<br />
Dolley Wagen zum Transport von Flugzeug-Gepäckcontainern<br />
RE RegionalExpress: schneller Nahverkehr im Verkehrsverbund bis 160 km/h (früher Eilzug)<br />
EBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung<br />
EKrG Eisenbahn-Kreuzungsgesetz<br />
16. Anhang<br />
16.1 Zeitlicher Aufwand bei Gepäckabfertigung Bus-Lösung in WIE<br />
Bearbeitung und Verantwortung: Airport Research Center
Tab. A1: Ausgangsdaten für den Aufwand an Zeit bei Gepäckabfertigung Bus-Lösung in WIE<br />
Vorfeldanbindung<br />
Zuführbänder 6pcs a 41m 250m<br />
6pcs Wippe<br />
Abführbänder 6pcs a 41m 250m<br />
6pcs Trichter<br />
6pcs Arbeitsplatz<br />
Busanbindung<br />
Zuführbänder 3pcs a 15m 50m<br />
3pcs Wippe<br />
Abführbänder 12pcs a 5m 60m<br />
12pcs Trichter<br />
12pcs Arbeitsplatz<br />
Gepäck-Scanner<br />
Scannerdusche 9pcs Torsonden<br />
Manuelle Station 3pcs 10m 30m<br />
3pcs Trichter<br />
3pcs Arbeitsplatz<br />
3pcs Wippe<br />
Transferkreislauf<br />
Satellitenkreisl. 2pcs a 60m 120m<br />
Zuführbänder 3pcs a 15m 50m<br />
3pcs Trichter<br />
3pcs Wippe<br />
Abführbänder 3pcs a 15m 50m<br />
3pcs Trichter<br />
3pcs Wippe<br />
Stichbänder<br />
Satellit-Satellit 2-4pcs a 200m 400 m (800m)<br />
2-4pcs Trichter<br />
2-4pcs Wippe<br />
Satellit-Hauptterminal<br />
optional 2-4pcs a 300m 600m (1.200m)<br />
4-6pcs Trichter<br />
4-6pcs Wippe<br />
16.2 Kostentabellen Eisenbahn-Trasse und Bus-Straße
Die folgende Kostenkalkulation (Tab. A2, A3 und A4) berücksichtigt nur Eisenbahnanlagen und die dazu<br />
gehörigen Kunstbauten, die für den Airport-Link im Regelbetrieb relevant sind. Das bedeutet, daß beispielsweise<br />
die Kosten für Rolltreppen zwischen der Bahnsteig- und <strong>einer</strong> separaten Fußgänger-Ebene ebenso wenig<br />
enthalten sind wie die Kosten für Gleisverbindungen, die allein von Regionalzügen befahren werden oder für die<br />
Umleitung von DB-Zügen bei Störfällen dienen.<br />
Tab. A2: Investitionskosten für Bahnanlagen:<br />
Streckenabschnitt von WIE bis zur Einmündung in die ICE-Strecke (incl. Bahnhof WIE, aber ohne<br />
Bahnbetriebswerk)<br />
Länge Kosten Gesamtoder<br />
pro km Kosten<br />
Stück- oder pro Mio. DM<br />
zahl Stück (gerundet)<br />
Baumaßnahme Mio. DM<br />
1. Bahnstrecke ohne Kunstbauten 7,50 km 12 90<br />
2. Bahnsteige WIE 20<br />
3. 2-gl. Überwerfung über 3 Gleise 0,10 km 40 4<br />
4. 1-gl. Tunnel unter ICE-Strecke 0,10 km 30 3<br />
5. 3. Gleis 0,5 km 6 3<br />
6. Weichen im Bereich WIE 6 0,3 2<br />
7. Umbau AS Wiesbaden-Nordenstadt 3<br />
8. Straßenbrücke L 3028 1<br />
9. Umbau AS Wallau + Neubau Straßenbrücke<br />
4<br />
10. Brücke über Wickerbach incl. Querung<br />
Tunnel Wandersmann-Süd 0,10 km 40 4<br />
11. Brücke über A 3 0,15 km 40 6<br />
12. 1-gleisige Überwerfung<br />
über ICE-Trasse 0,10 km 40 4<br />
13. zusätzl. Bahndamm für 1 Gleis 1,00 km 5 5<br />
14. Weichen für Abzw. mit 220 km/h 2 4 8<br />
ÄÄÄ<br />
157<br />
Tab. A3: Investitionskosten für Bahnanlagen:<br />
Separate Gleise entlang der ICE-Strecke bis FRA<br />
Länge Kosten Gesamtoder<br />
pro km Kosten<br />
Stück- oder pro Mio. DM<br />
zahl Stück (gerundet)<br />
Baumaßnahme Mio. DM<br />
1. Bahnstrecke ohne Kunstbauten 12,20 km 12,0 146<br />
2. 1-gl. Überwerfung über ICE-Trasse 0,10 km 40,0 4<br />
3. zusätzl. Bahndamm für 1 Gleis 1,00 km 5,0 5<br />
4. Weichen für Abzw. mit 220 km/h 2 4,0 8<br />
5. Verlängerung Straßenbrücke<br />
bei Weilbach 1 1,0 1<br />
6. Verbreiterung Eisenbahnbrücken<br />
über B 40 und B 519 2 1,5 3<br />
7. Verbreiterung Eisenbahnbrücken<br />
über L 3006 und Bahnstrecke F - WI 2 1,5 3<br />
8. Mainbrücke 0,35 km 50,0 18<br />
9. Neubau Eisenbahnbrücken über S-Bahn<br />
und B 43 (ehem. Caltex-Gelände) 2 2,0 4<br />
10. 1-gl. Überwerfung über Bahnstrecke<br />
F - MZ 0,1 km 40,0 4
11. zusätzl. Bahndamm für 1 Gleis 1,0 km 5,0 5<br />
12. Weichen für Abzw. mit 120 km/h 2 0,5 1<br />
13. Weichen für Abzw. mit 160 km/h 2 1,0 2<br />
14. 1-gl. Überwerfung über Bahnstrecke<br />
F - MZ 0,1 km 40,0 4<br />
15. zusätzl. Bahndamm für 1 Gleis 1,0 km 5,0 5<br />
16. Landschaftsbrücke (Eisenbahntunnel)<br />
südl. Kelsterbach 0,15 km 40,0 6<br />
17. Straßenbrücke bei Umspannwerk 1 2,0 2<br />
18. Eisenbahnbrücke für nördl. Gleis<br />
bei AS Kelsterbach 1,0 km 20,0 20<br />
19. Eisenbahnbrücke für südl. Gleis<br />
bei AS Kelsterbach 0,25 km 20,0 5<br />
20. Verlängerung Straßenbrücke B 43 4<br />
21. Weichen für Abzw. mit 130 km/h 4 0,5 2<br />
ÄÄÄ<br />
252<br />
Tab. A4: Investitionskosten für Bahnanlagen:<br />
Streckenführung im Bereich FRA incl. Bahnhöfe<br />
Länge Kosten Gesamtoder<br />
pro km Kosten<br />
Stück- oder pro Mio. DM<br />
zahl Stück (gerundet)<br />
Baumaßnahme Mio. DM<br />
1. Bahnstrecke ohne Kunstbauten 2,40 km 12,0 29<br />
2. Weichen für Abzw. mit 130 km/h 2 0,5 1<br />
3. 1-gl. Eisenbahnbrücke 0,65 km 20,0 13<br />
4. 2-gl. Eisenbahnbrücke 1,90 km 25,0 48<br />
5. 30% Zuschlag für Umbau bestehender<br />
Anlagen 7,5 14<br />
6. Bahnsteig T1 20<br />
7. Zuschlag für Anpassung Terminal 1<br />
auf 450 Meter Länge 40 (?)<br />
8. Zuschlag<br />
9. 1-gl. Eisenbahnbrücke für 0,50 km 20,0 10<br />
Überwerfung T2 (2x250 m)<br />
8. Bahnsteige T2 30<br />
10. Weichen für Abzw. mit niedriger<br />
Geschwindigkeit 10 0,25 3<br />
ÄÄÄ<br />
208<br />
Tab. A5: Investitionskosten Bus-Straße Vorfeld WIE bis FRA<br />
Länge Kosten Gesamtoder<br />
pro km Kosten<br />
Stück- oder pro Mio. DM<br />
zahl Stück (gerundet)<br />
Baumaßnahme Mio. DM<br />
1. Bus-Straßen ohne Kunstbauten 19,0 km 8 152<br />
2. Überwerfung ICE-Strecke 0,15 km 40 6<br />
3. Umbau AS Wiesbaden-Nordenstadt 3<br />
4. Straßenbrücke L 3028 2<br />
5. Umbau AS Wallau + Neubau Straßenbrücke<br />
4
6. Brücke über Wickerbach incl. Querung<br />
Tunnel Wandersmann-Süd 0,10 km 40 4<br />
7. Verbreiterung Straßenbrücken 2 0,5 1<br />
8. Verlängerung Straßenbrücke<br />
bei Weilbach 1 1,0 1<br />
9. Verbreiterung Straßenbrücken<br />
über B 40 und B 519 2 1,5 3<br />
10. Verbreiterung Straßenbrücken<br />
über L 3006 und Bahnstrecke F - WI 2 1,5 3<br />
11. Mainbrücke 0,40 km 50,0 20<br />
12. 3 Straßenbrücken Bereich AS Raunheim 0,3 km 40,0 12<br />
13. Straßenunterf. Mönchhof-Dreieck 4 2,0 8<br />
14. Verlängerung Feldwegbrücke 1<br />
15. Verläng. Brücke K 152, Stützwände 2<br />
16. Straßen Anschlußstelle Tor 97 0,8 7 6<br />
17. Anschlußst. Unterquerung Airportring 2<br />
18. Verlängerung Straßenbr. Staudenweiher 1<br />
19. Verlängerung Brücke Mörfeldner Straße 2<br />
20. Verlängerung Straßenbrücke B 43 4<br />
21. Tunnel bis besteh. Vorfeld-Tunnel 0,2 40 8<br />
ÄÄÄ<br />
245<br />
Tab. A6: Investitionskosten Bus-Straße Umfahrung Zentralbereich T1<br />
Länge Kosten Gesamtoder<br />
pro km Kosten<br />
Stück- oder pro Mio. DM<br />
zahl Stück (gerundet)<br />
Baumaßnahme Mio. DM<br />
Straße ebenerdig/Damm/Rampe 1,5 10 15<br />
2 Brücken westl. Fernbahnhof 0,3 40 12<br />
Brücke östl. Fernbahnhof 0,7 40 28<br />
30% Zuschlag für Umbau best. Anlagen 0,3 10 4<br />
ÄÄÄ<br />
59<br />
Tab. A7: Bus-Straße zur Anbindung des westl. Vorfeldes<br />
1. Bus-Straße ohne Kunstbauten 2,75 km 8 22<br />
17. Anschlußst. Unterquerung Airportring 2<br />
18. Verlängerung Straßenbr. Staudenweiher 1<br />
19. Verlängerung Brücke Mörfeldner Straße 2<br />
20. Verlängerung Straßenbrücke B 43 4<br />
21. Tunnel bis besteh. Vorfeld-Tunnel 0,2 40 8<br />
ÄÄÄ<br />
39<br />
16.3 Investitionskosten Terminals Bus- und Zug-Lösung<br />
Bearbeitung und Verantwortung: Airport Research Center<br />
16.3.1 Terminals Bus-Lösung<br />
Tab. A8: Flächen und Volumina Bus-Lösung
Satellit Grundflächen<br />
OG: 19.070m2 lufts. Passagierebene 5m Höhe 95.350m3<br />
EG: 6.400m2 Gepäcksortierung 5m Höhe 32.000m3<br />
2.320m2 Busgates, Büros 5m Höhe 11.600m3<br />
2.690m2 Vorfelddienste 5m Höhe 13.450m3<br />
UG: 5.980m2 Technik, Gepäck-Link 5m Höhe 29.900m3<br />
36.460m2 282.300m3<br />
Satellit Fassadenflächen<br />
OG: 630m Passagierebene x 5m Höhe 3.150m2<br />
EG: 400m Gepäcksortierung x 5m Höhe 2.000m2<br />
600m Busgates, Büros x 5m Höhe 3.000m2<br />
210m Vorfelddienste x 5m Höhe 1.050m2<br />
UG: 590m Technik, Gepäck-Link x 5m Höhe 2.950m2<br />
Haupt-Terminal Grundflächen<br />
12.150m2<br />
OG: 30.820m2 lands. Passagierebene x 5m Höhe 154.100m3<br />
EG: 12.230m2 Technik, Gepäcksort. x 5m Höhe 61.150m3<br />
25.600m2 Fernbahnhof x 5m Höhe 128.000m2<br />
68.650m2 343.250m3<br />
Haupt-Terminal Fassadenflächen<br />
OG: 870m Passagierebene x 5m Höhe 4.350m2<br />
EG: 1.330m ICE-Station, Technik x 5m Höhe 6.650m2<br />
Tab. A9: Kosten Bus-Lösung Gebäude<br />
Satellit<br />
Gebäudekonstruktion Hochbau<br />
11.000m2<br />
Pauschal 36.460m2 x 3.000DM/m2 110 Mio. DM<br />
310 Baugrube 1,9<br />
320 Fundament und Bodenplatte 7,4<br />
330 Fassade und Fassadenkonstruktion (12.150m2) 25,6<br />
340 Wände und Stützen (innen) 11,8<br />
350 Ebenen, Boden/Deckenplatten 17,9<br />
360 Dach und Dachkonstruktion zzgl. Aufwand<br />
weitgespannte Dächer (19.070m2) 38,9<br />
390 Baustelleneinrichtung, Vermessung 6,5<br />
Technische Ausrüstung<br />
Pauschal 36.460m2 x 1.500DM/m2 55 Mio. DM
410 Sanitär, Sprinkler 3,6<br />
430 Klimaanlage, Entrauchung 6,9<br />
440 Elektroinstallation, Licht 7,1<br />
450 Kommunikationseinr., Informationssysteme 2,8<br />
460 technische Anlagen zur Gebäudeerschließung 31,9<br />
470 sonstige 2,7<br />
Innenausbau<br />
Pauschal 36.460m2 x 550DM/m2 21 Mio. DM<br />
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ<br />
Haupt-Terminal 186 Mio. DM<br />
Gebäudekonstruktion Hochbau<br />
Pauschal 68.650m2 x 3.000DM/m2 206 Mio. DM<br />
310 Baugrube 5,0<br />
320 Fundament und Bodenplatte 17,1<br />
330 Fassade und Fassadenkonstruktion (11.000m2) 23,2<br />
340 Wände und Stützen (innen) 28,6<br />
350 Ebenen, Boden/Deckenplatten 42,7<br />
360 Dach und Dachkonstruktion zzgl. Aufwand<br />
weitgespannte Dächer (37.830m2) 77,2<br />
390 Baustelleneinrichtung, Vermessung 12,2<br />
Technische Ausrüstung<br />
Pauschal 68.650m2 x 1.500DM/m2 103 Mio. DM<br />
410 Sanitär, Sprinkler 10,8<br />
430 Klimaanlage, Entrauchung 23,2<br />
440 Elektroinstallation, Licht 20,5<br />
450 Kommunikationseinr., Informationssysteme 9,3<br />
460 technische Anlagen zur Gebäudeerschließung 29,9<br />
470 sonstige 9,3<br />
Innenausbau<br />
Pauschal 68.650m2 x 550DM/m2 38 Mio. DM<br />
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ<br />
347 Mio. DM<br />
Gesamtkosten Buslösung Gebäude: 186 + 347 = 533 Mio. DM<br />
16.3.2 Terminals Zug-Lösung<br />
Tab. A10: Flächen und Volumina Zug-Lösung<br />
Terminal Grundflächen<br />
OG: 30.820m2 lands. Passagierebene x 5m Höhe 154.100m3<br />
27.150m2 lufts. Passagierebene x 5m Höhe 135.750m3
EG: 25.600m2 Fernbahnhof x 5m Höhe 128.000m3<br />
11.230m2 ICE-Link-Station x 5m Höhe 56.150m3<br />
12.230m2 Technik, Gepäcksort. x 5m Höhe 61.150m3<br />
2.320m2 Busgates, Büros x 5m Höhe 11.600m3<br />
2.690m2 Vorfelddienste x 5m Höhe 13.450m3<br />
112.040m2 560.200m3<br />
Terminal Fassadenflächen<br />
OG: 1.460m Passagierebene x 5m Höhe 4.350m2<br />
EG: 980m Fernbahnhof x 5m Höhe 6.650m2<br />
1.070m ICE-Link-Station, Tech. x 5m Höhe 5.350m2<br />
600m Busgates, Büros x 5m Höhe 3.000m2<br />
210m Vorfelddienste x 5m Höhe 1.050m2<br />
Tab. A11: Kosten Zug-Lösung Gebäude<br />
Gebäudekonstruktion Hochbau<br />
20.400m2<br />
Pauschal 112.040m2 x 3.000DM/m2 336 Mio. DM<br />
310 Baugrube 5,7<br />
320 Fundament und Bodenplatte 25,8<br />
330 Fassade und Fassadenkonstruktion (20.400m2) 43,0<br />
340 Wände und Stützen (innen) 42,6<br />
350 Ebenen, Boden/Deckenplatten 64,8<br />
360 Dach und Dachkonstruktion zzgl. Aufwand<br />
weitgespannte Dächer (65.850m2) 134,3<br />
390 Baustelleneinrichtung, Vermessung 19,8<br />
Technische Ausrüstung<br />
Pauschal 112.040m2 x 1.500DM/m2 168 Mio. DM<br />
410 Sanitär, Sprinkler 18,9<br />
430 Klimaanlage, Entrauchung 37,8<br />
440 Elektroinstallation, Licht 36,8<br />
450 Kommunikationseinr., Informationssysteme 16,3<br />
460 technische Anlagen zur Gebäudeerschließung 41,9<br />
470 sonstige 16,3<br />
Innenausbau<br />
Pauschal 112.040m2 x 550DM/m2 61 Mio. DM<br />
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ<br />
Gesamtkosten Zuglösung Gebäude 565 Mio. DM<br />
In den Kosten sind Gepäcksortieranlagen und die Ausrüstung Standplatz Flugzeug nicht enthalten.
In der Kostenaufstellung ist sowohl bei Zug- als auch bei der Bus-Lösung der Baukörper für Bahnanlagen DB-<br />
Fernbahnhof schon enthalten, ebenso eine unterirdische Verbindung der zwei Terminal-Baukörper der Bus-<br />
Lösung als Bestandteil der Position "Untergeschoß (UG)".<br />
16.4 Ermittlung der Rollzeiten in WIE und FRA<br />
Bearbeitung und Verantwortung: Airport Research Center<br />
Rollzeiten bei einem Ausbau am Standort FRA im Vergleich zu den Rollzeiten des bestehenden Bahnsystems in<br />
FRA<br />
Tab. A12: Rollzeiten ab der nord-östlichen Landebahn (Variante 9A)<br />
Betriebsrichtung West zum Terminal 1 und 2<br />
Anbindung:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-Mitte: ca. 1.100 m<br />
Rollgeschwindigkeit 15 kt: 490 m 60 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 15 kt,<br />
Vorteil gegenüber Bestand: -1.020 m -130 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 880 m 90 sec<br />
Rollgeschw. 20 kt, längere Landebahn Nord-Ost: 750 m 70 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 90 sec ca. 1,5 min<br />
Bei <strong>einer</strong> durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30 kt über die Strecke von 1.100 m verringert sich die<br />
Differenz zum bestehenden Rollbahnsystem auf 70 sec<br />
Betriebsrichtung West zum Terminal 3<br />
Anbindung:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-Mitte: ca. 2.230 m<br />
Rollgeschwindigkeit 15 kt: 490 m 60 sec<br />
Rollgeschw. 15 kt, Vorteil gegenüber Bestand: -1.020 m -130 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 880 m 90 sec<br />
Rollgeschw. 20 kt, längere Landebahn Nord-Ost: 750 m 70 sec<br />
Querung bestehendes Bahnsystem 900 m 270 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 360 sec<br />
ca. 6 min<br />
Betriebsrichtung Ost zum Terminal 1 und 2<br />
Anbindung:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-Mitte: ca. 2.460 m<br />
Rollgeschwindigkeit 15 kt: 490 m 60 sec<br />
Rollgeschw. 15 kt, Vorteil gegenüber Bestand: -1.020 m -130 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 2.990 m 290 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 220 sec<br />
ca. 3,5 min<br />
Bei <strong>einer</strong> durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30 kt über die Strecke von 2.460 m besteht eine Differenz von<br />
160 sec (2,7 min) zum bestehenden Rollbahnsystem.
Tab. A13: Rollzeiten ab der nord-westliche Bahn (Variante 9B)<br />
Betriebsrichtung West zum Terminal 1 und 2<br />
Anbindung Variante 1:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-West: ca. 3.130 m<br />
Rollgeschwindigkeit 15 kt: 1.890 m 240 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 1.240 m 120 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 360 sec<br />
ca. 6 min<br />
Anbindung Variante 2:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-Mitte: ca. 3.100 m<br />
Rollgeschwindigkeit 15 kt: 80 m 10 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 3.020 m 290 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 300 sec<br />
ca. 5 min<br />
Bei <strong>einer</strong> durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30kt. über die Strecke von 3.100m besteht eine Differenz von<br />
200 sec (3,3min) zum bestehenden Rollbahnsystem.<br />
Beriebsrichtung Ost zum Terminal 1 und 2 (nur Variante 2)<br />
Anbindung Variante 2:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-Mitte: ca. 2.180 m<br />
Rollgeschwindigkeit 15 kt: 460 m 60 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 1.720 m 170 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 230 sec<br />
ca. 4 min<br />
Bei <strong>einer</strong> durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30kt. über die Strecke von 2.180m besteht eine Differenz von<br />
140 sec (2,3 min) zum bestehenden Rollbahnsystem.<br />
Die Größenordnung der Rollzeitdifferenz wird von der FAG für T1 und T2 mit 0-1 min angegeben und weicht<br />
damit stark von den ermittelten Werten ab. Die von FRA angegebenen Werte erscheinen unter den gegebenen<br />
Rahmenbedingungen daher als nicht plausibel.<br />
Betriebsrichtung West zum Terminal Süd<br />
Anbindung Variante 1:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-West: ca. 4.500 m<br />
Rollgeschwindigkeit 15 kt: 3.260 m 420 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 1.240 m 120 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 540 sec<br />
ca. 9 min<br />
Bei <strong>einer</strong> durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30 kt über die Strecke von 4.500 m besteht eine Differenz von<br />
290 sec (4,8 min) zum bestehenden Rollbahnsystem.<br />
Für den Weg zum Terminal Süd wurde eine Rollzeitdifferenz von ca. 9 min ermittelt. Die von<br />
FAG angegebene Differenz beträgt 7-8 min.<br />
Tab. A14: Rollzeiten ab möglichen Süd-Bahn (Variante 12)
Betriebsrichtung West zum Terminal 1 und 2<br />
Anbindung Bahn 1:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-Mitte: ca. 3.040 m<br />
Rollgeschw. 15 kt, Vorteil gegenüber Bestand: -1.670 m -220 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 3.810 m 370 sec<br />
Querung bestehendes Bahnsystem 900 m 270 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 420 sec<br />
ca. 7 min<br />
Bei <strong>einer</strong> durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30 kt über die Strecke von 3.810 m besteht eine Differenz von<br />
300 sec (5min) zum bestehenden Rollbahnsystem.<br />
Anbindung Bahn 2:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-Mitte: ca. 4.510 m<br />
Rollgeschw. 15 kt, Vorteil gegenüber Bestand: -1.670 m -220 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 5.280 m 510 sec<br />
Querung bestehendes Bahnsystem 900 m 270 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 560 sec<br />
ca. 9,5 min<br />
Bei <strong>einer</strong> durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30 kt über die Strecke von 5.280 m besteht eine Differenz von<br />
390 sec (6,5 min) zum bestehenden Rollbahnsystem.<br />
Betriebsrichtung Ost zum Terminal 1 und 2<br />
Anbindung Bahn 1:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-Mitte: ca. 1.090 m<br />
Rollgeschw. 15 kt, Vorteil gegenüber Bestand: -1.670 m -220 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 1.860 m 180 sec<br />
Querung bestehendes Bahnsystem 900 m 270 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 230 sec<br />
ca. 4 min<br />
Anbindung Bahn 2:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-Mitte: ca. 2.550 m<br />
Rollgeschw. 15 kt, Vorteil gegenüber Bestand: -1.670 m -220 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 3.320 m 320 sec<br />
Querung bestehendes Bahnsystem 900 m 270 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 370 sec<br />
ca. 6 min<br />
Betriebsrichtung West zum Terminal T3<br />
Anbindung Bahn 1:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-Mitte: ca. 2.140 m<br />
Rollgeschw. 15 kt, Vorteil gegenüber Bestand: -1.670 m -220 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 3.810 m 370 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 150 sec
ca. 2,5 min<br />
Bei <strong>einer</strong> durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30 kt über die Strecke von 3.810 m besteht eine Differenz von<br />
30 sec (0,5 min) zum bestehenden Rollbahnsystem.<br />
Anbindung Bahn 2:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-Mitte: ca. 3.610 m<br />
Rollgeschw. 15 kt, Vorteil gegenüber Bestand: -1.670 m -220 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 5.280 m 510 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 290 sec<br />
ca. 5 min<br />
Bei <strong>einer</strong> durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30 kt über die Strecke von 5.280 m besteht eine Differenz von<br />
120 sec (2 min) zum bestehenden Rollbahnsystem.<br />
Betriebsrichtung Ost zum Terminal T3<br />
Anbindung Bahn 1:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-Mitte: ca. 190 m<br />
Rollgeschw. 15 kt, Vorteil gegenüber Bestand: -1.670 m -220 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 1.860 m 180 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: -40 sec<br />
ca. -0,5 min<br />
Anbindung Bahn 2:<br />
Strecke Rapid-Exit zu Eintrittspunkt FRA-Mitte: ca. 1.650 m<br />
Rollgeschw. 15 kt, Vorteil gegenüber Bestand: -1.670 m -220 sec<br />
Rollgeschwindigkeit 20 kt: 3.320 m 320 sec<br />
Rollzeitdifferenz zum bestehenden System: 100 sec<br />
ca. 1,5 min<br />
Tab. A15: Rollzeiten in FRA nach Angaben der FAG (in min)<br />
Terminal 1 Terminal 2 Terminal Süd<br />
durchsch. max. durchsch. max. durchsch. max.<br />
Nord-Östliche Bahn 7 11 7 11 13 17<br />
Nord-Westliche Bahn 8 11 8 11 14 18<br />
Süd-Bahn(en) 12 17 12 17 8 14<br />
Vorhandenes Bahnsystem 8 10 7 10 6 11<br />
Tab. A16: Rollzeiten in FRA (in min) nach eigenen Berechnungen - Betriebsrichtung West (25)<br />
Terminal 1 Terminal 2 Terminal Süd<br />
durchsch. max. durchsch. max. durchsch. max.<br />
Nord-Östliche Bahn 9,5 11,5 9,5 11,5 12 17<br />
Nord-West Bahn Var 1/2 14/13 16/15 14/13 16/15 15 20<br />
Süd-Bahn1 2 15/17,5 17/19,5 15/17,5 17/19,5 8,5/11 13,5/16<br />
Vorhandenes Bahnsystem 8 10 7 10 6 11<br />
Tab. A17: Rollzeiten in FRA (in min) nach eigenen Berechnungen - Betriebsrichtung Ost (07)<br />
Terminal 1 Terminal 2 Terminal Süd<br />
durchsch. max. durchsch. max. durchsch. max.<br />
Nord-Ost Bahn 11,5 13,5 11,5 13,5 14 19<br />
Nord-West Bahn Var 2 12 14 12 14 14,5 19,5
Süd-Bahn 1/2 12/14 14/16 12/14 14/16 5,5/7,5 10,5/12,5<br />
Vorhandenes Bahnsystem 8 10 7 10 6 11<br />
17.<br />
Verzeichnis der Abbildungen<br />
Abb. 1a: Prinzipiell mögliche Fluggast- und Fluggepäck-Bewegungen<br />
Abb. 1b: Prinzipielle Möglichkeiten für einen Airport-Link am Beispiel der Richtung von WIE nach FRA<br />
Abb. 2: Bewegungen in WIE - Flugplan Szenario A, Variante 11a der Mediation<br />
Abb. 3: Flugzeugkategorien der ankommenden Flugzeuge - Flugplan Szenario A, Variante 11a der Mediation)<br />
Abb. 4: Verteilung der ankommenden "Sitze" nach Schengen / Non-Schengen und Inland laut Szenario-<br />
Flugplan in WIE<br />
Abb. 4a: Ausnutzung Gebäude-Positionen am typischen Flugplantag 1998<br />
Abb. 4b: Ausnutzung Vorfeldpositionen am typischen Flugplantag 1998<br />
Abb. 5: Bestehende / im Bau befindliche Schienen-Infrastruktur<br />
Abb. 6: Flughafen WIE Gesamtansicht Zug-Lösung<br />
Abb. 7: Flughafen WIE Terminal Zug-Lösung<br />
Abb. 8: Shuttle-Bahnhof WIE<br />
Abb. 9: Schematischer Gleisplan Airport-Link in FRA<br />
Abb. 10: Gleisanlagen im Bereich WIE<br />
Abb. 11: Trasse des Airport-Links im Bereich FRA<br />
Abb. 12: Shuttle-Bahnhof FRA T1<br />
Abb. 13: Shuttle-Bahnhof FRA T2<br />
Abb. 14: Flughafen Wiesbaden-Erbenheim mit neuem Gleispaar für den Airport-Link<br />
Abb. 15: FRA-interne Straßenverbindung zu Tor 97 (Zug-Lösung)<br />
Abb. 16: Fahrschaudiagramm Airport-Link Zug-Lösung<br />
Abb. 17: Container-gängige Flugzeuge vs. Flugzeuge mit Frachtraum für Einzelgepäck laut Szenario-Flugplan<br />
in WIE<br />
Abb. 18: Aufbau des Shuttlezugs<br />
Abb. 19: Grenzkontroll-Schalter und Raum für Zollkontrolle im Shuttlezug<br />
Abb. 20: Zeit-Wege-Diagramm: langsamster und schnellster Fluggast<br />
Abb. 21: Schematischer Gleisplan mit neuem Gleispaar im Abschnitt Wiesbadener Kreuz - Weilbach<br />
Abb. 22: Schematischer Gleisplan Neues Gleispaar im Abschnitt Eddersheim -Kelsterbach<br />
Abb. 23: Separate Gleise für den Airport-Link im Abschnitt von Weilbach bis westl. Terminal 1 in FRA
Abb. 24: Fahrschaudiagramm Fahrt eines Shuttle-Busses von WIE nach FRA-T1<br />
Abb. 25: Flughafen WIE Gesamtansicht Bus-Lösung<br />
Abb. 26: Satelliten-Terminal Flughafen WIE Bus-Lösung: Fluggast-Ebene<br />
Abb. 27: Satelliten-Terminal Flughafen WIE Bus-Lösung: Vorfeld-Ebene<br />
Abb. 28: Satelliten-Terminal Flughafen WIE Bus-Lösung: Gepäck-Sortierung<br />
Abb. 29: Flughafen Wiesbaden-Erbenheim Bus-Lösung mit neuer Bus-Straße<br />
Abb. 30: Bus-Straße von Weilbach bis FRA westlich Terminal 1<br />
Abb. 31: Bus-Straße im Bereich FRA Zentral<br />
Abb. 32: Zeit-Wegekette Personen (Bus-Lösung) von WIE nach FRA, Fall B1<br />
Abb. 33: Zeit-Wegekette Personen (Bus-Lösung) von WIE nach FRA, Fall B2<br />
Abb. 34: Zeit-Wegekette Gepäck (Bus-Lösung) von WIE nach FRA, Fall B2