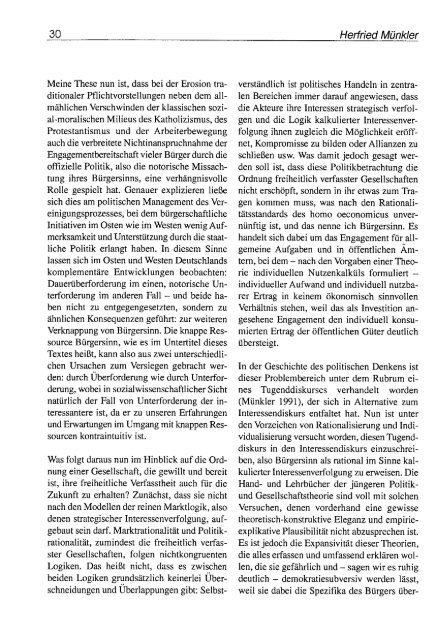Vollversion (8.77) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (8.77) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (8.77) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
30 Herfried Münkler<br />
Meine These nun ist, dass bei der Erosion traditionaler<br />
Pflichtvorstellungen neben dem allmählichen<br />
Verschwinden der klassischen sozial-moralischen<br />
Milieus des Katholizismus, des<br />
Protestantismus und der Arbeiterbewegung<br />
auch die verbreitete Nichtinanspruchnahme der<br />
Engagementbereitschaft vieler Bürger durch die<br />
offizielle Politik, also die notorische Missachtung<br />
ihres Bürgersinns, eine verhängnisvolle<br />
Rolle gespielt hat. Genauer explizieren ließe<br />
sich dies am politischen Management des Vereinigungsprozesses,<br />
bei dem bürgerschaftliche<br />
Initiativen im Osten wie im Westen wenig Aufmerksamkeit<br />
und Unterstützung durch die staatliche<br />
Politik erlangt haben. In diesem Sinne<br />
lassen sich im Osten und Westen Deutschlands<br />
komplementäre Entwicklungen beobachten:<br />
Dauerüberforderung im einen, notorische Unterforderung<br />
im anderen Fall - und beide haben<br />
nicht zu entgegengesetzten, sondern zu<br />
ähnlichen Konsequenzen geführt: zur weiteren<br />
Verknappung von Bürgersinn. Die knappe Ressource<br />
Bürgersinn, wie es im Untertitel dieses<br />
Textes heißt, kann also aus zwei unterschiedlichen<br />
Ursachen zum Versiegen gebracht werden:<br />
durch Überforderung wie durch Unterforderang,<br />
wobei in sozialwissenschaftlicher Sicht<br />
natürlich der Fall von Unterforderang der interessantere<br />
ist, da er zu unseren Erfahrungen<br />
und Erwartungen im Umgang mit knappen Ressourcen<br />
kontraintuitiv ist.<br />
Was folgt daraus nun im Hinblick auf die Ordnung<br />
einer Gesellschaft, die gewillt und bereit<br />
ist, ihre freiheitliche Verfasstheit auch für die<br />
Zukunft zu erhalten? Zunächst, dass sie nicht<br />
nach den Modellen der reinen Marktlogik, also<br />
denen strategischer Interessenverfolgung, aufgebaut<br />
sein darf. Marktrationalität und Politikrationalität,<br />
zumindest die freiheitlich verfasster<br />
Gesellschaften, folgen nichtkongruenten<br />
Logiken. Das heißt nicht, dass es zwischen<br />
beiden Logiken grundsätzlich keinerlei Überschneidungen<br />
und Überlappungen gibt: Selbst<br />
verständlich ist politisches Handeln in zentralen<br />
Bereichen immer darauf angewiesen, dass<br />
die Akteure ihre Interessen strategisch verfolgen<br />
und die Logik kalkulierter Interessenverfolgung<br />
ihnen zugleich die Möglichkeit eröffnet,<br />
Kompromisse zu bilden oder Allianzen zu<br />
schließen usw. Was damit jedoch gesagt werden<br />
soll ist, dass diese Politikbetrachtung die<br />
Ordnung freiheitlich verfasster Gesellschaften<br />
nicht erschöpft, sondern in ihr etwas zum Tragen<br />
kommen muss, was nach den Rationalitätsstandards<br />
des homo oeconomicus unvernünftig<br />
ist, und das nenne ich Bürgersinn. Es<br />
handelt sich dabei um das Engagement für allgemeine<br />
Aufgaben und in öffentlichen Ämtern,<br />
bei dem - nach den Vorgaben einer Theorie<br />
individuellen Nutzenkalküls formuliert -<br />
individueller Aufwand und individuell nutzbarer<br />
Ertrag in keinem ökonomisch sinnvollen<br />
Verhältnis stehen, weil das als Investition angesehene<br />
Engagement den individuell konsumierten<br />
Ertrag der öffentlichen Güter deutlich<br />
übersteigt.<br />
In der Geschichte des politischen Denkens ist<br />
dieser Problembereich unter dem Rubrum eines<br />
Tugenddiskurses verhandelt worden<br />
(Münkler 1991), der sich in Alternative zum<br />
Interessendiskurs entfaltet hat. Nun ist unter<br />
den Vorzeichen von Rationalisierung und Individualisierung<br />
versucht worden, diesen Tugenddiskurs<br />
in den Interessendiskurs einzuschreiben,<br />
also Bürgersinn als rational im Sinne kalkulierter<br />
Interessenverfolgung zu erweisen. Die<br />
Hand- und Lehrbücher der jüngeren Politikund<br />
Gesellschaftstheorie sind voll mit solchen<br />
Versuchen, denen vorderhand eine gewisse<br />
theoretisch-konstruktive Eleganz und empirieexplikative<br />
Plausibilität nicht abzusprechen ist.<br />
Es ist jedoch die Expansivität dieser Theorien,<br />
die alles erfassen und umfassend erklären wollen,<br />
die sie gefährlich und - sagen wir es ruhig<br />
deutlich - demokratiesubversiv werden lässt,<br />
weil sie dabei die Spezifika des Bürgers über-