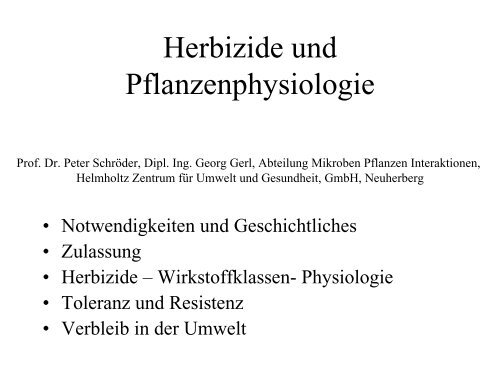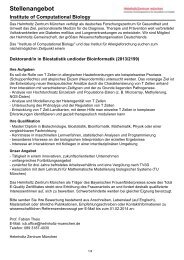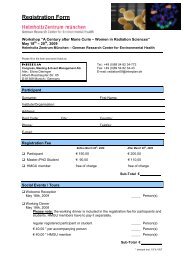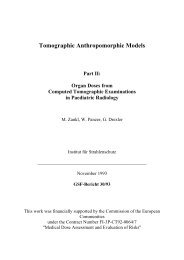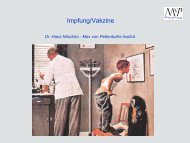Wirkstoffe im chemischen Pflanzenschutz - Helmholtz Zentrum ...
Wirkstoffe im chemischen Pflanzenschutz - Helmholtz Zentrum ...
Wirkstoffe im chemischen Pflanzenschutz - Helmholtz Zentrum ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Herbizide und<br />
Pflanzenphysiologie<br />
Prof. Dr. Peter Schröder, Dipl. Ing. Georg Gerl, Abteilung Mikroben Pflanzen Interaktionen,<br />
<strong>Helmholtz</strong> <strong>Zentrum</strong> für Umwelt und Gesundheit, GmbH, Neuherberg<br />
• Notwendigkeiten und Geschichtliches<br />
• Zulassung<br />
• Herbizide – Wirkstoffklassen- Physiologie<br />
• Toleranz und Resistenz<br />
• Verbleib in der Umwelt
Angst vor der Landwirtschaft
Malthus und die Folgen…
Grenzen des Wachstums
Scenario 10 - Sustainability<br />
• In Scenario 10 people in the s<strong>im</strong>ulated world decide on an<br />
average family size of two starting in 1995, and they have<br />
available effective birth control technologies. They also set<br />
themselves a consumption l<strong>im</strong>it.<br />
• When every family attains roughly the material standard of<br />
living of present-day Europe, it says "enough" and turns its<br />
attention to achieving other, nonmaterial goals.<br />
• Furthermore, starting in 1995, this world puts a high<br />
priority on developing and <strong>im</strong>plementing technologies that<br />
increase the efficiency of resource use, decrease pollution<br />
emissions, control land erosion, and increase land yields.
Nutzpflanzen und „Unkräuter“<br />
• 160 Nutzpflanzenarten<br />
• 0,06 % der Gesamtflora<br />
• 12 der wichtigsten Arten<br />
aus 5 Pflanzenfamilien<br />
• Stellen 75 % der<br />
globalen Nahrung<br />
• 250 Unkrautarten<br />
• 0,1 % der Gesamtflora<br />
• 70 % der Arten in 12<br />
Pflanzenfamilien<br />
• 40 % Gräser und<br />
Korbblütler<br />
• Familien identisch
Unkräuter sind Pflanzen ohne direkten<br />
wirtschaftlichen Nutzen für den Menschen, die<br />
in Plantagen mit Nutzpflanzen um Ressourcen<br />
konkurrieren, den Ertrag herabsetzen, die Ernte<br />
behindern oder die Qualität mindern.
Globalisierung ?
Der Krieg ist der Vater aller Dinge...<br />
Neophyt:<br />
Franzosenkraut<br />
Galinsoga parviflora<br />
G. ciliata<br />
Aus Botanischen Sammlungen ...<br />
als Kontamination in Pferdefutter<br />
Ähnlich:<br />
Kastanie eingewandert durch<br />
Römische Besetzung v. Chr.<br />
Wichtig: Geschwindigkeit<br />
der Ausbreitung anthropogen<br />
unterstützt
Neophyt<br />
ist eine Pflanze, die ab dem Jahre 1492 nach Mitteleuropa gelangt ist. Die<br />
Jahreszahl mutet auf den ersten Blick etwas kurios an. Mit der Entdeckung<br />
(oder Wiederentdeckung?) Amerikas durch Columbus beginnt aber der<br />
transkontinentale Schiffsverkehr und damit die bewusste Einführung und die<br />
unbeabsichtigte Einschleppung von Arten entfernter Kontinente.<br />
Eingeschleppte Arten, die an das mitteleuropäische Kl<strong>im</strong>a nur schlecht<br />
angepasst sind, treten meist nur vorübergehend auf (Ephemerophyten).<br />
Manche Arten können sich nur auf naturfernen Standorten behaupten<br />
(Industriophyten). relativ wenige Arten schaffen es, in mehr oder weniger<br />
natürliche Biotope einzudringen (Agriophyten).
Archäophyten<br />
Archäophyten sind bereits seit prähistorischer oder frühester historischer<br />
Zeit in einem Gebiet eingebürgerte Pflanzen. Die meisten Arten wurden<br />
mit dem Ackerbau und den größeren Siedlungen seit der Jungsteinzeit<br />
eingeschleppt bzw. eingebürgert. Dazu zählen viele Kulturpflanzen wie<br />
Weizen oder Wein sowie die meisten Ackerunkräuter (Kornblume etc.).<br />
Aber auch Baumarten wie Esskastanie (Castanea sativa) und<br />
Walnuss (Juglans regia) wurden schon zur Römerzeit in kl<strong>im</strong>atisch<br />
begünstigten Gebieten Deutschlands kultiviert und werden heute nur<br />
noch von den wenigsten Menschen als „Fremdländer“ empfunden.<br />
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/~botanik/bex-neol.html
Name deutscher Name Familie ursprüngliche He<strong>im</strong>at Besonderheiten<br />
Acer negundo Eschenahorn Aceraceae Nordmaerika<br />
teilw. in Auenwäldern<br />
eigebürgert<br />
Ailanthus altiss<strong>im</strong>a Götterbaum S<strong>im</strong>aroubaceae Ostasien Parkbaum, gern verwildernd<br />
Aristolochia<br />
clematitis<br />
Osterluzei Aristolochiaceae Mittelmeergebiet<br />
ehemalige Heilpflanze,<br />
Kulturrelikt, Weinbaugebiete<br />
Armoracia rusticana Meerrettich Brassicaceae SO-Europa bei uns keine Samenbildung!<br />
Buddleja davidii Sommerflieder Buddlejaceae China<br />
Conyza canadensis<br />
Kanadisches<br />
Berufkraut<br />
Datura stramonium Stechapfel Solanaceae<br />
Echinochloa crus-<br />
galli<br />
Echinops<br />
sphaerocephalos<br />
Elodea canadensis<br />
Elodea nuttallii<br />
Asteraceae Nordamerika<br />
südliches<br />
Nordamerika<br />
Zierpflanze; oft auf warmen<br />
Ruderalflächen verwildert;<br />
sehr beliebt bei<br />
Schmetterlingen<br />
<strong>im</strong> 17.Jhdt. eingeschleppt,<br />
Ruderalpflanze<br />
halluzinogen; früher für sog.<br />
Asthmazigarren verwendet.<br />
Hühnerhirse Poaceae ? weltweit verschleppt<br />
Kugeldistel Asteraceae Südeuropa<br />
Wasserpest Hydrocharitaceae Michigan<br />
Eranthis hyemalis Winterling Ranunculaceae Südeuropa<br />
an trocken-warmen Stellen<br />
eingebürgerte<br />
Bienenfutterpflanze<br />
Anfänglich<br />
Massenentwicklung (E. c.) bis<br />
zur Blockade von<br />
Wasserwegen; später (ab ca.<br />
1900) ökologisch "eingefügt"<br />
in Weinbergen verwildert;<br />
blüht schon <strong>im</strong> Februar
Galinsoga<br />
parviflora<br />
Helianthus<br />
tuberosus<br />
Heracleum<br />
mantegazzianum<br />
Impatiens<br />
glandulifera<br />
Impatiens<br />
parviflora<br />
Franzosenkraut Asteraceae Südamerika<br />
Topinambur Asteraceae Nordamerika<br />
Herkulesstaude Apiaceae Kaukasus<br />
drüsiges oder<br />
indisches<br />
Springkraut<br />
kleinblütiges<br />
Springkraut<br />
Balsaminaceae Südasien<br />
Balsaminaceae NO-Asien<br />
Juncus tenuis Zarte Binse Juncaceae Nordamerika<br />
Lupinus<br />
polyphyllus<br />
Matricaria<br />
discoidea<br />
Lupine Fabaceae Nordamerika<br />
strahlenlose<br />
Kamille<br />
Asteraceae Nordamerika<br />
angeblich von Napoleons<br />
Truppen eingeschleppt<br />
essbare Wurzelknolle<br />
(Inulin), Schnapsherstellung;<br />
in Baden teilw. verwildert;<br />
bis 2,5 m hohe<br />
Blütensprosse, giftig<br />
(übelste Hautausschläge!)<br />
durch Furokumarine<br />
Massenbestände an<br />
Bachufern,<br />
"Bauernorchidee"<br />
1837 aus einem Berliner<br />
Botanischen Garten<br />
verwildert<br />
Klebsame; von den<br />
Indianern als "Spur des<br />
Weißen Mannes"<br />
bezeichnet, da nur auf<br />
Waldwegen auftretend.<br />
durch bittere Alkaloide<br />
giftig<br />
als Heilpflanze eingeführt;<br />
1852 aus Berlin-Schöneberg<br />
entwichen
Mercurialis annua<br />
einjähriges<br />
Bingelkraut<br />
Euphorbiaceae Mittelmeergebiet<br />
Oenothera biennis Nachtkerze Onagraceae Nordamerika<br />
Ornithogalum<br />
umbellatum<br />
Oxalis fontana<br />
wärmeliebend, Blaufärbung<br />
der Milch / Rotfärbung des<br />
Urins bei Vieh (nicht giftig!)<br />
Seit 1619 in Europa, aber<br />
Arten von den NA Eltern<br />
verschieden (Artbildung!).<br />
Genetisch turbo-interessant.<br />
Doldiger Milchstern Liliaceae Mittelmeerraum Weinberge, Feldwegränder<br />
Europäischer<br />
Sauerklee<br />
Oxalidaceae Nordamerika<br />
Phacelia tanacetifolia Büschelschön Hydrophyllaceae Kalifornien<br />
Physalis alkekenghi<br />
Reynoutria japonica<br />
/ sachalinensis<br />
Robinia pseudoacacia<br />
Senecio inaequidens<br />
Solidago gigantea<br />
S. canadensis<br />
Blasenkirsche,<br />
Lampionblume<br />
Solanaceae Südamerika<br />
Staudenknöterich Polygonaceae Ostasien<br />
Robinie<br />
Scheinakazie<br />
Falsche Akazie<br />
Schmalblättriges<br />
Greiskraut<br />
Riesengoldrute<br />
Kanad. Goldrute<br />
Fabaceae Nordamerika<br />
Asteraceae Südafrika<br />
Asteraceae Nordamerika<br />
Veronica persica Persischer Ehrenpreis Scrophulariaceae wo wohl?<br />
gelbblühend, Schlafstellung<br />
der Blattfiedern b Starklicht<br />
Zierpflanze und Bienen-weide;<br />
an warmen Stellen jetzt häufig<br />
verwildert<br />
in warmen Lagen (Wein-<br />
berge); Früchte essbar<br />
Problempflanze an Bachufern,<br />
bis 3 m hoch, vegetativ durch<br />
Rhizomteile, Ausrottung<br />
schwierig<br />
Stipulardornen; Pionierge-<br />
hölz; benannt nach dem Pariser<br />
Gärtner Robin<br />
langer Weg durch ganz Afrika;<br />
1. dt Vorkommen bei Bremen;<br />
mittlerweile an Mitteleuropa<br />
angepasst.<br />
verbreitete sehr ausdau-ernde<br />
Pioniere auf Brachen<br />
Aus dem botanischen Garten in<br />
Karlsruhe geflüchtet (1805)
• Physiologie<br />
• Rasches Wachstum<br />
• Spross und Wurzel<br />
gleichermaßen<br />
• Hohe<br />
Photosyntheseleistung<br />
• Vegetativ > reproduktiv<br />
• Rasche Akkl<strong>im</strong>atisierung<br />
an wechselnde<br />
Umweltbedingungen<br />
Charakteristika erfolgreicher Unkräuter<br />
• Reproduktion<br />
• Selbstbefruchtend<br />
• Hohe Samenproduktion<br />
• Stets Blütenbildung<br />
• Windblütler<br />
• Keine Insektenspezifität<br />
• Agronomie<br />
• Ähnlichkeit zur<br />
Nutzpflanze<br />
• Samenreife bei Ernte<br />
• Herbizidresistenz<br />
• Vegetative Regeneration<br />
• Lange Ke<strong>im</strong>fähigkeit<br />
• Ke<strong>im</strong>ung übers Jahr<br />
möglich<br />
Die Evolution der Unkräuter hat<br />
nicht stattgefunden unter dem Druck der Herbizide,<br />
vielleicht unter dem Druck des Ackerbaus (Neolithikum)<br />
sicher aber als natürliche Auslese in Kompetition um Lebensraum<br />
und Reproduktion
Chemischer <strong>Pflanzenschutz</strong><br />
• Erste Ansätze <strong>im</strong> 19. Jahrhundert (anorganische Chemikalien:<br />
Kalk, Eisensulfat, Schwefelsäure, Kupfersulfat, Natriumchlorat,<br />
ätzende Düngemittel [Hederichkaninit, Kalkstickstoff])<br />
• Erstes organisches Herbizid: DNOC (4,6-Dinitro-o-cresol)<br />
• 40er Jahre: 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyessigsäure), MCPA (2-<br />
Methyl-4-chlorophenoxyessigsäure)<br />
• Nach dem 2. Weltkrieg rasche Zunahme der Produktpalette<br />
50 % der weltweit verwendeten <strong>Pflanzenschutz</strong>mittel sind Herbizide<br />
Herbizideinsatz in Kulturen:<br />
Getreide 80 – 95 % Rüben, Mais: 100 % Raps: 80-95 %<br />
Kartoffel: ca. 30 % Obstbau: ca. 60 % Grünland ca. 5 %<br />
Wald/Forst: ca. 1 %
Herbizid-Klassifizierung (HRAC)<br />
• A Inhibitoren der Lipidbiosynthese<br />
• B Inhibitoren der verzweigtkettigen Aminosäuren<br />
• C Photosystem II-Inhibitoren<br />
• D Photosystem I-Inhibitoren (Entkoppler)<br />
• E Protoporphyrinogen-oxidase Inhibitoren<br />
• F Inhibitoren der Pigment-Biosynthese<br />
• G EPSP-Synthase Inhibitoren<br />
• H Glutamin-Synthase Inhibitoren<br />
• I DHP Inhibitoren<br />
• K Zellteilungs-Hemmer<br />
• L Inhibitoren der Cellulosesynthese<br />
• M Entkoppler<br />
• N ACCase Inhibitoren<br />
• O Synthetische Auxine<br />
• P Auxin-Transport-Inhibitoren<br />
• Z Unbekannte Targets
Künstliche Auxine
Erste Herbizide: DNOC und 2,4-D<br />
DNOC als Insektizid patentiert<br />
Herbizide Wirksamkeit erkannt<br />
Parallele Synthesen führen zu 2,4-D<br />
1942 als Warfare agent....<br />
1945 Einführung als Herbizid
Phenoxyessigsäuren
Phenoxyessigsäuren sind Hormonanaloga
Wirkung künstlicher Auxine
Protonenausstrom nach Auxinbehandlung
Schwergewichte in der Wurzel
Gravitropismus<br />
• Statolithenstärke dient der Vermittlung des<br />
Schwerereizes<br />
• Stärkekörner lagern auf dem ER. Aber: kein<br />
Schwerereiz, sondern anderes Signal<br />
• ER verändert die Abgabe von Metaboliten:Auxin?<br />
• Unterbrechung des Protonentransports in die<br />
Wand<br />
• Wachstumsstop auf der „Unterseite“
Wirkungsweise der Auxine
Rezeptor für Auxin (ABP)
Phenoxyessigsäure - Entgiftung<br />
Hormone:<br />
Geringe Wirkkonzentrationen<br />
Hohe Spezifität am Rezeptor<br />
Rasche Wirkung<br />
Schnelle Reaktivierung des Rezeptors<br />
Künstliche Auxine:<br />
Hohe Aufwandsmenge<br />
Hohe Spezifität<br />
Metabolismus ist reversibel
Künstliche Auxine und<br />
Aufwandsmengen
Chemistry replaces the hoe!<br />
• Pro US $ Ausgaben für Herbizide 5 $ Gewinn<br />
• Arbeitszeitersparnis: 1 Std statt 6 Std pro Hektar<br />
• In Europa: Mangel an Arbeitskräften<br />
• Erhöhung der Ertragssicherheit<br />
• Industrielle Revolution: alles ist möglich<br />
• Technologiegläubigkeit<br />
• Aber: DNOC-Vergiftungen, Agent Orange…<br />
• Aber…..
Unkraut<br />
MCPA<br />
1945<br />
Mecoprop<br />
1957<br />
Dichlorprop<br />
1961<br />
Clopyralid<br />
1975<br />
Mischungen<br />
Dicamba +<br />
Mecoprop<br />
+<br />
MCPA<br />
Benazolin<br />
+<br />
clopyralid<br />
Sinapis arvensis S S S S S<br />
Capsella bursa-pastoris S S S S S<br />
Chenopodium album S S S S S<br />
Quinmerac<br />
1985<br />
Galium aparine R S S S S S<br />
Stellaria media R S S S S<br />
Polygonum lapathifolium R R S S S<br />
Polygonum persiaca R R S S S<br />
Bilderdykia convolvulus R R S S S<br />
Tripleurospermum marit<strong>im</strong>um R R R S S S<br />
Cirsium arvense R R S S R S<br />
Veronica hederifolia R R R R R S<br />
Lamium purpureum R R R R S S<br />
Martin 1987
Integrierter <strong>Pflanzenschutz</strong><br />
Schema des Integrierten <strong>Pflanzenschutz</strong>es<br />
Integrierter <strong>Pflanzenschutz</strong> bedeutet:<br />
Alle Schadensbegrenzungsfaktoren<br />
sind auszunutzen, um die Schaderreger<br />
unter der wirtschaftlichen<br />
Schadensschwelle zu halten.<br />
Verfahrensweisen:<br />
• biologisch<br />
• biotechnisch<br />
• anbau- und kulturtechnisch<br />
• physikalisch (z. B. mechanisch, thermisch)<br />
• chemisch (<strong>Pflanzenschutz</strong>mittel)<br />
• pflanzenzüchterisch<br />
Fachbeirat<br />
Naturhaushalt<br />
1.10
Wirtschaftliche Schadensschwelle/1<br />
Getreide<br />
1<br />
Schadensschwelle entscheidet<br />
über eine Bekämpfungsmaßnahme<br />
z. B. bei Ungräsern bzw. Unkräutern<br />
Ermittlung der:<br />
–Schaderregerdichte<br />
Befallsstärke von Schaderregern<br />
bzw. Grad der Verunkrautung,<br />
die gerade noch geduldet<br />
werden können<br />
–Schadenshöhe<br />
–Bekämpfungskosten<br />
Bekämpfungsmaßnahmen nur,<br />
wenn die zu erwartenden Verluste<br />
höher sind als die Kosten<br />
Ziel der Schwellenwertermittlung:<br />
–Verbesserung der Wirtschaftlichkeit<br />
–Umweltschonung<br />
–Ertragssicherung<br />
–Produktqualität<br />
Fachbeirat<br />
Naturhaushalt<br />
1.11
Wirtschaftliche Schadensschwelle/2<br />
Kartoffelkäfer<br />
ca. 15 Larven pro Kartoffelstaude<br />
Rapsglanzkäfer<br />
Winterraps vital geschwächt<br />
sehr früh 3 - 4 1 - 2 Käfer/Pflanze<br />
früh 7 - 8 3 - 4 Käfer/Pflanze<br />
spät > 8 > 4 Käfer/Pflanze<br />
Sommerraps: 2 Käfer/Pflanze<br />
Gelbrost/Braunrost (Getreide)<br />
Bei gelben Streifen bzw. braunen Rostpusteln<br />
auf den Blättern sofort reagieren!<br />
Peronospora (Wein)<br />
Bei „Ölflecken“ auf der Blattoberseite<br />
sofort reagieren!<br />
Fachbeirat<br />
Naturhaushalt<br />
1.12
Unverzichtbarkeit des<br />
Integrierten <strong>Pflanzenschutz</strong>es <strong>im</strong> Ackerbau<br />
Gelbrost<br />
Braunrost<br />
Weizen, Gerste, Roggen<br />
Beispiel: Gelb- und Braunrost (Rostpilze)<br />
• Weltweites Auftreten<br />
• Oft epidemischer Verlauf<br />
durch Sporenflug<br />
• Witterungsabhängig<br />
• Überwinterung auf Ausfallgetreide<br />
Ertragseinbußen bei Gelbrostbefall<br />
können über 50 % betragen!<br />
Bekämpfung:<br />
• Sortenwahl<br />
• Rechtzeitiger Fungizideinsatz<br />
Fachbeirat<br />
Naturhaushalt<br />
1.13
Anwendungsverfahren<br />
Düsenabstand 50 cm<br />
<br />
ca. 12 cm<br />
<br />
Bandbreite ca.<br />
15 cm<br />
Einzelpflanzenbehandlung<br />
Teilflächenbehandlung<br />
Ganzflächenbehandlung<br />
Bandspritzung<br />
Saat- und<br />
Pflanzgutbehandlung<br />
• Beizung (meist Fungizide)<br />
• Pillierung (Fungizide + Insektizide)<br />
• Tauchbehandlung (Fungizide, Insektizide<br />
+ Bakterizide)<br />
Pflanzen- und<br />
Bodenbehandlung<br />
• Spritzen (hydraulisches Zerstäuben)<br />
• Sprühen (Ausbringen mit<br />
Gebläseunterstützung)<br />
• Nebeln (Tröpfchenschleierbildung)<br />
• Streuen von Granulaten<br />
• Angießen<br />
• Be<strong>im</strong>ischen zu Anzuchterden<br />
• Räuchern und Begasen (in geschl. Räumen)<br />
• Bodenentseuchung<br />
Fachbeirat<br />
Naturhaushalt<br />
1.17
Teilflächenspezifischer <strong>Pflanzenschutz</strong><br />
Institut für Bodenökologie<br />
• Ziel ist die Anwendung eines Real-T<strong>im</strong>e-Verfahrens, gleichzeitige<br />
Erfassung des Unkrauts und Herbizidausbringung<br />
• CCD-Kamera n<strong>im</strong>mt Grauwertbilder auf, aus Binärbildern<br />
werden Konturbilder erstellt und diese mit Musterpflanzen<br />
verglichen<br />
• gezieltere Unkrautbekämpfung<br />
• Einsparung der Herbizidmenge durch teilflächenspezifisches<br />
Erkennen des Unkrautbefalles<br />
• Geringere Belastung von Grundwasser und Umwelt
Applikationsart
Applikationstechnik<br />
Raumkulturen<br />
Flächenkulturen<br />
Grundlegende Anforderungen<br />
• <strong>Pflanzenschutz</strong>geräteliste der BBA<br />
• 2-jährige Kontrolle der Feldspritzgeräte<br />
• Brüheaufwandmenge genau berechnen<br />
• Düsenwahl (Flachstrahl-, Rundstrahl-,<br />
Injektordüsen)<br />
• Spritzdruckeinstellung<br />
• Tropfengröße beachten (vollständige<br />
Benetzung)<br />
• Windstärke und -richtung beachten<br />
• Fahrgeschwindigkeit einhalten<br />
(Tacho überprüfen)<br />
• Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit<br />
beachten<br />
• Waschwasserbehälter zur <strong>Pflanzenschutz</strong>-<br />
gerätereinigung auf dem Feld<br />
Fachbeirat<br />
Naturhaushalt<br />
1.18
Verlustmindernde Technik<br />
Tunnelgerät<br />
Axialsprühgerät mit Abdeckblech<br />
Raumkultur<br />
90 % Abtriftreduzierung<br />
• Tunnelgerät (Obst- und Weinbau),<br />
1-, 2- oder 3-zeilig<br />
• Axialsprühgerät mit Injektordüsen<br />
und Abdeckblech (Hopfenanbau)<br />
Flächenkultur<br />
50 % oder 75 % Abtriftreduzierung<br />
• Injektordüsen<br />
+ Druckverminderung<br />
+ reduzierte Fahrgeschwindigkeit<br />
Fachbeirat<br />
Naturhaushalt<br />
1.19
Gesetzliche Regelungen<br />
Kulturlandschaft<br />
Naturlandschaft<br />
<strong>Pflanzenschutz</strong>gesetz (PflSchG)<br />
<strong>Pflanzenschutz</strong>mittelverordnung<br />
<strong>Pflanzenschutz</strong>-Sachkundeverordnung<br />
<strong>Pflanzenschutz</strong>-Anwendungsverordnung<br />
als Basis:<br />
Richtlinie der EU über das<br />
Inverkehrbringen von<br />
<strong>Pflanzenschutz</strong>mitteln<br />
(91/414/EWG)<br />
national<br />
international<br />
Fachbeirat<br />
Naturhaushalt<br />
2.1
Landesgesetze zum Naturschutz<br />
Herbizidanwendung auf Feldrain<br />
Landesgesetze zu Naturschutz<br />
und Landespflege<br />
Geregelt sind u. a. :<br />
• Abbrennen der Bodendecke<br />
• Behandlung mit chem. Mitteln<br />
• Rodung<br />
• Schnitt<br />
Fachbeirat<br />
Naturhaushalt<br />
2.2.b
Verminderung von<br />
Abtrift und Abschwemmung<br />
Abtrift<br />
Maßnahmen zur Verminderung:<br />
• Abstand zum Gewässer<br />
• verlustarme Applikationstechnik<br />
(z. B. Verwendung von Injektordüsen)<br />
Abschwemmung<br />
Maßnahmen zur Verminderung:<br />
• unbehandelte Randstreifen mit<br />
geschlossener Pflanzendecke<br />
• Mulch- oder Direktsaatverfahren<br />
• Auffangsysteme<br />
Fachbeirat<br />
Naturhaushalt<br />
2.10