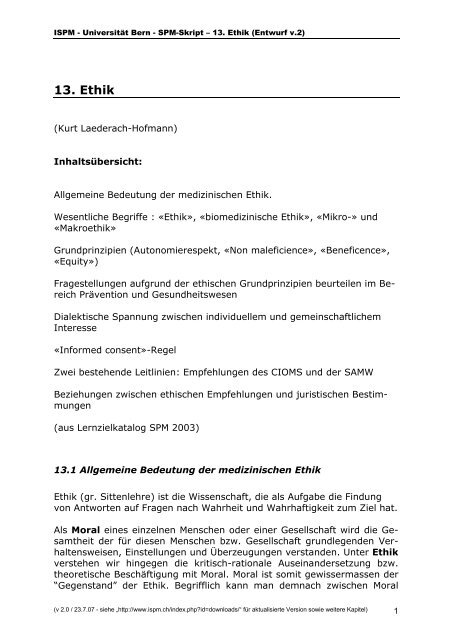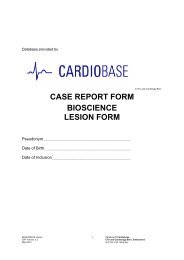13. Ethik
13. Ethik
13. Ethik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
<strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong><br />
(Kurt Laederach-Hofmann)<br />
Inhaltsübersicht:<br />
Allgemeine Bedeutung der medizinischen <strong>Ethik</strong>.<br />
Wesentliche Begriffe : «<strong>Ethik</strong>», «biomedizinische <strong>Ethik</strong>», «Mikro-» und<br />
«Makroethik»<br />
Grundprinzipien (Autonomierespekt, «Non maleficience», «Beneficence»,<br />
«Equity»)<br />
Fragestellungen aufgrund der ethischen Grundprinzipien beurteilen im Bereich<br />
Prävention und Gesundheitswesen<br />
Dialektische Spannung zwischen individuellem und gemeinschaftlichem<br />
Interesse<br />
«Informed consent»-Regel<br />
Zwei bestehende Leitlinien: Empfehlungen des CIOMS und der SAMW<br />
Beziehungen zwischen ethischen Empfehlungen und juristischen Bestimmungen<br />
(aus Lernzielkatalog SPM 2003)<br />
<strong>13.</strong>1 Allgemeine Bedeutung der medizinischen <strong>Ethik</strong><br />
<strong>Ethik</strong> (gr. Sittenlehre) ist die Wissenschaft, die als Aufgabe die Findung<br />
von Antworten auf Fragen nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit zum Ziel hat.<br />
Als Moral eines einzelnen Menschen oder einer Gesellschaft wird die Gesamtheit<br />
der für diesen Menschen bzw. Gesellschaft grundlegenden Verhaltensweisen,<br />
Einstellungen und Überzeugungen verstanden. Unter <strong>Ethik</strong><br />
verstehen wir hingegen die kritisch-rationale Auseinandersetzung bzw.<br />
theoretische Beschäftigung mit Moral. Moral ist somit gewissermassen der<br />
“Gegenstand” der <strong>Ethik</strong>. Begrifflich kann man demnach zwischen Moral<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 1
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
und <strong>Ethik</strong> unterscheiden. Allerdings handelt es sich in der Praxis dabei aber<br />
nicht um einen scharfen Unterschied, sondern eher um einen fliessenden<br />
Übergang.<br />
Die Ausdrücke ‘ethisch’ und ‘moralisch’ werden im Alltag häufig wertend<br />
verwendet, so etwa in Bewertungen wie eine Handlung sei unethisch oder<br />
unmoralisch. Eine solche (ab-)wertende Verwendung der erwähnten Ausdrücke<br />
gibt es bei unserer terminologischen Festlegung nicht: Ob ein<br />
Thema oder die theoretische Beschäftigung in dem hier festgelegten Sinn<br />
ethisch ist bzw. zur <strong>Ethik</strong> gehört oder nicht, hängt nämlich ausschliesslich<br />
von ihrem Inhalt ab, mit dem sich der Handelnde (der Arzt) auseinandersetzen<br />
muss.<br />
Folgende Tabelle stellt vereinfachend die wichtigsten Begriffe dar:<br />
<strong>Ethik</strong>: befasst sich mit der Erforschung<br />
der Verhaltensnormen oder –regeln<br />
(Regelethik, Normethik), der Analyse<br />
der Werte und den Überlegungen<br />
über die Grundlagen von Verpflichtungen<br />
(Deontologische <strong>Ethik</strong>)<br />
oder Werten. Daneben beschäftigt<br />
sie sich mit der Verwirklichung der<br />
Werte in konkreten Situationen.<br />
Bioethik: Wertebedingte (normethische) Diskussion<br />
um die verantwortungsvol-<br />
Biomedizinische<br />
<strong>Ethik</strong>:<br />
le menschliche Lebensführung.<br />
kann als <strong>Ethik</strong> des ganzen Gesundheitsbereiches<br />
verstanden werden.<br />
und schliesst damit die Beschäftigung<br />
mit allen ethischen Fragen im<br />
Bereich der Medizin, Biologie, Psychologie<br />
und Gesundheit, des Gesundheitswesens<br />
und des Wohlbefindens<br />
mit ein. (Bereich des Public<br />
Health inkl. Prävention)<br />
Mikroethik: beschäftigt sich aus der Perspektive<br />
der Klinik oder Forschung mit<br />
individuellen Fällen. Sie ist somit<br />
auf die individuelle Ebene bezogen<br />
(von Bedeutung für den Alltag des<br />
Klinikers und praktizierenden Arztes)<br />
Makroethik: befasst sich im gesellschaftlichen<br />
Rahmen im mit dem Gleichgewicht<br />
der Rechte und mit den zu<br />
errichtenden sozialen und rechtlichen<br />
Strukturen bzw. deren ethi-<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 2
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
schen Bedingtheiten.<br />
Auch Entwicklungen und Massnahmen<br />
auf individueller Ebene<br />
können Auswirkungen auf gesellschaftlicher<br />
Ebene haben und erfordern<br />
entsprechende Hinterfragung<br />
(ganzheitliche Betrachtungsweise).<br />
<strong>13.</strong>2 Pluralität der <strong>Ethik</strong>-Konzepte und <strong>Ethik</strong> in der Medizin<br />
Die Frage nach dem, was jemand tun darf oder tun soll, steht im Mittelpunkt<br />
jeder ethischen Reflexion. Liberale Rechtsstaaten schützen und respektieren<br />
die Freiheit unterschiedliche moralische Positionen zu vertreten.<br />
Wer hingegen verantwortlich handeln will, sollte sein Handeln, Unterlassen<br />
und Verhalten sorgfältig prüfen. Insbesondere im Verhältnis von Ärzten<br />
und Patienten ist es für letztere wichtig zu wissen, inwiefern Ärzte ihr Tun<br />
auch ethisch reflektieren. Doch nicht immer geben wir ausdrücklich Rechenschaft;<br />
oft kann man sich mit dem begnügen, was üblicherweise erwartet<br />
wird. Sobald wir jedoch ausdrücklich darüber reflektieren, ob die<br />
herrschende Moral richtig ist, anerkannt werden soll und womöglich allgemeine<br />
Geltung beanspruchen darf, nehmen wir eine distanziertere, beobachtende<br />
Perspektive ein. In diesem Sinne kann man die „<strong>Ethik</strong>“ die<br />
„Reflexion“ oder „Theorie der Moral“ nennen.<br />
<strong>13.</strong>3 Warum <strong>Ethik</strong> in der Medizin?<br />
Jeder, der handelt, muss seine Handlungen begründen können. Dies gilt<br />
besonders in der Medizin: Obgleich es beispielsweise aus mikrobiologischer<br />
Sicht klar ist, dass dieses oder jenes Antibiotikum zur erfolgreichen<br />
Behandlung einer Infektion verwendet werden kann, muss der Arzt entscheiden,<br />
ob und unter welchen Umständen er zu einer Handlung schreitet<br />
(beispielsweise dem Patienten das Antibiotikum injiziert) oder ob er es ihm<br />
in der ambulanten Behandlung lediglich nahelegt, oder in einer besonderen<br />
Situation darauf verzichtet, es dem Patienten zu geben. Diese „moralischen“<br />
bzw. bewertenden Elemente sind es, die ethisch begründbar sein<br />
müssen.<br />
<strong>Ethik</strong> in der Medizin (auch „medizinische <strong>Ethik</strong>“) ist deshalb ein Spezialgebiet<br />
der „angewandten <strong>Ethik</strong>“ („applied ethics“). Angewandte <strong>Ethik</strong> heisst:<br />
Anwendung ethischer Theorien, Prinzipien, Argumentationsformen und<br />
Entscheidungsverfahren auf Probleme, Fragen und Herausforderungen, die<br />
sich im Zusammenhang mit bestimmten gesellschaftlichen Funktionsbereichen,<br />
Institutionen und Berufen stellen. <strong>Ethik</strong> in der Medizin ist angewand-<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 3
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
te <strong>Ethik</strong>, die sich im weitesten Sinne auf das „Gesundheitswesen“ erstreckt.<br />
Medizinische <strong>Ethik</strong> handelt 1 von spezifischen beruflichen Herausforderungen<br />
und Pflichten und ist somit eine Berufs- oder „Standesethik“. Sie fragt<br />
vor allem nach der Gebotenheit, Erlaubtheit oder Nicht-Zulässigkeit bestimmter<br />
Entscheidungen, Handlungen, Unterlassungen und Verhaltensweisen<br />
von Medizinalpersonen unter verschiedenen Bedingungen. Sie betrifft<br />
2 im Wesentlichen spezielle, regelmässig wiederkehrende Probleme im<br />
Bereich ärztlichen und pflegerischen Handelns. Oft sind dies Probleme, die<br />
zu einem grossen Teil mit typischen Lebenssituationen zusammenhängen<br />
wie Empfängnis und Geburt, Leiden und Heilung, Alter und Tod. Die Medizinethik<br />
fragt hier nach Grundsätzen für handlungsleitende Regeln und<br />
nach den Problemen ihrer Anwendung 3 .<br />
Während besonders in der Naturwissenschaft und somit in einem wesentlichen<br />
Teil der Medizin und Biologie beschreibende (deskriptive) und faktische<br />
Fragen interessieren, beschäftigt sich <strong>Ethik</strong> mit wertenden (normativen)<br />
Fragen.<br />
Durch den gesellschaftlichen Wertepluralismus haben sich in der Medizin<br />
ethische Fragestellungen und Diskussion über Normen und Werte in den<br />
letzten Jahren akzentuiert. So gibt es in der Medizin die grundsätzliche<br />
Frage, ob in schwierigen Entscheiden Einigkeit in normativen oder deskriptiven<br />
Fragen möglich ist. Solche Überlegungen sind – bedingt durch die<br />
erhöhte Sensibilisierung der Öffentlichkeit via Medien – nicht mehr aus<br />
dem Alltag der ärztlichen Tätigkeit wegzudenken.<br />
Als Beispiele für normative (syn. „wertende“) Fragen können gelten 4 :<br />
- Ist es gut, die Organe zur Transplantation freizugeben?<br />
- Soll die Ärztin passive Sterbehilfe zu leisten.<br />
- Darf der Arzt die Behandlung abbrechen?<br />
Auf der anderen Seite lassen sich oft bei deskriptiven (faktischen) Fragen<br />
eher konsensuelle Lösungen finden:<br />
- Wie gross ist die Überlebenschance?<br />
- Wie lange dauert die Operation?<br />
- Wie viel Blut hat die Patientin verloren?<br />
1 Zur Einführung und Übersicht vgl. Dietrich Ritschl, Art. Medizinische <strong>Ethik</strong>, EKL 3. Aufl., Bd. 3, 1992, 349-356<br />
2 Siehe hierzu Heinz Eduard Tödt, Versuch einer ethischen Theorie sittlicher Urteilsfindung, in: ders., Perspektiven<br />
theologischer <strong>Ethik</strong>, München 1988, 21-48; Hermann Ringeling, Ethische Normativität und Urteilsfindung, in:<br />
ders., Christliche <strong>Ethik</strong> im Dialog. Beiträge zur Fundamental- und Lebensethik II, Fribourg-Freiburg-Wien 1991,<br />
107-131<br />
3 Die wesentlichsten Anteil dieses Abschnittes gehen auf die Medizinervorlesung von W. Lienemann (Bern) zurück<br />
und wurden durch Inhalte aus Diskussionen mit G. Maio (Zürich) und D. Hell (Zürich) ergänzt.<br />
4 Zitiert nach R. Givel, Crash-Course in Medizinischer <strong>Ethik</strong> für Medizinstudierende<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 4
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
<strong>13.</strong>4 Allgemeine Bedeutung der Biomedizinischen <strong>Ethik</strong><br />
Wie aus dem obigen Beispiel hervorgeht, stellen ethische Fragen in Medizin<br />
und Gesundheitswesen eine tägliche Herausforderung dar. Andererseits<br />
ist anzunehmen, dass die Bedeutung ethischer Fragestellungen zukünftig<br />
durch finanzielle Restriktionen im Gesundheitswesen, die Bewertungen<br />
ökonomischer Eingriffe etc. weiter zunehmen wird. Abgesehen von<br />
individuellen ethischen Fragen beschäftigen uns in Medizin und Gesundheitswesen<br />
heute im Wesentlichen folgende Fragen:<br />
- Arzt-Patienten-Beziehung und Therapie<br />
- Non-Compliance<br />
- Sterbehilfe (aktive, passive, indirekt aktive)<br />
- Ansteckungsgefahr (HIV, HCV, Tbc etc.)<br />
- Experimente am Menschen (GCP (good clinical practice) -Richtlinien)<br />
- medizinisch unterstützte Fortpflanzung (IVF)<br />
- Früherfassung genetischer Prädispositionen (Pränatal- oder Präimplantationsdiagnostik)<br />
- Eingriffe in die Erbmasse (Gentherapie, Stammzellenforschung),<br />
- rechtliche Grenzen für die Forschung<br />
- Verteilung von Mitteln innerhalb des Gesundheitswesens (Allokationsfragen)<br />
- Kosten der Spitzenmedizin (Organtransplantation)<br />
- Konkurrenz zwischen kurativer und präventiver Medizin<br />
- Qualitätssicherung im Gesundheitswesen<br />
Aus dieser, nicht abschliessenden Liste geht unmittelbar hervor, dass eine<br />
ärztliche Tätigkeit ohne ethische Überlegungen undenkbar ist.<br />
Rischl unterscheidet medizinethische Problemfelder, die sich überlappen:<br />
- Arzt-Patient Beziehungen (Ebene personaler Interaktionen)<br />
- Gesundheitspolitik und -versorgung (Ebene der strukturellen Probleme)<br />
- Gesundheitserwartungen/Gesundheitsverhalten (kulturelle Ebene)<br />
Die meisten Überlegungen zur <strong>Ethik</strong> in der Medizin gehen von der Sicht<br />
der Medizinalpersonen (Mikroethik) aus; ihre primären Adressaten sind<br />
Ärzte und Pfleger. Das ist richtig, insofern diese Menschen letztendlich<br />
massgeblich die meisten Interaktionen und Entscheidungen im Gesundheitswesen<br />
bestimmen. Auf der anderen Seite ist es hingegen nötig, regelmässig<br />
auch in die Lage der übrigen Beteiligten zu versetzen: der Gesunden<br />
und Kranken, ihrer Angehörigen, der Laboranten und Pharmaforscher,<br />
der Krankenhausverwalter und der Krankenkassen-Beitragszahler,<br />
nicht zuletzt auch der Politiker und vor allem Finanzpolitiker, die für Allokationsentscheidungen<br />
im Gesundheitswesen zuständig sind (Makroethik).<br />
Weiter behandelt die <strong>Ethik</strong> in der Medizin strukturelle Probleme des Gesundheitswesens<br />
einer Gesellschaft oder im internationalen Zusammen-<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 5
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
hang. Sie setzt sich insbesondere mit neuen technischen Entwicklungen<br />
und den ökonomischen Grundlagen und Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens<br />
auseinander. Schliesslich geht es um spezifische kulturelle<br />
Erwartungen an das Gesundheitswesen, das Verständnis der Menschen<br />
von Gesundheit, Krankheit und Tod und die besonderen Weisen des<br />
Umganges mit entsprechenden Grenzerfahrungen von Menschen in verschiedenen<br />
Kulturen 5 .<br />
Da vielmals nicht nur der Arzt, sondern im besonderen der sich einer Behandlung<br />
unterziehende Patient oder der freiwillig an einer Studie teilnehmende<br />
Proband von denselben Fragen betroffen sind, wurden die ethischen<br />
Richtlinien des sog. „Informed Consent“ ausgearbeitet, zu dessen<br />
Einhaltung sich die Ärzteschaft durch Standesregeln verpflichtet hat.<br />
Der Informed Consent beinhaltet im Besonderen die Aufklärung, die Risikoabschätzung,<br />
die Bewertung der Notwendigkeit einer medizinischen<br />
Massnahme, die Folgen bei Aussetzen bspw. der vorgeschlagenen<br />
Therapie und die Eröffnung der Einholung einer Zweitmeinung über<br />
die zu treffende Massnahme.<br />
Der Informed Consent setzt einen urteils- bzw. verhandlungsfähigen Patienten<br />
oder Probanden voraus. Somit werden direkt oder indirekt folgende<br />
4 BIOEHTISCHE PRINZIPIEN tangiert:<br />
1. Autonomie<br />
2. Non-Malefizienz (nicht schaden)<br />
3. Gerechtigkeit<br />
4. Fürsorge<br />
Während Autonomie die Selbstbestimmung menschlichen Entscheidens<br />
und Handelns bedeutet, setzt dieser Begriff auch voraus, dass der Betroffene<br />
frei von Zwang sein muss (darüber nachzudenken ist hier kein Platz;<br />
die Überlegung, wie zwangsfrei der Status eines Patienten allerdings ist,<br />
lohnt sich trotzdem hier anzufügen). Gleichzeitig wird impliziert, dass der<br />
Betroffene sich einer angepassten Information über Vor- und Nachteile<br />
einer Massnahme, Therapie oder medizinischen Intervention (auch einer<br />
Medikation!) bedienen kann.<br />
Diese Voraussetzung ist jedoch in vielen medizinischen Entscheidungsphasen<br />
nicht (mehr) gegeben oder anzunehmen. Somit kann davon ausgegangen<br />
werden, dass im oft unfreiwilligen Übergang vom „freien Bürger“<br />
zum „Patient“ Teile der Autonomie verloren gehen oder abgegeben werden<br />
müssen. Dieser Problematik hat sich die Epoche der Aufklärung gewidmet,<br />
doch bestehen die Probleme selbstverständlich heute ebenso weiter<br />
wie damals. Damit wird die Grenze zwischen Sein und Sollen, zwischen<br />
Ideal und Wirklichkeit deutlich.<br />
5 Vgl. Markus Zimmermann-Acklin, Töten und Sterbenlassen: ethische Aspekte der gegenwärtigen Euthanasie-<br />
Diskussion, in: Alberto Bondolfi/Hansjakob Müller (Hrsg.), Medizinische <strong>Ethik</strong> im ärztlichen Alltag, Basel-Bern<br />
1999, 363-379<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 6
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
Im Bestreben des Arztes, Teile der vom Patienten oft mutuell abgetretenen<br />
Autonomie im Sinne und Interessen desselben und zu vertreten, führen<br />
direkt zur Frage der sog. Fürsorge. Die Geschichte zeigt, dass sich die<br />
Ärzteschaft vieler dieser Fragen nicht bewusst war, bzw. durch bestimmte<br />
gesellschaftliche Normen die Frage der Fürsorge nicht zwangsläufig zu<br />
Gunsten des Patienten, sondern vielmehr zu Gunsten der Gesellschaft<br />
auslegte (man denke dabei an die Tötungen im 3. Reich oder an die<br />
Zwangssterilisationen behinderter Frauen bis in die 70-iger Jahre in der<br />
Schweiz). In dieser Situation war es deshalb nötig, Rechtsnormen aufzustellen,<br />
die den Patienten vor dem Arzt und umgekehrt auch den Arzt vor<br />
Ansprüchen des Patienten schützen. Dazu haben auch standesethische<br />
Regulative beigetragen, wie sie in den Richtlinien der Schweizerischen Akademie<br />
der Medizinischen Wissenschaften laufend aktualisiert, d.h. den<br />
neuen medizinischen Gegebenheiten bzw. der aktuellen ethischen und<br />
rechtlichen Normvorstellungen angepasst werden.<br />
Es gibt damit – philosophisch argumentiert – keinen sog. „pflichtfreien<br />
Raum“ für den Arzt. Ebenso wie Aufklärung besonders bei der Wahl von<br />
Behandlungsmöglichkeiten oder bei höherem Schweregrad der Krankheit<br />
absolute Pflicht ist, kann kein medizinischer Eingriff ohne Einwilligung des<br />
Patienten erfolgen, weil er sonst den juristischen Tatbestand einer Körperverletzung<br />
darstellt.<br />
In denselben Kontext gehören die Auseinandersetzung mit den Fragen der<br />
Verteilung von Mitteln (Allokation) bzw. der Gerechtigkeit und das Prinzip<br />
des Nicht-Schadens (Non-Malefizienz). Um diese Begriffe näher zu charakterisieren,<br />
schieben wir hier einen kurzen Exkurs über ethische Argumentation<br />
ein.<br />
<strong>13.</strong>5 EXKURS: Ethische Argumentation<br />
Wie lassen sich normative (= wertende) Sätze begründen?<br />
Normative Sätze lassen sich logisch herleiten. Als Beispiel einer gültigen<br />
Herleitung eines normativen Satzes diene:<br />
p1<br />
Das Töten eines Menschen ist immer schlecht.<br />
p2 Jeder menschliche Embryo ist ein Mensch.<br />
Das Töten eines Embryos ist immer schlecht.<br />
Eine logische Herleitung ist genau dann valid (= korrekt/gültig), wenn es<br />
ausgeschlossen ist, dass die Konklusion (= hergeleiteter Satz) falsch ist,<br />
obwohl alle Prämissen (= Voraussetzungen) wahr sind. Die Herleitung der<br />
obigen Konklusion ist also logisch korrekt. Trotzdem könnte die Konklusion<br />
falsch sein. Jedoch ist kein logischer Schluss mit normativer Konklusion<br />
gültig, der nicht mindestens einen normativen Satz als Prämisse setzt.<br />
Wer eine normative Konklusion ausschliesslich aus deskriptiven Sätzen<br />
ableitet, begeht einen sogenannten naturalistischen Fehlschluss<br />
(G. E. Moore: „naturalistic fallacy“). Damit stellt sich das Problem des<br />
infiniten Regresses (=Begründung ohne Ende): Leitet man einen normativen<br />
Satz u.a. aus einem normativen Satz ab, so muss sich dieser wieder<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 7
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
aus einem normativen Satz ableiten usw. Um den infiniten Regress zu<br />
vermeiden, muss die Richtigkeit mindestens eines normativen Satzes behauptet<br />
werden können, ohne dass sich diese durch logische Ableitung<br />
begründen lässt.<br />
Erfahrungsgemäss sind wir uns bei zahlreichen normativen Sätzen uneinig.<br />
Aus dieser Tatsache zu schliessen, dass keine Einigung bezüglich der<br />
zu setzenden normativen Sätzen möglich ist, wäre allerdings voreilig:<br />
Dass jemand die normative Konklusion des obigen Beispiels bestreitet,<br />
kann daran liegen, dass er im Gegensatz zu jemand anderem der deskriptiven<br />
Prämisse p1 nicht zustimmt. Uneinigkeit bezüglich normativer Sätze<br />
kann also auf Uneinigkeit bezüglich deskriptiver Sätze zurückzuführen<br />
sein. Dieses Phänomen können wir vermeintlichen Wertestreit nennen 6<br />
und dieser ist weit häufiger in medizinischen Diskussionen anzutreffen, als<br />
man gemeinhin annehmen könnte.<br />
Um auszuschliessen, dass die Uneinigkeit bezüglich deskriptiver Sätze die<br />
Suche nach intersubjektiv anerkannten normativen Sätzen beeinträchtigt,<br />
unterscheiden wir wie folgt:<br />
Intrinsisch ist ein normativer Satz, wenn er unabhängig von der<br />
Wahrheit deskriptiver Sätze wahr oder falsch ist;<br />
Extrinsisch ist ein normativer Satz, wenn er abhängig von der Wahrheit<br />
mindestens eines deskriptiven Satzes wahr oder falsch ist.<br />
Da alle apriorischen (=unabhängig von sinnlicher Erfahrung erkennbaren)<br />
Sätze auch notwendig (=in jeder logisch möglichen Welt) wahr sind, müssen<br />
intrinsische Sätze notwendigerweise wahr sein.<br />
Aus dem Unterschied zwischen Angewandter <strong>Ethik</strong> und Normativer <strong>Ethik</strong><br />
ergibt sich die übliche Zweiteilung in:<br />
- Aufgabe der Normativen <strong>Ethik</strong> ist es, die wahren intrinsischen Sätze<br />
herauszufinden;<br />
- Aufgabe der Angewandten <strong>Ethik</strong> (z.B. medizinische <strong>Ethik</strong>) ist es, die<br />
wahren extrinsischen Sätze herauszufinden. Die Beantwortung von Fragen<br />
der Angewandten <strong>Ethik</strong> hängt demnach von der Normativen <strong>Ethik</strong><br />
ab, die der Beantwortung zugrunde liegt.<br />
Im Verlaufe der Philosophiegeschichte haben sich zwei grosse normativethische<br />
Traditionen entwickelt: Der Konsequentialismus und die Deontologie.<br />
Konsequentialistische (teleologische {Gr. VWXYZ: Ziel}) Theorien bewerten<br />
Handlungen aufgrund ihrer Konsequenzen. Zu den Konsequentialisten<br />
gehören u.a. Bentham, Mill, Sidgwick und Singer. Im Konsequentialismus<br />
gibt es grob gesagt zwei unterschiedliche Formen, nämlich der Egoismus<br />
und der Utilitarismus. Beide halten sie das Hervorrufen angenehmer<br />
Empfindungen für gut und das Hervorrufen negativer Empfindungen für<br />
schlecht. Während der Egoist aber nur die eigenen Empfindungen für rele-<br />
6 Selbst wenn beide der deskriptiven Prämisse zustimmen und bezüglich der normativen Prämisse uneinig sind,<br />
kann diese Uneinigkeit auf eine Uneinigkeit bezüglich deskriptiver Sätze zurückzuführen sein. Enthält die zur<br />
normativen Prämisse führende Begründung ihrerseits eine deskriptive Prämisse, so sind die beiden vielleicht<br />
bezüglich dieser uneinig.<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 8
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
vant betrachtet, bewertet der Utilitarist die Empfindungen aller Wesen<br />
gleichwertig. Geht der Utilitarist an eine Fragestellung der angewandten<br />
<strong>Ethik</strong>, so fragt er in der Regel zuerst nach den empfindungsfähigen Wesen,<br />
die in die Folgen der Handlungen involviert sind. Dann versucht er,<br />
die angenehmen und unangenehmen Empfindungen abzuschätzen und<br />
gegeneinander abzuwägen.<br />
Deontologische {Gr. \WY]: Pflicht, ^W_: ich muss} Theorien bewerten<br />
Handlungen nicht aufgrund ihrer Konsequenzen, jedenfalls nicht ausschliesslich.<br />
Wichtige Vertreter dieser <strong>Ethik</strong> sind Kant, Nagel und Williams.<br />
Es gibt Deontologen – unter ihnen Immanuel Kant – die keinerlei utilitaristische<br />
Werte akzeptieren. Ihnen zufolge sind die Handlungen unabhängig<br />
ihrer Konsequenzen wahr oder falsch. Ein solcher Deontologe kann eine<br />
Liste aller gebotenen und eine Liste aller verbotenen Handlungen erstellen<br />
(Versprechen halten, nicht töten, nicht lügen etc.). Heute anerkennen jedoch<br />
die meisten Deontologen utilitaristische Werte, limitieren diese aber<br />
durch gewisse gebotene und verbotene Handlungen. Viele von ihnen heben<br />
aber diese Limitierungen wieder auf, wenn die Konsequenzen besonders<br />
deutlich vorauszusehen sind und besonders deutlich ausfallen. Die<br />
meisten Deontologen sind anthropozentrisch. Das heisst die Liste verbotener<br />
und gebotener Handlungen betreffen nur Menschen. Das Tötungsverbot<br />
etwa bedeutet dann, dass nur Menschen nicht getötet werden dürfen,<br />
Tiere und Pflanzen hingegen schon 2 .<br />
<strong>13.</strong>6 Problemfelder der <strong>Ethik</strong> in der Medizin im engeren Sinne<br />
Ethische Reflexion setzt immer dann ein, wenn zwischen verschiedenen<br />
Handlungsmöglichkeiten gewählt werden kann und womöglich gewählt<br />
werden muss. <strong>Ethik</strong> als Reflexion bezieht sich immer auf Wahlmöglichkeiten,<br />
die letztlich ihren Grund in menschlicher Freiheit haben. Wie Menschen<br />
von ihrer Freiheit Gebrauch machen, darüber sind sie rechenschaftsfähig<br />
und rechenschaftspflichtig. Nur auf dem Boden der Freiheit<br />
entsteht so etwas wie menschliche Verantwortung; hier aber wird sie unabweisbar.<br />
Sie nicht wahrzunehmen oder bei einer rechenschaftspflichtigen<br />
Wahl zu versagen, kann einen Menschen schuldig werden lassen.<br />
Diese auf die Fähigkeit und Pflicht zur Verantwortung bezogene Schuld<br />
kann wiederum rechtlicher (legaler) oder sittlicher (moralischer) Art sein.<br />
Es gibt immer wieder Situationen, wo jemand – auch als Ärztin oder Pfleger<br />
oder Finanzverwalter – im rechtlichen Sinn als unschuldig befunden<br />
wird und sich doch selbst moralisch als schuldig empfindet.<br />
Wie oben summarisch bereits angeführt, betreffen die wichtigsten Problemfelder<br />
der <strong>Ethik</strong> in der Medizin Entscheidungen in Situationen, in denen<br />
nicht nur aufgrund medizinischer Überlegungen, sondern auch mit ethischen,<br />
also normativen (=wertenden) Gründen gewählt werden muss.<br />
2 Ein wesentlicher Anteil dieses Exkurses geht auf die Arbeit von R. Givel (Bern) zurück.<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 9
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
Diese Fragen konzentrieren sich bemerkenswerterweise auf Beginn und<br />
Ende des Lebens (siehe S. 4).<br />
Hinzu kommen als allerdings oft vernachlässigte Bereiche der <strong>Ethik</strong> in der<br />
Medizin zwei Problemfelder:<br />
- Ethische Probleme des Umganges mit Langzeit- und chronisch kranken<br />
Patienten, besonders auch ethische Probleme im Umgang mit<br />
psychisch kranken Menschen<br />
- Ethische Probleme der Prävention und Rehabilitation<br />
Neu hinzugekommen sind vor allem ethische Fragen, die sich auf die Erweiterung<br />
technischer Möglichkeiten und die (wirtschaftlichen) Grenzen<br />
der Finanzierbarkeit medizinischer Leistungen beziehen:<br />
- Organtransplantation und Xenotransplantation<br />
- Forschung an Embryonen und Stammzellen<br />
- intergenerationelle somatische Gentherapie<br />
Auf der einen Seite stehen die hochtechnisierten Möglichkeiten, auf der<br />
anderen Seite der Zugang zu massenwirksamen, bezahlbaren Basismedikamenten<br />
oder zur Prävention. Dies ist die Problematik der Allokation<br />
bzw. (Verteil-)Gerechtigkeit.<br />
Urteilsbildung in der medizinischen <strong>Ethik</strong>: Das Vorgehen<br />
Die meisten medizinischen Entscheidungen, die Gegenstand expliziter oder<br />
impliziter ethischer Reflexion sind oder sein sollten, sind nicht von der Art,<br />
dass aus ethischen Prinzipien fallweise konkretisierende Handlungsanweisungen<br />
abgeleitet werden könnten. Am Beginn praktischer Überlegungen<br />
zur <strong>Ethik</strong> in der Medizin stehen vielmehr in der Regel konkrete Probleme<br />
und Herausforderungen.<br />
Die explizite ethische Reflexion im Blick auf konkrete Probleme der Medizin<br />
bildet den engeren Kern der angewandten <strong>Ethik</strong>. Es hat sich weithin<br />
bewährt, diese Reflexion in bestimmten, aufeinander bezogenen Schritten<br />
zu vollziehen, also methodisch einem Schema der ethischen Urteilsbildung<br />
zu folgen. Dabei geht man so vor, dass man im Blick auf einen Fall oder<br />
ein bestimmtes Problem zuerst versucht, das Problemfeld zu strukturieren<br />
und insbesondere Handlungsalternativen aufzuzeigen, sodann nach den<br />
einschlägigen Gütern, Normen oder Werten fragt, um schliesslich zu einem<br />
– oft vorläufigen – zusammenfassenden Urteilsentscheid zu gelangen.<br />
Beispiel:<br />
Ein 32-jähriger, an einem unheilbaren Hirntumor leidender Patient, der<br />
noch im vollen Besitz seiner geistigen Fähigkeiten ist, wünscht vom behandelnden<br />
Arzt die „Todesspritze“, zum Zeitpunkt, wenn ihn seine psychischen<br />
oder physischen Kräfte verlassen sollten und er unter starken,<br />
kaum erträglichen Schmerzen leiden würde. Arzt und Patient stimmen in<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 10
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
der Beurteilung überein, dass in diesem Stadium keine Hoffnung auf Genesung<br />
oder auf die Erhaltung einer als menschenwürdig empfundenen<br />
Lebensqualität mehr gegeben sei. Der Patient versichert, dass auch seinen<br />
Angehörigen mit seinem Wunsch nach einer aktiven Sterbehilfe einverstanden<br />
seien. Der Arzt zögert, dem Patienten ohne weiteres die Erfüllung<br />
seines Wunsches für jeden Fall zuzusagen und bittet um Bedenkzeit bis<br />
zum nächsten Gespräch mit dem Patienten.<br />
Die nachfolgende Tabelle 7 gibt Auskunft über eine mögliche Strategie der<br />
ethischen Reflexion des oben angeführten Beispiels. Dabei erscheint vor<br />
allem wichtig, dass alle nachfolgend angeführten Elemente in einer ethischen<br />
Argumentationskette berücksichtigt werden.<br />
1. Medizin-wissenschaftliche Befunde<br />
- Diagnose<br />
- Prognose<br />
- Therapiemöglichkeiten<br />
- Ökonomie<br />
- Nützlichkeit für den Patienten<br />
- Nutzen/Schaden<br />
- Behandlungsressourcen<br />
2. Medizin-ethische Befunde<br />
- Gesundheit und Lebensqualität des Patien-<br />
ten<br />
- Selbstbestimmung<br />
- Wertsystem des Patienten<br />
- Stv. des Patienten<br />
- Ärztliche Verantwortung<br />
3. Zusatzfragen<br />
- Konsistenz der Behandlung<br />
- Folgekosten (Angehörige, Gemeinschaft)<br />
- Güterabwägung<br />
- Studie: informed consent<br />
4. Problemlösung<br />
- Lösungsoptionen<br />
- Verpflichtung gegenüber neuen Patienten<br />
- Argument für und gegen den Entscheid<br />
- Zustimmung des Patienten, Gesellschaft<br />
Schema der Elemente ethischer Urteilsbildung<br />
1. Problembestimmung:<br />
7<br />
Verändert nach Vorgaben des Bochumer Arbeitsbogens der Medizinethik, (Autoren: Sass & Viefhues) durch K.<br />
Laederach-Hofmann und W. Lienemann<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 11
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
Wahrnehmung eines Sachverhaltes als problematisch - Erfahrungen, Erwartungen,<br />
Kontext, Wahlfreiheiten.<br />
Vordergründig besteht das ethische Problem im skizzierten Fall nur darin,<br />
das Pro und Contra hinsichtlich aktiver Sterbehilfe zu klären. Aber schon<br />
die Frage nach dem, was hier der Fall ist, ist nicht einfach zu beantworten.<br />
Was ist überhaupt „Sterbehilfe“? Meist versteht man darunter das Töten<br />
oder Sterbenlassen eines auf den Tod kranken, schwer leidenden Menschen.<br />
Dabei muss man freilich folgende Näherbestimmungen unterscheiden:<br />
a Sterbebegleitung: Aufmerksamkeit, Hilfe und Begleitung bei Sterbenden<br />
(vgl. besonders die Einrichtungen der Hospizbewegung)<br />
b Passive Euthanasie: Verzicht auf medizinische „Überbehandlung“ bei einem<br />
schwer leidenden, todkranken Patienten (Therapieverzicht/-abbruch)<br />
c Indirekte Euthanasie: Therapien oder Schmerzbehandlung mit lebensverkürzender<br />
Wirkung<br />
d Aktive Euthanasie (Tötung auf Verlangen): Verabreichung eines Mittels<br />
zur möglichst schmerzlosen (Selbst-)Tötung (Bereitstellung oder Verabreichung<br />
des Mittels)<br />
5 Aktive Euthanasie (ohne Verlangen des Patienten): strafrechtlich Mord<br />
oder Totschlag<br />
Diese Unterscheidungen beziehen sich in der Regel auf Patienten, die irreversibel<br />
und todkrank sind. Daneben gibt es wenigstens drei Fallgruppen,<br />
bei denen sich ebenfalls die Frage einer Sterbehilfe stellen kann:<br />
- Menschen im chronisch vegetativen Zustand („persistent vegetative<br />
state“ – PVS)<br />
- Menschen mit der sicheren Prognose einer schweren, mehr oder weniger<br />
nicht therapierbaren Krankheit (Alzheimer, Chorea Huntington, unheilbarer<br />
Tumor)<br />
- Menschen mit chronischen, äusserst schmerzhaften Krankheiten einschliesslich<br />
schwerer Depressionen in Verbindung mit Suizidabsichten<br />
In unserem Fall geht es also um einen Eventualwunsch unter Voraussetzung<br />
einer bestimmten, zuverlässigen Diagnose einer unheilbaren Krankheit.<br />
Folgende Aspekte sind in diesem Falle noch zu berücksichtigen:<br />
a) Die gesellschaftlichen Wahrnehmungen hinsichtlich der Antastbarkeit<br />
oder Unantastbarkeit des Lebens von Menschen<br />
b) Die Auswirkungen auf das Verhältnis von Ärzten und Patienten unter<br />
der Bedingung, dass menschliches Leben nicht mehr unantastbar ist<br />
2. Situationsanalyse:<br />
Kontext von Problemen - enger oder weiter gefasst. Zuordnung zu beruflichen<br />
und/oder politischen Kompetenzen, wissenschaftlichen Disziplinen,<br />
gesellschaftlichen Zusammenhängen. Erfassung von problemrelevanten<br />
Zielvorstellungen (Gütern, Zwecken). Bevor man die Kriterienfrage erörtert,<br />
muss der tatsächlich gegebene Handlungsspielraum betrachtet werden.<br />
Dazu gehören wenigstens folgende Hinweise:<br />
a) Strafrechtlich: Gemäss Art. 114 StGB ist in der Schweiz (und ähnlich<br />
in Deutschland) aktive direkte Sterbehilfe verboten. Suizidbeihilfe<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 12
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
wird nur dann bestraft, wenn sie aus selbstsüchtigen Gründen erfolgt<br />
(115 StGB), aber unterlassene Hilfeleistung bei suizidgefährdeten<br />
Personen ist strafbar. Die Abgrenzung der Tatbestände erfolgt<br />
gemäss der Zurechenbarkeit von Handlungen und Unterlassungen<br />
zum jeweiligen Willen von Patient und Arzt.<br />
b) Gesellschaftspolitisch: Es ist wichtig, sich die aktuellen Fragestellungen,<br />
Kontexte und Probleme der Euthanasiedebatte zu vergegenwärtigen.<br />
Dazu gehören u.a. folgende Aspekte:<br />
- Die Debatte um Rationierung im Gesundheitswesen und vor<br />
diesem Hintergrund eine zunehmende Bereitschaft, in Grenzfällen<br />
aus Kostengründen medizinische Leistungen zu begrenzen.<br />
- Ein gesellschaftlich verbreitetes Verständnis von Gesundheit<br />
und eine entsprechende Intoleranz gegenüber „behindertem“<br />
Leben (Druck in Richtung perinatale Diagnostik unter Einschluss<br />
der Bereitschaft zum Schwangerschaftsabbruch)<br />
- Ein verbreiteter Diskurs über die „Überalterung“ der Gesellschaft<br />
- Neuere Vorstellungen von Verbesserung der genetischen Basis<br />
einer Population (Eugenik)<br />
c) Insgesamt gehört zu einer sensiblen Problemwahrnehmung auch die<br />
Rechenschaft darüber, ob und inwiefern menschliches Leben zunehmend<br />
unter Nützlichkeitsgesichtspunkten wahrgenommen wird.<br />
3. Verhaltensoptionen:<br />
Bestimmung von Spielräumen, Alternativen, konkreten Wahlfreiheiten<br />
(Möglichkeiten der Zielwahl und der Mittelwahl). Bestimmung und Erläuterung<br />
des eigenen Verhältnisses (einschliesslich der eigenen Affekte) zu<br />
den sinnvollen Optionen. Hypothetische und vergleichende Folgenabschätzungen.<br />
Im gewählten Fallbeispiel soll das angenommene Zögern des Arztes darauf<br />
verweisen, dass es häufig nicht auf schnelle Entscheidungen, sondern<br />
auf sorgfältige Überlegungen und Abwägungen ankommt. In der Wahrnehmungsperspektive<br />
des Arztes können folgende Gesichtspunkte eine<br />
wichtige Rolle spielen:<br />
- Respekt vor der Autonomie des Patienten<br />
- Berücksichtigung der besonderen biographischen Bedingungen und<br />
des familiären Umfeldes des Patienten<br />
- Unterscheidungsvermögen zwischen einem aktuell geäusserten<br />
Wunsch eines Patienten und der künftigen Gesundheits- oder Krankheitsgeschichte<br />
Welche Optionen ein Arzt in einer Situation wie der angenommenen erkennt<br />
und wahrnimmt, ist letztlich auch abhängig von dem gesammelten<br />
und reflektierten Erfahrungswissen im Umgang mit vergleichbaren Patienten.<br />
Die vermutlich schwierigste Alternative bezeichnet die Entscheidung<br />
zwischen dem (bekundeten oder mutmasslichen) Willen eines Patienten<br />
und dem Leben des Patienten (voluntas versus salus).<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 13
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
4. Normenprüfung:<br />
Beschreibung und Analyse problemrelevanter Normen unterschiedlicher<br />
Art (technisch/rechtlich/sittlich). Der Normbegriff ist in der gesamten medizinischen<br />
<strong>Ethik</strong> problematisch. Ein pragmatisch brauchbarer soziologischer<br />
Normbegriff betrifft wechselseitige Erwartungen von Menschen; danach<br />
sind Normen kontrafaktisch stabilisierte Verhaltenserwartungen<br />
(Luhmann).<br />
Der rechtliche Begriff der Norm stellt das nach geltender Rechtsauffassung<br />
Erlaubte, Zulässige oder Gebotene heraus, welchem zuwiderzuhandeln<br />
Sanktionen auslösen kann. Schliesslich gibt es technisch-professionelle<br />
Normen, welche die übliche Handlungskompetenz in einem Beruf wie der<br />
Medizin betreffen und damit gleichzeitig „Kunstfehler“ zu bezeichnen ermöglichen.<br />
Darüber hinaus gibt es ethische Normen, die sich dadurch auszeichnen,<br />
dass sie erstens nicht bloss rechtlich oder technisch definiert<br />
und sanktionsfähig sind, und dass sie zweitens nicht allgemein verbindlich<br />
vorgeschrieben werden können.<br />
Diese Unterscheidung von Legalität und Moralität ist für den neuzeitlichen<br />
Rechtsstaat grundlegend. Von Rechts wegen kann von Ärzten nicht<br />
mehr verlangt werden, als dass sie ihre Profession im Rahmen der für alle<br />
Bürger geltenden gesetzlichen Regeln korrekt ausüben. Hinsichtlich der<br />
sittlichen Verpflichtungen muss jede Ärztin und jeder Arzt indes sich selbst<br />
und anderen darüber Rechenschaft geben, welchen Kriterien er oder sie<br />
folgt.<br />
Nach Lienemann 8 unterscheidet man hier folgende Typen:<br />
Legalist: entscheidend ist nur, was von Recht und Gesetz gefordert ist<br />
(passive Euthanasie nach Massgabe geltenden Rechts).<br />
Utilitarist: entscheidend ist – im Rahmen der Gesetze - was ein Patient<br />
als für ihn selbst nützlich ansieht (passive und indirekte Euthanasie nach<br />
Massgabe von Gesetz und Patientenwille).<br />
Prinzipialist: entscheidend ist – über die korrekte Gesetzestreue hinaus -<br />
die allgemeine Befolgung moralischer Prinzipien ohne Ansehung der konkreten<br />
Lebensumstände (von den konkreten Umständen unabhängige Ablehnung<br />
jeder Euthanasie ebenso wie grundsätzliche Anerkennung jedes<br />
Patientenwillens).<br />
Kreationist: entscheidend ist die einzelfallbezogene, biographische Besonderheiten<br />
umfassend berücksichtigende Orientierung an den konkreten<br />
Lebensumständen eines Patienten (auch unter Vernachlässigung dessen<br />
Willens im Grenzfall).<br />
Unterscheiden muss man in diesen Fragen übrigens stets zwischen der<br />
faktischer Anerkennung und der problematischen Geltung von Normen.<br />
Überdies beziehen sich alle Normen auf "Güter", das heisst auf erstrebte<br />
und geschätzte Gegenstände des menschlichen Strebens wie Gesundheit,<br />
Selbstbestimmung, Überleben, Erhaltung der eigenen Würde und dergleichen.<br />
Hier kann es zu Konflikten zwischen Gütern und Normen kommen,<br />
8 Wolfgang Lienemann, Vorlesung <strong>Ethik</strong> für Medizinstudierende<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 14
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
wenn beispielsweise lebenserhaltende Massnahmen in der subjektiven<br />
Perspektive der Betroffenen mit deren Verständnis von selbstverantwortlicher<br />
Lebensführung kollidieren.<br />
Die Reflexion der Gründe und Begründungen für konfliktträchtige Normen<br />
im ärztlichen Alltag sollte daher an Fällen geübt und in der Praxis immer<br />
wieder mit Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich reflektiert werden.<br />
5. Verbindlichkeitsprüfung:<br />
Erläuterung von Geltungserwartungen, Verallgemeinerungsansprüchen;<br />
Zumutbarkeitsprüfung und Bestimmung von Abweichungstoleranzen.<br />
Im gewählten Beispiel kann ein Aspekt der Verbindlichkeitsprüfung darin<br />
gefunden werden, als dass der Patient versichert, dass seine Angehörigen<br />
seine Auffassung und seinen Wunsch teilten. Jeder Patient ist grundätzlich<br />
ein Mensch in Beziehungen zu anderen. Darum ist es so entscheidend<br />
wichtig, dass Medizinalpersonen die Patienten im Gefüge ihrer Familie und<br />
Freundschaften bewusst wahrnehmen. In einer derartigen sozialen Konstellation<br />
sind wiederum unterschiedliche normative Vorstellungen und<br />
Normenkonflikte unvermeidlich.<br />
6. Synthese:<br />
Vorschlag und Urteilsentscheid<br />
7. Rückblick:<br />
Adäquanzkontrolle<br />
Hier bleibt zu betonen, dass es ausserordentlich wichtig sein dürfte, dass<br />
Medizinalpersonen sich und ihrer Mitwelt regelmässig und sorgfältig Auskunft<br />
über ihre handlungsleitenden Gründe und Entscheidungen geben.<br />
Gerade in Grenzbereichen wie dem der Sterbehilfe sollten zudem Ärzte<br />
regelmässig die beratende Hilfe von Supervisoren in Anspruch nehmen.<br />
Probleme<br />
Es ist leicht einzusehen, dass die einzelnen Momente der Urteilsbildung<br />
sich überschneiden; insbesondere gehen schon in die Problembestimmung<br />
in der Regel normative Vorstellungen ein.<br />
Das vorgeschlagene Schema hat deshalb vor allem den Zweck, die eigene<br />
Aufmerksamkeit so zu steuern, dass im Beratungsfall die Argumentation<br />
für die Adressaten hinreichend transparent wird und sie den Weg zur Findung<br />
eines Beratungsvorschlages nachvollziehen können. Schematas folgen<br />
rational-kognitiven Prämissen und setzen kompetente, einem rationalen<br />
Diskurs zugetane Subjekte voraus.<br />
Von einer solchen Argumentation ausgenommen bleiben oft traditionale,<br />
affektive und charismatische Elemente bei den meisten Ziel- und Mittelwahlen.<br />
Gerade Ärzte sollten sich aufgrund ihrer naturwissenschaftlich orientierten<br />
Ausbildung gegen diese Dimension ihres Tuns nicht abschotten.<br />
Ein Schema setzt zudem als Kontext eine Art toleranter, demokratischer<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 15
ISPM - Universität Bern - SPM-Skript – <strong>13.</strong> <strong>Ethik</strong> (Entwurf v.2)<br />
Öffentlichkeit voraus. Diese ist aber in vielen Gesellschaften keineswegs<br />
gegeben. Umso wichtiger ist, dass sich auch die Medizinalpersonen an den<br />
öffentlichen gesundheitspolitischen Auseinandersetzungen mit der Kraft<br />
guter Argumente beteiligen.<br />
<strong>13.</strong>7 Schlussbetrachtungen<br />
Ziel dieser kurzen Übersicht und Anleitung zur ethischen Argumentation<br />
war es, dem Studierenden vorzuführen, dass einige Grundlagen zur differenzierten<br />
ethischen Begründung der Tätigkeit in der Medizin notwendig<br />
sind. Darin sind einerseits die Kenntnisse des aktuellen Rechts vorausgesetzt<br />
und andererseits auf unsere Traditionen beruhende ethischmoralische<br />
Aspekte zu berücksichtigen. Während für erstere klare Normen<br />
und auch Sanktionen vorhanden sind, gelten letztere als Leitlinien und haben<br />
demnach empfehlenden Charakter. Dies ist wichtig zu wissen, zumal<br />
bei schwierigen Entscheiden diese letzteren Aspekte oft den Stellenwert<br />
einer Rechtsverbindlichkeit erhalten, die sie nicht haben. Dennoch muss<br />
betont werden, dass es entscheidend ist, sich über den aktuellen Stand<br />
dieser Richtlinien zu informieren. Während für die praktische ärztliche Tätigkeit<br />
die Leitlinien der SAMW (Schweizerische Akademie der Medizinischen<br />
Wissenschaften) herangezogen werden können, gelten für andere<br />
Bereiche des Gesundheitssystems die Leitlinien der CIOMS (Council for<br />
International Organizations of Medical Sciences). In einer freiheitlich organisierten<br />
Gesellschaft wie der unsrigen sind neben der Einhaltung der<br />
rechtlichen Vorgaben auch die Vertretung eigener ethischer und moralischer<br />
Werte und Vorstellungen wichtig. Wir möchten Allen Mut machen,<br />
diese zu differenzieren und in den Dialog einzubringen.<br />
(v 2.0 / 23.7.07 - siehe „http://www.ispm.ch/index.php?id=downloads/“ für aktualisierte Version sowie weitere Kapitel) 16