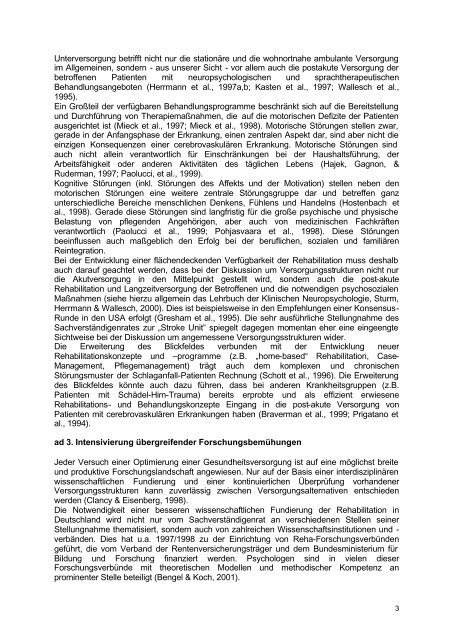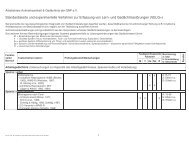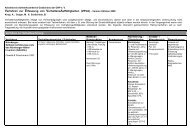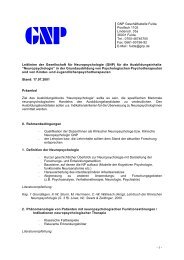Stellungnahme zur Versorgungssituation hirngeschädigter Pa… - GNP
Stellungnahme zur Versorgungssituation hirngeschädigter Pa… - GNP
Stellungnahme zur Versorgungssituation hirngeschädigter Pa… - GNP
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Unterversorgung betrifft nicht nur die stationäre und die wohnortnahe ambulante Versorgung<br />
im Allgemeinen, sondern - aus unserer Sicht - vor allem auch die postakute Versorgung der<br />
betroffenen Patienten mit neuropsychologischen und sprachtherapeutischen<br />
Behandlungsangeboten (Herrmann et al., 1997a,b; Kasten et al., 1997; Wallesch et al.,<br />
1995).<br />
Ein Großteil der verfügbaren Behandlungsprogramme beschränkt sich auf die Bereitstellung<br />
und Durchführung von Therapiemaßnahmen, die auf die motorischen Defizite der Patienten<br />
ausgerichtet ist (Mieck et al., 1997; Mieck et al., 1998). Motorische Störungen stellen zwar,<br />
gerade in der Anfangsphase der Erkrankung, einen zentralen Aspekt dar, sind aber nicht die<br />
einzigen Konsequenzen einer cerebrovaskulären Erkrankung. Motorische Störungen sind<br />
auch nicht allein verantwortlich für Einschränkungen bei der Haushaltsführung, der<br />
Arbeitsfähigkeit oder anderen Aktivitäten des täglichen Lebens (Hajek, Gagnon, &<br />
Ruderman, 1997; Paolucci, et al., 1999).<br />
Kognitive Störungen (inkl. Störungen des Affekts und der Motivation) stellen neben den<br />
motorischen Störungen eine weitere zentrale Störungsgruppe dar und betreffen ganz<br />
unterschiedliche Bereiche menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns (Hostenbach et<br />
al., 1998). Gerade diese Störungen sind langfristig für die große psychische und physische<br />
Belastung von pflegenden Angehörigen, aber auch von medizinischen Fachkräften<br />
verantwortlich (Paolucci et al., 1999; Pohjasvaara et al., 1998). Diese Störungen<br />
beeinflussen auch maßgeblich den Erfolg bei der beruflichen, sozialen und familiären<br />
Reintegration.<br />
Bei der Entwicklung einer flächendeckenden Verfügbarkeit der Rehabilitation muss deshalb<br />
auch darauf geachtet werden, dass bei der Diskussion um Versorgungsstrukturen nicht nur<br />
die Akutversorgung in den Mittelpunkt gestellt wird, sondern auch die post-akute<br />
Rehabilitation und Langzeitversorgung der Betroffenen und die notwendigen psychosozialen<br />
Maßnahmen (siehe hierzu allgemein das Lehrbuch der Klinischen Neuropsychologie, Sturm,<br />
Herrmann & Wallesch, 2000). Dies ist beispielsweise in den Empfehlungen einer Konsensus-<br />
Runde in den USA erfolgt (Gresham et al., 1995). Die sehr ausführliche <strong>Stellungnahme</strong> des<br />
Sachverständigenrates <strong>zur</strong> „Stroke Unit“ spiegelt dagegen momentan eher eine eingeengte<br />
Sichtweise bei der Diskussion um angemessene Versorgungsstrukturen wider.<br />
Die Erweiterung des Blickfeldes verbunden mit der Entwicklung neuer<br />
Rehabilitationskonzepte und –programme (z.B. „home-based“ Rehabilitation, Case-<br />
Management, Pflegemanagement) trägt auch dem komplexen und chronischen<br />
Störungsmuster der Schlaganfall-Patienten Rechnung (Schott et al., 1996). Die Erweiterung<br />
des Blickfeldes könnte auch dazu führen, dass bei anderen Krankheitsgruppen (z.B.<br />
Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma) bereits erprobte und als effizient erwiesene<br />
Rehabilitations- und Behandlungskonzepte Eingang in die post-akute Versorgung von<br />
Patienten mit cerebrovaskulären Erkrankungen haben (Braverman et al., 1999; Prigatano et<br />
al., 1994).<br />
ad 3. Intensivierung übergreifender Forschungsbemühungen<br />
Jeder Versuch einer Optimierung einer Gesundheitsversorgung ist auf eine möglichst breite<br />
und produktive Forschungslandschaft angewiesen. Nur auf der Basis einer interdisziplinären<br />
wissenschaftlichen Fundierung und einer kontinuierlichen Überprüfung vorhandener<br />
Versorgungsstrukturen kann zuverlässig zwischen Versorgungsalternativen entschieden<br />
werden (Clancy & Eisenberg, 1998).<br />
Die Notwendigkeit einer besseren wissenschaftlichen Fundierung der Rehabilitation in<br />
Deutschland wird nicht nur vom Sachverständigenrat an verschiedenen Stellen seiner<br />
<strong>Stellungnahme</strong> thematisiert, sondern auch von zahlreichen Wissenschaftsinstitutionen und -<br />
verbänden. Dies hat u.a. 1997/1998 zu der Einrichtung von Reha-Forschungsverbünden<br />
geführt, die vom Verband der Rentenversicherungsträger und dem Bundesministerium für<br />
Bildung und Forschung finanziert werden. Psychologen sind in vielen dieser<br />
Forschungsverbünde mit theoretischen Modellen und methodischer Kompetenz an<br />
prominenter Stelle beteiligt (Bengel & Koch, 2001).<br />
3