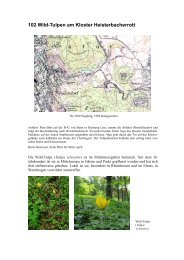Kommentierte Liste der Laubmoose Deutschlands - Jan-Peter Frahm
Kommentierte Liste der Laubmoose Deutschlands - Jan-Peter Frahm
Kommentierte Liste der Laubmoose Deutschlands - Jan-Peter Frahm
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
34<br />
<strong>Frahm</strong><br />
zu Plagiobryum gestellt, weil die Gattung in einem Stammbaum inmitten dieser Bryum-Arten<br />
erscheint (in einem an<strong>der</strong>emn allerdings basal zu Bryum, Anomobryum, Brachymenium etc. steht.<br />
Bryum bimum wird zu Plagiobryum gestellt, B. pseudotriquetrum nicht, obgleich die Unterscheide<br />
<strong>der</strong> beiden Arten so gering sind, dass sie zu einer Art zusammengefasst werden. Diese Einteilung<br />
konterkariert nicht nur die morphologischen Verhältnisse, was von den Autoren zugegeben wird<br />
(“Although Plagiobryum as deeply nested within a clade of Bryum species, no morphological<br />
synapomrphies can be detected”), son<strong>der</strong>n auch das Gattungkonzept von Lindberg und ist für die<br />
Praxis völlig irrelevant..<br />
(43) Bryum alpinum und muehlenbeckii stellen Pe<strong>der</strong>sen & Hedenäs (2005) in eine eigene<br />
Gattung Imbribryum, weil sie auf einem eigenen Ast liegen, eine Logik, die sich mir nicht<br />
erschließt, weil dann auch an<strong>der</strong>e Gattungsrank haben müssten und Mielichhofera in einem<br />
Bryum-Ast liegt und konsequenterweise zu Bryum gestellt werden müsste. Eine wenig beachtete<br />
Ursache von solchen Stammbaumtopologien sind Fehlbestimmungen, wie sie in dieser Arbeit<br />
auch an zwei Stellen zugegeben werden.<br />
(44) Der Status von Abietinella hystricosa wird kontrovers diskutiert und variiert zwischen einer<br />
Art (Ochyra et al. 2003), einer Subspecies (Smith 1978) o<strong>der</strong> Varietät. Die Unterschiede betreffen<br />
trocken abstehende Blätter und längere Astblätter mit längeren Zellen. Smith (1978) schreibt von<br />
Übergangen zu A. abietina. Nach “speziellen Untersuchungen zur mo<strong>der</strong>nen Taxonomie” von<br />
Düll-Hermanns (1981) bildet diese Übergangsform eine eigene Sippe (A. abietinum fo.<br />
intermedium Loeske), so dass die Autorin im Summary von drei Taxa ausgeht. Im Wi<strong>der</strong>spruch<br />
dazu heißt es jedoch in <strong>der</strong> Diskussion“Die Streuungsdiagramme und Merkmalswerte lassen<br />
gleitende Übergänge zwischen Thuidium abietinum var. abietinum und Th. a. var. hystricosum<br />
erkennen”… “Diese beiden Kriterien, gleiten<strong>der</strong> Übergang, kein eigenes Areal <strong>der</strong> var.<br />
hystricosum, sprechen für eine Einordnung <strong>der</strong> beiden Taxa als Varietäten”. Wieso bei gleitenden<br />
Übergängen eine Varietät unterschieden wird und bei drei statistischen Clustern nur zwei, bleibt<br />
unklar. Auch Loeske (zit. nach Duell-Hermanns 1981) geht von Übergängen aus: “je<br />
feuchtschattiger <strong>der</strong> Standort o<strong>der</strong> je feuchter die ihn umgebende Luft, umso mehr nähert sich das<br />
Moos dem Thuidium hystricosum”. Lei<strong>der</strong> hat keiner die nächstliegende Idee verwirklicht und<br />
Kulturversuche gemacht.<br />
(45) Pogonatum aloides var. minimum wird von älteren Autoren als Bastard zwischen<br />
weiblichem P. aloides und männlichem P. nanum gedeutet, P. nanum var. longisetum als solcher<br />
zwischen weiblichem P. aloides und männlichen P. nanum, was aber nicht zutreffen kann, da <strong>der</strong><br />
Bastard immer nur mit den Eltern in befruchtungsfähiger Distanz zusammen auftreten müsste, was<br />
aber nicht <strong>der</strong> Fall ist. Es handelt sich jedoch um Genotypen, wie das gemeinsame Vorkommen<br />
bei<strong>der</strong> Varietäten an einem Standort zeigen. Eine Möglichkeit wäre, dass es sich bei den<br />
langsetigen Ausprägungen um Polyploidie handelt.<br />
(46) Die Art ist in Isothecium, Eurhynchium und Plasteurhynchium gestellt worden, eine gängige<br />
Praxis, wenn eine Art nicht in die eine (Eurhynchium) und auch nicht richtig in die an<strong>der</strong>e<br />
(Isothecium) Gattung passt und man eine Verlegenheitsgattung kreiert. Solche Fälle gibt es auch<br />
bei Rhynchostegium – Eurhynchium – Platyhypnidium riparioides, Rhynchostegium –<br />
Eurhynchium – Rhynchostegiella pumila, Anisothecium - Dichodontium – Diobelum squarrosum<br />
etc. Da es keine eindeutigen anatomisch-morphologischen Entscheidung für die eine o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e<br />
Platzierung gibt, würde ich in den Fällen molekularen Ergebnissen den Vorzug geben (Huttunen &<br />
Ignatov 2004), da <strong>der</strong>en Resultate unabhängig von mehrfach auftretenden morphologischen<br />
Merkmalen wie geschnäbelten Kapseln, als Dorn austretenden Rippen und langen abgesetzten<br />
Blattspitzen (wie bei Cirriphyllum) zustande kommen. In <strong>der</strong> Tat besteht große Ähnlichkeit im<br />
Gelände mit E. striatum.<br />
ISSN 0945-3466