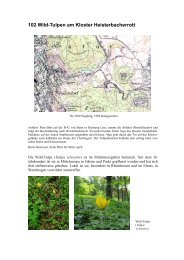Kommentierte Liste der Laubmoose Deutschlands - Jan-Peter Frahm
Kommentierte Liste der Laubmoose Deutschlands - Jan-Peter Frahm
Kommentierte Liste der Laubmoose Deutschlands - Jan-Peter Frahm
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
36<br />
<strong>Frahm</strong><br />
(57) = Tortula fiorii.<br />
(58) Aloina obliquifolia wird von Meinunger & Schrö<strong>der</strong> unter Bezug auf Gallego et al. (1999)<br />
aufgeführt. Ein Jahr später (Gallego 2000) führt die Autorin die Art nicht mehr an. Das Taxon<br />
wurde vom Carl Müller als Art aus China beschrieben. In seiner Aloina-Monographie schreibt<br />
Degadillo (1975) “..is closely related to var. rigida and var. mucronulata. Other than the<br />
differences in leaf apex morphology indicated in the descriptions, I am unable to see other<br />
distinctions among the three taxa.” Die var. rigida hat stumpfe Blätter, bei <strong>der</strong> var. mucronulata<br />
tritt die Rippe als Stachel aus, bei <strong>der</strong> var. obliquifolia als Glashaar.<br />
Die zitierte var. mucronulata (mucronata, mucronatula) wird von Delgadillo (1975) auch aus<br />
Deutschland angegeben (Schleswig-Holstein, Kreidegruben Lägerdorf, leg. Timm 1906). Wie bei<br />
Encalypta gibt es auch bei Aloina Ausprägungen von Arten mit o<strong>der</strong> ohne Glashaar, die man<br />
eigentlich nur als Formen bezeichnen kann, es sei denn, man unterstützt das Konzept <strong>der</strong><br />
“Einmerkmalarten”. Für A. rigida fo. obliquifolia muss eine neue Kombination gemacht werden,<br />
was hier in einem Online Journal nicht möglich ist.<br />
(59) Der Besitz eines Glashaares bei einer ansonsten nicht glashaartragenden Art ist – wenn kein<br />
an<strong>der</strong>es Merkmal dazukommt - ein (1) Merkmalsunterschied, und ist demenstprechend als fo. zu<br />
werten. Das wurde in <strong>der</strong> bryologischen Literatur auch so gehandhabt (Nyholm: Stegonia latifolia<br />
fo. pilifera, Encalypta vulgaris fo. pilifera; Mönkemeyer : Aloina rigida fo. pilifera).<br />
(60) Die Wertungen <strong>der</strong> infraspezifischen Taxa von Pottia davalliana und starkeana gehen weit<br />
auseinan<strong>der</strong>, so dass hier nur vom kleinsten gemeinsamen Nenner ausgegangen wird. Danach gibt<br />
es Pflanzen mit (starkeana) und ohne (davalliana incl. mutica und conica) Peristom., wie es bei<br />
Smith (2004) und Frey et al. (2004) angeführt wird. Zuvor hatte Smith (1978) noch alle hier<br />
erwähnten Taxa als Subspezies von starkeana angesehen. Ros et al. (1999) reduzierten den ganzen<br />
Komplex von Arten ebenfalls auf zwei (P. davalliana und P. starkeana), die an <strong>der</strong><br />
Sporenmorphologie unterschieden werden, und zogen Arten wie P. commutata, conica, minutula<br />
ein.<br />
Die Schreibweise lautet starkeana (wie bei Kiaeria starkei, Brachythecium starkei) und nicht<br />
starckeana.<br />
Zan<strong>der</strong> (1993), <strong>der</strong> die Gattung Pottia aufgelöst hat, stellt beide Arten zu Microbryum, Guerra &<br />
Cano (J. Bryol. 2000) belassen sie bei Pottia. Smith (2004) folgt dem.<br />
(61) Aphanorrhegma o<strong>der</strong> Physcomitrella patens? Beide Gattungen haben rundliche in die Blätter<br />
eingesenkte Kapseln. Aphanorrhegma hat einen abfallenden Deckel, Physcomitrella ist cleistocarp.<br />
Es ist jetzt Geschmackssache, ob man den Unterschied mit/ohne Operculum als<br />
Gattungsunterschied auffasst o<strong>der</strong> nicht. In Nordamerika wird das getan. Bei Molekulargenetikern<br />
ist die Art weltweit als Physcomitrella bekannt. Interessanterweise landet P. patens in<br />
molekularsystematischen Untersuchungen auf einem Ast mit Physcomitrium. Das lässt darauf<br />
schließen, dass P. patens sich zu Physcomitrium verhält wie Pottia bryoides zu Pottia truncata,<br />
man also genauso gut Physcomitrella patens zu Physcomitrium stellen könnte.<br />
(62) Bryum moravicum ist das, was früher als B. flaccidum Brid., B. subelegans o<strong>der</strong> B.<br />
laevifilum bezeichnet wurde. Ursprünglich hatte Syed (1973) fünf Bryum-Arten mit axillären<br />
Gemmen unterschieden, von denen B. laevifilum neu beschrieben wurde und glatte Gemmen<br />
haben soll (Name!), Bryum flaccidum Brid. 1826 fein papillöse und Bryum subelegans Kindb.<br />
1903 grobpapillöse Gemmen haben soll. Das geschah offenbar durch den Einfluss des<br />
Doktorvaters Allan Crundwell, <strong>der</strong> die Oberflächenstruktur von Rhizoiden in die Taxonomie<br />
eingeführt hat. Spätere Autoren (vgl. <strong>Frahm</strong> 2001) haben diese Arten wie<strong>der</strong> mit B. flaccidum<br />
synonymisiert. Der Typus von B. flaccidum war von Balbis angeblich auf Hispaniola gesammelt.<br />
ISSN 0945-3466