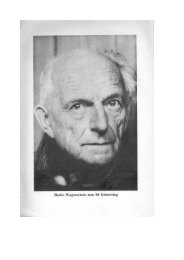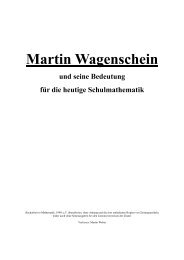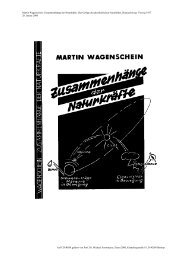Problem des genetischen Lehrens. - Martin Wagenschein
Problem des genetischen Lehrens. - Martin Wagenschein
Problem des genetischen Lehrens. - Martin Wagenschein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2. Beispiel: Erdrotation<br />
Ein zweites, ein physikalisches, Beispiel möge zeigen: dass die Anwesenheit der primären<br />
Wirklichkeit nicht schon dadurch garantiert ist, dass wir experimentell und gründlich, aber<br />
nur darlegend vorgehen.<br />
Dreht sich die Erde? Wer den „Foucault'schen Pendelversuch“ gesehen und verstanden hat,<br />
ist gezwungen, es zuzugeben. (Nicht einmal ohne Emotion: Der Versuch wirkt, wie mir ein<br />
Philosophieprofessor sagte, der ihn gesehen hatte, „haarsträubend“. Mit Recht. Ganz ähnlich<br />
wie das einträchtige Niederfallen von Münze und Flaumfeder im leeren Raum.) – Wenn es<br />
aber bei der unmotivierten Behauptung „Die Erde rotiert“ und ihrer Verifikation durch diesen<br />
Versuch bleibt (in der Erinnerung vieler Erwachsener ist es so), so ist das, fürchte ich, die<br />
falsche Emotion, nämlich ein Staunen-ex-machina, das Staunen vor dem Kunststück. Die<br />
Physik kommt dabei in den Ruf der Zauberkunst, den sie nach ihrer ganzen Vergangenheit<br />
am wenigsten auf sich sitzen lassen darf 18 . Davon abgesehen ist der Versuch allerdings<br />
„zwingend“.<br />
Trotzdem dürfen wir Lehrer mit diesem Stand der Klärung nicht zufrieden sein, denn der<br />
Schüler ist es nicht mit uns. Wenn er nämlich ein gesunder und einigermaßen selbständiger<br />
Kopf ist, so nagt an ihm immer noch – nicht ein Zweifel, aber – eine berechtigte Unzufriedenheit,<br />
(die wir, soweit ich sehe, in der Schule nur selten beheben). Er fragt sich: Foucault wäre offenbar<br />
nie auf seine Versuchsanordnung gekommen, wenn er nicht schon vorher vermutet<br />
hätte, dass die Erde sich drehe. Wie war er denn auf diese, doch zunächst absurde, Idee<br />
verfallen? – Wir können ihm dann sagen: er hatte sie von Kopernikus; der hatte sie von Cicero,<br />
und Cicero hatte sie von Aristarch. – Ja? Und wie kam Aristarch darauf?, fragt er nun.<br />
Genesis ist nicht Geschichte<br />
Hier treibt ihn nun nicht etwa ein primär geschichtliches Interesse, sondern sein gesun<strong>des</strong><br />
Zögern, den Physiker, heiße er nun Foucault oder Aristarch, für eine Art Zauberer zu halten,<br />
der eine auf keine Erfahrung gegründete Eingebung hat, die er dann nachträglich auf raffinierte<br />
Weise verifiziert. Der Schüler, der uns so in die Antike zurückdrängt, fragt also gar nicht<br />
historisch, sondern genetisch. Dieser Unterschied muss betont werden. „Nicht um die<br />
Geschichte handelt es sich“, schreibt Otto Toeplitz zu seiner <strong>genetischen</strong> Darstellung der<br />
Infinitesimalrechnung 19 , „sondern um die Genesis. Unerschöpflich“, fährt er fort, „kann man<br />
so aus der Historie für die didaktische Methode lernen“ 20 .<br />
18<br />
Als ich zur Schule ging, hieß der Raum, der die physikalischen Apparate aufbewahrte, noch das<br />
„physikalische Kabinett“.<br />
19<br />
Otto Toeplitz: Die Entwicklung der Infinitesimalrechnung, Bd. I, Berlin 1949.<br />
20<br />
Jahresberichte der deutschen Mathematiker-Vereinigung Bd. 36 (1927)S. 88 ff.<br />
10