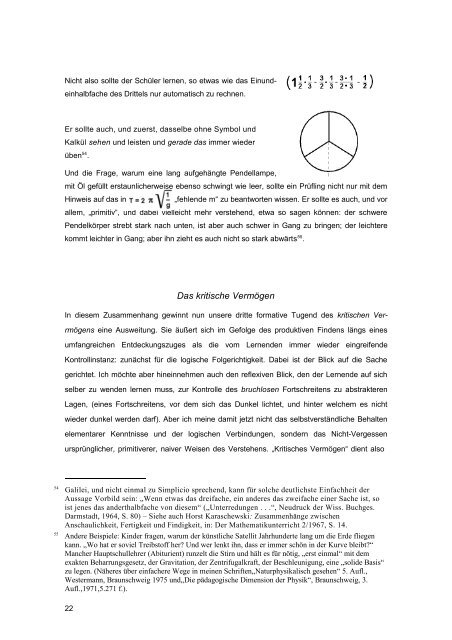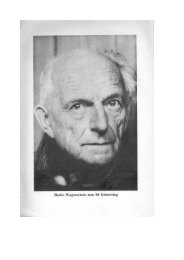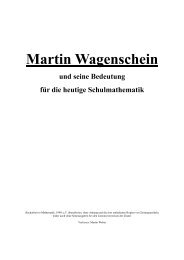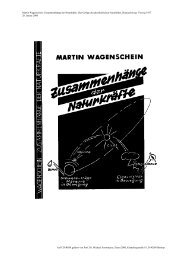Problem des genetischen Lehrens. - Martin Wagenschein
Problem des genetischen Lehrens. - Martin Wagenschein
Problem des genetischen Lehrens. - Martin Wagenschein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nicht also sollte der Schüler lernen, so etwas wie das Einundeinhalbfache<br />
<strong>des</strong> Drittels nur automatisch zu rechnen.<br />
Er sollte auch, und zuerst, dasselbe ohne Symbol und<br />
Kalkül sehen und leisten und gerade das immer wieder<br />
üben 54 .<br />
Und die Frage, warum eine lang aufgehängte Pendellampe,<br />
mit Öl gefüllt erstaunlicherweise ebenso schwingt wie leer, sollte ein Prüfling nicht nur mit dem<br />
Hinweis auf das in lende m“ „ „fehlende m“ zu beantworten wissen. Er sollte es auch, und vor<br />
allem, „primitiv“, und dabei vielleicht mehr verstehend, etwa so sagen können: der schwere<br />
Pendelkörper strebt stark nach unten, ist aber auch schwer in Gang zu bringen; der leichtere<br />
kommt leichter in Gang; aber ihn zieht es auch nicht so stark abwärts 55 .<br />
Das kritische Vermögen<br />
In diesem Zusammenhang gewinnt nun unsere dritte formative Tugend <strong>des</strong> kritischen Verrmögens<br />
eine Ausweitung. Sie äußert sich im Gefolge <strong>des</strong> produktiven Findens längs eines<br />
umfangreichen Entdeckungszuges als die vom Lernenden immer wieder eingreifende<br />
Kontrollinstanz: zunächst für die logische Folgerichtigkeit. Dabei ist der Blick auf die Sache<br />
gerichtet. Ich möchte aber hineinnehmen auch den reflexiven Blick, den der Lernende auf sich<br />
selber zu wenden lernen muss, zur Kontrolle <strong>des</strong> bruchlosen Fortschreitens zu abstrakteren<br />
Lagen, (eines Fortschreitens, vor dem sich das Dunkel lichtet, und hinter welchem es nicht<br />
wieder dunkel werden darf). Aber ich meine damit jetzt nicht das selbstverständliche Behalten<br />
elementarer Kenntnisse und der logischen Verbindungen, sondern das Nicht-Vergessen<br />
ursprünglicher, primitiverer, naiver Weisen <strong>des</strong> Verstehens. „Kritisches Vermögen“ dient also<br />
54<br />
Galilei, und nicht einmal zu Simplicio sprechend, kann für solche deutlichste Einfachheit der<br />
Aussage Vorbild sein: „Wenn etwas das dreifache, ein anderes das zweifache einer Sache ist, so<br />
ist jenes das anderthalbfache von diesem“ („Unterredungen . . .“, Neudruck der Wiss. Buchges.<br />
Darmstadt, 1964, S. 80) – Siehe auch Horst Karaschewski: Zusammenhänge zwischen<br />
Anschaulichkeit, Fertigkeit und Findigkeit, in: Der Mathematikunterricht 2/1967, S. 14.<br />
55<br />
Andere Beispiele: Kinder fragen, warum der künstliche Satellit Jahrhunderte lang um die Erde fliegen<br />
kann. „Wo hat er soviel Treibstoff her? Und wer lenkt ihn, dass er immer schön in der Kurve bleibt?“<br />
Mancher Hauptschullehrer (Abiturient) runzelt die Stirn und hält es für nötig, „erst einmal“ mit dem<br />
exakten Beharrungsgesetz, der Gravitation, der Zentrifugalkraft, der Beschleunigung, eine „solide Basis“<br />
zu legen. (Näheres über einfachere Wege in meinen Schriften„Naturphysikalisch gesehen“ 5. Aufl.,<br />
Westermann, Braunschweig 1975 und„Die pädagogische Dimension der Physik“, Braunschweig, 3.<br />
Aufl.,1971,5.271 f.).<br />
22