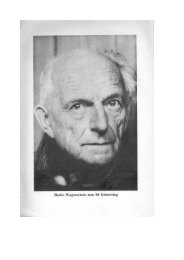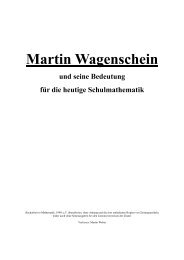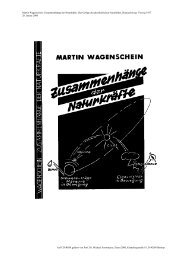Problem des genetischen Lehrens. - Martin Wagenschein
Problem des genetischen Lehrens. - Martin Wagenschein
Problem des genetischen Lehrens. - Martin Wagenschein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
wäre nichts einzuwenden, wenn zugleich ebenso stark ein andrer und, wie ich glaube,<br />
wichtigerer Impuls in Fluss käme, der seit Jahrzehnten fällig ist, nämlich eine pädagogische<br />
Modernisierung, eben im Sinne <strong>des</strong> <strong>genetischen</strong> Prinzips. Ich stimme also mit H. Freudenthal<br />
überein, wenn er schreibt: „Das erste Anliegen ist heute nicht, den Unterrichtsstoff sondern den<br />
Unterricht zu modernisieren.“ Offenbar in genetischer Richtung, denn er sagt in dem gleichen<br />
Vortrag: „Dass der Schüler etwas lernen muss, ist nur richtig, wenn dem „muss“ ein Bedürfnis<br />
<strong>des</strong> Schülers (nicht <strong>des</strong> Lehrers) vorangeht 50<br />
Das <strong>Problem</strong>, ob und wie moderne Mathematik genetisch zu unterrichten sei, wird nur Jemand<br />
lösen können, der bei<strong>des</strong> kennt und bejaht.<br />
Ohne Kenntnis der modernen Mathematik lässt sich nur soviel sagen:<br />
Es ist kein Zufall, dass die moderne Mathematik erst im 20. Jahrhundert entstanden ist.<br />
Andererseits hat sie, wie alles, eine Genese.<br />
Dass sie in der Schule nicht früh einsetzen darf, dafür scheint der Satz Freudenthals 51 zu<br />
sprechen: „Man kann ein Gebiet, das man nicht kennt, nun einmal nicht ordnen.“<br />
Es ist aber andererseits nicht auszuschließen (da Genese nicht Historie ist), dass es eine<br />
abkürzende und doch echte Genese gibt, ähnlich wie sie bei gewissen Zugängen zu der, ja<br />
ebenfalls jungen, Relativitätstheorie möglich erscheint.<br />
Die Kernfrage: ist es so, dass die modernen Fragestellungen, Begriffe, Symbole und Strukturen<br />
sich dem Schüler aus der Sache aufdrängen (ähnlich wie die geologischen Fragen aus der<br />
Landschaft), ohne dass der Lehrer sie ihm aufnötigt oder auch gefällig macht? Natürlich hat der<br />
Lehrer – wie gesagt – etwas zu tun: er hat ein Fragen und auch Begriffe 52 provozieren<strong>des</strong><br />
ursprüngliches Material (also Körper, Figuren, Mengen von Gegenständen) zu exponieren und<br />
möglichst wenig zu sagen.<br />
Von den <strong>Problem</strong>en der mathematischen Ontologie und von der Frage, ob überhaupt die<br />
axiomatische Mathematik als die moderne schlechthin bezeichnet werden dürfe (Der<br />
Mathematikunterricht, 1966/3), kann ich hier absehen. Einmal, da ich hierzu nicht genügend<br />
urteilsfähig bin, zweitens, weil ich meinen Standpunkt rein pädagogisch, fachunabhängig,<br />
begründe aus den auf S. 2 und 3 genannten drei Prinzipien.<br />
Ihre Richtigkeit ist nicht beweisbar, man muss sich entscheiden. Die pädagogische Entscheidung<br />
hängt davon ab, wie man die Zukunft <strong>des</strong> Menschen wünscht, die <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> und die<br />
der Menschheit. Im Besonderen kann man das Prinzip der Kontinuität (<strong>des</strong> „enracinement“)<br />
so formulieren: der Mensch darf nicht gespalten werden, wo er ganz bleiben kann. (Es ist<br />
nicht identisch mit dem Ideal der harmonischen Persönlichkeit. Spannungen sind unvermeidlich,<br />
aber sie sollten nicht zu Diskontinuitäten führen, und Polaritäten nicht zu Verdrängungen.)<br />
52<br />
So ist – ein Beispiel aus der Physik – die „elektrische Ladungsmenge'' ein Begriff, <strong>des</strong>sen<br />
Frühformen sich bei spielendem Umgang mit Elektroskopen aufdrängen, ohne dass der Lehrer etwas<br />
zu sagen braucht. Näheres auf S. 57 f. meines Buchs „Die pädagogische Dimension der Physik“,<br />
Braunschweig, 3. Aufl. 1970.<br />
20