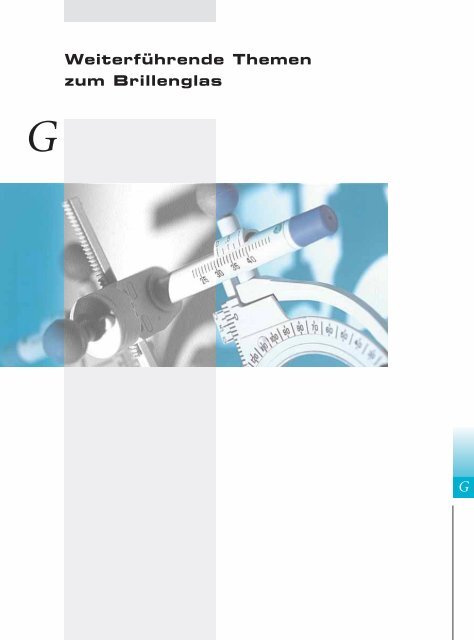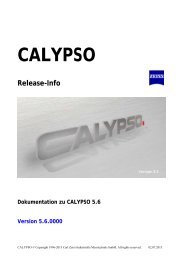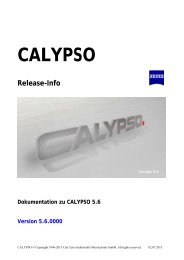Weiterführende Themen zum Brillenglas - Carl Zeiss
Weiterführende Themen zum Brillenglas - Carl Zeiss
Weiterführende Themen zum Brillenglas - Carl Zeiss
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong><br />
<strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
G<br />
G
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong><br />
<strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
G<br />
Spezialanfertigungen G 3<br />
Meß- und Gebrauchswert G 9<br />
OPTIMA G 17<br />
Slab-off-Schliff G 23<br />
Anpassung von <strong>Zeiss</strong> G 31<br />
Brillengläsern<br />
Normen und Richtlinien G 35
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Spezialanfertigungen<br />
Abweichende Dicken<br />
Für das Verglasen von randlosen Brillenfassungen ist<br />
in manchen Fällen ein Anheben der Randdicke im Plusbereich<br />
sinnvoll. <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> fertigt bei der Angabe „für<br />
Nylor“ oder „für Bohrbrille“ automatisch eine Mindestranddicke<br />
von 1,5 mm.<br />
Ist an der Bohrlochposition eine genau vorgegebene<br />
Dicke erwünscht, so werden folgende Angaben benötigt:<br />
Zentrierung<br />
Scheibenform<br />
Fassungsdaten<br />
Bohrlochposition<br />
Dioptrische und prismatische Wirkung<br />
Anhand dieser Angaben wird dann bei <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> das<br />
optimale <strong>Brillenglas</strong> berechnet.<br />
Abweichende Durchbiegungen<br />
Alle Einstärkengläser können mit abweichenden Durchbiegungen<br />
gefertigt werden. Brillengläser mit stärkerer<br />
bzw. flacherer Durchbiegung berücksichtigen vor<br />
allem ästhetische und modische Gesichtspunkte. Bei<br />
flacheren Durchbiegungen kann es Einbußen in der<br />
Abbildungsqualität geben.<br />
Wird der gewünschte Vorderflächenradius bei der <strong>Brillenglas</strong>bestellung<br />
angegeben, erfolgt in der technischen<br />
Kundenberatung die Prüfung auf fertigungstechnische<br />
Realisierbarkeit. Für besonders flache Brillengläser ist<br />
bei der <strong>Brillenglas</strong>bestellung die Angabe „Extra flach“<br />
ausreichend. In jedem Fall ist aus Gründen der besseren<br />
Abbildungsgüte ein asphärisches oder atorisches<br />
<strong>Brillenglas</strong> dem „extra flachen“ vorzuziehen.<br />
G3
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Spezialanfertigungen<br />
Brillengläser mit<br />
außergewöhnlichen Wirkungen<br />
Es besteht die Möglichkeit, <strong>Brillenglas</strong>wirkungen zu<br />
fertigen, die außerhalb des in der Preisliste angegebenen<br />
Lieferbereichs liegen. Im Einzelfall prüft die<br />
technische Kundenberatung, ob die Fertigung der<br />
benötigten dioptrischen oder prismatischen Wirkung<br />
zu realisieren ist.<br />
Dezentrierte Einstärkengläser<br />
Jedes Einstärkenglas kann vordezentriert gefertigt werden.<br />
Das ist sinnvoll, wenn die lieferbaren Standarddurchmesser<br />
eine exakte Zentrierung nicht zulassen.<br />
Die notwendige Vordezentrierung errechnet sich folgendermaßen:<br />
Die benötigte Dezentration wird bei der<br />
<strong>Brillenglas</strong>bestellung in Millimeter angegeben.<br />
Gewünschter ∅ [mm] - Lieferbarer ∅ [mm]<br />
2<br />
= Vordezentration [mm]<br />
Optimierter Durchmesser<br />
Bei Plusbrillengläsern ist es häufig sinnvoll, einen Durchmesser<br />
zu bestellen, der von den in der Preisliste angebotenen<br />
Standarddurchmessern abweicht. So kann ein<br />
dünneres <strong>Brillenglas</strong> gefertigt werden als mit dem<br />
nächst größeren Standarddurchmesser. Zur Erinnerung:<br />
Je kleiner der Durchmesser bei Plusbrillengläsern, desto<br />
dünner das <strong>Brillenglas</strong>. Bei Einstärkengläsern läßt sich<br />
ein optimierter Durchmesser bis 38 mm realisieren.<br />
Die Größe des optimierten Durchmessers wird so gewählt,<br />
daß das <strong>Brillenglas</strong> so groß wie nötig und so<br />
klein wie möglich ist.<br />
G4
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Spezialanfertigungen<br />
Dickenangleichung bei<br />
Anisometropie<br />
Stark unterschiedliche dioptrische Wirkungen des rechten<br />
und linken <strong>Brillenglas</strong>es können einen deutlichen<br />
Unterschied der Glasdicke bewirken. Im Falle einer<br />
höheren Anisometropie (Ungleichsichtigkeit) läßt sich<br />
daher die Durchbiegung der <strong>Brillenglas</strong>vorderfläche<br />
und/oder die Mitten- bzw. Randdicke des schwächeren<br />
<strong>Brillenglas</strong>es angleichen. Hierzu ist bei der <strong>Brillenglas</strong>bestellung<br />
die Angabe „Angleichen“ ausreichend. Soll<br />
die Dickenangleichung jedoch exakt berechnet werden,<br />
benötigt die technische Kundenberatung folgende<br />
Angaben:<br />
Zentrierung<br />
Scheibenform<br />
Fassungsdaten<br />
Dioptrische und prismatische Wirkung<br />
K<br />
K<br />
K<br />
K<br />
K<br />
Salzschmelze<br />
Iseikonische Brillengläser<br />
Si<br />
O<br />
O<br />
Zur Korrektion einer Aniseikonie fertigt <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> spezielle<br />
Brillengläser mit stärkerer Durchbiegung und<br />
höherer Mittendicke. So kann die notwendige Eigenvergrößerung<br />
und somit ein verbessertes Binokularsehen<br />
erreicht werden. Die <strong>Brillenglas</strong>bestellung erfolgt mit<br />
dem Zusatzhinweis “Iseikonische Brillengläser”.<br />
O<br />
O<br />
Si<br />
O Si O<br />
Vor Ionenaustausch<br />
O<br />
Si O<br />
O<br />
O Si<br />
Glas<br />
Härten mineralischer Brillengläser<br />
Chemisches Härten erhöht die Bruchfestigkeit mineralischer<br />
Brillengläser (Ausnahmen: Tital 1.7, Lantal 1.8<br />
und Lantal 1.9). Im Bereich der Glasoberfläche entsteht<br />
durch ein Ionenaustauschverfahren eine Druckspannung,<br />
die die Bruchfestigkeit des Glases erhöht. Eine<br />
nachträgliche Beschichtung (Entspiegelungschichten)<br />
kann die erzielte Bruchfestigkeit reduzieren.<br />
Bei <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> werden ausschließlich gerandete, d.h.<br />
für die ausgewählte Fassung in der richtigen Größe<br />
geschliffene Brillengläser gehärtet. Somit wird ausgeschlossen,<br />
daß ein nachträglicher Schleifvorgang die<br />
Bruchfestigkeit negativ beeinflußt, die durch chemisches<br />
Härten erzielt wurde.<br />
K<br />
K<br />
Si<br />
O<br />
K K<br />
O<br />
K<br />
K<br />
K<br />
K<br />
O<br />
K<br />
O<br />
Si<br />
O Si O<br />
Nach Ionenaustausch<br />
K<br />
K<br />
K<br />
Si O<br />
O<br />
O Si<br />
Salzschmelze<br />
Glas<br />
G5
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Spezialanfertigungen<br />
Taucherbrillen<br />
Für Taucherbrillen fertigt <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> mineralische plankonvexe-<br />
bzw. plankonkave Spezialbrillengläser, die<br />
auf die Innenseite der Taucherbrille gekittet werden.<br />
Das Programm umfaßt sowohl Einstärken- als auch<br />
Zweistärkengläser für Taucherbrillen. Bei Angabe der<br />
Zentrierdaten und Einsendung der Taucherbrille erfolgt<br />
die Fertigung in der Einschleifwerkstatt bei <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong><br />
in Aalen.<br />
Mattierte Brillengläser<br />
Taucherbrille mit aufgekitteten Plankonkavgläsern<br />
auf der Innenseite der Trägerscheibe<br />
Zum Abdecken eines Auges, das aus ästhetischen oder<br />
anderen Gründen nicht sichtbar sein soll, lassen sich<br />
alle Brillengläser aus dem <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> Programm augenseitig<br />
mattieren.<br />
Transmission (%)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Wellenlänge (nm)<br />
350 400 450 500 550 600 650 700 750<br />
Transmissionskurve des Didymium-Filterglases BG 20<br />
Okkludierte Brillengläser<br />
(Okklusionsgläser)<br />
Soll ein Auge aus medizinischen Gründen vom Sehen<br />
ausgeschlossen werden, so kann dies mit Hilfe eines<br />
Okklusionsglases erreicht werden. Da die augenseitige<br />
Fläche nur aufgerauht wird, ist das Auge im Gegensatz<br />
zu mattierten Brillengläsern von außen weiterhin<br />
schemenhaft sichtbar.<br />
Didymium-Filtergläser<br />
Das mineralische Bandenfilterglas BG 20 weist zwischen<br />
570 und 595 nm eine besonders niedrige Transmission<br />
auf. Es wird vor allem von der glasverarbeitenden<br />
Industrie bei der Arbeit an Schmelzöfen eingesetzt.<br />
<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> bietet das BG 20 als Plan-, Einstärkenund<br />
Mehrstärkenbrillenglas an. Das Glas ist nach DIN<br />
EN ISO 14889 weder nachtfahr- noch kfz-tauglich.<br />
G6<br />
08. 2000
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Spezialanfertigungen<br />
Executive-Brillengläser<br />
Die organischen Executive-Brillengläser werden bei<br />
Kinderbrillen häufig unterstützend für Sehschulungen<br />
eingesetzt. Executive-Brillengläser sind spezielle bildsprungfreie<br />
Zweistärkengläser, die die Nutzung eines<br />
sehr breiten Sehbereichs in der Nähe ermöglichen.<br />
Dabei wird für jeweils ein Executive-<strong>Brillenglas</strong> eine<br />
Fern- und eine Nahbrillenglashälfte zusammengekittet.<br />
Bi-Gläser<br />
Zur Verglasung von Lorgnetten oder für andere spezielle<br />
Zwecke sind sowohl mineralische als auch organische<br />
Bikonvex- oder Bikonkavgläser erhältlich.<br />
Lorgnetten,<br />
Optisches Museum<br />
Oberkochen<br />
Abweichende Additionen<br />
Bei Duopal 1.6 C 25 Brillengläsern sind je nach Wirkungsbereich<br />
auch höhere Additionen bis 6.0 dpt möglich.<br />
Bei Additionen über 6.0 dpt bieten Bifokal-Lupengläser<br />
eine bessere Korrektionsmöglichkeit. Nähere<br />
Informationen sind über die Hotline für vergrößernde<br />
Sehhilfen zu erfahren.<br />
Prismatische Wirkungen<br />
Prismatische Brillengläser werden bei <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> gebrauchsrichtig<br />
gefertigt. Dies bedeutet, daß im Bezugspunkt<br />
des <strong>Brillenglas</strong>es in der Gebrauchssituation<br />
exakt die bestellte dioptrische Wirkung für den Benutzer<br />
wirksam ist. Dadurch ergibt sich aufgrund eines<br />
anderen Strahlenganges bei der Messung im Scheitelbrechwert-Meßgerät<br />
ein Unterschied zwischen dem<br />
bestellten <strong>Brillenglas</strong>wert (Gebrauchswert) und dem<br />
Meßwert. Zur präzisen Nachkontrolle mit dem Scheitelbrechwert-Meßgerät<br />
ist der Meßwert auf der Glastüte<br />
angegeben.<br />
Bifokal-Lupenbrille<br />
G7
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Spezialanfertigungen<br />
Prismatische Wirkungen<br />
in Fern- und Nahteil<br />
Alle Bifokal- und Gleitsichtgläser von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> lassen<br />
sich durch Verkippen einer Fläche mit prismatischer<br />
Wirkung herstellen. Dabei ergibt sich für das Fernteil<br />
die gleiche prismatische Wirkung wie für das Nahteil.<br />
Bei Duopal C 25 Brillengläsern ist es durch Aufkitten<br />
eines prismatischen Nahteils möglich, unterschiedliche<br />
prismatische Wirkungen zwischen dem Nah- und Fernteil<br />
zu erreichen.<br />
Gleitsichtgläser<br />
ohne Schwenkung<br />
Für presbyope Brillenträger, die beim Blick in die Nähe<br />
nicht konvergieren, können alle Gleitsichtgläser von<br />
<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> ohne Schwenkung bestellt werden. Beim<br />
Einarbeiten müssen der Fern- und der Nahbezugspunkt<br />
in der Vertikalen direkt untereinander liegen, d.h. das<br />
Glas wird bei der Einarbeitung in die Brillenfassung<br />
nasal nach unten gedreht und von der Stempelung her<br />
schief eingeschliffen. Auf diese Weise ist dann die<br />
refraktionsrichtige Achse wirksam.<br />
Das Gleitsichtglas ohne Schwenkung wird schief eingeschliffen,<br />
so daß Fern- und Nachbezugspunkt in der Vertikalen untereinander<br />
liegen.<br />
Die <strong>Brillenglas</strong>bestellung erfolgt mit dem Zusatzhinweis<br />
„Ohne Schwenkung“.<br />
G8
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Meß- und Gebrauchswert<br />
Was ist der Meßwert?<br />
Der Meßwert ist die dioptrische Wirkung S’ im Bezugspunkt<br />
eines <strong>Brillenglas</strong>es und im Scheitelbrechwertmeßgerät<br />
nach einem definierten Meßverfahren gemessen.<br />
Was ist der Gebrauchswert?<br />
Der Gebrauchswert ist die dioptrische Wirkung im Bezugspunkt<br />
eines <strong>Brillenglas</strong>es beim Gebrauch, d.h. beim<br />
Tragen der Brille, bei einer definierten Gebrauchssituation.<br />
Ziel bei der Berechnung eines <strong>Brillenglas</strong>es<br />
ist es, daß der Gebrauchswert des <strong>Brillenglas</strong>es den<br />
ermittelten Werten der <strong>Brillenglas</strong>bestimmung entspricht.<br />
Warum wird zwischen Meß- und<br />
Gebrauchswert unterschieden?<br />
Der Meßwert für die Nähe unterscheidet sich bei <strong>Carl</strong><br />
<strong>Zeiss</strong> Bifokal-,Trifokal- und Gleitsichtgläsern aus zwei<br />
Gründen vom Gebrauchswert: Zum einen wegen unterschiedlicher<br />
Geometrien von Refraktionsmeßglas und<br />
<strong>Brillenglas</strong>. Zum anderen wegen unterschiedlicher<br />
Strahlengänge bei der Messung im Scheitelbrechwertmeßgerät<br />
und beim Gebrauch des <strong>Brillenglas</strong>es.<br />
Die Geometrie von Refraktionsmeßglas<br />
und <strong>Brillenglas</strong><br />
Ein Refraktionsmeßglas (RG) hat – bei gleichem Scheitelbrechwert<br />
– eine geringere Mittendicke als das fertige<br />
<strong>Brillenglas</strong> (BG). Wie die Abbildung (Seite G 10)<br />
zeigt, sind beim <strong>Brillenglas</strong> die Hauptebenen weiter<br />
zur Konvexseite verlagert als beim Refraktionsmeßglas.<br />
Daraus resultieren unterschiedliche bildseitige Brennweiten<br />
(f’ RG<br />
< f’ BG<br />
), die bildseitigen Schnittweiten aber<br />
sind gleich groß (s’ RG<br />
= s’ BG<br />
). Da der Kehrwert der<br />
Brennweite f’ dem Brechwert D und der Kehrwert der<br />
Schnittweite s’ dem Scheitelbrechwert S’ entspricht,<br />
haben Refraktionsmeßglas und <strong>Brillenglas</strong> unterschiedliche<br />
Brechwerte D, aber gleiche Scheitelbrechwerte S’.<br />
08. 2000<br />
G9
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Meß- und Gebrauchswert<br />
Unterschiedliche Brechwerte D haben beim Blick in die<br />
Nähe unterschiedliche Abbildungsfälle zur Folge (Abbildungen<br />
Seite G 11).<br />
H H’<br />
F S’ F’<br />
s’ RG<br />
f’ RG<br />
Refraktionsmeßglas (RG)<br />
Beispiel:<br />
Wird ein Objekt bei einer Leseentfernung von 40 cm<br />
durch ein Refraktionsmeßglas mit S’ = + 5,0 dpt scharf<br />
auf die Netzhaut abgebildet (obere Abbildung Seite<br />
G 11), so wird das gleiche Objekt durch ein <strong>Brillenglas</strong><br />
mit gleicher dioptrischer Wirkung bei gleichem HSA<br />
hinter die Netzhaut abgebildet. Das <strong>Brillenglas</strong> ist<br />
für den Benutzer zu schwach (mittlere Abbildung Seite<br />
G 11).<br />
s’ BG<br />
= s’ RG<br />
f’ BG<br />
> f’ RG<br />
H H’<br />
F S’ F’<br />
s’ BG<br />
Der presbyope Brillenträger hat nun mit dem zu schwachen<br />
<strong>Brillenglas</strong> zwei Möglichkeiten, das Objekt scharf<br />
zu sehen:<br />
Er muß stärker akkommodieren<br />
Er vergrößert die Leseentfernung (>40 cm; siehe<br />
Abbildung Seite G 11 unten)<br />
Beide Möglichkeiten entsprechen nicht dem Ergebnis,<br />
das laut <strong>Brillenglas</strong>bestimmung erzielt werden soll.<br />
Eine Korrektur der dioptrischen Wirkung des <strong>Brillenglas</strong>es<br />
ist also notwendig.<br />
f’ BG<br />
<strong>Brillenglas</strong> (BG)<br />
Damit das <strong>Brillenglas</strong> für das Sehen in die Nähe dieselbe<br />
Wirkung hat wie das Refraktionsmeßglas bei der<br />
<strong>Brillenglas</strong>bestimmung, wird der notwendige Korrekturwert<br />
addiert. Das <strong>Brillenglas</strong> hat dann einen<br />
stärker positiven Scheitelbrechwert. Im oben erwähnten<br />
Beispiel würde ein <strong>Brillenglas</strong> mit S’ = + 5,25 dpt<br />
benötigt (Abbildung Seite G 12 oben). Der Korrekturwert<br />
wird bei Bifokal-, Trifokal- und Gleitsichtgläsern<br />
von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> für eine normierte Gebrauchssituation<br />
berechnet und automatisch im <strong>Brillenglas</strong> verwirklicht.<br />
Bei Einstärken-Lesebrillen wird kein Korrekturwert<br />
addiert. Dieser muß vom Augenoptiker bereits bei der<br />
<strong>Brillenglas</strong>bestimmung berücksichtigt werden.<br />
G10
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Meß- und Gebrauchswert<br />
Situation bei der <strong>Brillenglas</strong>bestimmung<br />
+5,0<br />
H<br />
H’<br />
O S’ O’<br />
Zwei Situationen mit <strong>Brillenglas</strong> ohne<br />
Berücksichtigung des Gebrauchswertes<br />
Beim Blick durch das Refraktionsmeßglas (Bsp.: + 5,0 dpt)<br />
wird in der gewünschten Leseentfernung scharf gesehen;<br />
das Bild O’ entsteht auf der Netzhaut<br />
+5,0<br />
H<br />
H’<br />
O S’ O’<br />
1. Ohne Berücksichtigung des Gebrauchswertes wird beim<br />
Blick durch das <strong>Brillenglas</strong> (Bsp.: + 5,0 dpt) in der<br />
gewünschten Leseentfernung unscharf gesehen; das Bild O’<br />
entsteht hinter der Netzhaut<br />
+5,0<br />
H<br />
H’<br />
O S’ O’<br />
2. Der Brillenträger muß ohne Berücksichtigung des Gebrauchswertes<br />
die Leseentfernung vergrößern, um scharf<br />
zu sehen (Bsp.: + 5,0 dpt); das Bild O’ entsteht auf der<br />
Netzhaut<br />
G11
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Meß- und Gebrauchswert<br />
Situation mit <strong>Brillenglas</strong> unter<br />
Berücksichtigung des Gebrauchswertes<br />
H<br />
+5,25<br />
H’<br />
O S’ O’<br />
Beim Blick durch das <strong>Brillenglas</strong> (Bsp.: + 5,25 dpt) wird in<br />
der gewünschten Leseentfernung scharf gesehen; das Bild O’<br />
entsteht auf der Netzhaut<br />
Der Strahlengang bei der Messung<br />
und im Gebrauch<br />
Die dioptrische Wirkung eines <strong>Brillenglas</strong>es ist immer<br />
abhängig von dem Strahlenverlauf, für den sie ermittelt<br />
wird. Insbesondere bei Bifokal-, Trifokal- und Gleitsichtgläsern<br />
unterscheidet sich der Gebrauchsstrahlengang<br />
beim Blick in die Nähe deutlich vom Meßstrahlengang.<br />
Deshalb wird ein anderer dioptrischer<br />
Wert im Scheitelbrechwert-Meßgerät ermittelt, als der<br />
vor dem Auge des Brillenträgers wirksame Wert.<br />
Objekt in ∞<br />
Meßwert:<br />
+7,26<br />
Hauptstrahl des zentral abbildenden Bündels<br />
Strahlengang bei der Messung: Der Hauptstrahl trifft senkrecht<br />
auf die augenseitige <strong>Brillenglas</strong>fläche<br />
F’<br />
Im Scheitelbrechwert-Meßgerät wird die dioptrische<br />
Wirkung S’ mit Hilfe eines Parallelmeßbündels ermittelt.<br />
Das Scheitelbrechwert-Meßgerät mißt somit die<br />
bildseitige Schnittweite für ein unendlich fernes<br />
Objekt. Die Auflage des Gerätes fixiert das <strong>Brillenglas</strong><br />
so, daß der Hauptstrahl des Meßbündels das <strong>Brillenglas</strong><br />
unter 90° verläßt. In der Gebrauchssituation beim<br />
Blick in die Nähe ist der Strahlengang ein anderer:<br />
Hier geht vom nahen Objekt ein divergentes Strahlenbündel<br />
aus. Prismatische Nebenwirkungen im Nahbezugspunkt<br />
des <strong>Brillenglas</strong>es bewirken beim Blick in die<br />
Nähe eine Ablenkung der zentral abbildenden Hauptstrahlen,<br />
so daß der Hauptstrahl nicht senkrecht auf<br />
der augenseitigen Glasfläche steht. Vor dem Auge<br />
wirkt nicht derselbe dioptrische Wert wie bei der<br />
Messung im Scheitelbrechwert-Meßgerät. Brillengläser<br />
von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> werden so gefertigt, daß der bestellte<br />
Wert vor dem Auge wirksam ist. Zur Messung im<br />
Scheitelbrechwert-Meßgerät wird der Meßwert angegeben.<br />
G12
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Meß- und Gebrauchswert<br />
O’<br />
Gebrauchswert<br />
+7,0 dpt<br />
Hauptstrahl des zentral abbildenden Bündels<br />
Durch das schräge Strahlenbündel entstehen beim<br />
Blick in die Nähe zusätzlich astigmatische Abweichungen,<br />
die korrigiert werden müssen. Dieser Korrekturwert<br />
wird ebenfalls bei der Berechnung aller Bifokal-,<br />
Trifokal- und Gleitsichtgläser von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> berücksichtigt.<br />
Strahlengang im Gebrauch: Der Hauptstrahl steht<br />
schräg auf der augenseitigen <strong>Brillenglas</strong>fläche<br />
Vorteile gebrauchsrichtiger<br />
Brillengläser von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong><br />
Der Nah-Meßwert aller Mehrstärkengläser von <strong>Carl</strong><br />
<strong>Zeiss</strong> enthält folgende Korrekturen:<br />
Berücksichtigung der unterschiedlichen Geometrie<br />
von Refraktionsmeßglas und <strong>Brillenglas</strong><br />
Berücksichtigung der unterschiedlichen Strahlengänge<br />
bei der Messung im Scheitelbrechwert-Meßgerät<br />
und im Gebrauch<br />
Korrektur des Astigmatismus schiefer Bündel beim<br />
Blick in die Nähe<br />
Durch die Berücksichtigung aller Korrekturwerte findet<br />
der Brillenträger in der Gebrauchssituation genau die<br />
Wirkung vor, die er bei der <strong>Brillenglas</strong>bestimmung als<br />
die optimale empfunden hat. Alle Bifokal-, Trifokalund<br />
Gleitsichtgläser von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> sind somit<br />
gebrauchsrichtig.<br />
G13
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Meß- und Gebrauchswert<br />
Die normierte Gebrauchssituation<br />
Der Gebrauchswert für die Nähe wird für eine normierte<br />
Gebrauchssituation angegeben. Die Meßwerte der<br />
Brillengläser von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> sind für Additionen bis zu<br />
+ 2,50 dpt für einen Abstand von 380 mm berechnet.<br />
Für Additionen ab + 2,75 dpt wird der Arbeitsabstand<br />
kleiner, so daß eine additionsabhängige Berechnung<br />
notwendig wird (Objektabstand [mm] = 1000 /Add).<br />
Was steht auf der <strong>Brillenglas</strong>tüte?<br />
Auf den <strong>Brillenglas</strong>tüten der Bifokal-, Trifokal- und<br />
Gleitsichtgläser von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> sind sowohl der<br />
Gebrauchswert (= Bestellwert) als auch der Meßwert<br />
angegeben.<br />
Der angegebene Meßwert für die Nähe dient einzig<br />
und allein der Kontrolle im Scheitelbrechwert-<br />
Meßgerät. Ergibt sich beim Nachmessen von Bifokal-,<br />
Trifokal- und Gleitsichtgläsern im Scheitelbrechwert-<br />
Meßgerät dieser Meßwert, so sind vor dem Auge des<br />
Brillenträgers die bestellten Nahwerte für die normierte<br />
Gebrauchssituation wirksam.<br />
Die Angabe der Meßwerte erfolgt anhand der beiden<br />
Hauptschnittwirkungen und der Achslage für den<br />
ersten Hauptschnitt.<br />
Beispiel für die Angabe von Meß- und<br />
Gebrauchswert auf der <strong>Brillenglas</strong>tüte<br />
Gebrauchswerte sph cyl Achse Add<br />
+ 4,00 + 2,00 180 + 3,00<br />
Meßwerte 1. Hauptschnitt 2. Hauptschnitt Achse<br />
Ferne + 4,00 + 6,00 180<br />
Nähe + 7,26 + 9,40 1<br />
G14
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Meß- und Gebrauchswert<br />
Wie werden Mehrstärkengläser<br />
von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> nachgemessen?<br />
Zur Ermittlung des Fern- und Nahwertes der Bifokal-,<br />
Trifokal- und Gleitsichtgläser von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> findet das<br />
konkavseitige Meßverfahren Anwendung. Hierzu wird<br />
das Mehrstärkenglas, genau wie jedes Einstärkenglas,<br />
mit der augenseitigen Fläche, der Konkavfläche, auf<br />
die Auflage des Scheitelbrechwert-Meßgerätes gelegt.<br />
Die angegebenen Meßwerte können im Fern- und<br />
Nahbezugspunkt direkt überprüft werden.<br />
Messung bei Gleitsichtgläsern:<br />
Der Meßwert im Fernbezugspunkt wird oberhalb des<br />
Fernzentrierkreuzes innerhalb des Halbkreises (Meßkreis<br />
Ferne) nachgemessen. Im unteren Nahmeßkreis<br />
kann der Meßwert für die Nähe kontrolliert werden.<br />
Messung bei Bifokal- und Trifokalgläsern:<br />
Die Messung der dioptrischen Wirkung im Fern- und<br />
Nahbezugspunkt wird wie bei Einstärkengläsern durchgeführt.<br />
Im Nahbezugspunkt, der sich bei Bifokalgläsern<br />
5 mm unterhalb des Extrempunktes T der Nahteilkante<br />
befindet, wird der Meßwert für die Nähe<br />
kontrolliert.<br />
Ermittlung der Fernwirkung nach dem<br />
konkavseitigen Meßverfahren<br />
Ermittlung des Nahzusatzes nach dem<br />
konkavseitigen Meßverfahren<br />
G15
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Meß- und Gebrauchswert<br />
Meßwert für die Ferne<br />
Für die dioptrische Fernwirkung eines <strong>Brillenglas</strong>es ist<br />
eine Unterscheidung von Meß- und Gebrauchswert<br />
nicht notwendig. Die Geometrie von Refraktionsmeßglas<br />
und <strong>Brillenglas</strong> ist zwar unterschiedlich, aber der<br />
Abbildungsfall für die Ferne ist derselbe: Ein ferner<br />
Objektpunkt wird trotz unterschiedlicher Lage der<br />
Hauptebenen immer in den Fernpunkt R des Auges<br />
abgebildet. Das <strong>Brillenglas</strong> hat somit für den Gebrauch<br />
die richtige dioptrische Wirkung. Meß- und Gebrauchsstrahlengang<br />
sind annähernd gleich. Die Wirkung<br />
des <strong>Brillenglas</strong>es entspricht beim Gebrauch in<br />
der Ferne der Wirkung, die im Scheitelbrechwert-<br />
Meßgerät ermittelt wird.<br />
Prismatisches <strong>Brillenglas</strong><br />
bei der Messung im Scheitelbrechwert-Meßgerät<br />
Ausnahmen sind Lantal 1.8 Gradal Top E, Clarlet 1.67<br />
Gradal Top E sowie alle Gradal Individual Gleitsichtgläser.<br />
Hier werden für bestimmte Wirkungen vom<br />
Bestellwert abweichende Meßwerte für die Ferne<br />
angegeben, anhand deren die Kontrolle im Scheitelbrechwert-Meßgerät<br />
erfolgen kann.<br />
Prismatische Brillengläser<br />
Prismatisches <strong>Brillenglas</strong> im Gebrauch<br />
Auch bei prismatischen Brillengläsern von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong><br />
wird zwischen Meß- und Gebrauchswert unterschieden.<br />
Zum einen aufgrund der unterschiedlichen Geometrie<br />
von prismatischem Refraktionsmeßglas und<br />
prismatischem <strong>Brillenglas</strong>. Zum anderen aufgrund<br />
unterschiedlicher Strahlengänge bei der Messung im<br />
Scheitelbrechwert-Meßgerät und beim Gebrauch des<br />
prismatischen <strong>Brillenglas</strong>es.<br />
Bei prismatischen Verordnungen sollte das Prisma auf<br />
keinen Fall durch Dezentration erzeugt werden, da die<br />
Abbildungsqualität gegenüber Brillengläsern, die mit<br />
Prisma bestellt werden, erheblich verschlechtert ist.<br />
G16<br />
08. 2000
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
OPTIMA<br />
Grundlagen<br />
In den letzten Jahren wurden erhebliche Fortschritte<br />
hinsichtlich dünner und leichter Brillengläser erzielt.<br />
Dadurch konnte der Tragekomfort immer mehr verbessert<br />
werden. Die Entwicklung hochbrechender <strong>Brillenglas</strong>materialien<br />
hat dazu ebenso beigetragen wie die<br />
Berechnung und Fertigung asphärischer und atorischer<br />
Brillengläser.<br />
Ø 70<br />
Die Wahl des <strong>Brillenglas</strong>materials und der Flächengeometrie<br />
(Sphäre, Asphäre oder Atorus) ermöglicht es<br />
dem Augenoptiker, die Rand- und Mittendicke eines<br />
<strong>Brillenglas</strong>es zu beeinflussen. Darüber hinaus kann er<br />
die in der Brillenfassung sichtbare Rand- und Mittendicke<br />
entscheidend durch die Wahl einer geeigneten<br />
Brillenform und -größe bestimmen.<br />
Grundsätzlich gilt: Je kleiner die ausgewählte Brillenfassung,<br />
desto dünner kann das <strong>Brillenglas</strong> werden.<br />
Während bei Minusgläsern nur die Scheibengröße der<br />
Brillenfassung Einfluß auf die Randdicke hat, hängt bei<br />
Plusgläsern die Mittendicke entscheidend vom bestellten<br />
Rohglasdurchmesser ab. Je kleiner der bestellte<br />
Rohglasdurchmesser, desto dünner wird das Plusglas.<br />
Seit Mitte der 80er Jahre bietet <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> eine neue<br />
Technologie an, die in vielen Fällen eine weitere<br />
Reduktion der <strong>Brillenglas</strong>dicke ermöglicht. Mit der<br />
OPTIMA Dickenreduktion lassen sich vor allem bei<br />
Einstärken-Plusgläsern mit astigmatischer Wirkung,<br />
aber auch bei Gleitsichtgläsern und prismatischen<br />
Brillengläsern, Dicke und Gewicht, <strong>zum</strong> Teil über 50%,<br />
verringern.<br />
Beim Einarbeiten in die Fassung kann die Randdicke von<br />
Minusgläsern stark reduziert werden, selbst wenn ein großer<br />
Durchmesser bestellt wurde<br />
Die <strong>Brillenglas</strong>dicke hängt bei Plusgläsern entscheidend vom<br />
bestellten Durchmesser ab<br />
Ø 70<br />
Ø 60<br />
Mit dem computergestützten Verfahren OPTIMA kann<br />
die in der fertigen Brille sichtbare Rand- und Mittendicke<br />
der Brillengläser auf ein fertigungstechnisch realisierbares<br />
Minimum reduziert werden. Das <strong>Brillenglas</strong><br />
kann mit OPTIMA häufig noch sehr viel dünner gefertigt<br />
werden als es der kleinstmögliche Rohglasdurchmesser<br />
gestattet.<br />
G17
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
OPTIMA<br />
OPTIMA – das Prinzip<br />
Bei OPTIMA wird das <strong>Brillenglas</strong> über die gesamte<br />
+4,0 dpt<br />
RD min<br />
= 0,6 mm<br />
90°<br />
Rückfläche dünner geschliffen, ohne die dioptrische<br />
oder prismatische Wirkung zu verändern. Dadurch ergibt<br />
sich eine geringere Dicke, das fertige <strong>Brillenglas</strong><br />
ist aber auch kleiner. Dabei wird es nicht rohrund gefertigt,<br />
sondern der endgültigen <strong>Brillenglas</strong>form angenähert.<br />
Das <strong>Brillenglas</strong> ist an jeder Stelle gerade so<br />
groß wie es für die Verglasung notwendig ist. Es entsteht<br />
die typische Rohglasform der OPTIMA Brillengläser.<br />
180°<br />
0°<br />
+2,0 dpt<br />
RD max<br />
= 2,4 mm<br />
Ein Beispiel:<br />
sph +2,00 cyl +2,00 A 0°<br />
270°<br />
Hauptschnittwirkung in 0°:<br />
Hauptschnittwirkung in 90°:<br />
+2,00 dpt<br />
+4,00 dpt<br />
Optima<br />
Das <strong>Brillenglas</strong> im vorliegenden Beispiel hat – wie jedes<br />
<strong>Brillenglas</strong> mit astigmatischer Wirkung – in Richtung<br />
180°<br />
+4,0 dpt<br />
RD = 0,8 mm<br />
90°<br />
0°<br />
+2,0 dpt<br />
der beiden Hauptschnittwirkungen unterschiedliche<br />
Randdicken. Diese ergeben sich aus unterschiedlichen<br />
Rückflächenradien, die die astigmatische Wirkung<br />
erzeugen (Innentorus). Die maximale Randdicke<br />
(RD max<br />
) eines vorhandenen <strong>Brillenglas</strong>es liegt immer in<br />
Richtung der Pluszylinderachse. Für das Beispiel bedeutet<br />
dies, RD max<br />
liegt in Richtung 0°.<br />
RD = 1,9 mm<br />
Wird bei dem vorliegenden Beispiel nun die OPTIMA<br />
Dickenreduktion angewandt, so wird das <strong>Brillenglas</strong><br />
beim Abschleifen der Rückfläche an den dicken Stellen<br />
dünner (0° und 180°) und an den dünnen Stellen kleiner<br />
(90° und 270°). Auf diese Weise entsteht ein<br />
OPTIMA <strong>Brillenglas</strong> das seine größte Ausdehnung in<br />
Richtung des mathematisch schwächeren Hauptschnittes<br />
hat, nicht mehr rohrund und sehr dünn ist.<br />
G18
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
OPTIMA<br />
Wann ist OPTIMA sinnvoll?<br />
OPTIMA ist dann sinnvoll, wenn bei gegebenen Fassungs-<br />
und Zentrierdaten eine Dickenreduktion von<br />
mindestens ca. 0,5 mm erreicht wird. Bei jedem OPTI-<br />
MA Auftrag prüft der OPTIMA Kundenservice, ob sich<br />
dieser Wert erreichen läßt.<br />
Rohrundes<br />
<strong>Brillenglas</strong><br />
Ausgeliefertes Glas<br />
mit OPTIMA<br />
Folgende Faktoren bestimmen die Größe der<br />
Dickeneinsparung:<br />
<strong>Brillenglas</strong>form und -größe<br />
Zentrierdaten<br />
<strong>Brillenglas</strong>material<br />
Dioptrische und prismatische Wirkung<br />
<strong>Brillenglas</strong>typ (Einstärken-, Bifokal-, Trifokal- oder<br />
Gleitsichtglas)<br />
Eine Faustformel, die für alle <strong>Brillenglas</strong>typen eine<br />
Beurteilung ermöglicht, ob OPTIMA sinnvoll ist, gibt es<br />
nicht. Nachfolgende Tabelle zeigt jedoch, bei welchen<br />
<strong>Brillenglas</strong>typen eine OPTIMA Dickenreduktion, in Abhängigkeit<br />
von dioptrischer und prismatischer Wirkung,<br />
sinnvoll sein kann.<br />
Form des ausgelieferten<br />
Glases<br />
Formscheibe<br />
Dickeneinsparung<br />
Wann ist OPTIMA sinnvoll? –<br />
Eine Übersicht<br />
Glastyp Plusglas mit Minusglas mit <strong>Brillenglas</strong> mit <strong>Brillenglas</strong> mit<br />
sph. Wirkung sph. Wirkung astigm. Wirkung prismatischer Wirkung<br />
(1 HS positiv)<br />
Einstärken – –<br />
Je nach Kombination aus<br />
Wirkung und Basislage<br />
Bifokal , bei vorde- –<br />
zentrierten Bifokal-<br />
Je nach Kombination aus<br />
gläsern<br />
Wirkung und Basislage<br />
Gleitsicht –<br />
Je nach Kombination aus<br />
Wirkung und Basislage<br />
Mit OPTIMA kann häufig eine sinnvolle<br />
Dickeneinsparung erreicht werden<br />
G19
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
OPTIMA<br />
Da es eine Vielzahl von Wirkungskombinationen, vor<br />
allem bei Brillengläsern mit prismatischer Wirkung gibt,<br />
ist ohne Angabe der <strong>Brillenglas</strong>werte keine wirklich<br />
exakte Aussage zur Dickeneinsparung mit OPTIMA<br />
möglich. Nur eine exakte Berechnung z.B. durch den<br />
OPTIMA Kundenservice, kann Auskunft darüber geben,<br />
ob OPTIMA bei der gegebenen Wirkung sinnvoll ist.<br />
Die exakte Berechnung<br />
im Beratungsgespräch<br />
Eine OPTIMA Berechnung läßt sich mit Hilfe des<br />
<strong>Brillenglas</strong>beratungsprogramms Infral/Winfral bereits<br />
während des Beratungsgesprächs durchführen. Es können<br />
sofort genaue Aussagen über das Ausmaß der<br />
Dickenreduktion mit OPTIMA gemacht werden. Alle<br />
Einflüsse werden direkt berücksichtigt und können in<br />
das Beratungsgespräch einfließen.<br />
Clarlet 1.6 AS sph -0,50 pr. 7 cm/m Basis innen<br />
G20<br />
Clarlet 1.5, sph +2,0, cyl +2,0, A 0°
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
OPTIMA<br />
Bestellung<br />
Angabe der Zentrierdaten (Anpaßpunkthöhe und<br />
Zentrierpunktabstand):<br />
Bei Einstärkengläsern Zentrierpunkte einzeichnen<br />
Bei Mehrstärkengläsern Extrempunkte der<br />
Nahteilkante einzeichnen<br />
Bei Gleitsichtgläsern Fernzentrierkreuze einzeichnen<br />
Angabe der <strong>Brillenglas</strong>form:<br />
Bei Brillenfassungen von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> ist die Angabe<br />
der Modellnummer sowie der Fassungsmaße<br />
ausreichend<br />
Ansonsten ist die Zeichnung der Glasform mit<br />
Zentrierangaben erforderlich<br />
Soweit technisch möglich, kann eine gewünschte<br />
Mindestrand- und Mindestmittendicke (z.B. bei<br />
Nylorfassungen oder Bohrbrillen) berücksichtigt<br />
werden<br />
OPTIMA kann<br />
per Post oder Botendienst,<br />
per Fax,<br />
per DFÜ (<strong>Zeiss</strong>-DIRECT) und<br />
bei Brillenfassungen von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> per Telefon<br />
bestellt werden<br />
G21
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
OPTIMA<br />
Wie schlank macht OPTIMA?<br />
– Ein Rechenbeispiel<br />
Für die nebenstehend abgebildete Fassung wurden<br />
Mittendicke, minimale und maximal Randdicke sowie<br />
das Gewicht berechnet.<br />
<strong>Brillenglas</strong>daten:<br />
sph +2,00 cyl +2,00 A 0°<br />
Punktal 1.5 ( n = 1,525) ∅ 60<br />
Fern-PD: 60 mm<br />
Rohrundes Glas Formgerandetes Formgerandetes<br />
Glas ohne OPTIMA Glas mit OPTIMA<br />
Mittendicke [mm] 4,1 4,1 2,5<br />
Randdicke (min) [mm] 0,6 2,4 0,8<br />
Randdicke (max) [mm] 2,4 3,4 1,9<br />
Gewicht [g] 20,2 12,0 6,4<br />
Das Ergebnis kann sich sehen lassen:<br />
Mittendickenreduzierung von 4,1 mm auf 2,5 mm<br />
Gewichtsreduzierung von 12 g auf 6,4 g<br />
Darf es noch leichter sein?<br />
Ein Clarlet 1.6 AS <strong>Brillenglas</strong> würde bei gegebenen<br />
Daten mit OPTIMA nur noch 3,5 g wiegen!<br />
G22
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Slab-off-Schliff<br />
Definition<br />
Der Slab-off-Schliff ist eine bei Mehrstärken- und Gleitsichtgläsern<br />
angewandte Schleiftechnik zur Erzeugung<br />
eines Höhenausgleichprismas. Durch den Slab-off-<br />
Schliff ergibt sich auf dem <strong>Brillenglas</strong> eine kaum merkliche<br />
waagerechte Trennlinie, die über die gesamte<br />
Breite des <strong>Brillenglas</strong>es verläuft.<br />
Grundlagen<br />
Eine Mehrstärken- oder Gleitsichtbrille mit Slab-off-<br />
Schliff kann bei Alterssichtigkeit (Presbyopie) notwendig<br />
werden, wenn zusätzlich eine Ungleichsichtigkeit<br />
(Anisometropie) vorliegt. Von Anisometropie spricht<br />
man bereits bei einer Differenz der Fernpunktrefraktionen<br />
des rechten und linken Auges von 0,25 dpt.<br />
Sehprobleme, die beim Tragen von Mehrstärkengläsern<br />
aufgrund einer Anisometropie auftreten können,<br />
sind jedoch meist erst ab einer Differenz der Fernpunktrefraktionen<br />
von ca. 1,5 dpt zu erwarten. Sie<br />
können dann mit Hilfe eines Slab-off-Schliffes behoben<br />
werden.<br />
Welche Sehprobleme können sich für den presbyopen<br />
und zugleich anisometropen Brillenträger ergeben?<br />
Blick durch den Bezugspunkt<br />
Führt ein Brillenträger Blickbewegungen hinter dem<br />
<strong>Brillenglas</strong> aus, schaut er nicht mehr durch den Bezugspunkt<br />
(bei nichtprismatischen Werten = optischer<br />
Mittelpunkt), sondern durch die Randbereiche der Brillengläser.<br />
Dadurch ergeben sich prismatische Nebenwirkungen,<br />
d.h. der Hauptstrahl wird prismatisch abgelenkt.<br />
Bei Blicksenkung liegt dann das vom Brillenträger<br />
fixierte Zwischenbild entweder oberhalb (Minusglas)<br />
oder unterhalb (Plusglas) des realen Objektes.<br />
Objekt<br />
Zwischenbild<br />
Blick außerhalb des Bezugspunktes:<br />
Der Brillenträger fixiert das entstehende Zwischenbild<br />
G23
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Slab-off-Schliff<br />
Die vor beiden Augen entstehenden Zwischenbilder<br />
beim Blick durch die Randbereiche der Brille liegen bei<br />
Anisometropie wegen unterschiedlicher prismatischer<br />
Nebenwirkungen rechts und links auf unterschiedlicher<br />
Höhe. Überschreitet diese prismatische Höhendifferenz<br />
einen vom Brillenträger kompensierbaren<br />
Wert, ist es ihm nicht mehr oder nur bedingt möglich,<br />
die Zwischenbilder des rechten und linken Auges zu<br />
einem ungestörten binokularen Seheindruck zu fusionieren.<br />
Im Extremfall nimmt der Brillenträger Doppelbilder<br />
wahr. Häufiger jedoch erscheinen die Buchstaben beim<br />
Lesen unscharf und längeres Lesen ist für den Brillenträger<br />
ungewohnt anstrengend. Die Folge können<br />
asthenopische Beschwerden wie beispielsweise Kopfschmerz<br />
oder Augenbrennen sein.<br />
Mit dem Slab-off-Schliff wird erreicht, daß die Zwischenbilder<br />
beim Lesen mit einer Mehrstärkenbrille vor dem<br />
rechten und linken Auge wieder auf gleicher Höhe liegen.<br />
Ungestörtes und beschwerdefreies Binokularsehen<br />
in die Nähe ist dann wieder möglich.<br />
Rechtes Auge<br />
Linkes Auge<br />
Objekt<br />
Objekt<br />
Zwischenbild<br />
Unterschiedliche Höhe der<br />
Zwischenbilder vor dem rechten<br />
und linken Auge bei<br />
Anisometropie beim Blick<br />
in die Nähe<br />
Zwischenbild<br />
G24
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Slab-off-Schliff<br />
Warum machen sich die Sehprobleme meist erst bei<br />
Mehrstärkengläsern und noch nicht bei Einstärkengläsern<br />
bemerkbar?<br />
Bei Einstärkengläsern kann der Anisometrope durch<br />
stärkere Kopfbewegungen erreichen, daß er immer<br />
annähernd durch den Bezugspunkt des <strong>Brillenglas</strong>es<br />
schaut. Er vermeidet dadurch prismatische Nebenwirkungen<br />
und somit auch eine prismatische Differenz<br />
zwischen rechtem und linkem Glas.<br />
Beim Mehrstärkenglas dagegen wird der Brillenträger<br />
wegen des Glasdesigns gezwungen, <strong>zum</strong> Lesen den<br />
Blick zu senken. Kompensierende Kopfbewegungen<br />
<strong>zum</strong> Ausgleich prismatischer Nebenwirkungen sind<br />
nicht mehr möglich.<br />
Erhält der presbyope, anisometrope Brillenträger seine<br />
erste Mehrstärkenbrille, können also erstmals Sehprobleme<br />
beim Lesen entstehen, die mit der bisher getragenen<br />
Einstärkenbrille nicht aufgetreten sind.<br />
Beim Einstärkenglas Kopfbewegung möglich<br />
Beim Mehrstärkenglas<br />
Blicksenkung erforderlich<br />
G25
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Slab-off-Schliff<br />
Wirkungsweise am Beispiel von<br />
Bifokalgläsern<br />
Der Slab-off-Schliff ist ein Höhenausgleichsprisma für<br />
die Nähe mit Basis 90°, das stets auf dem mathematisch<br />
negativeren Mehrstärken- oder Gleitsichtglas<br />
(schwächeres Plus- bzw. stärkeres Minusglas) verwirklicht<br />
wird.<br />
Beim Blick durch die Nahteile bzw. Nahbereiche der<br />
Brillengläser wird der Hauptstrahl hinter dem mathematisch<br />
negativeren <strong>Brillenglas</strong> mit Hilfe des Höhenausgleichprismas<br />
wieder um den gleichen Betrag abgelenkt,<br />
wie der Hauptstrahl hinter dem mathematisch<br />
positiveren <strong>Brillenglas</strong>. Die prismatischen Nebenwirkungen<br />
im Bezugspunkt Nähe B N<br />
sind somit rechts<br />
und links wieder gleich. Folglich liegen die Zwischenbilder<br />
rechts und links wieder auf gleicher Höhe. Sie<br />
können problemlos beim Blick durch die Nahteile bzw.<br />
Nahbereiche fixiert und zu einem ungestörten binokularen<br />
Seheindruck fusioniert werden. Ungestörtes und<br />
beschwerdefreies Binokularsehen in die Nähe ist wieder<br />
möglich.<br />
Rechtes Auge<br />
Linkes Auge<br />
Die Zwischenbilder vor dem rechten und<br />
linken Auge liegen dank Slab-off-Schliff<br />
wieder auf gleicher Höhe<br />
G26
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Slab-off-Schliff<br />
Fertigung eines Slab-off-Schliffs<br />
bei Bifokalgläsern<br />
Fertigungsbedingungen<br />
Die Slab-off-Kante, die sich bei Bifokalgläsern auf der<br />
Glasvorderseite befindet und mit dem Extrempunkt T<br />
der Nahteiloberkante zusammenfällt, kann fertigungstechnisch<br />
erst ab einem Prisma von 1,5 cm/m realisiert<br />
werden. Dies entspricht in etwa einer Anisometropie<br />
von 1,5 dpt.<br />
Fertigung<br />
Das Halbfabrikat (HF) wird auf der Vorderfläche im<br />
Fernteil schräg abgeschliffen, so daß in der Ferne eine<br />
prismatische Wirkung Basis unten entsteht. Anschließend<br />
erfolgt das Schleifen der Rezeptfläche.<br />
Hierbei wird das modifizierte Halbfabrikat schräg<br />
aufgeblockt, um das Prisma im Fernteil wieder aufzuheben<br />
und nur in der Nähe ein Prisma Basis oben<br />
zu erreichen.<br />
Schleifen des<br />
Fernteils auf der<br />
HF-Vorderseite<br />
HF mit<br />
modifiziertem<br />
Fernteil<br />
Schleifen der<br />
Rezeptfläche<br />
Bifokalglas mit<br />
Slab-off-Schliff<br />
Nicht möglich<br />
Slab-off bei organischen Bifokalgläsern, da fertigungstechnisch<br />
keine saubere Slab-off-Kante erzielt<br />
werden kann<br />
OPTIMA auf dem mit Slab-off-Schliff gefertigten<br />
Bifokalglas. Auf dem Gegenglas ohne Slab-off bietet<br />
OPTIMA jedoch häufig eine sinnvolle Dickenersparnis,<br />
wodurch bei Plusgläsern ein Dickenangleich<br />
beider Gläser erreicht wird<br />
Lieferbare Glasarten<br />
Duopal C 28<br />
Duopal 1.6 C 25<br />
Duopal 1.6 C 30<br />
G27
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Slab-off-Schliff<br />
Slab-off-Schliff bei<br />
Gleitsichtgläsern<br />
Bei Bifokalgläsern ist der Slab-off-Schliff seit langem<br />
bekannt und bewährt. Da jedoch Gleitsichtgläser in den<br />
letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen<br />
haben und die Bifokalbrille fast vollständig durch die<br />
Gleitsichtbrille abgelöst worden ist, bestand die Notwendigkeit,<br />
Anisometropen auch mit Gleitsichtgläsern<br />
ein problemloses Binokularsehen zu ermöglichen.<br />
Die Fertigung des Slab-off-Schliffs bei Gleitsichtgläsern<br />
war jedoch technisch lange nicht möglich. <strong>Carl</strong><br />
<strong>Zeiss</strong> ist es als bisher einzigem Hersteller gelungen, das<br />
extrem aufwendige Verfahren umzusetzen.<br />
Im Gegensatz <strong>zum</strong> Slab-off-Schliff bei Bifokalgläsern<br />
müssen bei Gleitsichtgläsern nicht nur in den Bezugspunkten<br />
für die Nähe, sondern zusätzlich in den Bezugspunkten<br />
für die Ferne prismatische Differenzen<br />
kompensiert werden.<br />
Da ein Bifokalglas im Fernteil wie ein Einstärkenglas<br />
∆pr. = 0<br />
Gleitsichtgläser ohne Slab-off-Schliff<br />
wirkt, sind beim Blick durch die Fernbezugspunkte B F<br />
keine prismatischen Nebenwirkungen und somit keine<br />
prismatischen Differenzen zwischen rechtem und linkem<br />
<strong>Brillenglas</strong> vorhanden. Bei Gleitsichtgläsern ohne<br />
Slab-off ist die prismatische Differenz jedoch nur in<br />
den prismatischen Meßpunkten gleich Null. Sowohl in<br />
den Fern- als auch in den Nahbezugspunkten ist eine<br />
prismatische Differenz zwischen rechtem und linkem<br />
Glas vorhanden, sobald die dioptrische Wirkung rechts<br />
und links unterschiedlich ist.<br />
G28
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Slab-off-Schliff<br />
Die prismatische Differenz in den Fernbezugspunkten<br />
wird bei Gleitsichtgläsern mit Slab-off durch Aufschleifen<br />
eines Prismas über die gesamte Rezeptfläche aufgehoben.<br />
Die prismatische Differenz in den Nahbezugspunkten<br />
läßt sich beim Gleitsichtglas, genau wie<br />
beim Bifokalglas, mit Hilfe eines Slab-off-Schliffs ausgleichen.<br />
Das Höhenausgleichsprisma wird mit Basis<br />
90° auf dem mathematisch negativeren <strong>Brillenglas</strong><br />
(schwächeres Plus- bzw. stärkeres Minusglas) verwirklicht.<br />
Der Slab-off-Schliff bei Gleitsichtgläsern erlaubt dem<br />
anisometropen Brillenträger die Vorzüge eines Gleitsichtglases<br />
zu nutzen. Zwar ist das <strong>Brillenglas</strong> wegen<br />
der Slab-off-Kante auf Höhe des prismatischen Meßpunktes<br />
nicht nutzbar, dennoch kann der Anisometrope<br />
mehr Sehbereiche nutzen als mit einer Bifokalbrille.<br />
∆pr. = 0<br />
∆pr. = 0<br />
Gleitsichtgläser mit Slab-off-Schliff<br />
Beispiel für die prismatischen Wirkungen<br />
bei einem Gleitsichtglas:<br />
R +3,0, L +5,0<br />
Add.: 2,0<br />
Ohne Slab-off Mit Slab-off<br />
R L R L<br />
Meßkreis Ferne 3,3 B.u. 4,5 B.u. 4,5 B.u. 4,5 B.u.<br />
pr. Meßpunkt 1,2 B.u. 1,2 B.u. 2,4 B.u. 1,2 B.u.<br />
Meßkreis Nähe 4,7 B.o. 7,2 B.o. 7,2 B.o. 7,2 B.o.<br />
B. u. = Basis unten<br />
B. o. = Basis oben<br />
Bifokalgläser<br />
Gleitsichtgläser<br />
Prisma für<br />
die Ferne<br />
Prisma<br />
für die Nähe<br />
Prisma für<br />
die Nähe<br />
08. 2000<br />
G29
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Slab-off-Schliff<br />
Fertigung eines Slab-off-Schliffs<br />
bei Gleitsichtgläsern<br />
Fertigungsbedingungen<br />
Die Slab-off-Kante, die sich bei Gleitsichtgläsern auf<br />
der Glasrückseite befindet und ca. 0,5 mm unterhalb<br />
des prismatischen Meßpunktes liegt, kann fertigungstechnisch<br />
erst ab einem Prisma von 2,0 cm/m realisiert<br />
werden. Dies entspricht in etwa einer Anisometropie<br />
von 1,75 dpt.<br />
Fertigung<br />
Der Ausgleich der prismatischen Differenz in den Fernzentrierkreuzen<br />
wird bereits beim Schleifen der Rezeptfläche<br />
berücksichtigt.<br />
Gleitsichtglas<br />
mit fertiger<br />
Rezeptfläche<br />
Verkitten von<br />
Gleitsichtglas<br />
und Hilfslinse<br />
Schleifen des<br />
Slab-off<br />
Abkitten der<br />
Hilfslinse<br />
Der eigentliche Slab-off-Schliff für Gleitsichtgläser<br />
wird dann auf die fertig geschliffenen Gleitsichtgläser<br />
aufgebracht. Nach Aufkitten einer Hilfslinse auf die<br />
Rezeptfläche muß der Verbund ca. 24 Stunden aushärten.<br />
Anschließend wird das Gleitsichtglas auf der<br />
Vorderfläche schräg aufgeblockt so daß im unteren<br />
Glasbereich auf die Rückfläche die erforderliche prismatische<br />
Wirkung für die Nähe geschliffen werden<br />
kann.<br />
Nicht möglich<br />
Slab-off bei organischen Gleitsichtgläsern, da fertigungstechnisch<br />
keine saubere Slab-off-Kante erzielt<br />
werden kann<br />
OPTIMA auf dem mit Slab-off-Schliff gefertigten<br />
Gleitsichtglas. Auf dem Gegenglas ohne Slab-off<br />
bietet OPTIMA jedoch häufig eine sinnvolle Dickenersparnis,<br />
wodurch bei Plusgläsern ein Dickenangleich<br />
beider Gläser erreicht wird<br />
Lieferbare Glasarten<br />
Gradal HS<br />
Gradal Top<br />
Lantal 1.8 Gradal Top<br />
G30
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Anpassung von<br />
<strong>Zeiss</strong> Brillengläsern<br />
Um optimalen Sehkomfort zu gewährleisten, ist eine<br />
exakte und je nach Glastyp unterschiedliche optische<br />
Brillenanpassung notwendig. Die folgenden Zentrierempfehlungen<br />
für <strong>Zeiss</strong> Brillengläser berücksichtigen<br />
die jeweiligen Zentrierforderungen – Augendrehpunkt-,<br />
Bezugspunkt- und Blickfeldforderung – entsprechend<br />
ihrer Priorität.<br />
Nach der anatomischen Voranpassung der Brille<br />
sollte die gewählte Brillenfassung<br />
auf einen Hornhautscheitel-Abstand ( HSA ) angepaßt<br />
sein, der zwischen 12 und 16 mm liegt und<br />
eine Vorneigung zwischen 8° und 12° besitzen.<br />
<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> Brillengläser sind für diese Parameter berechnet<br />
und haben für diese ihre optimale Wirkung. Die<br />
empfohlenen Richtwerte können aufgrund anatomischer<br />
Gegebenheiten oder einer außergewöhnlichen<br />
Fassungsform nicht immer eingehalten werden. Dies<br />
sollte dann vom Augenoptiker bei der <strong>Brillenglas</strong>bestimmung<br />
und -bestellung berücksichtigt werden.<br />
Seitenzentrierung von<br />
<strong>Zeiss</strong> Brillengläsern<br />
ohne prismatische Wirkung<br />
Fern-PD<br />
Der Zentrierpunktabstand sollte dem Pupillenmittenabstand<br />
beim Blick in die Ferne entsprechen (Fern-PD).<br />
Dies gilt für alle Brillengläser von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>:<br />
Einstärkengläser für die Nähe und die Ferne<br />
Clarlet Business, das Glas für den erweiterten Nahbereich<br />
Gradal Gleitsichtgläser<br />
Bifokal- und Trifokalgläser – üblich ist es, bei der<br />
Seitenzentrierung die Extrempunkte T der Zusatzteile<br />
als Bezugspunkte zu verwenden. Diese werden, aus<br />
gehend von der Fern-PD, jeweils 2,5 mm nasal versetzt<br />
angezeichnet<br />
Seitenzentrierung von <strong>Zeiss</strong> Brillengläsern<br />
ohne prismatische Wirkung<br />
G31
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Anpassung von<br />
<strong>Zeiss</strong> Brillengläsern<br />
Höhenzentrierung von<br />
<strong>Zeiss</strong> Brillengläsern<br />
Einstärkengläser und Clarlet Business<br />
Bei der Anpassung von Einstärkengläsern und Clarlet<br />
Business sollte die Augendrehpunktforderung erfüllt<br />
werden. Zur Ermittlung der Höhenzentrierung gibt es<br />
zwei Möglichkeiten:<br />
Der Kunde hebt den Kopf, bis die Fassungsebene<br />
senkrecht steht. Bei Nullblickrichtung werden nun<br />
die Lagen der Pupillenmitten markiert.<br />
Bei natürlicher Kopf- und Körperhaltung werden die<br />
Lagen der Pupillenmitten bei Nullblickrichtung markiert.<br />
Es gilt dann die Praxisformel: Pro Grad Vorneigung<br />
der Fassung muß der optische Zentrierpunkt,<br />
ausgehend vom Nulldurchblickpunkt, um 0,5 mm<br />
nach unten verschoben werden.<br />
Extrempunkt T und Inset e bei Duopal C 28<br />
Bei Clarlet Business sollte der Meßkreis Nähe voll erhalten<br />
bleiben, die Mindesthöhe der Zentrierung, gemessen<br />
vom unteren Fassungsrand, also mindestens<br />
18 mm betragen.<br />
Gleitsichtgläser<br />
Zur Zentrierung von Gleitsichtgläsern werden die Lagen<br />
der Pupillenmitten bei Nullblickrichtung und natürlicher<br />
Kopf- und Körperhaltung des Kunden markiert.<br />
Um die Nutzbarkeit der Nahwirkung zu gewährleisten,<br />
sollte die Mindesteinschleifhöhe bei Gradal RD 25 mm,<br />
bei Gradal Individual 20 mm, bei allen anderen Gradal<br />
Gleitsichtgläsern 22 mm betragen (gemessen vom<br />
unteren Fassungsrand).<br />
Bifokal- und Trifokalgläser<br />
Bei Bifokalgläsern wird die Höhe der unteren Irisrän-<br />
G32<br />
Natürliche Kopfhaltung<br />
Kopfhaltung zur Markierung<br />
der Höhenzentrierung nach<br />
Augendrehpunktforderung<br />
(Fassungsebene senkrecht)<br />
der, bei Trifokalgläsern die der unteren Pupillenränder<br />
bei natürlicher Kopf- und Körperhaltung angezeichnet.<br />
Die Markierung gibt die Höhe des Extrempunktes T<br />
des Zusatzteils an, nach der die Gläser in die Fassung<br />
eingearbeitet werden. Individuelle Anforderungen des<br />
Brillenträgers sollten bei der Festlegung der Nahteilhöhen<br />
stets berücksichtigt werden. Unterschiedliche<br />
Nahteilhöhen aufgrund anatomischer Gegebenheiten<br />
sind wegen des binokularen Blickfeldes zu berücksichtigen.<br />
08. 2000
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Anpassung von<br />
<strong>Zeiss</strong> Brillengläsern<br />
Zentrierung von <strong>Zeiss</strong><br />
Brillengläsern mit prismatischer<br />
Wirkung<br />
Bei prismatischen Verordnungen sind die ermittelten<br />
Zentrierpunkte beim Einschleifen der Gläser – bei PMZ<br />
und Formelfall – um 0,25 mm pro 1 cm/m entgegengesetzt<br />
zur Basis zu versetzen. Dadurch wird die Nachstellbewegung<br />
der Augen bei prismatischen Brillengläsern<br />
berücksichtigt.<br />
Pupillenmittenzentrierung PMZ<br />
Wurde bei der <strong>Brillenglas</strong>bestimmung die Meßbrille<br />
nicht nachgestellt, spricht man von der Pupillenmittenzentrierung<br />
PMZ. Dann muß neben der oben genannten<br />
Vorgehensweise (0,25 mm pro 1 cm/m entgegengesetzt<br />
zur Basis) bei der <strong>Brillenglas</strong>bestellung die<br />
Angabe “PMZ” vermerkt sein. Dies ist notwendig, da<br />
bei der <strong>Brillenglas</strong>bestimmung neben den Korrektionsprismen<br />
auch die prismatischen Nebenwirkungen<br />
der sphärischen und zylindrischen Meßgläser wirken,<br />
wenn die Meßbrille nicht nachgestellt wird. <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong><br />
berücksichtigt dies dann bei der Berechnung und Fertigung<br />
der Brillengläser. Es gibt die Möglichkeit, sich<br />
eine PMZ-Kennziffer geben zu lassen, dann geht <strong>Carl</strong><br />
<strong>Zeiss</strong> von einer PMZ aus und ein zusätzlicher Vermerk<br />
ist nicht nötig.<br />
Höhenzentrierung bei natürlicher Kopf- und Körperhaltung<br />
von Gradal Gleitsichtgläsern, Trifokal- und Bifokalgläsern<br />
Gradal<br />
Trifokal<br />
Bifokal<br />
Formelfall<br />
Im sogenannten Formelfall wird die Meßbrille bei der<br />
<strong>Brillenglas</strong>bestimmung schon um 0,25 mm pro 1 cm/m<br />
nachgestellt. Für die Zentrierung der Brillengläser<br />
beim Einschleifen gilt dann zusätzlich die oben genannte<br />
Vorgehensweise (0,25 mm pro 1 cm/m entgegengesetzt<br />
zur Basis). Sofern bei der Bestellung nichts<br />
vermerkt ist oder keine PMZ-Kennziffer vorliegt, geht<br />
<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> bei der Berechnung und Fertigung prismatischer<br />
Brillengläser vom Formelfall aus.<br />
08. 2000<br />
Um eine exakte Fertigung prismatischer Brillengläser<br />
bei Sonderfällen zu gewährleisten, ist eine ausführliche<br />
Angabe aller bei der Messung verwendeter Parameter<br />
auf einem speziellen Bestellformular von <strong>Carl</strong><br />
<strong>Zeiss</strong> sinnvoll. Sonderfälle sind <strong>zum</strong> Beispiel hohe dioptrische<br />
Wirkungen in Verbindung mit hohen prismatischen<br />
Wirkungen oder Meßsituationen, in denen weder<br />
eine Pupillenmittenzentrierung noch der Formelfall angewandt<br />
werden.<br />
Berücksichtigung der Dezentration bei der <strong>Brillenglas</strong>bestimmung<br />
(Formelzentrierung)<br />
G33
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Anpassung von<br />
<strong>Zeiss</strong> Brillengläsern<br />
Zentrierung mit Video Infral<br />
Mit dem computergestützten Anpaß-System Video<br />
Infral lassen sich, ausgehend von der natürlichen Kopfund<br />
Körperhaltung, alle erforderlichen Zentrierdaten<br />
über zwei Videobilder hochpräzise ermitteln. Die richtige<br />
Lage der Zentrierpunkte wird aufgrund der geltenden<br />
Zentrierforderung, der dioptrischen Wirkung und<br />
des Glastyps automatisch errechnet und dargestellt.<br />
G34<br />
08. 2000
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Normen und Richtlinien<br />
Normen – ein notwendiger<br />
Rahmen für die Augenoptik<br />
Für die Schaffung grundlegender technischer Standards<br />
und die Festlegung von Verfahren und Begriffen in der<br />
Augenoptik sind das Deutsche Institut für Normung<br />
(DIN), das Europäische Komitee für Normung (CEN;<br />
Comité Européen de Normalisation) und die Internationale<br />
Organisation für Normung (ISO; International<br />
Organisation for Standardization) verantwortlich.<br />
Diese Institutionen erarbeiten und aktualisieren<br />
ständig die Parameter, die für Qualität und internationale<br />
Einheitlichkeit in der Augenoptik wesentlich sind.<br />
ISO<br />
Normen<br />
EU<br />
legt Richtlinien zu<br />
Grundanforderungen<br />
und Warenverkehr<br />
fest<br />
■ Verwaltung<br />
■ Öffentlichkeit<br />
■ Wirtschaft<br />
■ Technik<br />
wirken innerhalb<br />
einzelner<br />
Gremien bei<br />
Normierungen<br />
mit<br />
DIN<br />
CEN<br />
Normen<br />
harmonisiert<br />
bestehende<br />
Normen<br />
Produkt<br />
Normen<br />
Gesetze<br />
Bundesregierung<br />
verabschiedet<br />
Gesetze entsprechend<br />
der Richtlinien<br />
Das Erarbeiten von Normen innerhalb des DIN geschieht<br />
<strong>zum</strong> allgemeinen Nutzen und unter Beteiligung aller<br />
interessierten Kreise aus Wirtschaft, Technik, Wissenschaft,<br />
Verwaltung und Öffentlichkeit. Das DIN vertritt<br />
die Deutsche Normung im In- und Ausland und beteiligt<br />
sich wesentlich bei der Erstellung und Veröffentlichung<br />
von Normen innerhalb des CEN und der ISO.<br />
EG-Richtlinien und<br />
nationale Gesetze<br />
Innerhalb der Europäischen Union sollen Waren ungehindert<br />
verkehren können und Grundanforderungen an<br />
Sicherheit, Eignung und Leistung erfüllen. Hierfür gibt<br />
es EG-Richtlinien, die nach Umsetzung in das nationale<br />
Recht der einzelnen Mitgliedstaaten Rechtsgültigkeit<br />
haben.<br />
G35
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Normen und Richtlinien<br />
So sind für die Augenoptik, neben den Normen DIN<br />
5361 für Brillenfassungen, DIN EN ISO 14889 über<br />
grundlegende Anforderungen an Brillengläser, DIN EN<br />
ISO 8980/1-3 über die Anforderungen an spezielle<br />
Glastypen und DIN EN ISO 13666 mit der Festlegung<br />
augenoptischer Begriffe, die Richtlinien 89/686/EWG<br />
für Sonnenschutzgläser und 93/42/EWG für Medizinprodukte<br />
wesentlich. Letztere ist im Medizinproduktegesetz<br />
in Deutschland umgesetzt worden und behandelt<br />
unter anderem Brillengläser, Brillenfassungen,<br />
Contactlinsen und ophthalmologische Geräte.<br />
Die EU setzt ein Zeichen...<br />
Garantie-Zertifikat.<br />
Brillengläser<br />
von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>.<br />
PRÄZISION FÜR IHRE AUGEN<br />
Produkte, für die EG-Richtlinien und entsprechende<br />
Normen verabschiedet worden sind, unterliegen seit<br />
dem 14. Juni 1998 der Kennzeichnungspflicht durch<br />
das CE-Zeichen (CE: Communité Européen).<br />
20-880-d Printed in Germany<br />
Das CE-Zeichen wird vom Hersteller gut sichtbar und<br />
dauerhaft auf dem Produkt angebracht, sofern nicht,<br />
wie bei Brillengläsern, aus funktionellen Gründen darauf<br />
verzichtet werden muß. In solchen Fällen ist die<br />
Verpackung und Gebrauchsanweisung entsprechend<br />
gekennzeichnet.<br />
Das CE-Zeichen garantiert dem Verbraucher, daß die<br />
Mindestanforderung an Leistung und Sicherheit des<br />
Produkts in vorgeschriebenem Umfang erfüllt sind.<br />
Markenqualität von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong><br />
<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong><br />
Geschäftsbereich<br />
Augenoptik<br />
...und <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> setzt noch eins<br />
drauf!<br />
Der Geschäftsbereich Augenoptik von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> besitzt<br />
schon seit 1994 ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem<br />
nach DIN/ISO 9001, das weit über die Einhaltung<br />
der grundlegenden Anforderungen und Voraussetzungen<br />
zur Verwendung des CE-Zeichens hinausgeht.<br />
Dies bedeutet bei <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>: Eng gesteckte Toleranzen<br />
in Fertigung und Kontrolle und eine Produktbetreuung<br />
vom ersten Aufblocken des <strong>Brillenglas</strong>rohlings bis zur<br />
Auslieferung des Markenglases.<br />
G36<br />
08. 2000
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Normen und Richtlinien<br />
Die international tragfähige Hochgeschwindigkeits-<br />
Logistik ermöglicht die Fertigung von durchschnittlich<br />
20 000 <strong>Brillenglas</strong>aufträgen pro Tag. (Deutscher Logistik<br />
Preis 1995).<br />
Daher hat <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> auch sein eigenes Gütesiegel für<br />
augenoptische Produkte: das für Markenqualität<br />
von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>.<br />
DIN EN ISO 14889<br />
Diese Norm, die unter Beteiligung deutscher Experten<br />
ausgearbeitet worden ist, benennt die grundlegenden<br />
Anforderungen an rohkantige fertige Brillengläser.<br />
Diese Anforderungen betreffen neben Vorgaben über<br />
die physiologische Verträglichkeit, Entflammbarkeit<br />
und mechanische Festigkeit mit anzuwendenden Prüfverfahren<br />
den Transmissionsgrad von rohkantigen fertigen<br />
Brillengläsern.<br />
Der Transmissionsgrad, vor allem die "Zusatzanforderungen<br />
für Brillengläser für den Gebrauch durch Fahrzeuglenker",<br />
ist nicht nur für <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> als <strong>Brillenglas</strong>hersteller,<br />
sondern auch für den Augenoptiker in<br />
seiner beratenden Tätigkeit von großer Bedeutung.<br />
Sollte aufgrund kosmetischer oder medizinischer Indikation<br />
der Kunde nicht verkehrs- oder nicht nachtfahrtaugliche<br />
Brillengläser wünschen, so obliegt dem<br />
Augenoptiker eine Aufklärungspflicht. Vor allem sollte<br />
mit dem Kunden darüber gesprochen werden, daß<br />
nicht allein der Grad der Tönung auf die Verkehrstauglichkeit<br />
eines <strong>Brillenglas</strong>es Einfluß hat, sondern<br />
auch die Transmission für bestimmte Wellenlängen. So<br />
kann ein Glas bestimmter Filterwirkung zwar subjektiv<br />
<strong>zum</strong> Fahren in der Dämmerung oder bei Nacht "hell"<br />
genug erscheinen, die Farbwahrnehmung für eine<br />
bestimmte Signalfarbe jedoch so verfälschen, daß es<br />
<strong>zum</strong> Autofahren nicht geeignet ist. Das eindeutige<br />
Erkennen von Signalfarben ist, ebenso wie eine<br />
"ungetrübte" Sicht, im Straßenverkehr lebenswichtig.<br />
Transmission (%)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Wellenlänge (nm)<br />
350 400 450 500 550 600 650 700 750<br />
Transmissionskurven für Clarlet F 451, F 452. Diese<br />
Spezialfiltergläser erfüllen die „Zusatzanforderungen<br />
(τ 500-650<br />
, Q Rot<br />
, Q Gelb<br />
) für Brillengläser für den Gebrauch<br />
durch Fahrzeuglenker“ nicht<br />
F 451<br />
F 452<br />
G37
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Normen und Richtlinien<br />
Zusatzanforderungen für<br />
Brillengläser für den Gebrauch<br />
durch Fahrzeuglenker<br />
Brillengläser für Fahrten bei Tageslicht müssen im<br />
Bezugspunkt einen Lichttransmissionsgrad τ von<br />
≥8% bei Verwendung einer Strahlungsquelle für<br />
Normlicht D 65 aufweisen.<br />
Brillengläser für Fahrten bei Nacht müssen im Bezugspunkt<br />
einen Lichttransmissionsgrad τ von ≥75%<br />
bei Verwendung einer Strahlungsquelle für Normlicht<br />
D 65 aufweisen.<br />
Der spektrale Transmissionsgrad τ(λ) des <strong>Brillenglas</strong>es<br />
darf bei keiner Wellenlänge im Bereich von<br />
500 nm bis 650 nm geringer als das 0,2fache des<br />
Lichttransmissionsgrades τ sein.<br />
Der relative visuelle Schwächungsquotient Q darf für<br />
Rot und Gelb nicht kleiner als 0,8, für Grün nicht<br />
kleiner als 0,6 und für Blau nicht kleiner als 0,4<br />
sein.<br />
Relative spektrale Strahlendichte<br />
der Normlichtart D 65<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Wellenlänge (nm)<br />
350 400 450 500 550 600 650 700 750<br />
Lichttransmissionsgrad τ <br />
Unter dem Lichttransmissionsgrad τ versteht man das<br />
Verhältnis des von dem <strong>Brillenglas</strong> durchgelassenen<br />
Lichtstromes <strong>zum</strong> auftreffenden Lichtstrom unter<br />
Berücksichtigung des spektralen Hellempfindlichkeitsgrades<br />
V(λ).<br />
Spektraler Transmissionsgrad τ(λ)<br />
Der spektrale Transmissionsgrad τ(λ) ist das Verhältnis<br />
des spektralen Strahlungsstromes, der von dem <strong>Brillenglas</strong><br />
durchgelassen wird, <strong>zum</strong> auftreffenden Strahlungsstrom<br />
für eine bestimmte Wellenlänge λ.<br />
Hellempfindlichkeit V(λ)<br />
Der spektrale Hellempfindlichkeitsgrad V(λ) ist die festgelegte,<br />
relative spektrale Empfindlichkeit des helladaptierten<br />
photopischen Normalauges, deren Maximum<br />
auf λ = 555 nm in Luft bezogen ist.<br />
G38
<strong>Weiterführende</strong> <strong>Themen</strong> <strong>zum</strong> <strong>Brillenglas</strong><br />
Normen und Richtlinien<br />
Normlichtart D 65<br />
Die Normlichtart D 65 repräsentiert mittleres Tageslicht<br />
mit der Farbtemperatur 6500 K und wird meist<br />
durch Xenonlampen mit Filtern realisiert.<br />
Schwächungsquotient Q<br />
Der relative visuelle Schwächungsquotient Q gibt das<br />
Verhältnis des Lichttransmissionsgrades eines getönten<br />
<strong>Brillenglas</strong>es für die spektrale Strahlungsverteilung<br />
des Lichtes τ sign , das von einem Signallicht im Straßenverkehr<br />
ausgeht, <strong>zum</strong> Lichttransmissionsgrad desselben<br />
<strong>Brillenglas</strong>es für die Normlichtart D 65 an. Q sagt<br />
also nichts über die Farbwahrnehmung durch das<br />
<strong>Brillenglas</strong> aus, sondern gibt an, ob die Leuchtdichte<br />
eines Signallichts gegenüber der Umgebungsleuchtdichte<br />
stärker oder weniger stark geschwächt wird (Q<br />
größer oder kleiner 1).<br />
Selbstverständlich sind alle von <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> angebotenen<br />
Brillengläser entsprechend den Richtlinien dieser<br />
Norm geprüft und gekennzeichnet (Nachtfahrtauglichkeit/Verkehrstauglichkeit<br />
nach DIN EN ISO 14889).<br />
Ebenso genügen alle <strong>Zeiss</strong> Brillengläser den Mindestanforderungen<br />
nach der mechanischen Festigkeit,<br />
Entflammbarkeit und physiologischen Verträglichkeit.<br />
Weitere Normen für<br />
die Augenoptik<br />
Neben der DIN EN ISO 14889 gibt es noch weitere<br />
Normen, die für den Augenoptiker wesentlich sind<br />
bzw. noch detaillierter auf die einzelnen Anforderungen<br />
an die unterschiedlichen Brillengläser eingehen:<br />
DIN EN ISO 8980-1 Anforderungen an Einstärkenund<br />
Mehrstärken-Brillengläser<br />
DIN EN ISO 8980-2 Anforderungen an Gleitsicht-<br />
Brillengläser<br />
DIN EN ISO 8980-3 Transmissionsanforderungen mit<br />
Prüfverfahren<br />
DIN EN ISO 13666 Augenoptische Begriffe und<br />
Definitionen<br />
DIN 5361 Brillenfassungen mit Konstruktionsarten<br />
und Benennungen<br />
G39
G40