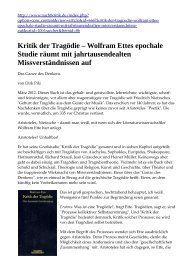Wolfram Ette
Wolfram Ette
Wolfram Ette
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
20 Ebd., 466–69.<br />
21 Ebd., 544–48.<br />
22 Ein Ausdruck, der in Diskussionen über Bessons »Ödipus«-Inszenierung von 1967 mehrfach<br />
verwendet wurde: Müller (1969), 146.<br />
23 Da der Hauptcharakter eigentlich retardierend ist, so tun die Umstände eigentlich alles zur<br />
Krise, schrieb Schiller am 2.10.1797 an Goethe. Das Zögern erzeugt ein charakterliches<br />
Vakuum, Wallenstein erscheint als Mann ohne Eigenschaften.<br />
24 Aristoteles, Poetik, Kap. 7. Das natürlicherweise ist Fuhrmanns Übersetzung der Verbalkonstruktion<br />
pephyken einai (Vgl. Aristoteles 1982, 24 f.; 1450 b 28 f.). Das Wort selbst<br />
weist also bereits auf die Prozesse hin, die kata physin ablaufen, und die in der »Physik«<br />
analysiert werden (dazu <strong>Ette</strong> 2003, 13–27).<br />
25 Der Ansatz von Diltheys Wallenstein-Essay geht in diese Richtung, wenn es heißt: Gäbe es<br />
eine Abbildung der historischen Wirklichkeit in sicheren historischen Erkenntnissen, so wäre<br />
für die historische Dichtung kein Platz ... Hieraus ergibt sich daß die Persönlichkeiten<br />
und ihre Beziehungen zueinander immer nur in subjektiver Beleuchtung gesehen werden<br />
können(Dilthey 1895, 74). Später heißt es: Das Drama ist nicht nur philosophischer als die<br />
Philosophie, sondern auch historischer als die Geschichte (ebd., 102). In der Interpretation<br />
des Schillerschen Dramas fällt er allerdings dahinter zurück und betreibt, der Maxime der<br />
Einfühlung getreu, eine Verwesentlichung historischer Erkenntnis durch die Kunst. Das<br />
Drama, und allein das Drama, vermag zu sagen, wie es wirklich war.<br />
26 Vgl. Silz (1963).<br />
27 Prolog zum »Wallenstein«, 118.<br />
28 Müller (1985), 105.<br />
29 Wallensteins Charakter hat sich in der Armee objektiviert, heißt es bei Dilthey (1895, 95).<br />
30 Am umfassendsten berichtet darüber Borchmeyer (1988).<br />
31 Vgl. Briggs / Peat (1990)<br />
32 Dazu Lovejoy (1936).<br />
33 Schiller, Die Piccolomini, 976–81.<br />
34 Ebd., 986–92.<br />
35 Vgl. hierzu Garin (1983).<br />
36 Schiller, Die Piccolomini, 2626.<br />
37 Ebd., 888-90.<br />
38 Schiller, Wallenstein: Prolog, 106–110.<br />
39 Ebd., 138.<br />
40 in: Schiller (2005), 298. So muss man, meine ich, Heiner Müllers Diktum erklären: Der<br />
Prolog ist eine Publikumsbeschimpfung (Müller 1985, 103).<br />
41 Adorno (1951), 253<br />
16