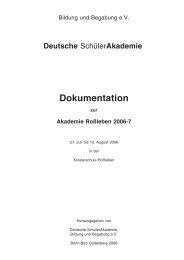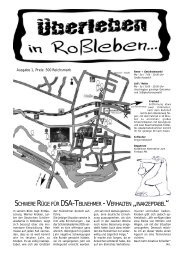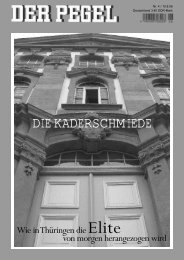Kurs 7.6: Überall ist Mittelalter - Werner Knoben
Kurs 7.6: Überall ist Mittelalter - Werner Knoben
Kurs 7.6: Überall ist Mittelalter - Werner Knoben
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Kurs</strong> <strong>7.6</strong> – »<strong>Überall</strong> <strong>ist</strong> <strong>Mittelalter</strong>« Akademie Roßleben 2006-7<br />
Das älteste dieser Modelle <strong>ist</strong> die Unterscheidung in »frei« und »unfrei«. Sie stammt aus der vorkarolingischen<br />
Zeit und war zur Zeit der Karolinger bereits antiquiert, da es inzwischen oftmals die unfreien Bauern waren,<br />
denen es wirtschaftlich besser ging. Sie selbst oder ihre Vorfahren waren vor dem Kriegsdienst und zum Schutz<br />
vor Missernten in die Abhängigkeit zu einem Grundherren geflüchtet. Entscheidend für die soziale Stellung war<br />
nicht, wie frei man war, sondern welche materiellen Mittel man besaß. Um eben diesen Sachverhalt deutlich<br />
zu machen, benutzte man im frühen <strong>Mittelalter</strong> oft den Gegensatz von pauperes und potentes, von Armen<br />
und Mächtigen. Arm war in diesem Kontext derjenige, der nicht Macht über andere ausübte, sondern vielmehr<br />
dem Zugriff anderer ausgesetzt war. Diese Unterscheidung von Herrschaft und Dienst war grundlegend für die<br />
mittelalterliche Hierarchie.<br />
Schließlich entwickelte sich im 10. Jahrhundert die Vorstellung einer Dreiteilung, die das <strong>Mittelalter</strong> überdauern<br />
sollte: die Einteilung nach Tätigkeiten. Hierbei unterschied man zwischen oratores (Klerikern), bellatores<br />
(Kriegern bzw. Rittern) und laboratores (Bauern). Erst jetzt kann auch von einem gefestigten, umreißbaren<br />
Bauern- bzw. Ritterstand gesprochen werden. Das Schema hat seinen Ursprung in der griechischen Philosophie,<br />
in welcher bereits Wehrstand, Nährstand sowie Lehrstand unterschieden wurden. Der ebenfalls dieser<br />
Philosophie entstammende Gedanke, dass alle Mitglieder eines Standes gleich seien, findet sich ebenso bei<br />
mittelalterlichen Schriftstellern, so z.B. beim deutschen Spruchdichter Heinrich Frauenlob von Meißen Ende<br />
des 13. Jahrhunderts: »In driu geteilet waren von erst die liute, als ich las: buman, ritter und pfaffen. ieslich<br />
nach siner mazen war gelich an adel und an art dem andern ie« 16 . Dass aber ein einfacher Bauer und ein<br />
ebenfalls dem Bauernstand zuzurechnender Meier nicht »gleich an Adel und Abstammung« 17 waren, dürfte<br />
jedoch auch den Menschen des <strong>Mittelalter</strong>s bewusst gewesen sein.<br />
4.1.3 Das hohe und späte <strong>Mittelalter</strong><br />
Auch im Hoch- und Spätmittelalter gab es Modelle zur Ständehierarchie. Die bedeutendsten davon sind Eike<br />
von Repgows »Sachsenspiegel« sowie die Predigt Bertholds von Regensburg »Von den zehn Chören der<br />
Engel und der Chr<strong>ist</strong>enheit«. In letzterer entwirft Berthold ein Bild der menschlichen Gesellschaft als Entsprechung<br />
der zehn himmlischen Engelschöre. Entsprechend sind die drei ersten Chöre der Menschheit höher<br />
gestellt als die anderen: »Die êrsten drî er leie sint die hoechsten unde die hêrsten, die der almehtige got selbe<br />
dar zuo erwelt unde geordent hât, daz in die andern siben alle undertaenic wesen suln und in dienen suln« 18 .<br />
Im ersten Chor befinden sich die Priester (»die pfaffen«), im zweiten die übrigen Ge<strong>ist</strong>lichen (»ge<strong>ist</strong>lîche liute«)<br />
und im dritten der gesamte weltliche Adel (alle weltlîche herren«). Die folgenden sechs dienenden Chöre sind<br />
geprägt von der sozialen Struktur der Stadt und bestehen dem entsprechend aus diversen handwerklichen<br />
Berufen sowie den Bauern. Der letzte und zehnte Chor schließlich besteht aus Gauklern und Schaustellern,<br />
die »guot für êre nement« 19 .<br />
Das andere wichtige Konzept zur sozialen Ordnung <strong>ist</strong> die sogenannte »Heerschildordnung«, welche um<br />
1220/30 von dem Min<strong>ist</strong>erialen Eike von Repgow im Sachsenspiegel verfasst wurde. Nach Eike gibt es sieben<br />
Stufen der Lehnsfähigkeit, analog zu den sieben Weltaltern. »To der selven wis sint de herscilde ut geleget, der<br />
de koningden ersten hevet; de biscope unde de ebbede unde ebbedischen den anderen, de leien vorsten den<br />
dridden, sint se de biscope man worden sint, de vrie herren den virden; de scepenbare lude unde de vrier herren<br />
man den viften: ere man vord den sesten«. Den siebten Heerschild lässt Eike, entsprechend dem siebten<br />
Weltalter, dessen Dauer unbekannt <strong>ist</strong>, ebenfalls unbestimmt: »Alse diu kr<strong>ist</strong>enheit in der sevenden welt nene<br />
stedicheit ne wet, wo lange siu stan scole, also ne wet men ok an dem sevende scilde, of he lenrecht oder<br />
herescilt hebben moge« 20 . Diese Ordnung hatte allerdings nur theoretische Bedeutung; außerdem kann sie<br />
auch nicht als vollständige Ständeordnung verstanden werden, da sie nur den lehnsrechtlichen Aspekt erfasst.<br />
Die landrechtliche und wirtschaftliche Stellung der Menschen bleibt unberücksichtigt.<br />
4.1.4 Fazit<br />
Eine einheitliche Charakterisierung des mittelalterlichen Gemeinwesens <strong>ist</strong> in der Tat äußerst schwierig. Dafür<br />
haben sich die sozialen Strukturen in den ca. 1000 Jahren zwischen Antike und Neuzeit, die wir heute als<br />
<strong>Mittelalter</strong> bezeichnen, zu sehr verändert. Es <strong>ist</strong> allein die soziale Unterschiedlichkeit der Ständeordnung, die<br />
eine Konstante in der mittelalterliche Sozialgeschichte darstellt. Diese Ungleichheit lässt sich bei allen oben<br />
genannten Quellen wiederfinden. Die Kategorien aber, welche die soziale Rangfolge bestimmten, divergieren<br />
teilweise erheblich.<br />
16 Heinrich von Meissen, Des Frauenlobs Leiche, Sprüche, Streitgedichte und Lieder, hrsg. von Ludwig Ettmüller, Quedlinburg / Leipzig<br />
1843 (Bibliothek der gesamten deutschen National-Literatur von der ältesten bis auf die neuere Zeit 16), VII, 22, 1–6.<br />
17 Siehe oben Körperallegorie als Gesellschaftsmodell.<br />
18 Berthold von Regensburg, Predigten, hrsg. von Franz Pfeiffer / Joseph Strobl, Berlin 1965 (Texte des <strong>Mittelalter</strong>s 1), S. 142.<br />
19 Berthold von Regensburg, Predigten, S. 155.<br />
20 Sachsenspiegel. Landrecht, hrsg. von Karl August Eckhardt, Göttingen 1955 (Monumenta Germaniae H<strong>ist</strong>orica. Fontes Iuris Germanici<br />
132<br />
Antiqui 1), S. 72–73.