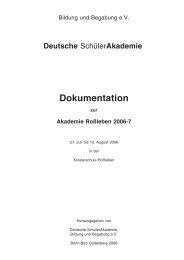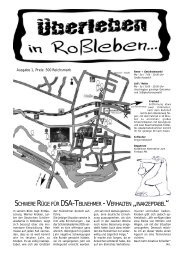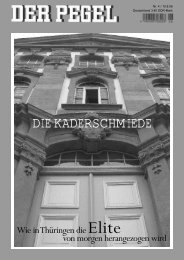Kurs 7.6: Überall ist Mittelalter - Werner Knoben
Kurs 7.6: Überall ist Mittelalter - Werner Knoben
Kurs 7.6: Überall ist Mittelalter - Werner Knoben
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Kurs</strong> <strong>7.6</strong> – »<strong>Überall</strong> <strong>ist</strong> <strong>Mittelalter</strong>« Akademie Roßleben 2006-7<br />
4.4.5 Fazit<br />
Die Hanse kann einerseits als ein großer wirtschaftlicher Personenverband bezeichnet werden, andererseits<br />
setzte sie sich wiederum aus vielen kleineren Personenverbänden bzw. Gemeinschaften zusammen. In ihrer<br />
Blütezeit war die Hanse nicht nur eine wirtschaftliche Großmacht, sondern auch ein Bund von hoher politischer<br />
Bedeutung. Das Ende der Hanse wurde durch das Erstarken der landesherrlichen Territorialgewalten<br />
eingeläutet und durch den Dreißigjährigen Krieg besiegelt.<br />
4.5 Krankheit im <strong>Mittelalter</strong> – Natürliches Schicksal oder persönliche Schuld?<br />
(Tabea Meurer)<br />
»Der König fragt den Philosophen: ’Gelehrter, in wessen Gesellschaft lebt der Mensch?’ Darauf der Philosoph:<br />
’Mit sieben Genossen, die ihn beständig plagen. Dies aber sind Hunger, Durst, Kälte, Müdigkeit, Krankheit<br />
und Tod«’ 40 . Dieser Dialog erscheint in den »Gesta Romanorum«, einer Sammlung oft auch phantastischer<br />
Geschichten, entstanden um 1350, unter der Überschrift »Vom Lebenslauf des Menschen« und spiegelt eine<br />
fundamentale mittelalterliche Einstellung zum Thema Krankheit wider: Krankheit und Tod gehören zum Leben<br />
und sind damit Teil der sozialen Identität der Menschen des <strong>Mittelalter</strong>s.<br />
Ausgehend von dieser grundsätzlichen Einstellung stellt sich die Frage der<br />
konkreten Bewertung der Erkrankung eines Menschen im <strong>Mittelalter</strong> - galt<br />
sie als natürliches Schicksal oder als persönliche Schuld?<br />
In der Vorstellung mittelalterlicher Menschen <strong>ist</strong> die Grundursache für Krankeit<br />
die Erbsünde, oder wie es Hildegard von Bingen ausdrückte: »Adams<br />
Hochmut, der die Menschen zu Fall brachte« 41 . Dieser Fall des Menschen<br />
aus dem paradiesischen Urzustand spiegelt sich auch in der lateinischen<br />
Bezeichnung für Krankheit destitutio wider, der die constitutio als der gesunde,<br />
paradiesische Urzustand gegenübergestellt wird. Der aus dem Paradies<br />
ins irdische »Jammertal« vertriebene Mensch, dessen Leben im Diesseits<br />
»elend <strong>ist</strong> die ganze Zeit«, wie es der Medizinh<strong>ist</strong>oriker Heinrich Schipperges<br />
aus den »Gesta Romanorum« zitiert 42 , leidet also um der Erbsünde<br />
wegen.<br />
Doch nicht wenigen Kranken wird die Schuld für ihre Erkrankung selbst<br />
angelastet. So heißt es in den »Gesta Romanorum«: »Du b<strong>ist</strong> aussätzig<br />
geworden und aus Furcht bekommt man Aussatz« 43 Heinrich Schipperges<br />
führt in diesem Zusammenhang das Beispiel des Herodes Agrippa I. an,<br />
dessen Tod in der Apostelgeschichte beschrieben wird: »Alsbald schlug ihn<br />
der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern<br />
zerfressen, gab sein Ge<strong>ist</strong> auf« 44 . Demnach beginnt Herodes bereits auf<br />
Abb. 6.10: Adam, Eva und die<br />
Erbsünde<br />
Erden seine ewigen Strafen abzubüßen. Für Schipperges steht fest, dass Herodes neben Hiob und Paulus<br />
eine der großen biblischen Gestalten war, die im <strong>Mittelalter</strong> bei der Bewertung von Krankheit als warnende und<br />
mahnende Beispiele dienten 45 .<br />
Das Bild von Krankheit als persönlicher Schuld wird ergänzt durch die rituelle Aussonderung, bei der der<br />
Aussätzige aus der familiären Gemeinschaft »herausgerissen« und lebendig für tot – tamquam mortuus –<br />
erklärt wird 46 .<br />
40 Gesta Romanorum. Die Taten der Römer, neu bearb. und übersetzt von Wilhelm Trilitzsch, Leipzig 1973, S. 34.<br />
41 Hildegard von Bingen, Causae et curae. Heilkunde, neu bearb. von Peter Riethe, Salzburg 1969, S. 45.<br />
42 Heinrich Schipperges, Der Garten der Gesundheit, Zürich / München 1987, S.42.<br />
43 Gesta Romanorum, S. 32.<br />
44 Apg. 12, 22–23.<br />
45 Vgl. Heinrich Schipperges, Die Kranken im <strong>Mittelalter</strong>, München 1990, S. 20.<br />
46 Vgl. Frank Rexroth, Deutsche Geschichte im <strong>Mittelalter</strong>, München 2005 (C. H. Beck Wissen 2307) passim und Horst Fuhrmann, <strong>Überall</strong><br />
140<br />
<strong>ist</strong> <strong>Mittelalter</strong>, München 2002 passim.