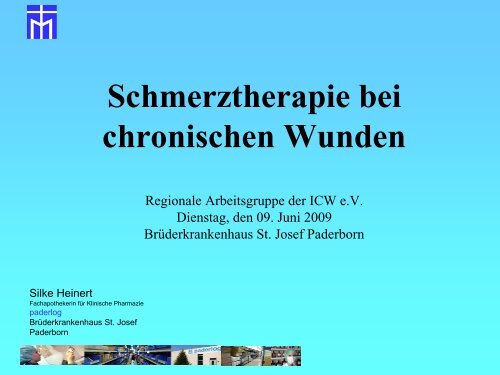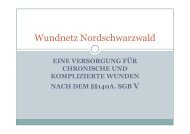Vortrag "Schmerz" - Initiative Chronische Wunden eV
Vortrag "Schmerz" - Initiative Chronische Wunden eV
Vortrag "Schmerz" - Initiative Chronische Wunden eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schmerztherapie bei<br />
chronischen <strong>Wunden</strong><br />
Regionale Arbeitsgruppe der ICW e.V.<br />
Dienstag, den 09. Juni 2009<br />
Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn<br />
Silke Heinert<br />
Fachapothekerin für Klinische Pharmazie<br />
paderlog<br />
Brüderkrankenhaus St. Josef<br />
Paderborn
Der „Internationale Verband für die Untersuchung von<br />
Schmerzen“ definiert Schmerz...<br />
„..als eine unangenehme sensible und emotionale<br />
Erfahrung, die im Zusammenhang mit einer tatsächlichen<br />
oder potentiellen Gewebeschädigung steht oder im Sinne<br />
einer solchen Schädigung beschrieben wird.“<br />
© S. Heinert paderlog
Bis zu 80% der Menschen, die unter<br />
chronischen <strong>Wunden</strong> leiden, haben einen<br />
permanenten Wundschmerz<br />
• Bewegungseinschränkung<br />
• Einschlaf- und Durchschlafstörungen<br />
• Beeinträchtigung der Körperwahrnehmung<br />
• Minderung des Selbstwertgefühls<br />
• Depression<br />
• Reduktion der sozialen Kontakte<br />
• Soziale Isolation<br />
© S. Heinert paderlog
Weitere Folgen für den Patienten:<br />
• Beschäftigung mit der Wunde wird zur Belastung<br />
• Zusätzlich Schmerzen, z.B. beim Verbandswechsel<br />
⇒ Entstehung einer ernsthaften Beeinträchtigung der<br />
Versorgung<br />
⇒ in Fragestellung des gesamten Behandlungsprozesses<br />
⇒ Ablehnung der Behandlung, keine Compliance<br />
© S. Heinert paderlog
Kommentare bei schmerzhaften<br />
Verbandswechsel<br />
© S. Heinert paderlog
3 Arten von Schmerz:<br />
• Nozizeptiver Schmerz<br />
– zurückzuführen auf eine Schädigung des Gewebes<br />
– in der Wunde Unterscheidung in akuten und chronischen<br />
Wundschmerz<br />
• Neuropathischer Schmerz<br />
– zurückzuführen auf eine Schädigung der Nerven<br />
• Psychogener Schmerz<br />
– ausgelöst von Furcht oder Angst<br />
Nur im Lehrbuch getrennt,<br />
in Wirklichkeit parallel oder gemischt auftretend<br />
© S. Heinert paderlog
Schmerzarten<br />
1. Akutschmerz durch Nozizeptorschädigung<br />
Abb. nach Mutschler: Arzneimittelwirkungen<br />
© S. Heinert paderlog
Schmerzarten<br />
2. Pathophysiologischer Nozizeptorschmerz<br />
Peripherie ZNS Folge<br />
Abb. nach Mutschler: Arzneimittelwirkungen<br />
© S. Heinert paderlog
Schmerzarten<br />
3. Neuropathischer Schmerz<br />
Peripherie ZNS Folge<br />
Abb. nach Mutschler: Arzneimittelwirkungen<br />
© S. Heinert paderlog
Schmerzursachen:<br />
Psychosoziale Faktoren<br />
z.B. Alter, Geschlecht,<br />
kultureller Hintergrund,<br />
Bildung,<br />
Geisteszustand -<br />
Angst, Depression,<br />
Furcht, Verlust, Trauer<br />
Operativer Schmerz<br />
Durchtrennen von Gewebe oder<br />
anhaltende Beeinflussung, wobei<br />
normalerweise eine Narkose erforderlich<br />
ist, z.B. Debridement,<br />
Verbände bei schweren Verbrennungen<br />
Anwendungsbedingter Schmerz<br />
= Verfahrensbedingter Schmerz<br />
Routine-/ Grundlegende Eingriffe, z.B.<br />
Verband entfernen, Wunde reinigen,<br />
Verband anlegen<br />
Mechanischer Schmerz<br />
bewegungsbedingte Aktivität, z.B.<br />
Reibung, Verrutschen des Verbandes,<br />
Husten<br />
Umgebungsfaktoren<br />
z.B. Zeitpunkt des<br />
Wechsels,<br />
Umfeld -<br />
Lärm, Position des<br />
Patienten,<br />
Mittel<br />
Dauerschmerz<br />
anhaltende grundlegende Schmerzen<br />
aufgrund von Wundätiologie und<br />
lokalen Faktoren wie z.B.<br />
Ischämie, Infektion<br />
© S. Heinert paderlog
Schmerzwahrnehmung<br />
• Endorphinrezeptoren (ZNS)<br />
• periphere Rezeptoren (freie Nervenenden)<br />
© S. Heinert paderlog
Endorphinrezeptoren<br />
• Befinden sich im Schmerzzentrum des ZNS<br />
• werden von den Endorphinen erregt<br />
• therapeutischer Ansatz:<br />
Zentrale Analgetika wie<br />
Morphin und andere Opiate<br />
© S. Heinert paderlog
Periphere Rezeptoren<br />
• Erstschmerz (ACH, Serotonin..)<br />
• Dauerschmerz (Prostaglandine)<br />
• Therapeutischer Ansatz:<br />
Periphere Analgetika/ nichtsteroidale<br />
Antirheumatika<br />
wie ASS, Paracetamol, Ibuprofen, Diclofenac,<br />
Novaminsulfon...<br />
© S. Heinert paderlog
Chronifiziert der Schmerz (Schmerzgedächtnis)<br />
können durch periphere Sensibilisierung der<br />
Schmerzrezeptoren im Wundgebiet und der<br />
Sensibilisierung zentraler Schaltstellen im Gehirn<br />
bereits kleinste Reize unerträgliche Schmerzen<br />
auslösen (Hyperalgesie).<br />
Selbst leichte Berührungen sogar in der weiteren<br />
Wundumgebung werden durch eine übersteigerte<br />
Schmerzwahrnehmung als sehr schmerzhaft<br />
empfunden (Allodynie).<br />
© S. Heinert paderlog
Schmerzchronifizierung<br />
„Schmerzkrankheit“<br />
<strong>Chronische</strong>s Stadium<br />
Schmerzgedächtnis<br />
Zentrale Sensibilisierung<br />
Akutes Stadium<br />
Unzureichende Schmerztherapie<br />
© S. Heinert paderlog
Schmerzarten<br />
Klinsiche Symptome neuropathischer Schmerzen<br />
Negative Symptome<br />
Positive Symprome<br />
Sensorisches Defizit<br />
- Dauerschmerz<br />
- Parästhesie<br />
- Dysästhesie<br />
- Hyperalgesie<br />
- Allodynie<br />
Neuropathische Schmerzen sind oftmals durch eine Kombination von<br />
positiven Symptomen gekennzeichnet.<br />
© S. Heinert paderlog
Grundlegende schmerzauslösende Probleme<br />
• Durchblutungsstörungen (pAVK)<br />
• Druck<br />
• Schwellung<br />
• Infektion<br />
• Tumore<br />
• Ischämie<br />
• Mazeration der wundumgebenden Haut<br />
© S. Heinert paderlog
• Gehen Sie davon aus, dass alle <strong>Wunden</strong> schmerzhaft<br />
sind<br />
• Mit der Zeit können <strong>Wunden</strong> schmerzhafter werden<br />
• Akzeptieren Sie, dass die wundumgebende Haut<br />
empfindlich und schmerzsensibel werden kann<br />
• Machen Sie sich bewusst, dass für manche Patienten die<br />
geringste Berührung oder einfach Luft, welche mit der<br />
Wunde in Berührung kommt, äußerst schmerzhaft sein<br />
kann.<br />
• Überweisen Sie rechtzeitig, wenn notwendig, zum<br />
Facharzt<br />
© S. Heinert paderlog
Beurteilungsstrategien<br />
• Schmerz ist, was immer der Patient sagt, aber<br />
manchmal sagt der Patient nichts<br />
• gezieltes Fragen<br />
• andere Indikatoren wie z.B. Entzündungszeichen<br />
• Messung der Schmerzintensität anhand von<br />
Skalen (Scores)<br />
• Schmerztagebücher zur dauerhaften<br />
Schmerzmessung<br />
© S. Heinert paderlog
VAS<br />
© S. Heinert paderlog
Doloplus-Skala hilft Pflegenden bei der Schmerzeinschätzung<br />
Somatische Parameter<br />
•Verbaler Schmerzausdruck<br />
•Schonhaltung in Ruhe<br />
•Schutz von schmerzhaften Körperzonen<br />
Psychomotorische Parameter<br />
•Mimik<br />
•Schlaf<br />
•Waschen und Ankleiden<br />
•Bewegungen / Mobilität<br />
Psychosoziale Parameter<br />
•Kommunikation (verbal / nonverbal)<br />
•Soziale Aktivitäten<br />
•Verhaltensstörungen<br />
Jeder Parameter kann mit 0 bis 3 Punkten bewertet werden. Insgesamt<br />
können maximal 30 Punkte erreicht werden. Ab 5 Punkten ist von Schmerzen<br />
auszugehen.<br />
Die Doloplus-Skala ist ein Instrument zur Beurteilung von Schmerzen bei<br />
Älteren.<br />
Quelle: Zeyfang, Grafik: Forschung und Praxis / Ärzte Zeitung<br />
© S. Heinert paderlog
Beurteilung der Schmerzen:<br />
• Anfangsbeurteilung<br />
• Laufende Beurteilung (vor Verbandwechsel, ggf.<br />
Beurteilung der Stärke auch währenddessen und danach)<br />
Es ist sicherzustellen, dass jede<br />
Schmerzbeurteilung individuell auf den<br />
Patienten ausgerichtet ist und nicht zum<br />
zusätzlichen Stressfaktor für ihn wird.<br />
© S. Heinert paderlog
Schmerztherapie:<br />
• Medikamente<br />
• Wundverbände<br />
• beteiligtes Personal<br />
© S. Heinert paderlog
Medikamentöse Schmerztherapie<br />
• Patienten haben einen Anspruch auf eine rechtzeitige<br />
und konsequente Schmerztherapie<br />
• Das WHO-Stufenschema ist ein Leitfaden, kein<br />
Paradigma<br />
• Das richtige, wirksame Medikament bzw. die richtige<br />
Kombination muss bei jedem einzelnen Patienten<br />
durch Erprobung gefunden werden (Schmerzkonsil,<br />
Schmerzambulanz)<br />
• Jeder Patient benötigt eine individuelle Dosierung in<br />
Abhängigkeit von Wirkung und Nebenwirkung<br />
(sorgfältige Titration)<br />
© S. Heinert paderlog
WHO-Stufenschema zur (Tumor-) Schmerztherapie<br />
Welches<br />
Schmerzmittel<br />
wann?<br />
Stufe 3<br />
Stufe 1<br />
Peripherwirksame<br />
Analgetika, NSAR<br />
+ Co-Medikation<br />
Stufe 2<br />
Schwache<br />
Opioid-Analgetika<br />
+<br />
Peripherwirksame<br />
Analgetika, NSAR<br />
+ Co-Medikation<br />
Starke<br />
Opioid-Analgetika<br />
+<br />
Peripherwirksame<br />
Analgetika, NSAR<br />
+ Co-Medikation<br />
© S. Heinert paderlog
Jede Stufe des WHO-Schemas lässt<br />
sich bedarfsgerecht mit den<br />
sogenannten Adjuvantien ergänzen.<br />
Lokalanästhetika und Benzodiazepine<br />
gehören dazu.<br />
Zusätzliche Antikonvulsiva oder<br />
Antidepressiva können neuropathische<br />
Schmerzen lindern.<br />
© S. Heinert paderlog
WHO Stufe 1<br />
• Bei längerer Gabe von konventionellen NSAR sind<br />
gastrointestinale und kardiovaskuläre Risiken und<br />
Kontraindikationen zu beachten<br />
• Ulcusprohylaxe mit Protonenpumpenhemmern<br />
• mehrere Untersuchungen zeigen einen Opioidsparenden<br />
Effekt unter NSAR-Medikation<br />
• Tageshöchstdosen für die einzelnen Substanzen<br />
beachten<br />
• Nebenwirkungen auf<br />
– Leber,<br />
– Niere,<br />
– Blut<br />
beachten!<br />
© S. Heinert paderlog
WHO Stufe 2<br />
• Zusätzlich zu Stufe 1, wenn diese nicht mehr<br />
ausreicht<br />
• Zur Langzeittherapie Retard-Formen einsetzen<br />
• Nicht-retardierte Präparate lediglich zur Dosistitration,<br />
bzw. als Zusatzmedikation bei Schmerzspitzen<br />
• Tageshöchstdosen beachten<br />
• bei starken Schmerzen kann u.U. Stufe 2<br />
übersprungen werden.<br />
• Kombination von Stufe 2 und 3 sollte unterbleiben<br />
© S. Heinert paderlog
WHO Stufe 3<br />
• Morphin (bei Tumorschmerzen) Mittel der Wahl<br />
• vorzugsweise orale, retardierte Arzneiformen<br />
• Bei Durchbruchschmerzen sind kurzwirksame Opioide<br />
indiziert<br />
• Gabe von Opioidpflastern stellt eine Alternative zur<br />
oralen Applikation dar bei Patienten mit<br />
– mittelgradig bis schweren Dauerschmerzen<br />
– stabilem und gleichmäßigem Opioidbedarf<br />
– Passagehindernis oder therapieresistentem Erbrechen<br />
• keine Tageshöchstdosen<br />
© S. Heinert paderlog
Nebenwirkungen der Opiate<br />
ZNS<br />
• Müdigkeit<br />
• Konzentrationsschwäche<br />
Magen/ Darm<br />
• Übelkeit Antiemetika<br />
• Verstopfung Laxantiengabe<br />
Abhängigkeiten<br />
• Physisch<br />
• psychisch (gering)<br />
© S. Heinert paderlog
Abhängigkeiten von Opiaten (Sucht?)<br />
Körperliche Abhängigkeit<br />
• Folge einer längeren Zufuhr einer Substanz<br />
• Physiologischer Anpassungsprozess<br />
• Entzugssymptomatik<br />
• kein abruptes Absetzen (Ausschleichen)<br />
Psychische Abhängigkeit<br />
Bei korrektem Einsatz von Opioiden ist die Gefahr<br />
einer psychischen Abhängigkeit sehr gering<br />
© S. Heinert paderlog
Grundregeln der Schmerztherapie<br />
• Über den Mund oder die Haut (oral, TTS)<br />
• pünktlich und regelmäßig<br />
• Individuell dosieren nach dem WHO-Stufenschema<br />
Dauerschmerz erfordert Dauertherapie<br />
© S. Heinert paderlog
Kurzfristige Schmerzspitzen können mit zusätzlichen<br />
kurzwirksamen Opioiden (Sevredol, Morphin Merck<br />
Tropfen) abgefangen werden.<br />
Bei der kurzfristigen Behandlung akuter Schmerzen z.B.<br />
während des Verbandswechsels sind besonders die<br />
Zeit bis zum Wirkungseintritt und die Wirkdauer der<br />
Analgetika zu berücksichtigen.<br />
Es macht keinen Sinn, Schmerztropfen kurz vor Beginn des<br />
Verbandswechsels dem Patienten zu geben.<br />
Prämedikation heißt in der Schmerztherapie, dass selbst alle<br />
nicht-retardierten oralen Analgetika mindestens 30<br />
Minuten vor einer schmerzhaften Prozedur verabreicht<br />
werden, um den rechtzeitigen Eintritt der analgetischen<br />
Wirkung sicherzustellen.<br />
© S. Heinert paderlog
Nicht-Opioide<br />
Arzneistoff<br />
Präparat/<br />
Applikation<br />
Wirkprofil<br />
Wirkeintritt<br />
(Wirkmaximum)<br />
nach<br />
Wirkdauer<br />
Einzeldosis<br />
(Erwachsene)<br />
Paracetamol Oral, rektal 30 min 4 – 6 h 500 – 1000 mg<br />
Metamizol<br />
Novalgin®<br />
oral<br />
Novalgin®<br />
rektal<br />
30 – 60 min<br />
k.A.<br />
Ibuprofen diverse 15 min<br />
(30 – 90 min)<br />
4 – 6 h<br />
k.A.<br />
500 – 1000mg<br />
1000 mg<br />
6 – 8 h 400 – 800 mg<br />
Diclofenac<br />
Voltaren®<br />
dispers<br />
Voltaren®<br />
resinat<br />
Magensaftresistent<br />
Voltaren®<br />
Supp.<br />
30 min<br />
1 h<br />
3 h (und mehr)<br />
30 – 60 min<br />
(90 – 100 min)<br />
6 –8 h<br />
12 h<br />
6 – 8 h<br />
4 – 6 h<br />
(-12 h)<br />
50 – 100 mg<br />
50 – 100 mg<br />
50 – 100 mg<br />
50 – 100 mg<br />
© S. Heinert paderlog
Opioide 2. Stufe<br />
Arzneistoff<br />
Tilidin/<br />
Naloxon<br />
Präparat/<br />
Applikation<br />
Valoron® N<br />
Lsg./ Kps.<br />
Wirkprofil<br />
Wirkeintritt<br />
(Wirkmaximum)<br />
nach<br />
10 min<br />
(25 – 50 min)<br />
Wirkdauer<br />
Einzeldosis<br />
(Erwachsene)<br />
4 – 6 h 50 – 100 mg<br />
Tramadol<br />
Tramal® Lsg./<br />
Kps.<br />
10 min (60 min) 4 h 50 – 100 mg<br />
© S. Heinert paderlog
Opioide Stufe 3<br />
Arzneistoff<br />
Morphin<br />
Präparat/<br />
Applikation<br />
Wirkprofil<br />
Wirkeintritt<br />
(Wirkmaximum<br />
) nach<br />
Wirkdauer<br />
Einzeldosis<br />
(Erwachsene)<br />
i.v. 5 – 10 min 4 – 6 h 5 – 10 mg<br />
s.c./ i.m. 15 – 30 min 4 – 6 h 10 – 30 mg<br />
Morphin Merck® 30 – 90 min 4 h ab 10 mg<br />
Tropfen<br />
(1,5 – 2 h)<br />
Viskose Morphin- 30 – 90 min 4 – 6 h 10 – 60 mg<br />
Lsg. 2% NRF<br />
Sevredol® Tbl. 20 min 4 h ab 10 mg<br />
Morphin Hexal 30 – 90 min 4 – 6 h ab 10 mg<br />
Ret.-Tabl.<br />
MST-Retardtabl.<br />
Mundipharma®<br />
60 – 90 min<br />
(4 – 6 h)<br />
8- 12 h ab 10 mg<br />
MSR-Supp.<br />
Mundipharma®<br />
20 – 60 min 4 h 10 – 30 mg<br />
© S. Heinert paderlog
Opioide Stufe 3 (Fortsetzung)<br />
Arzneistoff<br />
Wirkdauer<br />
Hydromorphon<br />
Präparat/<br />
Applikation<br />
Wirkprofil<br />
Wirkeintritt<br />
(Wirkmaximum)<br />
nach<br />
Einzeldosis<br />
(Erwachsene)<br />
Paladon® ret. k.A. 8 – 12 h 4 – 24 mg<br />
Oxycodon<br />
Oxygesic®<br />
ret.<br />
k.A. 8 – 12 h 10 – 20 mg<br />
Piritramid Dipidolor®<br />
i.m.<br />
s.c.<br />
i.v.<br />
Buprenorphin Temgesic® im<br />
Temgesic®<br />
sublingual<br />
Transtec®<br />
transdermal<br />
Fentanyl Fentanyl i.v.<br />
Fentanyl i.m.<br />
Durogesich®<br />
transdermal<br />
(10 – 60 min)<br />
10 – 15 min<br />
30 min<br />
1 – 2 min<br />
0,5 – 1 h<br />
0,5 h (1 – 2 h)<br />
(initial ca. 24 h)<br />
Sofort<br />
7 – 8 min<br />
12 – 24 h<br />
5 – 8 h 15 – 30 mg<br />
6 – 8 h<br />
6 – 8 h<br />
72 h<br />
0,5 – 1 h<br />
1 – 2 h<br />
48 –72 h<br />
0,3 – 0,6 mg<br />
0,2 – 0,4 mg<br />
35 – 70 µg/h<br />
25 – 50 µg<br />
50 – 100 µg<br />
25 – 100 µg<br />
© S. Heinert paderlog
Lokalanästhetika<br />
Arzneistoff<br />
Präparat/<br />
Applikation<br />
Wirkprofil<br />
Wirkeintritt<br />
Wirkdauer<br />
Einzeldosis<br />
(Erwachsene)<br />
Lidocain/<br />
Prilocain<br />
Emla® Creme<br />
30-60 min<br />
Einwirkzeit<br />
1 h 1 – 2 g Creme/<br />
10 cm 2<br />
• Zur Schmerzprophylaxe vor dem chirurgischen Debridement ist<br />
der Einsatz von Emla®-Creme, einem Lokalanästhetikum<br />
zugelassen.<br />
Diese wird direkt auf die Wunde und deren Umgebung<br />
aufgebracht, mit einer sterilen Transparentfolie abgedeckt und<br />
sollte 30 (-60) Minuten vor dem Eingriff einwirken. Die Wirkung<br />
hält jedoch nur für kurze Zeit an.<br />
© S. Heinert paderlog
Durchbruchschmerz: Dosierung<br />
• Die Höhe der Dauermedikation gibt keinen sicheren<br />
Anhalt für die benötigte Menge der Zusatzmedikation,<br />
die für jeden Patienten individuell titriert werden muss<br />
• Bei einer Zusatzmedikation mit oralem, nichtretardiertem<br />
Morphin kann als Annäherung mit einer<br />
Dosis von 1/6 bis 1/10 der Dauermedikationsdosis<br />
begonnen werden<br />
© S. Heinert paderlog
Häufig gemachte Fehler in der Schmerztherapie<br />
• Unterdosierung<br />
• Medikation „bei Bedarf“<br />
• Kombination von WHO Stufe 2 mit Stufe 3<br />
• Tranquilzer Dauermedikation<br />
• Fehlende Adjuvantientherapie (z.B. keine Antiemetika<br />
bei Opiatstart)<br />
• CAVE: Off-Label-Use<br />
Versatis Pflaster nicht für <strong>Wunden</strong> zugelassen und<br />
geeignet!<br />
© S. Heinert paderlog
Schmerzvermeidung durch spezielle Produkte<br />
(Beispiele zum Thema „Verkleben“)<br />
• Verklebende Wundverbände/ Wundgaze sollten bei bestehender<br />
Indikation vermieden und durch feuchthaltende Wundauflagen<br />
ersetzt werden.<br />
• Wo möglich und sinnvoll sollten Wundauflagen ohne Klebefläche<br />
zum Einsatz kommen, da sich häufig überreizte Nerven in der<br />
Wundumgebung befinden.<br />
• Fettfreie Distanzgitter sind schmerzfreier zu entfernen als<br />
angetrocknete Fettgazen (Produkte wie Mepitel®, Sorbion plus®<br />
oder Hydrokolloidgazen wie Urgotül®, Hydrotüll® oder<br />
Physiotülle®).<br />
• Alternativ zu stark klebenden Auflagen können Verbände mit<br />
geringer Klebkraft (Biatain® sanft haftend) oder Produkte mit<br />
Silikonhaftung wie Mepilex® oder Mepitel® border eingesetzt<br />
werden.<br />
© S. Heinert paderlog
Schmerzvermeidung durch spezielle Produkte<br />
(Beispiele zum Thema „Ablösen“)<br />
• Schnelles Abziehen der Wundauflage (Peeling) sollte<br />
auch bei modernen Wundauflagen vermieden werden,<br />
ggf. Pflasterentferner (Dermasol® oder Wundbenzin)<br />
einsetzen.<br />
• Falsches Ablösen von Folienverbänden kann zu<br />
schmerzhaften Hautläsionen und Rissen führen. Die Folie<br />
lässt sich durch stückweises Überdehnen parallel zur Haut<br />
atraumatisch lösen. Um Scherkräfte zu vermeiden, wird<br />
die Haut unterhalb der Haut durch Hand auflegen gestützt.<br />
© S. Heinert paderlog
Schmerzvermeidung durch spezielle Produkte<br />
(Beispiele zum Thema „Wundspüllösungen“)<br />
• Angewärmte und physiologische bzw. temperierte<br />
Antiseptika verwenden (Wärmeschrank,<br />
Flaschenwärmer, Wasserbad...)<br />
• Nicht schmerzhaften Spüllösungen und Antiseptika<br />
(Polyhexanidlösung, Octenisept ®) ist der Vorzug zu<br />
geben.<br />
© S. Heinert paderlog
Schmerzvermeidung durch spezielle Produkte<br />
(„Sonstiges“)<br />
• Bei <strong>Wunden</strong> mit gereizter oder empfindlicher<br />
Umgebungshaut empfiehlt sich der unterstützende<br />
Einsatz eines Hautschutzes (z.B. Cavilon® -<br />
Lolly/Spray)<br />
• längere Wechselintervalle durch länger haltende<br />
Verbände sicherstellen<br />
• Seit 1. April 2006 auf dem deutschen Markt ist ein<br />
mit 0,5mg Ibuprofen pro cm2 versetzter<br />
Polyurethanschaumverband (Biatain® Ibu)<br />
© S. Heinert paderlog
Vorbereiten, Planen, Vorbeugen (Pflegekraft)<br />
• Schaffen Sie eine angemessene, stressfreie Umgebung - schließen Sie die<br />
Fenster, schalten Sie Handys ab usw.<br />
• Schätzen Sie den Bedarf, den Sie an qualifizierter oder ungelernter<br />
Unterstützung benötigen (z.B. dem Patienten einfach die Hand zu halten)<br />
richtig ein<br />
• Achten Sie bei der Lagerung des Patienten darauf, möglichst wenig<br />
Beschwerden zu verursachen und jede unnötige Berührung oder Belastung<br />
zu vermeiden<br />
• Vermeiden Sie eine längere Freilegung der Wunde, während Sie<br />
beispielsweise auf fachärztliche Anordnung warten<br />
• Vermeiden Sie jede unnötige Reizung der Wunde - behandeln Sie die<br />
<strong>Wunden</strong> vorsichtig und seien Sie sich darüber bewusst, dass jede Berührung<br />
Schmerzen auslösen kann<br />
• Ziehen Sie eine vorbeugende Schmerzstillung in Betracht<br />
• sonstige (alternative) Maßnahmen: Atemtechnik, Musik....<br />
© S. Heinert paderlog
Maßnahmen zum Angstabbau vor und während<br />
des Verbandswechsels<br />
• Patient und Angehörigen die Maßnahmen erklären<br />
• Angehörige ermuntern, beim Wechsel mitzuhelfen und<br />
Aufgaben übertragen<br />
• Entspannungstechniken üben<br />
(z.B. langsame, rhythmische Atmung)<br />
• Ablenkung anbieten (Musik, Video, DVD, Unterhaltung)<br />
• „Auszeiten“ vereinbaren und einhalten, Stop-Signale<br />
(Klopfzeichen)<br />
• Patient ermutigen, selbst den Wechsel durchzuführen,<br />
bzw. Patient so viel, wie gewünscht, selber machen<br />
lassen<br />
© S. Heinert paderlog
• Gezielte Kälte und Wärmeanwendung können akute und manchmal<br />
auch chronische Schmerzen lindern (Octenisept® kann z.B. sowohl<br />
erwärmt als auch z.B. zu Eiswürfeln eingefroren werden)<br />
• TENS-Geräte (transkutane elektronische Nervenstimulation)<br />
reduzieren durch Stromstöße und subkutane Nervenreizung<br />
Schmerzen.<br />
• Ähnlicher Effekt durch WoundEl®, einer Elektrostimulation der Wunde<br />
über spezielle Elektroden-Wundverbände<br />
• Massage<br />
Weiterführende Überlegungen:<br />
• spezielle Lagerung unter kinästhetischen Gesichtspunkten<br />
• Meditation, Atem- oder Entspannungstechniken<br />
• Musiktherapie oder Akupunktur<br />
© S. Heinert paderlog
Schmerzbehandlung<br />
Es sollten lokale Leitlinien und Protokolle<br />
entwickelt werden, um eine sichere und<br />
wirksame Verschreibung und<br />
Vorgehensweise zu gewährleisten.<br />
Diese müssen vor dem Hintergrund der<br />
Ergebnisse aus laufenden Bewertungen<br />
überprüft und verbessert werden.<br />
© S. Heinert paderlog
Empfehlungen/ Leitlinien: Übersicht<br />
• World Union of Wound Healing Societies:<br />
Reduzierung von Schmerzen bei der<br />
Wundversorgung<br />
Ein Konsensusdokument (2004)<br />
entstanden aus 2 Dokumenten:<br />
– Schmerzen beim Verbandwechsel (2002)<br />
(Europäische Wundbehandlungsorganisation)<br />
– Praktische Behandlung von Wundschmerz und Trauma: eine<br />
Annäherung an den Patienten (2003)<br />
(Ergänzung des Ostomy Wound Management)<br />
• World Union of Wound Healing Societies:<br />
Gemeinsam gegen Wundschmerzen<br />
Konsensusdokument<br />
© S. Heinert paderlog
Konsensusdokument zur Bewertung und<br />
Behandlung des Wundschmerzes unter besonderer<br />
Berücksichtigung des chronischen Wundschmerzes<br />
(WUWHS)<br />
(International Wound Journal Vol. 5, Nr. 2, 2009)<br />
In Deutschland erschienen in<br />
Die Schwester Der Pfleger 48. Jahrg. 02/2009<br />
© S. Heinert paderlog
Konsensusdokument zur Bewertung und Behandlung<br />
des Wundschmerzes unter besonderer Berücksichtigung<br />
des chronischen Wundschmerzes<br />
Patient<br />
Entscheidungsträger<br />
Med. Personal<br />
(Pflege/ Arzt)<br />
Wissen<br />
Fortbildung/ Schulung<br />
Kommunikation<br />
Standardisiertes Vorgehen<br />
in 10 Statements<br />
© S. Heinert paderlog
DNQP: Expertenstandards<br />
Schmerzmanagement in der Pflege (2004)<br />
Pflege von Menschen mit chronischen <strong>Wunden</strong> (2008)<br />
Bezogen auf Pflegekraft und Einrichtung, fokussiert auf<br />
den Patienten<br />
Gliederung<br />
• Struktur<br />
• Prozess<br />
• Ergebnis<br />
© S. Heinert paderlog
Leitlinien: Übersicht<br />
• WHO-Stufenschema zur Schmerztherapie (1986)<br />
• Tumorschmerzen (2007) (Therapieempfehlungen der<br />
Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft)<br />
• AWMF-Leitlinie: Diagnostik und Therapie des Ulcus cruris venosum<br />
(08/2008) (Deutsche Gesellschaft für Phlebologie)<br />
• angemeldete AWMF-Leitlinie: geplante Fertigstellung 03/2009<br />
Lokaltherapie chronische <strong>Wunden</strong> bei Patienten mit den Risiken<br />
periphere arterielle Verschlusskrankheit, Diabetes mellitus, chronisch<br />
venöse Insuffizienz<br />
(Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V.)<br />
© S. Heinert paderlog
Zusammenfassung mit dem Ziel einer<br />
erfolgreichen Gesamttherapie:<br />
• vernünftige Schmerzbeurteilung<br />
• adäquate Schmerztherapie<br />
• einzusetzende Produkte kritisch hinterfragen<br />
(Achtung: veraltete oder schmerzhafte<br />
Produkte)<br />
• medizinisches und Pflegepersonal<br />
• Einbeziehung des Patienten<br />
© S. Heinert paderlog