DOKTORS DER VETERINÄRMEDIZIN (Dr. med. vet.) durch die ...
DOKTORS DER VETERINÄRMEDIZIN (Dr. med. vet.) durch die ...
DOKTORS DER VETERINÄRMEDIZIN (Dr. med. vet.) durch die ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aus dem Institut für Pathologie<br />
der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover<br />
Untersuchungen zur Therapie der idiopathischen Sebadenitis des Hundes<br />
mittels Cyclosporin A (NEORAL ? )<br />
INAUGURAL-DISSERTATION<br />
zur Erlangung des Grades eines<br />
<strong>DOKTORS</strong> <strong>DER</strong> <strong>VETERINÄRMEDIZIN</strong><br />
(<strong>Dr</strong>. <strong>med</strong>. <strong>vet</strong>.)<br />
<strong>durch</strong> <strong>die</strong> Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover<br />
Vorgelegt von<br />
Christina Boss<br />
aus Kassel<br />
Hannover 2004
Wissenschaftliche Betreuung:<br />
Univ.-Prof. <strong>Dr</strong>. M. Hewicker-Trautwein<br />
1. Gutachter: Univ.-Prof. <strong>Dr</strong>. M. Hewicker-Trautwein<br />
2. Gutachter: Univ.-Prof. <strong>Dr</strong>. M. Kietzmann<br />
Tag der mündlichen Prüfung: 18. November 2004
Für<br />
Irmtraud, Peter,<br />
Victoria und Reiner
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einleitung ............................................................................................................ 9<br />
2. Literaturübersicht......................................................................................10<br />
2.1 Die Haut des Hundes.................................................................................................... 10<br />
2.1.1 Ontogenese und Histologie der Haut ...................................................................... 10<br />
2.1.2 Ontogenese der Talgdrüse und des Haarfollikels................................................... 11<br />
2.1.3 Aufbau und Funktion der Talgdrüse ....................................................................... 14<br />
2.2 Regulation der Talgdrüsenaktivität ............................................................................. 17<br />
2.3 Nicht-neoplastische Erkrankungen der Talgdrüsen.................................................... 19<br />
2.3.1 Ichthyosis „congenita“ ............................................................................................. 19<br />
2.3.2 Idiopathische Seborrhoe........................................................................................... 19<br />
2.3.3 Akne (Acne vulgaris)............................................................................................... 20<br />
2.3.4 Leishmaniose............................................................................................................ 21<br />
2.3.5 Sebadenitis ................................................................................................................ 21<br />
2.4 Idiopathische Sebadenitis des Hundes........................................................................ 22<br />
2.4.1 Klinisches Bild ......................................................................................................... 23<br />
2.4.2 Histopathologie ......................................................................................................... 25<br />
2.4.3 Pathogenese .............................................................................................................. 27<br />
2.4.4 Therapiemöglichkeiten der Sebadenitis .................................................................. 27<br />
2.4.4.1 Topische Behandlung mit Antiseborrhoika / keratolytischen Shampoos........ 27<br />
2.4.4.2 Systemische Behandlung............................................................................. 28<br />
2.4.4.2.1 Freie Fettsäuren/Fischöl ........................................................................... 28<br />
2.4.4.2.2 Glukokortikoide........................................................................................ 29<br />
2.4.4.2.3 Retinoide ................................................................................................... 30<br />
2.5 Cyclosporin A............................................................................................................. 32<br />
2.5.1 Wirkmechanismus von Cyclosporin A................................................................. 32<br />
2.5.2 Nebenwirkungen von Cyclosporin A.................................................................... 35<br />
2.5.3 Anwendungsgebiete und Dosierungen von Cyclosporin A................................. 36<br />
2.5.4 Pharmakokinetik..................................................................................................... 38<br />
2.6. Einsatz von Cyclosporin A bei der idiopathischen Sebadenitis des Hundes........ 39<br />
2.6.1 Ziel eigener Untersuchungen................................................................................. 39<br />
3. Eigene Untersuchungen.............................................................................40<br />
3.1 Material und Methoden ............................................................................................... 40<br />
3.1.1 Versuchsanordnung................................................................................................. 40<br />
3.1.2 Bewertungssystem zur Erfassung des klinisch-dermatologischen Status............ 41<br />
3.1.3 Anfertigung von Gewebeschnitten......................................................................... 43<br />
3.1.4 Färbung der Gewebsschnitte................................................................................... 43<br />
3.1.4.1 Hämalaun-Eosin-Färbung (H.E.-Färbung)....................................................... 43<br />
3.1.4.2 Immunhistochemische Darstellung von Makrophagen ................................... 44<br />
3.1.4.3 Immunhistochemische Darstellung von CD3-Antigen der T-Lymphozyten . 44<br />
3.1.5.4 Immunhistochemische Darstellung des caninen MHC-Klasse II–Antigens .. 45<br />
3.1.5 Bewertungssystem zur Erfassung des histopathologischen Krankheitsstatus ........ 45<br />
3.1.6 Auswertung der immunhistologisch gefärbten Präparate/ Morphometrie .............. 46
3.1.7 Dokumentation der Ergebnisse.................................................................................. 46<br />
3.1.8 Statistik........................................................................................................................ 46<br />
3.2 Ergebnisse........................................................................................................................ 47<br />
3.2.1 Patientendaten........................................................................................................... 47<br />
3.2.2 Unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen ......................................................... 64<br />
3.2.3 Histopathologische Verlaufsuntersuchungen unter Cyclosporin A-Therapie ...... 66<br />
3.2.4 Immunhistologische Verlaufsuntersuchungen unter Cyclosporin A-Therapie .... 78<br />
3.2.4.1 Makrophagen...................................................................................................... 78<br />
3.2.4.2 MHC-Klasse II- Expression .............................................................................. 80<br />
3.2.4.3 CD3 Expression der T-Lymphozyten............................................................... 82<br />
3.2.5 Krankheitsverlauf nach zwölfmonatiger Cyclosporin A-Behandlung................ 84<br />
3.2.5.1 Beenden der Cyclosporin A-Therapie ............................................................. 84<br />
3.2.5.2 Fortsetzen der Cyclosporin A-Therapie........................................................... 87<br />
4. Diskussion .........................................................................................................98<br />
4.1 Betrachtung des Patientenmaterials .................................................................................. 98<br />
4.2 Betrachtung der Methodik ................................................................................................. 99<br />
4.3 Betrachtung der Ergebnisse ............................................................................................. 101<br />
5. Zusammenfassung .........................................................................................107<br />
5. Summary.........................................................................................................109<br />
6. Literaturverzeichnis ......................................................................................111<br />
7. Anhang ............................................................................................................128
Abkürzungsverzeichnis:<br />
ACTH Adrenocorticotropes Hormon<br />
CD „Cluster of Differentiation“; Sytem zuir Bezeichnung von<br />
Leukozytendifferenzierungsantigeneng<br />
DAB 3,3´- Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid<br />
DNA „Desoxyribonucleic acid“; Desoxyribonukleinsäure<br />
EDA Ectodysplasmin<br />
EPID Epidermis<br />
FSH Follikelstimulierendes Hormon<br />
GH Growth Hormone<br />
IL Interleukin<br />
LH Luteinisierendes Hormon<br />
MHC Haupt-Histokompatibilitätskomplex<br />
MSH Melanozytenstimulierendes Hormon<br />
SEBG Talgdrüsen<br />
SWG Schweißdrüsen<br />
TSH Thyreoideastimulierendes Hormon
Einleitung 9<br />
1. Einleitung<br />
Die idiopathische Sebadenitis des Hundes stellt eine immunvermittelte, entzündliche<br />
Destruktion der Talgdrüsen dar. Es handelt sich um eine seltene Erkrankung, von der viele<br />
verschiedene Rassen und auch Mischlinge betroffen sein können. Trotzdem ist eine deutliche<br />
Rassedisposition (Akita Inu, Pudel, Hovawart, Vizsla und Samojede) bekannt. Durch den<br />
Verlust der Talgdrüseneinheiten und dem damit einhergehenden Verlust des<br />
Talgdrüsensekretes erscheint das Fell stumpf und brüchig, <strong>die</strong> Haut wird trocken und<br />
schuppig und hat eine erhöhte Prädisposition zu Pyodermien. Charakteristisch sind <strong>die</strong> eng<br />
am Haarschaft klebenden Schuppen, <strong>die</strong> histologisch als infundibuläre Hyperkeratose<br />
auffallen.<br />
Eine kausale Therapiemöglichkeit besteht zur Zeit nicht. Die bisher eingesetzten<br />
Medikamente (topisches Propylenglykol, orale Retinoide, orale Glukokortikoide) können das<br />
klinische Bild nur begrenzt beeinflussen und haben zudem unerwünschte Nebenwirkungen.<br />
Cyclosporin A scheint als Therapeutikum geeignet, weil es nicht nur <strong>die</strong> T-Zell-vermittelte<br />
Immunantwort supprimiert, sondern auch einen das Haarwachstum stimulierenden Effekt<br />
aufweist. In den letzten Jahren häufen sich anekdotische Berichte von dem erfolgreichen<br />
Einsatz von Cyclosporin A. Bisher liegt aber keine systematische Untersuchung zur Therapie<br />
der idiopathischen Sebadenitis des Hundes mittels Cyclosporin A vor.<br />
Die vorliegende Arbeit befaßt sich im Einzelnen mit den folgenden Fragestellungen:<br />
- Verbessert eine Therapie mit Cyclosporin A das klinische Bild der Sebadenitis?<br />
- Wann setzt eine Verbesserung des klinischen Bildes ein?<br />
- Kann Cyclosporin A (NEORAL ? ) <strong>die</strong> Entzündungsreaktionen im Bereich der<br />
Talgdrüsen vermindern?<br />
- Ist <strong>durch</strong> <strong>die</strong> Wirkung von Cyclosporin A ein Nachwachsen von Talgdrüsen möglich?<br />
- Kann <strong>die</strong> infundibuläre Hyperkeratose gemildert werden?<br />
- Ist Cyclosporin A das Mittel der Wahl in der Therapie der idiopathischen Sebadenitis des<br />
Hundes?
Literaturübersicht 10<br />
2. Literaturübersicht<br />
2.1 Die Haut des Hundes<br />
Die Haut (Integumentum commune) ist <strong>die</strong> äußere Bedeckung des Körpers und schließt<br />
zahlreiche Hautanhangsgebilde (Haare, <strong>Dr</strong>üsen, Krallen) ein (WEISS und TEIFKE 1999). Sie<br />
schirmt als Grenzfläche den Organismus von der Umwelt ab und schafft eine breite<br />
Kontaktfläche zu <strong>die</strong>ser. Darüber hinaus besitzt <strong>die</strong> Haut eine Vielzahl von Eigenschaften, zu<br />
denen unter anderem der Schutz gegenüber mechanischen, thermischen, chemischen und<br />
biologischen Einflüssen gehört (LIEBICH 1992).<br />
2.1.1 Ontogenese und Histologie der Haut<br />
Die Haut besteht aus der Epidermis (Oberhaut), dem Korium (Dermis, Lederhaut) und der<br />
Subkutis (Hypodermis, Unterhaut) (WEISS und TEIFKE 1999). Die Epidermis entwickelt<br />
sich aus dem Ektoderm. Korium und Subkutis entstehen aus dem Mesoderm (SCHNORR<br />
1996).<br />
Die Epidermis ist ein mehrschichtiges verhornendes Plattenepithel. Die verhornenden<br />
Epithelzellen werden als Keratinozyten bezeichnet (SCHNORR 1996). Funktionell sind für<br />
den epithelialen Schutzmechanismus zwei Abschnitte der Epidermis von Bedeutung.<br />
Das Stratum germinativum <strong>die</strong>nt als basale Keimschicht der ständigen Erneuerung von<br />
Keratinozyten, welche oberflächlich verhornen und abgeschilfert werden. Die oberflächlichen<br />
Epithellagen, d.h. Stratum granulosum, Stratum lucidum und Stratum corneum, wirken als <strong>die</strong><br />
eigentliche Schutzschicht der Haut. Das Korium besteht aus einem dichten<br />
Kollagenfasergeflecht, welches von elastischen Fasern <strong>durch</strong>setzt ist. Im Korium liegen Blutund<br />
Lymphgefässe, sowie Nervenaufzweigungen. Bis in <strong>die</strong>se Schicht reichen <strong>die</strong> Wurzeln<br />
der Haarfollikel sowie <strong>die</strong> Hautdrüsen. Unter dem Korium liegt <strong>die</strong> Unterhaut, ein lockeres,<br />
<strong>durch</strong> Bindegewebsfaserzüge unterkammertes, fettgewebsreiches Bindegewebe. Sie verbindet<br />
<strong>die</strong> Haut mit der oberflächlichen Körperfaszie (LEONHARDT 1990).
Literaturübersicht 11<br />
2.1.2 Ontogenese der Talgdrüse und des Haarfollikels<br />
Die Talgdrüse entwickelt sich mit dem Haarfollikel zusammen aus einer Einheit, <strong>die</strong> als<br />
„pilosebaceous unit“ bezeichnet wird. Diese Entwicklung beginnt beim Menschen um den<br />
dritten fetalen Monat (PINKUS 1958). Die Epidermis „wuchert“ mit der Basalmembran<br />
gegen <strong>die</strong> mesenchymale Unterlage als Vorkeim vor (SCHNORR 1996) (Abb. 1).<br />
Die molekularen Mechanismen <strong>die</strong>ser Entwicklung sind sehr vielseitig und bisher nicht<br />
vollständig bekannt. Das Gen „Ectodysplasmin“ (EDA) spielt beispielsweise eine wichtige<br />
Rolle bei der Entwicklung von Haarfollikeln und Talgdrüsen. Fehlt EDA, bzw. sein Rezeptor<br />
(EDA-R), oder ist deren Funktion gestört, so kommt es zu einer ektodermalen Dysplasie und<br />
einem vollständigen Fehlen von Haaren und Talgdrüsen, was zum Krankheitsbild der<br />
„anhydrotischen ektodermalen Dysplasie“ führt (BLECHER et al. 1990).
Literaturübersicht 12<br />
Abb. 1: Schematische Darstellung der Haarfollikelentwicklung bei der Maus. Es sind acht<br />
verschiedene, morphologisch differenzierbare Entwicklungssta<strong>die</strong>n zu erkennen, <strong>die</strong> mit 0 bis<br />
8 gekennzeichnet sind (modifiziert nach HARDY 1992).
Literaturübersicht 13<br />
Als Reaktion auf <strong>die</strong> Haarkeimbildung verdichten sich <strong>die</strong> darunterliegenden<br />
Mesenchymzellen. Daraus entstehen <strong>die</strong> bindegewebige Haarpapille und <strong>die</strong> Anlage des<br />
bindegewebigen Haarbalges. Auslösend für <strong>die</strong>se Entwicklungsschritte sind direkte<br />
Signalübertragungen zwischen epithelialen und mesenchymalen Zellen (HARDY 1992).<br />
Der Haarkeim verlängert sich und wächst als Haarzapfen schräg in <strong>die</strong> Tiefe. Das Ende des<br />
Haarzapfens verdickt sich knotenartig und wird von der Haarpapille eingestülpt. Da<strong>durch</strong> ist<br />
aus dem Haarzapfen der Bulbuszapfen mit Haarwurzel entstanden. Die über der Papille<br />
gelegenen Meilerzellen bilden <strong>die</strong> Matrix für das wachsende Haar. Durch Proliferation<br />
entsteht aus den Matrixzellen der pyramidenförmige Haarkegel, der emporwächst und <strong>die</strong><br />
Füllzellen verdrängt. Das Haar geht aus basalen Mitosen der Zellen des epithelialen Bulbus<br />
hervor, <strong>die</strong> nach Aufnahme von Melanin in Richtung der Hautoberfläche abgeschoben werden<br />
und dabei verhornen. Es entsteht eine Hornspitze, schließlich ein von dachziegelförmig<br />
angeordneten verhornten Zellen, der Haarkutikula, überzogenes Hornstäbchen. Das<br />
eigentliche Haar <strong>durch</strong>stößt zunächst <strong>die</strong> innere epitheliale Wurzelscheide, <strong>die</strong> nur bis in Höhe<br />
der Talgdrüsensprosse reicht (SCHNORR 1996). Diese Entwicklung ist beim Menschen ab<br />
dem vierten fetalen Monat erkennbar (SERRI und HUBER 1963). Die Haarspitze dringt nun<br />
unter Abbiegung in den Haarkanal ein und erscheint an der Hautoberfläche.<br />
Die holokrinen Talgdrüsen erscheinen erst spät in der Haarfollikelentwicklung und entstehen<br />
distal von den Schlauchdrüsen <strong>durch</strong> „Wucherungen“ der äußeren Wurzelscheide (der<br />
zylinderförmigen Basalzellen des Haarzapfens). Zunächst bildet sich ein kleiner Wulst, der zu<br />
einem Säckchen auswächst. Die inneren Zellen vergrößern sich und fallen einer fettigen<br />
Degeneration anheim. Die meisten Talgdrüsen entwickeln sich nur in Verbindung mit einem<br />
Haarfollikel. Die Talgdrüsen der Lider und des Präputiums entwickeln sich hingegen<br />
selbständig, d.h. ohne Haarfollikel (SCHNORR 1996).<br />
Haarfollikel produzieren nicht kontinuierlich einen Haarschaft, sondern <strong>durch</strong>laufen<br />
lebenslang einen Zyklus aus Abbau und Wiederaufbau. Ein Haarzyklus besteht aus der<br />
Wachstumsphase (Anagen), der Rückbildungsphase (Katagen), während der <strong>die</strong> Matrix<br />
abstirbt und zum Haarkolben umgebildet wird, und der End-/Ruhephase (Telogen), nach der<br />
es zum Ausfall des Haares kommt (WEISS und TEIFKE 1999).
Literaturübersicht 14<br />
2.1.3 Aufbau und Funktion der Talgdrüse<br />
Talgdrüsen (Glandulae sebaceae) sind epitheliale, exokrine, mehrlappige, oberflächlich<br />
gelegene, holokrine <strong>Dr</strong>üsen in der Cutis. Sie stehen <strong>durch</strong> einen Ausführungsgang (Ductus<br />
seboglandularis), der in das Follikelinfundibulum mündet, mit der Oberfläche der Epidermis<br />
in Verbindung und entleeren dorthin ihr Sekret, den Talg (Sebum). Als Infundibulum<br />
bezeichnet man den Abschnitt des Follikelausführungsganges, der sich von der Höhe des<br />
Ostiums bis hinab zur obersten Einmündung des Talgdrüsenausführungsganges (Ductus<br />
seboglandularis) erstreckt (CUNLIFFE 1992; LEONHARDT 1990) (Abb. 2).<br />
Abb. 2: Schematische Einteilung der anatomischen Abschnitte eines menschlichen<br />
Haarfollikels (modifiziert nach KLEIN 1993); 1 = Haarkanal; 2 = Infundibulum; 3 =<br />
Talgdrüsenmündung; 4 = Isthmus; 5 = Ansatz des Haarbalgmuskels; 6 = untere<br />
Follikelportion; 7 = Haarbulbus.
Literaturübersicht 15<br />
Die Talgdrüse besteht aus einem vielschichtigen Epithel. Die Synthese des Talgs erfolgt an<br />
der Basis der alveolären <strong>Dr</strong>üsenläppchen in undifferenzierten, sich rasch teilenden<br />
Epithelzellen. Diese produzieren Fettsäuren, Cholesterine und Triglyceride. Die Zellen<br />
platzen schließlich und bilden in ihrer Gesamtheit das Endprodukt der <strong>Dr</strong>üse, den Talg,<br />
welchen sie <strong>durch</strong> den Ausführungsgang in das Follikelinfundibulum abgeben (Abb. 3).<br />
Abb. 3: Allgemeine Struktur eines Talgdrüsenlappens mit Sebozyten in unterschiedlichen<br />
Entwicklungsphasen der Talgsynthese (modifiziert nach JENKINSON 1990).<br />
Bei Menschen und Ratten beträgt <strong>die</strong> "Lebensspanne" einer Talgdrüsenzelle von Zellteilung<br />
bis zum Zelltod ca. zwei Wochen. Es vergehen weitere acht Tage von der Sebumfreisetzung<br />
in den Talgdrüsenausführungsgang bis zum Erreichen der Hautoberfläche (DOWING et al.<br />
1986; PLEWIG und CHRISTOPHERS 1978). Das fettige Sekret der Talgdrüsen verteilt sich<br />
im follikulären Infundibulum und auf der Hautoberfläche und überzieht <strong>die</strong> Epidermis mit<br />
einem dünnen Fettfilm. Dieser vermindert <strong>die</strong> Durchlässigkeit für Wasser und wässrige<br />
Flüssigkeiten, hält <strong>die</strong> Cuticula der Haare geschmeidig und trägt somit zum Glanz der Haare<br />
bei (LIEBICH 1992; LEONHARDT 1990). Im Krankheitsfall erscheinen manchmal <strong>die</strong><br />
Haare glanzlos und trocken, was oft auf eine inadäquate Talgdrüsenfunktion zurückzuführen<br />
ist. Außer zum Schutz, wirkt der Talg auch als chemische Barriere gegen potenzielle
Literaturübersicht 16<br />
Krankheitserreger. Bei den meisten Spezies beinhaltet frisch freigesetztes Sebum<br />
überwiegend Triglyceride und Wachsester (SCOTT et al. 2001). Der Hund und auch das<br />
Pferd produzieren hingegen einen Talg, welcher zu 38- 42% aus Sterolester besteht und keine<br />
Triglyceride und Wachsester beinhaltet (SHARAF et al. 1977; DOWNING und COLTON<br />
1980). Im Haarfollikelinfundibulum wird das Sebum mit Lipase-produzierenden Bakterien<br />
(Propionibacterium spp., Staphylococcus spp.) kontaminiert, welche Fettsäuren herstellen. Es<br />
ist bekannt, daß einige Fettsäuren antimikrobielle Wirkungen haben (SCOTT et al. 2001), und<br />
es wurde nachgewiesen, daß der Talg auch Immunglobulin A beinhaltet (GEBHART 1988;<br />
METZE et al. 1989). Desweiteren soll der Talg auch pheromonale Eigenschaften haben<br />
(JENKINSON 1990).<br />
Die Anzahl und Größe der Talgdrüsen variiert von Körperregion zu Körperregion. Beim<br />
Hund finden sich <strong>die</strong> größten Talgdrüsen am Kinn. Im Interdigitalraum, im Nacken und am<br />
Schwanzansatz ist eine besonders hohe Zahl großer Talgdrüsen zu finden (SCOTT et al.<br />
2001). Talgdrüsen fehlen an Zehen- und Sohlenballen, Zitzen, und Nasenspiegel (WEISS<br />
und TEIFKE 1999) (Abb. 4).<br />
Abb. 4: Vergleichende Beschreibung der Lokalisation von Schweißdrüsen (SWG) und<br />
Talgdrüsen (SEBG), (EPID) = Epidermis; (modifiziert nach JENKINSON 1990). a) In<br />
behaarter Haut werden beide Formen in Verbindung mit dem Haarfollikel gefunden und<br />
haben ihren Ausführungsgang in den Follikelkanal. b) Bei unbehaarter Haut entleert sich <strong>die</strong><br />
Talgdrüse direkt <strong>durch</strong> <strong>die</strong> Epidermis.
Literaturübersicht 17<br />
2.2 Regulation der Talgdrüsenaktivität<br />
Die Sekretion der Talgdrüsen unterliegt einer vielfältigen hormonellen Kontrolle (Abb. 5).<br />
Unter androgener Wirkung kommt es zur Hypertrophie und Hyperplasie der Talgdrüsen,<br />
während es bei östrogener und glukokortikoider Wirkung zur Involution kommt (SCOTT et<br />
al. 2001).<br />
Abb. 5: Endokrine Beeinflussung der Talgdrüsensekretion<br />
(modifiziert nach SHUSTER und THODY, 1974). GH = Growth Hormone, TSH =<br />
Thyreoidea Stimulierendes Hormon, ACTH = Adrenocorticotropes Hormon, FSH =<br />
Follikelstimulierendes Hormon, LH = Luteinisierendes Hormon, MSH =<br />
Melanozytenstimulierendes Hormon
Literaturübersicht 18<br />
Testosteron erhöht <strong>die</strong> Anzahl der Talgdrüsen bei juvenilen weiblichen Ratten (EBLING<br />
1948). Es stimuliert <strong>die</strong> Mitose der Talgdrüsenzellen und <strong>die</strong> Lipidsynthese (EBLING 1963).<br />
Auch beim Menschen ist <strong>die</strong> endokrine Regulation auf <strong>die</strong> Talgdrüsen beschrieben. So weiß<br />
man, daß <strong>die</strong> Talgdrüsen von Neugeborenen unter dem Einfluß der mütterlichen Androgene<br />
noch relativ groß und auch sekretorisch aktiv sind. Sie verkleinern sich jedoch postpartal<br />
innerhalb von Monaten, um erst in der Pubertät, wiederum gesteuert <strong>durch</strong> Androgene aus<br />
Nebennierenrinde und Hoden, in eine starke Entwicklung einzutreten. Allerdings weisen<br />
unterschiedliche Beobachtungen darauf hin, daß nicht <strong>die</strong> absolute Höhe des<br />
Androgenspiegels, sondern <strong>die</strong> individuelle Empfindlichkeit bzw. Reaktivität der Talgdrüsen<br />
auf bereits normale Androgenspiegel für <strong>die</strong> Talgdrüsenfunktion bedeutsam sind (WOLFF<br />
1992).<br />
Östrogene scheinen <strong>die</strong> Talgdrüsenaktivität zu unterdrücken (EBLING und SKINNER 1983).<br />
Östrogene haben im Gegensatz zu den Androgenen keine Wirkung auf <strong>die</strong> Anzahl der<br />
Sebozyten, sondern sie unterdrücken <strong>die</strong> Talgproduktion (EBLING 1973). Vermutlich wirkt<br />
Östrogen auf <strong>die</strong> Enzymregulation der Lipogenese (DOWNIE und KEALEY 1997). Bei<br />
Versuchen mit isolierten Talgdrüsen konnte gezeigt werden, daß <strong>die</strong> unterdrückende Wirkung<br />
der Östrogene nicht mit einer Veränderung der Mitoserate einhergeht (GUY et al. 1996).<br />
Es ist bis heute unsicher, wie und ob Gestagene auf <strong>die</strong> Entwicklung von Talgdrüsen wirken.<br />
Einzelne Experimente haben gezeigt, daß Progesteron zu einer Erhöhung der<br />
Talgdrüsenanzahl von ovariohysterektomierten Ratten führt (HASKIN et al. 1953).<br />
Diese Ergebnisse konnten von EBLING et al. (1969) aber selbst mit höheren<br />
Progesterondosen nicht reproduziert werden. STRAUSS und KLINGMANN zeigten (1961),<br />
daß Progesteron bei erwachsenen, jungen und älteren Frauen keinen Effekt auf <strong>die</strong><br />
Talgdrüsensekretion hat.
Literaturübersicht 19<br />
2.3 Nicht-neoplastische Erkrankungen der Talgdrüsen<br />
2.3.1 Ichthyosis „congenita“<br />
Ichthyosis (Fisch-Schuppen-Krankheit) ist eine sehr seltene heterogene Gruppe erblicher<br />
Hauterkrankung, <strong>die</strong> bei vielen verschiedenen Spezies, unter anderem Hunden, beschrieben<br />
worden ist. Die Veränderungen sind <strong>durch</strong> eine starke Hyperkeratose charakterisiert. Obwohl<br />
postuliert wurde, daß eine verringerte oder fehlende Schweißdrüsensekretion für <strong>die</strong><br />
schuppige Haut verantwortlich ist (WEISS und TEIFKE 1991), sind bei der Ichthyose in der<br />
Regel keine morphologischen Veränderungen an den Talgdrüsen feststellbar<br />
(MECKLENBURG, persönl. Mitteilung 2003).<br />
2.3.2 Idiopathische Seborrhoe<br />
Bei der idiopathischen Seborrhoe handelt es sich um eine kongenitale oder erworbene<br />
Hauterkrankung mit Verhornungsstörungen, <strong>die</strong> überwiegend bei bestimmten Rassen, wie<br />
z.B. beim Cockerspaniel, Irish Setter, Dobermann und Schäferhund vorkommt.<br />
Symptomatisch sind Schuppen, Krusten und Haarausfall. Sekundär kommt es zu Pyodermien.<br />
Das Haarkleid erscheint struppig, matt und stinkend. In einer Stu<strong>die</strong> verglich man nicht<br />
erkrankte Cockerspaniel mit erkrankten und stellte fest, daß deren Epidermis und<br />
Haarfollikelinfundibulum, sowie deren Talgdrüse hyperproliferativ waren. Die Zeit der<br />
epidermalen Zellerneuerung betrug bei Tieren mit idiopathischer Seborrhoe acht Tage im<br />
Vergleich zu 21 Tagen bei gesunden Tieren (KWOCHKA und RADEMAKERS 1989).
Literaturübersicht 20<br />
2.3.3 Akne (Acne vulgaris)<br />
Akne ist primär eine multifaktorielle Erkrankung der Haarfollikel beim Menschen und Hund.<br />
Eine wichtige Voraussetzung für <strong>die</strong> Entwicklung einer Akne ist <strong>die</strong> Aktivität der Talgdrüsen.<br />
Ihre Größe und Funktion sind im Wesentlichen abhängig von genetischer Disposition und<br />
hormoneller Steuerung <strong>durch</strong> Androgene. Nicht <strong>die</strong> absolute Höhe der Androgenspiegel ist<br />
dabei entscheidend, sondern <strong>die</strong> individuelle Reaktivität der Talgdrüsen. Der Talg ist<br />
zusammen mit den zerfallenen Hornzellen Nährsubstrat für im Follikelkanal siedelnde<br />
Mikroorganismen, von denen dem anaeroben Propionibacterium acnes mit seinen<br />
Stoffwechsel- und Abbauprodukten eine wesentliche pathogenetische Rolle bei der<br />
Entstehung der Akne zukommt (WOLFF 1992). Daneben ist <strong>die</strong> intrainfundibuläre<br />
Hyperkeratose - eine follikuläre Retentionshyperkeratose - einer der primären und wichtigsten<br />
pathogenetischen Faktoren bei der Entstehung der Akne-Effloreszenzen. Im Infundibulum der<br />
Talgdrüsenfollikel bildet sich ein aus Hornlamellen aufgebauter Pfropf (Ko<strong>med</strong>o). Ursache<br />
für <strong>die</strong> Entstehung des Ko<strong>med</strong>o ist eine gestörte und abnorm gesteigerte Verhornung. Es wird<br />
zuviel und „falsches“ Keratin gebildet. Die Hornzellen trennen sich nicht mehr, sondern<br />
haften zusammen, was den Transport nach außen verhindert. So entsteht <strong>durch</strong> einen Horn-<br />
Talgstau ein zunächst nur mikroskopisch feststellbarer Mikroko<strong>med</strong>o. Dann folgt<br />
makroskopisch sichtbar ein geschlossener Ko<strong>med</strong>o mit gelblich-zystenartigen Knötchen und<br />
schließlich der offene Ko<strong>med</strong>o mit dem „schwarzen“ Kopf (MELNIK und PLEWIG 1988).<br />
Dies bewirkt eine weitere Begünstigung der anaeroben Mikroflora. Retinierte<br />
Follikelbestandteile wie Talg und Horn, ihre Abbauprodukte sowie <strong>die</strong> Mikroorganismen und<br />
ihre Produkte bewirken eine perifollikuläre, toxisch und immunologisch ausgelöste<br />
entzündliche Reaktion. Bei Acne vulgaris reagieren <strong>die</strong> Haarfollikel bzw. Talgdrüsen<br />
asynchron. Daraus resultiert das klassische polymorphe Bild mit gleichzeitigem Vorkommen<br />
von Vorstufen, nichtentzündlichen (primären), entzündlichen (sekundären) und<br />
postinflammatorischen, narbigen (tertiären) Akne-Effloreszenzen (WOLFF 1992).<br />
Akne wird auch bei Hunden beschrieben, stellt dort aber keinen spezifischen<br />
Keratinisierungsdefekt dar, sondern ist eher eine unspezifische Form der Follikulitis und<br />
Furunkulose im Kinn- und Lippenbereich (SCOTT et al. 2000).
Literaturübersicht 21<br />
2.3.4 Leishmaniose<br />
Die Leishmaniose ist <strong>die</strong> am häufigsten in Deutschland „eingeschleppte“ Infektionskrankheit<br />
bei Hunden (GOTHE et al. 1997). Sie wird <strong>durch</strong> intrazellulär resi<strong>die</strong>rende Protozoen<br />
(Tryponosomatiden) verursacht. Bei der „Hautform“ kommt es zu einer nicht juckenden<br />
Dermatitis primär des Nasenrückens, der Ohrenspitzen und um <strong>die</strong> Augen herum. Die<br />
Hautveränderungen, <strong>die</strong> sich als große, leicht fettige Schuppen präsentieren, können sich aber<br />
auch auf den ganzen Körper ausbreiten. Bei der kutanen Leishmaniose des Hundes wird<br />
häufig eine sekundäre Zerstörung der Talgdrüsen (Sebadenitis) beobachtet (SCOTT et al.<br />
2001).<br />
2.3.5 Sebadenitis<br />
Die Sebadenitis ist eine primäre, selektive Entzündungsreaktion gegen <strong>die</strong> Talgdrüsen,<br />
welche beim Hund (SCOTT et al. 1995), bei der Katze (WENDELBERGER 1999; SCOTT<br />
1989), bei Kaninchen (LIN<strong>DER</strong> et al. 1998) und Menschen (RENFRO et al. 1993)<br />
beschrieben worden ist. Die Symptome bei Katze und Kaninchen ähneln denen des<br />
Hundes. Das Fell wird brüchig, schuppig und ist leicht epilierbar. Die Veränderungen<br />
beginnen ebenfalls am Kopf bzw. Nacken und an den Ohrmuscheln und gehen dann weiter<br />
auf den Körper über (SCOTT 1989; LIN<strong>DER</strong> et al. 1998). Bei einem Kaninchen konnte unter<br />
der Schuppung eine Depigmentierung beobachtet werden (LIN<strong>DER</strong> et al. 1998). Beim<br />
Menschen werden ringförmige Exantheme im Gesicht mit krustigen Belägen und einer leicht<br />
erhöhten und feinen Umrandung beschrieben (RENFRO et al. 1993; MARTINS et al. 1997).
Literaturübersicht 22<br />
2.4 Idiopathische Sebadenitis des Hundes<br />
Die idiopathische Sebadenitis des Hundes bezeichnet eine spezifische, primäre<br />
Entzündungsreaktion, welche gegen <strong>die</strong> Talgdrüsen gerichtet ist und zum vollständigen<br />
Verlust der <strong>Dr</strong>üsen führen kann. Folglich wird somit auch <strong>die</strong> Sebumproduktion „verhindert“.<br />
Die Destruktion der Talgdrüse hat bei anhaltendem Haarwachstum eine deutliche<br />
infundibuläre Hyperkeratose zur Folge (DUNSTAN und HARGIS 1995; REICHLER et al.<br />
2001). Das Haarwachstum selbst scheint <strong>durch</strong> den Verlust des Sebums nicht beeinträchtigt<br />
zu sein. Der Entzündungscharakter der Sebadenitis verändert sich im Verlauf der Erkrankung,<br />
da es sich um einen selbstlimitierenden Prozess handelt (von lymphozytär, über<br />
granulomatös, zu pyogranulomatös). Nach Verlust der Talgdrüsen nimmt auch <strong>die</strong><br />
Entzündungsintensität ab.<br />
Klinisch erscheint <strong>die</strong> Haut trocken und schuppig, und es entstehen haarlose Stellen.<br />
Charakteristisch sind <strong>die</strong> eng am Haarschaft anhaftenden, klebenden Schuppen. Das Fell<br />
erscheint glanzlos, trocken und brüchig.<br />
Histologisch können unterschiedliche Entzündungsgrade festgestellt werden. An Stellen, an<br />
denen man sonst Talgdrüsen erwartet, sind keine Sebozyten mehr erkennbar. Dort findet<br />
man perifollikuläre Granulome. Dieses Zellinfiltrat besteht aus Makrophagen, Lymphozyten,<br />
Plasmazellen und neutrophilen Granulozyten. Die Haarfollikel selbst bleiben verschont.<br />
Chronische Veränderungen sind gelegentlich charakterisiert <strong>durch</strong> eine oberflächliche,<br />
hyperplastische Dermatitis mit starker orthokeratotischer oder parakeratotischer<br />
Hyperkeratose der Epidermis und des Haarfollikels (SCOTT et al. 2001; CAROTHERS et al.<br />
1991). Die Sebadenitis hat keine Geschlechts- oder Fellfarbenprädisposition (DUNSTAN und<br />
HARGIS 1995). Beim Hund gibt es jedoch eine klare Rassedisposition (siehe 2.4.1).
Literaturübersicht 23<br />
2.4.1 Klinisches Bild<br />
Die idiopathische, granulomatöse Sebadenitis des Hundes ist im fortgeschrittenen Stadium<br />
charakterisiert <strong>durch</strong> das komplette Fehlen der Talgdrüsen. Augenscheinlich gibt es keine<br />
geschlechtliche Prädisposition, und <strong>die</strong> Erkrankung betrifft hauptsächlich junge bis mittelalte<br />
Tiere ohne eine Fellfarbenprädisposition (DUNSTAN und HARGIS 1995).<br />
Obwohl viele Rassen und Mischlinge betroffen sind, gibt es doch eine Rassedisposition bei<br />
folgenden Rassen: Pudel, Akita Inu, Vizsla, Samoyed und Chow-Chow (SCOTT 1986;<br />
ROSSER et al. 1987; GUAGUÈRE et al. 1990).<br />
Die ersten Anzeichen einer Sebadenitis treten am Kopf, an den Ohren und am Rumpf auf. Es<br />
kann auch zu sekundären Pyodermien kommen, welche von einer oberflächlichen bis tiefen<br />
Follikulitis bis hin zu einer Furunkulose reichen können. Häufig geht bei dem<br />
Krankheitsverlauf auch eine Otitis externa mit einher. Generell ist das klinische Bild <strong>durch</strong><br />
ein schütteres Haarkleid, Haarbruch, runde Stellen mit komplettem Haarausfall, ausgeprägten<br />
Schuppen und an den leicht ausgehenden Haaren und daran zum Teil haftenden<br />
zylinderförmigen Ausgüssen der Haarfollikel, <strong>die</strong> aus Schuppen und Talg bestehen,<br />
gekennzeichnet (BIGLER 2001).<br />
Die Krankheitssymptomatik scheint zwischen Langhaarrassen und kurzhaarigen Hunden<br />
etwas unterschiedlich zu sein. Bei Langhaarrassen wie dem Pudel oder Akita Inu beginnen <strong>die</strong><br />
Hautveränderungen begleitet von diffusen Haarverlusten am Kopf und auf der dorsalen<br />
Rückenlinie. Sie breiten sich von dort ventral über den Rumpf aus (REICHLER et al. 2001).<br />
Das Haar erscheint dünner, fast "mottenfraßähnlich" (Abb. 3.4). Bei kurzhaarigen Tieren<br />
erkennt man multifokale fast unbehaarte Felder, welche <strong>die</strong> Tendenz haben, sich zu einem<br />
zusammenhängenden alopezischen Feld zusammenzuschließen. Die punktuellen<br />
Veränderungen haben keine bezeichnende Hyperkeratose (REICHLER et al. 2001). Die<br />
Schuppen sind feiner und weiß und nicht so anhaftend an den Haarschäften (SCOTT et<br />
al.2001, CAROTHERS et al. 1991) (Abb. 3.3). Beim Pinscher sind neben den beschriebenen<br />
Veränderungen (Krusten, Schuppen, Alopezie), <strong>die</strong> hier am Planum nasale beginnen und sich<br />
dann über <strong>die</strong> Rückenlinie hin zum Rumpf entwickeln, auch noch Schwellungen der Nase, der<br />
Lippen und Augenlider bemerkt worden (CAROTHERS et al. 1991). SCOTT beschreibt 1989<br />
zuerst erythematöse Papeln und Plaques, welche sich dann zu runden und serpiginös<br />
alopezischen Veränderungen entwickeln. Hunde mit einer hochgradigen Hyperkeratose haben
Literaturübersicht 24<br />
häufig einen starken seborrhoeischen Geruch (DUNSTAN und HARGIS 1995). Beim Pudel<br />
werden <strong>die</strong> Veränderungen mit einer deutlichen Hyperkeratose und nachfolgender Alopezie<br />
beschrieben. Das Haar wird glanzlos und brüchig, mit eng anhaftenden, silbrig-weissen<br />
Schuppen mit integrierten Büscheln von matten Haaren. In manchen Fällen verlieren <strong>die</strong><br />
Haare an Lockung und <strong>die</strong> Fellfarbe verändert sich. Die Symptome beginnen am Kopf und an<br />
den Ohren und gehen dann über auf Nacken und dorsalen Rücken (DUNSTAN und HARGIS<br />
1995; ROSSER et al. 1987). Akitas neigen zu stark generalisierten erythematösen und fettigschmierigen<br />
Hautveränderungen. Es zeigen sich Papeln, Pusteln, Schuppen und gelblichbraune<br />
Beläge zusammenhaftend mit Haaren. Auffallend ist ein großer Verlust der<br />
Unterwolle (REICHLER et al. 1999; REICHLER et al. 2001). Im Allgemeinen leiden <strong>die</strong><br />
Tiere nicht unter Juckreiz. Durch eine Sekundärinfektion mit z.B. Staphylokokken kann es<br />
jedoch zu Juckreiz kommen (SCOTT et al. 2001). Sebadenitis ist in vielen Fällen eine<br />
hereditäre Dermatose. Die Vererbung beim Pudel erfolgt nach einem autosomal rezessiven<br />
Muster (SCARFF 1994; DUSTAN und HARGIS 1995). Neben der Genodermatose wird<br />
vermutet, daß auch Streßsituationen <strong>die</strong> Erkrankung auslösen können (REICHLER et al.<br />
2001) ebenso wie <strong>die</strong> Gabe von Glukokortikoiden (REICHLER et al. 2001; SCOTT 1989).
Literaturübersicht 25<br />
2.4.2 Histopathologie<br />
Die Sebadenitis des Hundes ist <strong>durch</strong> eine progressive Atrophie der Talgdrüsen<br />
charakterisiert. Man findet unterschiedliche Grade von epidermaler Hyperplasie und/ oder<br />
orthokeratotischer Hyperkeratose (SCOTT 1993). In der frühen Phase findet man eine<br />
Perifollikulitis im Isthmusbereich. Die Sebozyten sind fast vollständig von Entzündungszellen<br />
<strong>durch</strong>setzt, und man findet an der vermuteten Talgdrüsenlokalisation ein deutliches<br />
perifollikuäres Granulom, welches hauptsächlich aus neutrophilen Granulozyten, Histiozyten,<br />
Lymphozyten und wenigen Plasmazellen besteht. Immunhistochemisch wurden in der akuten<br />
Phase dendritische antigenpräsentierende Zellen (CD 1c+, CD11c+) und T-Zellen (CD3+)<br />
nachgewiesen. Letztere setzen sich aus CD4+ (welche <strong>die</strong> Aktivierung der<br />
antigenpräsentierenden Zellen übernehmen), CD8+ (zytotoxisch) und (CD3+,CD4-,CD8-)<br />
Zellen zusammen. Es wurden nur einige CD3+ und TCR?+-Zellen beobachtet und nur wenig<br />
CD21+-B-Zellen und CD79a+ Plasmazellen. In der nächsten Phase wird <strong>die</strong> Entzündung<br />
intensiver, und es kommt zu einer nodulären granulomatösen Entzündung im Bereich der<br />
Talgdrüse. In der anschließenden Phase ist <strong>die</strong> Talgdrüse zerstört, <strong>die</strong> Entzündungsreaktion<br />
kommt zum Stillstand, und es kommt zu einer perifollikulären Fibrose (DUNSTAN und<br />
HARGIS 1995; RYBNICEK et al. 1998). In der chronischen Phase der Sebadenitis treten<br />
hauptsächlich T-Lymphozyten (CD3+, TCR? ? +) auf, <strong>die</strong> sich in ungefähr gleicher Anzahl<br />
aus CD4+ und CD8+- Zellen zusammensetzen (RYBNICEK et al. 1998). Außerdem sind <strong>die</strong><br />
chronischen Veränderungen häufig <strong>durch</strong> eine hyperplastische, oberflächliche, perivaskuläre<br />
Dermatitis mit starken ortho- bis parakeratotischen Hyperkeratosen der Epidermis und des<br />
Haarfollikels und unterschiedlichen Graden von perifollikulärer Fibrose und follikulärer<br />
Atrophie (besonders beim Pudel und Akita) gekennzeichnet (SCOTT 1993; GROSS et al.<br />
1997).<br />
Es gibt keine signifikante Beziehung zwischen der Dauer der Erkrankung und dem Grad der<br />
Sebadenitis, obwohl es scheint, als ob Hunde mit zerstörten Talgdrüsen schon länger erkrankt<br />
sind, als Hunde mit nur einer glandulären Entzündung (REICHLER et al. 2001). Schwierig<br />
ist, <strong>die</strong> zweite von der letzten Phase klar voneinander zu trennen, denn REICHLER et al.<br />
(2001) berichten auch von Tieren, bei denen seit Monaten schon alle Talgdrüsen zerstört<br />
waren und noch immer deutliche Entzündungreaktionen erkennbar waren. Auch das
Literaturübersicht 26<br />
Voranschreiten der Erkrankung ist individuell verschieden. So kann <strong>die</strong> Zerstörung aller<br />
Talgdrüsen schon nach 2 Monaten erreicht sein oder über Jahre hinweg ein eher schleichender<br />
Prozess werden (REICHLER et al. 2001; RYBNICEK et al. 1998). Ausgehend von der<br />
Hypothese, daß in der Wulstregion des Haarfollikels <strong>die</strong> Stammzellen sowohl für <strong>die</strong><br />
Talgdrüse als auch für den Haarfollikel liegen, ist es denkbar, daß Entzündungen in <strong>die</strong>ser<br />
Region zu Verlust der Stammzellen führen und damit eine Regeneration unmöglich machen<br />
(LAVKER et al. 1993). Allerdings beschreiben REICHLER et al. (2001) den Fall eines<br />
Tieres, bei dem sich Talgdrüsen wieder regeneriert haben sollen. Die Mechanismen der<br />
Talgdrüsenzerstörung sind multikausal. Es wird vermutet, daß Lymphozyten <strong>die</strong><br />
proliferierenden Basalzellen der Talgdrüse attackieren, ähnlich wie bei der Graft versus Host-<br />
Erkrankung (STENN und SUNDBERG 1999).
Literaturübersicht 27<br />
2.4.3 Pathogenese<br />
Bislang ist <strong>die</strong> Pathogenese der caninen Sebadenitis noch unbekannt. Es werden folgende<br />
Theorien beschrieben:<br />
Die Zerstörung der Talgdrüsen wird möglicherweise verursacht <strong>durch</strong> eine immunvermittelte<br />
Entzündung eines <strong>Dr</strong>üsenbestandteils oder eine Entzündung als Folge eines<br />
Keratinisierungsdefekts mit Verlegung des Ausführungsganges der Talgdrüse (HARGIS<br />
1991). Aufgrund des gehäuften Vorkommens bei bestimmten Rassen (Pudel und Akita Inu)<br />
und bestimmten Zuchtlinien wird eine Genodermatose vermutet (SCOTT 1993),<br />
wahrscheinlich autosomal rezessiv vererbt (SCARFF 2000.) Auch eine Störung im<br />
Lipidstoffwechsel kommt in Betracht, welche <strong>die</strong> Sebumproduktion und <strong>die</strong> Keratinisierung<br />
beeinflusst (DUNSTAN und HARGIS 1995; ROSSER 1992; SCOTT et al. 1995).<br />
Neueste Untersuchungen favorisieren aufgrund einer deutlichen T-Zell-Aktivierung bei<br />
gleichzeitiger Abwesenheit von zirkulierenden Antikörpern eine immunvermittelte<br />
Pathogenese (RYBNICEK 1999).<br />
2.4.4 Therapiemöglichkeiten der Sebadenitis<br />
2.4.4.1 Topische Behandlung mit Antiseborrhoika / keratolytischen Shampoos<br />
Verschiedene Antiseborrhoika werden in keratolytischen Shampoos zur topischen<br />
Behandlung der Sebadenitis eingesetzt:<br />
Selendisulfid verringert bei lokaler Anwendung eine gesteigerte epidermale Zellproliferation.<br />
Es hemmt Sulfhydrylgruppen-enthaltende Enzyme und wirkt zudem antimykotisch und<br />
antiseptisch. Als Nebenwirkung kommt es nicht selten zu Hautirritationen (UNGEMACH und<br />
KIETZMANN 1997). Außerdem erhöht Selendisulfid signifikant <strong>die</strong> Größe der Talgdrüsen<br />
beim Hamster (GLOOR et al. 1980).<br />
Der therapeutische Effekt von Benzoylperoxid beruht auf seiner antiseptischen,<br />
sebosuppressiven und <strong>die</strong> Keratinozytenproliferation hemmenden Wirkung. Benzoylperoxid<br />
wird bereits in der Haut vollständig zu Benzoesäure metabolisiert. Die Behandlung der
Literaturübersicht 28<br />
Seborrhoe und als Begleittherapie <strong>die</strong> topische Anwendung bei der Pyodermie stellen<br />
Anwendungsgebiete von Benzoylperoxid beim Hund dar. Hier findet in der Regel ein<br />
Shampoo mit 2,5% Benzoylperoxid (Peroxyderm,V.M.) Anwendung. In Einzellfällen sind<br />
hautirritierende Wirkungen beschrieben worden (UNGEMACH und KIETZMANN 1997).<br />
Propylenglycol ist ein mehrwertiger Alkohol, der eine penetrationsverbessernde Wirkung hat,<br />
welche auf seine Lipidlöslichkeit und Mischbarkeit mit Wasser zurückzuführen ist. Die<br />
penetrationsverbessernde Wirkung nimmt im Allgemeinen mit zunehmender Konzentration<br />
bis zu einem Grenzbereich zu, wo dem Gewebe noch kein Wasser entzogen wird. Bei den<br />
zweiwertigen Alkoholen (1,2- Propylenglykol) liegt das Optimum zwischen 8 und 20%. In<br />
<strong>die</strong>sen Konzentrationen entfalten <strong>die</strong>se Alkohole ihre maximal mögliche antimykotische<br />
Wirkung (HEINZE 1996). Die guten bakteriziden Eigenschaften in Kombinationen mit<br />
Benzoesäureestern, erhöhen deren antiseptische Wirkung.<br />
Die Therapieerfolge topischer Behandlungen bei der Sebadenitis des Hundes sind jedoch<br />
begrenzt. Durch den Einsatz von keratolytischen Shampoos und weichmachenden Ölen oder<br />
Propylenglycol kann <strong>die</strong> Hyperkeratose zum Teil verbessert werden. Es ist jedoch nicht<br />
möglich, <strong>die</strong> Erkrankung mit solchen Mitteln erfolgreich zu kontrollieren (ROSSER 2000;<br />
SCOTT 1993).<br />
2.4.4.2 Systemische Behandlung<br />
2.4.4.2.1 Freie Fettsäuren/Fischöl<br />
Der Grundgedanke <strong>die</strong>ser Behandlung liegt in der Tatsache, daß ein Mangel an essentiellen<br />
Fettsäuren zu charakteristischen Veränderungen der Haut führt. Beim Hund sind <strong>die</strong>s eine<br />
trockene, schuppende Haut, glanzloses Fell, Alopezie, Puritus, Otitiden und schließlich<br />
Infektionen und Seborrhoe. Bei verschiedenen Hauterkrankungen wurde eine veränderte<br />
Zusammensetzung der epidermalen Lipide festgestellt. Die in den Ölen enthaltenen<br />
ungesättigten Fettsäuren sollen <strong>durch</strong> eine Beeinflussung der Prostaglandin- und
Literaturübersicht 29<br />
Leukotriensynthese eine Heilung der Erkrankung herbeiführen. Das verwendete Fischöl<br />
enthält <strong>die</strong> n-3-Fettsäure Eikosaptensäure und Docosahexaensäure. Infolge ihrer Anwendung<br />
entstehen Prostaglandine und Leukotriene mit weniger proinflammatorisch aktiven<br />
Metaboliten, wo<strong>durch</strong> <strong>die</strong> entzündungshemmende Wirkung erklärt wird (KIETZMANN<br />
1996).<br />
Die im Schrifttum für <strong>die</strong>se Öle, <strong>die</strong> oft in Kombination eingesetzt werden, erwähnten<br />
Behandlungserfolge variieren in weitem Umfang. MARSHALL und WILLIAMS (1990)<br />
berichten von einem Hund mit Sebadenitis, der sich <strong>durch</strong> <strong>die</strong> Nahrungsergänzung mit<br />
Fischöl klinisch besserte. Nach einem Monat war Haarwachstum am Rücken festzustellen,<br />
und <strong>die</strong> Haut war weich und elastisch mit einigen wenigen schuppenden Bereichen.<br />
Bakterielle sekundäre Infektionen kehrten nicht wieder, trotz ausbleibender antibiotischer<br />
Prophylaxe. Auch REICHLER et al. (1999) und SCARFF (1994) beschreiben, daß <strong>durch</strong> eine<br />
Verabreichung von Fischöl (Eikosaptensäure 2-10 mg/kg per os) <strong>die</strong> Schübe der Sebadenitis<br />
gemildert werden konnten. Mit dem Absetzen des Öls kommt es aber zu einer sofortigen<br />
erneuten Verschlechterung des Zustandes.<br />
2.4.4.2.2 Glukokortikoide<br />
Glukokortikoide haben sowohl einen antiinflammatorischen als auch einen<br />
immunsuppressiven Effekt. Sie schützen <strong>die</strong> Integrität der Zell- und Plasmamembranen und<br />
stabilisieren <strong>die</strong> Lysosomenmembranen. Da<strong>durch</strong> wird eine Freisetzung lysosomaler Enzyme<br />
verhindert. Sie vermindern <strong>die</strong> Synthese von Prostaglandinen, Leukotrienen und<br />
Thromboxanen. Weiterhin wird da<strong>durch</strong> <strong>die</strong> Migration von Leukozyten und Mastzellen in das<br />
Gewebe verringert. Die immunsuppressive Wirkung beruht auf Einflüssen der<br />
Glukokortikoide auf alle Sta<strong>die</strong>n der Immunantwort. In erster Linie ist es ein hemmender<br />
Effekt auf <strong>die</strong> Makrophagen und Lymphozyten (OETTEL 1996). Eine Dosierung mit<br />
Prednisolon von 1,1 bis 2,2 mg/kg/Tag scheint bei manchen Hunden mit Sebadenitis<br />
(kurzhaarige Rassen) erfolgreich zu sein (GUAGUÈRE et al. 1990). In anderen Fällen waren<br />
Glukokortikoide jedoch nicht effektiv (SCOTT 1986, CAROTHERS et al. 1991; STEWART<br />
et al. 1991), und auch REICHLER et al. (1999) berichten von keiner oder nur einer
Literaturübersicht 30<br />
kurzfristigen Verbesserung des Hautbildes nach Gabe von Prednisolon (2mg/kg/Tag). Dies<br />
hängt vermutlich mit der proliferationshemmenden Wirkung auf <strong>die</strong> Kollagensythese und das<br />
Haarwachstum zusammen, denn Glukokortikoide induzieren <strong>die</strong> zyklische Regression<br />
(Katagen) von Haarfollikeln und arretieren <strong>die</strong>se in der Ruhephase (Telogen) (PAUS et al.<br />
1993).<br />
2.4.4.2.3 Retinoide<br />
Der Anwendung von Retinoiden liegen Keratinisierungsstörungen als Pathogenese der<br />
Sebadenitis zu Grunde. Wenn man ursächlich annimmt, daß eine Hyperkeratose zu einer<br />
Verstopfung der Ausführungsgänge und der hier nachfolgenden Entzündung gegen <strong>die</strong><br />
Adnexe führt, so versucht man mit einem Vitamin A-Derivat, <strong>die</strong> Hyperkeratose zu mildern<br />
oder zu stoppen. In der Vergangenheit fanden zahlreiche Versuche statt,<br />
Keratinisierungsstörungen mit Retinol zu behandeln. Die zur Erzielung therapeutischer<br />
Wirkungen zu verabreichende Vitamin A-Dosis war jedoch so hoch, daß eine<br />
Hypervitaminose herbeigeführt wurde (KIETZMANN 1996). Synthetische Retinoide sind<br />
entwickelt worden hinsichtlich der Verstärkung ihrer proliferationsfördernden Effekte, ohne<br />
<strong>die</strong> toxischen Effekte ihrer Vorläufer (SCOTT et al. 2001). Vitamin A-Verbindungen haben<br />
eine wichtige Wirkung auf <strong>die</strong> Keratinozytenproliferation und -differenzierung. In der<br />
Veterinärdermatologie werden vorwiegend orale Retinoide, nämlich Tretinoin, Isotretinoin<br />
und Etretinat eingesetzt. Es ist allerdings auf das hohe teratogene Wirkungspotential der<br />
Vitamin-A-Derivate hinzuweisen, welche daher nur bei äußerst strenger Indikationsstellung<br />
zum klinischen Einsatz kommen dürfen (KWOCHKA 1989; KIETZMANN 1996).<br />
Generell sollen Retinoide <strong>die</strong> humorale und zelluläre Immunität stimulieren, aber je nach<br />
Retinoid und der Dosierung sind auch Inhibitionen beobachtet worden. Laut KWOCHKA<br />
und RADEMAKERS (1989) ist Isotretinoin der effektivste Unterdrücker der<br />
Sebumproduktion.<br />
Bei der Sebadenitis des Hundes sind unter der Therapie mit Retinoiden vereinzelt klinische<br />
Erfolge beschrieben worden. Nach dem Absetzen der Medikamente verschlechter sich das<br />
Krankheitsbild erneut (WHITE et al. 1995).
Literaturübersicht 31<br />
Isotretinoin (1-2 mg/kg/Tag per os) wird als sehr effektiv bei der Sebadenitis eines Vizslar<br />
beschrieben (STEWART et al. 1991) aber im allgemeinen als ineffektiv oder mit nur<br />
minimaler Wirkung bei anderen Rassen (GUAGUÈRE et al. 1990, CAROTHERS et al.<br />
1991). Keine oder nur eine kurzfristige Verbesserung des Hautbildes ist von REICHLER et<br />
al. (1999) nach Gabe von Isotretinoin (1-2 mg/kg per os) beschrieben worden.<br />
Unterschiedliche Angaben über Erfolge mit Retinoiden liegen auch bei der Anwendung von<br />
an Sebadenitis erkrankten Pudeln vor, wobei bemerkt werden muß, daß selbst nach erneutem<br />
Haarwachstum das Fell der Pudel deutlich rauher war und keine pudeltypischen Haarlocken<br />
mehr aufwies (POWER und IHRKE 1990). Laut POWER und IHRKE (1990) ist Isotretinoin<br />
effektiver als Etretinate. Hier sei zusätzlich angemerkt, daß Etrenitat nicht mehr verwendet<br />
wird. Statt Etretinat (Tigason®) kommt heute Acitretin (Neotigason®) zum Einsatz.
Literaturübersicht 32<br />
2.5 Cyclosporin A<br />
Cyclosporin A gehört zu der Stoffgruppe der Immunsuppressiva. Es führt zu einer<br />
Unterdrückung oder Abschwächung der Immunantwort. Bei Cyclosporin A handelt es sich<br />
um ein zyklisches Undecapeptid, das aus Trichoderma polysporum und anderen Pilzspezies<br />
isoliert wird, inzwischen aber auch synthetisch hergestellt wird.<br />
Ähnlich anderen immunsuppressiven Maßnahmen ist <strong>die</strong> Wirkungen von Cyclosporin A<br />
antigenunabhängig. Entwicklung und Einsatz von Immunsuppressiva gewannen in der<br />
Medizin mit der Erschließung von Möglichkeiten für Organtransplantation und <strong>die</strong> Therapie<br />
von Autoimmunkrankheiten erheblich an Bedeutung. Enge Beziehungen bestehen auch zur<br />
Krebschemotherapie (STREY 1996). Anfängliche Verwendung fand Cyclosporin A in der<br />
Veterinär<strong>med</strong>izin bei renalen Allotransplantationen der Katze (GREGORY und GOURLEY<br />
1992). Weiterhin wurde es erfolgreich bei immunvermittelten Anämien und<br />
Thrombozytopenien beim Hund verwendet (COOK et al. 1994).<br />
Cyclosporin gibt es in zwei Formen: SANDIMMUNE® und NEORAL®. SANDIMMUNE®<br />
ist <strong>die</strong> unveränderte Erstfassung von 1983. Um den Anteil und <strong>die</strong> Geschwindigkeit der<br />
Absorption zu erhöhen, wurde Cyclosporin „verändert“ und 1996 als NEORAL® vorgestellt.<br />
Aufgrund der lipophilen Struktur von SANDIMMUNE® ist <strong>die</strong> Absorption nach oraler<br />
Aufnahme stark unterschiedlich zwischen Individuen derselben Spezies (KOLARS et al.<br />
1991). Mit der Entwicklung von NEORAL® als Präkonzentrat in Form von einer<br />
Mikroemulsion führt <strong>die</strong> bessere intestinale Absorption von Cyclosporin A zu einer deutlich<br />
erhöhten Bioverfügbarkeit, und es wird eine geringere Leberbelastung festgestellt<br />
(VON<strong>DER</strong>SCHER und MEINZER 1994).<br />
2.5.1 Wirkmechanismus von Cyclosporin A<br />
Cyclosporin A entfaltet seine pharmakologische Wirkung <strong>durch</strong> Bindung an eine Gruppe<br />
intrazellulärer Proteine, <strong>die</strong> sogenannten Immunophiline. Die so gebildeten Komplexe greifen<br />
in <strong>die</strong> für <strong>die</strong> klonale Expression der Lymphozyten wichtigen Signalketten ein. Cyclosporin A<br />
blockiert <strong>die</strong> Proliferation der T-Zellen <strong>durch</strong> eine Verminderung der Expression mehrerer
Literaturübersicht 33<br />
Cytokingene, <strong>die</strong> normalerweise bei der T-Zell-Aktivierung induziert werden. Dazu gehört<br />
IL-2, dessen Synthese <strong>durch</strong> T-Lymphozyten ein wichtiges Wachstumssignal für T-Zellen<br />
darstellt. Obwohl <strong>die</strong> immunsuppressive Wirkung von Cyclosporin A wahrscheinlich<br />
hauptsächlich <strong>die</strong> Proliferation der T- Zellen hemmt, hat es noch eine Reihe anderer Effekte<br />
auf das Immunsystem (Abb. 6) (BOREL 1988; JANEWAY und TRAVERS 1997). Gene, <strong>die</strong><br />
<strong>durch</strong> den Transkriptionsfaktor NF-AT reguliert werden, werden auch bei B-Zellen<br />
(Interleukin 4) und bei dem CD40 Liganden benötigt (HO et al. 1996).<br />
Abb. 6: Immunologische Wirkungen von Cyclosporin A (modifiziert nach JANEWAY und<br />
TRAVERS 1997).<br />
Cyclosporin A inhibiert <strong>die</strong> von Lymphozyten sowie einige der von Granulozyten<br />
hervorgerufenen Effekte.<br />
Cyclosporin A bindet an eine bestimmte Gruppe von Immunophilinen, <strong>die</strong> Cyclophiline. Der<br />
Komplex aus Cyclophilin und Cyclosporin A wiederum bindet an <strong>die</strong> Ca 2+ - aktivierte<br />
Serin/Threonin-Phosphatase Calcineurin und hemmt deren Aktivität. Calcineurin wird<br />
aktiviert, wenn sich der intrazelluläre Ca 2+ -Spiegel infolge der Bindung des T-Zell-Rezeptors<br />
an entsprechende Antigene erhöht. Wenn Calcineurin aktiv ist, dephosphoryliert es <strong>die</strong><br />
zytosolische Komponente des Transkriptionsfaktors NF-AT, NF-Atc, <strong>die</strong> daraufhin in den<br />
Zellkern "wandert" und <strong>die</strong> Transkription des IL-2-Gens induziert (BOREL 1988; HESS et al.<br />
1988; JANEWAY und TRAVERS 1997) (Abb. 7).
Literaturübersicht 34<br />
Abb. 7: Darstellung der Signalübertragung zur Aktivierung des Transkriptionsfaktors NF-AT<br />
g (links) und dessen Blockade <strong>durch</strong> Cyclosporin A (rechts) (modifiziert nach JANEWAY<br />
und TRAVERS 1997).
Literaturübersicht 35<br />
Cyclosporin A hemmt <strong>die</strong> T-Zell-Aktivierung, indem es <strong>die</strong> Aktivität der Serin/Threoninspezifischen<br />
Phosphatase hemmt. Neben der immunsuppressiven Wirkung hat Cyclosporin A<br />
auch einen Effekt auf <strong>die</strong> Proliferation von Keratinozyten. FURUE et al. (1988) zeigten, daß<br />
Cyclosporin A <strong>die</strong> DNA-Synthese und Proliferation von Keratinozyten unterdrückt. Die<br />
Unterdrückung der DNA-Synthese und Zellproliferation der Keratinozyten ist abhängig von<br />
der Cyclosporin A-Dosis und Dauer der Anwendung. Außerdem induziert Cyclosporin A das<br />
Haarwachstum. Eine häufige Nebenwirkung von Cyclosporin A-Anwendungen ist <strong>die</strong><br />
Hypertrichose. Es ist bekannt, daß immunsuppressive Immunophilin-Liganden wie<br />
Cyclosporin A potente Haarwachstumsmodulatoren sind, welche aktiv das Haarwachstum<br />
(Anagen) induzieren und <strong>die</strong> Haarfollikelregression (Katagen) unterdrücken (PAUS et al.<br />
1989; MAURER et al. 1997; PAUS et al. 1997). Dieser Effekt wurde 2003 <strong>durch</strong> GAFTER-<br />
GVILI et al. an einer Stu<strong>die</strong> mit Nacktmäusen näher untersucht, und erstmals konnte gezeigt<br />
werden, daß Calcineurin und der Transkriptionsfaktor NF-AT <strong>die</strong><br />
Haarkeratinozytendifferenzierung beeinflussen.<br />
2.5.2 Nebenwirkungen von Cyclosporin A<br />
Die möglichen Nebenwirkungen einer Cyclosporin A-Therapie sind gut bekannt. Erstens<br />
betrifft es - genau wie alle zytotoxischen Substanzen - gleichermaßen alle Immunreaktionen;<br />
nur <strong>durch</strong> <strong>die</strong> Dosierung läßt sich <strong>die</strong> immunsuppressive Wirkung kontrollieren. Zweitens<br />
kommen Immunophiline auch in vielen anderen Zelltypen vor. Deshalb ist zu erwarten, daß<br />
Cyclosporin A auch andere Gewebe als nur Immunzellen beeinflußt (JANEWAY und<br />
TRAVERS 1997). Bezogen auf seine immunsuppressive Potenz hat Cyclosporin A jedoch<br />
eine geringe Zelltoxizität (SCOTT et al. 2001). Mögliche Nebenwirkungen bei einer<br />
Cyclosporin A-Behandlung sind Vomitus, Diarrhoe, Bakterurie, bakterielle Hautinfektionen,<br />
Anorexie, Hirsutismus (Hypertrichose), Nephropathie, gingivale Hypertrophie,<br />
Knochenmarkssuppression und lymphoplasmazelluläre Dermatitis (MIHATSCH und WOLFF<br />
1992). Die Wirkungen können mit einer Verringerung der Dosis abgeschwächt werden. Die<br />
erreichten Blutkonzentrationen nach einer spezifischen Dosis variieren von Patient zu Patient.<br />
Die Abweichungen ergeben sich aus der unterschiedlichen Absorption, Verteilung und dem
Literaturübersicht 36<br />
Metabolismus. Nach Besserung des klinischen Bildes kann eine Verringerung der Dosis oder<br />
eine Applikation alle 48 h probiert werden (WHITE 1986; SCOTT et al. 2001).<br />
In human<strong>med</strong>izinischen Langzeitstu<strong>die</strong>n an Psoriasispatienten stellte man fest, daß<br />
Cyclosporin A keine akzeptable Langzeitmonotherapie ist, da mit dem Alter der Patienten<br />
und der Dauer der Medikamentation Bluthochdruck und erhöhte Creatinin-Werte das Risiko<br />
von Cyclosporin-induzierten toxischen Effekten erhöhen (GROSSMANN et al. 1996;<br />
ZACHARIAE 1996). Das Fazit ist, daß das Risiko einer ernsthaften Schädigung sich deutlich<br />
bei einer Langzeitgabe erhöht.<br />
In subakuten und chronischen toxikologischen Stu<strong>die</strong>n (bis zu einem Jahr), sind einige<br />
Nebenwirkungen an Hunden bei einer Dosis von 5mg/kg/Tag aufgefallen. Es konnten<br />
geringgradige klinische und pathohistologische Beweise für renale, hepatische und<br />
hämatologische Veränderungen gezeigt werden (RYFFEL 1982). Allerdings besteht bei<br />
Hunden eine geringere Häufigkeit von Nephrotoxizität als beim Menschen. Unterstützt wird<br />
<strong>die</strong>se Aussage <strong>durch</strong> <strong>die</strong> Befunde einer Stu<strong>die</strong>, in der vier Hunde über zwölf Monate mit<br />
45 mg/kg/Tag Cyclosporin A behandelt wurden, wobei keine Veränderungen in der<br />
Nierenfunktion nachgewiesen wurden (AICHER et al. 1998).<br />
Die intravenöse Verabreichung von Cyclosporin A führt zur häufigen anaphylaktischen<br />
Reaktion bei Hunden, vermutlich <strong>durch</strong> den Lösungsvermittler (polyoxyethylated castor oil)<br />
ausgelöst (WHITE 1986).<br />
2.5.3 Anwendungsgebiete und Dosierungen von Cyclosporin A<br />
Cyclosporin A wird für eine große Menge unterschiedlicher dermatologischer und<br />
immunvermittelter Erkrankungen in der Human- und Veterinär<strong>med</strong>izin verwendet<br />
(SHUSTER 1988). Entwickelt und auch weiterhin genutzt wird es zur Behandlung der<br />
Immunsuppression nach Organtransplantationen in der Human- wie auch Veterinär<strong>med</strong>izin.<br />
Weiterhin wird es zur Unterdrückung der Überempfindlichkeitsreaktionen Typ IV und zur<br />
Behandlung der Psoriasis verwendet, ebenso wie bei immunvermittelter Myasthenia gravis<br />
und Thyreoiditis, Neuritis, Uveitis und Arthritis (HESS 1993; SCOTT et al. 2001). In der<br />
<strong>vet</strong>erinär<strong>med</strong>izinischen Dermatologie wird Cyclosporin A bei folgenden Erkrankungen<br />
eingesetzt:
Literaturübersicht 37<br />
Atopische Dermatitis:<br />
Sowohl in der Human<strong>med</strong>izin (2,5-6 mg/kg/d) (NAEYAERT et al. 1998) als auch in der<br />
Veterinär<strong>med</strong>izin erzielt man hier mit einer Cyclosporin A-Behandlung gute Erfolge. Mit<br />
einer Dosierung von 3mg/kg/d kommt es zu einer signifikanten Verbesserung des klinischen<br />
Bildes (FONTAINE und OLIVRY 2001).<br />
Kutaner Lupus erythematodes:<br />
ROSENKRANTZ et al. (1989) berichtet von einer erfolgreichen Behandlung eines<br />
Deutschen Schäferhundes mit 30mg/kg/d Cyclosporin A.<br />
Eosinophiles Granulom-Komplex:<br />
In einer Stu<strong>die</strong> wurden Katzen mit 25 mg Cyclosporin A pro Tag behandelt (GUAGUÈRE<br />
und PRELAUD 2000). Nur bei einem Viertel der Tiere führte <strong>die</strong> Cyclosporin A- Anwendung<br />
zu einem langfristigen Erfolg.<br />
Pemphigus erythematodes:<br />
Es wird von einer Katze mit guten Erfolgen <strong>durch</strong> eine alleinige Cyclosporin A-Therapie<br />
(15mg/kg/d) berichtet (ROSENKRANTZ et al. 1989). Allerdings wird von anderer Seite<br />
vermutet, daß Cyclosporin A alleine nur selten effektiv in der Behandlung sein wird (SCOTT<br />
et al. 2001).<br />
Pemphigus foliaceus:<br />
Auch bei <strong>die</strong>ser Erkrankung sind bisher nur Einzelfälle mit leidlich guten Ergebnissen und<br />
hohen Dosen (25mg/kg/) beschrieben worden (ROSENKRANTZ et al. 1989).<br />
Perianalfistel:<br />
Bei der Behandlung der Perianalfistel des Hundes werden Dosierungen zwischen 5- 10 mg/kg<br />
alle 12 h über 3 Monate empfohlen. Dieses Behandlungsschema läßt einen guten Erfolg<br />
erkennen (MATHEWS et al. 1997; GRIFFITHS et al. 1999). Durch <strong>die</strong> Gabe von<br />
Ketokonazol kann <strong>die</strong> Dosis verringert werden (MOUATT 2002).
Literaturübersicht 38<br />
Sterile noduläre Panniculitis:<br />
GUAGUÈRE (2000) berichtete von der Behandlung zweier Hunde mit 5mg/kg/d über fünf<br />
Wochen, anschliessend ließ man <strong>die</strong> Behandlung langsam ausschleichen. Schon nach circa<br />
zwei Wochen kam es zu einem fast vollständigen Verschwinden der Symptome, nach<br />
weiteren vier Wochen erschienen <strong>die</strong> Veränderungen ausgeheilt.<br />
2.5.4 Pharmakokinetik<br />
Tiere und Menschen, welche mit Cyclosporin A behandelt werden, weisen eine hohe<br />
Variabilität der Bioverfügbarkeit nach oraler Applikation auf, mit Werten zwischen 10-90%<br />
(VADEN 1989). Cyclosporin A ist sehr schnell (nach 1,4 – 3 h) bioverfügbar (ROBSON und<br />
BURTON 2003) und hat eine relativ lange Halbwertszeit (9,4 h) (STEFFAN et al. 2001). Um<br />
einen stabilen Spiegel von Cyclosporin A im Blut zu erreichen, dauert es 17 Tage<br />
(DAHLINGER et al. 1998). Cyclosporin A weist eine hohe Serumbindung auf und unterliegt<br />
der oxidativen Biotransformation (STREY 1996). Bei Ratten und Menschen werden 80-85%<br />
der verabreichten Dosis <strong>durch</strong> <strong>die</strong> Galle eliminiert. Dieser Wert liegt bei Hunden bei 99%, so<br />
daß <strong>die</strong> renale Elimination bei <strong>die</strong>ser Spezies unwesentlich ist (VADEN 1989). Cyclosporin A<br />
wird mit Hilfe von Cytochrom P-450-Enzymen in der Leber metabolisiert. Folglich kann man<br />
<strong>die</strong> Metabolisierung <strong>durch</strong> eine Kombination mit einem P-450 unterdrückenden Medikament<br />
abschwächen. Ketokonazol, ein Antimykotikum, unterdrückt <strong>die</strong> P-450-abhängige<br />
Metabolisierung und zeigt, daß <strong>die</strong> Cyclosporin A-Dosis bei der Behandlung von<br />
Autoimmunerkrankungen beim Hund deutlich gesenkt werden kann (DAHLINGER et al.<br />
1998). Auch hinsichtlich der Kosten in der Veterinär<strong>med</strong>izin ist <strong>die</strong>ses Verfahren zu<br />
bedenken.
Literaturübersicht 39<br />
2.6. Einsatz von Cyclosporin A bei der idiopathischen Sebadenitis des<br />
Hundes<br />
In den letzten Jahren mehren sich <strong>die</strong> Berichte von einzelnen an Sebadenitis erkrankten<br />
Hunden, <strong>die</strong> mit gutem Erfolg mit Cyclosporin A behandelt wurden. Hierbei handelt es sich<br />
jedoch um Einzelfälle, <strong>die</strong> keiner systematischen Untersuchung unterzogen wurden.<br />
CAROTHERS et al. (1991) berichten von einem zwei Jahre alten Pinscher mit einer<br />
Sebadenitis, welcher anfänglich mit Isotretinoin (2 mg/kg/d) behandelt worden war. Da nach<br />
dreiwöchiger Therapie keine Verbesserung festgestellt werden konnte, wurde er mit<br />
Cefadroxil (22mg/kg/12h) und Prednisolon und topischer Anwendung von Shampoos<br />
behandelt. Da sich nach weiteren drei Wochen der Allgemeinzustand des Tieres<br />
verschlechterte, wurde erneut das Behandlungsschema geändert, und man entschied sich für<br />
eine Cyclosporin A-Verabreichung (5 mg/kg/12h). Nach drei Wochen wurde das erste<br />
Haarwachstum festgestellt. Histologisch waren anagene Haarfollikel nachzuweisen. Nach<br />
weiteren acht Wochen erzielte man sowohl klinisch als auch histologisch gute Ergebnisse.<br />
Das Tier wies unter zwölfmonatiger Therapie keine Nebenwirkungen auf.<br />
2.6.1 Ziel eigener Untersuchungen<br />
Um das Potential einer Cyclosporin A-Behandlung bei der Sebadenitis des Hundes genauer zu<br />
untersuchen, wurde eine Stu<strong>die</strong> an zwölf Patienten <strong>durch</strong>geführt. Diese wurden über zwölf<br />
Monate mit Cyclosporin A (5mg/kg/d) behandelt. Der Erkrankungsstatus wurde klinisch,<br />
histologisch und immunhistologisch mittels semiquantitativer Verfahren erfaßt und im<br />
Verlauf der Therapie regelmäßig dokumentiert.
Material und Methoden 40<br />
3. Eigene Untersuchungen<br />
3.1 Material und Methoden<br />
3.1.1 Versuchsanordnung<br />
Für <strong>die</strong> Untersuchungen wurden aus verschiedenen Kleintierpraxen 12 Hunde mit einer<br />
idiopathischen Sebadenitis herangezogen. Diese Tiere wurden in einem kontrollierten<br />
Therapieversuch über 12 Monate mit 5mg/kg/Tag NEORAL? (Cyclosporin A) oral<br />
behandelt. Das Patientenmaterial wurde nach der histologisch verifizierten Diagnose<br />
„idiopathische Sebadenitis“ ausgewählt. Zum Zeitpunkt des Behandlungsbeginns sollten<br />
möglichst akute Entzündungsprozesse nachweisbar sein. Sekundärerkrankungen mußten<br />
ausgeschlossen sein, und Hündinnen durften während der Behandlung weder gedeckt werden<br />
noch säugen.<br />
Die Patienten wurden zum Untersuchungsbeginn nach den Verfahren der allgemeinen<br />
<strong>vet</strong>erinärdermatologischen Diagnostik untersucht. Dies beinhaltete immer eine<br />
Allgemeinuntersuchung. Das Ausmaß der Haut- und Haarveränderungen wurde mittels<br />
Fotodokumentation und mittels eines klinischen Bewertungssystems (Abb. 8) festgehalten.<br />
Desweiteren wurden Nierenfunktionsparameter (Harnstoff und Kreatinin) blutchemisch<br />
untersucht.<br />
Zum selben Zeitpunkt wurden an mehreren Lokalisationen der veränderten Haut<br />
Stanzbiopsien entnommen. Diese wurden umgehend in einer 4%igen, neutralgepufferten<br />
Formalinlösung fixiert und versandt. Die <strong>durch</strong>schnittliche Dauer der Formalinfixierung<br />
betrug 48 Stunden. Es waren aufgrund logistischer Gegebenheiten auch kürzere und deutlich<br />
längere Fixierungszeiten möglich. Die Hautbioptate wurden alle <strong>durch</strong> <strong>Dr</strong>. Lars Mecklenburg<br />
(Hamburg), <strong>Dr</strong>. Monika Linek (Hamburg)und Christina Boss beurteilt. Im Verlaufe der<br />
Untersuchung wurden alle drei bis vier Monate ausführliche klinisch- dermatologische<br />
Kontrolluntersuchungen <strong>durch</strong>geführt. Der klinisch-dermatologische Status wurde erneut<br />
nach dem Bewertungssystem ermittelt und fotografisch dokumentiert. Ferner wurden aus den<br />
früheren Regionen erneut Hautbioptate entnommen. Diese wurden histologisch und<br />
immunhistologisch untersucht, um das Ausmaß der Entzündungsprozesse, deren Charakter
Material und Methoden 41<br />
und den Entwicklungsstatus der Talgdrüsen festzustellen. Bei neun der zwölf untersuchten<br />
Hunde sind Informationen über <strong>die</strong> zwölfmonatige Therapie hinaus verfügbar.<br />
Bei drei Tieren wurde nach zwölfmonatiger Therapie das Medikament abgesetzt, und es<br />
wurden nach weiteren vier Monaten erneut Untersuchungen <strong>durch</strong>geführt, <strong>die</strong> den klinischen<br />
und histomorphologischen Status der Haut bestimmen sollten. Bei weiteren sechs Tieren<br />
wurde <strong>die</strong> Therapie fortgesetzt und es wurden erneute klinische Untersuchungen oder<br />
Informationen über den klinischen Zustand <strong>durch</strong> den Tierbesitzer eingeholt.<br />
3.1.2 Bewertungssystem zur Erfassung des klinisch-dermatologischen Status<br />
Der klinische Krankheitsstatus wurde ermittelt, indem an insgesamt 17 verschiedenen<br />
Körperregionen <strong>die</strong> Parameter "follikuläre Hyperkeratose", "Alopezie/Haarbruch" und<br />
"Follikulitis/Furunkulose" beurteilt wurden. Jede Beurteilung wurde mit einer Bewertung von<br />
null bis drei versehen. Die Werte aller Regionen wurden schließlich zu einem Gesamtwert<br />
ad<strong>die</strong>rt, der den Erkrankungsstatus des Patienten wiedergab.<br />
Als follikuläre Hyperkeratose und „follikulären Cast“ bezeichnet man eine Anhäufung von<br />
Keratin und follikulärem Material auf der Haut und am Haarschaft (Abb. 10). Die Alopezie<br />
bezeichnet einen partiellen oder vollständigen Haarverlust (MÜLLER, 2004). Unter einer<br />
Follikulitis versteht man eine Infektion der Haarfollikel mit perifollikulärer Entzündung. Bei<br />
einer Furunkulose kommt es zur Ruptur des infizierten Haarfollikels mit nachfolgender<br />
Infektion des umliegenden Gewebes (BIGLER, 2001). Beide Veränderungen stellen sich als<br />
Pusteln dar.
Material und Methoden 42<br />
0= kein Befund 1= mild 2= moderat 3= extrem<br />
Follikuläre<br />
Hyperkeratose<br />
(„Follicular<br />
Alopezie/<br />
Follikulitis oder<br />
Körperregion<br />
cast“)<br />
Haarbruch<br />
Furunkulose<br />
Total Score<br />
Kopf<br />
Rechtes Ohr<br />
Linkes Ohr<br />
Nacken<br />
Hals<br />
Brust<br />
Abdomen<br />
Rücken kranial<br />
Rücken kaudal<br />
Linke Flanke<br />
Rechte Flanke<br />
Schwanz<br />
Perineum<br />
Rechte<br />
Vordergliedmaße<br />
Linke<br />
Vordergliedmaße<br />
Rechte<br />
Hintergliedmaße<br />
Linke<br />
Hintergliedmaße<br />
Abb. 8: Klinisches Bewertungssystem zur Ermittlung des klinischen Krankheitsstatus,<br />
welches im Verlauf der Stu<strong>die</strong> an allen Patienten angewendet worden ist.
Material und Methoden 43<br />
Da es in der Ausprägung des klinischen Bildes große individuelle Unterschiede gab, wurde<br />
der Gesamtwert zu Beginn der Stu<strong>die</strong> bei jedem Patienten als 100% bezeichnet. Alle später<br />
erhobenen Werte errechnen sich daraufhin ebenfalls prozentual in Bezug auf den<br />
Ausgangswert, um eine quantifizierende Aussage innerhalb der einzelnen Patienten treffen zu<br />
können.<br />
3.1.3 Anfertigung von Gewebeschnitten<br />
Die 6mm- oder 8mm- Stanzbiopsien wurden in 4% gepuffertem Formalin fixiert, in der Mitte<br />
halbiert und routinemäßig in Paraffin eingebettet. Von den Paraffinblöcken wurden<br />
5 ?m - dicke Schnitte hergestellt, auf Objektträger aufgezogen, entparaffiniert und gefärbt.<br />
3.1.4 Färbung der Gewebsschnitte<br />
3.1.4.1 Hämalaun-Eosin-Färbung (H.E.-Färbung)<br />
Die Hämalaun-Eosin-Färbung wurde nach folgendem Verfahren <strong>durch</strong>geführt:<br />
1. Entparaffinierung<br />
2. Aqua dest.: 2 min.<br />
3. Hämalaun nach Mayer: 15 min.<br />
4. Wässern in Leitungswasser: 10 min.<br />
5. Eosin: 2 min.<br />
6. Aqua dest.: 1 min.<br />
7. Dehydrierung und Einschließen der Präparate
Material und Methoden 44<br />
3.1.4.2 Immunhistochemische Darstellung von Makrophagen<br />
Nach Entparaffinierung und Hemmung der endogenen Peroxidase mit 0,5 % H 2 O 2 in<br />
Methanol wurden <strong>die</strong> Gewebeschnitte einer Hitzedemaskierung unterzogen. Hierzu wurden<br />
<strong>die</strong> Präparate für 20 min. in eine Demaskierungslösung (bioLogo, Kronshagen, Deutschland,<br />
Best. DE 007) bei 96°C in einem Wasserbad verbracht. Nach der Hitzebehandlung kühlten<br />
<strong>die</strong> Schnitte für weitere 10 min. in der Demaskierungslösung ab. Die Gewebeschnitte wurden<br />
nach dem Spülen mit PBS in Feuchte Kammern (Coverplates, Fa. Shandon Sequenza,<br />
Frankfurt, Deutschland) eingesetzt und mit je 100 ? l inaktiviertem Ziegen- Normalserum in<br />
PBS in einer Verdünnung von 1:5 für 20 min. bestückt. Es folgte <strong>die</strong> Inkubation des primären<br />
Antikörpers gegen Makrophagen (monoklonaler Antikörper aus der Maus, Klon MAC 387 ,<br />
DAKO, Hamburg, Deutschland, Code-Nr.: M 0747) in einer Verdünnung von 1: 200. Die<br />
Inkubation erfolgte über Nacht bei 4°C. Als sekundärer Antikörper <strong>die</strong>nte ein biotinylierter<br />
Antikörper aus der Ziege, der gegen das Mäuse- IgG gerichtet ist (Fa. Vector, Burlingame,<br />
USA, Best. Nr.: BA-9200). Dieser wurde mit 1:200 in PBS mit 10% Hundenormalserum<br />
verdünnt und 30 min. auf den Gewebeschnitten belassen. Zur Detektion wurde <strong>die</strong> ABC-<br />
Methode (siehe Anhang) verwendet. Als Chromogen <strong>die</strong>nte 3,3´-Diaminobenzidin-<br />
Tetrahydrochlorid (DAB, siehe Anhang). Die gefärbten Gewebeschnitte wurden dehydriert<br />
und eingeschlossen.<br />
3.1.4.3 Immunhistochemische Darstellung von CD3-Antigen der T-Lymphozyten<br />
Die Methodik zur Darstellung der CD3-Antigene der T- Lymphozyten gleicht weitestgehend<br />
der zuvor für <strong>die</strong> Makrophagen beschriebenen. Als primärer Antikörper wurde in einer<br />
Verdünnung von 1:50 ein monoklonaler Antikörper aus der Ratte eingesetzt, der gegen ein<br />
rekombinantes humanes CD3- Protein (Kaninchen anti CD3 Antiserum / Fa. SEROTEC,<br />
Düsseldorf, Hamburg) gerichtet ist. Als sekundärer Antikörper wurde ein biotinylierter<br />
Antikörper aus der Ziege, der gegen Ratten-IgG gerichtet ist, in einer Verdünnung von 1:200<br />
verwendet.
Material und Methoden 45<br />
3.1.5.4 Immunhistochemische Darstellung des caninen MHC-Klasse II–Antigens<br />
Nach Entparaffinierung und Hemmung der endogenen Peroxidase mit 0,5% Methanol- H ² O ²<br />
wurden <strong>die</strong> Gewebeschnitte einer 15-minütigen Demaskierung in kochendem Citratpuffer<br />
unterzogen. Anschließend wurden <strong>die</strong> Schnitte dreimalig mit PBS gespült, in Coverplates<br />
(Fa.Shandon Sequenza, Frankfurt, Deutschland) verbracht und mit inaktiviertem Ziegen-<br />
Normalserum für 20 min überschichtet. Danach wurde der erste Antikörper, ein monoklonaler<br />
Antikörper gegen MHC-II aus der Maus (Maus Anti-Human HLA-DR Antigen Alpha-<br />
Chain/ Fa. DAKOCytomation, Hamburg, Deutschland, Code: M0746) in einer Verdünnung<br />
von 1: 50 in PBS-BSA auf <strong>die</strong> Schnitte aufgetragen und über Nacht bei 4°C inkubiert. Als<br />
sekundärer Antikörper wurde ein biotinylierter Antikörper aus der Ziege, der gegen Mäuse-<br />
IgG (Fa. VECTOR, Burlingame, USA) gerichtet ist, verwendet. Dieser wurde in 10%<br />
Hundenormalserum in einer Verdünnung von 1:200 eingesetzt und für 30 Minuten auf den<br />
Gewebeschnitten belassen. Zur Detektion des Antigens wurden <strong>die</strong> Gewebeschnitte für 30<br />
min. mit dem ABC-Kit (Fa. VECTOR, Burlingame, USA) inkubiert. Als Chromogen <strong>die</strong>nte<br />
3,3-Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid (DAB). Die gefärbten Gewebeschnitte wurden mit<br />
Hämalaun nach Mayer gegengefärbt, dehydriert und eingeschlossen.<br />
3.1.5 Bewertungssystem zur Erfassung des histopathologischen Krankheitsstatus<br />
Bei der histologischen Auswertung wurden folgende Parameter zur quantitativen Bewertung<br />
herangezogen:<br />
1) Anzahl der Talgdrüsen pro Haarfollikel: Es wurden mittels Zählung sowohl <strong>die</strong><br />
Anzahl der Haarfollikel, als auch <strong>die</strong> Zahl der Talgdrüsen pro Gewebeschnitt ermittelt.<br />
Die Anzahl der Talgdrüsen pro Haarfollikel ist prozentual zu den gezählten<br />
Haarfollikeln ausgedrückt.<br />
2) Anzahl der Entzündungsreaktionen im Bereich der Haarfollikelisthmen und deren<br />
Ausprägungsgrade von null bis drei Punkten. Mit Hilfe von Multiplikatoren wurde der<br />
Grad der Entzündung genauer bestimmt. Der prozentuale Anteil der<br />
Entzündungsreaktionen mit einer geringgradigen Ausprägung wurde einfach bewertet,<br />
der prozentuale Anteil der Entzündungsreaktionen mit mittelgradiger Ausprägung
Material und Methoden 46<br />
wurde doppelt bewertet und der prozentuale Anteil der Entzündungsreaktionen mit<br />
hochgradiger Ausprägung wurde mit drei multipliziert. Die Summe <strong>die</strong>ser Werte ergab<br />
einen Wert, der <strong>die</strong> Entzündungsausdehnung und den Entzündungsgrad wiedergibt.<br />
3) Hyperkeratose im Haarfollikelinfundibulum, bewertet mit null bis drei Punkten.<br />
3.1.6 Auswertung der immunhistiologisch gefärbten Präparate/ Morphometrie<br />
Die immunhistiologisch gefärbten Gewebeschnitte wurden mit Hilfe eines binokularen<br />
Lichtmikroskops (Fa. Carl Zeiss, Oberkochen, Deutschland) ausgewertet.<br />
Zur Auszählung der Entzündungszellen wurde <strong>die</strong> 40 fache Vergrößerung gewählt. Dann<br />
wurde im Gesichtsfeld, am Übergang zwischen Wurzelscheide und Haartrichter (Sitz der<br />
Talgdrüsen) <strong>die</strong> Zahl der gefärbten Zellen ermittelt. Pro Schnitt wurden zehn Gesichtsfelder<br />
ausgezählt.<br />
3.1.7 Dokumentation der Ergebnisse<br />
Alle zuvor erwähnten Werte aus semiquantitativer Bestimmung und Morphometrie wurden in<br />
EXCEL-Tabellen eingegeben.<br />
3.1.8 Statistik<br />
Die mittels klinischer Untersuchung und Histomorphometrie erhobenen<br />
Untersuchungsparameter wurden bezüglich ihrer Veränderung unter der Therapie statistisch<br />
ausgewertet. Hier wurde eine Statistik- Software (SAS 6.12) verwendet (SAS Institute Inc.,<br />
Cary, NC, USA). Alle Ergebnisse wurden mittels der „General Linear Model“- Prozedur für<br />
verbundene Stichproben und dem einseitigen Dunnet´s -Test ausgewertet.
Ergebnisse 47<br />
3.2 Ergebnisse<br />
3.2.1 Patientendaten<br />
Im folgenden werden <strong>die</strong> zwölf Patienten und ihr Krankheitsbild bei Therapiebeginn<br />
beschrieben.<br />
Patient 1:<br />
Es handelt sich um einen vier Jahre alten, nicht kastrierten, männlichen Hovawart, von 34,5<br />
kg Körpergewicht. Der Hund wurde Anfang März 2002 mit einer chronischen, progre<strong>die</strong>nten<br />
Seborrhoe, einer Hypotrichose und Follikulitis im Rückenbereich vorgestellt. Die Symptome<br />
hatten sich in den letzten 1,5 Jahren entwickelt. Es hatte keine Vorbehandlung stattgefunden.<br />
Ende März 2002 wurde er in <strong>die</strong> vorliegende Stu<strong>die</strong> aufgenommen. Zu <strong>die</strong>sem Zeitpunkt<br />
waren <strong>die</strong> am stärksten krankheitsbedingt veränderten Stellen der Rücken, beide Flanken und<br />
der Schwanz. Es waren dort Schuppen und alopezische Bereiche erkennbar. Der histologische<br />
Befund <strong>die</strong>ser Untersuchung ergab eine mittelgradige periadnexale Entzündungsreaktion mit<br />
destruierten Talgdrüsen. Der Hovawart erhielt ab Ende März 2002 einmal täglich 175 mg<br />
Cyclosporin A, 2 h vor oder nach einer Mahlzeit.<br />
Patient 2:<br />
Dies ist ein sieben Jahre alter Mittelschnauzer mit 27 kg Körpergewicht. Der kastrierte Rüde<br />
wurde Anfang März 2002 mit einer Pyodermie und follikulärer Hyperkeratose vorgestellt. Er<br />
litt seit ca. 1 Jahr an den Hautveränderungen und war einmal für 4 Wochen mit Cefaseptin<br />
(25mg/kg zweimal täglich) vorbehandelt worden, was eine geringgradige, kurzfristige<br />
Besserung zur Folge hatte. Ende März 2002 wurde das Tier in <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong> aufgenommen.<br />
Klinische Krankheitszeichen, wie follikuläre Hyperkeratose, Alopezie und Follikulitis waren<br />
am ganzen Körper zu sehen, am stärksten jedoch an den Ohren, am Nacken, an den Flanken<br />
und den Gliedmaßen. Hals, Rücken und das Perineum waren mittelgradig verändert. Am<br />
Kopf und am Bauch konnten nur wenig Schuppen festgestellt werden. Alopezie und<br />
Haarbruch traten an Perineum und Nacken am stärksten, an den Gliedmaßen und am Schwanz
Ergebnisse 48<br />
hingegen moderat auf. Bei Kopf, Brust, Abdomen und den Flanken war keine Alopezie<br />
erkennbar. Auffallend bei <strong>die</strong>sem Patienten war <strong>die</strong> gering- bis mittelgradig ausgeprägte<br />
Follikulitis, insbesondere an Rücken, Schwanz und der rechten Vordergliedmaße.<br />
Histologisch zeigte sich eine hochgradige periadnexale Entzündungszellinfiltration mit<br />
vollständiger Destruktion der Talgdrüsenkomplexe. Der Mittelschnauzer erhielt einmal<br />
täglich 150 mg Cyclosporin A, 2 h vor oder nach einer Mahlzeit.<br />
Patient 3:<br />
Der damals fünf Jahre alte männliche, nicht kastrierte Hovawart wurde Mitte April 2002<br />
mit Seborrhoe an Rumpf-, Kopf- und Gliedmaßen vorgestellt. Die Untersuchung der<br />
entnommenen Hautstanzen ergab eine mittelgradige Entzündungszellinfiltration im Bereich<br />
der Haarfollikelisthmen. Talgdrüsen waren größtenteils nicht mehr vorhanden. Das Tier wog<br />
55 kg und zeigte <strong>die</strong> ersten Krankheitssymptome am Schwanz vor ca. 1,5 Jahren, wurde aber<br />
nicht vorbehandelt. Neben der Sebadenitis wurde eine Hypothyreose diagnostiziert. Das Tier<br />
erhielt seit Mitte Mai einmal täglich 275 mg Cyclosporin A und zusätzlich 700 mg Euthyrox<br />
zweimal täglich.<br />
Patient 4:<br />
Der sechs Jahre alte männliche, kastrierte Berner Sennenhund-Mischling zeigte schon seit 1,5<br />
Jahren Hautveränderungen, welche mit Antibiotika und Shampoos vorbehandelt wurden. Der<br />
40 kg schwere Rüde wies eine starke Alopezie und follikuläre Hyperkeratose am Kopf, im<br />
Nacken, am kaudalen Rücken und an den Vordergliedmaßen auf. Histologisch wurde eine<br />
hochgradige Entzündung auf Höhe der Haarfollikelisthmen und größtenteils vollständig<br />
zerstörte Talgdrüsen festgestellt. Der Hund erhielt ab Anfang Juni 2002 eine Dosis von<br />
200mg Cyclosporin A einmal täglich, 2h vor oder nach einer Mahlzeit.<br />
Patient 5:<br />
Der fünf Jahre alte, männliche, kastrierte Akita Inu von 41 kg Körpergewicht, wurde Mitte<br />
August 2002 mit einer starken follikulären Hyperkeratose vorgestellt. Die seit einem Jahr<br />
zunehmend stärker werdenden Symptome waren nicht vorbehandelt. Der Akita Inu wies eine<br />
am ganzen Körper starke Hyperkeratose und deutliche Alopezie an den Ohren und an der
Ergebnisse 49<br />
Flanke auf, sowie mittelgradigen Haarbruch an der Brust, am Hals und an den Gliedmaßen.<br />
Bei der Untersuchung der ersten Hautbioptate zeigte sich eine mittelgradige<br />
Entzündungszellinfiltration der Haarfollikelisthmen, und es waren keine Talgdrüsen mehr<br />
nachweisbar. Der Hund erhielt ab Anfang September 2002 einmal täglich 200 mg<br />
Cyclosporin A.<br />
Patient 6:<br />
Die sechs Jahre alte, kastrierte Hovawarthündin wog 32 kg. Der Hund litt seit knapp drei<br />
Jahren an progressiven Hautveränderungen, welche 1999 schon als lymphozytäre Sebadenitis<br />
diagnostiziert worden waren. Das Tier erhielt jedoch bis zum Eintritt in <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>, d.h. Mitte<br />
November 2002, keine Behandlung. Seither erhält das Tier einmal täglich 150 mg<br />
Cyclosporin A. Zum Zeitpunkt der Aufnahme in <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong> zeigte das Tier eine starke<br />
Hyperkeratose am ganzen Rumpf und Kopf, sowie deutlichen Haarausfall an Brust, Hals,<br />
Rücken und Schwanz. Die Auswertung der Hautbiopsien ergaben eine hochgradige<br />
periadnexale Entzündungszellinfiltration und das vollständige Fehlen der<br />
Talgdrüsenkomplexe. Zudem hatte <strong>die</strong> Hündin eine deutliche Follikulitis an Kopf, Hals, Brust<br />
und Rücken. Daher bekam sie zusätzlich für 20 Tage zweimal täglich 25 mg/kg KGW<br />
Cefaseptin.<br />
Patient 7:<br />
Bei dem vier Jahre alten, männlichen, nicht kastrierten, 42 kg schweren Akita Inu wurden<br />
Ende des Sommers 2002 erste Hautveränderungen, wie Schuppen und Haarverluste, an Kopf<br />
und Gliedmaßen erkennbar. Histologisch zeigte sich eine mittel- bis hochgradige periadnexale<br />
Entzündungszellinfiltration und der vollständige Verlust der Talgdrüsen. Eine Vorbehandlung<br />
hatte nicht stattgefunden. Der Hund kam Ende November in <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong> und erhält seitdem<br />
einmal täglich 200mg Cyclosporin A.<br />
Patient 8:<br />
Der fünf Jahre alte, männliche, nicht kastrierte Berner Sennenhund wog 52 kg. Sebadenitis<br />
war bei <strong>die</strong>sem Patienten bereits Mitte 1999 diagnostiziert worden. Klinisch fiel am ganzen<br />
Körper eine Schuppenbildung auf. Der Hund bekam seit Mitte 1999 in Intervallen
Ergebnisse 50<br />
Prednisolon 5mg (einmal täglich 7,5 mg) und Enrofloxacin. Seit Anfang Dezember 2002<br />
erhielt das Tier einmal täglich 250 mg Cyclosporin A, 2 h vor oder nach einer Mahlzeit. Zu<br />
<strong>die</strong>sem Zeitpunkt war eine hochgradige Hyperkeratose und mittelgradige Alopezie an Nacken<br />
und Schwanz zu beobachten. Histologisch zeigte sich nur eine leichte periadnexale<br />
Entzündungszellinfiltration und vollständiger Verlust der Talgdrüsenkomplexe.<br />
Patient 9:<br />
Die weibliche, sechs Jahre alte, 35 kg schwere Berner Sennenhündin zeigte erste<br />
Hautveränderungen im Frühjahr 2002 und wurde mit rückfettenden Shampoos und Cefaseptin<br />
vorbehandelt. Die Hündin zeigte eine hochgradige Hyperkeratose an den Ohren und am<br />
Schwanz. Die Untersuchungsbefunde der Hautbioptate ergaben eine mittelgradige<br />
periadnexale Entzündung mit vollständiger Destruktion der Talgdrüsenkomplexe. Zudem war<br />
<strong>die</strong> Haut Ende September 2002 auf der kompletten Rückenlinie sehr dick. Seither erhielt der<br />
Hund einmal täglich 175 mg Cyclosporin A, 2h vor oder nach einer Mahlzeit.<br />
Patient 10:<br />
Der sechs Jahre alte, männliche Hovawart, von 45 kg Körpergewicht wies zum Eintritt in <strong>die</strong><br />
Stu<strong>die</strong> erst seit kurzem eine starke follikuläre Hyperkeratose am ganzen Körper auf. Es hatte<br />
keine Vorbehandlung stattgefunden. Histologisch zeigte sich das Bild einer subakuten,<br />
pyogranulomatösen Sebadenitis mit einer hochgradigen periadnexalen<br />
Entzündungszellinfiltration und vollständigem Verlust von Talgdrüsen. Seit Anfang<br />
November 2002 erhielt das Tier einmal täglich 225 mg Cyclosporin A, 2 h vor oder nach<br />
einer Mahlzeit.<br />
Patient 11:<br />
Dieser Patient ist ein weiblicher, kastrierter Kleiner Münsterländer. Die Hündin ist fünf Jahre<br />
alt und wiegt 32 kg. Die ersten Hautveränderungen traten im November 2001 auf und wurden<br />
im Zeitraum von Dezember 2001 bis Februar 2002 mit Cortison behandelt. Zu Beginn der<br />
Stu<strong>die</strong> war am ganzen Körper des Tieres eine deutliche Alopezie erkennbar, insbesondere am<br />
Bauch, an den Gliedmaßen und an den Flanken. Histologisch fand sich eine mittelgradige<br />
Entzündungszellinfiltration auf Höhe der Haarfollikelisthmen, und es waren keine Talgdrüsen
Ergebnisse 51<br />
mehr nachweisbar. Seit Mitte März 2002 wurde dem Patienten einmal täglich 150 mg<br />
Cyclosporin A verabreicht.<br />
Patient 12:<br />
Erste Symptome wie Alopezie und Schuppen traten bei dem 3 jährigen, weiblichen, nicht<br />
kastrierten Akita Inu im Frühjahr/Sommer 2002 auf. Seit Anfang Dezember 2002 bekam das<br />
Tier einmal täglich 150 mg Cyclosporin A. Zu <strong>die</strong>sem Zeitpunkt waren eine deutliche<br />
Hyperkeratose und mittelgradiger Haarausfall am Rumpf des Tieres ersichtlich.<br />
Die histologische Untersuchung ergab eine geringgradige periadnexale Entzündung und<br />
vollständigen Verlust der Talgdrüsenkomplexe.
Ergebnisse 52<br />
Tabelle 1: Zusammenfassung aller Patientendaten
Ergebnisse 53<br />
3.2.2 Entwicklung des klinischen Krankheitsbildes unter Cyclosporin A-Therapie<br />
Patient 1:<br />
Der Hovawart wies zu Beginn der Anwendung von Cyclosporin A eine begrenzte und starke<br />
Alopezie und follikuläre Hyperkeratose auf dem gesamten Rücken, bis hin zum Schwanz und<br />
an den Flanken auf. Schon bei der nächsten Untersuchung vier Monaten später war eine<br />
deutliche Verbesserung des klinischen Bildes von 89% zu bemerken. Die follikuläre<br />
Hyperkeratose und Alopezie in den oben genannten Bereichen war stark zurückgegangen.<br />
Zum nächsten Termin weitere vier Monate später, zeigte sich noch eine leichte Hyperkeratose<br />
am Kopf und an der dorsalen Linie und leichter Haarbruch am Rücken. Insgesamt war der<br />
Krankheitsstatus zwischen vier und acht Monaten nach Therapiebeginn gleich. Am Ende der<br />
zwölfmonatigen Behandlung mit Cyclosporin A war <strong>die</strong> Hyperkeratose an Kopf, Nacken,<br />
Rücken und den Flanken wieder um 15% stärker geworden als im vorherigen Quartal.<br />
Patient 2:<br />
Der Mittelschnauzer zeigte bei der ersten Untersuchung eine deutliche, follikuläre<br />
Hyperkeratose an Ohren, Nacken, Schwanz und den Gliedmaßen. Desweiteren lagen<br />
Alopezie und eine moderate Follikulitis vor. Zur zweiten Untersuchung war eine<br />
Verbesserung um 84% zu erkennen. Es waren weder eine Follikulitis noch Alopezie zu<br />
beobachten. Die follikuläre Hyperkeratose war deutlich zurückgegangen und nur noch<br />
geringgradig an Kopf, Ohren, Hals, Nacken, Rücken, Schwanz und den Gliedmaßen<br />
festzustellen. Zur dritten Untersuchung Ende Oktober waren keine klinischen Befunde mehr<br />
zu erheben. Ebenso wie <strong>die</strong> letzte Verlaufsuntersuchung, welche keine besonderen klinischdermatologischen<br />
Befunde ergab.<br />
Patient 3:<br />
Der Hovawart zeigte bei der ersten Untersuchung mittel- bis hochgradige Veränderungen.<br />
Insbesondere an Kopf, Schwanz und den Gliedmaßen war <strong>die</strong> follikuläre Hyperkeratose stark<br />
ausgeprägt. Alle weiteren Körperbereiche wiesen mittel- bis geringgradige Schuppungen auf.<br />
Lediglich am kranialen Rücken gab es keine besonderen Befunde. An allen vier Gliedmaßen,<br />
am Schwanz, in der Dammregion, sowie am Kopf waren hochgradig alopezische Stellen
Ergebnisse 54<br />
festzustellen. Ohren, Brust und Hals wiesen moderaten Haarbruch und Haarausfall auf. Zum<br />
zweiten Untersuchungstermin zeigte der allgemeine dermatologische Status eine<br />
Verbesserung um 27%. Im Einzelnen war <strong>die</strong> follikuläre Hyperkeratose noch immer stark an<br />
Ohren und Brust ausgeprägt. Eine moderate Verbesserung zeigte hingegen <strong>die</strong> Schuppung an<br />
Gliedmaßen und Schwanz. Rücken, Flanken und Hals wiesen jedoch nur noch eine milde<br />
Hyperkeratose auf. Der Haarbruch hatte sich deutlich verbessert. Mittelgradig betroffen waren<br />
allerdings noch <strong>die</strong> Gliedmaßen, <strong>die</strong> Ohren und <strong>die</strong> Brust. Beim dritten Besuch war <strong>die</strong><br />
Veränderung insgesamt deutlich zurückgegangen. Der Krankheitstatus betrug nur noch 27%<br />
des Ausgangswertes. Nur an Ohren und Gliedmaßen konnte noch eine follikuläre<br />
Hyperkeratose und leichte Alopezie beobachtet werden. Das Tier entwickelte jedoch ab dem<br />
neunten Behandlungsmonat großflächige Plaques am Rumpf. Nach einer histologischen<br />
Untersuchung, <strong>die</strong> den Verdacht einer Arzneimittelreaktion ergab (morphologische Diagnose:<br />
lichenoide Dermatitis), wurde Cyclosporin A abgesetzt. <strong>Dr</strong>ei Wochen nach dem Absetzen<br />
verschwanden <strong>die</strong> Plaques. Der Patient wurde vier Monate später erneut vorgestellt und zeigte<br />
wieder starke Schuppen am Kopf. Auch Ohren, Hals und Nacken wiesen eine deutliche<br />
Hyperkeratose auf. Diese Regionen waren außerdem von deutlichem Haarausfall geprägt.<br />
Patient 4:<br />
Der Mischlingsrüde litt beim ersten Besuch an einer extremen Hyperkeratose an Kopf,<br />
Nacken, Brust und kaudalem Rücken. Diese Bereiche waren außerdem <strong>durch</strong> einen starken<br />
Haarausfall gekennzeichnet. Auffallend war eine leichte Follikulitis an Kopf und Nacken.<br />
Ansonsten war <strong>die</strong> Hyperkeratose am ganzen Körper gering- bis mittelgradig. Der<br />
Haarbruch war am kaudalen Rücken und Schwanz als mittelgradig einzuschätzen, an den<br />
übrigen Bereichen wurde eine leichte Alopezie festgestellt. Nach vier Monaten kam es zu<br />
einer erheblichen Verbesserung von 64%, d.h. der Krankheitsstatus betrug nur noch 36%. Die<br />
Follikulitis war verschwunden und es wurden nur noch einige mittelgradige,<br />
hyperkeratotische Bereiche an Kopf, Nacken und Rücken entdeckt. An den Ohren, sowie den<br />
restlichen Regionen der dorsalen Linie wurden noch vereinzelt Schuppen festgestellt. Auch<br />
<strong>die</strong> Alopezie war deutlich zurückgegangen. Es waren nur noch geringgradig alopezische<br />
Bereiche an Kopf, Nacken, Rücken und Schwanz zu sehen. Zum dritten Besuch hatte sich<br />
sowohl <strong>die</strong> follikuläre Hyperkeratose als auch <strong>die</strong> Alopezie ein wenig verbessert. Nur noch
Ergebnisse 55<br />
an Nacken, Rücken und Schwanz waren Schuppen zu erkennen, welche jedoch teils als<br />
mittelgradig und am Schwanz als hochgradig eingestuft werden mußten. Eine geringgradige<br />
Alopezie war nur noch an Schwanz und Rücken zu bemerken. Zur letzten Untersuchung Mitte<br />
Juni wurde eine deutliche Verschlechterung festgestellt, <strong>die</strong> sich seit April entwickelt hatte.<br />
Das klinische Bild war sogar um 10% schlechter als der Anfangsbefund. Obendrein<br />
entwickelte sich auch ein leichter Juckreiz. Die Patientenbesitzer teilten mit, es sei auch schon<br />
früher zu jahreszeitlichen Verschlechterungen gekommen. Ohren, Brust, Rücken, Schwanz<br />
und Oberschenkel des rechten Beines waren von einer hochgradigen, follikulären<br />
Hyperkeratose geprägt. An den restlichen Beinen sowie an den Flanken und am Bauch waren<br />
nur vereinzelt zarte Schuppen bis gar keine erkennbar. Kopf, Nacken und Hals waren<br />
mittelgradig betroffen. Die Alopezie war am stärksten an Schwanz und Rücken ausgeprägt,<br />
moderater an Kopf, Ohren und Brust. Eine milde Follikulitis erstreckte sich über den Rücken.<br />
Patient 5:<br />
Der fünfjährige Akita Inu hatte am ganzen Körper eine hochgradige Hyperkeratose. Nur an<br />
Hals, Brust, Abdomen und Rücken waren <strong>die</strong> Veränderungen etwas schwächer. Der<br />
Haarausfall war am deutlichsten an den Ohren und Flanken, etwas milder waren <strong>die</strong><br />
Haarverluste an Kopf, Brust, Hals, Schwanz und Gliedmaßen. Die anderen Körperregionen<br />
wiesen keine Veränderungen auf. Bei der nächsten Verlaufsuntersuchung hatte sich der<br />
klinische Eindruck um 48% verbessert, obwohl noch eine leichte Follikulitis am Nacken,<br />
Abdomen und Rücken auffiel. Die Alopezie war deutlich zurückgegangen. Der Rücken und<br />
Schwanz waren nur noch mittelgradig betroffen. An Kopf, inklusive Ohr, sowie Flanken und<br />
Hintergliedmaßen waren nur leichte Haarverluste zu erkennen. Bei der Beurteilung der<br />
follikulären Hyperkeratose fiel eine extreme Neigung zur großflächigen Schuppenbildung,<br />
insbesondere an Flanken und Schwanz auf. Rücken und Kopf zeigten eine mittelgradige<br />
Hyperkeratose. An Ohren, Nacken, Perineum und der linken Hintergliedmaße waren kleine,<br />
zarte Schuppen zu sehen. Zum dritten Besuch war noch eine starke Hyperkeratose an Nacken,<br />
Ohren und allen vier Gliedmaßen, besonders auf Höhe des Metacarpus auffällig.<br />
Mittelgradige Veränderungen wurden an Schwanz, Brust und Hals, sowie Kopf beobachtet.<br />
Der Bauch wies nur vereinzelt zarte Schuppen auf. Alopezie und Follikulitis wurden nicht<br />
mehr beobachtet. Insgesamt kam es zu einer Verbesserung um weitere 11% (Abb. 11). Die
Ergebnisse 56<br />
abschließende Untersuchung ergab eine weitere Verbesserung der Hyperkeratose. Da<strong>durch</strong><br />
verbesserte sich der klinische Gesamteindruck um weitere 12%, so daß abschließend über<br />
zwölf Monate eine Verbesserung von 71% erreicht worden ist.<br />
Patient 6:<br />
Bei <strong>die</strong>sem Patienten war bei der Anfangsuntersuchung eine fast generalisierte hochgradige<br />
follikuläre Hyperkeratose zu bemerken. Die Gliedmaßen, Nacken und Ohren wiesen eine<br />
moderate Hyperkeratose auf. Starker Haarbruch und Haarausfall waren an Hals, Brust und<br />
Rücken zu erkennen. Die anderen Körperregionen wiesen nur eine leichte Alopezie auf.<br />
Weiterhin hatte das Tier eine mittelgradige Follikulitis an Kopf, Brust und Hals, sowie eine<br />
geringgradige Follikulitis an Rücken und den Flanken. Vier Monate später hatte sich das<br />
gesamte Erscheinungsbild des Tieres deutlich gebessert, der Krankheitsstatus betrug nur noch<br />
45% vom Erscheinungsbild bei der Anfangsuntersuchung. Trotzdem war noch eine<br />
mittelgradige Schuppung an Kopf, Ohren, kaudalem Rücken, Flanken, Schwanz, und<br />
Gliedmaßen zu bemerken. Brust, Hals und Nacken waren nur leicht betroffen. Eine<br />
geringgradige Alopezie war <strong>durch</strong>gehend am ganzen Körper zu beobachten. Der Rücken und<br />
<strong>die</strong> Flanken waren etwas stärker betroffen. Anzeichen für eine Follikulitis gab es keine mehr.<br />
Bei dem dritten Besuch war eine weitere Verbesserung des klinischen Bildes festzustellen. Es<br />
waren noch deutliche Veränderungen am Kopf zu erkennen. Insbesondere Ohren, Stirn und<br />
Nacken zeigten eine hochgradige Hyperkeratose, hinzu kam an der Stirn auch noch starker<br />
Haarausfall. Auch <strong>die</strong> Brust und <strong>die</strong> Innenseiten der Vordergliedmaßen zeigten eine<br />
mittelgradige, follikuläre Hyperkeratose und Alopezie. Alle weiteren Körperregionen waren<br />
ohne besonderen Befund. Zur abschließenden Verlaufsuntersuchung war wieder eine leichte<br />
Verschlechterung des Hautbildes festzustellen. An folgenden Stellen wurde eine hochgradige<br />
Hyperkeratose beobachtet: Kopf, insbesondere <strong>die</strong> Stirn, kranialer Rücken und <strong>die</strong> Flanken.<br />
Ohren, Hals, Schwanz und Hintergliedmaßen wiesen eine mittelgradige Hyperkeratose auf,<br />
<strong>die</strong> Vordergliedmaßen und <strong>die</strong> Brust zeigten nur leichte Veränderungen. Die Alopezie war an<br />
der Brust besonders stark, der kraniale Rücken und <strong>die</strong> Flanken waren mittelgradig betroffen.<br />
Insgesamt war das Fell sehr dünn und <strong>die</strong> Haare leicht epilierbar. Zum Teil bestand <strong>die</strong><br />
Körperbehaarung fast nur noch aus Sekundärhaaren. Ein milder Haarbruch wurde an Kopf,<br />
Hals und Hintergliedmaßen festgestellt.
Ergebnisse 57<br />
Patient 7:<br />
Zu Beginn der Stu<strong>die</strong> hatte der Akita Inu eine starke Hyperkeratose am ganzen Körper,<br />
besonders an Ohren, Stirn, Schwanz und Gliedmaßen. Hals, Brust und Rücken zeigten nur<br />
mittelgradige Veränderungen, und an den Flanken fielen zarte Schuppen auf. An Schwanz<br />
und Gliedmaßen war eine starke Alopezie wahrzunehmen. Etwas leichterer Haarausfall war<br />
an Ohren und Brust zu erkennen. Bei der nächsten Verlaufsuntersuchung war nur noch eine<br />
mittlere Hyperkeratose und Alopezie am Kopf zu sehen. Die Ohren waren von einer leichten<br />
Schuppung und Haarbruch gekennzeichnet, und insgesamt wurde eine Verbesserung des<br />
klinischen Bildes von 60% festgestellt. Bei der dritten Untersuchung Mitte August hatte das<br />
Tier einen stark seborrhoeischen Geruch und <strong>die</strong> follikuläre Hyperkeratose an Kopf und<br />
Gliedmaßen war hochgradig. Brust, Hals und Abdomen waren von einer mittelgradigen<br />
Schuppung betroffen. Die Ohren, Rücken, Schwanz und Flanken waren hingegen nur leicht<br />
betroffen. Ein starker Haarausfall war nur an den Gliedmaßen zu sehen, <strong>die</strong> Ohren waren<br />
davon nur leicht betroffen. Es war eine temporäre Verschlechterung auf einen<br />
Krankheitsstatus von 83% zu bemerken. Zum Abschluß im Dezember war das klinische<br />
Ergebnis der dermatologischen Untersuchung gut und ausgehend von der letzten<br />
Untersuchung verbesserte sich das klinische Bild wieder, so dass nach zwölf Monaten<br />
Therapie eine Besserung um 89% erreicht wurde. Es konnten nur noch leichte Schuppen an<br />
den Ohren und am Schwanzansatz festgestellt werden.<br />
Patient 8:<br />
Die Hyperkeratose bei dem Berner Sennenhund war zu Anfang im Verhältnis zur Alopezie<br />
erstaunlich gering. Nur Nacken und Schwanz wiesen eine hochgradige Schuppung auf. Hals<br />
und Brust hingegen waren mittelgradig betroffen. Vereinzelte kleine Schuppen waren an<br />
Ohren, Flanken und Hintergliedmaße zu sehen. Eine mittelgradige Alopezie war von Nacken,<br />
Hals, Brust, Rücken bis Schwanz zu erkennen. Bei der nächsten Kontrolluntersuchung ergab<br />
sich ein um 82% verbessertes klinisches Bild. Aber es fielen großflächige Schuppen an der<br />
rechten Schulter und am linken Ellenbogen auf. Die follikuläre Hyperkeratose war nur noch<br />
an Kopf und Nacken ausgeprägt. Desweiteren war am Kopf noch eine geringgradige Alopezie<br />
zu beobachten. Zum dritten Besuch war keine Alopezie mehr erkennbar und nur an Kopf,<br />
Nacken, Hals und Brust war eine leichte Hyperkeratose zu sehen. Die Ohren waren etwas
Ergebnisse 58<br />
stärker betroffen. Die abschließende Verlaufsuntersuchung ergab eine deutliche<br />
Verschlechterung des klinischen Bildes, welche jetzt um 20% schlechter war als der<br />
Ausgangsbefund zu Beginn der Stu<strong>die</strong>. Die infundibuläre Hyperkeratose an Ohren, Nacken,<br />
Hals, und Schwanz war hochgradig. Kranialer Rücken und Kopf wiesen eine mittelgradige<br />
Schuppung auf. Die übrigen Körperregionen waren unverändert. Auch <strong>die</strong> Alopezie hatte sich<br />
wieder verschlechtert. Die Ohren und der Schwanz waren von mittelgradigen Haarverlusten<br />
geprägt. Kopf, Nacken, Hals und kranialer Rücken zeigten nur leichte Haarverluste.<br />
Patient 9:<br />
Der Berner Sennenhund hatte zu Anfang der Stu<strong>die</strong> eine sehr starke Hyperkeratose am ganzen<br />
Körper. Die Haut der dorsalen Linie, von Nacken bis Schwanz, war stark verdickt. Allerdings<br />
war nur ein leichter Haarbruch an Rücken, Nacken und Schwanz zu erkennen. Vier Monate<br />
später war noch immer eine extreme Hyperkeratose am ganzen Körper zu beobachten. Einzig<br />
<strong>die</strong> Haut im Nacken wurde etwas weicher, aber ab dem kaudalen Rücken war sie noch immer<br />
sehr hart. Der Haarwuchs an der Schwanzwurzel wurde etwas besser. Insgesamt besserte sich<br />
das klinische Bild jedoch nur um 5%. Zum dritten Besuch hatte sich der dermatologische<br />
Allgemeinzustand deutlich gebessert (weitere 66%). Nur noch an Nacken und Kruppe waren<br />
Veränderungen zu beobachten. Der Nacken war fast frei von Schuppen an den Haaren. Die<br />
Haut war weich, und lediglich an der Kruppe waren noch mittelgradig Schuppen zu erkennen,<br />
<strong>die</strong> langsam mit den Haaren herauswuchsen. Es war auch keine Alopezie mehr festzustellen.<br />
Bei der abschließenden Untersuchung Mitte Oktober 2003 waren nur noch vereinzelt<br />
Schuppen an Rücken und Nacken zu erkennen. Die Ohren waren etwas stärker von der<br />
follikulären Hyperkeratose betroffen. Somit verbesserte sich das klinische Bild innerhalb der<br />
zwölf Monate um insgesamt 78%.<br />
Patient 10:<br />
Dieser Hovawart hatte zu Beginn der Stu<strong>die</strong> eine starke Hyperkeratose, insbesondere an Hals,<br />
Nacken, Schwanz und Perineum, mit deutlichem follikulärem Cast (Abb. 10). Die übrigen<br />
Körperregionen waren von einer mittelgradigen Schuppung betroffen. Der Schwanz und das<br />
Perineum wiesen einen mittelgradigen Haarausfall auf. Zum nächsten Verlaufsbesuch im<br />
Januar 2003 waren nur noch moderate Schuppen an Schwanz, Perineum, Nacken, Brust und
Ergebnisse 59<br />
Hals zu erkennen. Der Rest des Körpers wurde von zarten Schuppen bedeckt. Die<br />
alopezischen Bereiche hatten sich deutlich verbessert. Rechnerisch ergab sich eine<br />
Verbesserung von 57%. Vier Monate später fiel wieder eine etwas stärkere follikuläre<br />
Hyperkeratose auf, insbesondere der Kopf mit den Ohren war hochgradig betroffen. Der<br />
Rumpf war von einer mittelgradigen Hyperkeratose befallen. Die Gliedmaßen zeigten nur<br />
geringgradige Veränderungen. An Stirn und Ohren waren <strong>die</strong> Haare leicht epilierbar. Zur<br />
abschließenden Untersuchung war beiderseits am Carpus noch eine leichte Hyperkeratose zu<br />
beobachten. An den Schultern fielen moderat Schuppen auf, ebenso an den Tarsi. Die Ohren<br />
wiesen ebenfalls eine deutliche Besserung auf. Insgesamt konnte bei <strong>die</strong>sem Patienten nach<br />
zwölfmonatiger Cyclosporin A-Behandlung eine klinische Verbesserung von 73% erreicht<br />
werden.<br />
Patient 11:<br />
Die Hündin zeigte an Rücken und Ohren eine mittelgradige, follikuläre Hyperkeratose. Die<br />
Alopezie war bei <strong>die</strong>sem Tier stark ausgeprägt. Ganz besonders stark betroffen waren<br />
Abdomen, Schwanz, Perineum, und Hintergliedmaßen. An den restlichen Körperregionen war<br />
der Haarausfall als mittelgradig zu bewerten. Bis zur zweiten Untersuchung besserte sich das<br />
klinische Bild um 35% und auch der Haarwechsel verlief physiologisch. Bei der dritten<br />
Untersuchung fiel nur eine geringgradige Hyperkeratose auf, welche auch bei der<br />
abschließenden Untersuchung noch erkennbar war. Zwischen dem vierten und achten<br />
Behandlungsmonat ergab sich eine Verbesserung von 7%. Bei der letzten Untersuchung<br />
wurden neben dem stumpfen Haarkleid keine Veränderungen mehr festgestellt. Somit ergab<br />
sich eine klinische Besserung von insgesamt 95% verglichen mit dem Ausgangswert zu<br />
Beginn der Stu<strong>die</strong>.<br />
Patient 12:<br />
Der Akita Inu zeigte eine mittelgradige Alopezie. Nur Ohren und Kopf zeigten eine<br />
mittelgradige Hyperkeratose. Bei der nächsten Verlaufsuntersuchung waren <strong>die</strong> Haare zu<br />
einem guten Teil nachgewachsen, aber noch immer leicht epilierbar. Am Kopf war noch<br />
immer eine mittel- bis hochgradige Hyperkeratose zu beobachten. Am restlichen Körper<br />
waren nur leichte Beläge zu erkennen und nach dem Bewertungssystem ergab sich eine
Ergebnisse 60<br />
Besserung von 35%. Nach weiteren vier Monaten hatte sich <strong>die</strong> Alopezie zwar deutlich<br />
verbessert, aber Stirn, Ohren und Rumpf wiesen noch immer eine mittelgradige<br />
Hyperkeratose auf. Die letzte Untersuchung Mitte November 2003 ergab eine deutliche<br />
Besserung der Hyperkeratose und somit besserte sich der Krankheitsstatus um insgesamt<br />
89% im Vergleich zum Ausgangswert zu Beginn der Stu<strong>die</strong>. Die Haut erschien insgesamt<br />
weicher, und es war eine deutliche Verbesserung des Haarwachstums festzustellen.<br />
___________________________________________________________________________<br />
Abb. 9 (Seite 61): Veränderung des klinischen Krankheitsbildes unter Therapie mit<br />
Cyclosporin A. Der Schweregrad des klinischen Krankheitsstatus wurde immer auf den<br />
Ausgangswert zu Beginn der Stu<strong>die</strong> (0 Monate) bezogen. In Abbildung a) sind <strong>die</strong> Werte aller<br />
12 Patienten individuell dargestellt, während b) den Mittelwert aus 12 Patienten und den<br />
„Standard Error of the Mean“, sowie <strong>die</strong> Irrtumswahrscheinlichkeit (p-Werte) wiedergibt. p ><br />
0,05 = nicht signifikant(n.s.); p < 0,001 = ***<br />
Zu a) Patient 3 entwickelt unter der Cyclosporin A Behandlung eine lichenoide Dermatitis, so<br />
daß trotz Verbesserung des klinischen Bildes der Sebadenitis <strong>die</strong> Behandlung ab dem achten<br />
Monat abgesetzt werden musste.
Ergebnisse 61<br />
Abb. 9<br />
a)<br />
b)<br />
***<br />
n.s.<br />
n.s.
Ergebnisse 62<br />
Die an allen zwölf Patienten ermittelten Mittelwerte zeigen eindeutig, daß es innerhalb der<br />
ersten vier Monate unter Therapie mit Cyclosporin A zu einer signifikanten Verbesserung des<br />
klinischen Bildes kommt. Der Krankheitsstatus nimmt um ca. 50% ab. Nach dem vierten<br />
Monat kommt es im Mittel trotz Fortführen der Therapie nicht mehr zu einer signifikanten<br />
Verbesserung.<br />
Abb. 10: Großflächige Schuppen von Keratin und follikulärem Material welche am<br />
Haarschaft anhaften. Patient 10 (Hovawart) vor Therapiebeginn.
Ergebnisse 63<br />
A)<br />
B)<br />
Abb. 11: Verbesserung des klinischen Bildes unter Cyclosporin A am Beispiel von Patient 5<br />
(Akita Inu). (A) Vor der Behandlung mit Cyclosporin A: Deutlich sind diffuse Haarverluste<br />
und dünnes Fell (mottenfraßähnlich) sowie follikuläre Hyperkeratose zu erkennen. (B) Nach<br />
achtmonatiger Cyclosporin A-Therapie: Es sind neben einer leichten Hyperkeratose keine<br />
klinischen Anzeichen einer Sebadenitis mehr erkennbar.
Ergebnisse 64<br />
3.2.2 Unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen<br />
- Niere<br />
Die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen der Nierenparameter (Harnstoff und Kreatinin)<br />
ergaben bei keinem Patienten Abweichungen von der Norm.<br />
- Gingivale Hyperplasie<br />
Zwei Patienten (7,12) entwickelten unter der Cyclosporin A-Therapie eine gingivale<br />
Hyperplasie (Abb. 12). Bei beiden Tieren handelt es sich um männliche Akita Inus. Bei<br />
Patient 12 war eine leichte Zahnfleischwucherung schon bei der ersten Verlaufsuntersuchung<br />
(nach 4 Monaten) zu erkennen. Innerhalb der nächsten Monate verschlechterte sich <strong>die</strong><br />
Zahnfleischzubildung soweit, so daß man sie als hochgradig bewerten mußte. Die<br />
Zahnspitzen waren jedoch noch nicht überwuchert, und das Tier kam mit der Situation gut<br />
zurecht. Nach weiteren vier Monaten hatte sich der Zustand nicht weiter verschlechtert. Bei<br />
Patient 7 war erst nach achtmonatiger Cyclosporin A-Behandlung eine leichte gingivale<br />
Hyperplasie zu bemerken, <strong>die</strong> sich im weiteren Verlauf jedoch nicht verschlimmerte.<br />
Abb. 12: Hund (West Highland White Terrier) mit gingivaler Hyperplasie nach<br />
sechsmonatiger Cyclosporin A-Behandlung; (Foto: <strong>Dr</strong>.R.Hämmerling, Düsseldorf)
Ergebnisse 65<br />
- kutane Arzneimittelreaktion<br />
Patient 3 (Hovawart) entwickelte trotz fortschreitender Verbesserung des klinischen Bildes<br />
der Sebadenitis, zwischen dem vierten und achten Behandlungsmonat immer größer<br />
werdende Plaques im Bereich des Rumpfes. Eine histologische Untersuchung zeigte eine<br />
subepidermale Entzündungsreaktion mit partieller Infiltration der Epidermis und Destruktion<br />
dorsaler Keratinozyten. Diese lichenoide Dermatitis wurde als Arzneimittelreaktion gewertet,<br />
so daß <strong>die</strong> Cyclosporin A-Behandlung abgesetzt wurde. <strong>Dr</strong>ei Wochen nach dem Absetzen<br />
heilten <strong>die</strong> Plaques ab.<br />
- Vomitus/Erbrechen<br />
Sowohl Patient 10 (Hovawart) als auch Patient 11 (Kleiner Münsterländer) litten am Anfang<br />
der Therapie unter Vomitus, insbesondere direkt nach der Verabreichung des Medikaments.<br />
Bei dem Hovawart setzten <strong>die</strong>se Symptome ohne weitere Maßnahmen nach ca. 14 Tagen aus.<br />
Bei Patient 11, welcher einen normalen Appetit zeigte, wurde NEORAL® ursprünglich direkt<br />
nach dem Aufwachen gegeben. Später zeigte <strong>die</strong> Einnahme nach dem ersten Spaziergang den<br />
Erfolg, daß der Hund das Medikament deutlich besser vertrug. Trotzdem kam es in Abständen<br />
von mehreren Wochen immer wieder zu Erbrechen nach der Verabreichung von NEORAL? .<br />
- Hypertrichose<br />
Eine deutliche Zunahme des Haarwachstums, insbesondere an den Pfoten, war bei sieben<br />
Hunden zu bemerken. Patient 3 (Hovawart) entwickelte zwischen dem 4. und 8.<br />
Behandlungsmonat eine sehr starke Hypertrichose, speziell zwischen den Zehen.<br />
Auch <strong>die</strong> Patienten 7 (Akita Inu), 8 (Berner Sennenhund), 9 (Hovawart) und 12 (Akita Inu)<br />
wiesen ab dem vierten Monat eine gering- bis mittelgradige Hypertrichose auf. Bei den<br />
Patienten 4 (Berner Sennenhund- Mischling) und 6 (Hovawart) fiel circa zwei Wochen nach<br />
Stu<strong>die</strong>nbeginn schon ein insgesamt deutlich verbessertes Haarwachstum auf, welches später<br />
auch zu einer deutlichen Zunahme des Haarwachstums im Zwischenzehenbereich führte.
Ergebnisse 66<br />
3.2.3 Histopathologische Verlaufsuntersuchungen unter Cyclosporin A-Therapie<br />
Patient 1:<br />
Bei den ersten Hautbioptaten war im Isthmusbereich der Haarfollikel eine mittelgradige,<br />
periadnexale, lymphozytäre Entzündungszellinfiltration zu sehen. Die Talgdrüsen waren fast<br />
vollständig von Entzündungszellen infiltriert und zerstört. Außerdem war eine mittelgradige<br />
Hyperkeratose im Haarfollikelinfundibulum zu erkennen. Die Haarfollikel befanden sich<br />
hauptsächlich im anagenen Stadium, einzelne telogene Haarfollikel waren jedoch auch zu<br />
erkennen. Nach vier Monaten Therapie waren in denselben Hautarealen noch immer<br />
mittelgradige Entzündungszellinfiltrationen im Isthmusbereich erkennbar, wobei im<br />
Vergleich zur ersten Untersuchung <strong>die</strong> Anzahl der entzündeten Haarfollikel auf ein <strong>Dr</strong>ittel<br />
zurückgegangen war. Talgdrüsen waren auch in <strong>die</strong>sen Biopsien nicht erkennbar. Die<br />
Haarfollikel waren kräftig entwickelt und befanden sich im anagenen Stadium. Nach<br />
achtmonatiger Cyclosporin A-Behandlung waren nur noch leichte entzündliche<br />
Veränderungen im Bereich der Haarfollikelisthmen erkennbar. Talgdrüsen waren noch immer<br />
nicht vorhanden. Zusätzlich war noch eine geringgradige, infundibuläre Hyperkeratose zu<br />
erkennen. Auch bei der abschließenden Untersuchung waren keine Talgdrüsen nachweisbar.<br />
Es lag noch immer eine leichte perivaskuläre Entzündung vor. Desweiteren wurde eine<br />
hochgradige, infundibuläre Hyperkeratose festgestellt. Die Haarfollikel waren im Anagen.<br />
Patient 2:<br />
Bei der Ausgangsuntersuchung der Bioptate des Mittelschnauzers fiel eine hochgradige<br />
Hyperkeratose mit einer mittelgradigen, gemischtzelligen periadnexalen<br />
Entzündungszellinfiltration und vollständiger Destruktion der Talgdrüsen auf. Die<br />
Haarfollikel waren überwiegend im anagenen Stadium und einige im Katagen. Die Befunde<br />
der Untersuchung nach viermonatiger Therapie ergaben eine geringgradige, infundibuläre<br />
Hyperkeratose und keine periadnexalen Entzündungszellinfiltrationen. Es waren zum Teil<br />
normal entwickelte Talgdrüsenkomplexe zu erkennen. In manchen Bereichen waren jedoch<br />
keine Talgdrüsen nachweisbar. Nach acht Monaten Therapie waren auch keinerlei Hinweise<br />
auf entzündliche Veränderungen mehr zu bemerken. Desweiteren waren in allen Schnitten<br />
Talgdrüsen zu erkennen. Es gab keine morphologischen Anzeichen mehr für eine Sebadenitis.<br />
Allerdings war noch eine geringgradige infundibuläre Hyperkeratose auffällig. Zum Abschluß
Ergebnisse 67<br />
der zwölfmonatigen Therapie waren gut entwickelte Talgdrüsen ohne Anzeichen von<br />
Degeneration und Entzündung zu erkennen. Noch immer war eine mittelgradige,<br />
infundibuläre Hyperkeratose zu sehen. Auffallend waren viele inaktive Haarfollikel.<br />
Patient 3:<br />
Bei der ersten histologischen Untersuchung vor Therapiebeginn war im Bereich der<br />
Haarfollikelisthmen eine periadnexale gering- bis mittelgradige, lymphohistiozytäre<br />
Entzündungszellinfiltrationen zu sehen. Es war eine Destruktion der Talgdrüsen bemerkbar.<br />
Desweiteren fand sich eine mittel- bis hochgradige infundibuläre Hyperkeratose. Die meisten<br />
Haarfollikel waren inaktiv. Nach vier Monaten Behandlung gab es keine Anzeichen mehr für<br />
eine infundibuläre Hyperkeratose. Talgdrüsen waren vereinzelt erkennbar. Auf Höhe der<br />
Haarfollikelisthmen zeigte sich eine geringgradige, periadnexale Entzündung. Die<br />
Haarfollikel waren im Anagen. Bei den nächsten Biopsien der dritten Verlaufsuntersuchung<br />
war <strong>die</strong> Entzündung vollständig verschwunden, und <strong>die</strong> Talgdrüsen waren zahlreich und<br />
morphologisch normal. Die infundibuläre Hyperkeratose in den Haarschäften war nur noch<br />
geringgradig. Leider mußte dann <strong>die</strong> Cyclosporin A-Therapie abgesetzt werden, da das Tier<br />
eine lichenoide Dermatitis, vermutlich eine Arzneimittelreaktion, entwickelte. Vier Monate<br />
nach dem Absetzen wurde das Tier wieder bioptiert und es zeigte sich erneut eine<br />
mittelgradige Entzündungszellinfiltration der Talgdrüsen. Diese waren jedoch vielfach noch<br />
vorhanden. Die infundibuläre Hyperkeratose hatte sich ebenfalls wieder verschlechtert.<br />
Patient 4:<br />
Anfang Juni wurden bei dem Berner Sennenhund-Mischling erste Biopsien aus dem Kopf-,<br />
Schulter- und Rückenbereich entnommen. Im Bereich einiger Haarfollikelisthmen waren<br />
hochgradige Entzündungszellinfiltrationen zu sehen. Desweiteren waren in den Biopsien<br />
überwiegend anagene Haarfollikel mit starker infundibulärer Hyperkeratose zu erkennen. Die<br />
Talgdrüsen waren größtenteils zerstört. Nach vier Monaten Cyclosporin A-Therapie wies eine<br />
Biopsie keine Hinweise auf entzündliche Veränderungen mehr auf. Die Haarfollikel waren im<br />
anagenen Stadium und es gab keine Anzeichen für eine infundibuläre Hyperkeratose. Die<br />
Talgdrüsenkomplexe waren zum Teil gut ausgebildet. Die Biopsie des kaudalen Rückens<br />
ergab jedoch noch eine multifokale, geringgradige, gemischtzellige
Ergebnisse 68<br />
Entzündungszellinfiltration im Bereich der Haarfollikelisthmen. Es waren dort keine<br />
Talgdrüsenkomplexe vorhanden. Die Haarfollikel befanden sich teils im Katagen und teils im<br />
Anagen. Nach achtmonatiger Behandlung zeigte sich eine geringgradige, entzündliche<br />
Infiltration auf Höhe der Haarfollikelisthmen, ebenso wie eine leichte infundibuläre<br />
Hyperkeratose. In manchen Bereichen waren normale Talgdrüsenkomplexe erkennbar, an<br />
anderer Stelle fehlten sie vollständig. Bei den abschließenden Biopsien fiel erneut eine<br />
deutliche infundibuläre Hyperkeratose und eine mittelgradige Entzündungszellinfiltration mit<br />
Destruktion der Talgdrüsen auf.<br />
Patient 5:<br />
Die Anfangsbiopsie des Akita Inu ergab eine mittelgradige Entzündungszellinfiltration im<br />
Bereich der Haarfollikelisthmen. Neben einer hochgradigen, infundibulären Hyperkeratose<br />
waren keine Talgdrüsen mehr nachweisbar. Vier Monate später war <strong>die</strong> Entzündungsreaktion<br />
deutlich geringer. Die infundibuläre Hyperkeratose blieb jedoch. Es wurden vereinzelt<br />
Talgdrüsen gefunden. Bei der dritten Untersuchung war <strong>die</strong> Entzündungszellinfiltration nur<br />
noch minimal und <strong>die</strong> infundibuläre Hyperkeratose mittelgradig erkennbar. Außerdem waren<br />
einzelne kleine Talgdrüsenkomplexe zu sehen. Beinahe jeder zweite Haarfollikel zeigte eine<br />
Talgdrüse. Die Haarfollikel befanden sich überwiegend im Anagen. Bei der letzten Biopsie<br />
waren keine entzündlichen Veränderungen mehr nachweisbar. Es wurden vereinzelt<br />
unveränderte Talgdrüsenkomplexe ohne Entzündungsreaktion gezählt. Desweiteren war noch<br />
eine geringgradige, infundibuläre Hyperkeratose zu sehen.<br />
Patient 6:<br />
Der Hovawart wies am Anfang eine mittelgradige Entzündungszellinfiltration auf Höhe der<br />
Haarfollikelisthmen auf. Die Talgdrüsen fehlten vollständig und eine mittelgradige<br />
infundibuläre Hyperkeratose war auffällig. Die Haarfollikel befanden sich hauptsächlich im<br />
Anagen. Die Biopsie nach viermonatiger Therapie zeigte einen leichten Rückgang der<br />
Entzündungszellinfiltration im Bereich der Talgdrüsen und der Destruktion <strong>die</strong>ser Komplexe.<br />
Es konnte eine zehnfache Steigerung der Talgdrüsenanzahl festgestellt werden. Die<br />
infundibuläre Hyperkeratose erwies sich als mittelgradig und <strong>die</strong> Haarfollikel befanden sich<br />
im Anagen. Nach achtmonatiger Cyclosporin A-Behandlung zeigten <strong>die</strong> Biopsien noch immer
Ergebnisse 69<br />
leichte Entzündungsprozesse. Talgdrüsenkomplexe waren 12% weniger als im vorherigen<br />
Quartal vorhanden. Noch immer bestand eine mittelgradige, infundibuläre Hyperkeratose. Die<br />
Haarfollikel befanden sich teils in der anagenen Phase, teils im Telogen. Nach<br />
zwölfmonatiger Therapie hatte sich im Vergleich zur letzen Biopsie kaum etwas an der<br />
Anzahl der Talgdrüsen verändert. Es waren vereinzelt Talgdrüsen zu sehen, begleitet jedoch<br />
von einer leichten Entzündung. Die infundibuläre Hyperkeratose hatte sich ein wenig<br />
verbessert.<br />
Patient 7:<br />
Die Biopsien vor Therapiebeginn ergaben eine mittel- bis hochgradige Entzündung im<br />
Isthmusbereich der Haarfollikel. Es waren keine Talgdrüsenkomplexe mehr erkennbar. Die<br />
infundibuläre Hyperkeratose war geringgradig ausgebildet, und <strong>die</strong> Haarfollikel befanden sich<br />
überwiegend im Anagen. Bei der zweiten Untersuchung waren keine floriden<br />
Entzündungsprozesse und lediglich vereinzelt Talgdrüsen nachweisbar. Die infundibuläre<br />
Hyperkeratose mußte als mittelgradig bewertet werden. Nach achtmonatiger Cyclosporin A-<br />
Therapie waren keine Entzündungsprozesse auf Höhe der Haarfollikelisthmen mehr<br />
festzustellen. Es konnten teilweise kleine Talgdrüsenkomplexe gefunden werden. Eine<br />
mittelgradige, infundibuläre Hyperkeratose konnte ebenfalls festgestellt werden. Die<br />
Haarfollikel befanden sich im Anagen. Die abschließende histologische Untersuchung war<br />
aufgrund stu<strong>die</strong>nunabhängiger Umstände nicht möglich.<br />
Patient 8:<br />
Bei der Ausgangsuntersuchung des Berner Sennenhundes wurden geringgradige<br />
Entzündungsprozesse auf Höhe der Haarfollikelisthmen und ein vollständiger Verlust von<br />
Talgdrüsen festgestellt. Desweiteren fanden sich eine hochgradige infundibuläre<br />
Hyperkeratose der Haarschäfte und Haarfollikel überwiegend in katagenen und telogenen<br />
Haarzyklussta<strong>die</strong>n. Nach viermonatiger Cyclosporin A-Therapie waren kaum noch<br />
entzündliche Veränderungen sichtbar. Talgdrüsenkomplexe wurden keine gefunden. Die<br />
infundibuläre Hyperkeratose war noch immer hochgradig, und <strong>die</strong> Haarfollikel befanden sich<br />
überwiegend im Anagen. In der dritten Biopsie wurde wieder eine geringgradige<br />
Entzündungszellinfiltration im Bereich der Talgdrüsen festgestellt. Zum Teil waren kleine
Ergebnisse 70<br />
Talgdrüsen zu erkennen. Die Hyperkeratose war mittelgradig, und <strong>die</strong> Haarfollikel befanden<br />
sich hauptsächlich in der anagenen Phase. In der letzten Biopsie waren <strong>die</strong><br />
Entzündungsprozesse wieder vollständig verschwunden Es wurden jedoch auch keine<br />
intakten Talgdrüsenkomplexe mehr nachgewiesen. Die infundibuläre Hyperkeratose war<br />
hochgradig.<br />
Patient 9:<br />
Die erste Biopsie des Berner Sennenhundes zeigte eine mittelgradige, periadnexale<br />
Entzündungszellinfiltration im Bereich der Haarfollikelisthmen. Talgdrüsen waren keine<br />
mehr vorhanden. Desweiteren war eine mittelgradige infundibuläre Hyperkeratose zu<br />
erkennen. Es lagen überwiegend anagene Haarfollikel vor. Nach vier Monaten Therapie<br />
stellten sich nur noch minimale Entzündungsprozesse dar. An den größtenteils anagenen<br />
Haarfollikeln waren gut entwickelte Talgdrüsenkomplexe ausgebildet. Es kam zu einer<br />
Zunahme der Talgdrüsenanzahl pro Haarfollikel um das 64fache. Die infundibuläre<br />
Hyperkeratose war noch immer mittelgradig ausgeprägt. In den Hautbiopsien nach<br />
achtmonatiger Cyclosporin A-Applikation war eine geringgradige Entzündungszellinfiltration<br />
zu beobachten. Die Talgdrüsenkomplexe waren unauffällig, an elf Haarfollikeln waren acht<br />
gut entwickelte Talgdrüsen zu erkennen. Daneben war eine leichte infundibuläre<br />
Hyperkeratose zu sehen. Es gab keine Hinweise auf eine Sebadenitis mehr. Auch bei der<br />
abschließenden Untersuchung fehlten morphologischen Anzeichen einer Sebadenitis.<br />
Patient 10:<br />
Die Ausgangsuntersuchung zeigte eine hochgradige Entzündungszellinfiltration an fast allen<br />
Haarfollikeln. Es waren keine Talgdrüsen mehr vorhanden und in den Haarfollikelinfundibula<br />
war eine mittelgradige Hyperkeratose zu erkennen. Bei der nächsten Kontrolluntersuchung<br />
zeigten <strong>die</strong> Biopsien noch vereinzelt geringgradige Entzündungszellinfiltrationen.<br />
Talgdrüsenkomplexe waren keine zu erkennen. Die Hyperkeratose in den Haarschäften war<br />
noch immer hochgradig. Bei den dritten Biopsien ergab <strong>die</strong> histologische Untersuchung eine<br />
geringgradige Entzündungszellinfiltration und weiterhin das fast vollständige Fehlen von<br />
Talgdrüsenkomplexen (ein Talgdrüsenkomplex auf 15 Haarfollikel). Die infundibuläre<br />
Hyperkeratose war hochgradig und <strong>die</strong> Haarfollikel befanden sich teils im Anagen und teils
Ergebnisse 71<br />
im Katagen. Auch zur Abschlußuntersuchung waren keine Talgdrüsen erkennbar. Es wurden<br />
erneut deutliche Entzündungsprozesse im Bereich der Haarfollikelisthmen nachgewiesen.<br />
Desweiteren lag eine hochgradige, infundibuläre Hyperkeratose vor.<br />
Patient 11:<br />
Die erste histologische Untersuchung ergab hauptsächlich mittelgradige, vereinzelt auch<br />
hochgradige, pyogranulomatöse, periadnexale Entzündungsprozesse mit vollständiger<br />
Destruktion der Talgdrüsen. Die infundibuläre Hyperkeratose war moderat ausgeprägt. Nach<br />
vier Monaten Cyclosporin A-Therapie waren nur noch leichte Entzündungszellinfiltrationen<br />
zu erkennen, und jeder zweite Haarfollikel wies Talgdrüsenkomplexe auf. Die Hyperkeratose<br />
in den Haarschäften war als mittelgradig zu bewerten. Nach weiteren vier Monaten waren<br />
keine Entzündungsprozesse mehr festzustellen und <strong>die</strong> infundibuläre Hyperkeratose war noch<br />
mehr zurückgegangen. Desweiteren waren einzelne gut entwickelte Talgdrüsenkomplexe zu<br />
beobachten. Nach zwölfmonatiger Cyclosporin A-Therapie waren keine periadnexalen<br />
Entzündungszellinfiltrationen mehr nachweisbar. Die meisten Haarfollikelkomplexe zeigten<br />
normale Talgdrüsen, und es war lediglich noch eine geringgradige infundibuläre<br />
Hyperkeratose zu erkennen. Nach dem Absetzten der Therapie wurden vier Monate später<br />
erneut Hautbiopsien entnommen, in denen sich eine hochgradige, periadnexale<br />
Entzündungszellinfiltration im Bereich der Talgdrüsen zeigte. Es wurde eine weitgehende<br />
Destruktion der Talgdrüsen bemerkt, assoziiert mit einer mittelgradigen, infundibulären<br />
Hyperkeratose.<br />
Patient 12:<br />
Die ersten histologischen Untersuchungen des Akita Inu wiesen eine mittel- bis hochgradige<br />
Entzündungszellinfiltration auf Höhe der Haarfollikelisthmen auf. Es waren keine<br />
Talgdrüsenkomplexe mehr vorhanden, und es zeigte sich eine geringgradige infundibuläre<br />
Hyperkeratose. Bei der nächsten Verlaufsuntersuchung war nur noch eine geringgradige<br />
Entzündungsreaktion festzustellen. In den Biopsien waren vereinzelt kleine<br />
Talgdrüsenkomplexe zu sehen. Die Hyperkeratose war noch immer mittelgradig ausgeprägt.<br />
Nach acht Monaten Cyclosporin A-Behandlung zeigten sich keine entzündlichen<br />
Veränderungen, und es waren 18% mehr Talgdrüsenkomplexe als in den Proben vom letzten
Ergebnisse 72<br />
Quartal nachweisbar. Die infundibuläre Hyperkeratose war noch immer als mittelgradig zu<br />
bewerten. Die Haarfollikel waren inaktiv. Bei der Abschlußuntersuchung gab es keine<br />
Anzeichen mehr für Entzündungsprozesse. Es waren viele gut entwickelte Talgdrüsen zu<br />
erkennen. Die infundibuläre Hyperkeratose war noch immer mittelgradig ausgeprägt. Die<br />
Haarfollikel befanden sich im telogenen Zyklusstadium.<br />
___________________________________________________________________________<br />
Abb. 13 (Seite 73): Veränderung der Entzündungsreaktionen im Bereich der<br />
Haarfollikelisthmen unter der Therapie mit Cyclosporin A.In Abbildung a) sind <strong>die</strong> Werte<br />
aller 12 Patienten individuell dargestellt, während b) den Mittelwert aus 12 Patienten und den<br />
„Standard Error of the Mean“ sowie <strong>die</strong> Irrtumswahrscheinlichkeit (p-Wert) wiedergibt.<br />
p < 0,001 = ***<br />
Zu a) Patient 3 entwickelt unter der Cyclosporin A Behandlung eine lichenoide Dermatitis, so<br />
dass trotz Verbesserung des klinischen Bildes der Sebadenitis <strong>die</strong> Behandlung ab dem achten<br />
Monat abgesetzt werden musste. Patient 7 konnte aus stu<strong>die</strong>nunabhängigen Gründen zum<br />
Zeitpunkt 12 Monate nicht histopathologisch untersucht werden.
Ergebnisse 73<br />
Abb. 13<br />
a)<br />
b)
Ergebnisse 74<br />
Betrachtet man für jeden einzelnen Parameter (Grad und Ausprägung der<br />
Entzündungsreaktion, Anzahl der Talgdrüsen pro Haarfollikel und infundibuläre<br />
Hyperkeratose) <strong>die</strong> Mittelwerte aus den 12 Patienten, so fällt folgendes auf:<br />
Die Entzündungsreaktionen im Bereich des Haarfollikelisthmus nehmen in den ersten vier<br />
Monaten der Therapie signifikant ab, etwa um zwei <strong>Dr</strong>ittel. Ab dem vierten Monat der<br />
Therapie ist keine weitere signifikante Abnahme der Entzündungsreaktionen mehr feststellbar<br />
(Abb. 13, Abb. 19, Abb. 20, Tabelle 3).<br />
Die Anzahl der Talgdrüsen pro Haarfollikel steigt innerhalb der ersten vier Monate unter der<br />
Therapie mit Cyclosporin A signifikant an. Dieser Anstieg setzt sich bis über den vierten<br />
Monat der Therapie fort. Allerdings fallen hierbei relativ große interindividuelle<br />
Schwankungen auf (Abb.14, Tabelle 7).<br />
Die infundibuläre Hyperkeratose, <strong>die</strong> semiquantitativ von 0 bis 3 beurteilt wurde, zeigte keine<br />
signifikante Änderung unter Cyclosporin A-Therapie (Abb. 15, Tabelle 8).<br />
___________________________________________________________________________<br />
Abb. 14 (Seite 75): Veränderung der Talgdrüsenanzahl pro Haarfollikel in Prozent unter der<br />
Therapie mit Cyclosporin A. In Abbildung a) sind <strong>die</strong> Werte aller 12 Patienten individuell<br />
dargestellt, während b) den Mittelwert aus 12 Patienten und den „Standard Error of the<br />
Mean“, sowie <strong>die</strong> Irrtumswahrscheinlichkeit (p-Wert) wiedergibt. p > 0,05 = nicht<br />
signifikant(n.s.); p < 0,001 = ***<br />
Zu a) Patient 3 entwickelt unter der Cyclosporin A Behandlung eine lichenoide Dermatitis, so<br />
dass trotz Verbesserung des klinischen Bildes der Sebadenitis <strong>die</strong> Behandlung ab dem achten<br />
Monat abgesetzt werden musste. Patient 7 konnte aus stu<strong>die</strong>nunabhängigen Gründen zum<br />
Zeitpunkt 12 Monate nicht histopathologisch untersucht werden.
Ergebnisse 75<br />
Abb. 14<br />
a)<br />
b)<br />
n.s.<br />
n.s.
Ergebnisse 76<br />
Abb. 15 (Seite 77): Veränderungen des Grades der histologisch festgestellten infundibulären<br />
Hyperkeratose unter der Therapie mit Cyclosporin A. Es werden <strong>die</strong> Mittelwerte aus 12<br />
Patienten und der „Standard Error of the Mean“, sowie <strong>die</strong> Irrtumswahrscheinlichkeit (p-<br />
Wert) dargestellt. p > 0,05 = nicht signifikant(n.s.)
Ergebnisse 77<br />
Abb. 15<br />
n.s.<br />
n.s.<br />
n.s.
Ergebnisse 78<br />
3.2.4 Immunhistologische Verlaufsuntersuchungen unter Cyclosporin A-Therapie<br />
3.2.4.1 Makrophagen<br />
Zu Beginn der Stu<strong>die</strong> zeigten <strong>die</strong> Patienten große interindividuelle Unterschiede in der Anzahl<br />
der Makrophagen, <strong>die</strong> sich im periadnexalen Gewebe auf Höhe der Talgdrüse darstellen<br />
ließen. Im Mittel wurden ca. elf Zellen pro Gesichtsfeld (40-fache Vergrößerung) gezählt. In<br />
den ersten vier Monaten der Therapie kam es zu einer signifikanten Abnahme der<br />
Makrophagenzahl, <strong>die</strong> sich auch über den vierten Monat hinweg fortsetzt. Nach<br />
zwölfmonatiger Therapie wurden im Mittel noch drei Zellen nachgewiesen. Bei keinem<br />
Patienten war <strong>die</strong> Zahl höher als vier. Dies entspricht im Mittel einer Abnahme von<br />
annähernd 90% (Abb. 16, 21, Tabelle 4).<br />
___________________________________________________________________________<br />
Abb. 16 (Seite 79): Veränderung der (Mac 387 + ) markierten Makrophagenanzahl pro<br />
Gesichtsfeld (40-fache Vergrößerung) im Bereich der Haarfollikelisthmen unter der Therapie<br />
mit Cyclosporin A. In Abbildung a) sind <strong>die</strong> Werte aller 12 Patienten individuell dargestellt,<br />
während b) den Mittelwert aus 12 Patienten und den „Standard Error of the Mean“, sowie <strong>die</strong><br />
Irrtumswahrscheinlichkeit (p-Wert) wiedergibt. p < 0,001 = ***<br />
Zu a) Patient 3 entwickelt unter der Cyclosporin A Behandlung eine lichenoide Dermatitis, so<br />
dass trotz Verbesserung des klinischen Bildes der Sebadenitis <strong>die</strong> Behandlung ab dem achten<br />
Monat abgesetzt werden musste. Patient 7 konnte aus stu<strong>die</strong>nunabhängigen Gründen zum<br />
Zeitpunkt 12 Monate nicht histopathologisch untersucht werden.
Ergebnisse 79<br />
Abb. 16<br />
a)<br />
b)<br />
*** n.s. n.s.
Ergebnisse 80<br />
3.2.4.2 MHC-Klasse II- Expression<br />
Antigene des Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHC) sind in entscheidendem Maße an<br />
der Regulation von Immunantworten beteiligt. Das MHC-Klasse II-Antigen , von dem<br />
mehrere Subtypen existieren, wird von antigenpräsentierenden Zellen exprimiert. Hierzu<br />
gehören nicht nur intraepitheliale Langerhans Zellen und perifollikuläre Makrophagen,<br />
sondern auch migrative Vorläufersta<strong>die</strong>n sowie einzelne Keratinozyten selbst.<br />
MHC Klasse II-exprimierende Zellen wurden zu Beginn der Stu<strong>die</strong> bei allen Tieren im<br />
Bereich der Haarfollikelisthmen nachgewiesen. Es waren sowohl intraepithelial als auch im<br />
perifollikulären Mesenchym positive Zellen nachweisbar. Die Zahl an immunreaktiven Zellen<br />
lag zu Beginn der Stu<strong>die</strong> bei <strong>durch</strong>schnittlich 28 Zellen pro Gesichtsfeld, wobei relativ große<br />
interindividuelle Schwankungen feststellbar waren. Die Anzahl an immunreaktiven Zellen<br />
nahm unter der Therapie kontinuierlich ab und erreichte nach zwölf Monaten Therapie<br />
<strong>durch</strong>schnittlich den Wert 13. Entsprechend wurden auch <strong>die</strong> interindividuellen<br />
Schwankungen kleiner. Fast alle Patienten zeigten eine Abnahme der MHC-II-positiven<br />
Zellen (Abb. 17, Abb. 22, Tabelle 5). Bei Patient 3 stieg, binnen der ersten acht Monate,<br />
leicht <strong>die</strong> Anzahl der MHC-II markierten Zellen an. Patient 4 zeigt eine deutliche temporäre<br />
Erhöhung der markierten Zellen nach dem ersten Quartal der Behandlung von<br />
<strong>durch</strong>schnittlich 20 markierten Zellen pro Gesichtsfeld auf <strong>durch</strong>schnittlich 46 markierte<br />
Zellen pro Gesichtsfeld. Bei Patient 6 kam es zum Zeitpunkt der ersten Nachkontrolle zu<br />
einem geringen Anstieg. Bei <strong>die</strong>sem Patienten fällt jedoch auf, daß <strong>die</strong> Werte ab dem achten<br />
Behandlungsmonat abnehmen.<br />
Abb. 17 (Seite 81) : Veränderung der (MHC II + ) Zellen pro Gesichtsfeld (40-fache<br />
Vergrößerung) im Bereich der Haarfollikelisthmen unter der Therapie mit Cyclosporin A. In<br />
Abbildung a) sind <strong>die</strong> Werte aller 12 Patienten individuell dargestellt, während b) den<br />
Mittelwert aus 12 Patienten und den „Standard Error of the Mean“ sowie <strong>die</strong><br />
Irrtumswahrscheinlichkeit (p-Wert) wiedergibt. p < 0,001 = ***<br />
Zu a) Patient 3 entwickelt unter der Cyclosporin A Behandlung ein immer größer werdendes<br />
Erythema multiforme, so dass trotz Verbesserung des klinischen Bildes der Sebadenitis <strong>die</strong><br />
Behandlung ab dem achten Monat abgesetzt werden musste. Patient 7 konnte aus<br />
stu<strong>die</strong>nunabhängigen Gründen zum Zeitpunkt 12 Monate nicht histopathologisch untersucht<br />
werden .
Ergebnisse 81<br />
Abb. 17<br />
a)<br />
b)<br />
*** n.s. n.s.
Ergebnisse 82<br />
3.2.4.3 CD3 Expression der T-Lymphozyten<br />
Zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung waren im Mittel 15 CD3 + -Zellen pro Gesichtsfeld<br />
im periadnexalen Gewebe nachweisbar; <strong>die</strong> interindividuellen Schwankungen waren mäßig.<br />
Unter Therapie fiel im Mittel eine deutliche Abnahme der markierten Zellen auf, insbesondere<br />
im ersten Quartal (im Durchschnitt um 47%). Im weiteren Verlauf kam es je Quartal noch mal<br />
zu einer weiteren Abnahme der Zellzahlen (Abb. 18, Abb. 23, Tabelle 2). Bei Patient 6 kam<br />
es jedoch im ersten Behandlungsquartal zu einer Erhöhung von CD3 markierten Zellen.<br />
Patient 8 zeigte zum Zeitpunkt des achten Behandlungsmonats eine leichte Zunahme der<br />
CD3 + -Zellen.<br />
Abb. 18 (Seite 83) : Veränderung der (CD3 + ) Zellen pro Gesichtsfeld (40-fache<br />
Vergrößerung) im Bereich der Haarfollikelisthmen unter der Therapie mit Cyclosporin A. In<br />
Abbildung a) sind <strong>die</strong> Werte aller 12 Patienten individuell dargestellt, während b) den<br />
Mittelwert aus 12 Patienten und den „Standard Error of the Mean“ sowie <strong>die</strong><br />
Irrtumswahrscheinlichkeit (p-Wert) wiedergibt.<br />
p > 0,05 = nicht signifikant (n.s.); p < 0,05 = *; p< 0,01 = **; p < 0,001 = ***<br />
Zu a) Patient 3 entwickelt unter der Cyclosporin A Behandlung eine lichenoide Dermatitis, so<br />
dass trotz Verbesserung des klinischen Bildes der Sebadenitis <strong>die</strong> Behandlung ab dem achten<br />
Monat abgesetzt werden musste. Patient 7 konnte aus stu<strong>die</strong>nunabhängigen Gründen zum<br />
Zeitpunkt 12 Monate nicht histopathologisch untersucht werden.
Ergebnisse 83<br />
Abb. 18<br />
a)<br />
b)<br />
*** n.s. n.s.
Ergebnisse 84<br />
3.2.5 Krankheitsverlauf nach zwölfmonatiger Cyclosporin A-Behandlung<br />
3.2.5.1 Beenden der Cyclosporin A-Therapie<br />
Die zwölfmonatige Cyclosporin A-Behandlung beendeten zehn Patienten mit deutlichen<br />
Verbesserungen des klinischen Bildes. Zwei Patienten (5, 9) fuhren mit der Cyclosporin A-<br />
Behandlung fort und der erreichte klinische Status blieb konstant. Bei den anderen zehn<br />
Patienten wurde <strong>die</strong> Cyclosporin A-Therapie abgesetzt. Zwei von <strong>die</strong>sen zehn Patienten<br />
erlitten deutliche klinische Rückfälle der Sebadenitis, welche auch histologisch verifiziert<br />
wurden. Bei beiden Tieren wurde <strong>die</strong> Cyclosporin A-Behandlung wieder aufgenommen. Die<br />
verbleibenden acht Hunde, bei denen <strong>die</strong> Cyclosporin A-Applikation gestoppt wurde, werden<br />
weiter topisch mit Ölen behandelt, wo<strong>durch</strong> der klinische Zustand teils gut gehalten wird. Bei<br />
einem Hund (Patient 2) kam es zu keinem erneuten Auftreten der Sebadenitis, ohne jegliche<br />
Form der Weiterbehandlung. Die Veränderungen der acht Tiere, welche das Medikament<br />
nach zwölfmonatiger Therapie abgesetzt haben, werden nachfolgend im Einzelnen<br />
beschrieben:<br />
Patient 1:<br />
Die Cyclosporin A-Therapie wurde bei dem Hovawart Ende März 2003 beendet, da es zum<br />
Ende der zwölfmonatigen Behandlung zu einer geringgradigen Verschlechterung des<br />
klinischen Bildes gekommen ist.<br />
Patient 2:<br />
Bei dem Mittelschnauzer wurde Ende Februar 2003 <strong>die</strong> Cyclosporin A-Therapie beendet. Zu<br />
<strong>die</strong>sem Zeitpunkt lagen sowohl klinisch, als auch histologisch keine Anzeichen mehr für eine<br />
Sebadenitis vor. Auch ein Vierteljahr später, konnten sowohl klinisch als auch histologisch<br />
keine Anzeichen für ein Wiederauftreten der Sebadenitis gefunden werden. Auch ein Jahr<br />
nach Beendigung der Stu<strong>die</strong> kam es zu keinem Wiederauftreten von Anzeichen einer<br />
Sebadenitis.
Ergebnisse 85<br />
Patient 3:<br />
Nach einer Arzneimittelreaktion wurde Cyclosporin A abgesetzt. Bis dahin war eine<br />
deutliche Verbesserung des Hautbildes festgestellt worden. Vier Monate nach dem Absetzten<br />
wurde das Tier erneut klinisch und histologisch untersucht. Klinisch wurde wieder eine<br />
deutliche Schuppung am Rumpf festgestellt, und erneut lagen auch deutliche periadnexale<br />
Entzündungszellinfiltrationen mit Destruktion der Talgdrüsen vor.<br />
Patient 4:<br />
Bei dem Berner-Sennenhund-Mischling wurde Mitte Juni 2003 NEORAL? abgesetzt. Der<br />
Hund wurde daraufhin topisch mit Öl behandelt. Die Patientenbesitzer äussern sich zufrieden<br />
über <strong>die</strong> verbesserte Fellqualität.<br />
Patient 6:<br />
Bei <strong>die</strong>sem Hovawart wurde Ende November 2003 <strong>die</strong> Cyclosporin A-Behandlung abgesetzt.<br />
Auf Grund der hohen Kosten bei einer Cyclosporin A-Anwendung nehmen <strong>die</strong> Besitzer eine<br />
Verschlechterung des klinischen Bildes in kauf und baden das Tier mit keratolytischen<br />
Shampoos.<br />
Patient 7:<br />
Bei <strong>die</strong>sem Akita Inu wurde Ende Dezember 2003 nach zwölfmonatiger Behandlung das<br />
Cyclosporin A abgesetzt. Sowohl klinisch als auch histologisch hat sich der Krankheitszusand<br />
wieder deutlich verschlechtert. Histiologisch sind im März wieder mittel- bis hochgradige,<br />
periadnexale Entzündungszellinfiltrationen mit fast vollständiger Destruktion der Talgdrüsen<br />
zu erkennen. Klinisch sind erneut verstärkte hyperkeratotische Veränderungen an den Ohren,<br />
Kopf und Schwanz zu erkennen. Aufgrund der hohen Kosten der Cyclosporin A- Behandlung<br />
wird das Tier seither topisch mit Ölen behandelt.<br />
Patient 8:<br />
Bei <strong>die</strong>sem Berner Sennenhund wurde Ende Dezember 2003 nach zwölfmonatiger<br />
Behandlung das Cyclosporin A abgesetzt. Das Tier wird seither topisch mit Ölen behandelt,
Ergebnisse 86<br />
und das klinische Bild hat sich teilweise verbessert und ist besser als unter Cyclosporin A-<br />
Therapie.<br />
Patient 10:<br />
Bei <strong>die</strong>sem Hovawart wurde <strong>die</strong> Cyclosporin A-Behandlung Ende November 2003 abgesetzt.<br />
In den ersten drei Monaten blieb der klinische Hautzustand mit Hilfe von regelmäßigen<br />
topischen Ölanwendungen stabil. Nach einer dann erfolgten klinischen Verschlechterung<br />
denken <strong>die</strong> Besitzer über eine erneute Aufnahme der Cyclosporin A-Behandlung nach.<br />
Patient 11:<br />
Bei dem kleinen Münsterländer wurde nach guten Erfolgen das Cyclosporin A Mitte März<br />
2003 abgesetzt. Vier Monate später wurde sowohl bei der klinischen, als auch bei der<br />
histologischen Untersuchung erneut eine Verschlechterung festgestellt. Klinisch wurde <strong>die</strong><br />
Hyperkeratose wieder deutlich stärker. Histologisch waren wieder hochgradige<br />
pyogranulomatöse Entzündungszellinfiltrationen im Bereich der Haarfolikelisthmen,<br />
assoziiert mit einer Destruktion der Talgdrüsen, zu erkennen. Seither erhält das Tier wieder<br />
Cyclosporin A in einer Dosierung von 5mg/kg KGW einmal täglich.<br />
Patient 12:<br />
Der Akita Inu beendete <strong>die</strong> zwölfmonatige Cyclosporin A-Behandlung im Dezember 2003.<br />
Sowohl klinisch als auch histologisch ist es schon nach drei Monaten wieder zu einer<br />
deutlichen Verschlechterung gekommen. Insbesondere an Kopf und Schwanz ist eine mittelbis<br />
hochgradige Hyperkeratose erkennbar. Histologisch sind deutliche<br />
Entzündungszellinfiltrationen im Bereich der Haarfollikelisthmen mit fast vollständiger<br />
Destruktion der Talgdrüsen zu erkennen. Auf Grund der hohen Kosten versuchen <strong>die</strong><br />
Patientenbesitzer trotzdem weiterhin das klinische Bild mit einer topischen Ölanwendung zu<br />
behandeln.
Ergebnisse 87<br />
3.2.5.2 Fortsetzen der Cyclosporin A-Therapie<br />
Patient 5:<br />
Aufgrund der guten klinischen Besserung unter der Cyclosporin A-Behandlung wurde <strong>die</strong><br />
Therapie fortgesetzt. Wegen der starken Gingivahyperplasie wird Cyclosporin A jedoch nur<br />
noch jeden zweiten Tag verabreicht. Seither ist der Zustand der Haut stabil.<br />
Patient 9:<br />
Bei <strong>die</strong>sem Berner Sennenhund wurde aufgrund der guten klinischen und histologischen<br />
Therapieerfolge <strong>die</strong> Cyclosporin A Behandlung fortgesetzt. Der klinische Zustand der Haut ist<br />
stabil.
Ergebnisse 88<br />
___________________________________________________________________________<br />
Abb. 19 (Seite 89):<br />
Histopathologie der Haut von Patient 12 unter Therapie mit Cyclosporin A.<br />
Abb. A: Vor der Behandlung: Deutliche perifollikuläre Entzündungszellinfiltrationen mit<br />
Destruktion der Talgdrüsen (Pfeil); Paraplasteinbettung; HE-Färbung; Eichstrich: 200 µm<br />
Kleines Bild: Übersichtsvergrößerung mit Markierung des Bildausschnittes der<br />
Vergrößerung.<br />
Abb. B: Nach viermonatiger Cyclosporin A-Therapie: Vollständiger Rückgang der<br />
Entzündungszellinfitration. Vereinzelte Sebozyten (Pfeile); Paraplasteinbettung; HE-Färbung;<br />
Eichstrich: 200 µm. Kleines Bild: Übersichtsvergrößerung<br />
Abb. C: Nach zwölfmonatiger Cyclosporin A-Therapie: Gut entwickelte Talgdrüsen (Pfeile)<br />
ohne Anzeichen von Degeneration und Entzündung; Paraplasteinbettung; HE-Färbung;<br />
Eichstrich: 200 µm
Ergebnisse 89<br />
A<br />
B<br />
C
Ergebnisse 90<br />
___________________________________________________________________________<br />
Abb. 20 (Seite 91):<br />
Histopathologie der Haut von Patient 3 unter Cyclosporin A-Therapie.<br />
Abb. A: Vor Therapiebeginn: Deutliche perifollikuläre Entzündungszellinfiltrationen mit<br />
Destruktion der Talgdrüsen (Pfeil); Paraplasteinbettung; HE-Färbung; zehnfache<br />
Vergrößerung, Eichstrich: 200 µm.<br />
Abb. B: Ausschnittsvergrößerung (40-fache Vergrößerung) von Abb. A; nur noch einzelne<br />
Sebozyten erkennbar (Pfeil); Paraplasteinbettung; HE-Färbung, Eichstrich: 200 µm.<br />
Abb. C: Nach achtmonatiger Cyclosporin A-Therapie: Vollständiger Rückgang der<br />
Entzündungszellinfitration und gut entwickelte Talgdrüsen (Pfeil); Paraplasteinbettung; HE-<br />
Färbung; zehnfache Vergrößerung, Eichstrich: 200 µm.
Ergebnisse 91<br />
Abb. 20:<br />
A<br />
B
Ergebnisse 92<br />
___________________________________________________________________________<br />
Abb. 21 (Seite 93):<br />
Perifollikuläre Infiltration von Makrophagen (MAC 387 + ) bei Patient 5.<br />
(A) Zu Beginn der Cyclosporin A-Behandlung. (B) Nach viermonatiger Behandlung.<br />
Abb. A: Zahlreiche Mac 387 markierte Makrophagen (Pfeile); Paraplasteinbettung; Mac 387-<br />
Färbung; zehnfache Vergrößerung, Eichstrich: 200 µm.<br />
Abb. B: Nur noch vereinzelt markierte Makrophagen (Pfeile); Paraplasteinbettung; Mac 387-<br />
Färbung, 20fache Vergrößerung, Eichstrich: 200 µm.<br />
TG=Talgdrüse
Ergebnisse 93<br />
Abb. 21:
Ergebnisse 94<br />
___________________________________________________________________________<br />
Abb. 22 (Seite 95):<br />
MHC Klasse II-Expression in der Haut von Patient 2. (A) vor der Behandlung mit<br />
Cyclosporin A. (B) und (C) nach achtmonatiger Cyclosporin A-Therapie, sowie Abbildung<br />
(D) nach zwölf Monaten Therapie.<br />
Abb. A: Viele MHC II-markierte Zellen; überwiegend perifollikulär.<br />
Paraplasteinbettung; MHC II-Färbung, zehnfache Vergrößerung, Eichstrich: 200 µm.<br />
Abb. B: Deutlich weniger MHC II-markierte Zellen nach acht Monaten Therapie.<br />
Paraplasteinbettung; MHC II-Färbung, zehnfache Vergrößerung, Eichstrich: 200 µm.<br />
Abb. C: Ausschnittsvergrößerung (40fache Vergrößerung) der Abb. B; MHC II-Färbung,<br />
Eichstrich: 200 µm<br />
Abb. D: Nur noch wenige MHC II-markierte Zellen im Isthmusbereich der Haarfollikel,<br />
Paraplasteinbettung; MHC II-Färbung; 20fache Vergrößerung, Eichstrich: 200 µm.
Ergebnisse 95<br />
Abb. 22:
Ergebnisse 96<br />
___________________________________________________________________________<br />
Abb. 23 (Seite 97):<br />
CD3 + T-Zellen in der Haut von Patient Nr. 9. (A) Zu Beginn der Behandlung mit Cyclosporin<br />
A. (B) Nach zwölfmonatiger Cyclosporin A-Therapie.<br />
Abb. A: Viele CD3 + T-Zellen im periadnexalen Bereich; Eichstrich: 200 µm.<br />
Abb. B: Wenige CD3 + T-Zellen im periadnexalen Bereich,<br />
TG = Talgdrüse; Eichstrich: 200 µm.
Ergebnisse 97<br />
Abb. 23:<br />
B<br />
TG
Diskussion 98<br />
4. Diskussion<br />
Die idiopathische Sebadenitis des Hundes stellt eine immunvermittelte, entzündliche<br />
Destruktion der Talgdrüsen dar. Sekundär kommt es bei chronischem Verlauf oft zu einer<br />
verminderten Haarwuchsaktivität. Eine kausale Therapiemöglichkeit besteht bisher nicht. Die<br />
derzeit eingesetzten Medikamente (topisches Propylenglykol, orale Retinoide, orale<br />
Glukokortikoide) können das klinische Bild nur begrenzt beeinflussen und haben zudem<br />
unerwünschte Wirkungen. Cyclosporin A (NEORAL? ) scheint deshalb als Therapeutikum<br />
für <strong>die</strong> Sebadenitis des Hundes geeignet, weil es nicht nur <strong>die</strong> T -Zell-vermittelte<br />
Immunantwort moduliert (BOREL 1988), sondern zudem auch einen das Haarwachstum<br />
stimulierenden Effekt besitzt (MAURER et al. 1997; GAFTER-GVILI et al. 2003). Ziel der<br />
vorliegenden Untersuchungen war herauszufinden, welchen Einfluß Cyclosporin A auf <strong>die</strong><br />
idiopathische Sebadenitis des Hundes hat. In der vorliegenden Stu<strong>die</strong> wurden zwölf Hunde<br />
mit idiopathischer Sebadenitis über einen Zeitraum von zwölf Monaten mit Cyclosporin A<br />
(5mg/kg KGW/d) behandelt. Im Abstand von vier Monaten wurden mittels eines<br />
standardisierten Bewertungssystems, klinische, histologische und immunhistologische<br />
Parameter bestimmt, um den Krankheitsverlauf unter der Therapie objektiv zu beurteilen.<br />
4.1 Betrachtung des Patientenmaterials<br />
Naturgemäß liegt der Stu<strong>die</strong> ein sehr heterogenes Patientenmaterial zugrunde. Die zwölf Tiere<br />
gehören verschiedenen Rassen an (Akita Inu, Hovawart, Berner Sennenhund,<br />
Mittelschnauzer, Kleiner Münsterländer, Mischling) und sind bezüglich Geschlecht und Alter<br />
unterschiedlich. REICHLER et al. (2001) beschreiben Rasseunterschiede im klinischen<br />
Erscheinungsbild der Sebadenitis des Hundes, weshalb es denkbar ist, daß sich <strong>die</strong>se<br />
Unterschiede auch in der Wirksamkeit der Cyclosporin A-Behandlung widerspiegeln. In der<br />
vorliegenden Untersuchung stellte sich jedoch, zumindest temporär, bei allen Patienten eine<br />
Verbesserung des Krankheitsbildes ein, und ein von der Rasse abhängiger Therapieerfolg<br />
konnte nicht beobachtet werden. Weitere Divergenzen zwischen den Patienten sind
Diskussion 99<br />
jahreszeitliche Unterschiede bezüglich des Eintritts in <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>, eine variierende Dauer der<br />
Krankheitsgeschichte und <strong>die</strong> damit verbundenen Vorbehandlungen.<br />
4.2 Betrachtung der Methodik<br />
Der Grad und <strong>die</strong> Ausprägung der klinischen und histologischen Veränderungen waren bei<br />
den einzelnen Patienten zum Teil sehr verschieden. Zur Auswertung des klinischen Verlaufs<br />
wurden deshalb alle bei den Nachuntersuchungen ermittelten Werte auf <strong>die</strong> Ausgangswerte<br />
(100%) bezogen.<br />
Grundsätzlich wurde bei der Beurteilung des Krankheitsverlaufs zwischen einem klinischen<br />
und einem histologischen Krankheitsstatus unterschieden. Diese setzen sich wiederum aus<br />
verschiedenen Einzelmerkmalen zusammen.<br />
Zur Beurteilung des Therapieerfolgs wurden verschiedene Parameter erhoben. Die klinischen<br />
Parameter follikuläre Hyperkeratose, Alopezie und Follikulitis wurden nach Beurteilung von<br />
Schweregrad und Verteilungsmuster in einem klinischen Gesamtparameter<br />
zusammengezogen. Dieser als „Krankheitsstatus“ bezeichnete Parameter spiegelt recht<br />
zuverlässig den subjektiven Eindruck des Krankheitsbildes bei der Sebadenitis wieder.<br />
Histologisch wurden <strong>die</strong> Ausprägung von periadnexalen Entzündungsreaktionen, <strong>die</strong> Anzahl<br />
von intakten Talgdrüsen bezogen auf <strong>die</strong> Anzahl von Haarfollikeln in der jeweiligen Biopsie,<br />
und <strong>die</strong> Ausprägung der infundibulären Hyperkeratose semiquantitativ erfasst. Dabei zeigt<br />
sich eine gute Korrelation zwischen dem klinischen Bild und der Ausprägung von<br />
Entzündungsprozessen, sowie der Anzahl intakter Talgdrüsen.<br />
Bei der histologischen Beurteilung fiel auf, daß nicht alle Einzelmerkmale gleich gewichtet<br />
werden können. Deshalb wurden <strong>die</strong> Parameter Entzündungsreaktion, Anzahl der Talgdrüsen<br />
und infundibuläre Hyperkeratose einzeln betrachtet. Bei der Auswertung der Mittelwerte der<br />
infundibulären Hyperkeratose werden keine Veränderungen im Verlaufe der zwölfmonatigen<br />
Cyclosporin A- Behandlung festgestellt, so daß bei der histologischen Beurteilung <strong>die</strong>ser<br />
Parameter vernachlässigt werden kann. Es hat sich jedoch gezeigt, daß mit den in <strong>die</strong>ser<br />
Stu<strong>die</strong> angewandten Verfahren und Parametern (klinischer Krankheitsstatus,
Diskussion 100<br />
Entzündungsreaktion und Anzahl der Talgdrüsen pro Haarfollikel) der Krankheitsverlauf<br />
einer caninen Sebadenitis realitätsnah wiedergegeben werden kann.<br />
Zusätzlich zu den oben genannten Parametern wurden Zellen, <strong>die</strong> eine wichtige Rolle in der<br />
Pathogenese der Sebadenitis spielen, eingehend morphometrisch untersucht. Die Antigene<br />
des Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHC) sind in entscheidendem Maße an der<br />
Regulation von Immunantworten beteiligt. Das MHC-Klasse II-Antigen, von dem mehrere<br />
Subtypen existieren, wird von den antigenpräsentierenden Zellen exprimiert. Hierzu gehören<br />
nicht nur intraepitheliale Langerhans-Zellen und perifollikuläre Makrophagen, sondern auch<br />
migrative Vorläufersta<strong>die</strong>n sowie einzelne Keratinozyten selbst. Die Menge an MHC-Klasse<br />
II- exprimierenden Zellen sagt deshalb etwas über <strong>die</strong> Intensität der Antigenpräsentation aus<br />
und stellt damit indirekt einen Parameter für <strong>die</strong> Entzündungsreaktion im Verlauf der<br />
Autoaggression dar.<br />
CD3 ist assoziiert mit dem Antigenrezeptor von T-Zellen und notwendig für <strong>die</strong><br />
Zelloberflächenexpression und Signalübertragung von T-Zellen. Die Anzahl der CD3-<br />
markierten Zellen spiegelt daher direkt <strong>die</strong> Intensität der Entzündungsreaktion gegen <strong>die</strong><br />
Talgdrüsen wieder.<br />
Mac 387 ist ein Antigen zur immunhistochemischen Darstellung von Makrophagen, welche<br />
sowohl als antigenpräsentierende Zellen sowie als Effektorzellen bei humoralen und<br />
zellulären Immunreaktionen fungieren. Somit stellen <strong>die</strong> so markierten Zellen ebenfalls einen<br />
Parameter für <strong>die</strong> Entzündungsreaktion <strong>die</strong>ser Autoaggression dar.
Diskussion 101<br />
4.3 Betrachtung der Ergebnisse<br />
Bei Patient 1 liegt eine gute Korrelation aller erhobenen Parameter vor. Die Besserung des<br />
klinischen Bildes spiegelt sich in der verminderten Entzündung und in der Abnahme an<br />
Makrophagen, T-Lymphozyten und MHC-Klasse II-exprimierenden Zellen wieder. Eine<br />
deutliche Zunahme an Talgdrüsenzellen tritt unter der Behandlung allerdings nicht auf. Bei<br />
<strong>die</strong>sem Tier fallen zu Beginn der Stu<strong>die</strong> relativ viele Makrophagen bei gleichzeitig wenigen<br />
T-Lymphozyten auf. Unter Behandlung nimmt <strong>die</strong> Zahl an Makrophagen jedoch sehr rasch<br />
ab. Die minimale Verschlechterung des klinischen Bildes zum Ende der Stu<strong>die</strong> ist nicht mit<br />
einem entsprechenden Anstieg an Entzündungszellen verbunden und ist deshalb nicht auf eine<br />
Verschlechterung der Sebadenitis zurückzuführen. Auch bei Patient 2 korrelieren <strong>die</strong><br />
erhobenen Parameter gut. Dieser Patient weist zu Beginn der Stu<strong>die</strong> eine hohe Anzahl an<br />
periadnexalen Entzündungszellen auf, <strong>die</strong> jedoch innerhalb der ersten vier<br />
Behandlungsmonate stark zurückgeht. Gleichzeitig kommt es zu einer sehr ausgeprägten<br />
Zunahme an Talgdrüsen. Bereits nach acht Monaten Therapie ist <strong>die</strong> Haut nahezu ausgeheilt.<br />
Bei <strong>die</strong>sem Patienten wurde nach zwölf Monaten <strong>die</strong> Therapie mit Cyclosporin A nicht<br />
fortgesetzt. Trotzdem kam es auch im Laufe weiterer vier Monate nicht zu einem erneuten<br />
Auftreten der Symptome. Patient 3 zeigt eine deutliche klinische Besserung innerhalb der<br />
ersten vier Behandlungsmonate, assoziiert mit einer Abnahme an Makrophagen und T-<br />
Lymphozyten und einer Zunahme an Talgdrüsenkomplexen. Allerdings nimmt bei <strong>die</strong>sem<br />
Patienten <strong>die</strong> Zahl der MHC-Klasse II-exprimierenden Zellen stetig zu, und nach acht<br />
Monaten Behandlung tritt eine adverse Arzneimittelreaktion in Form einer lichenoiden<br />
Dermatitis auf. Es ist denkbar, daß <strong>die</strong> verstärkte Expression von MHC-Klasse II in<br />
Zusammenhang steht mit der Entwicklung der lichenoiden Dermatitis, bei der es sich um eine<br />
Autoimmunreaktion handelt. Patient 4 zeigt eine deutliche klinische Besserung während der<br />
ersten acht Behandlungsmonate. Dies korreliert nur teilweise mit einer Abnahme an<br />
Makrophagen und T-Lymphozyten. Im vierten Behandlungsmonat kommt es zu einer<br />
Zunahme an periadnexalen Entzündungsprozessen, was mit einer Zunahme an MHC-Klasse<br />
II–exprimierenden Zellen assoziiert ist. Allerdings ist keine Zunahme an Makrophagen und T-<br />
Lymphozyten erkennbar. Die starke Verschlechterung des klinischen Bildes zum Ende der<br />
Stu<strong>die</strong> geht nicht mit einer Zunahme an Entzündungsreaktionen einher, spiegelt sich aber in
Diskussion 102<br />
einer erneuten Abnahme intakter Talgdrüsenkomplexe wider. Der plötzlich aufgetretene<br />
Pruritus bei <strong>die</strong>sem Patienten deutet möglicherweise auf weitere Hauterkrankungen hin, <strong>die</strong><br />
mit der Sebadenitis in keinem direkten Zusammenhang stehen. Bei Patient 5 korrelieren <strong>die</strong><br />
Untersuchungsparameter recht gut. Die klinische Besserung wird von einer Abnahme der<br />
Entzündungsprozesse und einer Zunahme der intakten Talgdrüsenkomplexe begleitet. Zu<br />
Beginn der Stu<strong>die</strong> sind relativ wenig Makrophagen nachweisbar, so daß T-Lymphozyten in<br />
den Entzündungsprozessen dominieren. Auch Patient 6 zeigt eine deutliche klinische<br />
Besserung, verbunden mit einer Abnahme der Entzündungsprozesse (insbesondere der<br />
Makrophagen) und einer, wenn auch nur mäßigen, Zunahme intakter Talgdrüsenkomplexe.<br />
Der minimale Anstieg des Krankheitsstatus zum Ende der Stu<strong>die</strong> geht nicht mit einer<br />
Zunahme an Entzündungsprozessen einher. Bei Patient 7 liegt weitestgehend eine gute<br />
Korrelation aller erhobenen Untersuchungsparameter vor. Die klinisch auffallende<br />
Verschlechterung zum achten Behandlungsmonat geht jedoch nicht mit einer entsprechenden<br />
Zunahme an Entzündungsprozessen oder einer Abnahme an Talgdrüsenkomplexen einher,<br />
weshalb nicht anzunehmen ist, daß es sich um eine Verschlechterung der Sebadenitis handelt.<br />
Wahrscheinlich ist, daß sekundäre Faktoren den Hautzustand beeinflusst haben. Die starke<br />
klinische Verschlechterung hängt möglicherweise mit der Jahreszeit zusammen. Die<br />
Verschlechterung des Hautzustands trat im Juli 2003 auf, welcher ungewöhnlich heiß und<br />
feucht war. Nach dem Abklingen der sommerlichen Temperaturen besserte sich das klinische<br />
Bild wieder, ohne daß zusätzliche Maßnahmen ergriffen wurden. Es ist bekannt, daß eine<br />
erhöhte Luftfeuchtigkeit <strong>die</strong> Keratinozyten im Haarfollikelinfundibulum beeinflussen kann<br />
(CUNLIFFE 1992), wo<strong>durch</strong> möglicherweise eine Hyperkeratose begünstigt wird.<br />
Patient 8 zeigt unter der Therapie keine deutliche Abnahme in der Zahl von Makrophagen<br />
und T-Lymphozyten. Die MHC-Klasse II –Expression nimmt hingegen deutlich ab. Bei<br />
<strong>die</strong>sem Hund wurde <strong>die</strong> Behandlung nach dem achten Behandlungsmonat mehrfach<br />
unterbrochen. Diese Unterbrechungen fanden aufgrund anderer Erkrankungen (Verdacht auf<br />
Borreliose und absze<strong>die</strong>rende bakterielle Entzündung des Weichteilgewebes) statt. In Folge<br />
der Therapieunterbrechung verschlechterte sich das Krankheitsbild <strong>die</strong>ses Patienten, was nicht<br />
nur den klinischen Krankheitsstatus ansteigen ließ, sondern auch <strong>die</strong> Zahl der intakten<br />
Talgdrüsenkomplexe verringerte. Eine deutliche Zunahme an entzündlichen Veränderungen<br />
wurde allerdings nicht beobachtet. Nach erneutem Einsetzen der Therapie konnte dann der
Diskussion 103<br />
vorher gute Hautzustand nicht mehr erreicht werden. Ursache für den mangelhaften<br />
Therapieerfolg scheint hier also eine diskontinuierliche Medikamenteneinnahme zu sein.<br />
Dieser Hund wies zu Beginn der Stu<strong>die</strong> eine dreijährige Krankheitsgeschichte auf und war<br />
über mindestens zwei Jahre mit Prednisolon vorbehandelt worden. Aufgrund der<br />
Glukokortikoid-Behandlungen waren <strong>die</strong> meisten Haarfollikel zu Beginn der Stu<strong>die</strong> im<br />
Telogen. Die deutliche klinische Besserung innerhalb der ersten vier Behandlungsmonate ist<br />
deshalb möglicherweise zum Teil auf <strong>die</strong> Anagen-stimulierende Wirkung von Cyclosporin A<br />
zurückzuführen. Nach viermonatiger Behandlung mit Cyclosporin A war bei <strong>die</strong>sem<br />
Patienten eine deutliche Verbesserung des Haarwachstums festzustellen. Dies korrelierte<br />
histologisch mit einer hohen Anzahl anagener Haarfollikel. Bei Patient 9 besteht eine gute<br />
Korrelation zwischen der Besserung des klinischen Bildes und der Abnahme der<br />
Entzündungsprozesse sowie der Zunahme an Talgdrüsenkomplexen. Patient 10 zeigt eine<br />
temporäre Verschlechterung des klinischen Bildes um den achten Behandlungsmonat herum.<br />
Diese Verschlechterung korreliert nicht mit einer Zunahme an Entzündungszellen oder einer<br />
Abnahme an Talgdrüsen, weshalb nicht von einer Verschlechterung der Sebadenitis<br />
auszugehen ist. Der Patient 10 reagiert im letzten Behandlungsquartal mit einer starken<br />
Erhöhung der Entzündungsreaktionen, welche aber bei der Zählung der Makrophagen, MHC-<br />
Klasse-II exprimierenden Zellen und CD3 markierten Zellen nicht widergespiegelt wird.<br />
Bei Patient 11 kommt es zu einer deutlichen klinischen Verbesserung, assoziiert mit einer<br />
deutlichen Zunahme an Talgdrüsenkomplexen und einer Verminderung der<br />
Entzündungsreaktionen, wobei zu Beginn der Stu<strong>die</strong> relativ viele Makrophagen vorlagen,<br />
deren Zahl unter Therapie sehr deutlich abnimmt. Nach Beendigung der zwölf Monate wurde<br />
Cyclosporin A bei <strong>die</strong>sem Patienten abgesetzt. Innerhalb von vier Monaten entwickelte sich<br />
daraufhin ein Rezidiv mit einer deutlichen Entzündungszellinfiltration und einer Destruktion<br />
der Talgdrüsenkomplexe. Auch bei Patient 12 ist eine gute Korrelation zwischen dem<br />
klinischen Krankheitsstatus und den anderen erhobenen Parametern erkennbar. Es kommt zu<br />
einer deutlichen Zunahme von Talgdrüsenkomplexen.<br />
Cyclosporin A (NEORAL ®) führte im Mittel aller Patienten zu einer signifikanten<br />
Verbesserung des Krankheitsbildes. Alle zwölf Patienten zeigen nach vier Monaten<br />
Behandlungsdauer eine Abnahme des klinischen Krankheitsstatus. Dabei beträgt das
Diskussion 104<br />
Krankheitsbild im Mittel nur noch 42% des Ausgangswertes. Auch nach achtmonatiger<br />
Behandlung zeigen alle Patienten einen geringeren Krankheitsstatus als zu Beginn der<br />
Therapie. Hier liegt im Mittel ein Krankheitsstatus vor, der 35% des Ausgangswertes beträgt.<br />
Nach zwölf Monaten Therapie zeigen zehn von zwölf Patienten eine deutliche Verbesserung<br />
des klinischen Hautzustands. Der Krankheitsstatus liegt nur noch zwischen 5% und 39%. Die<br />
deutliche Besserung des klinischen Bildes korreliert mit der Abnahme der periadnexalen<br />
Entzündungsprozesse, welche wiederum auf einer Abnahme an Makrophagen, T-<br />
Lymphozyten und MHC-Klasse II-exprimierenden Zellen basiert. Folglich ist davon<br />
auszugehen, daß Cyclosporin A aufgrund seiner immunmodulatorischen Eigenschaften in der<br />
Lage ist, <strong>die</strong> Entzündungsprozesse zu minimieren. Dies dürfte in erster Linie auf <strong>die</strong> Wirkung<br />
von Cyclosporin A auf T-Zellen zurückzuführen sein, und ist ein weiteres Indiz dafür, daß es<br />
sich bei der idiopathischen Sebadenitis des Hundes um eine T-Zell vermittelte<br />
Autoaggressionserkrankung handelt (RYBNICEK et al. 1998). Gleichzeitig kommt es zu<br />
einer Zunahme intakter Talgdrüsenkomplexe. Dies ist ein Indiz dafür, daß sich <strong>die</strong> Talgdrüsen<br />
regenerieren können, sobald sie nicht mehr von Entzündungszellen attackiert werden. Die<br />
Besserung des klinischen Bildes dürfte demzufolge nicht nur auf eine Abnahme der<br />
entzündlichen Veränderungen, sondern auch auf eine gesteigerte Funktionalität der<br />
Talgdrüsen zurückzuführen sein. Die Hyperkeratose im Haarfollikelinfundibulum wird <strong>durch</strong><br />
<strong>die</strong> gesteigerte Talgdrüsenfunktion jedoch offensichtlich nicht beeinflußt. Zumindest ist ein<br />
Einfluß histopathologisch nicht verifizierbar. Zur Besserung des klinischen Bildes könnte<br />
desweiteren <strong>die</strong> Eigenschaft von Cyclosporin A beitragen, das Haarwachstum zu stimulieren.<br />
In der Tat sind bei vielen Patienten nach vier Monaten Therapie mehr anagene Haarfollikel<br />
nachweisbar als vor der Behandlung.<br />
Insgesamt ist also bei allen Patienten eine deutliche Besserung des Hautzustands <strong>durch</strong><br />
Cyclosporin A zu beobachten, doch <strong>die</strong> interindividuellen Schwankungen sind groß und<br />
bedürfen einer näheren Betrachtung. Es ist denkbar, daß <strong>die</strong> Dauer des Krankheitsgeschehens<br />
vor Initierung der Cyclosporin A-Therapie eine Auswirkung auf den Erfolg der Behandlung<br />
hat. Es gibt Indizien dafür, daß <strong>die</strong> Erfolgschancen einer Cyclosporin A-Therapie bei sehr<br />
chronischen Erkrankungen, bei denen bereits sehr viele Talgdrüsen zerstört worden sind und<br />
kaum noch Entzündungsprozesse vorliegen, geringer sind als bei akuter und subchronischer<br />
Sebadenitis. Bei drei Wurfgeschwistern der Rasse Hovawart, <strong>die</strong> alle eine
Diskussion 105<br />
Krankheitsgeschichte von über drei Jahren aufwiesen, waren mittels Cyclosporin A innerhalb<br />
von vier Monaten kaum klinische Veränderungen zu induzieren (R. Hämmerling, pers.<br />
Mitteilung). Es ist zu vermuten, daß Cyclosporin A keinen Einfluß mehr auf <strong>die</strong> Sebadenitis<br />
hat, wenn bereits <strong>die</strong> Talgdrüsen vollständig zerstört und <strong>die</strong> Entzündungsprozesse<br />
abgeklungen sind. Systematische Untersuchungen hierüber gibt es aber nicht und waren auch<br />
nicht Gegenstand der hier beschriebenen Stu<strong>die</strong>.<br />
Interessant ist desweiteren, in welchem Maße es überhaupt zu einer Regeneration von einmal<br />
zerstörten Talgdrüsen kommen kann. In der vorliegenden Untersuchung fällt auf, daß bei<br />
nahezu allen Patienten <strong>die</strong> Zahl intakter Talgdrüsenkomplexe pro Haarfollikel unter<br />
Behandlung mit Cyclosporin A zunimmt. Im Mittel ist nach vier Monaten Behandlung eine<br />
Zunahme auf das 13,5-fache zu verzeichnen. Dies ist ein klares Indiz dafür, daß <strong>die</strong><br />
Talgdrüsen in der Tat in der Lage sind, sich zu regenerieren. Ob <strong>die</strong>se Regeneration von<br />
undifferenzierten Stammzellen im Haarfollikelepithel ausgeht oder von noch vorhandenen<br />
Reservezellen in der Peripherie der Talgdrüsen läßt sich mit <strong>die</strong>ser Untersuchung nicht sagen.<br />
Die Ergebnisse <strong>die</strong>ser Stu<strong>die</strong> zeigen, daß Cycosporin A <strong>die</strong> Autoaggressionsreaktion gegen<br />
Talgdrüsen unterdrücken kann, und somit in der Lage ist, <strong>die</strong> Erkrankung zu kontrollieren.<br />
Gleichzeitig kommt es zu einer vermutlichen Regeneration der Talgdrüsen. Von großer<br />
Bedeutung ist <strong>die</strong> Frage, ob <strong>die</strong> Therapie mit Cyclosporin A lebenslang fortgesetzt werden<br />
muß, oder ob <strong>die</strong> Therapie abgesetzt werden kann, sobald <strong>die</strong> Entzündungsreaktionen<br />
unterdrückt sind und sich das Hautgewebe regeneriert hat. Bei einem Patienten (2) sind nach<br />
Absetzen der Therapie innerhalb von vier Monaten tatsächlich keine Rezidive aufgetreten.<br />
Bei Patient 3 und 12 jedoch traten innerhalb von drei Monaten nach Absetzen des<br />
Cyclosporin A erneut eindeutige Anzeichen einer akuten Sebadenitis auf. Daraus ist zu<br />
folgern, daß in den meisten Fällen eine lebenslange Therapie mit Cyclosporin A notwendig<br />
ist, um <strong>die</strong> Krankheitsprozesse zu kontrollieren und ein erneutes Auftreten der Erkrankung zu<br />
verhindern. Eine derart chronische Anwendung von NEORAL® hat zum einen den Nachteil<br />
sehr hoher Kosten. Hier ist zu überlegen und experimentell zu überprüfen, ob <strong>die</strong> Dosis<br />
reduziert werden kann, indem entweder niedrigere Dosen (z.B. 2,5 mg/kg/d) täglich gegeben<br />
werden, oder indem <strong>die</strong> Applikation auf jeden 2. Tag beschränkt wird (SCOTT et al. 2001).
Diskussion 106<br />
Zum anderen sind derartige Überlegungen auch deshalb wichtig, weil eine chronische<br />
Anwendung von Cyclosporin A Risiken unerwünschter Arzneimittelwirkungen birgt. Zu den<br />
in <strong>die</strong>ser Stu<strong>die</strong> am häufigsten aufgetretenen Nebenwirkungen zählen <strong>die</strong> Hypertrichose und<br />
<strong>die</strong> gingivale Hyperplasie. Die Hypertrichose tritt vorwiegend im Zehenbereich auf, trägt<br />
aber, sofern sie am Rumpf erkennbar wird, auch zur klinischen Besserung des Hautzustands<br />
bei. Eine gingivale Hyperplasie wurde bei zwei der zwölf Patienten beobachtet. In <strong>die</strong>sen<br />
Fällen verursachten sie keine funktionellen Störungen. Eine Nephrotoxizität wurde bei den<br />
hier untersuchten Patienten nicht festgestellt und bestätigt somit <strong>die</strong> Aussage von AICHER<br />
(1998) über das sehr geringe Potential der Nephrotoxizität von Cyclosporin A bei Hunden.<br />
Eine weitere potentielle Nebenwirkung von Cyclosporin A ist Erbrechen (WHITE 1986).<br />
Erbrechen wurde bei den Patienten 10 und 11 beobachtet. Bei Patient 3 wurde nach<br />
achtmonatiger Anwendung von Cyclosporin A eine lichenoide Dermatitis nachgewiesen, <strong>die</strong><br />
nach Absetzen des Präparates verschwand und deshalb wahrscheinlich als<br />
Arzneimittelreaktion aufgefaßt werden muß. Weitere Nebenwirkungen sind in der<br />
Anwendung über zwölf Monate nicht aufgetreten. Die Behandlung der Sebadenitis mit 5<br />
mg/kg/d Cyclosporine A kann deshalb als relativ sicher angesehen werden, und scheint der<br />
Anwendung von Retinoiden oder Glukokortikoiden deutlich überlegen.<br />
Aufgrund der dargestellten Ergebnisse muß Cyclosporin A zur Zeit als das Medikament der<br />
Wahl bei der Behandlung der akuten und subakuten idiopathischen Sebadenitis des Hundes<br />
angesehen werden. Es scheint dem systemischen und alleinigen Einsatz von Glukokortikoiden<br />
oder Retinoiden überlegen zu sein und weist gleichzeitig ein geringeres Potential für<br />
unerwünschte Wirkungen auf. Ob mittels einer konsequenten topischen Therapie ein<br />
gleichwertiger klinischer Erfolg zu erzielen ist, und ob sich <strong>durch</strong> Kombination <strong>die</strong>ser beiden<br />
Therapieverfahren deren Effizienz steigern läßt, muß in weiteren Stu<strong>die</strong>n untersucht werden.<br />
Die Limitierungen in der Anwendung von Cyclosporin A liegen zum einen in den hohen<br />
Kosten der Therapie und in der Langzeitanwendung, <strong>die</strong> vermutlich notwendig ist, um ein<br />
Auftreten von Rezidiven zu verhindern. Hier stehen weitere Untersuchungen bezüglich einer<br />
minimalen Dosis und eines optimierten Therapieschemas aus.
Zusammenfassung 107<br />
5. Zusammenfassung<br />
Christina Boss (2004)<br />
Untersuchung zur Therapie der idiopathischen Sebadenitis des Hundes mittels<br />
Cyclosporin A (NEORAL ®)<br />
Die idiopathische Sebadenitis des Hundes ist eine immunvermittelte, entzündliche<br />
Destruktion der Talgdrüsen. Es handelt sich um eine seltene Erkrankung, von der viele<br />
verschiedene Rassen und Mischlinge betroffen sein können. Die bisher eingesetzten<br />
Medikamente (topisches Propylenglykol, orale Retinoide, orale Glukokortikoide) können das<br />
klinische Bild nur begrenzt beeinflussen und haben zudem unerwünschte Nebenwirkungen.<br />
Cyclosporin A scheint als Therapeutikum geeignet, weil es nicht nur <strong>die</strong> T-Zell-vermittelte<br />
Immunantwort supprimiert, sondern auch einen das Haarwachstum stimulierenden Effekt<br />
aufweist. In Einzelfällen wurde von der Behandlung der idiopathischen Sebadenitis mittels<br />
Cyclosporin A berichtet. Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit einer systematischen<br />
Untersuchung des Einflusses von Cyclosporin A auf <strong>die</strong> idiopathische Sebadenitis des<br />
Hundes.<br />
Zwölf Hunde unterschiedlicher Rassen wurden mit 5mg/kg/Tag Cyclosporin A<br />
(NEORAL ®) oral über zwölf Monate behandelt. Mittels spezieller Bewertungssysteme<br />
wurde alle vier Monate sowohl der klinische als auch der histologische Krankheitsstatus<br />
festgestellt. Die Entzündungszellen wurden immunhistochemisch (CD3, MAC 387, MHC II)<br />
differenziert und gezählt.<br />
Der klinische Krankheitsstatus verbesserte sich um 50 bis 60%. Deutliche Besserungen<br />
waren schon nach vier Monaten Cyclosporin A Behandlung zu sehen. Anschließend kam es<br />
zu keiner weiteren signifikanten Verbesserung des klinischen Bildes. Histologisch konnte<br />
festgestellt werden, dass der Entzündungsprozess um <strong>die</strong> Talgdrüse und deren damit<br />
verbundene Destruktion nach rund achtmonatiger Cyclosporin A-Therapie gestoppt wurde.<br />
Anschließend konnten an einigen Haarfollikeln aus Hautarealen, wo früher keine Talgdrüsen<br />
zu erkennen waren, einzelne kleine Sebozyten ausgemacht werden. Möglichweise handelt es
Zusammenfassung 108<br />
sich dabei um eine Regeneration der Talgdrüsenzellen. Gleichzeitig konnte ein Rückgang der<br />
infundibulären Hyperkeratose beobachtet werden<br />
Das Absetzen der Cyclosporin A-Therapie führte zu einer Verschlechterung des klinischen<br />
Bildes, mit erneutem Auftreten deutlicher Entzündungsprozesse im Bereich der Talgdrüsen.<br />
Aus der hier vorliegenden Arbeit läßt sich folgern, daß eine Cyclosporin A-Behandlung von<br />
5mg/kg/Tag zu einem signifikanten Rückgang der Entzündungszellinfiltration im Bereich der<br />
Talgdrüsen bei einer idiopathischen Sebadenitis führt. Anschließend kommt es zu einer<br />
Verbesserung des klinischen Bildes von 60%. Dieses Ergebnis unterstreicht <strong>die</strong> Theorie, daß<br />
es sich bei der idiopathischen Sebadenitis um eine T-Zell vermittelte Immunerkrankung<br />
handelt. Das Absetzen der Cyclosporin A-Behandlung führt zu einer Reaktivierung der<br />
Immunantwort, deshalb erscheint eine lebenslange Cyclosporin A-Behandlung notwendig.<br />
Nach den vorliegenden Ergebnissen sollte Cyclosporin A als Mittel der Wahl für <strong>die</strong><br />
Behandlung der idiopathischen Sebadenitis des Hundes gelten. Weitere klinische<br />
Untersuchungen in <strong>die</strong>sem Bereich, insbesondere zur kausalen Klärung der<br />
Entzündungsreaktion, wären wünschenswert.
Zusammenfassung 109<br />
5. Summary<br />
Christina Boss (2004)<br />
Investigations of the treatment with Cyclosporine A (NEORAL®) on idiopathic<br />
Sebaceous adenitis in dogs<br />
Sebaceous adenitis (SA) is an idiopathic inflammatory destruction of sebaceous glands,<br />
occurring in various breeds of dogs. Treatment is currently largely restricted to topical rinsing<br />
with limited clinical benefit. The immunomodulator Cyclosporine A (CyA) has sporadically<br />
been suggested for the treatment of SA, but detailed clinical stu<strong>die</strong>s are lacking. Since SA is<br />
considered to be a T-cell <strong>med</strong>iated autoimmune disease, CyA should theoretically be able to<br />
suppress the autoimmune reaction and additionally could stimulate hair growth. The purpose<br />
of this clinical study was to systematically evaluate the potential of CyA in the therapy of<br />
SA.12 dogs of various breeds with SA were orally treated with CyA at 5 mg/kg/day for 12<br />
months. Using a scoring system, the status of disease was evaluated clinically and<br />
histopathologically every 4 months. Inflammatory cells were counted and characterized by<br />
immunohistochemistry. In general, the clinical status markedly improved by 50 to 60%.<br />
Improvement was already seen after 4 months of treatment. Thereafter, no significant<br />
improvement of the clinical picture was noticed. Histologically, the inflammatory processes<br />
around the sebaceous glands disappeared after about 8 months of treatment. Subsequently,<br />
some hair follicles in areas where formerly no sebaceous glands were seen revealed small<br />
sebocytes, possibly suggesting regeneration. Simultaneously, the hyperkeratosis within the<br />
follicular infundibulum declined significantly. Cessation of treatment always led to worsening<br />
of the clinical picture, associated with marked inflammatory processes at the sebaceous<br />
glands. We conclude that CyA at a dose of 5 mg/kg/day is able to significantly reduce the<br />
inflammation in SA and subsequently improves the clinical picture by about 60%. This<br />
further supports the theory that SA is a T-cell <strong>med</strong>iated autoaggression. Cessation of<br />
treatment leads to reactivation of the autoimmunity, and therefore lifelong treatment appears<br />
to be necessary in order to control the disease. Our data suggest that since the causative<br />
inflammation is diminished, Cyclosporine A should be considered as the gold standard for the
Zusammenfassung 110<br />
treatment of idiopathic canine sebaceous adenitis, and further clinical investigations are<br />
encouraged.
Literaturverzeichnis 111<br />
6. Literaturverzeichnis<br />
AICHER L., WAHL D., ARCE A. (1998):<br />
New insights into cyclosporine A nephrotoxicity by proteome analysis.<br />
Electrophoresis 19, 1998-2003<br />
BAGLADI M.S., SCOTT D.W., MILLER H.W. (1996):<br />
Sebaceous gland melanosis in dogs with endocrine skin disease or follicular dysplasia.<br />
A retrospective study<br />
Vet. Dermatol. 7, 85-90<br />
BIGLER B. (2001):<br />
Hautkrankheiten<br />
In: NIEMAND H. G., SUTER P.F. (Hrsg.), Praktikum der Hundeklinik, 9. Auflage, Parey<br />
Buchverlag, Berlin, 379-443<br />
BIREN C.A., BARR R.J. (1986):<br />
Dermatologic applications of cyclosporine.<br />
Arch. Dermatol. 122,1028-1032<br />
BLECHER S.R., KAPALANGA J., LALONDE D. (1990):<br />
Induction of sweat glands by epidermal growth factor in murine X-linked anhidrotic<br />
ectodermal dysplasia.<br />
Nature 345, 542-544<br />
BOREL J.F. (1988):<br />
Immunosuppression: Building on Sandimmune (Cyclosporine).<br />
Transpl. Proc. 10, 149-153
Literaturverzeichnis 112<br />
CATHER J.C., ABRAMOVITS W., MENTER A. (2001):<br />
Cyclosporine and tacrolismus in dermatology.<br />
Dermatologic Clinics 19, 119-137<br />
CAROTHERS M.A., KWOCHKA K.W., ROJKO J.L. (1991):<br />
Cyclosporine-responsive granulomatous sebaceous adenitis in a dog.<br />
J. Am. Vet. Med. Assoc.198, 1645-1648<br />
COOK A.K., BERTOY E.H., GREGORY C.G. (1994):<br />
Effects of oral cyclosporine in dogs with refractory immune-<strong>med</strong>iated anemia or<br />
thrombocytopenia.<br />
Proc 12 th American College of Veterinary Internal Medicine Forum, San Francisco, CA, 1001<br />
CUNLIFFE W. J. (1992):<br />
Akne- Klinik, Differentialdiagnose, Pathogenese, Therapie<br />
Hippokrates Verlag, Berlin<br />
DAHLINGER J., GREGORY C., BEA J. (1998):<br />
Effect of ketokonazole on cyclosporine dose in healthy dogs.<br />
Vet. Surg. 27, 64-68<br />
DOWNING D.T., COLTON S.W. (1980):<br />
Skin surface lipids of the horse.<br />
Lipids 15, 323-327<br />
DOWING D.T., WERTZ P.W., STEWART M.A. (1986):<br />
The role of sebum and epidermal lipids in the cosmetic properties of skin.<br />
Int. J. Cosmet. Sci. 8,115-123
Literaturverzeichnis 113<br />
DOWNIE M.M.T., KEALEY T. (1997):<br />
Inter<strong>med</strong>iary metabolism of the human sebaceous gland.<br />
J. Invest. Dermatol. 108, 373<br />
DUNSTAN R.W., HARGIS A.M. (1995):<br />
The diagnosis of sebaceous adenitis in the standard poodle dogs.<br />
In: BONAGURA J.D., (eds.), Kirk´s Current Veterinary Therapy XII. W.B. Saunders CO,<br />
Philadelphia, 619-622<br />
EBLING F. J. (1948):<br />
Sebaceous glands. The effect of sex hormones on the sebaceous glands of the femal albino<br />
rat.<br />
J. Endocrinol 5, 297-302<br />
EBLING F. J. (1963):<br />
Hormonal control of sebaceous glands in experimental animals.<br />
In: MONTAGNA W., ELLIS R., SILVER A. (ed.), Advances in the Biology of the Skin: The<br />
Sebaceous Glands, 4. Auflage, Pergamon Press, Oxford, 200-219<br />
EBLING F.J. (1973):<br />
The effects of cyproterone acetate and oestradiol upon testosterone stimulated sebaceous<br />
activity in the rat.<br />
Acta. Endocrinol. 72, 361-365<br />
EBLING F. J., SKINNER J. (1983):<br />
The local effects of topically applied estradiol, cyproterone acetate, and ethanol on sebaceous<br />
secretion in intact male rats.<br />
J. Invest. Dermatol. 81, 448-451
Literaturverzeichnis 114<br />
EBLING F. J., EBLING E., SKINNER J. (1969):<br />
The influence of the pituitary on the response of the sebaceous glands of the rat to<br />
progesterone.<br />
J. Endocrinol. 45, 257-263<br />
FONTAINE J., OLIVRY T. (2001):<br />
Treatment of canine atopic dermatitis with cyclosporine: a pilot clinical study.<br />
Vet. Record 148, 662-663<br />
FURUE M., GASPARI A.A., KATZ S.I. (1988):<br />
The effect of cyclosporin A on epidermal cells.II.Cyclosporine A inhibits proliferation of<br />
normal and transfor<strong>med</strong> keratinocytes.<br />
J. Invest. Dermatol. 90, 796-780<br />
GAFTER-GVILI A., SREDNI B., GAL R., GAFTER U., KALECHMAN Y. (2003):<br />
Cyclosporin A-induced hair growth in mice is associated with inhibition of calcineurindependent<br />
activation of NFAT in follicular keratinocytes.<br />
Am. J. Physiol. Cell Physiol. 284 , 1593-1603<br />
GEBHARDT W. (1988):<br />
Immunoglobuline A-<strong>med</strong>iated local immunity in the sebaceous follicle<br />
In: MARKS R., PLEWIG G. (ed.), Acne and related Disorders. Martin Dunitz Ltd, London,<br />
23-26<br />
GLOOR M., GANTNER M., WIRTH H., SCHNY<strong>DER</strong> U.W. (1980):<br />
On the influence of topically applied drugs on cell kinetics in the sebaceous gland.<br />
Dermatologica 160, 175-179
Literaturverzeichnis 115<br />
GOTHE R., NOLTE I., KRAFT W. (1997):<br />
Leishmaniose des Hundes in Deutschland: epidemiologische Fallanalyse und Alternative zur<br />
bisherigen kausalen Therapie.<br />
Tierärztl. Praxis 25, 68<br />
GREGORY C.R., GOURLEY I.M. (1992):<br />
Renal transplantation in clinical <strong>vet</strong>erinary <strong>med</strong>icine.<br />
In: KIRK R.W., BONAGURA J.D. (eds.): Current Veterinary Therapy (XI) Small Animal<br />
Practice. Saunders, Philadelphia, 870-875<br />
GRIFFITHS L.G.,SULLIVAN M.,BORLAND W.W. (1999):<br />
Cyclosporine as the sole treatment for anal furunculosis: preliminary results.<br />
J. Small Anim. Pract. 40, 569-572<br />
GROSS T.L., STANNARD A.A., YAGER J.A. (1997):<br />
An anatomical classification of folliculitis.<br />
Vet. Dermatol. 8,147-156<br />
GROSSMANN R.M., CHEVRET S., ALIRACHED J., BLANCHET F., DUBERTRET L.<br />
(1996):<br />
Longterm safety of cyclosporine in the treatment of Psoriasis.<br />
Arch. Dermatol. 132 , 623-629<br />
GUAGUÈRE E. (2000):<br />
Efficacy of cyclosporine in the treatment of idiopathic sterile nodular panniculitis in two dogs.<br />
Vet. Dermatol. 11, 22<br />
GUAGUÈRE E., PRELAUD P. (2000):<br />
Efficacy of cyclosporine in the treatment of 12 cases of eosinophilic granuloma complex.<br />
Vet. Dermatol. 11, 31
Literaturverzeichnis 116<br />
GUAGUÈRE E., ALHAIDARI Z.,MAGNOL J.P. (1990):<br />
Adénité sébacée granulomateuse á propos de trois cas.<br />
Pract. Méd. Chir. Anim. Comp. 2, 169-175<br />
GUY R., RIDDEN C., KEALEY T. (1996):<br />
The improved organ maintenance of the human sebaceous gland: modeling in vitro the<br />
effects of epidermal growth factor, androgens, estrogens, 13-cis retinoic acid, and phenol red.<br />
J. Invest. Dermatol 106, 454-460<br />
HARDY M.H. (1992):<br />
The secret life of the hair follicle.<br />
Trends in Genetics 8, 55-61<br />
HARGIS A. (1991):<br />
Sebaceous adenitis.<br />
In: Proceedings of the 7 th Annual Members` Meeting of the American Academy of Veterinary<br />
Dermatology and the American College of Veterinary Dermatology, Scottsdale, S: 87<br />
HASKIN D., LASHER N., ROTHMANN S. (1953):<br />
Some effects of ACTH , cortisone, progesterone and testosterone on sebaceous glands in the<br />
white rat.<br />
J. Invest. Dermatol. 20, 207-211<br />
HEINZE W. (1996):<br />
Hilfsstoffe mit antimykotischer Wirkung<br />
In: FREY H., LÖSCHER W. (Hrsg.),Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie für <strong>die</strong><br />
Veterinär<strong>med</strong>izin, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 509-522
Literaturverzeichnis 117<br />
HESS A.D., ESA A.H., COLOMBANI P.M. (1988):<br />
Mechanisms of action of cyclosporine: effect on cells of the immune system and on<br />
subcellular events in T cell activation.<br />
Transplant. Proc. 20, 29-40<br />
HESS A.D. (1993):<br />
Mechanisms of action of cyclosporine: consideration for the treatment of autoimmune<br />
diseases.<br />
Clin. Immunol. Immunopathol. 68, 220-229<br />
HO S., CLIPSTONE N., TIMMERMANN L., NORTHROP J., GRAEF I., FIORENTINO D.,<br />
NOURSE J., CRABTREE G.R. (1996):<br />
The mechanism of action of cyclosporine A and FK506.<br />
Clin. Immunol. Immunopathol. 80, 40- 45<br />
JANEWAY C.A., TRAVERS P. (1997):<br />
Immunologie<br />
2. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg<br />
JENKINSON D.M. (1990):<br />
Sweat and sebaceous glands and their function in domestic animals<br />
In : V.TSCHARNER C., HALLIWELL R.E.W. (eds.): Advances in Veterinary Dermatology,<br />
(1), Bailliere Tindall, London, 229<br />
KIETZMANN M. (1996):<br />
Pharmakologie der Haut<br />
In: FREY H., LÖSCHER W. (Hrsg.), Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie für <strong>die</strong><br />
Veterinär<strong>med</strong>izin, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 445-453
Literaturverzeichnis 118<br />
KLEIN N. (1993):<br />
In: FITZPATRICK T.B. (ed.): Dermatology in General Medicine, (2), MacGraw-Hill, New<br />
York, 285<br />
KOLARS J.C., MERION R.M., AWNI W.M. (1991):<br />
First-pass metabolism of cyclosporine by the gut.<br />
Lancet 338, 1488-1490<br />
KWOCHKA K.W., RADEMAKERS A.M. (1989):<br />
Cell proliferation kinetics of epidermis, hair follicles and sebaceous glands of Cocker<br />
Spaniels with idiopathic seborrhea.<br />
Am. J. Vet. Res. 50, 1918<br />
KWOCHKA K.W. (1989):<br />
Retinoids in dermatology.<br />
In: KIRK R.W. (eds.): Kirks Current Veterinary Therapy X, WB Saunders, Philadelphia; 553-<br />
560<br />
LAVKER R.M., MILLER S.W., WILSON C. (1993):<br />
Hair follicle stem cells: their location, role in hair cycle, and involvement in skin tumor<br />
formation.<br />
J. Invest. Dermatol. 101, 16-26<br />
LEONHARDT H. (1990):<br />
Histologie, Zytologie und Mikroanatomie des Menschen.<br />
Georg Thieme Verlag, Stuttgart<br />
LIEBICH H. G. (1992):<br />
Funktionelle Histologie.<br />
Schattauer Verlag, Stuttgart
Literaturverzeichnis 119<br />
LIN<strong>DER</strong> K.E., WHITE S.D., SCHULTHEISS P., SCOTT K.V., GARNETT P., TAYLOR<br />
M., BEST S.J., YAGER J.A. (1998):<br />
Generalized exfoliative dermatosis with sebaceous adenitis in three domestic rabbits.<br />
14 th Proc. An. Dermatol., 89-90<br />
MARSHALL C., WILLIAMS J. (1990):<br />
Re-establishment of hair growth, skin pliability and apparent resistance to bacterial infection<br />
after dosing fish oil in a dog with sebaceous adenitis.<br />
In: VON TSCHARNER C., HALLIWELL R. E. W. (eds.), Advances in Veterinary<br />
Dermatology Vol. 1, Bailliere Tindall, London, 446<br />
MAURER M., HANDJISKI B., PAUS R. (1997):<br />
Hair growth modulation by topical immunophilin ligands. Induction of anagen, inhibition of<br />
massive catagen development, and relative protection from chemotherapy – induced alopecia.<br />
Am. J. Pathol. 150, 1433-1441<br />
MARTINS C., TELLECHEA O., MARIANO A., BAPTISTA A.P. (1997):<br />
Sebaceous adenitis.<br />
J. Am. A. Dermatol. 36, 845-846<br />
MATHEWS K.A., AYRES S.A., TANO C.A. (1997):<br />
Cyclosporine treatment of perianal fistulas in dogs.<br />
Can. Vet. J. 38, 39-41<br />
MC ALLISTER (1991):<br />
Adenohypophysitis associated with sebaceous gland atrophy in a dog.<br />
Vet. Pathol. 28, 340-341
Literaturverzeichnis 120<br />
MELNIK B., PLEWIG G. (1988):<br />
Hypothese zur Pathogenese der follikulären Verhornungsstörungen bei Acne vulgaris.<br />
Hautkrankheiten 7, 12<br />
METZE D., JURECKA W., GEBHARDT W., SCHMIDT J., MAINTIZ M., NIEBAUER G.<br />
(1989):<br />
Immunohistochemical demonstration of immunoglobuline A in human sebaceous and sweat<br />
glands.<br />
J. Invest. Dermatol. 91, 13-17<br />
MIHATSCH M., WOLFF K.<br />
Consensus conference on cyclosporine for psoriasis.<br />
Br. J. Dermatol. 126, 621-623<br />
MOUATT J. (2002):<br />
Cyclosporine and ketokonacol interaction for treatment of perianal fistual in the dog.<br />
Aust. Vet. J. 80, 207-211<br />
MÜLLER R.S. (2004):<br />
Primär- und Sekundäreffloreszenzen<br />
In: Das Handbuch für <strong>die</strong> Kleintierpraxis, Vet Verlag, Babenhausen, 16-20<br />
NAEYAERT J.M., LACHAPELLE J.M., DEGREEF H. (1998):<br />
Cyclosporine in atopic dermatitis: review of the literature and outline of a Belgian consensus.<br />
Dermatology 198, 142-152<br />
OETTEL M. (1996):<br />
Endokrinpharmakologie<br />
In: Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie für <strong>die</strong> Veterinär<strong>med</strong>izin, FREY H.,<br />
LÖSCHER W. (Hrsg.), Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 370-423
Literaturverzeichnis 121<br />
PAUS R., BÖTTGE J. A., CZARNETZKI B.M. (1993):<br />
Cyclosporine A, FK 506 and related drugs as tools for hair research.<br />
Arch. Dermatol. Res. 285, 80-81<br />
PAUS R., HANDJISKI B., CZARNETZKI B. M., EICHMÜLLER S. (1997):<br />
Murine model for inducing and manipulating hair follicle regression (catagen): effects of<br />
dexamethason and CyA.<br />
J. Invest. Dermatol. 103, 143-147<br />
PAUS R., STENN K. S., LINK R. E. (1989):<br />
The induction of anagen hair growth in telogen- mouse skin by CyA administration.<br />
Lab. Invest. 60, 365-369<br />
PLEWIG G., CHRISTOPHERS E. (1978):<br />
Renewal rate of human sebaceous glands.<br />
Acta. Derm. Venereol. (Stockholm) 79, 314-317<br />
PINKUS H. (1958):<br />
Embryology of hair.<br />
In: MONTAGNA W., ELLIS R. (ed.); The Biology of Hair Growth, Academic Press, New<br />
York ,1-33<br />
POWER H.T., IHRKE P.J. (1990):<br />
Synthetic Retinoids in Veterinary Dermatology.<br />
Advances in Clinical Dermatology 20, 1525- 1539<br />
RENFRO L., KOPF A. W., GUTTERMAN A., GOTTLIEB G. J., JACOBSON M. (1993):<br />
Neutrophilic sebaceous adenitis.<br />
Archives of dermatology, 129, 910 -911
Literaturverzeichnis 122<br />
REICHLER I.M., BOMHARD D., SCHILLER I., MEISL D., HAUSER B., GLAUS T.,<br />
PFLEGHAAR S., ARNOLD S. (1999):<br />
Rassespezifische Hauterkrankungen beim Akita Inu.<br />
Kleintierpraxis 44, 647-659<br />
REICHLER I.M., HAUSER B., SCHILLER I., DUNSTAN R.W., CREDILLE K. M.,<br />
BIN<strong>DER</strong> H., GLAUS T., ARNOLD S. (2001):<br />
Sebaceous adenitis in the Akita: clinical observations, histopathology and heredity.<br />
Vet. Dermatol., 12, 243- 253<br />
ROBSON D.C., BURTON G.G. (2003):<br />
Cyclosporine: applications in small animal dermatology.<br />
Vet. Dermatol. 14, 1-9<br />
ROSSER E. J. (2000):<br />
Therapy of sebaceous adenitis.<br />
In: BONAGURA J.D., KIRK R. W. (eds.), Kirk´s Current Veterinary Therapy XIII. W.B.<br />
Saunders, Philadelphia, 572-573<br />
ROSSER E. J. (1992):<br />
Sebaceous adenitis.<br />
In: BONAGURA J.D., KIRK R.W., Kirk`s Current Veterinary Therapy XI. W.B. Saunders,<br />
Philadelphia, 534 –536<br />
ROSSER E. J., DUNSTAN R. W., BREEN P. T. (1987):<br />
Sebaceous adenitis with hyperkeratosis in the Standard Poodle: A discussion of 10 cases.<br />
J. Am. Anim. Hosp. Assoc. 23, 341-345
Literaturverzeichnis 123<br />
ROSENKRANTZ W. S., GRIFFIN C. E., BARR R. J. (1989) :<br />
Clinical evaluation of cyclosporine in animal models with cutaneous immune<strong>med</strong>iated disease<br />
and epitheliotropic lymphoma.<br />
J. Am. Anim. Hosp. Assoc. 25, 25<br />
RYFFEL B. (1982):<br />
Experimental toxicological stu<strong>die</strong>s with cyclosporine A.<br />
White, D.J.G., (ed.), Cyclosporine A, Elsevier Bio<strong>med</strong>ical Press, Amsterdam, 45-75<br />
RYBNICEK J., AFFOLTER V. K., MOORE P. F. (1998):<br />
Sebaceous adenitis: an immunohistological examination.<br />
In: KWOCHKA K.W., WILLEMSE T., VON TSCHARNER C.(eds.) Advances in<br />
Veterinary Dermatology Vol. 3, Butterworth Heinemann, Oxford, 539<br />
RYBNICEK J. (1999):<br />
Sebaceous adenitis: an immunohistological examination.<br />
45. Jahrestagung der FK-DVG, Dermatologie- Seminar, 7.Okt.1999, Gießen<br />
SCARFF D.H. (1994):<br />
Sebaceous adenitis in the standard poodle.<br />
Vet. Rec. 2, 64<br />
SCARFF D. H. (2000):<br />
Sebaceous adenitis in standard poodles.<br />
Vet. Rec. 146 , 476<br />
SCHNORR B.(1996):<br />
Embryologie der Haustiere<br />
3. Aufl., Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart
Literaturverzeichnis 124<br />
SCOTT D. W. (1986):<br />
Granulomatous sebaceous adenitis in dogs.<br />
J. Am. Anim. Hosp. Assoc. 22, 631<br />
SCOTT D. W. (1993):<br />
Sterile granulomatous sebaceous adenitis in dogs and cats.<br />
Vet. annual. 33 , 236-243<br />
SCOTT D. W. (1989) :<br />
Adénité sébacée granulomateuse chez un chat.<br />
Le Pointe Vet. 21, 107-111<br />
SCOTT D.W., MILLER W. H., GRIFFIN C.E. (1995):<br />
In: Muller and Kirk´s Small Animal Dermatology. 5 th ed.<br />
W.B. Saunders Comp., Philadelphia<br />
SCOTT D.W., MILLER W.H., GRIFFIN C.E. (2000):<br />
In: Muller and Kirk´s Small Animal Dermatology. 6 th ed.<br />
W.B. Saunders Comp., Philadelphia<br />
SCOTT D. W., MILLER R., GRIFFIN C.E. (2001):<br />
In: Muller and Kirk´s Small Animal Dermatology 7 th ed.<br />
W.B. Saunders Comp., Philadelphia<br />
SERRI F., HUBER W. M. (1963) :<br />
The development of sebaceous glands in man.<br />
MONTAGNA, ELLIS R, SILVER A (ed.), Advances in Biology of the Skin : The sebaceous<br />
Glands, Vol. 4 Pergamon Press, London, 1-18
Literaturverzeichnis 125<br />
SHARAF D. M., CLARK S. J., DOWNING D. T. (1977) :<br />
Skin surface lipids of the dog.<br />
Lipids 12, 786-790<br />
SHUSTER S. (1988):<br />
Cyclosporine in dermatology.<br />
Transplant. Proc. 20, 19-22<br />
SHUSTER S., THODY A. J. (1974):<br />
The control and measurement of sebum secretion.<br />
J. Invest. Dermatol. 62, 172-190<br />
STEFFAN J., STREHLAU M., MAURER M. (2001):<br />
Cyclosporine: a population kinetics in dogs.<br />
In: Proceedings 17 th Annual Congress of the European Society of Veterinary<br />
Dermatology/European College of Veterinary Dermatology.<br />
Copenhagen, 179<br />
STENN K.S., SUNDBERG J.P. (1999) :<br />
Hair follicle biology, the sebaceous glands and scarring alopecia.<br />
Arch. Dermatol. 135 , 973<br />
STEWART L.J., WHITE S.D., CARPENTER J.L. (1991):<br />
Isotretinoin in the treatment of sebaceous adenitis in two Vizslas.<br />
J. Am. Anim. Hosp. Assoc. 27, 65<br />
STRAUSS J.S., KLINGMAN A.M. (1961):<br />
The effect of progesterone and progesterone- like compounds on the human sebaceous gland.<br />
J. Invest. Dermatol. 36, 309-319
Literaturverzeichnis 126<br />
STRAUSS J.S., STEWART M.E., DOWING D.F. (1987):<br />
The effect of 13 cis retinoic acid on sebaceous glands.<br />
Arch. Dermatol. 123, 1538-1541<br />
STREY A. (1996):<br />
Immunpharmaka<br />
In: FREY H., LÖSCHER W. (ed.), Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie für <strong>die</strong><br />
Veterinär<strong>med</strong>izin, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 612-621<br />
UNGEMACH F. R., KIETZMANN M. (1997):<br />
Dermatika<br />
In: LÖSCHER W., UNGEMACH F.R., KROKER R. (Hrsg.), Pharmakotherapie bei Hausund<br />
Nutztieren, 3. Auflage, Parey Buchverlag, Berlin, 402-411<br />
VADEN S.L. (1989):<br />
Cyclosporine A and its potential use in the treatment of autoimmune diseases.<br />
In: Proceedings 7 th Annu. Vet. Med. Forum, 707-710<br />
VON<strong>DER</strong>SCHER J., MEINZER A. (1994):<br />
Rationale for the development of Sandimmune Neoral.<br />
Tranplant. Proc. 26, 2925-2927<br />
WEISS E., TEIFKE J. P. (1999):<br />
Haut<br />
In: DAHME E., WEISS E. (Hrsg.), Grundriß der speziellen pathologischen Anatomie der<br />
Haustiere, Enke-Verlag, München, 485-490<br />
WENDELBERGER U. (1999):<br />
Sebadenitis bei einer Katze.<br />
Kleintierpraxis 44, 293-298
Literaturverzeichnis 127<br />
WHITE J.V. (1986):<br />
Cyclosporine: prototype of a T-cell selective immunsuppressant.<br />
J. Am. Vet. Med. Assoc. 5, 566-570<br />
WHITE S.D., ROSYCHUK R.A., SCOTT K.V., HARGIS A.M., JONAS L., TRETTIEN A.<br />
(1995):<br />
Sebaceous adenitis in dogs and results of treatment with isotretinoin and etretinate: 30 cases<br />
(1990-1994).<br />
J. Am. Vet. Med. Assoc. 207, 197-200<br />
WOLFF H.H. (1992):<br />
Akne Pathogenese- Klinik- Therapie<br />
Springer Verlag, Wissenschaftliche Kommunikation S.16-17<br />
WOLFF H.H., ARING D. (1992):<br />
Aknetherapie heute- eine Standortbestimmung<br />
Dermatologen – Symposium Berlin<br />
ZACHARIAE H. (1996):<br />
Long-term use of cyclosporine in dermatology.<br />
Arch.Dermatol.132, 692-4
Anhang 128<br />
7. Anhang<br />
Tabelle 2:<br />
Durchschnittliche Anzahl der CD3-markierten T-Lymphozyten im Isthmusbereich pro<br />
Gesichtsfeld. Pro Schnitt wurden zehn Gesichtsfelder ausgezählt.<br />
Patient 3 entwickelte unter der Cyclosporin A-Behandlung eine lichenoide Dermatitis, so dass<br />
trotz Verbesserung des klinischen Bildes der Sebadenitis <strong>die</strong> Behandlung ab dem achten<br />
Monat abgesetzt werden musste. Patient 7 konnte aus stu<strong>die</strong>nunabhängigen Gründen zum<br />
Zeitpunkt 12 Monate nicht histopathologisch untersucht werden.<br />
Tabelle 3:<br />
Arbiträrer Entzündungsparameter bestehend, aus Inzidenz und Schweregrad der<br />
Entzündungszellreaktionen im Bereich der Haarfollikelisthmen. Pro Schnitt wurden zehn<br />
Gesichtsfelder ausgezählt.<br />
Patient 3 entwickelt unter der Cyclosporin A-Behandlung eine lichenoide Dermatitis, so dass<br />
trotz Verbesserung des klinischen Bildes der Sebadenitis <strong>die</strong> Behandlung ab dem achten<br />
Monat abgesetzt werden musste. Patient 7 konnte aus stu<strong>die</strong>nunabhängigen Gründen zum<br />
Zeitpunkt 12 Monate nicht histopathologisch untersucht werden.
Anhang 129<br />
Tabelle 4:<br />
Durchschnittliche Anzahl der MAC 387 markierten Makrophagen im Isthmusbereich pro<br />
Gesichtsfeld. Pro Schnitt wurden zehn Gesichtsfelder ausgezählt.<br />
Patient 3 entwickelt unter der Cyclosporin A-Behandlung eine lichenoide Dermatitis, so dass<br />
trotz Verbesserung des klinischen Bildes der Sebadenitis <strong>die</strong> Behandlung ab dem achten<br />
Monat abgesetzt werden musste. Patient 7 konnte aus stu<strong>die</strong>nunabhängigen Gründen zum<br />
Zeitpunkt 12 Monate nicht histopathologisch untersucht werden.<br />
Tabelle 5:<br />
Durchschnittliche Anzahl der MHCII-markierte Zellen im Isthmusbereich pro Gesichtsfeld.<br />
Pro Schnitt wurden zehn Gesichtsfelder ausgezählt.<br />
MHCII-Zellen<br />
Patient 3 entwickelt unter der Cyclosporin A-Behandlung eine lichenoide Dermatitis, so dass<br />
trotz Verbesserung des klinischen Bildes der Sebadenitis <strong>die</strong> Behandlung ab dem achten<br />
Monat abgesetzt werden musste. Patient 7 konnte aus stu<strong>die</strong>nunabhängigen Gründen zum<br />
Zeitpunkt 12 Monate nicht histopathologisch untersucht werden.
Anhang 130<br />
Tabelle 6:<br />
Ermittelte Patientenwerte der klinischen Verlaufsuntersuchung (Total Score).<br />
Patient 3 entwickelt unter der Cyclosporin A-Behandlung eine lichenoide Dermatitis, so dass<br />
trotz Verbesserung des klinischen Bildes der Sebadenitis <strong>die</strong> Behandlung ab dem achten<br />
Monat abgesetzt werden musste.<br />
Tabelle7 :<br />
Auflistung der Anzahl der Talgdrüsen pro Haarfollikel in Prozent pro Gesichtsfeld.<br />
Pro Schnitt wurden zehn Gesichtsfelder ausgezählt.<br />
Patient 3 entwickelt unter der Cyclosporin A-Behandlung eine lichenoide Dermatitis, so dass<br />
trotz Verbesserung des klinischen Bildes der Sebadenitis <strong>die</strong> Behandlung ab dem achten<br />
Monat abgesetzt werden musste. Patient 7 konnte aus stu<strong>die</strong>nunabhängigen Gründen zum<br />
Zeitpunkt 12 Monate nicht histopathologisch untersucht werden.
Anhang 131<br />
Tabelle 8:<br />
Durchschnittlicher Grad der infundibulären Hyperkeratose pro Schnitt.<br />
Patient 3 entwickelt unter der Cyclosporin A-Behandlung eine lichenoide Dermatitis, so dass<br />
trotz Verbesserung des klinischen Bildes der Sebadenitis <strong>die</strong> Behandlung ab dem achten<br />
Monat abgesetzt werden musste. Patient 7 konnte aus stu<strong>die</strong>nunabhängigen Gründen zum<br />
Zeitpunkt 12 Monate nicht histopathologisch untersucht werden.<br />
DAB-Gebrauchslösung<br />
1. Stammlösung:<br />
100 mg DAB (Fa. Buchs,CH) in<br />
50 ml TBS<br />
Lagerung bei -20°C; vor Gebrauch im Dunkeln auftauen<br />
2. Gebrauchslösung:<br />
50ml Stammlösung (filtriert) und<br />
150 ml TBS und<br />
3 ml 3%iges H 2 O 2<br />
Inkubation in einer Kü<strong>vet</strong>te für 5 min. auf einem Magnetrührer
Anhang 132<br />
Veröffentlichung:<br />
Teilergebnisse <strong>die</strong>ser Arbeit wurden bereits vorab zur Veröffentlichung eingereicht:<br />
M. Linek, C. Boss, R. Hämmerling, M. Hewicker-Trautwein, L. Mecklenburg (2004):<br />
Cyclosporine A significantly improves the clinical and histomorphological features of canine<br />
sebaceous adenitis.<br />
JAVMA in press
Anhang 133<br />
Danksagung:<br />
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Frau Prof. <strong>Dr</strong>. M. Hewicker-Trautwein und bei Ph. D <strong>Dr</strong>.<br />
Lars Mecklenburg für <strong>die</strong> Vergabe des Themas und für <strong>die</strong> Unterstützung und Hilfestellung<br />
beim Erstellen <strong>die</strong>ser Arbeit.<br />
Frau <strong>Dr</strong>. Renate Hämmerling gilt mein Dank für <strong>die</strong> Bereitstellung des Patientenmaterials und<br />
für <strong>die</strong> Unterstützung der Fotodokumentation.<br />
Für <strong>die</strong> Überlassung des Medikaments NEORAL® danke ich der Firma Novartis und Frau<br />
Funke.<br />
Herr Klaus-Peter Kuhlmann danke ich fürr seine Hilfsbereitschaft und freundliche<br />
Unterstützung bei der Anfertigung der immunhistochemischen Färbungen.<br />
Mein besonderer Dank gilt der engagierten und liebevollen Unterstützung von Frau <strong>Dr</strong>.<br />
Monika Linek. Die konstruktiven Gespräche mit ihr haben viel zu dem Gelingen der Arbeit<br />
beigetragen.<br />
Ein liebevoller Dank gebührt meinen Freundinnen Franziska, Heike und Tina für Ihr<br />
Vertrauen und Ihren Rückhalt. Sie haben mich trotz mancher Tiefs immer zur Weiterarbeit<br />
motivieren können.<br />
Ein aufrichtiges und herzliches Dankeschön gilt Reiner für seine zahlreiche, tatkräftige und<br />
geduldige Unterstützung.<br />
Zuletzt ein herzliches Dankeschön an meine lieben Eltern für <strong>die</strong> Ermöglichung meiner<br />
Ausbildung und dafür, daß ich mich auf ihre volle Unterstützung immer verlassen konnte.


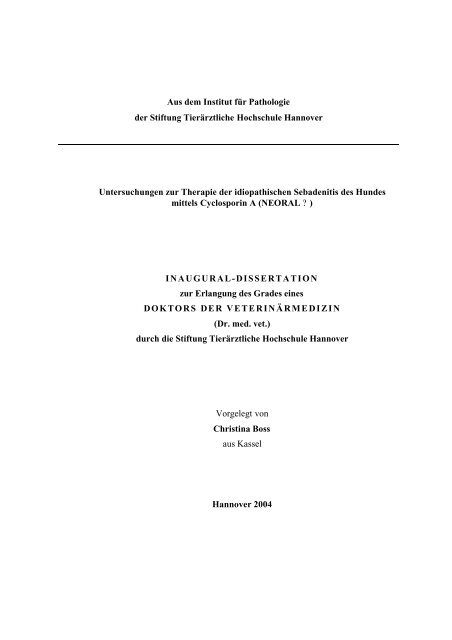



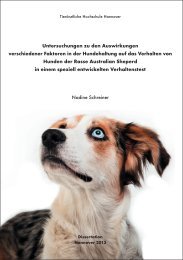



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






