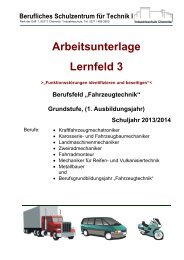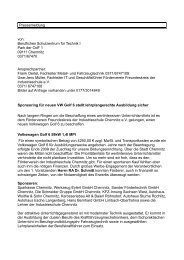Prof. Dr. Gottfried Adolph Die Praxis des handlungsorientierten ...
Prof. Dr. Gottfried Adolph Die Praxis des handlungsorientierten ...
Prof. Dr. Gottfried Adolph Die Praxis des handlungsorientierten ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Gottfried</strong> <strong>Adolph</strong><br />
<strong>Die</strong> <strong>Praxis</strong> <strong>des</strong> <strong>handlungsorientierten</strong> Unterrichts<br />
[In der fünften Unterrichtseinheit geht es um die Einführung in die elektrotechnischen<br />
Grundbegriffe. Alle diese Begriffe stehen nicht isoliert voneinander. Irgendwie hängen sie<br />
miteinander zusammen. Der technische elektrische Stromkreis liefert den Kontext. In ihm sind<br />
physikalische und technische Grundbegriffe miteinander „vermengt". So weist ein<br />
Installationsschalter Merkmale auf, die aus physikalischen Gründen so sein müssen (z.B. Abstand<br />
der geöffneten Schaltflächen) und andere, die technischer ökonomischer Art sind (z.B. der<br />
Werkstoff der Kontaktflächen). In jedem elektrischen Gerät gibt es Eigenschaften, die aus<br />
physikalischen Gründen unumgänglich sind und solche, die so oder so „gemacht" sein können. Bei<br />
jeder technischen Realität gibt es „naturwissenschaftliche" Zwänge und Gestaltungsspielräume mit<br />
jeweils anderen Zwängen. <strong>Die</strong>sen Zusammenhang durchschauen zu können, ist ein wesentlicher<br />
Faktor allgemeiner und technischer Bildung. Ein rein physikalischer Zugang zu dem Grundbegriff<br />
elektrischer Stromkreis verfehlt diese allgemeine Bildung.<br />
Eine Einführung in die elektrotechnischen Grundbegriffe kommt ohne Belehrung nicht aus.<br />
Niemand kann aus sich heraus Begriffe entwickeln, die sich in einem langen gesellschaftlichen<br />
Prozess inhaltlich und in ihrer sprachlichen Form entwickelt haben. Das Medium der Begriffe und<br />
deren Begreifen ist die Sprache. Werden die Schüler mit der sprachlichen Form eines Begriffes<br />
konfrontiert, bevor sie <strong>des</strong>sen Inhalt begriffen haben, kommt es häufig zu großen Verwirrungen. Da<br />
alles Gesprochene auf ein Vorverständnis stößt, rufen die Begriffsnamen Vorstellungen in das<br />
Bewusstsein, die in der Regel kaum etwas mit den naturwissenschaftlich-technischen<br />
Begriffsinhalten und den ihnen zugrunde liegenden Phänomenen zu tun haben. <strong>Die</strong> zu<br />
vermittelnden naturwissenschaftlich-ökonomisch-technischen Begriffe sind das Ergebnis eines<br />
langen Forschungsprozesses, und Forschen bedeutet Fragen.<br />
Auch das individuelle Eindringen in neue Wissensstrukturen ist ein Frageprozess. Etwas<br />
verstehen, etwas begreifen ist das Antwortfinden auf eine zuvor gestellte Frage. Wenn Schüler im<br />
Unterricht Schwierigkeiten haben, etwas zu verstehen, dann wissen sie in der Regel nicht, um<br />
welche Frage es bei dem zu Verstehenden geht. <strong>Die</strong>sen Zusammenhang nicht zu erkennen,<br />
kennzeichnet weitgehend den heutigen Mathematikunterricht mit der Folge, dass er in der Regel<br />
bei den Schülern keinerlei Bildungswirkung hinterlässt.<br />
Am Beginn je<strong>des</strong> Verstehensprozesses stehen Fragen. Deshalb muss auch jeder<br />
Belehrungsprozess, bei dem es darum geht, geistig verfügbares Wissen zu vermitteln, mit den<br />
Fragen beginnen, die das Wissen an die Phänomene binden.]<br />
„Was hat ein Stromkreis mit einem Kreis zu tun?“ " " Was ist elektrischer Strom?" „Was ist<br />
Stromstärke?" „Was verbraucht ein Verbraucher?" „Warum sind Leitungen aus Kupfer?" „Wie ist<br />
ein normaler Installationsschalter aufgebaut?" „Wie funktioniert sein Schaltmechanismus?"<br />
„Warum hat er diesen Schaltmechanismus?" „Warum sitzt der Schalter in der L1 Leitung?" „Warum<br />
nicht im Neutralleiter?" „Ist OV gefährlich?" „Was bedeutet Volt?" „Was ist elektrische Spannung?"<br />
oder so ähnlich können die Fragen lauten, um deren Bearbeitung es in der fünften<br />
Unterrichtseinheit geht.<br />
[ Wie sollen diese Fragen nun bearbeitet werden? Fragend entwickelnd? Arbeitsteilig in<br />
Kleingruppen? In Einzelarbeit? Durch Lehrervortrag? Alle diese Wege sind gangbar. Welcher<br />
gewählt wird, hängt von zusätzlichen Variablen ab. Erkennt der Lehrer z.B., dass die Schüler von<br />
der Frage: „Wieso eigentlich Stromkreis, wenn die vorliegende Schaltung, (vor allem in aufgelöster<br />
Darstellung), überhaupt nichts mit einem Kreis zu tun hat?" wirklich erfasst sind, wäre ein guter<br />
Lehrervortrag eine gute Wahl. Ob ein Vortrag gut oder schlecht ist, ist leicht daran zu erkennen, ob<br />
die Zuhörer konzentriert bei der Sache bleiben. Merkt der vortragende Lehrer, dass bei einigen<br />
Schülern während <strong>des</strong> Vortrags Fragen auftauchen, kann er den Vortrag vorsichtig zu fragender<br />
Entwicklung hin öffnen. Geht eine Schülerfrage am Thema vorbei, erkennt der Vortragende, dass<br />
er diesen Zuhörer nicht so erreicht, wie er ihn erreichen wollte. An der Reaktion der anderen<br />
Schüler lässt sich erkennen, ob es nur diesen Schüler oder mehrere betrifft.<br />
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Gottfried</strong> <strong>Adolph</strong> <strong>Die</strong> <strong>Praxis</strong> <strong>des</strong> <strong>handlungsorientierten</strong> Unterrichts 11/14