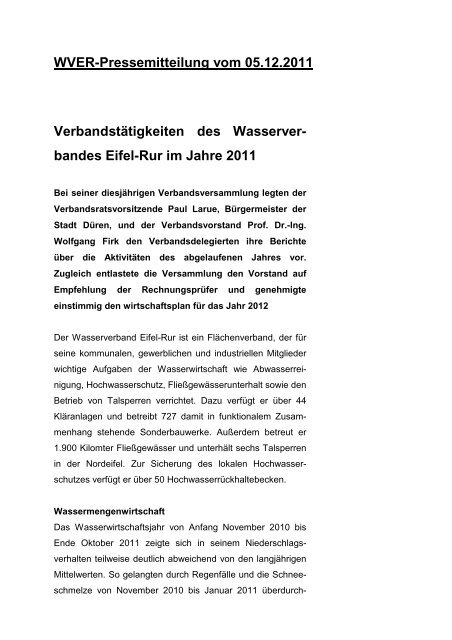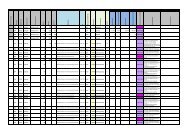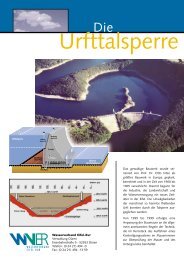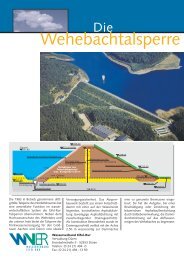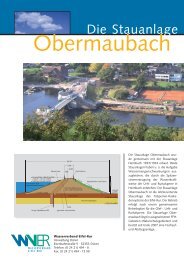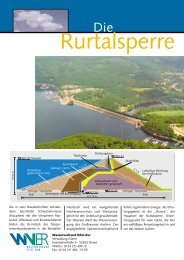Vorlage allgemeine Schreiben - Wasserverband Eifel-Rur
Vorlage allgemeine Schreiben - Wasserverband Eifel-Rur
Vorlage allgemeine Schreiben - Wasserverband Eifel-Rur
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WVER-Pressemitteilung vom 05.12.2011<br />
Verbandstätigkeiten des <strong>Wasserverband</strong>es<br />
<strong>Eifel</strong>-<strong>Rur</strong> im Jahre 2011<br />
Bei seiner diesjährigen Verbandsversammlung legten der<br />
Verbandsratsvorsitzende Paul Larue, Bürgermeister der<br />
Stadt Düren, und der Verbandsvorstand Prof. Dr.-Ing.<br />
Wolfgang Firk den Verbandsdelegierten ihre Berichte<br />
über die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres vor.<br />
Zugleich entlastete die Versammlung den Vorstand auf<br />
Empfehlung der Rechnungsprüfer und genehmigte<br />
einstimmig den wirtschaftsplan für das Jahr 2012<br />
Der <strong>Wasserverband</strong> <strong>Eifel</strong>-<strong>Rur</strong> ist ein Flächenverband, der für<br />
seine kommunalen, gewerblichen und industriellen Mitglieder<br />
wichtige Aufgaben der Wasserwirtschaft wie Abwasserreinigung,<br />
Hochwasserschutz, Fließgewässerunterhalt sowie den<br />
Betrieb von Talsperren verrichtet. Dazu verfügt er über 44<br />
Kläranlagen und betreibt 727 damit in funktionalem Zusammenhang<br />
stehende Sonderbauwerke. Außerdem betreut er<br />
1.900 Kilomter Fließgewässer und unterhält sechs Talsperren<br />
in der Nordeifel. Zur Sicherung des lokalen Hochwasserschutzes<br />
verfügt er über 50 Hochwasserrückhaltebecken.<br />
Wassermengenwirtschaft<br />
Das Wasserwirtschaftsjahr von Anfang November 2010 bis<br />
Ende Oktober 2011 zeigte sich in seinem Niederschlagsverhalten<br />
teilweise deutlich abweichend von den langjährigen<br />
Mittelwerten. So gelangten durch Regenfälle und die Schneeschmelze<br />
von November 2010 bis Januar 2011 überdurch-
schnittliche Wassermengen in die Talsperren. Besonders im<br />
Januar floss mehr als doppelt soviel Wasser zu als im<br />
langjährigen Mittel.<br />
Die Monate Februar bis Mai fielen besonders niederschlagsarm<br />
aus, was sich auch in deutlich geringeren Zuflüssen in die<br />
Stauseen bemerkbar machte. Selbst im relativ feuchten Sommer<br />
stiegen die Zuflüsse kaum, da dann der Niederschlag von<br />
der Vegetation verdunstet wird und nicht in die Seen gelangt.<br />
Nach dem Sommer waren wiederum überdurchschnittlich<br />
trockene Monate September und Oktober zu verzeichnen.<br />
Aber auch der November 2011 und damit der Beginn des<br />
wasserwirtschaftlichen Folgejahres zeichnete sich durch<br />
übergroße Trockenheit aus.<br />
Dies führte zu einem deutlichen Zuflussdefizit in die<br />
Stauanlagen, die jedoch trotzdem zu jedem Zeitpunkt ihre<br />
wasserwirtschaftlichen Aufgaben in Bezug auf Mindestabgaben<br />
an den Unterlauf bzw. die Trinkwasserversorgung<br />
erfüllen konnten.<br />
Trotz des optisch geringen Füllstandes der Stauanlagen kann<br />
aber auch im kommenden Jahr die wasserwirtschaftliche<br />
Aufgabenerfüllung gewährleistet werden, selbst wenn ein<br />
erneutes Jahr mit geringen Zuflüssen erfolgen sollte. Das<br />
Talsperrensystem ist darauf ausgelegt, ein Doppeltrockenjahr<br />
zu überstehen.<br />
Maßnahmen an Talsperren<br />
Die Sicherung der Standfestigkeit der Talsperren erfordert<br />
eine ständige Pflege der Anlagen. Dazu gehören unter anderem<br />
auch Unterhaltungsmaßnahmen wie die im Berichtsjahr<br />
erfolgte Entkrautungsaktion im Eiserbachsee der <strong>Rur</strong>talsperre<br />
Schwammenauel. An der Oleftalsperre wurde zudem<br />
der Ablaufpegel erneuert. Im Obersee der <strong>Rur</strong>talsperre wurde<br />
bei <strong>Rur</strong>berg eine neue Steganlage eingebracht.
Die Talsperren dienen auch der Energiegewinnung, indem<br />
das Wasser nicht einfach durch die Grundablässe abgelassen,<br />
sondern dabei über Turbinen geführt wird. Lediglich an<br />
der Wehebachtalsperre fehlte diese Möglichkeit noch. Die Abgabe<br />
von bis zu maximal 200 Litern in der Sekunde machte<br />
eine wirtschaftliche Energiegewinnung in der Vergangenheit<br />
dort nicht möglich. Dank verbesserter Technik konnte dort nun<br />
eine Miniturbine eingesetzt werden, die umgerechnet Strom<br />
für bis zu 100 Haushalte liefern kann.<br />
Das Thema Energie wurde auch durch die Absicht des<br />
Unternehmens Trianel zum Bau eines Pumpspeicherkraftwerks<br />
in den Focus der Öffentlichkeit gerückt. Dazu soll auf<br />
dem Gebiet der Gemeinde Simmerath ein Gegensee angelegt<br />
werden, der dann im Verbund mit dem Hauptsee der<br />
<strong>Rur</strong>talsperre als Pumpeicher dienen könnte.<br />
Der WVER als Besitzer des <strong>Rur</strong>sees muss dabei die Standsicherheit<br />
und die ungestörte Erfüllung der bisherigen wasserwirtschaftlichen<br />
Aufgaben und Nutzungen der Stauanlage<br />
sicherstellen. Daraus ergeben sich Fragen nach der Standsicherheit<br />
von Böschungen und Bauwerken, den limnologischen<br />
Auswirkungen, dem <strong>allgemeine</strong>n Betrieb und der Beeinträchtigung<br />
des Tourismus durch die beabsichtigte Pumptätigkeit,<br />
die nicht unerhebliche Wasserstandsschwankungen<br />
im Tagesverlauf mit sich bringen würde. Hierzu muss Trianel<br />
entsprechende Gutachten beibringen.<br />
Hochwasserschutz im Rahmen der europäischen<br />
Richtlinie<br />
Der WVER befasste sich auch im Berichtsjahr in Zusammenarbeit<br />
mit der Bezirksregierung Köln an der Umsetzung<br />
der europäischen Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie.<br />
Diese sieht unter anderem bis 2013 die Erstellung von<br />
Hochwassergefahrenkarten vor. Bis 2015 sollen daraus entsprechende<br />
Hochwasserrisikomanagementpläne entwickelt
werden. Im Verbandsgebiet des WVER sind dazu 33 Gewässer<br />
zu betrachten. Bisher erfolgten die Vermessung der Gewässer<br />
sowie die Aufstellung von Niederschlag-Abfluss-<br />
Modellierungen. Die nächsten Schritte werden die hydraulische<br />
Modellierung und die Ermittlung der Überschwemmungsflächen<br />
sein.<br />
Bau von Hochwasserrückhaltebecken<br />
Der WVER verbessert auch konkret den Hochwasserschutz in<br />
seinem Verbandsgebiet. So geht es auch beim Hochwasserschutz<br />
am Omerbach in Nothberg voran. Nachdem bereits<br />
vor drei Jahren des Hochwasserrückhaltebecken Omerbach in<br />
Betrieb gehen konnte, wurde im Berichtsjahr der Bau<br />
entsprechender Becken in Gressenich und am Diepenlinchenbach<br />
begonnen, wodurch ein 100jährlicher Schutz am<br />
Omerbach gesichert wird.<br />
Ebenso wurden Planungen zum Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens<br />
am Wiesenbach auf dem Gebiet von<br />
Kreuzau aufgestellt. Mit dem Bau des Beckens wird im neuen<br />
Jahr begonnen werden.<br />
EU-Wasserrahmenrichtlinie<br />
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie sieht vor, das – unter<br />
Einbeziehung möglicher Verlängerungszeiträume – bis zum<br />
Jahre 2027 ein „guter Zustand“ der Gewässer erreicht werden<br />
soll. Dabei liegt das Hauptaugenmerk dank eines funktionierenden<br />
Gewässerschutzes und des Betriebs von leistungsstarken<br />
Kläranlagen weniger auf der biologischen und chemischen<br />
Güte der Gewässer, sondern vielmehr auf der Gewässerstruktur,<br />
die vor allen Dingen durch Begradigungsmaßnahmen<br />
in der Vergangenheit in Mitleidenschaft gezogen<br />
wurde.<br />
Im Berichtsjahr wurde mit der Erstellung der Umsetzungsfahrpläne<br />
für notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der
Gewässerstruktur begonnen. Dazu wurden in regionalen<br />
Kooperationen insgesamt 13 Planungsbereiche im Einzugsgebiet<br />
der <strong>Rur</strong> festgelegt, in denen insgesamt 26 Workshops<br />
durchgeführt wurden und werden, in denen die anstehenden<br />
Maßnahmen diskutiert und festgelegt werden. Dieser Arbeitsschritt<br />
wird im April 2012 abgeschlossen sein.<br />
Eine konkrete Maßnahme, die in diesem Zusammenhang im<br />
Berichtsjahr geplant wurde, ist die Renaturierung eines Wurmabschnitts<br />
in Übach-Palenberg. Dort soll es zu einer Laufstreckenverlängerung<br />
von 30 % kommen. 50.000 Kubikmeter<br />
Retentionsraum im Rahmen des vorausschauenden Hochwasserschutzes<br />
werden zudem geschaffen. Die Kosten von<br />
1,6 Millionen Euro werden mit 80 % durch das Land NRW<br />
bezuschusst.<br />
Energiegewinnung auf Kläranlagen<br />
Mit der Errichtung von drei Faultürmen und einem Blockheizkraftwerk,<br />
die im Jahre 2010 offiziell in Betrieb genommen<br />
wurden, kann der WVER den Energie- und Wärmebedarf der<br />
Kläranlage Düren zum großen Teil selbst decken und sich<br />
damit vom Zukauf externer Energie unabhängig machen. Die<br />
Faultürme bieten jedoch noch weitere Kapazitäten über die<br />
Vergärung der anfallenden Klärschlämme hinaus. Deswegen<br />
wurden im Berichtsjahr Laborversuche zur so genannten Co-<br />
Vergärung unternommen, die im Jahr 2011 in einem der Faultürme<br />
fortgesetzt werden. Durch die Hinzugabe von geeigneten<br />
Substraten, nämlich Produktionsabfällen aus der Nahrungsmittelindustrie<br />
wie z. B. Schälabfällen von Gemüse soll<br />
der Gasanfall und damit die Energieausbeute erhöht werden.<br />
Dazu ist im Versuch zu testen, ob der Faulungsprozess stabil<br />
bleibt, wie hoch die zusätzliche Gasausbeute ist, welche<br />
Qualität das Gas hat und wie weit die hinzu gegebenen<br />
Substrate im Faulturm abgebaut werden.
Messprogramm am Regenrückhaltebecken Kleebach in<br />
Aachen<br />
Die Anwohner des Regenrückhaltebeckens Kleebach klagten<br />
in der Vergangenheit über Geruchsbelästigungen, die durch<br />
das Becken bei Einstau verursacht worden sein sollen. Der<br />
WVER übernahm das Becken im Berichtsjahr von der<br />
STAWAG Aachen und setzte ein Messprogramm in Gang, um<br />
die Art und die Quelle des Geruchs genau bestimmen zu<br />
können. Außerdem wird das Becken nach einem Einstau<br />
jeweils gründlich gereinigt.<br />
Im Berichtsjahr konnten bisher keine Beschwerde über<br />
unangenehme Gerüche verzeichnet werden.<br />
Abwassermenge im Berichtsjahr<br />
Der <strong>Wasserverband</strong> <strong>Eifel</strong>-<strong>Rur</strong> reinigte in allen seinen Anlagen<br />
im Jahr 2010 129,76 Mio. Kubikmeter Abwasser. In den letzten<br />
Jahren hat sich eine Menge von ca. 130 Mio. Kubikmeter<br />
als Durchschnitt stabilisiert. Lediglich die Jahre 2007 und<br />
2008 fielen als nassere Jahre mit über 140 Mio. Kubikmeter<br />
gereinigten Abwassers aus dem Rahmen.<br />
Kosten der Abwasserreinigung<br />
Die Reinigungskosten für einen Kubikmeter Abwasser lagen<br />
im Verbandsschnitt im Jahr 2010 bei 0,73 Euro und damit<br />
einen Cent über dem Vorjahreswert. Dabei entfielen 45 % auf<br />
Investitionen und 55 % auf Löhne, Energie, Instandhaltungen,<br />
Kauf von Betriebsmitteln únd Entsorgungskosten.<br />
Zukünftige Investitionen auf Kläranlagen<br />
Die Kläranlage Aachen-Soers erfuhr ihre letzte Erweiterung im<br />
Jahr 1992. Auch andere Kläranlagen des WVER wurden in<br />
den 90er Jahren baulich verändert. Damals kam die Nährstoffelimination<br />
als geforderte Reinigungsleistung hinzu, da
sich Probleme mit einer Eutrophierung der Gewässer bis in<br />
die Nordsee zeigten.<br />
Nach fast 20jährigem Betrieb der Erweiterungen sind auf<br />
diesen Kläranlagen in Zukunft Reinvestitionen in der Maschinentechnik,<br />
der Elektrotechnik und der Prozessleittechnik erforderlich,<br />
die ab dem nächsten Jahr angegangen werden.<br />
Mikroverunreinigungen im Abwasser<br />
Das Wasser ist einer Reihe von Mikroverunreinigungen ausgesetzt,<br />
die aus Industrie- und Haushaltschemikalien, Waschmittelinhaltsstoffen,<br />
Körperpflegemitteln, Arzneimitteln, Röntgenkontrastmitteln,<br />
Hormonen Veterinärpharmaka, Futterzusatzstoffen,<br />
Korrosionsschutzmitteln, Bioziden, Herbiziden,<br />
Insektiziden und Fungiziden stammen. Neben punktförmigen,<br />
lokalisierbaren Eintragsquellen wie Kläranlagen, die Pharmaka,<br />
Hormone und Biozide eintragen, erfolgt die Gewässerverunreinigung<br />
auch aus diffusen Quellen wie Straßen, Bahntrassen,<br />
undichten Kanälen, Mischwasserüberläufen, der Tierhaltung<br />
und der Schifffahrt, aber auch durch die Ausbringung<br />
von Pflanzenschutzmitteln.<br />
Das Umweltbundesamt fordert die Einführung einer 4. Reinigungsstufe<br />
auf Kläranlagen, um die dort anfallenden Mikroverunreinigungen<br />
herauszufiltern. Der dafür zu treibende technische<br />
Aufwand würde nach Schätzungen den Preis für einen<br />
gereinigten Kubikmeter Abwasser um ca. 10 – 20 Cent erhöhen.<br />
Eine Realisierung der 4. Reinigungsstufe brächte<br />
jährliche Mehrkosten für die Abwasserreinigung von ca. 15 –<br />
30 % mit sich.<br />
Wirtschaftsplan 2012<br />
Der Wirtschaftsplan 2012 wird ein Volumen von 204.216.305<br />
Euro umfassen. Dabei entfallen 139.414.645 Euro auf den<br />
Erfolgsplan und 64.801.660 Euro auf den Vermögensplan.
Beitragsbedarf<br />
Der durch die Mitglieder des WVER zu erbringende Beitrag<br />
wurde entsprechend dem 2004 angefallenen Beitrag (in diesem<br />
Jahr war der Aufbau des Verbandes mit der unterjährigen<br />
Übernahme der Kläranlagen der Stadt Aachen im<br />
Vorjahr abgeschlossen) in einer Vereinbarung zwischen Verbandsrat<br />
und Vorstand auf maximal 132 Mio. Euro begrenzt.<br />
Diese Begrenzung wurde seitdem stets zielsicher eingehalten.<br />
Im Jahr 2012 wird sie mit 130,3 Mio. Euro sogar noch unter<br />
dem Beitragsbedarf des Jahres 2004 liegen.<br />
Schuldenstand und Eigenkapitalquote<br />
Der WVER konnte im Berichtsjahr seinen Schuldenstand<br />
weiter von 499 auf 488 Mio. Euro abbauen. Einer Neukreditaufnahme<br />
von 22 Mio. Euro stand eine Tilgung von 33 Mio.<br />
Euro entgegen. Die Eigenkapitalquote liegt bei ca. 25 %.