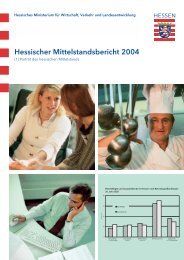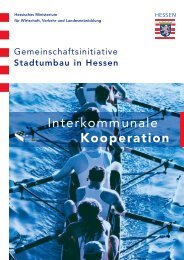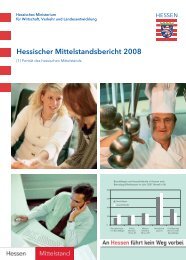PDF - HA Hessen Agentur GmbH
PDF - HA Hessen Agentur GmbH
PDF - HA Hessen Agentur GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Evaluierung des Projektes<br />
Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Wilfried Möhrle<br />
Bernd Werner<br />
Report Nr. 681<br />
Wiesbaden 2005
Eine Veröffentlichung der<br />
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Postfach 1811<br />
D-65008 Wiesbaden<br />
Abraham-Lincoln-Straße 38-42<br />
D-65189 Wiesbaden<br />
Telefon 0611 / 774-81<br />
Telefax 0611 / 774-8313<br />
E-Mail info@hessen-agentur.de<br />
Internet http://www.hessen-agentur.de<br />
Geschäftsführer:<br />
Martin H. Herkströter<br />
Dr. Dieter Kreuziger<br />
Diese Studie wurde im Auftrag des Hessischen Sozialministeriums erstellt und aus<br />
Mitteln des Europäischen Sozialfonds unterstützt.<br />
Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit Quellenangabe<br />
gestattet. Belegexemplar erbeten.
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Evaluierung des Projektes Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Inhalt<br />
Seite<br />
1 Einleitung und Untersuchungsziel 1<br />
2 Die Arbeitsmarktsituation in Kassel 4<br />
2.1 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 4<br />
2.2 Entwicklung der Arbeitslosigkeit 6<br />
3 Das Kasseler Modell Kombilohn 12<br />
3.1 Erfahrungshintergrund und Ziel des Modellprojektes 12<br />
3.1.1 Art und Umfang der Förderung durch das Land <strong>Hessen</strong> bzw. den ESF<br />
(Definition des bewilligten Projektes) 14<br />
3.2 Die Kommunale Arbeitsförderung als Träger des Modellprojektes 16<br />
3.2.1 Auswahl, Unterstützung und Vermittlung der Teilnehmer/innen am<br />
Modellprojekt durch den Projektträger „Kommunale Arbeitsförderung<br />
(KAF)“ 18<br />
3.2.2 Marketingaktivitäten zur Bekanntmachung des Modellprojektes und<br />
zur Gewinnung von Arbeitgebern 23<br />
4 Soziodemografische Struktur der Teilnehmer/innen am Kasseler<br />
Modellversuch Kombilohn 26<br />
5 Die Einbeziehung der Teilnehmer/innen in den Evaluierungsprozess 32<br />
5.1 Untersuchungsziel der Teilnehmerbefragungen 32<br />
5.2 Durchführung der Befragungen 34<br />
6 Die erste Teilnehmerbefragung 35<br />
6.1 Vorbemerkungen 35<br />
6.2 Dauer und Gründe der Erwerbslosigkeit der Teilnehmer/innen 35<br />
6.3 Persönliche Lebenssituation der Teilnehmer/innen 40<br />
6.4 Erwartungen der Teilnehmer/innen und erste Erfahrungen mit dem<br />
Modellversuch 41<br />
7 Die zweite Teilnehmerbefragung 47<br />
7.1 Zielsetzung und Methode 47<br />
7.2 Repräsentativitätsüberprüfung, Struktur der Teilnehmer/innen 47<br />
7.3 Auswertung der Befragungsergebnisse 50<br />
I
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Inhalt<br />
Seite<br />
7.3.1 Direkte Wirkungen der Teilnahme am Modell 50<br />
7.3.2 Derzeitige Erwerbssituation 52<br />
7.3.3 Zufriedenheit mit der (privaten) Lebenssituation 53<br />
7.3.4 Zusammenarbeit mit der KAF 55<br />
7.3.5 Gesamtbewertung des Modells durch den/die Teilnehmer/in 57<br />
7.4 Auswertung der 2. Teilnehmerbefragung nach besonderen Merkmalen 58<br />
7.4.1 Verbleib nach abgeschlossener geförderter Arbeit 58<br />
7.4.2 Auswirkung von geförderter Arbeit auf die Lebensumstände und<br />
Zufriedenheit der Teilnehmer/innen mit dem Modellversuch 58<br />
7.4.3 Auswirkung von geförderter Arbeit auf den Übergang in dauerhafte<br />
Arbeitsverhältnisse 60<br />
7.5 Auswertung der Fragebogen von den Teilnehmer/innen, die an der 1.<br />
und der 2. Befragung teilgenommen haben 60<br />
7.5.1 Dauerhaftigkeit der Arbeitsverhältnisse 60<br />
7.5.2 Fragen zur aktuellen und damaligen Lebenssituation 61<br />
7.5.3 Erfüllung der Erwartungen beim Eintritt in den Modellversuch 62<br />
8 Einbeziehung der Arbeitgeber in den Evaluierungsprozess 64<br />
8.1 Methodisches Vorgehen und zeitlicher Ablauf der schriftlichen<br />
Befragungen 64<br />
8.2 Erste Befragung der Arbeitgeber mit geförderten Beschäftigten 65<br />
8.2.1 Information und Motivation 65<br />
8.2.2 Arbeitsmarktpolitik/Arbeitsamt/Kommunale Arbeitsförderung 68<br />
8.2.3 Erfahrungen mit dem Modellprojekt und dessen Umsetzung 69<br />
8.2.4 Fragen zu Person und Qualifikation der Beschäftigten und der<br />
Besetzung des Arbeitsplatzes 73<br />
8.3 Zweite Befragung der Arbeitgeber mit geförderten Beschäftigten 76<br />
8.3.1 Stellenbesetzung und deren Nachhaltigkeit 76<br />
8.3.2 Zusammenarbeit mit der Kommunalen Arbeitsförderung 82<br />
9 Befragung der Arbeitgeber ohne KaMoKo-Beschäftigten 86<br />
9.1 Methodenbeschreibung 86<br />
9.2 Auswertung der Befragung 87<br />
9.2.1 Fragen zu Ihrem Betrieb 87<br />
9.2.2 Fragen zur Arbeitsförderung in Kassel 90<br />
9.2.3 Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich 97<br />
II
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Inhalt<br />
Seite<br />
10 Einbeziehung der KAF in den Evaluierungsprozess 101<br />
11 Zusammenfassung und Empfehlungen 102<br />
Tabellenverzeichnis 106<br />
Abbildungsverzeichnis 107<br />
Literatur 109<br />
Anhang 1 Faksimileabdrucke der Fragebogen<br />
1. Teilnehmerbefragung 1<br />
2. Teilnehmerbefragung 5<br />
1. Arbeitgeberbefragung Unternehmen mit Kamoko-Beschäftigten 7<br />
2. Arbeitgeberbefragung Unternehmen mit Kamoko-Beschäftigten 9<br />
Arbeitgeberbefragung Unternehmen ohne Kamoko-Beschäftigte 11<br />
Anhang 2 Dokumentation der Öffentlichkeitsarbeit der Kommunalen Arbeitsförderung<br />
III
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
IV
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
1 Einleitung und Untersuchungsziel<br />
Die Europäische Union hat mit ihrer Entscheidung, die Förderung der Beschäftigung<br />
und den Abbau der Arbeitslosigkeit zu einem Hauptschwerpunkt der gemeinschaftlichen<br />
Anstrengungen zu machen, einen wichtigen arbeitsmarktpolitischen Impuls<br />
gegeben. Dies manifestiert sich sowohl in der erweiterten, aber auch flexibleren<br />
Zielvorgabe für die Pläne und Umsetzung der neuen Förderperiode der Strukturfonds<br />
(2000-2006) als auch in der besseren finanziellen Ausstattung insbesondere<br />
des für die Arbeitsmarktpolitik relevanten Fonds, des Europäischen Sozialfonds<br />
(ESF).<br />
Das Bundesland <strong>Hessen</strong> hat die Verbesserung der finanziellen Ausstattung des<br />
ESF und die Verbreiterung seiner Einsatzmöglichkeiten dahingehend genutzt, bewährte<br />
Programme fortzuführen und gleichzeitig neue Programme in die Förderung<br />
aufzunehmen, um einem noch breiteren Kreis von Zielgruppen noch spezifischere<br />
Maßnahmen anbieten zu können. Eines dieser Programme ist das aus mehreren<br />
Programmmodulen bestehende “Hessische Aktionsprogramm regionale Arbeitsmarktpolitik“<br />
(<strong>HA</strong>RA). In seinem Rahmen wird als „Experiment“ seit November 2001<br />
das „Kasseler Modell Kombilohn“ (KaMoKo) gefördert.<br />
Zentraler und im Vergleich mit ähnlichen Programmen zusätzlicher Ansatzpunkt von<br />
KaMoKo ist die Verbesserung der Eingliederung von Sozialhilfeempfängern durch<br />
die aktive Erschließung neuer Arbeitsplätze im Bereich geringer Qualifikationserfordernisse<br />
und Entlohnung. Dies tritt im Modellversuch neben die herkömmliche Förderung<br />
der Eingliederung der Zielgruppe (Lohnkostenzuschüsse, Qualifizierungsmaßnahmen<br />
usw.).<br />
Gleichzeitig mit den flexibleren Einsatzmöglichkeiten des ESF stellt die EU jedoch<br />
auch höhere Ansprüche an die Begleitung der Programme und fordert eine erweiterte<br />
Berichtspflicht ein. Da es sich bei der ESF-Förderung in der Förderperiode 2000-<br />
2006 um einen Programmansatz handelt, bei dem der Bund die Gesamtverantwortung<br />
für das Programm trägt, wurde ein bundeseinheitliches abgestimmtes Monitoring<br />
mit einem eigens dafür entwickelten Indikatorenkatalog eingeführt. Dieser dient<br />
dazu, über alle Länder vergleichbare und aggregierbare Daten für die laufende Berichterstattung<br />
der Bundesrepublik Deutschland zu liefern, und bildet gleichzeitig eine<br />
gute Datenbasis für die vertiefenden, zusätzlich erforderlichen Evaluationen der<br />
Programme. Aufgrund der Tatsache, dass durch das Monitoring die beschreibende,<br />
quantitative Abbildung der Programmabwicklung weitgehend abgedeckt ist, kann<br />
der Schwerpunkt vertiefender Evaluationen in der Erfassung von qualitativen Informationen<br />
über Programmablauf und -ergebnis liegen.<br />
1
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Die von den Ländern durchgeführten vertiefenden Evaluationen dienen nicht nur der<br />
landesinternen Erfolgskontrolle und Steuerung der Arbeitsmarktförderung; sie fließen<br />
auch in die laut EU-Verordnung vorgeschriebene Zwischenevaluierung zur Mitte<br />
der Förderperiode auf Bundesebene ein.<br />
Im Rahmen einer Evaluation sind generell folgende Aspekte zu berücksichtigen:<br />
Problemanalyse, Programmausrichtung/Zielsetzung, Monitoring/Zielerreichung sowie<br />
Wirkungsanalyse und die Entwicklung von Handlungsstrategien.<br />
In einer kurzen Problemanalyse sind die für das Förderprogramm relevante regionale<br />
Ausgangssituation (Arbeitsmarkt, Beschäftigungsentwicklung, Wirtschaftsstruktur<br />
usw.) zu analysieren und aussagekräftige Indikatoren zu definieren, an denen<br />
die Informationen aus dem Monitoring und den Befragungen gespiegelt werden<br />
können. Die Grundlage hierfür sind insbesondere amtliche Statistiken sowie Informationen<br />
aus vorhandenen Gutachten und der wissenschaftlichen Literatur.<br />
Durch das Monitoring wird die Umsetzung des Förderprogramms, d.h. der materielle<br />
Verlauf der Förderung beschrieben. Die wesentlichen Bestandteile des Monitoringsystems<br />
sind Informationen zum Träger, zum Projekt sowie zu den geförderten<br />
Personen und Unternehmen. Ebenfalls im Monitoring darzustellen ist der finanzielle<br />
Verlauf des Förderprogramms.<br />
Auf der Basis der Ergebnisse der Monitoringphase erfolgt die Wirkungsanalyse,<br />
die eigentliche Erfolgs- und Effizienzmessung des Programms. Im Vordergrund<br />
steht dabei vor allem eine vertiefte Analyse von quantitativen und qualitativen Indikatoren.<br />
Hierzu zählen vor allem Details zum Ablauf und zur Umsetzung der Projekte,<br />
z. B. Organisation des Projekts, Kooperation und Kommunikation zwischen den<br />
Akteuren, Bewertung der Funktionsweise und des Ablaufs des Modellversuchs<br />
durch die kombilohngeförderten Personen und durch die Arbeitgeber. Diese Informationen<br />
werden ergänzt durch die Zielerreichungs- und Erfolgseinschätzung des<br />
Modells sowohl durch die Mitarbeiter der Kommunalen Arbeitsförderung (KAF) als<br />
auch die Kombilohnempfänger/innen und Arbeitgeber.<br />
Das Monitoring und die Wirkungsanalyse zusammen ermöglichen abschließend die<br />
Bewertung des Programms und seiner Umsetzung. Die Bilanzierung der Effekte<br />
und Ergebnisse des Förderprogramms sowie die Ableitung von eventuell notwendigen<br />
Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Wirkungseffizienz des Programms<br />
schließen die Evaluation ab.<br />
Auf diesen theoretischen Evaluierungsgrundlagen wurde das Untersuchungsdesign<br />
zur Evaluierung von KaMoKo entwickelt.<br />
2
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Da es sich bei dem Modellversuch KaMoKo – wie beim Programm <strong>HA</strong>RA insgesamt–<br />
um ein flexibles Programm handelt, kommt der Beobachtung der prozessualen<br />
Umsetzung eine entscheidende Bedeutung zu. Mit Hilfe einer vergleichenden<br />
Gegenüberstellung bei einzelnen Teilnehmern und Arbeitgebern lassen sich unterschiedliche<br />
Wirkungsweisen und Effekte darstellen.<br />
Gleichzeitig ist durch die laufende Beobachtung des Programmablaufes und die<br />
Einbeziehung aller Akteure in den Evaluierungsprozess festzustellen, wodurch und<br />
in welcher Art Veränderungen in der Situation der Teilnehmer/innen, des Arbeitsplatzangebotes<br />
oder sonstiger Einflussfaktoren eingetreten sind. Aufgrund dieser<br />
Konstellation wurde für die Beantwortung der zentralen Fragestellungen ein qualitativ<br />
orientiertes Evaluierungskonzept ausgewählt.<br />
Neben den Informationen, die über das bei ESF-geförderten Programmen obligatorische<br />
Monitoring anfallen, war es besonders bedeutsam, diese Kenntnisse durch<br />
eine Reihe von Primärerhebungen zu ergänzen, die im Rahmen der Standardbegleitung<br />
und -bewertung nicht abgedeckt werden können. Dies gilt insbesondere mit<br />
Blick auf die Einbeziehung der Akteure während des Programmablaufs. So lassen<br />
sich nur durch eine breite und umfassende Befragung der beteiligten Akteure die relevanten<br />
qualitativen Informationen generieren. Nachfolgend sind die wesentlichen<br />
Bausteine der Evaluierung dieses Modellprojekts näher dargestellt.<br />
Die Evaluierung basiert auf sechs Bausteinen:<br />
1. Kurze Arbeitsmarktanalyse des regionalen Arbeitsmarkts Kassel<br />
2. Auswertung der Anträge, Sach- und Durchführungsberichte der Zuwendungsempfänger,<br />
3. mehrmalige Befragung der geförderten Teilnehmer/innen,<br />
4. mehrmalige Befragung der Arbeitgeber,<br />
5. regelmäßiger Kontakt mit den im Projekt aktiven Berater/innen (KAF),<br />
6. Ergebnistransfer.<br />
Die begleitende Evaluierung fand im Zeitraum von Oktober 2002 bis Oktober 2004<br />
statt und wurde von der Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft <strong>Hessen</strong> mbH<br />
(FEH) durchgeführt, die seit Oktober 2004 als <strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> firmiert.<br />
Die Evaluierung wird aus Mitteln des Landes <strong>Hessen</strong> bzw. des Hessischen Sozialministeriums<br />
als Auftraggeber und aus der Technischen Hilfe des Europäischen Sozialfonds<br />
finanziert.<br />
3
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
2 Die Arbeitsmarktsituation in Kassel<br />
Um die arbeitsmarktpolitische Situation der Region und speziell der Stadt Kassel<br />
richtig einordnen zu können, sind hier die langfristigen sozioökonomischen Entwicklungstrends<br />
in Erinnerung zu rufen, die die Rahmenbedingungen für die Entwicklung<br />
Kassels bilden:<br />
• Die Bevölkerungsentwicklung verlief - abgesehen von einer kurzen Phase nach<br />
der Grenzöffnung zur ehemaligen DDR - unterdurchschnittlich.<br />
• Kennzeichnend für die Bevölkerungsstruktur ist ein überdurchschnittlicher Anteil<br />
Älterer, der begleitet wird von einer hohen Fluktuation bei den jüngeren<br />
Jahrgängen (Wanderungsbewegungen der Studenten der Gesamthochschule).<br />
• Trotz positiver Wirtschaftsimpulse durch die Grenzöffnung konnte der Rückstand<br />
in der Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen im Vergleich zur<br />
Landesentwicklung nicht verringert werden.<br />
• Die Wirtschaftstruktur in der Region Kassel ist besonders stark durch den<br />
sekundären Sektor geprägt. Innerhalb des Produzierenden Gewerbes liegt eine<br />
hohe Konzentration auf von der Globalisierung und vom Strukturwandel<br />
besonders betroffene Branchen - wie den Straßenfahrzeugbau und den<br />
Maschinenbau (Wehrtechnik) - vor.<br />
• Charakteristisch für diese Branchen im Raum Kassel ist ihre großbetriebliche<br />
Struktur und ihre Zugehörigkeit zu Konzernen mit Zentralen in anderen<br />
Regionen.<br />
• Das Niveau der Arbeitslosigkeit liegt seit langem über dem Landes-, Bundes- und<br />
EU-Durchschnitt. Es ist eine starke Verfestigung der Arbeitslosigkeit mit hoher<br />
Sockelarbeitslosigkeit festzustellen.<br />
2.1 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte<br />
Eine zeitnahe Darstellung der Beschäftigungssituation auf Kreisebene ist über die<br />
Statistik der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (BA-Statistik) 1 möglich. Die<br />
Wirtschaftsstruktur erscheint zwar dadurch im Vergleich mit den Ergebnissen der<br />
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR), die erst mit größerer zeitlicher Ver-<br />
1 Zum erfassten Personenkreis gehören nicht Beamte, die weit überwiegende Zahl der Selbstständigen und mithelfende<br />
Familienangehörige.<br />
Die Auswertung der Daten nach Landkreisen erfolgt vom Statistischen Landesamt auf Basis der Beschäftigtenstatistik<br />
der Bundesagentur für Arbeit (BA-Statistik).<br />
4
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
zögerung vorliegen, stärker auf das Produzierende Gewerbe ausgerichtet, weil Beamte<br />
und damit große Teile der öffentlich Bediensteten nicht in ihr erfasst werden.<br />
Bei der Beurteilung der Beschäftigtenentwicklung in Verbindung mit der Struktur und<br />
Entwicklung der Arbeitslosigkeit ist es jedoch wichtiger, die aktuellen Entwicklungstrends<br />
erfassen zu können. Dies leistet die BA-Statistik.<br />
Die Stadt Kassel ist ein regionales Arbeitsmarktzentrum, das durch einen Einpendlerüberschuss<br />
gekennzeichnet ist. 2003 weist die BA-Statistik rund 54.000 Beschäftigte<br />
am Wohnort, aber rund 91.500 Beschäftigte am Arbeitsort Kassel aus, mithin<br />
einen Einpendlerüberschuss von etwa 37.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.<br />
(Dazu kommen noch Beschäftigte, die nicht durch die BA-Statistik erfasst<br />
werden und über die somit keine aktuellen Informationen vorliegen.) Im Landkreis<br />
Kassel sind die Verhältnisse spiegelbildlich. Rund 60.000 Beschäftigten am Arbeitsort<br />
stehen rund 79.000 Beschäftigte am Wohnort gegenüber, so dass sich daraus<br />
ein Auspendlerüberschuss von knapp 20.000 ergibt.<br />
Abbildung 1: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 1997-2003<br />
(Juniwerte, Index 1997=100)<br />
105<br />
Index 1997=100<br />
100<br />
95<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />
Kassel, Stadt Landkreis Kassel RB Kassel <strong>Hessen</strong><br />
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; Statistische Berichte Kennziffer A VI 5.<br />
Die Entwicklung der Beschäftigtenzahl in Kassel in den letzten Jahren war sehr statisch<br />
und dadurch gekennzeichnet, dass der allgemein zu beobachtende Beschäftigtenanstieg<br />
Ende der 90erJahre/Anfang dieses Jahrhunderts in Kassel praktisch<br />
nicht mit vollzogen wurde. Allerdings setzte der Rückgang der Beschäftigtenzahlen<br />
5
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
im Vergleich zu <strong>Hessen</strong> oder auch zum Landkreis Kassel erst verzögert ein (vgl.<br />
Abbildung 1).<br />
Auch was die wirtschaftsstrukturelle Zusammensetzung der Arbeitsplätze anbelangt,<br />
sind Stadt und Landkreis Kassel sehr unterschiedlich bzw. sie ergänzen sich in ihren<br />
Funktionen. Die Stadt Kassel ist das nordhessische Dienstleistungszentrum mit<br />
einem Beschäftigtenanteil des Dienstleistungssektors von rund 77% und lediglich<br />
noch rund 23% Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe. In Kassel hat sich damit<br />
in den letzten Jahren Strukturwandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft fortgesetzt.<br />
Der Landkreis Kassel ist dagegen stark durch den Produzierenden Bereich geprägt.<br />
Knapp die Hälfte der Beschäftigten ist hier tätig.<br />
2.2 Entwicklung der Arbeitslosigkeit<br />
Obwohl das Kasseler Modell Kombilohn nur Personen betrifft, deren Sozialhilfeträger<br />
die Stadt Kassel ist, kommt der Entwicklung der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktsituation<br />
auch des Landkreises Kassel Bedeutung zu, weil die Vermittlung in<br />
(geförderte) Arbeitsverhältnisse nicht auf das Gebiet der Stadt Kassel beschränkt<br />
ist. Als Referenzräume werden zudem noch der Regierungsbezirk Kassel und <strong>Hessen</strong><br />
insgesamt herangezogen.<br />
Die Arbeitslosenzahl in Kassel liegt in den letzten Jahren in der Größenordnung von<br />
14.000. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von rund 16%, dem mit Abstand<br />
höchsten Wert aller hessischen Stadt- und Landkreise. Die jahresdurchschnittliche<br />
Arbeitslosigkeit in Kassel liegt seit Jahren und so auch vor und während des Modellversuchs<br />
um rund 8%-Punkte über dem Landesdurchschnitt und um rund 7%-<br />
Punkte über dem entsprechenden Wert im Landkreis Kassel. Wie die folgende Abbildung<br />
2 veranschaulicht, verlaufen die Entwicklungen in allen dargestellten Vergleichsregionen<br />
weitgehend parallel, unabhängig davon, ob die (allgemeine) Entwicklung<br />
der Arbeitslosigkeit einen ansteigenden oder sinkenden Trend zeigt.<br />
Lediglich seit 2001 zeigt die hessische Entwicklung – wenn auch auf niedrigerem<br />
Niveau – eine schlechtere Entwicklungstendenz auf als der Raum Kassel. Der<br />
Grund dafür ist die unterschiedliche Wirtschaftsstruktur, denn vom Anstieg der Arbeitslosigkeit<br />
waren in den letzen beiden Jahren verstärkt Dienstleistungsberufe betroffen,<br />
die in Kassel - im Vergleich zum Rhein-Main-Gebiet, wo sich der Beschäftigtenrückgang<br />
besonders auswirkte, - unterrepräsentiert sind.<br />
6
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Abbildung 2: Entwicklung der Arbeitslosenquote 1997-2003 (Jahresdurchschnittswerte)<br />
Arbeitslosenquote in % (bez. auf abhängige zivile Besch.)<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />
Kassel, Stadt Landkreis Kassel RB Kassel <strong>Hessen</strong><br />
Quelle: Bundesagentur für Arbeit- Regionaldirektion <strong>Hessen</strong>.<br />
Betrachtet man die Entwicklung der absoluten Zahl der Arbeitslosen, so wird dieser<br />
Effekt noch deutlicher: Bis 2001 ging die Arbeitslosenzahl in <strong>Hessen</strong> deutlich stärker<br />
zurück als in Kassel und in Nordhessen insgesamt. Durch den rapiden Anstieg der<br />
Arbeitslosigkeit in Südhessen wurde dieser Vorsprung innerhalb der beiden Jahre<br />
2002 und 2003 fast vollständig aufgezehrt. Unter den günstigen konjunkturellen Voraussetzungen<br />
Ende der 90er Jahre hat also der Arbeitsmarkt in Kassel nur sehr gering<br />
von dem Aufschwung profitiert und aktuell schlägt sich die Negativentwicklung<br />
nicht so stark nieder. Der Kasseler Arbeitsmarkt ist somit in den letzten Jahren – bei<br />
Weiterbestehen der Niveauunterschiede – von einer etwas größeren Stetigkeit gekennzeichnet<br />
als die Entwicklung im hessischen Durchschnitt.<br />
7
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Abbildung 3: Entwicklung der Arbeitslosenzahl 1997 – 2003<br />
(Jahresdurchschnittswerte, Index 1997 = 100)<br />
Index 1997=100<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />
Kassel, Stadt Landkreis Kassel RB Kassel <strong>Hessen</strong><br />
Quelle: Bundesagentur für Arbeit- Regionaldirektion <strong>Hessen</strong>, eigene Berechnungen.<br />
Die Zielgruppe des Kasseler Modells Kombilohn ist in der Arbeitsmarktstatistik am<br />
ehesten vergleichbar mit den Langzeitarbeitslosen. Hier ist die Entwicklung in Kassel<br />
in den letzten Jahren eindeutig ungünstiger verlaufen als im Landesdurchschnitt<br />
und auch deutlich schlechter als im Landkreis und in Nordhessen insgesamt.<br />
In Kassel ist die Zahl dieser am Arbeitsmarkt besonders schwer zu vermittelnden<br />
Personen zwischen 1997 und 2003 lediglich um 10% zurückgegangen, während in<br />
<strong>Hessen</strong> insgesamt und auch in den nordhessischen Vergleichsregionen über diesen<br />
Zeitraum ein Abbau um rund 20% stattgefunden hat.<br />
Auch in der Phase des starken Rückgangs der Zahl der gemeldeten Langzeitarbeitslosen<br />
in <strong>Hessen</strong> (in den Jahren 2000 bis 2002) um 30% gegenüber 1997 wirkte<br />
sich diese überregionale Tendenz in Kassel wesentlich weniger stark aus und es<br />
trat nur eine Reduktion der Zahl der Langzeitarbeitslosen um 13% ein (vgl. Abb. 4).<br />
8
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Abbildung 4: Entwicklung der Langzeitarbeitslosen 1997-2003<br />
(Jahresdurchschnittswerte, Index 1997 = 100)<br />
Index 1997=100<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />
Kassel, Stadt Landkreis Kassel RB Kassel <strong>Hessen</strong><br />
Quelle: Bundesagentur für Arbeit- Regionaldirektion <strong>Hessen</strong>, eigene Berechnungen.<br />
Differenziert nach dem Geschlecht ist festzustellen, dass - gemessen an den geschlechtsspezifischen<br />
Arbeitslosenquoten – im Bereich des <strong>Agentur</strong>bezirks Kassel 2<br />
Männer noch stärker als Frauen von Arbeitslosigkeit betroffen sind, und auch der<br />
Trend der letzten drei Jahre ist für Männer in Kassel besonders ungünstig. Die Arbeitslosenquote<br />
von Frauen hat in den beiden letzten Jahren um 0,7 %-Punkte abgenommen,<br />
während sie im Land <strong>Hessen</strong> gleichzeitig um 0,8% angestiegen ist (vgl.<br />
Abb. 5).<br />
Wie die Abbildung ebenfalls verdeutlicht, liegen im Landesdurchschnitt die Arbeitslosenquoten<br />
von Männern und Frauen mit einer Differenz von 1,7%-Punkten wesentlich<br />
dichter beieinander als dies im Bezirk Kassel (Abstand 2,8%-Punkte) der<br />
Fall ist. Das heißt, Frauen sind (bei wesentlich höherer Gesamtarbeitslosigkeit als in<br />
<strong>Hessen</strong>) in Kassel vergleichsweise weniger stark von Arbeitslosigkeit betroffen als<br />
Männer.<br />
2 Geschlechtsspezifische Arbeitslosenquoten liegen nur für Bezirke, nicht aber für Kreise vor.<br />
9
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Abbildung 5: Arbeitslosigkeit von Frauen und Männern 1997-2003 (Jahresdurchschnittswerte)<br />
Arbeitslosenquote in % (bez. auf abhängige zivile Besch.)<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />
AA Kassel Insgesamt AA Kassel Frauen AA Kassel Männer<br />
<strong>Hessen</strong> Insgesamt <strong>Hessen</strong> Frauen <strong>Hessen</strong> Männer<br />
Quelle: Bundesagentur für Arbeit- Regionaldirektion <strong>Hessen</strong>, eigene Berechnungen.<br />
Für einzelne Personengruppen 3 , die ebenfalls im Zusammenhang mit dem Kombilohnmodell<br />
von Interesse sind, stellt sich die Arbeitsmarktsituation wie folgt dar:<br />
Ausländer sind in Kassel mit etwas höheren Anteilen an der Arbeitslosenzahl beteiligt<br />
als im Landesdurchschnitt (22,8% gegenüber 21,0%) obwohl ihr Bevölkerungsanteil<br />
deutlich geringer ist als im Landesdurchschnitt. Die spezifische Arbeitslosigkeit<br />
ist mit einer Quote von 27,3% % mit Abstand die höchste aller hessischer Arbeitsamtsbezirke<br />
und liegt über 60% über dem Landesdurchschnitt.<br />
Für ältere Arbeitslose (> 55 Jahre) ergibt sich dagegen in Kassel eine relativ günstige<br />
Situation. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen lag 2003 bei 12,2 % und somit etwas<br />
besser als im Land (12,8 %). Allerdings muss festgestellt werden, dass in den letzten<br />
beiden Jahren die Zahl der arbeitslosen Ausländer – entgegen der Entwicklung<br />
in den Jahren zuvor – nur noch langsamer zurückging als in <strong>Hessen</strong> insgesamt.<br />
Die für einzelne Personengruppen besonders schwierige Situation am Arbeitsmarkt<br />
lässt sich auch anhand spezifischer Arbeitslosenquoten zeigen.<br />
3 Absolute Zahlen und Anteilswerte liegen für diese einzelnen Personengruppen im Gegensatz zu den Arbeitslosenquoten<br />
auch auf Kreisebene vor, so dass diese Aussagen korrekt die Gegebenheiten für die Stadt Kassel und zum Vergleich für<br />
den Landkreis Kassel abbilden. Die Quotenangaben beziehen sich auf den gesamten <strong>Agentur</strong>bezirk Kassel, der im Wesentlichen<br />
aus dem Stadt- und Landkreis Kassel besteht, aber auch Teile des Schwalm-Eder-Kreises und des Werra-<br />
Meißner-Kreises umfasst.<br />
10
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Die Arbeitslosenquote von jüngeren Arbeitslosen (unter 25 Jahren) hatte in den<br />
letzten Jahren trotz der Probleme am Ausbildungsstellenmarkt eine günstigere Entwicklung<br />
als die Gesamtarbeitslosenquote in Kassel. Allerdings liegt sie im Vergleich<br />
zur entsprechenden Quote in <strong>Hessen</strong>, die 2003 8,0% betrug, mit 9,7% deutlich<br />
höher und ist die höchste Jugendarbeitslosenquote aller hessischen <strong>Agentur</strong>bezirke.<br />
Die insgesamt ungünstige Arbeitsmarktsituation schlägt sich auch in der Sozialhilfestatistik<br />
nieder: In der Stadt Kassel lebten 2002 mit rund 19.600 Personen 8,2 % aller<br />
Sozialhilfeempfänger <strong>Hessen</strong>s bei einem Bevölkerungsanteil an <strong>Hessen</strong> von<br />
3,2%. Entsprechend ist die Sozialhilfedichte 4 mit 10,1 % sehr hoch. Sie liegt weit<br />
über dem Landesdurchschnitt von 3,9% und ist mit Abstand (vor der Stadt Offenbach<br />
mit 8,9%) die höchste aller hessischen Stadt- und Landkreise. 28,5% der Sozialhilfeempfänger<br />
waren arbeitslos gemeldet, ein Wert der ebenfalls deutlich über<br />
dem hessischen Durchschnitt (24,0 %) liegt.<br />
Aus den vorangegangenen Ausführungen wird deutlich, dass sich die Situation auf<br />
dem Arbeitsmarkt auch in Kassel in den letzten Jahren bis 2003 etwas verbessert<br />
hat. Bei einigen wichtigen Kenngrößen des Arbeitsmarktes kann jedoch bei weitem<br />
noch nicht von einer Entspannung gesprochen werden. Im Bereich der Sockelarbeitslosigkeit<br />
ist eine sich kontinuierlich verstärkende Verfestigung zu diagnostizieren.<br />
Eine Reintegration in das Erwerbsleben scheint für bestimmte Personengruppen<br />
bei hohen Arbeitslosenzahlen und bei immer noch erheblicher Langzeitarbeitslosigkeit<br />
sowie weiter rückläufiger Zahl der bei der Arbeitsverwaltung gemeldeten offenen<br />
Stellen schwierig zu bleiben. Dies umso mehr, wenn ein unzureichendes Qualifikationsniveau<br />
und gesundheitliche Einschränkungen zu den vermittlungshemmenden<br />
Faktoren der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen gehören.<br />
4 Zahl der Sozialhilfeempfänger am Wohnort bezogen auf die Wohnbevölkerung<br />
11
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
3 Das Kasseler Modell Kombilohn<br />
3.1 Erfahrungshintergrund und Ziel des Modellprojektes<br />
Eines der im Jahr 2000 neu geordneten und inhaltlich erheblich erweiterten Arbeitsmarktprogramme<br />
des Hessischen Sozialministeriums ist das Hessische Aktionsprogramm<br />
Regionaler Arbeitsmarktpolitik (<strong>HA</strong>RA), das neu in die ESF-<br />
Förderung aufgenommen wurde. <strong>HA</strong>RA ist ein modular zusammengesetztes Programmpaket,<br />
dessen Elemente für die Förderung der Zielgruppe (Sozialhilfeempfänger/innen)<br />
einzeln oder aufeinander aufbauend zur Verfügung stehen. Die Programmelemente,<br />
die systemisch ineinander greifen, sind nicht für den ganzen Förderzeitraum<br />
abschließend definiert, sondern können entsprechend dem Bedarf und<br />
sich verändernden Rahmenbedingungen in ihrer Ausprägung im Zeitablauf angepasst,<br />
aufgegeben oder durch neue Module ergänzt werden.<br />
Zum Zeitpunkt der Bewilligung des Kasseler Modells Kombilohn am Ende des Jahres<br />
2001 bestand das Programm aus neun Teilprogrammen, die gefördert und<br />
durch den ESF kofinanziert wurden:<br />
• Qualifizierungsmodule,<br />
• feste Betreuung,<br />
• Hilfeplanung und Vermittlung,<br />
• Vermittlungsagenturen,<br />
• Job-Center 5 ,<br />
• Sprungbrett,<br />
• Arbeitnehmerüberlassung,<br />
• Kombilohn und<br />
• Experimente.<br />
Das Kasseler Modell Kombilohn mit seinem multiplen Förderansatz ist dem Modul<br />
„Experimente“ zugeordnet. Einer Begleitforschung kommt bei einem so flexiblen<br />
Programmansatz eine hohe Bedeutung zu, um einerseits die Wirkungsweise der<br />
einzelnen Maßnahmen für sich, aber auch als ein ineinander greifendes System -<br />
und dies nach Möglichkeit regional differenziert - verfolgen zu können, und um andererseits<br />
Probleme zu identifizieren und evtl. notwendige Programmanpassungen<br />
zügig einzuleiten.<br />
5 Auch für die im Rahmen dieses Programms geförderten JobCenter und JobOffensivCenter wurde vom Hessischen Sozialministerium<br />
ein Begleitforschungs- und Evaluierungsauftrag an die <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> – damalige FEH – vergeben, der<br />
parallel zur Evaluierung von KaMoKo bearbeitet wird.<br />
12
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Das Land <strong>Hessen</strong> hat bereits mit dem Instrument Kombilohn Erfahrungen gesammelt,<br />
denn im Jahr 2000 wurde mit einem entsprechenden Modellversuch begonnen,<br />
der bis März 2002 befristet war. Der Ansatz bestand darin, in mehreren Regionen<br />
<strong>Hessen</strong>s mit den verschiedenen Ausgestaltungen dieses arbeitsmarktpolitischen<br />
Instruments Erfahrungen zu sammeln.<br />
An dem Modellversuch haben sich sieben Stadt- und Landkreise beteiligt. Über 100<br />
Personen bezogen Einkommen nach einer - unterschiedlich angewendeten - Form<br />
von Kombilohn, die jedoch alle der Grundform „Arbeitnehmerzuschuss“ zuzurechnen<br />
sind und somit dem Mainzer Modell verwandt sind, bei dem der Arbeitnehmer<br />
einen Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen und evtl. zum Kindergeld erhält.<br />
Das Hessische Sozialministerium war bestrebt, das Instrument Kombilohn zur<br />
Schaffung eines aus arbeitsmarktpolitischen Notwendigkeiten erforderlichen Bereichs<br />
von Beschäftigungsmöglichkeiten für Geringqualifizierte mit entsprechend<br />
niedriger Grenzproduktivität und damit auch einem niedrigen Entlohnungsniveau im<br />
allgemeinen Arbeitsmarkt nachhaltig zu etablieren. Zu diesem Zweck wurde – kofinanziert<br />
durch den ESF – mit KaMoKo ein weiterer Modellversuch, zunächst regional<br />
beschränkt auf Kassel und zeitlich befristet bis zum Jahresende 2003, durchgeführt.<br />
Bei der Ausgestaltung der genauen Bedingungen dieses Versuchs war angestrebt,<br />
erste Erkenntnisse im noch laufenden Kombilohn-Modellversuch zu berücksichtigen.<br />
Zentraler Ansatzpunkt von KaMoKo ist die Verbesserung der Erschließung neuer<br />
Arbeitsplätze im Bereich geringer Qualifikationserfordernisse und Entlohnung. In<br />
vielen Wirtschaftsbereichen, insbesondere im Dienstleistungsbereich, wurde vermutet,<br />
dass eine hohe Anzahl dieser Arbeitsplätze latent vorhanden ist. Zudem sollte<br />
an dieser Stelle an die Beschäftigungsmöglichkeiten in privaten Haushalten gedacht<br />
werden. 6 Insbesondere in diesen Wirtschaftsbereichen sollten die aktiven Akquisitionsbemühungen<br />
von Arbeitsplätzen ansetzen. 7<br />
Dieser Modellversuch ist nicht nur auf die Akquisition von neuen Stellen für die spezifische<br />
Zielgruppe von langzeiterwerbslosen Sozialhilfeempfängern fokussiert. Er<br />
beinhaltet auch eine ganze Bandbreite von flankierenden Maßnahmen, z. B. Qualifizierung<br />
vor und während der Kombilohn-Phase oder Kinderbetreuungsmöglichkeiten,<br />
die im Rahmen dieses Modells eingesetzt werden können.<br />
6 Vgl. auch Trabert (2002).<br />
7 Die Praxis bei der Umsetzung des Modellprojektes hat gezeigt, dass die Erwartung, in privaten Haushalten ein Beschäftigungsfeld<br />
im Niedriglohnbereich erschließen zu können, nicht realistisch war. Alle Bemühungen der KAF, in diesem Bereich<br />
Stellen zu akquirieren waren erfolglos.<br />
13
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Wie aus dieser groben Situationsbeschreibung ersichtlich wird, umfasst das Programm<br />
ein ganzes Bündel von Elementen, die einen wesentlichen Einfluss auf den<br />
Programmerfolg haben können. Diese verschiedenen Elemente sollten durch eine<br />
Programmevaluation sowohl in ihrer Inanspruchnahme als auch in ihren Auswirkungen<br />
überprüft werden. Vorteilhaft für dieses Vorhaben ist, dass das Programm in<br />
dieser Form mit dem Stadtgebiet Kassel zunächst in einem regional relativ kleinen<br />
Gebiet umgesetzt wird und diese Testregion eindeutig und vollständig einem regionalen<br />
Arbeitsmarkt zuzurechnen ist.<br />
3.1.1 Art und Umfang der Förderung durch das Land <strong>Hessen</strong> bzw. den ESF (Definition<br />
des bewilligten Projektes)<br />
Die Stadt Kassel beantragte im September 2001 die Förderung eines „Kasseler Modells<br />
Kombilohn“ als „Experiment“ im „Hessischen Aktionsprogramm Regionale Arbeitsmarktpolitik<br />
(<strong>HA</strong>RA)“. Das vorgeschlagene Modellprojekt basierte auf der Erfahrung<br />
des Sozialamts der Stadt Kassel aus dem hessischen Kombilohn-<br />
Modellversuch, dass ein Anreiz in Form eines Zuschusses an Hilfeempfänger bei<br />
Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nach § 18 Abs. 5<br />
Bundessozialhilfegesetz (BSHG) nur in sehr wenigen Fällen zum erhofften Ergebnis<br />
der Aufnahme einer selbst gesuchten Arbeit im Niedriglohnsektor führte.<br />
Aufbauend auf dieser Erfahrung sollte im „Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)“<br />
eine mehrdimensionale Strategie erprobt werden:<br />
• Auswahl der Teilnehmer durch die Stadt Kassel unter Einsatz von Hilfeplanung<br />
und eines geeigneten Profiling-Verfahrens (mit Konzentration auf langzeitarbeitslose<br />
schwer vermittelbare Sozialhilfeempfänger ohne Leistungsansprüche nach<br />
SGB III zwischen 25 und 45 Jahren – zur Zielgruppe sollte nicht gehören, wer<br />
auch ohne Maßnahmen in den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt werden<br />
könnte);<br />
• Aktive Akquise von sozialversicherten Arbeitsplätzen im Niedriglohnsektor (auch<br />
bei nicht tarifgebundenen Arbeitgebern); bisher nicht besetzbare Arbeitsplätze<br />
sollten besetzt und zusätzlich bisher nicht bekannte Arbeitsplatzpotenziale (auch<br />
in Privathaushalten) für die Zielgruppe erschlossen werden; dabei sollte illegale<br />
Beschäftigung zurückgedrängt und geringfügige Beschäftigung in – mit ergänzenden<br />
Zahlungen aus der Sozialhilfe – auskömmliche Teilzeit- oder Vollzeitarbeit<br />
umgewandelt werden; Niedriglöhne wurden definiert als Stundenlöhne<br />
unterhalb des tariflichen oder ortsüblichen Niveaus – geringe Gesamtvergütungen,<br />
die sich bei höheren Stundenlöhnen lediglich wegen der geringen<br />
Stundenzahl von Teilzeit-Beschäftigungsverhältnissen ergeben, sollten nicht<br />
gefördert werden;<br />
14
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
• Öffentlichkeitsarbeit der Stadt zum „Kasseler Modell Kombilohn“ zur Begleitung<br />
und Unterstützung der Arbeitsplatz-Akquise;<br />
• Beratung (Einzel- und Gruppencoaching zur Vorbereitung auf die Arbeitsaufnahme),<br />
Qualifizierung (berufsorientierende Kurzzeitlehrgänge, berufliche<br />
Basislehrgänge), Arbeitserprobung (in maximal 4-wöchigen Praktika) und<br />
Vermittlung der Teilnehmer (mit Vereinbarung der auf das jeweilige Arbeitsverhältnis<br />
zugeschnittenen Bedingungen) sowie ihre sozialpädagogische Begleitung<br />
(als Service für Arbeitgeber und Arbeitnehmer) parallel zum Arbeitprozess;<br />
• Zuschüsse nach § 18 Abs. 5 BSHG an die Beschäftigten (für einen Zeitraum von<br />
12 Monaten degressiv gestaffelt: für die ersten vier Monate 100% des<br />
Regelsatzes eines Haushaltsvorstands, für die zweiten vier Monate 75% und für<br />
die letzten 4 Monate 50%);<br />
• Wo erforderlich, auch Zuschüsse an Arbeitgeber (bis zu 50% der Brutto-<br />
Lohnkosten für maximal 12 Monate, bei der Umwandlung geringfügiger in<br />
sozialversicherte Beschäftigung bis zu 40% - jedoch kein Arbeitgeberzuschuss<br />
dort, wo Niedriglöhne unterhalb tariflicher Löhne gezahlt werden).<br />
Ziel war es, mit KaMoKo „100 + X“ langzeitarbeitslose Sozialhilfeempfänger/innen<br />
mit mehreren Vermittlungshemmnissen in Arbeit zu bringen. Dem hohen Ressourceneinsatz<br />
sollten mittel- und langfristig erhebliche Einsparungen in der Sozialhilfe<br />
gegenüberstehen, weil geförderte Arbeitnehmer nach der Modellphase in ihren Arbeitsverhältnissen<br />
verbleiben und keine oder nur noch sehr geringe Sozialhilfeleistungen<br />
beanspruchen.<br />
Wenn sich Sozialhilfeempfänger/innen weigern sollten, zumutbare Arbeitsangebote<br />
anzunehmen, sollten die Leistungen gemäß § 25 BSHG eingeschränkt werden<br />
(Prinzip des „Förderns und Forderns“).<br />
Von dem Projektbudget von insgesamt 2,9 Mio. DM sollten 1,9 Mio. DM durch das<br />
Land und 1 Mio. DM durch die Stadt Kassel finanziert werden.<br />
Kosten Bildungs-/Betreuungspersonal 786.000 DM (401.875 €)<br />
Lohnkostenzuschüsse/ Kombilohn 1.900.000 DM (971.455 €)<br />
Gemeinkosten 214.000 DM (109.416 €)<br />
Summe: 2.900.000 DM (1.482.746 €)<br />
Mit Zuwendungsbescheid vom 25.10.2001, aufgestockt durch Bescheid vom<br />
23.4.2002, wurden durch die Investitionsbank <strong>Hessen</strong> AG (IBH) im Auftrag des<br />
Hessischen Sozialministeriums (HSM) der Stadt Kassel insgesamt 971.454,57 €<br />
(umgerechnet 1.900.000 DM) bewilligt - davon 854.113,08 € aus dem Europäischen<br />
Sozialfonds (ESF) und 117.341,49 € aus Landesmitteln.<br />
15
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Nach dem Verwendungsnachweis der Stadt Kassel vom 25.6.2004 teilten sich die<br />
tatsächlich entstandenen Kosten wie folgt auf<br />
Bildungs-/Betreuungspersonal 288.877 €<br />
Lohnkostenzuschüsse/Kombilohn 939.990 €<br />
Gemeinkosten 134.121 €<br />
Summe: 1.362.988 €<br />
Die Finanzierung erfolgte mit 336.827 € aus privaten Mitteln (Beiträge der Arbeitgeber<br />
zu den Lohnkosten), mit 494.261 € aus Mitteln der Stadt Kassel, mit 467.646 €<br />
aus ESF- und mit 64.254 € aus Landesmitteln.<br />
3.2 Die Kommunale Arbeitsförderung als Träger des Modellprojektes<br />
Die Kommunale Arbeitsförderung der Stadt Kassel, über die das Modellprojekt umgesetzt<br />
und betreut wird, ist eine Abteilung des Sozialamtes. Zu Beginn des Projektes<br />
wurde eine spezielle – ausschließlich mit der Umsetzung des Modellprojektes<br />
befasste - Arbeitsgruppe gebildet, die allerdings zwischenzeitlich durch Umorganisation<br />
und zur besseren Nutzung von Synergien wieder in die Kommunale Arbeitsförderung<br />
Kassel eingegliedert wurde. Die Arbeitsgruppe war mit zwei bis drei Sachbearbeiter/innen<br />
besetzt, die sich auf Arbeitnehmerseite ausschließlich mit den Personenkreis<br />
derjenigen Sozialhilfeempfänger, die für eine Förderung im Modellprojekt<br />
in Frage kamen, beschäftigte. Gleichzeitig hatte sie die Aufgabe, generell die Akquisition<br />
von Arbeitsplätzen (insbesondere im Niedriglohnbereich) zu betreiben und<br />
speziell für die zu vermittelnden Sozialhilfeempfänger Kontakte zu Arbeitgebern<br />
herzustellen, die einen (geförderten) Arbeitsplatz für (zunächst) ein Jahr anbieten<br />
konnten.<br />
Die Kommunale Arbeitsförderung versteht sich als Ratgeber für Arbeitssuchende<br />
und Sozialhilfeempfänger und als Gesprächspartner der Wirtschaft.<br />
Aufgrund der bereits in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungen der Wirtschafts-<br />
und Arbeitsförderung der Stadt Kassel war für das Modellprojekt Kombilohn<br />
ein einschlägiges Know-how vorhanden, das im Rahmen des Projektes angewendet<br />
und weiter verfeinert werden konnte.<br />
Im Einzelnen ist auf folgende Kompetenzen zu verweisen:<br />
Das Angebot für Arbeitssuchende:<br />
Arbeitssuchenden werden Beratungs- und Informationsleistungen angeboten. In einem<br />
ausführliches Erstgespräch werden die zukünftigen Schritte für einen (Wieder-)<br />
Einstieg ins Arbeitsleben besprochen. Primäres Ziel ist die Vermittlung in den ersten<br />
16
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Arbeitsmarkt; wenn dies nicht direkt erreichbar ist, gibt es ein Bündel von monetären<br />
und nichtmonetären Förderinstrumenten, mit denen der Übergang in Arbeit oder<br />
Ausbildung unterstützt werden kann. Daneben gibt es das Beratungs- und Betreuungsangebot<br />
bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen, bei der Vorbereitung<br />
von Vorstellungsgesprächen und bei anderen Aktivitäten der Arbeitsuche, z. B. bei<br />
der Nutzung von Stelleninformationssystemen.<br />
Die Kommunale Arbeitsförderung bietet somit<br />
• eine Rundum-Beratung zur Arbeitsaufnahme,<br />
• die Analyse der Stärken und Fähigkeiten der Arbeitssuchenden (Profiling):<br />
• ein Bewerbungstraining,<br />
• die Vermittlung in Qualifizierungmaßnahmen,<br />
• die Vermittlung von Vorstellungsgesprächen und<br />
• die Vermittlung von Arbeits- oder Praktikumsplätzen.<br />
Die Kommunale Arbeitsförderung in Kassel führt durch ihre Einbindung an das Sozialamt<br />
de facto für ihre Kunden bereits jetzt ein Fallmanagement durch, wie es bei<br />
Jobcentern nach dem Muster der Hartz-Gesetze vorgesehen ist.<br />
Das Angebot für Arbeitgeber:<br />
Die Kommunale Arbeitsförderung bietet auch ein breites Bündel von Informationsangeboten<br />
und Beratungs- und Förderleistungen an, die den Unternehmen helfen<br />
und die gleichzeitig die Arbeitsmarktchancen von am Arbeitsmarkt benachteiligten<br />
Personen verbessern. Dabei sind die mittelständischen Unternehmen die im Fokus<br />
stehende Zielgruppe. Das Angebot umfasst<br />
• die Beratung der Betriebe bei der Personalbedarfsermittlung,<br />
• das Erstellen eines Anforderungsprofils an gesuchte Arbeitskräfte,<br />
• die entsprechende Vorauswahl von Bewerberinnen und Bewerbern, um so den<br />
Aufwand der Betriebe bei der Personaleinstellung zu minimieren,<br />
• eine beratende Begleitung des Arbeitgebers und des vermittelten Arbeitnehmers<br />
auch nach Beginn der Arbeitsaufnahme,<br />
• falls erforderlich eine Vorbereitung der Bewerberinnen und Bewerber durch<br />
Qualifizierungsmaßnahmen,<br />
• Gespräche und Hilfestellungen bei Fragen oder Problemen mit der Arbeitskraft,<br />
• Finanzielle Hilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen oder Zuschüssen zu den<br />
Ausbildungskosten.<br />
17
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Die Arbeitgeber haben dadurch erhebliche Vorteile und Ersparnisse,<br />
• weil zum Beispiel Kosten für Stellenanzeigen und Zeit für langwierige<br />
Auswahlverfahren entfallen können,<br />
• weil durch die Vorauswahl eines auf das Stellenprofil passenden Arbeitnehmers<br />
das Risiko einer Fehlbesetzung sinkt und die Möglichkeit einer Probebeschäftigung<br />
in einem für den Betrieb kostenneutralen Praktikum besteht,<br />
• und weil durch die Inanspruchnahme bzw. Vermittlung weiterer Fördermöglichkeiten<br />
zusätzlich Kosten gespart werden können.<br />
3.2.1 Auswahl, Unterstützung und Vermittlung der Teilnehmer/innen am Modellprojekt<br />
durch den Projektträger „Kommunale Arbeitsförderung (KAF)“<br />
Zielgruppe waren langzeitarbeitslose Sozialhilfeempfänger/innen zwischen 25 und<br />
45 Jahren ohne oder mit veralteter Berufsausbildung, die grundsätzlich geeignet<br />
sind zur Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt, aber voraussichtlich bei Aufnahme<br />
einer Erwerbsarbeit weiterhin auf den Bezug von Sozialhilfe angewiesen sind.<br />
Verfahren: Vom Träger wurden aus dem Kreis der Sozialhilfeempfänger/innen in<br />
Kassel Personen ausgewählt, auf die diese Merkmale zutrafen. Mit diesen Personen<br />
wurden Beratungsgespräche geführt und ein Plan erstellt, wie eine Eingliederung in<br />
den Arbeitsmarkt erfolgen könnte. Falls dies für nötig und zielführend erachtet wurde,<br />
wurden vorgeschaltete Qualifizierungsmaßnahmen mit den Projektteilnehmer/innen<br />
vereinbart, um so für das Ziel der mindestens einjährigen Arbeitsaufnahme<br />
im ersten Arbeitsmarkt bessere Voraussetzungen zu bieten. Bis zum Stichtag für<br />
den Beginn der Begleitforschung umfasste diese Auswahl 155 Personen 8 .<br />
Ein weiterer Baustein im Modellprojekt war die gezielte – den Fähigkeiten der Sozialhilfeempfänger/innen<br />
entsprechende - Stellenakquise bei Arbeitgebern in Kassel<br />
und der näheren Umgebung sowie der Versuch, durch die Fördermöglichkeiten<br />
neue (zusätzliche) Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor zu errichten.<br />
Es wurden verschiedene Ansatzpunkte parallel verfolgt, um die Zielsetzung des Projektes<br />
– Vermittlung von 100+X Sozialhilfeempfänger/innen in Arbeit - zu erfüllen.<br />
Einerseits wurden dafür teilnehmerbezogene Arbeitsstellen akquiriert und besetzt,<br />
andererseits wurden stellenbezogen geeignete Arbeitskräfte aus der Zielgruppe gesucht,<br />
- wenn nötig, zuvor qualifiziert - und vermittelt.<br />
Die zur Verfügung stehenden Instrumente, wie Lohnkostenzuschüsse für den Arbeitgeber,<br />
Qualifizierung, Kombilohn für den Arbeitnehmer als Motivationsanreiz und<br />
8 Näheres zur Struktur der Teilnehmer/innen und ihren Erfahrungen im Modellprojekt siehe Kapitel 4, 6 und 7<br />
18
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsfirmen wurden flexibel durch die Mitarbeiter/innen<br />
von der Kommunalen Arbeitsförderung, die für das Kasseler Modell Kombilohn abgestellt<br />
worden waren, eingesetzt.<br />
Aus den Unterlagen der Kommunalen Arbeitsförderung sind folgende (quantitativen)<br />
Angaben über die Umsetzung zu entnehmen:<br />
Im Vorfeld von Vermittlungen der Sozialhilfeempfänger hat die KAF zur Auswahl der<br />
Teilnehmer/innen für den Modellversuch, aber auch in der laufenden Betreuung<br />
zahlreiche Gespräche geführt. Zur Akquisition der Stellen fanden neben den schriftlichen<br />
Aktionen 9 auch persönliche oder telefonische Kontakte mit den Arbeitgebern<br />
statt. Die Aktivitäten zur Auswahl und Beratung der Teilnehmer/innen sowie die<br />
Kontakte zu den Arbeitgebern wurden von der KAF für den Zeitraum 2002/2003 wie<br />
folgt angegeben:<br />
Tabelle 1: Beratungsfälle und Arbeitgeberkontakte der Kommunalen Arbeitsförderung<br />
2002 2003 Insgesamt<br />
I II III IV I II III IV<br />
Beratungsgespräche mit Sozialhilfeempfängern/innen 238 162 149 198 313 278 322 200 1.860<br />
Arbeitgeberkontakte 95 230 95 86 164 149 147 73 1.039<br />
Quelle: Angaben der Kommunalen Arbeitsförderung Kassel.<br />
Während der fast 2-jährigen Modellphase des Kasseler Modells Kombilohn (KaMo-<br />
Ko) konnten von den insgesamt 155 ausgewählten Sozialhilfeempfängern 109 Personen<br />
(77 Teilnehmerinnen und 32 Teilnehmer) in Arbeit vermittelt werden. 8 Personen<br />
wurden bisher durch KaMoKo zweimal in Arbeit vermittelt, da eine erste Vermittlung<br />
gescheitert war.<br />
Weitere 9 Personen wurden über die Mitarbeiter/innen von KaMoKo in geringfügige<br />
Beschäftigungen, 11 Personen wurden in Vollzeitstellen über andere Programme<br />
oder in Ausbildung vermittelt. In diesen Fällen wurden keine Transfers an die Arbeitgeber<br />
oder Arbeitnehmer aus Projektmitteln bezahlt.<br />
Insgesamt wurden während des Modellversuchs bis Ende 2003 im Rahmen von<br />
KaMoKo 137 Vermittlungen für 129 Personen in den ersten Arbeitsmarkt getätigt.<br />
9 Näheres im Abschnitt über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.<br />
19
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Das Instrument des Profiling als Stärken- und Schwächenanalyse mit schriftlich dokumentierter<br />
Integrationsprognose wurde durch die KAF weiter entwickelt und an<br />
die Erfordernisse von niedrig qualifizierten, langzeitarbeitslosen Sozialhilfeempfängern<br />
angepasst. 7 Auswahl- und Förderprofilings wurden durch Vermittlung und mit<br />
Zuschüssen von KaMoKo mit 4 verschiedenen Bildungsträgern durchgeführt.<br />
Darüber hinaus fanden für 37 Männer und 47 Frauen Vermittlungen in Qualifizierung<br />
statt, die jedoch nicht in allen Fällen zu einer Arbeitsaufnahme im Modellprojekt<br />
führten. 10<br />
Um diese Ergebnisse zu erreichen, wurden 1.860 Beratungsgespräche mit Sozialhilfeempfängerinnen<br />
und Sozialhilfeempfängern und 1.039 Informationsgespräche mit<br />
Arbeitgebern geführt.<br />
Neben diesen direkten Effekten hatte das Modellprojekt weitere Effekte nach außen<br />
und innerhalb der städtischen Verwaltung:<br />
Um den Bekanntheitsgrad von KaMoKo und der KAF in der Öffentlichkeit zu erhöhen,<br />
wurde ein Marketing-Konzept entwickelt. Inhaltlich wurden darin die Anreize für<br />
Arbeitgeber, wie Lohnkostenzuschüsse, höhere Motivation der Arbeitnehmer durch<br />
Kombilohn, Unterstützung bei der Stellenbesetzung und Arbeitnehmerauswahl<br />
durch KaMoKo in den Mittelpunkt gerückt. Als Instrumente hat die KAF eine zielgruppenorientierte<br />
Öffentlichkeitsarbeit (Zielgruppe Arbeitgeber), die Einbindung<br />
und Kontaktaufnahme zu den Kammern und Steuerberatern als Multiplikatoren für<br />
das Modell, direkte Anschreiben sowie Telefon- sowie Direktmarketingaktionen vor<br />
Ort gewählt und umgesetzt.<br />
Dieses Konzept wurde eingebunden in die allgemeine Außenkommunikation der<br />
Kommunalen Arbeitsförderung und auch in der begleitenden Evaluation von KaMo-<br />
Ko durch die <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> (vormals FEH) gespiegelt. Durch diese Kombination<br />
sollten möglichst viele Synergieeffekte (Verankerung und Bekanntheitsgrad von<br />
KAF und KaMoKo bei den nordhessischen Arbeitgebern, die Helferstellen anbieten<br />
können, insbesondere das Verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungsbranche)<br />
erzeugt und genutzt werden. Dieser multiple strategische Ansatz war die Basis für<br />
die Akquisition von geeigneten Stellenangeboten.<br />
Nach innen wurde KaMoKo als neues und zusätzliches Instrument mit einem<br />
Schwerpunkt der Vermittlung von ausschließlich Sozialhilfebezieherinnen und Sozialhilfebeziehern<br />
mit anderen Projekten der Kommunalen Arbeitsförderung verknüpft.<br />
Kooperationen, insbesondere bei der Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen<br />
haben sich als effektiv und sinnvoll erwiesen. Kombilohn und<br />
10 In Zusammenarbeit mit anderen Projekten der Kommunalen Arbeitsförderung wurden nach Angaben der Kommunalen<br />
Arbeitsförderung weitere 68 Männer und 50 Frauen in Qualifizierungen vermittelt.<br />
20
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Lohnkostenzuschüsse haben sich als wirksame Anreizinstrumente für die Integration<br />
arbeitsloser Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfänger mit mehreren<br />
Vermittlungshemmnissen erwiesen. Insbesondere hat die Zielgruppe der Alleinerziehenden<br />
davon profitiert, denn bei den in KaMoKo aufgenommenen Personen<br />
handelt es sich zu einem großen Teil um Alleinerziehende, wobei der Anteil der<br />
Frauen, die über KaMoKo in Arbeit vermittelt wurden, mehr als doppelt so hoch ist<br />
wie der Anteil der Männer.<br />
Der Kommunalen Arbeitsförderung war es dabei frei gestellt, welchen Instrumentenmix<br />
sie anwenden wollte (oder musste), um das Ziel der Vermittlung in Arbeit zu<br />
erreichen. Es bestanden dabei im Wesentlichen folgende Handlungsparameter:<br />
Lohnkostenzuschüsse an den Arbeitgeber: Es handelt sich dabei um eine zeitlich<br />
befristete Übernahme der Lohnkosten durch die KAF (bzw. durch den ESF) von<br />
maximal 50%. Die KAF konnte den Fördersatz von Förderfall zu Förderfall variieren,<br />
um so Mitnahmeeffekte möglichst zu minimieren. Als Anreiz ist auch eine Staffelung<br />
des Fördersatzes im Zeitablauf möglich (z.B. im 1. Halbjahr über 50% und im 2.<br />
Halbjahr entsprechend darunter).<br />
Kombilohn ist eine Zahlung an den Arbeitnehmer, die sein Arbeitseinkommen direkt<br />
erhöht, wenn der erzielbare Arbeitslohn aus Gründen der regionalen Arbeitsmarktlage<br />
und/oder der Produktivität der Arbeit nicht ausreichend ist.<br />
Im Rahmen des Modellprojektes war es auch möglich, beide Instrumente zu kombinieren<br />
oder auch Arbeitskräfte ohne eines der beiden Förderinstrumente zu vermitteln.<br />
Wichtige weitere Hilfen bei der (Wieder-)Eingliederung in Erwerbstätigkeit waren im<br />
Rahmen des Modellprojektes Beratungsgespräche, die Vermittlung in Qualifizierungs-<br />
oder Trainingsmaßnahmen und begleitendes Coaching durch die KAF. 11<br />
In der folgenden Tabelle ist zusammengefasst, welche monetären Instrumente bei<br />
den Vermittlungen in Arbeit im Zeitraum zwischen Oktober 2002 und Dezember<br />
2003 eingesetzt worden sind. Insgesamt waren es 109 Personen, die vermittelt<br />
werden konnten. Frauen und Männer waren an den Vermittlungen mit 68% bzw.<br />
32% fast genau so beteiligt wie es ihrem Anteil an der Grundgesamtheit der 155<br />
11 Wie bei der Beschreibung der Befragten bei der Teilnehmer/innenbefragung ausführlich dargestellt, bildete die Zahl der<br />
im Oktober 2002 durch die KAF für KaMoKo ausgewählten Sozialhilfeempfänger die Grundgesamtheit für die Befragungsaktionen<br />
(Basis für die Paneluntersuchung). Während der Laufzeit des Projektes hat sich diese Grundgesamtheit<br />
des durch das Kasseler Modell Kombilohn geförderten Personenkreises geändert. Die Förderung durch die KAF bestand<br />
entsprechend dem Projektauftrag nicht ausschließlich in der Vermittlung in Arbeit, sondern Beratungsleistungen oder<br />
Vermittlung in Qualifizierungsmaßnahmen gehörten ebenfalls zu den definierten Aufgaben. Dennoch war es wichtigstes<br />
Ziel, mit Hilfe der vorhandenen (finanziellen) Förderinstrumente die Generierung von Arbeitsverhältnissen zu unterstützen.<br />
21
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
schriftlich befragten Teilnehmer/innen entsprach. In über der Hälfte der Fälle wurde<br />
die Vermittlung sowohl durch einen Zuschuss an den Arbeitgeber als auch durch eine<br />
Aufstockung des Lohnes für den/die Arbeitnehmer/in unterstützt. Bei Frauen<br />
wurde diese Kombination der Doppelförderung relativ gesehen etwas häufiger eingesetzt<br />
als bei Männern (79% gegenüber 21%). Die zweithäufigste Fördervariante<br />
war Kombilohn an den/die Arbeitnehmer/in ohne Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber.<br />
Diese Kombination wurde überdurchschnittlich bei der Vermittlung von<br />
Männern angewendet, denn 46% der so geförderten Arbeitsverhältnisse entfielen<br />
auf Männer und 54% auf Frauen. Nur mit Lohnkostenzuschüssen (aber ohne Kombilohn)<br />
konnten 13% der Vermittlungen abgeschlossen werden. Diese Förderkombination<br />
wurde für Frauen und Männer entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtzahl<br />
der Vermittlungen angewendet. Die Vermittlungen ganz ohne Fördermittel stellen<br />
mit knapp 10% die am seltensten gewählte Kombination dar. Männer waren bei diesen<br />
Vermittlungen in der Überzahl.<br />
Tabelle 2: In Arbeit vermittelte Sozialhilfeempfänger/innen 2002/2003<br />
Eingesetzte Förderinstrumentkombination<br />
Vermittlung in Arbeit<br />
Insgesamt Frauen Männer<br />
mit Kombilohn - mit Lohnkostenzuschuss 24 13 11<br />
mit Kombilohn - ohne Lohnkostenzuschuss 14 10 4<br />
ohne Kombilohn - mit Lohnkostenzuschuss 58 48 10<br />
ohne Kombilohn - ohne Lohnkostenzuschuss 13 6 7<br />
Insgesamt 109 77 32<br />
Quelle: Angaben der Kommunalen Arbeitsförderung Kassel.<br />
Da 8 Personen zweimal vermittelt wurden, beträgt die Zahl der besetzten Arbeitsplätze<br />
insgesamt 117. Darüber hinaus wurden 9 Personen aus der Zielgruppe in MiniJobs<br />
vermittelt. Dafür hat es jedoch keinen Einsatz von Fördermitteln in Form von<br />
Lohnkostenzuschüssen oder Kombilohn gegeben. Die Leistungen im Rahmen des<br />
Modellprojektes beschränkten sich auf die Beratung und die Vermittlung der Beschäftigung.<br />
22
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
3.2.2 Marketingaktivitäten zur Bekanntmachung des Modellprojektes und zur<br />
Gewinnung von Arbeitgebern<br />
Die KAF formulierte ihre Ziele so: „Im Kasseler Modell Kombilohn bauen wir ein<br />
strukturiertes und kontinuierliches Kommunikationssystem auf, mit dem Ziel, Arbeitgeber<br />
für eine Kooperation mit der Kommunalen Arbeitsförderung zu gewinnen. Das<br />
dafür genutzte Instrumentarium ist vielfältig und setzt mittelfristig auf die Implementierung<br />
eines Systems, das schon vorhandene Kommunikationskanäle der Arbeitgeber<br />
nutzt.<br />
Unumgänglich ist eine enge Zusammenarbeit mit den Kammern (IHK, HWK) sowie<br />
mit Steuerberatern, die gerade für kleine und mittlere Unternehmen eine wichtige<br />
Rolle spielen: Die Beratung wird nicht nur in steuerlichen Angelegenheiten in Anspruch<br />
genommen, sondern in fast allen unternehmensrelevanten Entscheidungen.“<br />
12<br />
Die daraus abgeleiteten Eckpunkte der Öffentlichkeitsarbeit waren:<br />
• Presse allgemein, Presseerklärungen;<br />
• Zielgruppenorientierte Pressearbeit; bedient wurden Presseorgane, die sich an<br />
Arbeitgeber richten (Wirtschaft Nordhessen, diverse Veröffentlichungen der<br />
Handwerkskammer);<br />
• Informationsverteiler, Nutzung der Beratungsstruktur von Industrie, Handel und<br />
Handwerk.<br />
Im Laufe des Projektes wurden konkret folgende Aktivitäten ergriffen:<br />
• Kontinuierliche Presseerklärungen;<br />
• März 2002: Mailingaktion an 400 Betriebe vornehmlich aus dem Hotel- und<br />
Gaststättengewerbe, Lagerwirtschaft, Dienstleistungen;<br />
• April 2002: Erstellung eines Informationsblattes für Arbeitgeber (Auflage: 15.000);<br />
• Mai 2002: Einlage (Flyer) in „Wirtschaft Nordhessen“, Ausgabe Kassel Stadt und<br />
Land (Auflage13.000 Stück) und Versendung des Informationsblattes an Betriebe<br />
direkt;<br />
• Mai 2002: Versendung von mehreren Exemplaren des Flyers an 120<br />
Steuerberater im Stadtgebiet Kassel mit der Bitte, das Projekt ihren Mandanten<br />
vorzustellen, Aufbau und Information persönlicher Kontakte;<br />
12 Internes Papier der Kommunalen Arbeitsförderung Juni 2002.<br />
23
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
• Juni 2002: Kontakte mit der IHK und HWK mit dem Ziel, dass das Projekt in die<br />
betriebswirtschaftliche Beratung der Kammern aufgenommen wird (positive<br />
Resonanz der HWK);<br />
• Juni 2002: Artikel in der regionalen Tageszeitung, der Hessisch<br />
Niedersächsischen Allgemeinen (HNA) über das Kombilohnmodell in<br />
Zusammenhang mit dem Besuch der Hessischen Sozialministerin Silke<br />
Lautenschläger;<br />
• August 2002: Ausbau des Kontakts zur IHK, verstärkte Zusammenarbeit in der<br />
Öffentlichkeitsarbeit;<br />
• August 2002: Auslegen der Prospekte bei IHK und HWK;<br />
• September 2002: Einbeziehung von Zeitarbeitsunternehmen als Partner zur<br />
Vermittlung von Sozialhilfeempfängern;<br />
• Oktober 2002: Vorstellung des Kasseler Modells Kombilohn im Serviceteil der<br />
„Wirtschaft Nordhessen“ (Zeitschrift der Industrie- und Handelskammer Kassel)<br />
• November 2002: Das Kasseler Modell Kombilohn ist Titelgeschichte „Wirtschaft<br />
Nordhessen“, verbunden damit ist eine Vorstellung der Kommunalen Arbeitsförderung;<br />
• November 2002: Presseerklärung zu Zeitarbeit Stadt Kassel<br />
• November 2002: erneute Vorstellung der Fördermöglichkeiten im Serviceteil der<br />
„Wirtschaft Nordhessen“;<br />
• Dezember 2002: Vorstellung des ebenfalls von der Kommunalen<br />
Arbeitsförderung umgesetzten Landes- und ESF-Programms „Arbeit statt<br />
Sozialhilfe“ im Servicteil der „Wirtschaft Nordhessen“;<br />
• Januar 2003: Mailingaktion an 600 ausgewählte Handwerksbetriebe (HWK-<br />
Adressenliste) durch die Dezernentin der Stadt Kassel für Frauen, Jugend und<br />
Soziales. Von der KAF wurde dazu eine telefonische Nachfassaktion<br />
durchgeführt;<br />
• Juli 2003: Mitarbeit bei Neugestaltung der Internetseite www.KAF-Kassel.de und<br />
Präsentation von KaMoKo auf dieser Seite.<br />
Nach Auswertung der von der FEH im Rahmen der begleitenden Evaluierung<br />
durchgeführten Arbeitgeberbefragung, die einen recht geringen allgemeinen Bekanntheitsgrad<br />
des Modells erbracht hatte und bei der eine geringe Wahrnehmung<br />
24
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
von Informationen durch die Kammern bei ihren Mitgliedern offenbar wurde, hat die<br />
KAF die Öffentlichkeitsarbeit überdacht und Wege für eine breitere Wirkung gesucht.<br />
Dazu wurden nach Beendigung der Förderung durch das Land bzw. den ESF<br />
folgende Aktivitäten ergriffen:<br />
• Januar 2004: Kontaktaufnahme mit HNA wegen neuer Aktion und Artikelserie<br />
„Suche Arbeit“;<br />
• April 2004 bis September 2004: Aktion „Suche Arbeit“ in HNA: Vorstellung<br />
Kommunaler Arbeitsförderung und von arbeitslosen Sozialhilfeempfängern in der<br />
HNA mit dem Ziel, Arbeitsstellen insbesondere für die vorgestellten Personen zu<br />
akquirieren: bis September 2004 sind in der Reihe 16 Artikel zum Thema zu 14<br />
verschiedenen Terminen im Lokalteil der HNA erschienen. Es handelte sich<br />
dabei um die Vorstellung von am Modell teilnehmenden Firmen und Personen,<br />
um die Darstellung der Fördermöglichkeiten mit den daraus resultierenden<br />
Vorteilen für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der gewünschte Effekt besteht<br />
darin, die Kommunale Arbeitsförderung in Kassel im Allgemeinen - und<br />
besonders bei Arbeitgebern - besser bekannt zu machen und eine<br />
Profilschärfung anhand der Darstellung der angebotenen Serviceleistungen zu<br />
erzielen.<br />
• Folgende weiteren Maßnahmen befinden sich in Arbeit:<br />
Laufende Pflege der Arbeitgeberdatenbank und der darin enthaltenen<br />
Informationen;<br />
regelmäßige Anschreiben der Arbeitgeber mit dem Ziel des Kontaktaufbaus und<br />
der Kontaktpflege.<br />
25
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
4 Soziodemografische Struktur der Teilnehmer/innen am Kasseler<br />
Modellversuch Kombilohn<br />
Am Modellversuch nehmen 155 Personen, 109 Frauen (70 %) und 46 Männer<br />
(30 %), teil. 13 Dieser hohe Anteil von weiblichen Teilnehmern entspricht weitgehend<br />
der Verteilung, die auch bei anderen Kombilohnmodellen festzustellen ist. 14 Abbildung<br />
6 zeigt die Altersstruktur der Teilnehmer/innen.<br />
Abbildung 6: Altersstruktur der Teilnehmer/innen<br />
Anzahl<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
bis 30 Jahre 31-40 Jahre 41-50 Jahre über 50 Jahre<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmerdatei, eigene Darstellung.<br />
Rund 22 % der Teilnehmer/innen (35) sind der Altersgruppe von 20 bis 30 Jahre zuzuordnen.<br />
Den größten Anteil (48 %) stellen die Teilnehmer/innen, die zwischen 31<br />
und 40 Jahre alt sind. Weitere 42 Teilnehmer/innen (27 %) sind zwischen 41 und 50<br />
Jahre alt, nur ein sehr geringer Anteil (3 %) ist über 50 Jahre alt. Wird nur das Alter<br />
der Teilnehmer/innen isoliert betrachtet, so ist an dieser Stelle festzuhalten, dass<br />
das Alter allein bei über 70 % der Teilnehmer/innen kein Vermittlungshemmnis darstellen<br />
dürfte, sondern noch andere Faktoren eine Rolle spielen.<br />
Die Analyse der Verteilung der Altersgruppen nach Geschlecht zeigt deutliche Unterschiede<br />
auf (vgl. Abbildung 7). So dominieren - gemessen an der Verteilung der<br />
13 Diese und folgende Angaben beziehen sich - sofern nicht anders angegeben - auf die Gesamtheit der<br />
155 Teilnehmer/innen, die Mitte November am Modellversuch teilnahmen.<br />
14 Vgl. hierzu Hollereder, Alfons/ Rudolph, Helmut: Arbeitsanreize und Niedriglöhne: Konzeption und erste Erfahrungen des<br />
Mainzer Modells und des SGI-Modells, 2002, S. 61 f. und Dann, Sabine u.a.: Das Einstiegsgeld - eine zielgruppenorientierte<br />
negative Einkommensteuer: Konzeption, Umsetzung und eine erste Zwischenbilanz nach 15 Monaten in Baden-<br />
Württemberg, 2002, S. 74 f.<br />
26
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Frauen und Männer in der jeweiligen Altersgruppe - in der Altersgruppe der 20- bis<br />
30-jährigen Teilnehmer/innen die Frauen. Von den insgesamt 109 Frauen am Modellversuch<br />
ist rund ein Viertel in dieser Altersgruppe, wohingegen der Anteil der<br />
Männer in dieser Altersgruppe nur rund 15 % beträgt.<br />
In den mittleren Altersgruppen sind die Männer leicht überdurchschnittlich vertreten.<br />
Bei der Altersgruppe der über 50-jährigen sind nur Frauen vertreten.<br />
Abbildung 7: Altersstruktur der Teilnehmer/innen nach Geschlecht (in %)<br />
Anteile in Prozent<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
bis 30 Jahre 31-40 Jahre 41-50 Jahre über 50 Jahre<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmerdatei, eigene Darstellung.<br />
Die Auswertung der Datensätze in Bezug auf die Nationalität der Teilnehmer/innen<br />
ergibt folgendes Ergebnis: 117 Teilnehmer/innen haben die deutsche Staatsangehörigkeit<br />
(75 %), die 38 ausländischen Teilnehmer/innen (25 %) verteilen sich auf insgesamt<br />
19 Nationen.<br />
Der Vergleich der Altersstruktur zeigt, dass in der Altersgruppe der 20- bis 30-<br />
Jährigen keine wesentlichen Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen<br />
Teilnehmer/innen besteht. Dagegen fallen die jeweiligen Anteile der deutschen Teilnehmer/innen<br />
in der Altersgruppe der 31- bis 40-Jährigen und die der ausländischen<br />
Teilnehmer/innen in der Gruppe der 41- bis 50-Jährigen deutlich höher aus. In der<br />
Altersgruppe der über 50-Jährigen sind wiederum keine Unterschiede festzustellen<br />
(vgl. Abbildung 8).<br />
27
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Abbildung 8: Altersstruktur der Teilnehmer/innen nach Nationalität (in %)<br />
Anteile in Prozent<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
bis 30 Jahre 31-40 Jahre 41-50 Jahre über 50 Jahre<br />
Deutsche<br />
Ausländer<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmerdatei, eigene Darstellung.<br />
Die Auswertung nach dem Familienstand zeigt, dass die Mehrzahl der 155 Teilnehmer/innen<br />
allein lebt: 49 Teilnehmer/innen sind ledig, 40 Teilnehmer/innen sind<br />
geschieden, 29 Teilnehmer/innen leben getrennt und 3 Teilnehmer/innen sind verwitwet.<br />
25 bzw. etwas mehr als ein Sechstel der Teilnehmer/innen ist dagegen verheiratet<br />
und 9 Teilnehmer/innen leben in einer eheähnlichen Gemeinschaft (vgl. Abbildung<br />
9).<br />
Abbildung 9: Struktur der Teilnehmer/innen nach dem Familienstand<br />
ledig<br />
geschieden<br />
getrennt lebend<br />
verheiratet<br />
eheähnliche Gemeinschaft<br />
verwitwet<br />
Anzahl<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmerdatei, eigene Darstellung.<br />
28
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Nur knapp 22 % der Teilnehmer/innen sind ohne Kinder, während 78 % ein oder<br />
mehrere Kinder haben. Etwas mehr als ein Drittel der Teilnehmer/innen hat nur ein<br />
Kind und rund 24 % der Teilnehmer/innen haben zwei Kinder. Insgesamt ein Fünftel<br />
der Teilnehmer/innen hat drei (15,5 %) oder mehr Kinder (4,5 %). Wird hierbei berücksichtigt,<br />
dass die Mehrheit der Kinder einer Betreuung bedarf, so kann bereits<br />
an dieser Stelle vermutet werden, dass eine Vielzahl der Teilnehmer/innen auf die<br />
Möglichkeit einer Kinderbetreuung angewiesen ist, um am Erwerbsleben teilnehmen<br />
zu können.<br />
Abbildung 10: Kinderzahl der Teilnehmer/innen (Anteile in %)<br />
Anteile in Prozent<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
ohne Kinder mit 1 Kind mit 2 Kindern mit 3 Kindern mit 4 und mehr Kindern<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmerdatei, eigene Darstellung.<br />
Die Auswertung der Datensätze ergibt des Weiteren, dass nur ein sehr geringer Anteil<br />
der Teilnehmer/innen über einen höheren Bildungsabschluss verfügt. Nur<br />
3 Teilnehmer/innen weisen einen Fachhochschulabschluss und 9 Teilnehmer/innen<br />
die allgemeine Hochschulreife (Abitur) auf. 32 Teilnehmer/innen haben eine Realschulabschluss.<br />
Die Mehrzahl der Teilnehmer/innen (38 %) verfügt über einen<br />
Hauptschulabschluss. Rund 20 % der Teilnehmer/innen können keinen Schulabschluss<br />
vorweisen. Nach den Angaben der Stadt Kassel streben darüber hinaus<br />
16 Teilnehmer/innen einen Bildungsabschluss an und bei 5 Teilnehmer/innen ist der<br />
Schulabschluss unbekannt (vgl. Abbildung 11).<br />
29
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Abbildung 11: Schulausbildung der Teilnehmer/innen<br />
Fachhochschulabschluss<br />
Abitur<br />
Realschule<br />
Hauptschule<br />
ohne Schulausbildung<br />
Abschluss unbekannt<br />
Anzahl<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmerdatei, eigene Darstellung.<br />
In der Gesamtbetrachtung weisen die Teilnehmer/innen somit, was ihre schulische<br />
Ausbildung anbelangt, ungünstige Merkmale auf, die eine zügige Integration in das<br />
Erwerbsleben erschweren. Diese erste Einschätzung wird bestätigt, wenn die<br />
Grundgesamtheit der 155 Teilnehmer/innen nach dem Kriterium des beruflichen<br />
Ausbildungsniveaus ausgewertet wird.<br />
Von den insgesamt 155 Teilnehmer/innen hat nur knapp ein Drittel eine anerkannte<br />
berufliche Ausbildung absolviert. Die überwiegende Mehrzahl der Teilnehmer/innen<br />
verfügt über keine Berufsausbildung. Allerdings ist hierbei anzumerken, dass von<br />
den 84 Teilnehmer/innen ohne berufliche Ausbildung 37 Personen eine berufliche<br />
Ausbildung begonnen, aber nicht abgeschlossen haben. 20 Teilnehmer/innen haben<br />
zwar eine berufliche Ausbildung absolviert, allerdings handelt es sich dabei um<br />
Ausbildungsabschlüsse aus anderen Ländern, die in Deutschland nicht anerkannt<br />
sind. Aufgrund der Tatsache, dass die Arbeitgeber einer erfolgreich abgeschlossenen<br />
anerkannten Berufsausbildung als Einstellungskriterium eine hohe Bedeutung<br />
beimessen, ist anzunehmen, dass Teilnehmer/innen mit nicht anerkannten Berufsabschlüssen<br />
nur geringfügig bessere Chancen bei der Arbeitsplatzsuche gegenüber<br />
denjenigen haben, die über gar keine Berufsausbildung verfügen.<br />
30
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Abbildung 12: Berufsausbildung der Teilnehmer/innen<br />
ohne Berufsausbildung<br />
ohne anerkannte<br />
Berufsausbildung<br />
mit Berufsausbildung<br />
Anzahl<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmerdatei, eigene Darstellung.<br />
Die Auswertung der Datensätze ergibt zudem, dass - bis auf die Gruppe der über<br />
50-Jährigen - in allen Altersgruppen die Teilnehmer/innen ohne eine Berufsausbildung<br />
dominieren (vgl. Tabelle 3).<br />
Tabelle 3: Berufsausbildung der Teilnehmer/innen nach Altersstruktur in %<br />
Alter Ohne berufliche Ausbildung Ohne anerkannte berufliche<br />
Ausbildung<br />
Mit beruflicher<br />
Ausbildung<br />
bis 30 Jahre 51,4 20,0 28,6<br />
31 - 40 Jahre 58,1 10,8 31,1<br />
41 - 50 Jahre 52,4 11,9 35,7<br />
über 50 Jahre 25,0 0,0 75,0<br />
Quelle: Eigene Berechnungen.<br />
31
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
5 Die Einbeziehung der Teilnehmer/innen in den Evaluierungsprozess<br />
Für die Evaluierung des Kasseler Modells Kombilohn ist für den Auftraggeber – neben<br />
der üblichen Überprüfung des Verbleibs der Teilnehmer/innen während und<br />
nach der Förderphase – besonders von Interesse, wie sich die Lebenssituation der<br />
Teilnehmer/innen vor, während und nach der Teilnahme an dem Modell darstellte.<br />
Dieser Anforderung konnte nur dadurch genügt werden, dass die Teilnehmer zu<br />
Beginn und am Ende der Maßnahme über ihre Lebenssituation befragt wurden und<br />
dass sie ihr Urteil über die Erfüllung der Erwartungen an den Modellversuch abgaben.<br />
Durch diese Bewertungen und den Vergleich der Einschätzungen bzw. die<br />
Feststellung der Veränderungen können in Kombination mit anderen erfassten<br />
Merkmalen die Wirkungen des Programms beschrieben werden. Voraussetzung dafür<br />
ist, dass derselbe Personenkreis an beiden Zeitpunkten in die Befragung einbezogen<br />
wird. Das heißt, es wurde eine Paneluntersuchung mit zwei Befragungswellen<br />
durchgeführt. Ergänzt wurden diese Befragungen durch Interviews mit 10 Teilnehmer/innen<br />
am Programm. In diesen leitfadengestützten Interviews wurden zusätzliche<br />
qualitative Aussagen zur Lebenssituation und den Bedingungen im Modellversuch<br />
erfasst. Die Interviews fanden teilweise in Form von Gruppengesprächen<br />
der Evaluatoren mit bis zu drei Teilnehmer/innen oder in Form von Telefoninterviews<br />
statt. Es wurden dabei sowohl die Ergebnisse der Teilnehmerbefragungen<br />
als auch der Arbeitgeberbefragungen und -interviews besprochen und diskutiert.<br />
Da die Interviews mit den Teilnehmer/innen – im Gegensatz zu den Ergebnissen der<br />
schriftlichen Befragungen – wegen der insgesamt geringen Anzahl nicht den Anspruch<br />
auf Repräsentativität erheben können und sollen, werden die daraus gezogenen<br />
Erkenntnisse nicht gesondert ausgewertet und dargestellt. Sie dienen vielmehr<br />
der Erläuterung und Erklärung des Hintergrundes der ausgewerteten Ergebnisse<br />
der Fragebogenaktionen. Nur bei besonderen Details (z.B. arbeitsrechtliche<br />
Probleme beim geförderten Beschäftigungsverhältnis) wurde das Problem von den<br />
Evaluatoren direkt an die KAF herangetragen.<br />
5.1 Untersuchungsziel der Teilnehmerbefragungen<br />
Da es sich bei dem Modellversuch KaMoKo – wie beim Gesamtprogramm <strong>HA</strong>RA<br />
auch – um ein flexibles Programm handelt, kommt der Beobachtung der prozessualen<br />
Umsetzung und der Bewertung alternativ umgesetzter Programmelemente eine<br />
entscheidende Bedeutung zu. Mit Hilfe einer vergleichenden Gegenüberstellung der<br />
unterschiedlichen Ausgestaltung des Programms bei einzelnen Teilnehmer/innen<br />
und Arbeitgebern lassen sich unterschiedliche Wirkungsweisen und Effekte darstellen.<br />
32
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Gleichzeitig ist durch die laufende Beobachtung des Programmablaufes und der<br />
Einbeziehung aller Akteure in den Evaluierungsprozess festzustellen, wodurch und<br />
in welcher Art Veränderungen in der Situation der Teilnehmer/innen, des Arbeitsplatzangebotes<br />
oder sonstiger Einflussfaktoren eingetreten sind. Aufgrund dieser<br />
Konstellation wird es für die Beantwortung der zentralen Fragestellungen als sachgerecht<br />
und zielführend erachtet, ein qualitativ orientiertes Evaluierungskonzept anzuwenden.<br />
Vor dem Hintergrund einer geplanten Anzahl von rund 100 geförderten Kombilohnempfängern<br />
in Kassel war es - zumal bei mehrfachen Kontakten während der Evaluierung<br />
– nicht möglich, persönliche Interviews mit allen Teilnehmer/innen zu führen.<br />
Deshalb wurde unter Kostenaspekten eine schriftliche Befragung aller Teilnehmer/innen<br />
gewählt, die zu zwei Zeitpunkten erfolgte und für die zwei teilweise deckungsgleiche<br />
Fragebogen eingesetzt wurden.<br />
Ein Teil der Fragen war darauf ausgerichtet, Veränderungen in der Lebenssituation<br />
der Kombilohnempfänger/innen zu erfassen, um so den Wirkungsprozess abbilden<br />
zu können. Ein anderer Teil befasst sich mit Erfahrungen am Arbeitsplatz und in der<br />
Zusammenarbeit mit der KAF sowie der Inanspruchnahme von flankierenden Projektmodulen.<br />
Da die Grundgesamtheit für beide Befragungen mit den zum Stichtag<br />
Oktober 2002 von der KAF in das Modell einbezogenen Personen identisch definiert<br />
war, konnte für diejenigen Personen, die sich an beiden Befragungen beteiligt haben,<br />
auch die Entwicklung/Veränderung ihrer Situation und Einschätzungen ermittelt<br />
werden.<br />
Die erste Befragung wurde etwa einen Monat nach Eintritt in die Maßnahme, eine<br />
zweite gegen Ende der Maßnahme bzw. nach Abschluss der Maßnahme durchgeführt.<br />
Ergänzt wurden die schriftlichen Befragungen durch vertiefende mündliche Interviews<br />
mit 10 Teilnehmer/innen, die teilweise im persönlichen Gespräch und teilweise<br />
durch ein leitfadengestütztes Telefoninterview erfolgten.<br />
Diese Befragungen und Interviews sollten dabei vor allem Erkenntnisse bringen<br />
über:<br />
• den demografischen, sozialen, wirtschaftlichen (z. B. Einkommenssituation) und<br />
erwerbsbiografischen Hintergrund der Teilnehmer/innen,<br />
• deren Informationen über das Modellprojekt und ihren Zugang dazu,<br />
• die Motivation zur Teilnahme am Modellprojekt,<br />
• persönliche, soziale und ökonomische Veränderungen während der Teilnahme<br />
am Modell und nach dessen Beendigung,<br />
33
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
• Nutzung der flankierenden Module,<br />
• gegebenenfalls Gründe für den Abbruch der Teilnahme,<br />
• Begleitung und Betreuung durch die KAF,<br />
• Beurteilung des Projektes und Verbesserungsvorschläge aus Sicht der Betroffenen,<br />
• Planungen für die Zukunft.<br />
5.2 Durchführung der Befragungen<br />
Grundgesamtheit der Teilnehmerbefragungen waren die im Oktober 2002 von der<br />
Kommunalen Arbeitsvermittlung für eine Teilnahme an Modellversuch vorgesehenen<br />
155 Sozialhilfeempfänger/innen.<br />
Bei beiden Befragungen wurde den Teilnehmer/innen der Fragebogen durch die<br />
Kommunale Arbeitsförderung zugeschickt und der Rücklauf erfolgte direkt an die<br />
FEH. Durch dieses Vorgehen konnten die Datensätze für die Adressen strikt von<br />
den sozioökonomischen Daten und den Antworten getrennt gehalten werden. Die<br />
Anonymität der Befragten und somit der Datenschutz waren dadurch voll gewährleistet.<br />
Alleinige Verbindung war eine zufällige Teilnehmernummer, die für die Rücklaufkontrolle<br />
und die Zuordnung der Fragebogen aus der ersten und der zweiten Befragung<br />
notwendig war. Als Anreiz und als Anerkennung für die Teilnehmer wurde<br />
bei beiden Befragungen für jeden auswertbaren Fragebogen ein Gutschein für den<br />
Eintritt in ein Kasseler Kino ausgelobt. Die Nachfassaktion und die Verteilung der für<br />
die Teilnahme ausgelobten Preise wurden - wegen der strengen Trennung der Adressdatensätze<br />
von den erfassten ausgefüllten Fragebogen - ebenfalls organisatorisch<br />
von der Stadt Kassel betreut.<br />
34
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
6 Die erste Teilnehmerbefragung<br />
6.1 Vorbemerkungen<br />
Ende November/ Anfang Dezember 2002 wurden - in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt<br />
der Stadt Kassel - die 155 Teilnehmer/innen des Modellversuchs gebeten,<br />
an einer ersten schriftlichen Befragung teilzunehmen. Der Rücklauf war mit<br />
113 Fragebögen, d.h. rund 73 %, im Vergleich zu vorliegenden Erfahrungen ungewöhnlich<br />
hoch. Im Rahmen dieser ersten Erhebung standen Fragen über die:<br />
• Dauer und Gründe der Erwerbslosigkeit,<br />
• persönliche Lebenssituation,<br />
• Erwartungen der Teilnehmer/innen sowie<br />
• ersten Erfahrungen der Teilnehmer/innen mit dem Modellversuch<br />
im Vordergrund.<br />
In Tabelle 4 ist die Struktur der Teilnehmer/innen dargestellt. Die 113 Teilnehmer/innen,<br />
die einen Fragebogen ausgefüllt haben, unterscheiden sich in ihren soziodemografischen<br />
Strukturmerkmalen nur in sehr geringem Maße von den<br />
155 Teilnehmer/innen der Grundgesamtheit (vgl. Tabelle 2). Daher können die Befragungsergebnisse<br />
als repräsentativ gelten.<br />
6.2 Dauer und Gründe der Erwerbslosigkeit der Teilnehmer/innen<br />
Die Teilnehmer/innen wurden zunächst danach befragt, wie lange sie vor Eintritt in<br />
das Kasseler Modell Kombilohn nicht erwerbstätig waren. Um die Chancen einer<br />
zügigen Integration in den Arbeitsmarkt abzuschätzen, ist dieses Strukturmerkmal<br />
von hoher Bedeutung, da Langzeitarbeitslosigkeit als wichtiges vermittlungshemmendes<br />
Merkmal gilt. Anhand der Dauer der Erwerbslosigkeit können die Probleme,<br />
die durch die Arbeitsentwöhnung infolge von Langzeiterwerbslosigkeit und die Entwertung<br />
von sozialen und fachlichen Qualifikationen entstehen - um nur zwei Beispiele<br />
zu nennen - abgeschätzt werden.<br />
35
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Tabelle 4: Vergleich der Strukturmerkmale (Angaben jeweils in %)<br />
Merkmale Grundgesamtheit (n = 155) Antwortende Teilnehmer/innen (n = 113)<br />
Alter bis 30 Jahre 22,6 22,1<br />
31-40 Jahre 47,7 46,0<br />
41-50 Jahre 27,1 28,3<br />
über 50 Jahre 2,6 3,5<br />
Geschlecht männlich 29,7 27,4<br />
weiblich 70,3 72,6<br />
Nationalität Deutsche 75,5 73,5<br />
Ausländer 24,5 26,5<br />
Familienstand Ledig 31,6 27,4<br />
Geschieden 25,8 28,3<br />
Getrennt lebend 18,7 16,8<br />
Verheiratet 16,1 18,6<br />
Eheähnliche Gemeinschaft 5,8 6,2<br />
Verwitwet 1,9 2,7<br />
Kinder Ohne Kinder 21,9 21,2<br />
Mit 1 Kind 34,2 34,5<br />
Mit 2 Kindern 23,9 24,8<br />
Mit 3 Kindern 15,5 15,0<br />
Mit 4 und mehr Kindern 4,5 4,4<br />
Schulausbildung Abschluss unbekannt 3,2 4,4<br />
Ohne Schulausbildung 20,0 18,6<br />
Hauptschule (HS) 40,7 35,4<br />
Realschule (RS) 23,8 26,5<br />
Abitur 10,3 12,4<br />
Fachhochschulabschluss 1,9 2,7<br />
Berufsausbildung Mit Berufsausbildung 32,9 34,5<br />
Ohne anerkannte Berufsausbildung 12,9 11,5<br />
Ohne Berufsausbildung 54,2 54,0<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmerdatei und der Teilnehmer/innenbefragung.<br />
36
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass etwas mehr als ein Drittel der Teilnehmer/innen<br />
bis zu einem Jahr erwerbslos ist. Jeweils rund 16 % der Teilnehmer/innen<br />
sind 1 - 2 Jahre bzw. 2 - 5 Jahre ohne Erwerbstätigkeit. Mit knapp 42 %<br />
überwiegen die Teilnehmer/innen, die schon länger als 5 Jahre keiner Erwerbstätigkeit<br />
mehr nachgehen (vgl. Abbildung 13).<br />
Abbildung 13: Dauer der Erwerbslosigkeit<br />
Anteile in Prozent<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
bis zu einem Jahr 1 bis 2 Jahre 2 bis 5 Jahre länger als 5 Jahre<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmer/innenbefragung, eigene Darstellung.<br />
Es kann festgehalten werden, dass eine Vielzahl der Teilnehmer/innen am Modellversuch<br />
aufgrund ihrer langen Dauer der Erwerbslosigkeit - als eigenständiges<br />
Vermittlungshemmnis - über ungünstige Voraussetzungen für die Wiederaufnahme<br />
einer Beschäftigung verfügt. Da die in den amtlichen Statistiken erfassten Strukturmerkmale<br />
nur zum Teil das Ausmaß der Vermittlungshemmnisse abbilden 15 , wurden<br />
die Teilnehmer/innen auch nach den Ursachen für die Erwerbslosigkeit befragt.<br />
Mit dieser Frage sollte auf der einen Seite sichergestellt werden, dass eine realistischere<br />
Einschätzung über die Chancen einer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt<br />
erfolgt. Auf der anderen Seite ist die Einschätzung der Teilnehmer/innen von<br />
großer Bedeutung für die Identifizierung geeigneter individueller Hilfs- und Maßnahmeangebote<br />
im Rahmen des Modellversuchs.<br />
15 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung: Evaluierung von Vermittlungsagenturen auf kommunaler Ebene,<br />
2002, S. 76 f.<br />
37
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Das Ergebnis zeigt, dass über 50 % der Teilnehmer/innen fehlende Arbeitsplatzangebote<br />
als Hauptgrund für die Erwerbslosigkeit ansehen. Dies lässt sehr deutlich erkennen,<br />
dass der Arbeitsplatzakquise durch die kommunalen Akteure eine besondere<br />
Bedeutung zukommt, wenn der Modellversuch ein Erfolg werden soll.<br />
Eine eingeschränkte Mobilität, genauer kein Auto (50,4 %) sowie kein Führerschein<br />
(ca. 40 %), ist aus der Sicht der Teilnehmer/innen ebenfalls ein wichtiger Grund für<br />
die Erwerbslosigkeit. Zudem geben mehr als 45 % der Teilnehmer/innen als Grund<br />
der oftmals sehr langen Erwerbslosigkeit die nicht ausreichende Möglichkeiten der<br />
Kinderbetreuung an. Auffällig ist, dass aus der Sicht der Teilnehmer/innen damit die<br />
drei am häufigsten genannten Gründe nicht in ihrem Verhalten oder ihrer Qualifikation<br />
begründet sind, sondern die Erwerbslosigkeit vielmehr auf "exogenen" Faktoren<br />
beruht.<br />
Die eigene berufliche und schulische Qualifikation wird von über 42 % bzw. 19 %<br />
der Teilnehmer/innen als ein Hindernis für die Wiederaufnahme einer Beschäftigung<br />
angesehen. Das Problem der "Sozialhilfefalle", d.h. keine finanzielle Verbesserung<br />
gegenüber der Sozialhilfe, weil die Transferentzugsrate bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit<br />
zu hoch ist, wird von rund 28 % der Teilnehmer/innen, ein zu niedriger<br />
Arbeitslohn dagegen nur von 15 % der Teilnehmer/innen als Grund für die Erwerbslosigkeit<br />
benannt.<br />
In der Abbildung 14 sind die einzelnen Gründe detailliert dargestellt. Zu beachten ist<br />
dabei, dass aus der Perspektive der Teilnehmer/innen nicht nur ein Grund, sondern<br />
oftmals eine Kumulation von personenbezogenen vermittlungshemmenden Strukturmerkmalen<br />
und exogenen Gründen als Ursache für die Erwerbslosigkeit angegeben<br />
wurde.<br />
38
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Abbildung 14: Genannte Gründe für die Erwerbslosigkeit (Mehrfachantworten möglich)<br />
fehlende<br />
Arbeitsplatzangebote<br />
kein Auto<br />
nicht ausreichende<br />
Möglichkeiten der<br />
Kinderbetreuung<br />
keine Ausbildung<br />
kein Führerschein<br />
keine Berufserfahrung<br />
ungünstige<br />
Arbeitszeiten<br />
keine finanzielle<br />
Verbesserung gegenüber<br />
der Sozialhilfe<br />
gesundheitliche<br />
Beeinträchtigungen<br />
kein Schulabschluss<br />
sprachliche Probleme<br />
schlechte Erreichbarkeit<br />
des Arbeitsplatzes mit<br />
öffentlichen Verkehrsmitteln<br />
zu niedriger<br />
Arbeitslohn<br />
Überschuldung<br />
pflegebedürftige<br />
Haushaltsangehörige<br />
Vorstrafen<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Anteile in Prozent<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmer/innenbefragung, eigene Darstellung.<br />
39
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
6.3 Persönliche Lebenssituation der Teilnehmer/innen<br />
Obwohl eine Vielzahl der Teilnehmer/innen sehr lange, d.h. über 5 Jahre ohne eine<br />
Erwerbstätigkeit war 16 , hatte nur ein sehr geringer Anteil (rund 10 %) die Hoffnung<br />
auf Arbeit aufgegeben (vgl. zu den einzelnen Werten Tabelle 5). Der Aussage, sich<br />
nicht um einen Arbeitsplatz bemüht zu haben, stimmten nur 12 % der Teilnehmer/innen<br />
zu, die überwiegende Mehrzahl hält diese Einschätzung für nicht zutreffend.<br />
Aus der Sicht der beteiligten Sozialhilfeempfänger ist die pauschale Vermutung,<br />
dass sie sich nicht ausreichend um einen Arbeitsplatz bemühen, somit abzulehnen.<br />
Vielmehr weisen nahezu zwei Drittel der Teilnehmer/innen darauf hin, sich<br />
sehr wohl - allerdings ohne Erfolg - um einen Arbeitsplatz bemüht zu haben.<br />
Rund ein Drittel aller Teilnehmer/innen hat darüber hinaus nach eigener Aussage ab<br />
und zu Aushilfstätigkeiten ausgeübt und damit versucht ein Arbeitseinkommen zu<br />
erwirtschaften. In der Gesamtbetrachtung bleibt festzuhalten, dass die Teilnehmer/innen<br />
am Modellversuch nur zu einem geringen Teil eine mangelnde Motivation<br />
erkennen lassen, eine Voraussetzung, die wesentlich für den Erfolg des Modellversuchs<br />
sein kann.<br />
Tabelle 5: Einschätzung der persönlichen Situation vor Beginn des Modellversuchs<br />
(Angaben jeweils in %)<br />
Aussage Trifft zu Trifft teilweise zu Trifft nicht zu Keine Antwort<br />
Hatte die Hoffnung auf Arbeit aufgegeben 10,6 36,3 35,4 17,7<br />
Hatte mich nicht um einen Arbeitsplatz bemüht 12,4 7,1 59,3 21,2<br />
Habe mich erfolglos um einen Arbeitsplatz bemüht 64,6 14,2 8,0 13,3<br />
Habe ab und zu Aushilfstätigkeiten ausgeübt 37,2 10,6 37,2 15,0<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmer/innenbefragung.<br />
Um Aussagen darüber zu treffen, inwiefern sich die persönliche Lebenssituation der<br />
Teilnehmer/innen durch den Modellversuch verändert hat, wurden in der ersten Erhebung<br />
die Teilnehmer/innen nach der Zufriedenheit in ausgewählten Lebenssituationen<br />
befragt. Diese Ergebnisse werden später mit den Ergebnissen der erneuten<br />
Befragung der Teilnehmer/innen zum Ende des Modellversuchs verglichen, um<br />
Veränderungen durch die Teilnahme am Modellversuch herauszuarbeiten.<br />
16 Vgl. Abbildung 13.<br />
40
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Bei der Bewertung der gesundheitlichen, familiären sowie der Wohnsituation ergaben<br />
sich weitgehend übereinstimmende Einschätzungen. 17 Etwa 20 % der Teilnehmer/innen<br />
sind sehr zufrieden, die Mehrzahl (um die 35 %) eher zufrieden. Eher unzufrieden<br />
sind zwischen 18 und 27 %, die Spannweite der Teilnehmer/innen, die<br />
sehr unzufrieden sind, reicht von 6 bis 11 %.<br />
Der Anteil der Teilnehmer/innen, die sehr zufrieden oder eher zufrieden mit diesen<br />
drei ausgewählten Lebenssituationen sind, dominiert somit eindeutig gegenüber den<br />
negativen Einschätzungen.<br />
Abweichend davon sieht die Beurteilung der finanziellen Situation aus: Mit ihrer finanziellen<br />
Situation ist die Mehrzahl der Teilnehmer/innen entweder eher unzufrieden<br />
(42, 5%) oder sehr unzufrieden (ca. 40 %). Hier überwiegt klar die negative Einschätzung.<br />
Abbildung 15: Zufriedenheit der Teilnehmer/innen mit ausgewählten Lebenssituationen<br />
50<br />
Anteile in Prozent<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
gesundheitliche Situation Wohnsituation familiäre Situation finanzielle Situation<br />
sehr zufrieden eher zufrieden eher unzufrieden sehr unzufrieden<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmer/innenbefragung, eigene Darstellung.<br />
6.4 Erwartungen der Teilnehmer/innen und erste Erfahrungen mit dem Modellversuch<br />
Die Erwartungen die Teilnehmer/innen an das Modellprojekt sind vielschichtig. An<br />
erster Stelle erwarten sie, im Rahmen des Modellversuchs einen Arbeitsplatz mit einem<br />
geregelten Einkommen zu erhalten. Eng damit verbunden, und aufgrund der<br />
17 Die prozentualen Werte beruhen auf der Auswertung der 113 Fragebögen, wobei zu berücksichtigen ist, dass bei den<br />
einzelnen Fragen rund 10 bis 15% keine Antwort abgaben.<br />
41
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Einschätzung der finanziellen Situation der Teilnehmer/innen auch nicht besonders<br />
überraschend, ist die Hoffnung der Teilnehmer/innen auf mehr finanzielle Unabhängigkeit.<br />
Insbesondere dieser letztgenannte Aspekt kann eine wichtige Erfolgsvoraussetzung<br />
für das Kombilohnmodell darstellen, sollen doch gerade Anreize für die<br />
Arbeitsaufnahme dieser spezifischen Zielgruppe gesetzt werden.<br />
60 % der Teilnehmer/innen erwarten sich höhere Chancen auf einen Arbeitsplatz.<br />
Das Sammeln von Berufserfahrung steht für 41 % der Teilnehmer/innen im Vordergrund.<br />
Mehr als ein Drittel der Teilnehmer/innen verspricht sich durch die Teilnahme<br />
am Modellversuch eine Verbesserung der familiären Situation, mehr soziale Kontakte<br />
sowie Fortbildungsmöglichkeiten (vgl. Abbildung 16).<br />
Abbildung 16: Erwartungen der Teilnehmer/innen an den Modellversuch<br />
(Mehrfachnennungen möglich)<br />
einen Arbeitsplatz<br />
mit einem geregelten<br />
Einkommen<br />
finanzielle<br />
Unanhängigkeit<br />
höhere Chancen<br />
auf einen Arbeitsplatz<br />
Berufserfahrung<br />
eine Verbesserung der<br />
familiären Situation<br />
Fortbildungsmöglichkeiten<br />
mehr soziale Kontakte<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
Anteile in Prozent<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmer/innenbefragung, eigene Darstellung.<br />
Die Auswertung der Frage, an welchen Modellmaßnahmen sich die Teilnehmer/innen<br />
beteiligten, ergibt, dass die Mehrzahl der Teilnehmer/innen an individuellen<br />
Beratungsgesprächen teilgenommen hat. Bereits 41 Teilnehmer/innen konnten<br />
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Weitere 41 Teilnehmer/innen nahmen an einer<br />
Berufsorientierung teil und 24 Teilnehmer/innen befinden sich in einer fachlichen<br />
Qualifizierungsmaßnahme. Wenige Teilnehmer/innen haben eine Aus- oder Um-<br />
42
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
schulungsmaßnahme angetreten bzw. haben kein weiteres Interesse am Modellversuch<br />
(vgl. Abbildung 17).<br />
Abbildung 17: Teilnahme an einzelnen Maßnahmen im Modellversuch<br />
(Mehrfachnennungen möglich)<br />
Erwerbstätigkeit<br />
Beratungsgespräche<br />
Berufsorientierung<br />
fachliche<br />
Qualifizierung<br />
kein Interesse<br />
am Modellversuch<br />
Ausbildung oder<br />
Umschulung<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80<br />
Anzahl<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmer/innenbefragung, eigene Darstellung.<br />
Aufgrund des hohen Anteils von bereits erwerbstätigen Teilnehmer/innen (36 %) ist<br />
von besonderem Interesse, welche Strukturmerkmale diese Gruppe von Teilnehmer/innen<br />
kennzeichnen. Insbesondere ist zu überprüfen, ob sich diese Teilnehmer/innen<br />
durch eine besonders hohe Qualifikation oder ein geringes Alter auszeichnen,<br />
was die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit begünstigt haben könnte.<br />
Im Vergleich mit der Gesamtheit der 155 Teilnehmer/innen zeigt sich jedoch, dass<br />
die Teilnehmer/innen, die eine Erwerbstätigkeit aufnahmen, sich in Bezug auf die<br />
Strukturmerkmale Alter und berufliche Qualifikation nicht wesentlich von den anderen<br />
unterscheiden (vgl. Tabelle 6). Es kann allenfalls eine leichte Überrepräsentanz<br />
von älteren und weniger qualifizierten Personen festgestellt werden. Mithin Merkmale,<br />
die eine Eingliederung normalerweise eher erschweren.<br />
43
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Tabelle 6: Strukturmerkmale der Teilnehmer/innen in Arbeit im Vergleich (Angaben jeweils in %)<br />
Merkmale<br />
Teilnehmer/innen in Arbeit<br />
(n = 41)<br />
alle Teilnehmer/innen<br />
(n = 155)<br />
Alter bis 30 Jahre 19,5 22,6<br />
31-40 Jahre 46,3 47,7<br />
41-50 Jahre 31,7 27,1<br />
über 50 Jahre 2,4 2,6<br />
Berufsausbildung Mit Berufsausbildung 29,3 32,9<br />
Ohne anerkannte Berufsausbildung 12,2 12,9<br />
Ohne Berufsausbildung 58,5 54,2<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmerdatei und der Teilnehmer/innenbefragung.<br />
Eine sehr lange Phase der Erwerbslosigkeit (länger als 5 Jahre) als eigenständiges<br />
vermittlungshemmendes Merkmal ist kennzeichnend für einen hohen Anteil der<br />
Teilnehmer/innen. Die Teilnehmer/innen, die eine Erwerbstätigkeit aufnehmen konnten,<br />
haben im Vergleich zu den übrigen eine kürzere Dauer der Erwerbslosigkeit<br />
hinter sich. Dieser Unterschied ist jedoch nur gering (vgl. Tabelle 6). Bei den Antworten<br />
der Teilnehmer/innen, die angaben, weniger als ein Jahr erwerbslos gewesen<br />
zu sein, muss insofern ein Missverständnis vorliegen, weil grundsätzlich nur<br />
Personen von der KAF in das Modellprojekt aufgenommen wurden, die länger als<br />
ein Jahr arbeitslos gemeldet waren. Es könnte sein, dass diese Personen Aushilfstätigkeiten<br />
bzw. geringfügige Beschäftigungen ausgeübt haben.<br />
Als Resümee kann deshalb konstatiert werden, dass die erfolgreiche Beschäftigungsaufnahme<br />
von 41 Teilnehmer/innen zumindest nicht durch positive Ausprägungen<br />
der Strukturmerkmale Alter, die berufliche Qualifikation sowie die Dauer der<br />
Erwerbslosigkeit der Teilnehmer/innen zu erklären ist.<br />
44
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Tabelle 7: Dauer der Erwerbslosigkeit der Teilnehmer/innen in Arbeit (Angaben jeweils in %)<br />
Dauer der Erwerbslosigkeit<br />
Teilnehmer/innen in Arbeit<br />
(n = 41)<br />
antwortende Teilnehmer/innen<br />
(n = 113)<br />
Bis zu einem Jahr 18 29,3 26,9<br />
1 bis 2 Jahre 17,1 15,7<br />
2 bis 5 Jahre 12,2 15,7<br />
Länger als 5 Jahre 36,6 41,7<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmer/innenbefragung<br />
Der Modellversuch befand sich zum Zeitpunkt der ersten Befragung noch in einer<br />
sehr frühen Phase. Dennoch wurden die Teilnehmer/innen danach befragt, wie sie<br />
ihre aktuelle Situation im Kasseler Modellversuch Kombilohn einschätzen. Von den<br />
113 Teilnehmer/innen, die den Fragebogen beantwortet haben, gaben 55 Teilnehmer/innen<br />
(ca. 49 %) an, mit ihrer Situation zufrieden zu sein. 27 Teilnehmer/innen<br />
(24 %) waren mit ihrer Situation unzufrieden. Die positive Einschätzung dominiert<br />
somit klar. Nur ein sehr geringer Anteil der Teilnehmer/innen gab an, überfordert<br />
(4,9 %) oder unterfordert (5,9 %) zu sein.<br />
Die Teilnehmer/innen wurden auch gebeten, ihre Situation abschließend zu bewerten,<br />
d.h. sie sollten die Frage beantworten, ob es ihnen durch die Teilnahme am<br />
Modellversuch besser, unverändert oder schlechter geht.<br />
Aufgrund der frühen Modellphase ist es nachvollziehbar, dass rund ein Drittel aller<br />
Teilnehmer/innen dies noch nicht beantworten konnte bzw. ein weiteres Drittel keine<br />
Veränderung seiner allgemeinen Situation angab. Als Zwischenergebnis lässt sich<br />
allerdings festhalten, dass der Anteil der Teilnehmer/innen, denen es im Modellversuch<br />
besser geht, wesentlich höher liegt als der Anteil der Teilnehmer/innen, die ihre<br />
persönliche Situation schlechter einschätzen (vgl. Abbildung 18).<br />
18 Die Zugangsvoraussetzung zum Modellprojekt ist Langzeitarbeitslosigkeit von über einem Jahr. Wenn Teilnehmer/innen<br />
kürzere Arbeitslosenzeiten angeben, so berücksichtigen sie offensichtlich (erlaubte) Gelegenheitsarbeiten oder geringfügige<br />
Beschäftigungsverhältnisse während der Arbeitslosigkeit (oder es liegt Schwarzarbeit vor).<br />
45
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Abbildung 18: Persönliche Situation im Modellversuch<br />
Anteile in Prozent<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
besser unverändert schlechter noch nicht beantwortbar<br />
Insgesamt (n = 113) in Arbeit (n = 41)<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmer/innenbefragung, eigene Darstellung.<br />
Besonders positiv fiel die Einschätzung der Teilnehmer/innen aus, die bereits eine<br />
Erwerbstätigkeit aufgenommen haben. Dies ist aufgrund der Erwartungen an den<br />
Modellversuch - bei denen Arbeitsplätze und eine größere finanzielle Unabhängigkeit<br />
den größten Stellenwert hatten - leicht zu verstehen.<br />
Die Teilnehmer/innen am Kasseler Modellversuch Kombilohn weisen - aufgrund der<br />
spezifischen Zielgruppe des Modellversuchs - in der Regel eine Vielzahl von vermittlungshemmenden<br />
Merkmalen auf. Durch die Befragung wurde darüber hinaus klar,<br />
dass aus der Sicht der Teilnehmer/innen ein ganzes Bündel an sehr unterschiedlichen<br />
Gründen als Ursache für die lange Dauer der Erwerbslosigkeit gesehen wird,<br />
wobei exogene Faktoren, wie ein geringes Arbeitsplatzangebot, eine eingeschränkte<br />
Mobilität sowie nicht ausreichende Möglichkeiten der Kinderbetreuung, als besonders<br />
problematisch beurteilt werden.<br />
46
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
7 Die zweite Teilnehmerbefragung<br />
7.1 Zielsetzung und Methode<br />
Die zweite Befragung der Teilnehmer/innen im Rahmen der Evaluierung des Kasseler<br />
Modells Kombilohn, die im März/April 2004 durchgeführt wurde, ist von entscheidender<br />
Bedeutung für die Ergebnisbeurteilung des Modellversuchs hinsichtlich der<br />
Effekte der Förderung auf die Lebens- und Erwerbssituation der von der Kommunalen<br />
Arbeitsförderung in das Projekt einbezogenen Sozialhilfeempfänger/innen.<br />
Die Grundgesamtheit für die Befragung ist identisch mit derjenigen der ersten Teilnehmerbefragung<br />
vom November 2002 (155 Personen im Verteiler). Da die Inhalte<br />
des Fragebogens teilweise identisch mit denjenigen der ersten Befragung sind,<br />
können direkt Unterschiede in der Bewertung der eigenen Lage und der Arbeitsmarktsituation<br />
in Kassel damals und aktuell gezogen werden. Zusätzlich kann für<br />
diejenigen, die sich an beiden Befragungen beteiligten, durch den Vergleich ihrer<br />
aktuellen und der damaligen Situation die persönliche Auswirkung des Programms<br />
festgestellt werden.<br />
7.2 Repräsentativitätsüberprüfung, Struktur der Teilnehmer/innen<br />
Da die Grundgesamtheit der 2. Befragung mit derjenigen der ersten Befragung identisch<br />
ist, kann auf die detaillierte Darstellung der soziodemografischen Struktur der<br />
155 Teilnehmer/innen am Kasseler Modellversuch Kombilohn an dieser Stelle verzichtet<br />
werden 19 .<br />
In das Kasseler Modell Kombilohn sind – wie der folgenden Tabelle zu entnehmen<br />
ist -wesentlich mehr weibliche Sozialhilfeempfänger einbezogen worden, als männliche.<br />
Der Rücklauf in beiden Befragungen bildet dieses Verhältnis fast exakt ab.<br />
19 Vgl. dazu die Auswertung der 1. Teilnehmerbefragung in Kap. 6, in der die soziodemografische Struktur der Grundgesamtheit<br />
der Teilnehmer/innen dargestellt wurde.<br />
47
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Tabelle 8: Teilnehmer/innen am Modellversuch und ihre Beteiligung an den Befragungen<br />
Teilnehmer<br />
insgesamt männlich weiblich<br />
Grundgesamtheit absolut 155 46 109<br />
Anteil in % 29,7 70,3<br />
Teilnehmer 1. Befragung absolut 113 31 82<br />
Anteil in % 27,4 72,6<br />
Teilnehmer 2. Befragung absolut 88 25 63<br />
Anteil in % 28,4 71,6<br />
Teilnehmer an beiden Befragungen absolut 76 21 55<br />
Anteil in % 27,6 72,4<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmerdatei und der Teilnehmer/innenbefragungen der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Die 113 Teilnehmer/innen, die bei der ersten Befragung einen Fragebogen ausgefüllt<br />
haben sowie die 88 Teilnehmer/innen an der 2. Befragung und auch die 76 Personen,<br />
die an beiden Befragungen teilgenommen haben, unterscheiden sich in ihren<br />
soziodemografischen Strukturmerkmalen nur in sehr geringem Maße von den<br />
155 Teilnehmer/innen der Grundgesamtheit (vgl. Tabelle 9). Daher können die Ergebnisse<br />
aus allen Auswertungen als repräsentativ gelten.<br />
48
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Tabelle 9: Vergleich der Strukturmerkmale (Angaben jeweils in %)<br />
Merkmale<br />
Grundgesamtheit<br />
(n = 155)<br />
Teilnehmer/innen<br />
1. Befragung<br />
(n = 113)<br />
Teilnehmer/innen<br />
2. Befragung<br />
(n = 88)<br />
Teilnehmer/innen<br />
1. und 2. Befragung<br />
(n = 76)<br />
Alter bis 30 Jahre 22,6 22,1 20,5 22,4<br />
31-40 Jahre 47,7 46,0 47,7 46,0<br />
41-50 Jahre 27,1 28,3 28,4 27,6<br />
über 50 Jahre 2,6 3,5 3,4 3,9<br />
Geschlecht männlich 29,7 27,4 28,4 27,6<br />
weiblich 70,3 72,6 71,6 72,4<br />
Nationalität Deutsche 75,5 73,5 71,6 71,1<br />
Ausländer 24,5 26,5 28,4 28,9<br />
Familienstand Ledig 31,6 27,4 31,8 28,9<br />
Geschieden 25,8 28,3 23,9 26,3<br />
Getrennt lebend 18,7 16,8 19,3 17,1<br />
Verheiratet 16,1 18,6 18,2 19,7<br />
Eheähnl. Gemeinsch. 5,8 6,2 4,5 5,3<br />
Verwitwet 1,9 2,7 2,3 2,6<br />
Kinderzahl Ohne Kinder 21,9 21,2 26,1 25,0<br />
1 Kind 34,2 34,5 35,2 35,5<br />
2 Kinder 23,9 24,8 23,9 25,0<br />
3 Kinder 15,5 15,0 10,2 9,2<br />
4 und mehr Kinder 4,5 4,4 4,5 5,3<br />
Schulausbildung Abschluss unbekannt 3,2 4,4 2,2 2,6<br />
Ohne Schulausbildung 20,0 18,6 20,5 19,7<br />
Hauptschule (HS) 40,7 35,4 37,4 33,9<br />
Realschule (RS) 23,8 26,5 26,1 29,0<br />
Abitur 10,3 12,4 12,5 13,2<br />
FH-Abschluss 1,9 2,7 1,1 1,3<br />
Berufsausbildung Mit Berufsausbildung 32,9 34,5 34,1 35,5<br />
Abgebr. Berufsausb. 12,9 11,5 21,5 19,7<br />
Ohne Berufsausb. 54,2 54,0 44,3 44,7<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmerdatei und der Teilnehmer/innenbefragungen.<br />
49
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Nachfolgend sind zunächst die Ergebnisse der Erhebung bezogen auf alle teilnehmenden<br />
Personen an der Zweitbefragung dargestellt (n=88). Danach wird die Auswertung<br />
für diejenigen Personen durchgeführt, die an beiden Befragungen teilgenommen<br />
haben. Der Schwerpunkt liegt dabei darauf, wie sich die Eingliederung in<br />
den Arbeitsmarkt darstellt und inwieweit die Teilnahme an dem Projekt die Lebenssituation<br />
und die Zufriedenheit der Geförderten verändert hat.<br />
7.3 Auswertung der Befragungsergebnisse<br />
7.3.1 Direkte Wirkungen der Teilnahme am Modell<br />
Die ersten beiden Fragen erheben, welche Art der Förderung bzw. Vermittlung<br />
dem/der Teilnehmer/in im Rahmen des Modellprojektes zuteil wurde.<br />
Frage 1: Sie haben im Jahr 2002/2003 durch die Kommunale Arbeitsförderung<br />
(KAF) am „Kasseler Modell Kombilohn“ teilgenommen. Was haben Sie gemacht?<br />
Da die Betreuung der Sozialhilfeempfänger durch die Kommunale Arbeitsförderung<br />
im Kasseler Modell auch Vorschaltmaßnahmen umfasste, die vor einer (möglichst<br />
passgenauen) Vermittlung in den Arbeitsmarkt für notwendig gehalten wurden (Hilfeplan),<br />
wurde hier die gesamte Palette der verschiedenen Angebote abgefragt. Da<br />
dieselbe Person mehrere Angebote wahrgenommen haben konnte, waren auch<br />
Mehrfachantworten möglich.<br />
Tabelle 10: Art der Förderung der Befragungsteilnehmer/innen durch KaMoKo<br />
Teiln. insg. männlich Anteil (%) weiblich Anteil (%)<br />
Befragungsteilnehmer 88 25 28,4 63 71,6<br />
Beratungsgespräch 47 15 31,9 32 68,1<br />
Berufsorientierungskurs 25 12 48,0 13 52,0<br />
Sonst. Qualifizierung 23 8 34,8 15 65,2<br />
Aufnahme einer Arbeit 46 13 28,3 33 71,7<br />
darunter Vollzeit 17 9 52,9 8 47,1<br />
Teilzeit 21 1 4,8 20 95,2<br />
MiniJob 5 1 20,0 4 80,0<br />
Quelle: Auswertung der zweiten Teilnehmer/innenbefragung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
50
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Von den 88 Teilnehmer/innen an der Befragung gaben 47 (53%) an, ein Beratungsgespräch<br />
gehabt zu haben. Bei den Männern erinnerten sich 60% und bei den<br />
Frauen 51% an ein solches Gespräch. Da mit allen Teilnehmer/innen zu Beginn ihrer<br />
Teilnahme am Modellprojekt ein Einstiegsgespräch geführt wurde, in dem grundsätzliche<br />
Informationen vermittelt wurden, wurde dieses offensichtlich nicht von allen<br />
Befragten als Beratungsgespräch wahrgenommen.<br />
Frage 2: Wenn Sie durch die KAF eine Arbeit gefunden haben, wie lang hat Ihr<br />
Arbeitsverhältnis gedauert?<br />
Von den 46 Personen, die durch die KAF in Arbeit vermittelt worden waren (vgl.<br />
Frage 1) machten 37 Angaben darüber wie lange das Arbeitsverhältnis gedauert<br />
hat. Die überwiegende Mehrheit von 26 Personen (21 Frauen, 5 Männer) hatte die<br />
Arbeit über die gesamte geplante Förderzeit von einem Jahr. 5 Personen (1 Frau, 4<br />
Männer) waren kürzer als 1 Jahr in geförderter Arbeit. Die vorzeitige Beendigung<br />
kann verschiedene Gründe haben, die allerdings in der Befragung nicht erhoben<br />
wurden, weil die Vermutung bestand, dass - insbesondere in negativen Fällen – keine<br />
zutreffende Auskunft über die Beendigungsgründe zu erhalten wären 20 . 6 Personen<br />
(4 Frauen, 2 Männer) gaben an, länger als ein Jahr in dem Arbeitsverhältnis<br />
gewesen zu sein. Offensichtlich wurde von diesen die Frage insofern missverstanden<br />
21 , als ein Verbleib/Übergang in Arbeit nach Abschluss der Förderung hier in die<br />
Antwort einging. Von den 37 Personen, die durch die KAF in (geförderte) Arbeit gekommen<br />
waren, befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung im Frühjahr 2004 18<br />
(16 Frauen, 2 Männer) noch in diesem Arbeitsverhältnis. 21 Personen (13 Frauen, 8<br />
Männer) hatten das Arbeitsverhältnis bereits beendet 22 .<br />
Aus der Auswertung der Frage 2 sind insbesondere folgende Ergebnisse festzuhalten:<br />
rund drei Viertel der in Arbeit vermittelten Teilnehmer/innen mit Angaben zur<br />
Dauer des Arbeitsverhältnisses haben ihren Arbeitsplatz über die volle Förderzeit<br />
behalten. Frauen haben zu einem deutlich höheren Prozentsatz das volle Jahr oder<br />
länger den Arbeitsplatz behalten als Männer, auf die 4 der 5 vorzeitigen Beendigungen<br />
entfielen.<br />
20 Ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem geförderten Arbeitsverhältnis kann u.a. folgende Gründe haben: Wechsel in ein<br />
anderes Arbeitsverhältnis, Beendigung wegen Krankheit, Kündigung durch den Arbeitgeber wegen Fehlverhaltens des<br />
Arbeitnehmers oder wegen Betriebsschließung.<br />
21 Da es sich bei vielen Teilnehmer/innen des Modellversuchs um Personen mit Migrationshintergrund handelt, könnten<br />
auch Sprach- bzw. Verständnisprobleme für die Beantwortung ursächlich sein.<br />
22 Wegen der Anonymisierung der Fragebogen konnte nicht geklärt werden, wie sich die Differenz von 2 „unlogischen Antworten“<br />
(37 Befragte versus 39 Antworten im 2. Teil der Frage) ergibt.<br />
51
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
7.3.2 Derzeitige Erwerbssituation<br />
Zur Überprüfung der aktuellen Beschäftigungssituation und der Nachhaltigkeit der<br />
Förderung sowie der aus der Betreuung durch die KAF gezogenen möglichen anderweitigen<br />
positiven Effekte diente Frage 3.<br />
Frage 3: Was machen Sie jetzt - im März 2004 - ?<br />
Der erste Teil der im Fragebogen vorgegebenen Antwortmöglichkeiten richtete sich<br />
an diejenigen Personen, die zum Befragungszeitpunkt eine feste Arbeit (außerhalb<br />
des Modellversuchs) hatten. Es waren dies 24 Personen (22 Frauen, 2 Männer).<br />
Auch an diesem Erfolgsindikator gemessen haben Frauen von der Förderung/Betreuung<br />
durch die KAF in deutlich überproportionaler Weise positive Ergebnisse<br />
erzielt. Die Zusatzfrage, in welchem Beruf/Tätigkeitsgebiet die Beschäftigung<br />
erfolgt, wurde nur von der Hälfte der in Arbeit befindlichen Personen beantwortet, so<br />
dass dadurch kein sicheres Bild über die Tätigkeiten gewonnen werden kann. Mehrere<br />
Nennungen bezogen sich auf den Einzelhandel (Verkäuferin/Regalauffüller)<br />
und auf das Hotel- und Gaststättengewerbe (Zimmerfrau).<br />
Unübersehbar ist der Klebeeffekt der geförderten Arbeit, denn 11 der 24 Übergänge<br />
in Arbeit erfolgten bei dem „alten“ Arbeitgeber. Dies wird auch durch die mit den Arbeitgebern<br />
geführten Gesprächen bestätigt. Es wurde darin immer wieder betont,<br />
dass durch eine Übernahme erneute Personalakquisitionskosten und Einarbeitungszeiten<br />
vermieden werden könnten. Es wäre deshalb unökonomisch, bewährtes<br />
Personal auszutauschen. Dem gegenüber wurde jedoch auch die Überlegung angestellt,<br />
dass durch die Einstellung einer „neuen“ geförderten Person für ein weiteres<br />
Jahr ein deutlich spürbarer Lohnkostenzuschuss unter rein betriebswirtschaftlichen<br />
Gründen verlockend wäre. Da die geförderten Arbeitsverhältnisse häufig von<br />
kleinen Betrieben zur Verfügung gestellt wurden, kam als weitere die Entscheidung<br />
beeinflussende Überlegung noch die persönliche Bindung und somit eine sozialethische<br />
Kategorie dazu, die zugunsten der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses ausschlug.<br />
Bei einem neuen Arbeitgeber haben 6 Personen (ausschließlich Frauen) Arbeit gefunden<br />
und 7 in Arbeit befindliche Personen haben keine näheren Angaben über<br />
den Arbeitgeber gemacht. Weitere 9 Personen (4 Frauen, 5 Männer) üben zeitweise<br />
Aushilfstätigkeiten aus.<br />
Mit 49 Personen sind über die Hälfte derjenigen, die sich an der Befragung beteiligten,<br />
arbeitslos. Die meisten von ihnen (32; 21 Frauen, 11 Männer)) „immer noch“<br />
arbeitslos, d.h. dass diese Personen zwar von der KAF betreut und beraten und teilweise<br />
auch qualifiziert worden waren, aber nicht in (geförderte) Arbeit vermittelt<br />
werden konnten. 17 Personen (10 Frauen, 7 Männer) waren „wieder“ arbeitslos; sie<br />
52
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
hatten also zwischenzeitlich Arbeit gefunden, konnten diese jedoch nicht dauerhaft<br />
behalten. Sechs Teilnehmer an der Befragung machten keine Angaben über ihren<br />
Erwerbsstatus zum Befragungszeitpunkt.<br />
Im zweiten Teil von Frage 3 wurde erfragt, inwieweit sich – außer einer Arbeitsaufnahme<br />
als dem Primärziel der Förderung – andere positive Effekte für die Teilnehmer/innen<br />
ergeben haben. Ein Viertel der Befragten beantwortete die Fragen dieses<br />
Komplexes nicht. Jeweils rund 70 % bejahten die Aussagen, dass die Betreuung im<br />
Modellversuch ihnen etwas gebracht habe, weil sie etwas gelernt hätten, weil sie<br />
beweisen konnten, dass sie etwas können und weil die Hoffnung gestützt wurde,<br />
dass doch noch eine Arbeit gefunden werden kann. Differenziert man die Antworten<br />
auf diese Fragen nach dem Geschlecht, so sind die Einschätzungen bezüglich des<br />
Lerneffekts und der Hoffnung auf einen Arbeitsplatz bei den Männern mit jeweils<br />
rund 80% Zustimmung positiver als bei den Frauen, deren Zustimmung dafür lediglich<br />
bei rund 66% lag. Besser bewertet wird dagegen von den Frauen mit 71% Zustimmung<br />
(Männer 65%), dass sie die Möglichkeit bekommen haben, sich und anderen<br />
zu beweisen, dass sie etwas zu leisten vermögen.<br />
7.3.3 Zufriedenheit mit der (privaten) Lebenssituation<br />
Vertieft wurde die Bewertung der augenblicklichen Situation der Lebensumstände<br />
bezüglich der persönlichen, finanziellen, familiären, Wohnungs- und gesundheitlichen<br />
Situation in Frage 4.<br />
Frage 4: Wie bewerten Sie Ihre Lebenssituationen jetzt?<br />
Im Fragebogen waren zu den einzelnen Teilfragen jeweils zwei positive (sehr zufrieden,<br />
eher zufrieden) und zwei negative (eher unzufrieden, sehr unzufrieden)<br />
Antwortmöglichkeiten vorgegeben 23 . Die einzelnen Fragen wurden jeweils von rd.<br />
80 der 88 an der Befragung teilnehmenden Personen beantwortet.<br />
Die persönliche Situation wurde von 55% der Befragten positiv gesehen Durchschnittsnote<br />
2,95). Auffällig dabei ist, dass Männer ihre Situation (Anteil der positiven<br />
Wertungen 44%) deutlich zurückhaltender bewerten als Frauen (60% positive<br />
Wertung). Dies kommt auch in der ermittelten Durchschnittsnote zum Ausdruck, die<br />
bei den Männern mit 3,32 deutlich schlechter ausfällt als bei den Frauen mit 2,79.<br />
Insgesamt sehr unzufrieden sind die Befragungsteilnehmer mit ihrer finanziellen Situation.<br />
Mit der Durchschnittsnote von 3,77 und negativen Einschätzungen von drei<br />
Viertel der Befragten erhält dieser Bereich die mit Abstand schlechteste Beurteilung<br />
23 Zur Berechnung der Durchschnittsbewertung wurde „sehr zufrieden“ gleich Note 1, „eher zufrieden“ gleich Note 2, „eher<br />
unzufrieden“ gleich Note 4 und „sehr unzufrieden“ gleich Note 5 gesetzt.<br />
53
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
von allen abgefragten Lebenssituationen. Nur knapp ein Viertel der Befragten äußerte<br />
sich positiv zu ihrer finanziellen Situation. Männer (Note 4,25) sehen die Lage<br />
noch negativer als Frauen (Note 3,57). Weniger als 10% der Männer können ihrer<br />
finanziellen Situation überhaupt etwas Positives abgewinnen. Bei den Frauen sind<br />
es immerhin rund 30%.<br />
Abbildung 19: Bewertung der Lebenssituation differenziert nach dem Geschlecht<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
in Prozent<br />
männl. TN<br />
Bewertung<br />
positiv<br />
weibl. TN<br />
Bewertung<br />
positiv<br />
männl. TN<br />
Bewertung<br />
negativ<br />
20<br />
weibl. TN<br />
Bewertung<br />
negativ<br />
0<br />
Persönliche<br />
Situation<br />
Finanzielle Situation Familiäre Siutation Wohnsituation Gesundheitliche<br />
Situation<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmer/innenbefragung, eigene Darstellung.<br />
Recht gut und auch homogen wird die familiäre Situation beurteilt (Durchschnittsnote<br />
2,28). Frauen sind etwas zufriedener (Note 2,22) als Männer (Note 2,42). Dies<br />
gilt in fast gleicher Weise für die Wohnungssituation, die mit einer Gesamtnote von<br />
2,26 bewertet wurde und bei der Frauen wiederum mit der Note 2,23 geringfügig zufriedener<br />
sind als Männer (Note 2,33).<br />
Schließlich ergab sich auch bei der Beurteilung des gesundheitlichen Befindens eine<br />
zum Positiven neigende Bewertung (Note 2,57), weil zwei Drittel der Befragten<br />
damit sehr oder eher zufrieden waren. Allerdings scheinen Frauen mit ihrer Gesundheit<br />
größere Probleme zu haben oder sie kritischer zu beobachten als Männer,<br />
denn die Bewertung bleibt mit 2,67 spürbar hinter derjenigen der Männer zurück<br />
(Durchschnittsnote 2,33).<br />
54
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
7.3.4 Zusammenarbeit mit der KAF<br />
Nachdem alle Teilnehmer am Kombilohnmodell längere Erfahrung im Kontakt mit<br />
der Kommunalen Arbeitsförderung hatten, wurde in Frage 5 anhand von 7 Aussagen/Thesen<br />
eine Einschätzung der Arbeit der KAF abgefragt. Nicht alle der 88 Befragungsteilnehmer/innen<br />
haben sich zu allen Fragen geäußert, so dass die Zahl<br />
der Antworten von Frage zu Frage variiert. Der Auswertung der einzelnen zu beurteilenden<br />
Themen liegen zwischen 49 und 67 Antworten zugrunde.<br />
Frage 5: Wie bewerten Sie im Rückblick die Zusammenarbeit mit der<br />
Kommunalen Arbeitsförderung (KAF)?<br />
5.1: Arbeitsangebot (67 Antworten; 48 Frauen, 19 Männer)<br />
Der Aussage „Ich habe schnell eine Arbeit angeboten bekommen“ hat knapp die<br />
Hälfte der Befragten zugestimmt und etwas mehr als die Hälfte verneinte die Aussage.<br />
Auffällig ist, dass die Zustimmung bei den Männern mit 58% deutlich höher<br />
ausfiel als bei den Frauen mit 44%. Dafür gibt es mehrere Erklärungsmöglichkeiten.<br />
Zunächst ist festzustellen, dass – wie an anderer Stelle bereits ausgeführt ist – wesentlich<br />
mehr Frauen an dem Modellversuch beteiligt waren als Männer und insofern<br />
möglicherweise pro Teilnehmerin weniger Beschäftigungsmöglichkeiten akquiriert<br />
werden konnten als für die männlichen Teilnehmer. Dies könnte auch damit zusammenhängen,<br />
dass die Arbeitsmarktsituation in Kassel für die Klientel des Modellversuchs<br />
für männliche Arbeitskräfte besser war als für Frauen. Es könnte jedoch<br />
auch möglich sein, dass die Frauen (ein großer Teil sind Alleinerziehende) mit<br />
größerer Erwartungshaltung an die KAF herangetreten sind und dringender Arbeit<br />
angestrebt haben als die Männer. Umso „enttäuschter“ reagierten sie deshalb, wenn<br />
sich ihre Wünsche nicht schnell genug realisieren ließen.<br />
5.2: Atmosphäre (62 Antworten; 46 Frauen, 16 Männer)<br />
Die Atmosphäre bei der Kommunalen Arbeitsförderung wurde mit 85% Zustimmung<br />
eindeutig als angenehm empfunden. Männer und Frauen unterscheiden sich in diesem<br />
Urteil auch nur geringfügig. Eine Umgebung und Gesprächssituation zu schaffen,<br />
die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Kunden und „Amt“ ermöglicht,<br />
ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit. Dies scheint die<br />
Kommunale Arbeitsförderung erreicht zu haben. Ergänzt wird dies durch weitere<br />
positive Bewertungen bezüglich anderer Aspekte der Kommunikation (s.u.).<br />
55
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
5.3: Problemlösung (51 Antworten; 35 Frauen, 16 Männer)<br />
Die Erwartungshaltung an die KAF zur Lösung der Probleme der Teilnehmer/innen<br />
scheint hoch gewesen zu sein. Zwar konnten nur knapp 60% der Befragten zu dieser<br />
Frage Stellung beziehen, weil sie wahrscheinlich die KAF nicht mit entsprechenden<br />
Anfragen konfrontiert haben. In den Augen der Betroffenen, die offensichtlich<br />
Erfahrungen gemacht hatten, ging es jedoch mit der Bewältigung nicht immer<br />
schnell genug, denn der Aussage „Bei Problemen wurde mir schnell geholfen“ haben<br />
lediglich zwei Drittel zugestimmt. Männer waren dabei geringfügig zufriedener<br />
als Frauen.<br />
5.4: Beratung über berufliche Zukunft (61 Antworten; 44 Frauen, 17 Männer)<br />
Da die KAF im Modellversuch neben der konkreten Vermittlung in Arbeit auch vorbereitende<br />
und beratende Funktionen zu erfüllen hatte, die zur Vorbereitung einer<br />
Arbeitsaufnahme dienen, wurde die Aussage „Ich wurde hinsichtlich meiner beruflichen<br />
Möglichkeiten gut beraten“ zur Bewertung vorgelegt. Insgesamt konnten dieser<br />
Aussage gut 70% der Teilnehmer/innen zustimmen. Zwischen den Geschlechtern<br />
differiert die Einschätzung jedoch deutlich, denn die Männer waren zu über 80%<br />
dieser Meinung und bei den Frauen erreichte die Zustimmung nicht die 70%-Marke.<br />
Dieser Unterschied in der Beurteilung kann - ähnlich wie bereits bei der Interpretation<br />
anderer Aussagen - auch mit einer gesteigerten Erwartungshaltung bei den Frauen<br />
zusammen hängen.<br />
5.5: KAF als permanenter Ansprechpartner (66 Antworten; 48 Frauen, 18<br />
Männer)<br />
Mit 91% Zustimmung wird die Aussage „Es stand immer ein/e Ansprechpartner/in<br />
zur Verfügung“ am besten von allen vorgelegten Aussagen bewertet. Männer sind<br />
zwar mit 83% etwas zurückhaltender in ihrer Zustimmung als Frauen, die mit 94%<br />
ein überragendes Zeugnis ausstellen. Zusammen mit der guten Atmosphäre bei der<br />
KAF dokumentiert dieses Ergebnis, dass sich die Teilnehmer/innen im Rahmen des<br />
Modellprojektes gut aufgenommen und akzeptiert gefühlt haben. Eindrucksvoll ergänzt<br />
wird dies durch die Antworten auf die Frage 5.6<br />
5.6: Hilfe bei individuellen Problemen (50 Antworten; 35 Frauen, 15 Männer)<br />
Zu „Meine Probleme wurden ernst genommen“ konnten 86 % zustimmen. Für Männer<br />
scheint dies mit einer Zustimmung von 93% noch wichtiger und beeindruckender<br />
gewesen zu sein als für Frauen (83% Zustimmung).<br />
56
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
5.7: Bürokratischer Aufwand (49 Antworten; 33 Frauen, 16 Männer)<br />
Die letzte Einschätzung über die Zusammenarbeit mit der KAF rückte mit der Aussage<br />
“Die KAF handelt unbürokratisch“ den Verfahrensaspekt in den Vordergrund.<br />
Mit einer Zustimmung von 73%, die von den Geschlechtern kaum unterschiedlich<br />
gesehen wird, kommt zwar vergleichsweise eine gewisse Zurückhaltung zum Ausdruck,<br />
aber angesichts notwendiger unverzichtbarer Verwaltungsabläufe, die vom<br />
Nutzer immer als lästig empfunden werden, erscheint dieses Ergebnis dennoch sehr<br />
zufriedenstellend und zeigt, dass Schwellenängste abgebaut bzw. gar nicht erst<br />
entstanden sind.<br />
Bezüglich der Bewertung der Arbeit der kommunalen Arbeitsförderung durch die<br />
Kunden kann zusammenfassend festgestellt werden, dass es – mit Ausnahme der<br />
nicht ausreichenden Arbeitsangebote - keine wichtigen Kritikpunkte gab. Was die<br />
Vermittlungsangebote anbelangt, ist schwer zu beurteilen, inwieweit das in Kassel<br />
angesichts der allgemeinen Arbeitsmarktlage sehr schwierige Akquisitionspotenzial<br />
ausgeschöpft worden ist oder nicht. Einige Hinweise dazu finden sich in den Kapiteln<br />
über die Arbeitsmarktsituation in Kassel und über die Implementierung des Programms<br />
bzw. die Ergebnisse der Betriebsbefragung.<br />
7.3.5 Gesamtbewertung des Modells durch den/die Teilnehmer/in<br />
Als Abschlussfrage wurde von den Teilnehmer/innen eine Gesamtbewertung des<br />
Modellversuchs gemessen an eigenen Erwartungen erbeten:<br />
Frage 6: Hat die Teilnahme am Kasseler Modell Kombilohn insgesamt gesehen<br />
Ihre Erwartungen erfüllt?<br />
Die Frage 6 wurde von 82 der 88 Befragungsteilnehmer/innen beantwortet. 60%<br />
bewerten ihre Teilnahme am Modell positiv bzw. sehen ihre Erwartungen erfüllt. Die<br />
Beurteilung von Männern und Frauen differiert kaum. Immerhin 40% der Befragten<br />
sind enttäuscht bzw. unzufrieden über das Kasseler Modell Kombilohn. Aus den angegebenen<br />
Gründen für eine negative Bewertung wird eindeutig sichtbar, dass von<br />
wenigen Ausnahmen abgesehen die Ursache dafür darin liegt, dass der erwartete<br />
oder wenigstens erhoffte Übergang in (dauerhafte) Arbeit sich nicht erfüllte. In einigen<br />
wenigen Fällen wird diese Begründung durch Vorhaltungen an die KAF ergänzt.<br />
In den Formulierungen kommt Bitternis und Verzweiflung über die eigene (verschuldete<br />
oder unverschuldete) Situation zum Ausdruck, die (über-?) empfindliche Reaktionen<br />
auf unerfüllte Erwartungen zur Folge hat.<br />
Einige Befragte haben auch Erklärungen für ihre Zufriedenheit mit dem Modellversuch<br />
formuliert: In diesen Aussagen wird die Zufriedenheit mit dem (teilweise auch<br />
nur vorübergehenden) Erhalten eines Arbeitsplatzes begründet. Insofern entspricht<br />
57
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
dies genau spiegelbildlich den Anmerkungen der Unzufriedenen und es bestätigt die<br />
Bedeutung, die Arbeit für die Zufriedenheit der Teilnehmer/innen hat.<br />
7.4 Auswertung der 2. Teilnehmerbefragung nach besonderen Merkmalen<br />
7.4.1 Verbleib nach abgeschlossener geförderter Arbeit<br />
Von den 46 Teilnehmer/innen, die in ein gefördertes Arbeitsverhältnis eingetreten<br />
sind, haben 30 Angaben über den Beginn der Arbeitsaufnahme (siehe Frage 2) gemacht.<br />
Von diesen hatten 21 zum Zeitpunkt der 2. Befragung bereits wieder den<br />
einjährigen Förderzeitraum überschritten, so dass deren Erwerbssituation zum Zeitpunkt<br />
der Befragung Aufschluss über die Nachhaltigkeit der geförderten Beschäftigung<br />
geben kann: Von diesen 21 Personen hatten neun eine feste Beschäftigung (8<br />
Frauen, 1 Mann). Der „Klebeeffekt“ der geförderten Beschäftigung war relativ hoch,<br />
denn 6 Frauen waren noch bei dem „alten Arbeitgeber“, eine Frau war bei einem<br />
anderen Arbeitgeber beschäftigt und bei einer Frau und einem Mann liegen über<br />
den Arbeitgeber keine Informationen vor. Darüber hinaus übt eine Frau Aushilfstätigkeiten<br />
aus. 11 Personen (d.h. 52%) waren wieder arbeitslos (7 Männer, 4 Frauen).<br />
Von allen 88 Befragten waren 49 (somit 56%) noch oder wieder arbeitslos.<br />
7.4.2 Auswirkung von geförderter Arbeit auf die Lebensumstände und Zufriedenheit der<br />
Teilnehmer/innen mit dem Modellversuch<br />
Neben dem Primärziel der geförderten Arbeit, nämlich den Übergang in dauerhafte<br />
Beschäftigung zu erreichen, gibt es Sekundäreffekte, die ebenfalls positiv zu bewerten<br />
sind. Diese kann insbesondere durch eine besondere Auswertung der Frage 4<br />
nachvollzogen werden. Wie sich die Bewertung ihrer derzeitigen Lebensumstände<br />
der 46 durch die KAF in Arbeit vermittelten Sozialhilfeempfänger von der Bewertung<br />
aller an der Befragung teilnehmenden Personen unterscheidet, ist in Tabelle 11 und<br />
in Abbildung 20 dargestellt.<br />
Aus der Gegenüberstellung der Auswertungen ist für alle angesprochenen Lebensbereiche<br />
ersichtlich, dass die Vermittlung in Arbeit – auch wenn diese nicht immer in<br />
ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis mündete – einen eindeutig positiven Einfluss<br />
auf die Beurteilung der eigenen Lebensumstände hat. Es ist zu vermuten, dass<br />
nicht immer eine objektiv bessere Situation zu dieser besseren Bewertung beigetragen<br />
hat, sondern dass die durch die Arbeit erfolgte Befriedigung und Anerkennung<br />
Mut gemacht hat und deshalb auch die eigene Situation optimistischer gesehen<br />
wird. Dies trifft in besonderem Maße auf die Frauen zu: sowohl bei allen Befragten<br />
als auch bei denjenigen, die Arbeit hatten, sind die positiven Bewertungsanteile bei<br />
Frauen im Schnitt rd. 5%-Punkte höher als bei den Männern und die negativen ent-<br />
58
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
sprechend niedriger. Allein ihre gesundheitliche Situation wird von Frauen (ebenfalls<br />
um etwa 5%-Punkte) schlechter bewertet als von Männern.<br />
Tabelle 11: Beurteilung der Lebenssituation 2004 in Abhängigkeit vom Erwerbsstatus<br />
Alle Befragten (n=88)<br />
In Arbeit vermittelte Befragte (n=46)<br />
Sehr/eher<br />
Sehr/eher<br />
Sehr/eher<br />
Sehr/eher<br />
zufrieden<br />
unzufrieden<br />
zufrieden<br />
unzufrieden<br />
(Anteil in %)<br />
(Anteil in %)<br />
(Anteil in %)<br />
(Anteil in %)<br />
Persönliche Situation 51 49 67 33<br />
Finanzielle Situation 23 77 35 65<br />
Familiäre Situation 66 34 74 26<br />
Wohnsituation 69 31 89 11<br />
Gesundheitliche Situation 61 39 76 24<br />
Quelle: Auswertung der zweiten Teilnehmer/innenbefragung durch die <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>; die jeweils geringen Anteile<br />
derjenigen, die keine Angaben machten, wurden zur Berechnung der Quoten proportional aufgeteilt.<br />
Abbildung 20: Zufriedenheit der Befragten mit Arbeit im Modellprojekt im Vergleich zu denen<br />
ohne Vermittlung<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
in Prozent<br />
Befragte mit<br />
Arbeit<br />
Bewertung<br />
positiv<br />
Befragte mit<br />
Arbeit<br />
Bewertung<br />
negativ<br />
Befragte ohne<br />
Arbeit<br />
Bewertung<br />
positiv<br />
Befragte ohne<br />
Arbeit<br />
Bewertung<br />
negativ<br />
0<br />
Persönliche<br />
Situation<br />
Finanzielle Situation Familiäre Siutation Wohnsituation Gesundheitliche<br />
Situation<br />
Quelle: Auswertung der Teilnehmer/innenbefragung, eigene Darstellung.<br />
59
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Auch die Gesamtbewertung des Modellversuchs (Frage 6) hängt eng damit zusammen,<br />
ob eine (zeitweise) Vermittlung in Arbeit stattgefunden hat. Die Zustimmung<br />
liegt mit 80% bei den Vermittelten insgesamt und mit 84% bei den vermittelten<br />
Frauen deutlich höher als bei den Befragten insgesamt (60% positive Urteile). Noch<br />
höher ist die Zufriedenheit mit dem Kasseler Modell Kombilohn mit einer Quote der<br />
erfüllten Erwartung von 90% bei denjenigen, die nach Abschluss der geförderten<br />
Arbeit in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis einmündeten.<br />
7.4.3 Auswirkung von geförderter Arbeit auf den Übergang in dauerhafte Arbeitsverhältnisse<br />
Wie bereits bei der Auswertung der Frage 3 dargestellt, konnten nicht alle - sondern<br />
lediglich 24 - der durch die KAF geförderten bzw. betreuten Personen, die sich an<br />
der Befragung beteiligten, ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis begründen. Klar erkennbar<br />
ist, dass wegen des Klebeeffekts die effektivste Maßnahme zur Vorbereitung<br />
eines dauerhaften Arbeitsverhältnisses die Vermittlung in ein gefördertes –<br />
zeitlich befristetes - Arbeitsverhältnis war. 20 der 24 Personen hatten diesen Weg<br />
beschritten. Aber immerhin 4 ehemalige Sozialhilfeempfänger waren in dauerhafter<br />
Arbeit, ohne vorher in ein gefördertes Arbeitsverhältnis vermittelt gewesen zu sein.<br />
Es wurden jedoch andere Angebote der KAF genutzt. Je 1 Person hatte ein Beratungsgespräch,<br />
nahm an einem Berufsorientierungskurs teil bzw. hatte an einer anderen<br />
Qualifizierung teilgenommen. Inwiefern dieses ursächlich für den Übergang in<br />
dauerhafte Arbeit war, lässt sich nicht feststellen. Es bleibt somit festzuhalten, dass<br />
natürlich die Beratung durch die KAF, die für alle Personen im Modellprojekt obligatorisch<br />
war, ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der KAF ist. Im Hinblick auf das eigentliche<br />
Ziel der (Re-)Integration der Sozialhilfeempfänger ist jedoch die Herstellung<br />
direkter Kontakte zu Arbeitgebern eine sehr wichtige und erfolgversprechende,<br />
wenn auch sicherlich zeitaufwändige und damit teuere, Möglichkeit einer wirkungsvollen<br />
kommunalen Arbeitsmarktpolitik 24 .<br />
7.5 Auswertung der Fragebogen von den Teilnehmer/innen, die an der 1. und der 2.<br />
Befragung teilgenommen haben<br />
7.5.1 Dauerhaftigkeit der Arbeitsverhältnisse<br />
Zum Zeitpunkt der 1. Befragung waren 28 Personen (22 Frauen, 6 Männer) bereits<br />
von der KAF in Arbeit vermittelt worden. 15 von diesen (13 Frauen, 2 Männer) befanden<br />
sich zum Zeitpunkt der 2. Befragung in einem Arbeitsverhältnis und können<br />
24 Die Ansiedlung neuer und die Pflege der vorhandenen Betriebe stellt unabhängig davon ein weiteres kommunales Aktionsfeld<br />
mit Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt dar.<br />
60
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
deshalb als in den Arbeitsmarkt integriert betrachtet werden, denn die Förderung<br />
des Arbeitsverhältnisses dieser Personen war bei allen mindestens schon 4 Monate,<br />
bei den meisten jedoch über 8 Monate und bei einigen sogar mehr als 1 Jahr beendet.<br />
Diese nachhaltige Integration der Teilnehmer/innen am Modellversuch in den Arbeitsmarkt,<br />
die hälftig beim „alten“ Arbeitgeber und zur anderen Hälfte bei einem<br />
anderen Arbeitgeber erfolgte, relativiert etwas den an anderer Stelle der Auswertung<br />
(der Arbeitgeberbefragung) konstatierten Verdacht von erheblichen Mitnahmeeffekten<br />
durch die Arbeitgeber.<br />
7.5.2 Fragen zur aktuellen und damaligen Lebenssituation<br />
Wie bereits dargestellt, haben sich von den 113 Teilnehmern der 1. Teilnehmerbefragung<br />
76 Personen auch an der 2. Teilnehmerbefragung beteiligt. Ihre soziologische<br />
Struktur weicht von der Grundgesamtheit aller vom Kasseler Modell Kombilohn<br />
erfassten Personen nur geringfügig ab, so dass die Ergebnisse der Auswertung der<br />
2. Befragung im vorangegangenen Kapitel (bezogen auf die 88 Befragungsteilnehmer/innen)<br />
auch auf die Teilmenge derjenigen, die an beiden Befragungen teilgenommen<br />
haben, zutrifft.<br />
Für die Personen, die an beiden Befragungen teilgenommen haben, lässt sich bei<br />
der beide Male identisch gestellten Frage zur Beurteilung ihrer Lebenssituation direkt<br />
feststellen, wie sich ihre Einschätzung unter dem Einfluss des Modellversuchs<br />
verändert hat.<br />
Wie die Gegenüberstellung in der folgenden Tabelle zeigt, beurteilen dieselben Personen<br />
ihre Situation aktuell mit einer größeren Zufriedenheit als dies anderthalb<br />
Jahre zuvor der Fall war. Bei der verknüpften Auswertung aus beiden Befragungswellen<br />
zeigt sich, dass Frauen im Durchschnitt mit ihrer Situation zufriedener waren<br />
als Männer und dass sich ihre Zufriedenheit zwischen den beiden Befragungen<br />
deutlich stärker erhöht hat als dies bei den Männern der Fall war. Allein die Einschätzung<br />
der gesundheitlichen Situation hat sich bei den Frauen im Zeitablauf nicht<br />
verbessert. Die größte Unzufriedenheit besteht immer noch bezüglich der finanziellen<br />
Situation, auch wenn sich die Beurteilung im Niveau etwas verbessert hat.<br />
Überdurchschnittlich besser bewertet wurde die finanzielle Situation von Frauen:<br />
Waren noch 2002 lediglich 9% der Frauen damit sehr oder eher zufrieden, so kennzeichneten<br />
2004 dieses Kriterium immerhin 30% der Frauen positiv.<br />
61
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Tabelle 12: Beurteilung der Lebenssituation 2002 und 2004<br />
Beurteilung Nov. 2002 (n=76)<br />
Beurteilung April 2004 (n=76)<br />
Sehr/eher<br />
zufrieden<br />
(Anteil in %)<br />
Sehr/eher<br />
unzufrieden<br />
(Anteil in %)<br />
Sehr/eher<br />
zufrieden<br />
(Anteil in %)<br />
Sehr/eher<br />
unzufrieden<br />
(Anteil in %)<br />
Finanzielle Situation 10 90 24 76<br />
Familiäre Situation 66 34 71 29<br />
Wohnsituation 60 40 78 22<br />
Gesundheitl. Situation 63 37 64 36<br />
Quelle: Auswertung der ersten und zweiten Teilnehmer/innenbefragung durch die <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>; die jeweils geringen<br />
Anteile derjenigen, die nicht antworteten, wurden zur Berechnung der Quoten proportional aufgeteilt.<br />
7.5.3 Erfüllung der Erwartungen beim Eintritt in den Modellversuch<br />
In der ersten Befragung wurde erfasst, welche Erwartungen die Teilnehmer/innen<br />
an die Beteiligung am Modellversuch knüpfen 25 . Inwieweit sich diese Vorstellungen<br />
realisierten, wurde anhand des tatsächlich Erreichten in der zweiten Befragung<br />
überprüft.<br />
65 Personen erwarteten einen Arbeitsplatz und ein geregeltes Einkommen. Für<br />
37 (das sind 57%) ging dieser Wunsch insofern in Erfüllung, als sie in ein zeitlich befristetes<br />
Arbeitsverhältnis vermittelt wurden. Bei der Mehrzahl dieser Vermittlungen<br />
wurden die Förderinstrumente Lohnkostenzuschuss bzw. Kombilohn eingesetzt. Es<br />
kamen jedoch auch Vermittlungen ohne eines der beiden Instrumente zustande. Gut<br />
ein Drittel davon hatte eine Vollzeitbeschäftigung und knapp zwei Drittel eine Teilzeitbeschäftigung<br />
oder einen MiniJob 26 . Für 21 realisierte sich darüber hinaus eine<br />
Folgebeschäftigung, so dass ein Drittel der Befragten auch längerfristig den formulierten<br />
Wunsch umsetzen konnte.<br />
In eine ähnliche – etwas weniger konkrete - Richtung ging die Erwartung auf „höhere<br />
Chancen auf einen Arbeitsplatz“, die von 46 der 76 Befragungsteilnehmer/innen<br />
geäußert wurde. Von diesen Personen hatten 28 ein gefördertes Arbeitsverhältnis<br />
vermittelt bekommen (10 Vollzeit, 18 Teilzeit und MiniJob) und 17 (16<br />
Frauen, 1 Mann) hatten bei der Zweitbefragung ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis.<br />
25 Da Mehrfachnennungen möglich waren, können bei der Auswertung Personen auch mehrfach bei den Erfüllungsquoten<br />
enthalten sein.<br />
26 MiniJobs wurden zwar von der KAF vermittelt, eine finanzielle Förderung für diese Arbeitsverhältnisse gab es jedoch<br />
nicht.<br />
62
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Berufserfahrung sammeln wollten 30 Befragte und für 21 wurde dies in Form eines<br />
geförderten Arbeitsverhältnisses Wirklichkeit. Für 12 von ihnen ergab sich sogar eine<br />
Beschäftigung nach der Förderphase (11 Frauen, 1 Mann).<br />
Fortbildungsmöglichkeiten zu erhalten war die Erwartung von 31 Personen. Sie<br />
wurde für 6 Teilnehmer/innen in Form eines Berufsorientierungskurses umgesetzt.<br />
Allerdings könnten auch praktische Tätigkeiten im Rahmen von Arbeitsverhältnissen<br />
eine Fortbildung im Sinne von Weiterqualifizierung bedeuten, so dass nicht eindeutig<br />
festgestellt werden kann, in welchem Maße diesbezüglich sich die Erwartungen<br />
der Teilnehmer/innen erfüllten.<br />
Den Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit, den 52 Teilnehmer/innen hegten,<br />
lässt sich ebenfalls nicht konkret überprüfen. Hilfsweise kann jedoch die Bewertung<br />
der finanziellen Situation (Frage 4 der 2. Teilnehmerbefragung) herangezogen werden.<br />
14 der 52 Teilnehmer/innen (das sind 27%) äußerten sich zufrieden. Diese<br />
Quote ist nur geringfügig höher als der Anteil der Zufriedenen bei allen Befragten<br />
(24%) und kann deshalb nicht als Beweis erfüllter Erwartungen interpretiert werden.<br />
Eine nicht direkt mit einem Arbeitsmarkprogramm zu verbindende Erwartung war eine<br />
Verbesserung der familiären Situation, die von 34 Befragten benannt wurde.<br />
22 von diesen waren bei der 2. Befragung mit ihrer familiären Situation zufrieden.<br />
Dieser Anteil von 65 % unterscheidet sich jedoch nicht von dem bei denjenigen, die<br />
diese Erwartung nicht an den Modellversuch geknüpft hatten.<br />
63
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
8 Einbeziehung der Arbeitgeber in den Evaluierungsprozess<br />
Das Kasseler Modellprojekt Kombilohn erschöpft sich nicht in der Beratung und<br />
Vermittlungstätigkeit des definierten Klientels – arbeitslose Sozialhilfeempfänger –<br />
;auch die Akquisition von vakanten Stellen, die für die zu vermittelnden Personen<br />
geeignet sind, ist Inhalt des Modellprojektes. Die Arbeitgeber, die am Projekt beteiligt<br />
sind, stellen deshalb eine wichtige Quelle zur Beurteilung des Ansatzes, das Ablaufs<br />
und der erreichten Ergebnisse des Modellprojektes dar.<br />
Um den gesamten Erfahrungshintergrund möglichst vieler Arbeitgeber ausschöpfen<br />
zu können, wurde eine schriftliche Befragung gewählt, die durch Interviews mit einem<br />
Teil der Arbeitgeber ergänzt wurde.<br />
Der Fragebogen der schriftlichen Befragung gliederte sich in drei Themenkomplexe.<br />
Im ersten Teil wurden die Motive für die Teilnahme am Modellversuch erfragt. Im<br />
zweiten Teil standen Kenntnisse und gemachte Erfahrungen mit anderen Arbeitsmarktprogrammen<br />
im Vergleich zu KaMoKo sowie die Zusammenarbeit mit der KAF<br />
im Mittelpunkt. Der dritte Teil schließlich galt den Erfahrungen mit den geförderten<br />
Beschäftigten.<br />
Mit 10 Arbeitgebern wurden leitfadengestützte Interviews (Expertengespräche) von<br />
im Durchschnitt knapp einstündiger Dauer geführt. Die Auswahl der interviewten Arbeitgeber<br />
wurde aus allen Arbeitgebern mit einem geförderten Beschäftigten getroffen.<br />
Es waren somit auch solche an den Expertengesprächen beteiligt, die nicht an<br />
der schriftlichen Befragung teilgenommen hatten. Insofern konnte durch diese Vorgehensweise<br />
die Informationsbasis nicht nur durch qualitative Auskünfte und Einschätzungen<br />
vertieft werden, sondern sie wurde durch die Einbeziehung zusätzlicher<br />
Arbeitgeber noch verbreitert. Ein Abgleich, ob die Interviewpartner sich an der<br />
schriftlichen Befragung beteiligt hatten oder nicht, wurde nicht vorgenommen. In den<br />
Interviews wurden den Arbeitgebern die Befragungsergebnisse vorgestellt. Mittels<br />
gezielter Nachfragen durch die Interviewer wurden die Ergebnisse hinterfragt, durch<br />
Beispiele ergänzt und teilweise auch relativiert.<br />
8.1 Methodisches Vorgehen und zeitlicher Ablauf der schriftlichen Befragungen<br />
Im Juni 2003 und im März 2004 wurden 50 Arbeitgeber angeschrieben, die zum<br />
Stichtag November 2002 einen durch die Kommunale Arbeitsförderung (KAF) vermittelten<br />
und im Kasseler Modellprojekt Kombilohn integrierten (ehemaligen) Sozialhilfeempfänger<br />
beschäftigt hatten (Totalerhebung). Da einige Arbeitgeber mehrere<br />
geförderte Arbeitnehmer gleichzeitig oder gestaffelt beschäftigt hatten, wurden so<br />
64
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
die beschäftigtenbezogenen Erfahrungen von über 70 geförderten Personen in die<br />
Befragungen einbezogen.<br />
Beide Befragungen waren als freiwillige, anonyme Befragungen angelegt.<br />
Der Versand der Fragebogen erfolgte durch die KAF mit einem Anschreiben, das<br />
von der Sozialdezernentin der Stadt Kassel unterzeichnet war. Dieses Verfahren<br />
wurde gewählt, weil zum einen den Arbeitgebern für ihre Kooperation in dem Projekt<br />
gedankt werden sollte und weil zum andern dadurch eine höhere Akzeptanz bei den<br />
Befragten und damit ein hoher Fragebogenrücklauf erwartet wurde. Da durch dieses<br />
Verfahren das Adressenmaterial der Arbeitgeber nicht in die Verfügungsgewalt der<br />
evaluierenden Stelle gelangte, war die Anonymität der befragten Firmen von vornherein<br />
gewährleistet. Die Rücksendung der Fragebogen erfolgte mit einem dem<br />
Fragebogen beigelegten Freiumschlag direkt an die FEH nach Wiesbaden. Um jeden<br />
Verdacht des Verletzens der Anonymität auszuräumen, waren die Fragebogen<br />
nicht nummeriert, was allerdings den Nachteil hatte, dass eine Rücklaufkontrolle,<br />
welcher Arbeitgeber sich an der Befragung beteiligte und welcher nicht, nicht möglich<br />
war und deshalb auch eine gezielte Nachfassaktion zur Erhöhung der Rücklaufs<br />
nicht durchgeführt werden konnte. In wenigen Fällen wären die Antworten den Absendern<br />
zuzuordnen gewesen, weil sie sich durch Stempelaufdruck auf den Rückumschlägen<br />
oder Ähnliches selbst identifizierten. Durch sofortige Vernichtung der<br />
Umschläge wurde diese theoretische Möglichkeit unterbunden.<br />
8.2 Erste Befragung der Arbeitgeber mit geförderten Beschäftigten<br />
Der Rücklauf der Fragebogen verlief relativ schleppend und blieb insgesamt hinter<br />
den Erwartungen zurück. Um auch Nachzügler noch berücksichtigen zu können,<br />
wurden alle Fragebogen, die bis zum Ende der Sommerpause (gemessen an den<br />
hessischen Schulferien, die am 29. August 2003 endeten) bei der FEH eingingen, in<br />
die Auswertung einbezogen.<br />
Insgesamt gingen 21 auswertbare Fragebogen ein, die sich auf 23 Beschäftigte bezogen.<br />
Die Rücklaufquote betrug damit 42%.<br />
8.2.1 Information und Motivation<br />
Eine der Besonderheiten des Kassler Modells Kombilohn bestand darin, dass aktive<br />
Arbeitsplatzakquisition durch die Kommunale Arbeitsförderung betrieben werden<br />
sollte, um zusätzliche (neue) Beschäftigungsmöglichkeiten für die vom Modellversuch<br />
angesprochene Personengruppe im Arbeitsmarkt Kassel zu finden oder anzustoßen.<br />
Da die Befragung sich an Betriebe richtete, bei denen ein Beschäftigungsverhältnis<br />
mit einem Teilnehmer von KaMoKo bestand, war zumindest das Ziel, ein<br />
65
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Beschäftigungsverhältnis zu begründen, erreicht. Von Interesse ist jedoch, wie dieser<br />
„Erfolg“ zustande kam, um erfolgreiche Methoden der Arbeitsplatzbeschaffung<br />
heraus zu filtern. Diesem Ziel diente Frage 1.<br />
Frage 1: Wie haben Sie von dem Modellversuch „Kasseler Modell Kombilohn“<br />
erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)<br />
Durch<br />
Hinweise in der Tagespresse<br />
Mitteilungen in Verbandsorganen (z.B. IHK-Zeitschrift)<br />
Informationsveranstaltungen<br />
direktes Anschreiben der „Kommunalen Arbeitsförderung“<br />
direkte Ansprache der „Kommunalen Arbeitsförderung“<br />
Sonstiges, bitte nennen.........................................................................<br />
Die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit für das Kasseler Modell Kombilohn, die - wie an<br />
anderer Stelle des Berichtes dargelegt ist – durch diverse Aktionen intensiv betrieben<br />
wurde, ist von den Arbeitgebern nur in sehr geringem Umfang wahrgenommen<br />
worden. Jeweils lediglich von einem oder zwei Arbeitgebern wurden Hinweise in der<br />
Tagespresse, Mitteilungen in Verbandsorganen oder Informationsveranstaltungen<br />
als Informationsquelle für das Projekt angegeben. Wesentlich erfolgreicher waren<br />
die direkten Aktionen der kommunalen Arbeitsförderung, die in insgesamt 9 Fällen<br />
die Arbeitgeber mit dem Modell vertraut machten. Dabei waren Anschreiben (5<br />
Nennungen) und Telefonaktionen (4 Nennungen) gleich erfolgreich. Unerwartet ist<br />
das Ergebnis, dass das Gros der Kontakte mit 12 Nennungen durch „Sonstiges“<br />
hergestellt wurde. Dahinter verbirgt sich, dass in 9 Fällen der/die Teilnehmer/in den<br />
Kontakt zum Arbeitgeber gesucht hat und ihn auf das Modell aufmerksam machte.<br />
Jeweils eine Verbindung wurde durch (mündliche) Information eines Mitarbeiters der<br />
Handwerkskammer, durch Information eines Kollegen des Arbeitgebers sowie durch<br />
eigene Recherchen des Arbeitsgebers begründet.<br />
Wie aus den ergänzenden Interviews mit den Arbeitgebern deutlich wurde, ist die<br />
Tagespresse das am regelmäßigsten gelesene Printmedium. Kammerinformationen<br />
(IHK und HWK) sind wegen der (Zwangs-)Mitgliedschaft der meisten Betriebe zwar<br />
regelmäßig vorhanden, sie werden jedoch sehr häufig nur unregelmäßig und flüchtig<br />
gelesen. Als Gründe wurden dafür in den Interviews u.a. Zeitmangel, Desinteresse<br />
an der Kammerarbeit, unattraktive und unübersichtliche Informationsaufbereitung in<br />
den Veröffentlichungen genannt. Eine Reihe der Arbeitgeber wird durch Kammerinfos<br />
nicht erreicht, weil sie nicht darin organisiert sind. Eine höhere Akzeptanz bei<br />
den Betrieben fanden Fachzeitschriften aus den jeweiligen Sparten (z.B. Hotel- und<br />
Gaststättenverband, Lebensmittelzeitung u.ä.). Die Problematik dieser Veröffentlichungen<br />
in Bezug auf regional bezogene Informationen - wie es die KaMoKo-<br />
66
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Förderung ist - liegt jedoch darin, dass normalerweise keine Regionalseiten darin<br />
existieren und deshalb derartige Veröffentlichungen, die sich nur auf ein eng begrenztes<br />
Gebiet beziehen, schwer platzierbar sind, weil sie nur auf einen kleinen<br />
Teil der Leserschaft zutreffen.<br />
Eigene Aktivitäten der Arbeitnehmer haben nach den Angaben der Arbeitgeber<br />
überraschend und in erfreulich vielen Fällen die Aufnahme eines Beschäftigtenverhältnisses<br />
zur Folge gehabt, denn fast die Hälfte der in der Befragung erfassten geschlossenen<br />
Arbeitsverträge ist auf diese Weise zustande gekommen.<br />
In den Interviews wurde hinterfragt, inwieweit die Zufriedenheit der Arbeitgeber positiv<br />
mit dem „Suchengagement“ der Arbeitnehmer korreliert. Aufgrund der kleinen<br />
Zahl sind die Aussagen im statistischen Sinn nicht als repräsentativ zu klassifizieren,<br />
aber es zeichnet sich der spürbare Trend ab, dass aktive Arbeitnehmer auch<br />
bei der Ausfüllung des Arbeitsplatzes überdurchschnittlich engagiert sind.<br />
Frage 2 hatte das Ziel festzustellen, was letztendlich den Anstoß dazu gab, dass ein<br />
Arbeitsverhältnis mit einem Sozialhilfeempfänger begründet wurde.<br />
Frage 2 Warum haben Sie sich an dem Modellversuch beteiligt und einen<br />
Arbeitsplatz angeboten?<br />
Aktive Unterstützung bei der Personalsuche durch die „Kommunale Arbeitsförderung“<br />
Lohnkostenzuschuss für den Arbeitgeber<br />
Kombilohn für den Arbeitnehmer<br />
Sonstige Argumente, bitte nennen: ..................................................................................<br />
Genau die Hälfte der Antworten besagte, dass die Subvention der Arbeit in Form eines<br />
Lohnkostenzuschusses an den Arbeitgeber, das heißt de facto eine Reduzierung<br />
der Kosten für die Arbeit, wichtig für die Besetzung des Arbeitsplatzes war. Zu<br />
knapp 20% wurde die Zahlung eines Zuschusses an den Arbeitnehmer (Kombilohn)<br />
als ausschlaggebend bezeichnet, weil sich durch die Zahlung von Kombilohn die<br />
Motivation des Arbeitnehmers erhöhe, was sich in besserer Arbeitszufriedenheit und<br />
in besseren Arbeitsleistungen ausdrücke und insofern dem Arbeitgeber nütze. Es<br />
besteht jedoch die Vermutung, dass einige Arbeitgeber bei der Beantwortung dieser<br />
Frage nicht voll über den Unterschied von Lohnkostenzuschuss und Kombilohn informiert<br />
waren und insofern die Antworten nicht trennscharf sind und von der Aussage<br />
her zusammengefasst werden müssen. Das heißt somit, dass über zwei Drittel<br />
der Motivation Arbeitsverhältnisse im Kasseler Modell Kombilohn zu begründen, den<br />
finanziellen Anreizen des Modells zuzurechnen sind.<br />
Mit je 15% wurden jedoch auch andere Motive genannt:<br />
Zum einen ist dies die Vermittlungstätigkeit der kommunalen Arbeitsförderung, die<br />
67
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
durch die Akquisition von latent vorhandenen Arbeitsplätzen und die passende<br />
Vermittlung eines/r geeigneten Sozialhilfeempfängers/in zur Realisierung des Arbeitsplatzes<br />
beigetragen haben. Und zum andern kommt bei der Antwortmöglichkeit<br />
„Sonstiges“ eine gefühlte und gelebte gesellschaftliche Verantwortung der Arbeitgeber<br />
zum Ausdruck, denn bei dieser offenen Fragestellung wurde angegeben, dass<br />
den Sozialhilfeempfängern und Stellenbewerbern eine „Chance“ oder „Hilfestellung<br />
zur Wiedereingliederung in das Erwerbsleben“ gegeben werden sollte.<br />
Die Interviews bei den Arbeitgebern, bei denen dieser Punkt speziell hinterfragt<br />
wurde, bestätigten diese Interpretation. Es wurde eingeräumt, dass zwar einesteils<br />
eine gewisse Reserviertheit Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern gegenüber<br />
bestand, gleichzeitig aber auch eine soziale Verantwortung vorhanden war,<br />
die zu einem eigenen Beitrag zur Lösung der Arbeitsmarktprobleme allgemein<br />
schwer vermittelbarer Personengruppen motivierte.<br />
8.2.2 Arbeitsmarktpolitik/Arbeitsamt/Kommunale Arbeitsförderung<br />
Ziel des Modellversuchs ist es u.a. ein anderes – ein besseres - Vermittlungsangebot<br />
sowohl für die Arbeitgeber als auch für die besondere Zielgruppe von Arbeitnehmern<br />
– Sozialhilfeempfänger - im regionalen Arbeitsmarkt zu generieren, als<br />
dies bislang zur Verfügung stand. Um die Aktivitäten im Rahmen des Modellversuchs<br />
in den Gesamtkontext der sonstigen Arbeitsmarktförderung einordnen zu<br />
können, wurden die Arbeitgeber zunächst nach ihrem Erfahrungshintergrund befragt.<br />
Frage 3: Haben Sie bereits früher finanzielle Leistungen durch das Arbeitsamt<br />
bei der Wiedereingliederung von Arbeitslosen genutzt oder nutzen Sie sie<br />
derzeit?<br />
nein (wenn nein, weiter mit Frage 6)<br />
ja:<br />
Eingliederungszuschüsse<br />
Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose<br />
Sonstige, bitte nennen: .........................................................................<br />
Von 21 Arbeitgebern, die an der Befragung beteiligt waren, haben 8, also gut ein<br />
Drittel, bislang keine Erfahrungen mit Förderprogrammen der Arbeitsverwaltung gesammelt.<br />
Von den 13 Arbeitgebern, die schon entsprechende Leistungen bezogen<br />
haben oder beziehen, haben bereits einige mehrere der im Fragebogen angebotenen<br />
Programme genutzt. Am häufigsten handelte es sich bei den insgesamt 17<br />
Nennungen um Eingliederungszuschüsse, die bereits 9 Arbeitgeber erhalten hatten.<br />
7-mal wurden Beschäftigungsbeihilfen genannt.<br />
14 Befragte gaben ein Urteil über die Fördermöglichkeiten durch das Arbeitsamt ab.<br />
68
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Frage 4: Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit den oben genannten arbeitsmarktpolitischen<br />
Maßnahmen?<br />
Sehr gut eher gut eher schlecht sehr schlecht<br />
Die Bewertung fiel günstig aus, denn 11 Befragte (knapp 80%) hatten gute oder<br />
sehr gute Erfahrungen gesammelt und nur 3 (gut 20%) bezeichneten die Erfahrungen<br />
mit „eher schlecht“. Völlig negativ fiel gar kein Urteil aus.<br />
8.2.3 Erfahrungen mit dem Modellprojekt und dessen Umsetzung<br />
Da das Kasseler Modellprojekt Kombilohn von seinem Ansatz her - sowohl was die<br />
Pflege des Arbeitsplatzangebotes als auch die Auswahl der geeigneten Arbeitskräfte<br />
(bei einem im Durchschnitt schwierigeren Klientel!) anbelangt – eine ambitionierte<br />
Herangehensweise beinhaltet, war es wichtig festzustellen, ob die beteiligten Arbeitgeber<br />
dies bemerkten und wie sie das Angebot aufnehmen. Dies auszuloten war<br />
Inhalt von Frage 5.<br />
Frage 5: Wenn bereits Erfahrungen mit Arbeitskräften vorliegen, die durch<br />
andere Arbeitsmarktprogramme gefördert wurden, lassen sich Unterschiede<br />
zu dem Kontakt mit der Kommunalen Arbeitsförderung feststellen?<br />
nein<br />
ja, in der Person der Arbeitnehmer im Programm positiv negativ<br />
ja, in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung positiv negativ<br />
ja, sonstige. Welche?.......................................................................................................<br />
In 8 Fällen ergaben sich keine Unterschiede in der Zusammenarbeit mit den zuständigen<br />
Stellen, wenn sie geförderte Beschäftigte von unterschiedlichen Stellen<br />
hatten.<br />
In ebenfalls 8 Aussagen wurden Unterschiede festgestellt, die ausnahmslos positiv<br />
zugunsten der kommunalen Arbeitsförderung ausfielen. Dreimal wurde die Auswahl<br />
des vermittelten Arbeitnehmers als im Vergleich positiv bewertet, 4 Nennungen bezogen<br />
sich auf die Zusammenarbeit mit den Ämtern und einmal wurde das Verfahren<br />
(„unkompliziertes Antragswesen“), das von der KAF praktiziert wird, positiv erwähnt.<br />
Unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung der Arbeitsmarktsituation in Kassel ist<br />
letztendlich entscheidend, inwieweit die guten Erfahrungen der Arbeitgeber mit der<br />
KAF auch tatsächlich zu einer Ausweitung des Arbeitsplatzangebotes geführt haben.<br />
69
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Frage 6: Wäre ohne den Modellversuch „Kasseler Modell Kombilohn“<br />
(KaMoKo) der Arbeitsplatz mit einer anderen Person besetzt worden?<br />
nein<br />
ja<br />
12 Befragte hätten – ohne die Zusammenarbeit mit der KAF - den Arbeitsplatz auch<br />
mit einer (anderen) Person besetzt. In 9 Fällen wurde angegeben, dass ohne das<br />
Kasseler Modell Kombilohn niemand eingestellt worden wäre. In Verbindung mit den<br />
Antworten zu den Fragen 2 und 5 kann festgestellt werden, dass diese zusätzlichen<br />
Arbeitsplätze dem Zusammenspiel von der aktiven Stellenakquise der KAF und den<br />
erbrachten Beratungsleistungen in Verbindung mit den finanziellen Anreizen des<br />
Modells zuzurechnen sind. Bei den 12 anderen hätte es offensichtlich dieser Anreize<br />
nicht bedurft, d.h. die geförderte Einstellung einer – nicht aber der speziellen mit<br />
Vermittlungshemmnissen behafteten – Person, stellte einen Mitnahmeeffekt dar. Ob<br />
bzw. wie derartige Mitnahmeeffekte, die erst aufgrund der Auskunft der Arbeitgeber<br />
im Nachhinein festgestellt werden, vermieden werden können, lässt sich nicht generell<br />
beantworten. Ein Hinweis ergab sich jedoch insofern aus den Interviews, als es<br />
Arbeitgeber gibt, die erwogen, nach Auslaufen der Förderung des ersten Arbeitnehmers<br />
diesen durch einen anderen – wieder geförderten - Arbeitnehmer zu ersetzen.<br />
Andere Arbeitgeber lehnten dies jedoch aus ethischen und ökonomischen Erwägungen<br />
ab, wenn sie mit dem Arbeitnehmer zufrieden waren. Neuerliche Kosten<br />
für Bewerberauswahl und Einarbeitungszeit sowie das Risiko des Scheiterns des<br />
Arbeitsverhältnisses würden in ihren Augen durch die mögliche Subvention der<br />
Lohnkosten nicht aufgewogen.<br />
Wie die Tätigkeit der KAF bezogen auf im einzelne Elemente ihres Tätigkeitsspektrums<br />
beurteilt wird, ist durch Frage 7 ermittelt worden:<br />
Frage 7: Beurteilung der Zusammenarbeit mit der Kommunalen Arbeitsförderung<br />
(KAF)<br />
Unser/ mein Unternehmen/ Haushalt ist...<br />
Beurteilung bezüglich...<br />
sehr<br />
zufrieden<br />
eher<br />
zufrieden<br />
eher<br />
unzufrieden<br />
sehr<br />
unzufrieden<br />
trifft<br />
nicht zu<br />
1 ... Auswahl der Bewerber<br />
2 ... Stellenbesetzung<br />
3 ... Kommunikation mit der KAF<br />
4 ... Hilfe bei Problemen<br />
5<br />
... Abwicklung der Förderung bei<br />
Lohnkostenzuschuss<br />
70
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
2 Befragte haben keine Bewertung in Frage 7 abgegeben, so dass sich die Auswertung<br />
auf die Angaben von 19 Arbeitgebern beziehen.<br />
7.1: Bewerberauswahl<br />
Bezüglich der Auswahl der Bewerber ergibt sich auf der Basis von 13 Antworten<br />
(für 6 Befragte traf die Frage nicht zu, weil z. B. der Arbeitnehmer direkt Kontakt<br />
zum Arbeitgeber aufgenommen hatte oder nur ein Bewerber vorgesprochen hatte)<br />
eine Durchschnittsnote von 2,0 27 . 7 Befragte waren mit der getroffenen Auswahl der<br />
vermittelten Bewerber „eher zufrieden“, je 3 „sehr zufrieden“ bzw. „eher unzufrieden“.<br />
Völlig unzufrieden war keiner der Arbeitgeber.<br />
7.2: Stellenbesetzung<br />
Auf der Basis von 15 Bewertungen erreichte die Stellenbesetzung die Note 2,1. Die<br />
eher Unzufriedenen mit 4 Nennungen überwiegen die sehr Zufriedenen (2 Nennungen).<br />
Keine Stellenbesetzung fiel sehr unzufriedenstellend aus. Für 4 Arbeitgeber<br />
traf die Fragestellung aus ähnlichen Gründen wie bei der Bewerberauswahl nicht zu.<br />
7.3: Kommunikation<br />
Die Kommunikation mit der Kommunalen Arbeitsförderung wurde bis auf einen Arbeitgeber<br />
in Anspruch genommen und in 15 Antworten als sehr oder eher zufriedenstellend<br />
bezeichnet. Für 3 Arbeitgeber waren die Kontakte eher nicht zufriedenstellend.<br />
Völlige Unzufriedenheit kam nicht vor. Als Durchschnittsnote ergibt sich<br />
1,8.<br />
7.4: Problemlösung<br />
Am besten war die Benotung der Arbeit der KAF bezüglich der Hilfe bei auftretenden<br />
Problemen mit den Durchschnittswert 1,6. Für 5 Befragte traf die Fragestellung<br />
nicht zu, weil offensichtlich keine mit Hilfe der KAF zu klärenden Probleme aufgetreten<br />
waren. Von 14 Beurteilungen durch Arbeitgeber fiel lediglich eines mit „eher unzufrieden“<br />
negativ aus. 7 bzw. 8 Arbeitgeber waren sehr oder eher zufrieden.<br />
7.5: Finanzielle Abwicklung<br />
Mit einem Durchschnittswert von 1,8 fiel auch die Bewertung der Abwicklung der<br />
Lohnkostenzuschüsse positiv aus. Lediglich ein Arbeitgeber war damit „sehr unzufrieden“<br />
– übrigens die einzige Bewertung dieser Art in der gesamten Frage 7 – und<br />
2 Arbeitgeber hatten keine Erfahrungen damit gemacht, weil sie keine Lohnkostenzuschüsse<br />
erhielten. Mit 8 „sehr zufriedenen“ Nennungen und 5 „eher zufriedenen“<br />
27 Zur Ermittlung einer Durchschnittsnote wurden den Antwortmöglichkeiten Werte zugeordnet (sehr zufrieden = 1, eher zufrieden<br />
= 2, eher unzufrieden = 3, sehr unzufrieden = 4)<br />
71
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Urteilen wird zum Ausdruck gebracht, dass an dem praktizierten Verfahren wohl<br />
wenig zu verbessern ist.<br />
Auch in den Interviews mit den Arbeitgebern wurde durch Berichte über die Lösung<br />
von Problemen die gute Bewertung der Zusammenarbeit mit der KAF wiederholt<br />
und auch die problemlose und zuverlässige finanzielle Abwicklung wurde durchweg<br />
lobend hervorgehoben. Allein ein Arbeitgeber, der sehr weitgehende Wünsche bezüglich<br />
der Förderung hatte, denen seitens der KAF nicht entsprochen wurde, vermittelte<br />
im Interview seine negative Bewertung der Zusammenarbeit.<br />
Die Antworten auf Frage 8ff bestätigen das positive Gesamturteil über Lohnkostenzuschüsse<br />
in Frage 7, denn hier wurde durch direkte Abfrage derjenigen Arbeitgeber,<br />
die Lohnkostenzuschüsse erhalten, zusätzlich Informationen über dieses arbeitsmarktpolitische<br />
Förderinstrument eingeholt.<br />
Frage 8: Werden Lohnkostenzuschüsse (LKZ) gezahlt?<br />
ja<br />
nein (wenn nein, weiter mit Frage 12)<br />
19 Befragte haben Lohnkostenzuschüsse erhalten. Diese bilden die Grundgesamtheit<br />
für die folgenden Fragen 9 bis 11.<br />
Frage 9: Wenn LKZ: Wie beurteilen Sie den Verwaltungsaufwand?<br />
Der Verwaltungsaufwand ist<br />
niedrig angemessen zu hoch<br />
Frage 10: Wenn LKZ: Die Lohnkostenzuschüsse sind gemessen an der<br />
Arbeitsleistung und Arbeitsfähigkeit der Bewerber<br />
zu niedrig angemessen zu hoch<br />
Frage 11: Wenn LKZ: Die Dauer der Lohnkostenzuschüsse ist gemessen an<br />
der Arbeitsleistung und dem Einarbeitungsaufwand<br />
zu kurz<br />
angemessen<br />
Lediglich ein Arbeitgeber schätzte in Frage 9 den Verwaltungsaufwand als unzumutbar<br />
hoch ein. 7 hielten ihn für niedrig und 11 für der Sache angemessen.<br />
Wie zu erwarten war, gab kein Arbeitgeber in Frage 10 an, dass er den erhaltenen<br />
Lohnkostenzuschuss für (unangemessen) hoch hält. Da 15-mal die Höhe als korrekt<br />
empfunden wurde, dürfen die 4 Angaben, dass die Lohnsubvention zu gering sei,<br />
nicht überbewertet werden.<br />
72
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Ähnlich hohes Einverständnis mit der Ausgestaltung der Förderung lässt sich aus<br />
den Antworten auf Frage 11 ableiten, denn13-mal wurde die Dauer als den Umständen<br />
entsprechend bezeichnet. 5 Arbeitgeber hielten es für besser, wenn die<br />
Dauer der Förderung verlängert würde.<br />
8.2.4 Fragen zu Person und Qualifikation der Beschäftigten und der Besetzung des<br />
Arbeitsplatzes<br />
Letztendlich entscheidend für die Zufriedenheit eines Arbeitgebers mit Arbeitsverhältnissen,<br />
die durch ein Förderprogramm unterstützt bzw. eingeleitet wurden, ist<br />
die eng mit der Person der Beschäftigten zusammenhängende realisierte Umsetzung<br />
im Arbeitsalltag.<br />
Häufig resultiert – gerade im Niedriglohnbereich - Unzufriedenheit von Arbeitgebern<br />
daraus, dass Erwartungen an den Arbeitnehmer und dessen Leistungsfähigkeit bzw.<br />
-bereitschaft und das tatsächliche Engagement differieren. Der dritte Komplex des<br />
Fragebogens war deshalb der Einschätzung der Beschäftigten und der Erfüllung der<br />
Erwartungen des Arbeitgebers gewidmet.<br />
Wie groß der Aufwand zur Stellenbesetzung war, ist u.a. an der Zahl der Bewerber<br />
abzulesen, die sich vorgestellt haben, bis eine geeignete Person gefunden war.<br />
Frage 12: Wie viele Bewerberinnen oder Bewerber haben sich bei Ihnen vorgestellt,<br />
bis der Arbeitsplatz besetzt war?<br />
Anzahl: ............<br />
Insgesamt haben sich 68 Personen bei den Arbeitgebern für die zu besetzenden<br />
Arbeitsplätze gemeldet. Im Durchschnitt somit 3,2 je Arbeitgeber bzw. rd. 3 je zu<br />
besetzender Stelle. In 9 Fällen wurde der Arbeitsplatz mit dem ersten Bewerber besetzt,<br />
was für die Vorauswahl der KAF spricht (vgl. Frage 7). Als Maximum meldeten<br />
3 Arbeitgeber, dass 10 Bewerber vorstellig waren, ehe eine geeignete Person gefunden<br />
war.<br />
In den Interviews wurde deutlich, dass es für die Arbeitgeber einen hohen Wert darstellt,<br />
wenn sich der (Zeit-)Aufwand bei einer Stellenbesetzung (Bewerbergespräche<br />
usw.) klein halten lässt. Die Personalvorschläge der KAF wurden meist als sehr<br />
passgenau gelobt, was sicherlich wesentlich damit zusammenhängt, dass die Mitarbeiter/innen<br />
der KAF sich die Arbeitsplätze, die besetzt werden sollten, vor Ort angesehen<br />
haben. Als (negativer) Kontrast dazu wurde die Vorgehensweise der Arbeitsverwaltung<br />
von mehreren Interviewpartnern benannt, weil hier meist sehr viele<br />
Bewerber vorgeschlagen wurden, die oft gar nicht dem gewünschten Berufsbild entsprachen.<br />
73
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Möglich Gründe für die Schwierigkeit, eine Stelle nach den Vorstellungen des Arbeitgebers<br />
angemessen zu besetzen, wurden in Frage 13 ermittelt.<br />
Frage 13: Kenntnisse und Eigenschaften der vorgeschlagenen Bewerberinnen<br />
und Bewerber<br />
Für die zu besetzende Stelle war/waren die...<br />
unter den<br />
Anforderungen<br />
angemessen<br />
über den<br />
Anforderungen<br />
... fachlichen Qualifikationen, berufl. Kenntnisse<br />
... Motivation<br />
... persönliche Eignung/Erscheinung<br />
... geforderte Flexibilität<br />
In den Antworten zu allen vier Unterpunkten von Frage 13 kommt zum Ausdruck,<br />
dass etwa ein Drittel der Bewerber die gestellten Anforderungen nicht voll erfüllt hat,<br />
die Mehrzahl diese jedoch erfüllte.<br />
Im Einzelnen ergaben sich folgende Einschätzungen:<br />
Die erwarteten bzw. geforderten fachlichen bzw. beruflichen Kenntnisse lagen bei 7<br />
von 20 Arbeitgebern (35%) unter dem Limit. In 13 Fällen (65%) deckten sich Anforderung<br />
und Profil des Bewerbers. Von Überqualifikationen wurde nicht berichtet.<br />
Etwas besser war es nach dem Eindruck der Arbeitgeber um die Motivation der Bewerber<br />
bestellt. Sie lag zwar in 5 von 20 Fällen (25%) unter dem Erwünschten, aber<br />
auch in 4 Fällen (20%) darüber. (In den Interviews mit Arbeitgebern wurde bestätigt,<br />
dass es sich dabei mehrfach um einen nicht zu realisierenden Wunsch nach Vollzeitbeschäftigung<br />
handelte.)<br />
Fast identisch waren die Antworten bezüglich der persönlichen Eignung/Erscheinung<br />
und der Flexibilität der Bewerber. In 4 bzw. 5 Fällen lagen sie unter den<br />
Anforderungen, in 14 bzw. 15 Fällen waren sie angemessen und in jeweils einem<br />
Fall wurden sie bezogen auf den zu besetzenden Arbeitsplatz als über den Anforderungen<br />
liegend bezeichnet. Wenn man analog zur Vorgehensweise bei Frage 7 eine<br />
„Durchschnittnote“ 28 ermittelt, so ergibt sich bei der fachlichen Qualifikation mit 2,35<br />
Notenpunkten die schlechteste Bewertung. Auch bei Flexibilität (2,2), Eignung/Erscheinung<br />
(2,15) ergeben sich leichte Übergewichte zum Negativen. Lediglich<br />
bezüglich der Motivation (2,05) wird den vermittelten Arbeitskräften von den Ar-<br />
28 Zur Ermittlung einer Durchschnittsnote wurden den Antwortmöglichkeiten Werte zugeordnet (über den Anforderungen =<br />
1, angemessen = 2, unter den Anforderungen = 3).<br />
74
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
beitgebern im Durchschnitt uneingeschränkt eine angemessene Haltung bescheinigt.<br />
Frage 14 ermittelte, ob Zusatzqualifizierungen notwendig waren und welche Bereiche<br />
sie betrafen.<br />
Frage 14: War eine Zusatzqualifizierung der vermittelten Personen notwendig?<br />
nein<br />
ja, und zwar im Bereich der<br />
fachlichen Qualifikationen<br />
persönlichen Eigenschaften<br />
Die Hälfte (genau 11 von 21) der Arbeitgeber hielt Zusatzqualifizierungen der Vermittelten<br />
(also der eingestellten Personen und nicht der Bewerber, die Gegenstand<br />
von Frage 13 waren) nicht für notwendig. Bei nötigen Zusatzqualifizierungen stand<br />
eine Aufbesserung der Fachkenntnisse (9 Fälle) deutlich im Vordergrund gegenüber<br />
der Verbesserung persönlicher Eigenschaften (3 Fälle). 2 Arbeitgeber haben Zusatzqualifikationen<br />
in beiden Bereichen benannt.<br />
Frage 15 zielte darauf ab einen Vergleich darüber zu bekommen, ob bzw. inwieweit<br />
die im Rahmen von KaMoKo eingestellten Arbeitnehmer erhöhten Einarbeitsaufwand<br />
erzeugen oder nicht.<br />
Frage 15: Wie war der Einarbeitungsaufwand der vermittelten Personen<br />
gegenüber anderen Neubesetzungen?<br />
niedriger gleich hoch höher<br />
Folgerichtig zu den Antworten auf Frage 13 und 14 kommt auch in Frage 15 zum<br />
Ausdruck, dass in 8 von 21 Fällen ein erhöhter Einarbeitungsaufwand von KaMoKo-<br />
Beschäftigten gegenüber anderweitigen Stellenbesetzungen nötig war. Meistens jedoch<br />
(12 Mal) war er vergleichbar und in einem Fall war er sogar geringer.<br />
In der letzten Frage im Fragebogen sollte herausgearbeitet werden inwiefern der<br />
Modellversuch in der Lage ist neue, zusätzliche Arbeitsplätze zu generieren.<br />
Frage 16: Wird durch die Anreize des Modellversuchs ein neuer (zusätzlicher)<br />
Arbeitsplatz geschaffen? (Erweiterung des Arbeitsplatzangebots?)<br />
Ja, dauerhaft ja, befristet (maximal 1 Jahr) keine Angaben<br />
75
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Fünf Arbeitgeber meldeten, dass sie im Rahmen des Modellprojektes einen dauerhaften<br />
und ein Arbeitgeber einen befristeten zusätzlichen Arbeitsplatz geschaffen<br />
haben. 15 Nennungen hatte die Antwortmöglichkeit „keine Angaben“ angekreuzt.<br />
8.3 Zweite Befragung der Arbeitgeber mit geförderten Beschäftigten<br />
Die zweite Arbeitgeberbefragung wurde im März 2004 durchgeführt. Der Rücklauf<br />
der Fragebogen verlief ähnlich wie bei der ersten Arbeitgeberbefragung schleppend<br />
und blieb insgesamt mit einem Rücklauf von 19 auswertbaren Fragebogen, die sich<br />
allerdings auf 37 Vermittlungs- und Beschäftigungsfälle bezogen, hinter den Erwartungen<br />
zurück. Die Rücklaufquote betrug damit 38%. Um auch Nachzügler noch berücksichtigen<br />
zu können, wurden alle Fragebogen, die bis zum Ende April 2004 bei<br />
der FEH eingingen, in die Auswertung einbezogen. Eine gezielte Nachfassaktion zur<br />
Erhöhung des Rücklaufs war wegen der Anonymität der Befragung nicht möglich.<br />
Im Gegensatz zur Teilnehmerbefragung waren keine Codes auf den Fragebogen<br />
angebracht, die eine Rücklaufkontrolle ermöglicht hätten 29 .<br />
Während bei der ersten Befragung im Vordergrund des Interesses stand, wie die<br />
Arbeitgeber über das Kasseler Modell informiert worden waren und wie die ersten<br />
Erfahrungen mit der Kommunalen Arbeitsvermittlung und den vermittelten Beschäftigten<br />
waren, waren die Schwerpunkte bei der zweiten Befragung die Nachhaltigkeit<br />
der Förderung sowie die Beurteilung der Zusammenarbeit mit der kommunalen Arbeitsvermittlung.<br />
Weiterhin wurden auf Grund dieser Erfahrungen Vorschläge zur<br />
(weiteren) Verbesserung der Arbeitsförderung erbeten.<br />
Da die Beurteilung zur Zusammenarbeit mit der KAF bereits Gegenstand der ersten<br />
Befragung war, sollte bezüglich dieses Themas eine während der Zusammenarbeit<br />
innerhalb des Modellprojektes möglicherweise eingetretene Urteilsänderung erfasst<br />
werden. Diese Erwartung an die Befragung kann jedoch wegen des unerwartet geringen<br />
Rücklaufs und der nicht möglichen Zuordnung, welche Arbeitgeber sich an<br />
beiden Befragungen beteiligt haben, nicht erfüllt werden.<br />
8.3.1 Stellenbesetzung und deren Nachhaltigkeit<br />
Frage 1 zielte darauf ab, die Bedeutung bzw. Ursächlichkeit der Förderung im Modellversuch<br />
für die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich für Sozialhilfeempfänger<br />
zu ermitteln.<br />
29 Vgl. dazu die methodischen Anmerkungen zur ersten Arbeitgeberbefragung.<br />
76
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Frage 1: Wäre ohne die Förderung im Modellversuch „Kasseler Modell Kombilohn“<br />
(KaMoKo), der durch die Kommunale Arbeitsförderung (KAF) umgesetzt<br />
wurde, der Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen auch mit einer anderen Person<br />
besetzt worden?<br />
nein<br />
ja<br />
12 Arbeitgeber gaben an, dass der Arbeitsplatz auch ohne Förderung von einer anderen<br />
Person besetzt worden wäre. Für 7 Arbeitgeber war dagegen die Förderung<br />
ursächlich für die Einrichtung bzw. Besetzung der Arbeitsplätze. Damit entspricht die<br />
Beantwortung dieser Frage fast genau dem Ergebnis, das sich bereits in der ersten<br />
Befragung (Frage 6) ergab und das auch bei den Interviews bei den Arbeitgebern<br />
bestätigt wurde. Damit erhärtet sich die Vermutung, dass ein so konstruiertes Anreizsystem<br />
zur Einstellung von Sozialhilfeempfängern Mitnahmeeffekte begünstigt<br />
oder zumindest nicht verhindern kann 30 . Dagegen ist die andere – knappe – Hälfe<br />
der begründeten Beschäftigtenverhältnisse zu stellen, die ohne Förderung offenbar<br />
nicht zustande gekommen wären. Da die Arbeitsmarktsituation in Kassel, wie in Kapitel<br />
2 dargestellt, von hoher Arbeitslosigkeit bzw. zu geringem Arbeitsplatzangebot<br />
gekennzeichnet ist, unterliegt es einem Abwägungsprozess, ob die Mitnahmeeffekte<br />
unter diesen Bedingungen in Kauf zu nehmen sind oder nicht. Um einen möglichst<br />
sparsamen Umgang mit öffentlichen Fördermitteln zu gewährleisten, könnten differenzierte<br />
Fördersätze im Rahmen der Antragsbearbeitung und Mittelbewilligung verstärkt<br />
angewendet werden. In der Praxis dürfte es allerdings sehr schwierig sein, für<br />
jeden Einzelfall die Förderung so zu bestimmen, dass diese ursächlich für das Anbieten<br />
eines Arbeitsplatzes ist und deshalb nicht von Mitnahmeeffekten gesprochen<br />
werden kann.<br />
Ein weiterer Indikator dafür, ob die Konditionen im Modellversuch dafür geeignet<br />
waren, zusätzliche und dauerhafte Arbeitsplätze schaffen zu helfen, ist die Beibehaltung<br />
des Arbeitsplatzes nach Auslaufen der Förderung. Dem wurde mit Frage 2<br />
nachgegangen.<br />
Frage 2: Ist die Stelle nach dem Ende der Förderung weiterhin besetzt?<br />
nein<br />
ja<br />
Nur in 3 Fällen wurde der geschaffene Arbeitsplatz nicht wieder neu besetzt. Bei 16<br />
Arbeitgebern blieb der Arbeitsplatz weiterhin erhalten.<br />
30 Mitnahmeeffekte stellen bei vielen Subventionen und so auch bei Arbeitsmarksubventionen eine Tatsache dar, die aber<br />
oft nur sehr schwer nachweisbar und quantifizierbar ist. Der evaluationsmethodische Aufwand zur Identifikation von Mitnahmeeffekten<br />
ist sehr hoch. Deshalb sind in der Literatur keine verlässlichen Angaben über Größenordnungen zu finden.<br />
Vgl. dazu u.a. auch Hujer; Caliando (2003), S. 109-123 und Walwei (1996).<br />
77
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Um die Verknüpfung mit dem Modellprojekt herzustellen, wurde in Frage 3 erfragt<br />
durch wen der Arbeitsplatz besetzt wurde.<br />
Frage 3: Wenn ja,<br />
durch Übernahme des von der Kommunalen Arbeitsförderung vorgeschlagenen Arbeitnehmers<br />
zu vergleichbaren Bedingungen für den Arbeitnehmer (Bezahlung, Arbeitszeit)<br />
zu anderen Bedingungen<br />
durch eine andere Person<br />
Erfreulicherweise wurde bei über drei Vierteln der dauerhaften Stellenbesetzung<br />
der/die geförderte Arbeitnehmer/in übernommen. Hierdurch wird der „Klebeeffekt“<br />
von befristeten Arbeitsverhältnissen (oder wie er auch bei Praktika in anderen Arbeitsmarkförderprogrammen<br />
schon festgestellt wurde) eindrucksvoll bestätigt. In 4<br />
Fällen wurde einem anderen Arbeitnehmer bei der Stellenbesetzung der Vorzug gegeben.<br />
Aufgrund der in den Interviews gemachten Äußerungen von einigen (wenigen)<br />
Arbeitgebern, dass eine Anschlussbeschäftigung auch gefördert werden solle,<br />
ist nicht auszuschließen, dass möglicherweise Fördermöglichkeiten, die z.B. von der<br />
Arbeitsverwaltung angeboten werden, dazu genutzt wurden, wieder einen subventionierten<br />
Beschäftigten einzustellen. Falls dies der Fall gewesen sein sollte, was aus<br />
der Befragung nicht zwingend abgeleitet werden kann, wäre zu überlegen, wie diesem<br />
unerwünschten - wenn auch sicherlich legalen Verhalten - begegnet werden<br />
kann.<br />
Bei den 13 übernommenen Arbeitskräften wurden überwiegend (8 Fälle) die Konditionen<br />
aus der Förderphase übernommen. Für den Arbeitgeber, der Lohnkostenzuschüsse<br />
erhalten hatte, bedeutet dies eine Verteuerung der Arbeitskraft, die jedoch,<br />
so ist zu unterstellen, durch die Einarbeitungszeit auch leistungsfähiger geworden<br />
ist als zu Beginn der Förderung. Insofern ist der Grund für die Förderung – nämlich<br />
Ausgleich einer verminderten Leistungsfähigkeit – entfallen. Falls das Modell so<br />
ausgestaltet war, dass der Arbeitnehmer eine Aufstockung seines Verdienstes<br />
durch Kombilohn erhalten hat, oder wenn Anrechnungen der Einkommen auf sonstige<br />
Transferleistungen erfolgen, stellte sich die Einkommenssituation der Arbeitnehmer<br />
nach Übernahme schlechter dar als während der Teilnahme am Modellversuch.<br />
Dieser Fall ist – so ergaben die Interviews mit den Teilnehmer/innen – mehrfach<br />
vorgekommen. Für die Beschäftigten stellte dies eine unbefriedigende Situation<br />
dar, die die eindeutig vorhandene Zufriedenheit, wieder ein festes Arbeitsverhältnis<br />
zu haben, überschattete.<br />
78
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Die Beschäftigungsverhältnisse mit 2 Personen wurden zu geänderten Konditionen<br />
fortgesetzt. Welcher Art die Veränderungen waren, ist nicht bekannt. Bei 3 Übernahmefällen<br />
wurden von Arbeitgebern überhaupt keine näheren Angaben gemacht.<br />
Die Basis, auf der die Einschätzungen der Arbeitgeber beruhen, wurde in Frage 4<br />
ermittelt.<br />
Frage 4: Wie viele von der KAF vermittelte (und evtl. geförderte) Arbeitnehmer<br />
haben Sie in der Vergangenheit insgesamt beschäftigt?<br />
....................Anzahl (bitte zählen Sie auch bereits beendete Beschäftigtenverhältnisse dazu)<br />
Insgesamt hatten die Befragten 57 (also durchschnittlich 3) Beschäftigte gehabt, die<br />
durch die KAF vermittelt worden waren. Allerdings verteilen sich diese sehr ungleichmäßig,<br />
denn zwei Arbeitgeber hatten jeweils über 10 Beschäftigte gehabt, einige<br />
2 bis 4 und die Mehrheit hatte Erfahrungen mit einem/r Beschäftigten.<br />
Frage 5: Wie beurteilen Sie die Kenntnisse und Eigenschaften der vorgeschlagenen<br />
Bewerberinnen und Bewerber?<br />
Für die zu besetzende Stelle war/waren die... unter den Anforderungen angemessen<br />
über den<br />
Anforderungen<br />
... fachlichen Qualifikationen, berufl. Kenntnisse<br />
... Motivation<br />
... persönliche Eignung/Erscheinung<br />
... geforderte Flexibilität<br />
Bei der Auswertung der Antworten auf Frage 5 wurde nicht mit der Zahl der Beschäftigten<br />
gewichtet. Das heißt jeder Arbeitgeber gab eine Gesamtbewertung ab,<br />
die in den Fällen mit mehreren Beschäftigten die durchschnittliche Erfahrung wiedergibt.<br />
Ermittelt man für die einzelnen Merkmale Durchschnittsnoten 31 so werden die fachlichen<br />
Qualifikationen der geförderten Teilnehmer/innen insgesamt mit einem Durchschnitt<br />
von 2,3 am schlechtesten beurteilt. Zwar sagen 13 Arbeitgeber, dass sie die<br />
Kenntnisse als angemessen empfanden, aber immerhin hatten 6 Arbeitgeber Erwartungen<br />
gehabt, die in dieser Hinsicht nicht erfüllt wurden. Etwas besser wurde die<br />
persönliche Erscheinung/Eignung mit Note 2,2 bewertet. Wie bei allen anderen<br />
Merkmalen auch, wurde die Eignung mehrheitlich (13 Fälle) als angemessen be-<br />
31 Zur Ermittlung einer Durchschnittsnote wurden den Antwortmöglichkeiten Werte zugeordnet (über den Anforderungen =<br />
1, angemessen = 2, unter den Anforderungen = 3)<br />
79
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
zeichnet. In 5 Fällen wurden die Anforderungen nicht erfüllt, in einem Fall allerdings<br />
übertroffen.<br />
Bezüglich der Motivation (Note 2,05) und bei der Flexibilität (Note 1,95) ergaben<br />
sich ausgewogene Eindrücke, die – wie bei den anderen Merkmalen auch – durch<br />
überwiegende Zufriedenheit (12 Fälle) und 4 bzw. 3 unter den Anforderungen und 3<br />
bzw. 4 über den erwarteten Anforderungen liegenden Bewertungen zustande kamen.<br />
Da in der ersten Arbeitgeberbefragung diese Frage identisch gestellt worden war,<br />
kann ein direkter Vergleich der Einschätzungen gezogen werden: Es zeigt sich,<br />
dass die Urteile zu beiden Zeitpunkten fast identisch ausgefallen sind. Eine erfreuliche<br />
Besserbewertung hat es bezüglich der Flexibilität der Beschäftigten gegeben<br />
(jetzt Note 1,95 statt 2,2). Diese Durchschnittsverbesserung rührt daher, dass die<br />
Bewertung „über den Anforderungen“ statt einem Mal jetzt vier Mal vergeben wurde.<br />
Dies legt die Vermutung nahe, dass die Beschäftigten mit ihrer Aufgabe gewachsen<br />
sind und dies entsprechend spürbar unter Beweis gestellt haben.<br />
Eine Einordnung der für den besetzten Arbeitsplatz mitgebrachten Kenntnisse der<br />
geförderten Beschäftigten in die Erfahrungen, die die Arbeitgeber im Allgemeinen<br />
bei Stellenbesetzungen gemacht haben, erfolgte mit Frage 6.<br />
Frage 6: War der Einarbeitungsaufwand der vermittelten Personen gegenüber<br />
anderen Neubesetzungen...<br />
niedriger gleich hoch höher<br />
Die Antworten spiegeln das Urteil aus Frage 5 wider, denn 9 Arbeitgeber (47%)<br />
schätzten den Einarbeitungsaufwand gleich hoch ein, 7 höher (37%), aber auch 3<br />
niedriger (16%) als es ihren Erfahrungen mit nicht geförderten Arbeitnehmern entsprach.<br />
Gegenüber der ersten Arbeitgeberbefragung stellt dies insgesamt gesehen eine<br />
Bestätigung dar, denn zum damaligen Zeitpunkt wurde der Aufwand auch etwa von<br />
der Hälfte (57%) für gleich hoch bezeichnet, für 38% war er höher und für 5% niedriger.<br />
Zusammengefasst zeigt die Beantwortung der Fragen 5 und 6, dass die Beschäftigung<br />
von (ehemaligen) Sozialhilfeempfängern bei den Arbeitgebern die Erwartungen<br />
an die Qualifikationen und die persönlichen Eigenschaften im Allgemeinen<br />
durchaus die Erwartungen erfüllte und dass gegenüber den anderen Personalbesetzungen<br />
auf Basis anderer Akquisitionswege nur leicht erhöhte Aufwendungen für<br />
die Einarbeitung anfielen. Eine wesentliche Ursache dafür dürfte auch daran liegen,<br />
dass bei der Vorauswahl der Personen durch die KAF das Anforderungsprofil der<br />
80
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Arbeitsplätze und die Fähigkeiten der Bewerber gut abgeglichen worden sind und<br />
deshalb passgenaue Vermittlungen erfolgten.<br />
Welchen Einfluss das Modellprojekt auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze hat, wurde<br />
mit Frage 7 erfragt:<br />
Frage 7: Wurde durch die Förderung ein neuer (zusätzlicher) Arbeitsplatz geschaffen?<br />
(Erweiterung des Arbeitsplatzangebots?)<br />
Ja, dauerhaft ja, befristet (maximal 1 Jahr) nein<br />
Die Antwort auf diese Frage entspricht in den einzelnen Ausprägungen zwar nicht<br />
ganz genau den aus Frage 1 und 2 resultierenden Aussagen, aber sie bestätigt die<br />
Einschätzung, dass das Programm, was seine Nachhaltigkeit anbelangt, nicht die<br />
Erwartungen erfüllt. So haben lediglich 5 Arbeitgeber durch die Konditionen des<br />
Modells angeregt einen zusätzlichen dauerhaften Arbeitsplatz geschaffen. In 4 Fällen<br />
bestand der neue Arbeitsplatz nur während der Zeit der einjährigen Förderung<br />
und 10 Arbeitgeber, also knapp über die Hälfte der Befragten, gaben an, dass kein<br />
neuer Arbeitsplatz geschaffen wurde. Dies entspricht etwa der Aussage aus Frage<br />
1, dass in 12 Fällen ein (offensichtlich bereits vorhandener) Arbeitsplatz auch mit einer<br />
anderen Person besetzt worden wäre, wenn es keinen Modellversuch gegeben<br />
hätte.<br />
Nimmt man diese Informationen zusammen, so zeigt sich, dass das Modellprojekt<br />
nur bei einer Minderheit der geförderten Arbeitsverhältnisse in der Lage war, dauerhafte<br />
neue Arbeitsplätze zu initiieren. Da außerdem ein Teil der Arbeitsplätze auch<br />
ohne Förderung besetzt worden wäre bedeutet dies, dass die Förderung der Mehrzahl<br />
der im Modellprojekt mit Sozialhilfeempfängern besetzten Arbeitsplätze für die<br />
Arbeitgeber einen Mitnahmeeffekt 32 darstellt.<br />
32 Ein Programm kann nur dann als erfolgreich bezeichnet werden, wenn der Effekt eindeutig dem Programm zugeordnet<br />
werden kann (Kausalität) und wenn die Wirkungen nur aufgrund des Programms und nicht ohne dies eingetreten wären<br />
(Mitnahmeeffekt). Eine ebenfalls unerwünschte - aber nur sehr schwer nachweisbare – Wirkung wären Substitutionseffekte,<br />
die darin bestünden, wenn vorhandene Beschäftigte durch geförderte neue Beschäftigte ersetzt würden.<br />
81
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
8.3.2 Zusammenarbeit mit der Kommunalen Arbeitsförderung<br />
Die letzten drei Fragen der Arbeitgeberbefragung waren der Tätigkeit der Kommunalen<br />
Arbeitsförderung gewidmet.<br />
Frage 8: Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der Kommunalen Arbeitsförderung<br />
(KAF) im Rückblick?<br />
Unser Unternehmen/ Haushalt ist...<br />
...mit der/dem...<br />
...sehr<br />
zufrieden<br />
...eher<br />
zufrieden<br />
....eher<br />
unzufrieden<br />
...sehr<br />
unzufrieden<br />
Fragestellung trifft nicht zu<br />
... Auswahl der Bewerber/innen<br />
... Kommunikation mit der KAF<br />
... Hilfe bei Problemen<br />
... Abwicklung der Förderung bei<br />
Lohnkostenzuschuss<br />
... Kontakt/Beratung über die Förderphase<br />
hinaus<br />
Insgesamt gesehen waren die Arbeitgeber bei allen fünf Bewertungsgebieten, die<br />
die KAF betreffen zufrieden, denn der Anteil der (sehr oder eher) Zufriedenen lag<br />
zwischen 76 und 93%. Im Einzelnen ergab die Auswertung folgendes 33 :<br />
Die Auswahl der Bewerber/innen wurde relativ am schlechtesten beurteilt; 4 Arbeitgeber<br />
waren eher unzufrieden, 9 eher zufrieden und lediglich 4 waren sehr zufrieden.<br />
Sehr unzufrieden war keiner der Arbeitgeber. Daraus ergibt sich eine<br />
Durchschnittsbewertung von 2,0, die exakt auch der Bewertung aus der ersten Befragung<br />
entspricht. Inwieweit die Bewertung der KAF bezüglich der Personalvorschläge<br />
überlagert wird durch Beurteilung der Fähigkeiten der eingestellten Arbeitnehmer,<br />
ist nicht feststellbar. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass Defizite bei den<br />
Beschäftigten der Auswahl der Sozialhilfeempfänger angelastet wird, obwohl es sich<br />
streng genommen um unterschiedliche Dinge handelt.<br />
33 Zur Ermittlung einer Durchschnittsnote wurden den Antwortmöglichkeiten analog zur Auswertung der entsprechenden<br />
Frage 7 in der ersten Arbeitgeberbefragung Werte zugeordnet (sehr zufrieden = 1, eher zufrieden = 2, eher unzufrieden =<br />
3, sehr unzufrieden = 4)<br />
82
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Ebenfalls im Durchschnitt mit 2,0 wurden „Kontakt/Beratung über die Förderphase<br />
hinaus“ bewertet. Der Durchschnitt ermittelt sich aus zusammen 10 zufriedenen<br />
und 3 unzufriedenen Antworten. 6 Arbeitgeber haben keine Beurteilung abgegeben,<br />
weil sich für sie das Problem mit Abschluss der Förderung gar nicht mehr stellte.<br />
Noch höher war mit 10 Arbeitgebern (also über der Hälfte derjenigen, die sich an<br />
der Befragung beteiligten) die Zahl derjenigen, die bei der Frage nach der Hilfe bei<br />
Problemen kein Urteil abgegeben haben, weil keine Probleme im Zusammenhang<br />
mit dem geförderten Arbeitsverhältnis zu lösen waren. Dies stellt an sich schon ein<br />
positives Ergebnis dar. Dass darüber hinaus auftretende Probleme in 7 von 8 Fällen<br />
zur Zufriedenheit zusammen mit der KAF behandelt wurden, verstärkt diesen Eindruck,<br />
der sich auch in der Durchschnittsbewertung von 1,75 nieder schlägt. Bei der<br />
ersten Befragung gab es eine etwas höhere Anzahl von Problemen, die auch damals<br />
weit überwiegend zur Zufriedenheit gelöst wurden (13 von 14 Fällen positiv,<br />
Durchschnittsnote 1,65)<br />
Auch die Kommunikation mit der KAF wurde von 14 der 15 Arbeitgeber, die sich<br />
darüber eine Meinung gebildet hatten, positiv beurteilt (Note 1,67). Dieses Ergebnis<br />
ist sogar noch etwas besser als im Jahr 2003 (Note 1,80). Es dürfte sich darin sicherlich<br />
der Kontakt während des Ablaufs des Projektes positiv niedergeschlagen<br />
haben.<br />
Die beste Bewertung wurde für die „Abwicklung der Förderung bei Lohnkostenzuschuss“<br />
vergeben. 10 „sehr zufrieden und 5 „eher zufrieden“ bei lediglich 2 „eher<br />
unzufrieden“ ergaben die Note 1,5. Aus den persönlichen Gesprächen mit Arbeitgebern<br />
ist bekannt, dass an der (termingerechten) Auszahlung keine Kritik bestand.<br />
Lediglich das Antragsverfahren wurde in Einzelfällen als zu kompliziert bezeichnet.<br />
Dies sollte jedoch angesichts der dargestellten Gesamtbewertung nicht überbewertet<br />
werden. Da sich die Einschätzung gegenüber der ersten Befragung auch verbesserte<br />
(damals Note 1,80), ist die Ursache für derartige Anmerkungen sicherlich<br />
auch in (überwundenen) Anlaufschwierigkeiten zu sehen.<br />
Um indirekt ein abschließendes Gesamturteil über den Modellversuch zu erhalten,<br />
das versucht alle Aspekte zu bündeln, wurde dies in eine Frage über die weitere Bereitschaft<br />
zur Zusammenarbeit mit der Kommunalen Arbeitsförderung gekleidet.<br />
Frage 9: Werden Sie weiterhin mit der KAF zusammenarbeiten?<br />
ja<br />
nein<br />
wenn nein, warum nicht?......................................................................................................<br />
Die insgesamt vorhandene Zufriedenheit der Arbeitgeber mit dem Modellprojekt<br />
kommt dadurch zum Ausdruck, dass16 von 19 Befragten weiterhin mit der KAF ko-<br />
83
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
operieren wollen (werden). In zwei weiteren Fällen ist die Bereitschaft theoretisch<br />
vorhanden, es wird jedoch keine (aktuelle) Realisierungschance gesehen, weil die<br />
Befragten in absehbarer Zeit keine Arbeitskräfte benötigen. Nur ein Arbeitgeber<br />
lehnt jede weitere Zusammenarbeit ab, weil „eine negative Erfahrung reicht“. Aus<br />
dem Kontext der Beantwortung der anderen Fragen des Fragebogens geht hervor,<br />
dass sich die negative Einstellung nicht auf die Erfahrungen mit der Person des/der<br />
geförderten Beschäftigten beruht, sondern die Art und Weise der finanziellen Abwicklung<br />
und deren Höhe sowie die Beratung durch die KAF Missfallen erregt hat.<br />
Für mögliche weitere Förderprogramme ist es von Interesse, welche Ansatzpunkte<br />
seitens der Arbeitgeber gesehen werden, wodurch eine (weitere) Verbesserung der<br />
Programme erreicht werden kann.<br />
Frage 10: Wodurch könnte die Zusammenarbeit verbessert oder die Wirksamkeit<br />
der Arbeitsmarktprogramme erhöht werden?<br />
Von den 19 Befragten haben 12 Anregungen und Verbesserungsvorschläge formuliert.<br />
Am häufigsten wurde dabei der Bereich der finanziellen Ausgestaltung bzw. Auswirkung<br />
des Programms angesprochen. Zum einen bezogen sich die Ideen auf die<br />
Förderung für den Arbeitgeber, zum anderen wurde jedoch auch die „Förderfalle“ für<br />
den Arbeitnehmer thematisiert, die darin besteht, dass nach der Förderung (hohe)<br />
Anrechnungen der Arbeitseinkommen auf Transferleistungen erfolgen, so dass die<br />
Einkommenssituation der Arbeitnehmer schlechter sein kann als zum Zeitpunkt des<br />
Sozialhilfebezugs. Dies stellt ein zwar bekanntes, aber dennoch sehr relevantes<br />
Problem dar, das nur durch entsprechende (bundes-)gesetzliche Regelungen entschärft<br />
werden kann. Bezüglich des Lohnkostenzuschusses für die Arbeitgeber<br />
wurden eine Erhöhung der Fördersätze und eine Ausdehnung der Förderdauer auf<br />
zwei Jahre gewünscht. Diese Wünsche mögen zwar subjektiv nachvollziehbar sein,<br />
aber im Zusammenhang mit der festgestellten Anfälligkeit des Programms für Mitnahmeeffekte<br />
können derartige Bestrebungen nicht unterstützt werden.<br />
Der Wunsch nach schnellerer Bewilligung und Auszahlung der Lohnkostenzuschüsse<br />
beruht offensichtlich auf der spezifischen (negativen) Erfahrung eines Arbeitgebers.<br />
Allgemein richtig und notwendig ist sicherlich, dass bei der Programmumsetzung<br />
eine zügige Bearbeitung der Anträge und eine zeitnahe Auszahlung der<br />
daraus resultierenden Ansprüche zu fordern und zu gewährleisten ist.<br />
84
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Drei Arbeitgeber machen darauf aufmerksam, dass eine passgenaue – und in ihren<br />
Augen noch weiter verbesserungsfähige - Bewerberauswahl sehr förderlich für das<br />
Arbeitsmarktprogramm ist. 34<br />
Auch sehr wichtig erscheint den Arbeitgebern der regelmäßige telefonische oder<br />
persönliche Kontakt mit der KAF und die Bedienung mit Informationen aus dem<br />
Bereich der Arbeitsförderung (drei Nennungen). Auch hiermit wird ein Punkt in der<br />
Befragung angesprochen, der sowohl bei den Interviews bei den Arbeitgebern, die<br />
einen geförderten Beschäftigten hatten als auch bei den Unternehmen, die noch<br />
keine Kenntnis von der KAF und dem Modellversuch hatten, eine Rolle spielte. Einmalige<br />
und relativ anonyme Aktionen werden oft übersehen und/oder prägen sich<br />
nicht ein. Wiederholungen und konkrete Ansprache (einer dann aus Gründen der<br />
Machbar- und Finanzierbarkeit kleineren Zielgruppe) scheinen wesentlich besser bei<br />
der Zielgruppe anzukommen und lassen daher auch bessere Erfolge erwarten.<br />
Schließlich wurden noch Anregungen gegeben, die nicht direkt Kassel und die dortigen<br />
Akteure betreffen, die der Vollständigkeit halber jedoch nicht unerwähnt bleiben<br />
sollen. Zum einen war es die Bemerkung, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen<br />
und damit der Erfolg von Eingliederungsprogrammen wesentlich auch von der –<br />
derzeit verbesserungsbedürftigen – wirtschaftlichen Situation abhänge. Zum anderen<br />
wurde eine Änderung der Sozial- und Arbeitsgesetzgebung gefordert, ohne dies<br />
jedoch näher zu spezifizieren.<br />
34 Aus den Expertengesprächen wurde deutlich, dass die KAF hier gerade auch bei Bewerbern im Niedriglohnbereich gegenüber<br />
der Arbeitsverwaltung einen deutlichen Vorsprung habe, denn nicht nur die Passgenauigkeit sondern auch die<br />
(geringe) Anzahl der Bewerber, unter denen der „richtige“ Arbeitnehmer gefunden wurde, fiel den Arbeitgebern positiv<br />
auf.<br />
85
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
9 Befragung der Arbeitgeber ohne KaMoKo-Beschäftigten<br />
Der Frage, wie die Möglichkeit der Förderung von neu begründeten Beschäftigungsverhältnissen<br />
durch den Kasseler Modellversuch bei potenziellen Arbeitgebern<br />
wahrgenommen wurde bzw. weshalb sie keine Kenntnis davon erlangt haben,<br />
wurde durch eine groß angelegte Unternehmensbefragung nachgegangen.<br />
9.1 Methodenbeschreibung<br />
Die Grundgesamtheit der zu befragenden Betriebe bestand aus den Mitgliedern der<br />
Industrie- und Handelskammer Kassel sowie der Handwerkskammer Kassel, die in<br />
den Postleitzahlenbereichen 341.. und 342.. eine Betriebstätte haben und somit als<br />
Arbeitgeber für die Zielgruppe des Modellversuchs in Frage kommen. Insgesamt<br />
umfasst diese Adressdatei 18.577 Anschriften.<br />
Es sollte eine völlig freiwillige und anonyme Befragung mit Zufallsauswahl durchgeführt<br />
werden, um keine datenschutzrechtlichen Probleme aufzuwerfen. Das bedeutete<br />
aber, dass keine Rücklaufkontrolle möglich war und bei möglicherweise nicht<br />
zufriedenstellendem Rücklauf eine Nachfassaktion von vornherein ausgeschlossen<br />
war. Angestrebt und erwartet wurde, dass 200 auswertbare Fragebogen aus der Befragungsaktion<br />
vorliegen sollten, um belastungsfähige Aussagen zu erhalten.<br />
Auf Basis der Erfahrungen mit derartigen Befragungsaktionen war davon auszugehen,<br />
dass - ohne Nachfassaktion und bei der rechtlichen Situation in der sich die<br />
angeschriebenen Firmen befanden 35 - ein Rücklauf von auswertbaren Fragenbogen<br />
von etwa 10% erreicht werden kann. Das bedeutete, dass über 2000 Betriebe in die<br />
Auswahl einzubeziehen waren.<br />
Die Auswahlquote der zu befragenden Betriebe wurde unter diesen Annahmen auf<br />
12% der Grundgesamtheit (=2229 Befragte) festgelegt.<br />
Mit Hilfe eines Zufallszahlengenerators wurde jeder der 18.577 Adressen eine Zufallszahl<br />
zugeordnet. Die Adressdaten wurden sodann nach der Größe dieser Zahlen<br />
sortiert und die 2229 Adressen mit der niedrigsten Zufallszahl in die Befragung<br />
einbezogen. Der Versand der Fragebogen erfolgte Mitte Juni 2003.<br />
Den Fragebogen war ein Anschreiben 36 beigefügt, in dem die Rahmenbedingungen<br />
und das Ziel der Umfrage erläutert wurden. Für die Rücksendung war ein adressierter<br />
Freiumschlag beigelegt.<br />
35 Die Adressaten wurden im Anschreiben auf die Freiwilligkeit und auf die gültigen und im Rahmen der Befragung angewendeten<br />
datenschutzrechtlichen Regelungen hingewiesen.<br />
36 Vgl. Faksimileabdruck im Anhang.<br />
86
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Der Fragebogen mit insgesamt 13 Fragen, die auf einem doppelseitigen DIN A 4-<br />
Blatt gut leserlich untergebracht waren, war in zwei Hauptteile gegliedert. Zum einen<br />
handelte es sich dabei um einen kleinen Komplex, der sich mit grundsätzlichen Angaben<br />
zum befragten Betrieb befasste und einem größeren Teil, in dem Kenntnisse<br />
und Urteile über die regionale Arbeitsförderung und den Arbeitskräftebedarf erhoben<br />
wurden.<br />
Um einen möglichst hohen Rücklauf zu erzielen, waren die Themen so ausgewählt<br />
und die Fragen so formuliert, dass sie von den Befragten ad hoc beantwortet werden<br />
konnten und das Ansprechen möglicherweise als sensibel empfundener Bereiche<br />
(z.B. Umsatz) unterblieb.<br />
In die Auswertung einbezogen wurden Fragebogen, die bis Ende August 2003 bei<br />
der FEH in Wiesbaden eingingen. Es waren dies 227 Fragebogen, was einer Rücklaufquote<br />
von 10,2% entspricht<br />
Nach der schriftlichen Befragung wurden aus denjenigen Befragungsteilnehmern,<br />
die im Fragebogen ihre Adresse angegeben hatten, per Zufallstichprobe zehn ausgewählt,<br />
mit denen vertiefende Interviews geführt wurden. In den Gesprächen wurde<br />
auf die Gesamtergebnisse der Befragung Bezug genommen und versucht qualitative<br />
Erklärungen bzw. Zusatzinformationen zu den einzelnen Fragen herauszuarbeiten.<br />
Außerdem wurde hinterfragt, inwieweit die von den Arbeitgebern gewünschte<br />
Kontaktaufnahme mit der KAF ablief und welche Ergebnisse diese Kontakte bereits<br />
hatten.<br />
Die Erkenntnisse aus den Interviews sind in die Erläuterungen der Ergebnisdarstellung<br />
der Befragung eingeflossen. Kritik und Anregungen wurden mit der KAF besprochen<br />
und sind teilweise bereits im laufenden Umsetzungsprozess umgesetzt<br />
worden.<br />
9.2 Auswertung der Befragung<br />
9.2.1 Fragen zu Ihrem Betrieb<br />
Ein wesentliches Merkmal zur Einschätzung eines Betriebes ist die Betriebsgröße<br />
gemessen an der Beschäftigtenzahl.<br />
Frage 1. Betriebsgröße gemessen an der Zahl der Beschäftigten<br />
1 – 5 Beschäftigte 51 – 100 Beschäftigte<br />
6 – 20 Beschäftigte 100 – 250 Beschäftigte<br />
21 – 50 Beschäftigte über 250 Beschäftigte<br />
87
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Alle zurückgekommenen Fragebogen waren bezüglich der Betriebsgröße auswertbar.<br />
146 (das sind 64,3%) der an der Befragung beteiligten Betriebe waren Kleinstbetriebe<br />
mit bis zu 5 Beschäftigten (incl. des/der Inhabers/in). In der Gesamtheit der<br />
angeschriebenen Betriebe hatte diese Größenklasse einen Anteil von über 85%,<br />
d.h. das Antwortverhalten dieser kleinen Betriebe war unterdurchschnittlich.<br />
Abbildung 21: Verteilung der befragten Betriebe auf Betriebsgrößenklassen<br />
Anteile in Prozent<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1-5 Besch. 6-20 Besch. 21-50 Besch. 51-100 Besch. 100-250 Besch. >250 Besch.<br />
Quelle: Auswertung der Betriebsbefragung, eigene Darstellung.<br />
Leicht verzerrend könnte sich jedoch die gerade bei sehr kleinen Betrieben überdurchschnittliche<br />
Fluktuation in der Existenz der Betriebe dahingehend ausgewirkt<br />
haben, dass einige schon nicht mehr existierende Betriebe angeschrieben wurden,<br />
die dann nicht an der Befragung teilnehmen konnten. 55 (24,3%) der Betriebe gehörten<br />
zur Größenklasse 6-20 Beschäftigte. Sie haben sich überdurchschnittlich an<br />
der Befragung beteiligt, denn ihr Anteil bei den angeschriebenen Betrieben lag bei<br />
8%. Fasst man die beiden kleinsten Größenklassen zusammen, so weicht ihr Anteil<br />
bei den auswertbaren Fragenbogen nur um wenige Anteilspunkte von der Größenverteilung<br />
bei den angeschriebenen Firmen ab. Das Antwortverhalten bei den übrigen<br />
Betriebsgrößenklassen war jeweils überdurchschnittlich gut, fällt aber bei insgesamt<br />
26 Fragebogen (das sind 11,5%) absolut nicht so sehr ins Gewicht.<br />
Um evtl. vorhandene besondere Bedürfnisse von Zeitarbeitsfirmen (als wichtige Arbeitgeber<br />
im Niedriglohnbereich) zu erfassen, wurde dies in Frage 2 erfragt.<br />
88
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Frage 2. Handelt es sich bei Ihrem Betrieb um eine Zeitarbeitsfirma?<br />
nein ja Wenn ja, geben Sie bei Frage 3 die Geschäftsfelder Ihrer Kunden an.<br />
Als Zeitarbeitsfirma waren 4 der beteiligten Firmen mit dem Verleih von Arbeitskräften<br />
aktiv. Die Erwartung, dass Zeitarbeitsfirmen unterschiedliche Sichtweisen und<br />
Einschätzungen haben, konnte wegen der geringen Zahl, die sich an der Befragung<br />
beteiligten, nicht signifikant nachgewiesen werden. Eher ist im Gegenteil davon<br />
auszugehen, dass Zeitarbeitsfirmen keine spezielle Sicht der Dinge haben, da sich<br />
ihre Antworten kaum von denen der anderen Befragten unterscheiden.<br />
Wichtig im Zusammenhang mit den im zweiten Teil des Fragebogens erhobenen<br />
(potenziellen) Arbeitsplatzangeboten im Niedriglohnbereich war die Frage nach den<br />
Geschäftsfeldern der Firmen.<br />
Frage 3. In welchen Geschäftsfeldern sind Sie tätig? (Mehrfachnennungen<br />
möglich)<br />
Gartenbau/Landwirtschaft Handel/Verkauf Reinigungsdienste<br />
Produzierendes Gewerbe persönl. Dienstleistungen Gesundheit/Soziales<br />
Bauhauptgewerbe Hotel/Gastronomie Sicherheitsdienste<br />
Baunebengewerbe<br />
Übrige Dienstleistungen, Sonstiges, bitte nennen: .............................................................<br />
Da bei dieser Frage Mehrfachnennungen möglich waren und andererseits einige<br />
Befragte keine Angaben über den Inhalt ihres Gewerbes machten, beziehen sich die<br />
folgenden Anteile auf insgesamt 268 ausgewertete Nennungen.<br />
Wichtigstes Tätigkeitsgebiet der Betriebe war mit 91 Nennungen (34,0%) der Handel/Verkauf,<br />
gefolgt von 75 Angaben (28,0%) die sich auf Übrige Dienstleistungen<br />
beziehen. Hinter diesem Sammelbegriff verbergen sich (nach der Häufigkeit der<br />
Nennungen) diverse Finanzdienstleistungen, Reparaturhandwerk/Anlagenbau, Büro-/Hausmeisterservice,<br />
IT-Firmen, Werbung/Marktforschung/Unternehmensberater<br />
und Transportunternehmen.<br />
89
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Abbildung 22: Verteilung der Befragungsteilnehmer auf Branchen<br />
30<br />
Anteile in Prozent<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Gartenbau,Landwirtsch.<br />
Prod. Gewerbe<br />
Baugewerbe<br />
Handel<br />
Persönliche Dienstl.<br />
Hotel- u. Gaststättengew.<br />
Reinigungsgewerbe<br />
Gesundheitsd./Soziales<br />
Sicherheitsdienste<br />
Sonstige Dienstl.<br />
Quelle: Auswertung der Betriebsbefragung, eigene Darstellung.<br />
Mit deutlichem Abstand folgten mit jeweils 22 Nennungen (8,2%) Produzierendes<br />
Gewerbe, Baunebengewerbe und persönliche Dienstleistungen. 15 Betriebe (5,6%)<br />
waren in der Hotellerie/Gastronomie tätig und 9 (3,4%) im Bereich Gartenbau/Landwirtschaft.<br />
Bauhauptgewerbe, Reinigungsdienste und Sicherheitsdienste<br />
machten Anteile von etwa 1% aus.<br />
Im zweiten Fragenblock galt es zu ergründen, welchen Bekanntheitsgrad die Kommunale<br />
Arbeitsförderung und das Kasseler Modell Kombilohn bei den Firmen hat,<br />
die keine/n Beschäftigte/n haben, der/die durch KaMoKo gefördert wurde und welche<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten evtl. bei diesen Betrieben bestehen.<br />
9.2.2 Fragen zur Arbeitsförderung in Kassel<br />
Frage 4. Kennen Sie die Kommunale Arbeitsförderung (KAF) des Sozialamtes<br />
der Stadt Kassel ?<br />
ja nein (wenn nein, weiter mit Frage 6)<br />
Jeder Betrieb, der an der Befragung teilnahm, hat diese Frage beantwortet. Allerdings<br />
ist der Bekanntheitsgrad der KAF mit 32 (14,1%) positiven Antworten bei den<br />
Befragten gering. Damit ist ein wichtiges Problem identifiziert, das sich direkt auf die<br />
mögliche Vermittlung von Arbeitskräften auswirkt. Im Idealfall wäre es nämlich gut,<br />
wenn nicht nur die KAF die Betriebe bezüglich möglicher Vermittlungen ansprechen<br />
würde, sondern wenn die Betriebe bei entsprechendem Bedarf auf die KAF zukä-<br />
90
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
men. Dass seitens der Betriebe ein grundsätzliches Interesse an einer Zusammenarbeit<br />
besteht, wird anhand der Antworten auf Frage 13 deutlich.<br />
Abbildung 23: Bekanntheitsgrad der Kommunalen Arbeitsförderung bei den befragten<br />
Betrieben in Kassel<br />
100<br />
Anteile in Prozent<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
bekannt<br />
nicht bekannt<br />
Quelle: Auswertung der Betriebsbefragung, eigene Darstellung.<br />
Nur die Befragten, die die Frage 4 mit ja beantworteten, konnten die folgende Frage<br />
beantworten:<br />
Frage 5. Welche Dienstleistungen/Programme der Kommunalen Arbeitsförderung<br />
(KAF) kennen Sie? (Mehrfachnennungen möglich)<br />
Vermittlung von Arbeitskräften<br />
Beratung von Unternehmen bei der Besetzung von Arbeitsplätzen<br />
finanzielle Förderung von Arbeitsplätzen (Information der Arbeitgeber über Zuschüsse bei<br />
der Einstellung von Sozialhilfeempfängern)<br />
Projekte, wie Kasseler Modell Kombilohn, Arbeit statt Sozialhilfe, Ausbildung statt Sozialhilfe,<br />
Nordstadt-Projekt, GALAMA-Projekt<br />
Kurzqualifizierung von arbeitslosen Sozialhilfeempfängern, z.B. Praktikum<br />
Sonstiges, bitte nennen: .................................................................................<br />
Wegen der Möglichkeit von Mehrfachnennungen beziehen sich die folgenden Auswertungen<br />
auf 56 Aussagen der 32 Betriebe, die die KAF kennen.<br />
18 dieser Betriebe gaben an, dass sie die KAF wegen deren Aktivitäten im Bereich<br />
der Vermittlung von Arbeitskräften kennen. Bei der Gruppe von Betrieben, die die<br />
KAF überhaupt kennen, sind noch - mit 14 Nennungen - die diversen Projekte - wie<br />
91
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
KaMoKo, Nordstadt-Projekt usw., an denen die KAF beteiligt ist sowie die Möglichkeiten<br />
finanzieller Förderungen (11 Nennungen) von höherem Bekanntheitsgrad.<br />
Die anderen in dem Fragebogen genannten Aktionsfelder der KAF sind nur bei weniger<br />
als einem Viertel der 32 Betriebe im Bewusstsein. Keiner der Befragten nannte<br />
unter „Sonstiges“ weitere ihm bekannte Aktivitäten.<br />
Die Zuspitzung auf das Kasseler Modell Kombilohn erfolgte mit Frage 6:<br />
Frage 6. Kennen Sie das Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)?<br />
ja nein (wenn hier und bei Frage 4 Ihre Antwort nein ist, weiter mit Frage 8)<br />
Etwas im Widerspruch zur Antwort auf Frage 5, bei der KaMoKo bereits beinhaltet<br />
war, und bei der lediglich 14 Betriebe angaben die KAF u.a. durch KaMoKo zu kennen,<br />
wurde in Frage 6 von 15 Befragten das Kasseler Modell Kombilohn als bekannt<br />
angegeben. Ihre Erklärung könnte diese (für die Auswertung nicht besonders relevante)<br />
Differenz darin finden, dass es Firmen gibt, die KaMoKo zwar kennen, dies<br />
aber nicht mit der KAF in Verbindung bringen.<br />
Abbildung 24: Bekanntheitsgrad des „Kasseler Modell Kombilohn“ bei den befragten Betrieben<br />
in Kassel<br />
100<br />
Anteile in Prozent<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
bekannt<br />
nicht bekannt<br />
Quelle: Auswertung der Betriebsbefragung, eigene Darstellung.<br />
Dass 93,3% der Firmen KaMoKo nicht kennen und damit - auch die förderbare Möglichkeit<br />
einen Arbeitsplatz (im Niedriglohnbereich) zu besetzen - nicht aktiv nutzen<br />
können, ist für die Akquisition von Arbeitsplätzen durch die KAF ein erschwerender<br />
Tatbestand. Dass jedoch durchaus Interesse an dieser Möglichkeit besteht, wird an<br />
der Auswertung der Frage 13 deutlich (siehe unten).<br />
92
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Die Frage danach, wodurch diejenigen Firmen, denen die KAF bzw. KaMoKo ein<br />
Begriff sind, darüber Kenntnis erlangt haben, soll einen Ansatzpunkt geben, welche<br />
Aktivitäten dafür effizient sind.<br />
Frage 7. Woher bzw. wodurch kennen Sie die KAF bzw. KaMoKo?<br />
(Mehrfachnennungen möglich)<br />
Ich kenne………… ……..die KAF …….KaMoKo<br />
(bitte entsprechend ankreuzen)<br />
durch........<br />
ja nein ja nein<br />
...Berichte in der Tagespresse<br />
...Berichte in Verbandsorganen (z.B. IHK Nachrichten)<br />
...Flyer/Broschüren<br />
...Kontakte zu anderen Arbeitgebern (Mund-zu-Mund-<br />
Propaganda)<br />
...Steuerberater<br />
...direkte Ansprache durch die Kommunale Arbeitsförderung per<br />
Anschreiben<br />
Telefongespräch<br />
...Sonstiges, bitte nennen: ................................................................................................................................................................................<br />
Von den 32 Betrieben, die die Kommunale Arbeitsförderung kennen, haben nicht alle<br />
Angaben gemacht bzw. sich nicht mehr erinnert, wodurch ihnen die KAF bekannt<br />
wurde. Es konnten deshalb – trotz einiger Mehrfachnennungen - nur 30 Angaben<br />
ausgewertet werden. Am häufigsten wurde (mit 10 Angaben) die Tagespresse<br />
als Informationsquelle genannt.<br />
Kammerzeitschriften und Flyer werden fast nicht wahrgenommen (5 bzw. 4 Nennungen).<br />
Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen der Interviews mit den Betrieben,<br />
die einen geförderten Beschäftigten haben. Auch diese haben nur zu einem<br />
sehr geringen Teil diese Medien als Informationsquelle benannt. Direkte Aktivitäten<br />
der KAF haben 5 Betriebe im Gedächtnis (2 Anschreiben, 3 Anrufe). Wenn man den<br />
Aufwand für Mailing- und Telefonaktionen und damit die beschränkte Anzahl von<br />
Adressaten, die überhaupt erreicht werden können, bedenkt, kann diese Anzahl im<br />
93
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Vergleich zum Ergebnis breit gestreuter Massenaktionen als „Erfolg“ bewertet werden.<br />
Zur allgemeinen Bekanntheit der KAF trugen offensichtlich auch die anderen<br />
angebotenen Möglichkeiten wenig bei, denn auf sie entfielen nur zwischen 2 und 4<br />
positive Angaben.<br />
Etwas anders sieht die Situation bei der Quelle der Bekanntheit von KaMoKo aus.<br />
Zwar kennen nur 15 Betriebe von den 227 Antwortenden den Modellversuch (s. o. ),<br />
aber diese haben 30 Quellen (also im Durchschnitt 2 Impulse) benennen können.<br />
Die Hälfte dieser Betriebe (8 Nennungen) kannte den Modellversuch durch direkte<br />
Kontakte, die von der KAF durchgeführt wurden (6 Anschreiben, 2 Anrufe). Durch<br />
diese Aktionen wurde sogar die Tagespresse, die theoretisch jeden Betrieb erreicht,<br />
als Informationsquelle leicht überboten, denn 7 Betriebe haben angegeben, darüber<br />
Informationen bezogen zu haben. Die anderen Quellen liegen in ihrer Informationswirkung<br />
bezüglich KaMoKo auf vergleichbar (niedrigem) Niveau wie schon bei der<br />
Auswertung für die KAF angeführt.<br />
Auch bei der Auswertung von Frage 7 kommt die schon bei Frage 5 und 6 angesprochene<br />
unterschiedliche Wahrnehmungsweise des Programms KaMoKo und der<br />
Institution KAF zum Ausdruck: Die direkte Ansprache der Betriebe bezüglich des<br />
Fördermodells durch die KAF führt nicht in allen Fällen zu einer Wahrnehmung der<br />
KAF als Förder- bzw. Vermittlungsinstitution. Das heißt mögliche synergetische bzw.<br />
multiplikative Effekte, die durch die Kontaktaufnahme realisiert werden könnten,<br />
kommen dadurch nicht zum Tragen.<br />
Die Fördermöglichkeiten der Beschäftigung für Betriebe durch die Arbeitsverwaltung<br />
oder anderer überregionaler Stellen, die überdies schon seit längerer Zeit praktiziert<br />
werden, haben verständlicherweise einen um ein Vielfaches höheren Bekanntheitsgrad<br />
als die kommunalen Aktivitäten.<br />
Im Rahmen der geführten Interviews wurde auch erörtert, wie nach Meinung der Arbeitgeber<br />
der Bekanntheitsgrad von Fördermöglichkeiten verbessert werden kann.<br />
Diese Ergebnisse wurden mit der KAF kommuniziert und einige der Verbesserungsansätze<br />
sind bereits in die laufende Umsetzung des Programms eingeflossen.<br />
Um überhaupt die Kenntnis der Möglichkeiten betrieblicher Arbeitskräfteförderung<br />
bei den Arbeitgebern festzustellen, wurde die Frage 8 in den Fragebogen aufgenommen.<br />
94
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Frage 8. Kennen Sie folgende finanziellen Fördermöglichkeiten bei der Einstellung<br />
von Arbeitskräften? (Mehrfachnennungen möglich)<br />
Lohnkostenzuschüsse durch das Arbeitsamt<br />
Lohnkostenzuschüsse durch das Sozialamt<br />
Kombilohn<br />
Sonstige Zuschüsse durch das Arbeitsamt, das Land oder die Kommune<br />
keine der genannten Fördermöglichkeiten<br />
Sonstige, bitte nennen. ..........................................................................................................<br />
Den größten Bekanntheitsgrad bei den Betrieben haben die Lohnkostenzuschüsse<br />
durch das Arbeitsamt, von denen 59,0% der befragten 227 Betriebe Kenntnis hatten.<br />
Lohnkostenzuschüsse vom Sozialamt waren 15,9% der Betriebe ein Begriff.<br />
Sonstige Zuschüsse oder Fördermöglichkeiten von der Arbeitsverwaltung, vom<br />
Land oder der Kommune bei der Einstellung von Arbeitskräften kannten 17,2%.<br />
Über Kombilohnmodelle zeigten sich nur 5,3 % der Betriebe informiert 37 . Bemerkenswert<br />
ist, dass bei über einem Drittel (35,7%) der Befragten keine Kenntnisse<br />
/Informationen über eine der in der Frage 8 angesprochenen Fördermöglichkeiten<br />
bestanden. Das heißt, dass auch langjährig etablierte Institutionen wie die Arbeitsverwaltung<br />
Probleme damit haben, Fördermöglichkeiten bei der Zielgruppe nachhaltig<br />
bekannt zu machen.<br />
Allen dieser Förderungen ist gemein, dass sie – unabhängig vom Kasseler Modell<br />
Kombilohn - die Bereitschaft bei den Unternehmen, einen Arbeitsplatz zu besetzen<br />
bzw. zu schaffen, befördern sollen. Es muss anhand dieser unvollständigen Wahrnehmung<br />
bzw. Verarbeitung von Informationen bei den Arbeitgebern festgestellt<br />
werden, dass die Potenziale, die diese Anreizsysteme beinhalten, nicht ausgeschöpft<br />
sein können.<br />
Wie ein attraktives Förder- und Anreizsystem – z.B. durch die Kommunale Arbeitsförderung<br />
- ausgestaltet sein müsste, um positiv aufgenommen zu werden, wurde<br />
durch Frage 9 erfasst.<br />
37 Wegen der Möglichkeit von Mehrfachnennungen ist die Summe der Anteile größer als 100 Prozent.<br />
95
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Frage 9. Für wie wichtig erachten Sie folgende (mögliche) Aspekte bei der<br />
Einstellung von Hilfskräften, die von der KAF vermittelt werden?<br />
Unbürokratische Abwicklung<br />
Lohnkostenzuschüsse<br />
Feste Ansprechpartner bei der KAF<br />
Laufende Betreuung/Hilfe bei Problemen<br />
Marketingeffekte durch Kooperation mit der KAF<br />
Flexible Vertragsgestaltung (z. B. Befristung,<br />
Entlohnung, Teilzeit)<br />
wichtig weniger wichtig unwichtig<br />
Sonstiges, bitte nennen: ...........................................................................................................................................................<br />
Nicht jeder Betrieb, der sich an der Befragung beteiligte, hat eine Einschätzung der<br />
Bedeutung für alle in der Frage angebotenen Aspekte einer möglichen Zusammenarbeit<br />
mit der KAF abgegeben. Die Zahl der Antworten schwankt zwischen 170<br />
(Marketingeffekte) und 202 (Bürokratie). Unbürokratisches Vorgehen wurde nicht<br />
nur am häufigsten genannt, sondern auch mit 95% als besonders wichtig für die Zusammenarbeit<br />
bezeichnet. Kein anderer Aspekt wurde als so wichtig erachtet. Es<br />
folgen jedoch mit relativ geringem Abstand die Möglichkeit einer flexiblen Ausgestaltung<br />
der Verträge (89% der Nennungen für „wichtig“) und die Möglichkeit von finanzieller<br />
Förderung in Form von Lohnkostenzuschüssen (84% der Nennungen für<br />
„wichtig“). Feste Ansprechpartner und eine laufende Betreuung werden jeweils von<br />
etwa zwei Dritteln der Betriebe für wichtig erachtet. Erwartete oder mögliche Marketingeffekte<br />
durch eine Kooperation mit der KAF hält lediglich knapp ein Drittel der<br />
Betrieb für wichtig, über 40% ist dies weniger wichtig und gar ein Viertel hält dies für<br />
unwichtig. Wenn man die Antworten auf die Marketingeffekte interpretiert, könnte<br />
man auch sagen, dass die Antworten nicht nur die Wichtigkeit abbilden, sondern<br />
auch die erwartete Wahrscheinlichkeit, dass dadurch positive Effekte erzielt werden,<br />
in das Urteil eingeflossen ist.<br />
Um einen Anhaltspunkt über die generelle Beschäftigungsmöglichkeit von Hilfskräften<br />
in Betrieben im Arbeitsmarkt Kassel zu bekommen, wurde die Frage 10 in den<br />
Fragebogen aufgenommen.<br />
96
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
9.2.3 Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich<br />
Frage 10. Bietet Ihr Unternehmen dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeiten für<br />
Hilfskräfte? (keine Zeitarbeit oder Aushilfen zur Überbrückung kurzfristiger Engpässe)<br />
Ja Nein (wenn nein, weiter mit Frage 13)<br />
Wenn ja, wie besetzen Sie diese Arbeitsplätze? (Mehrfachnennungen sind möglich)<br />
Stellenanzeigen<br />
Arbeitsamt<br />
private Personalagenturen<br />
Kommunale Arbeitsförderung, Sozialamt<br />
Zusammenarbeit mit Personaldienstleistern (Zeitarbeitsfirmen)<br />
durch Übernahme/Einstellung von Leiharbeitnehmer/innen,<br />
die bereits im Betrieb sind<br />
persönliche Kontakte/Empfehlungen<br />
Sonstiges, bitte nennen: .................................................................... ................<br />
Gut ein Drittel der befragten Betriebe (37,9%) beschäftigt danach dauerhaft Hilfskräfte,<br />
62,1% gaben an, dass es in ihrem Betrieb keine dauerhaften Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
für Hilfskräfte gibt. Gemessen an der absoluten Anzahl ist dabei<br />
der Handel die wichtigste Sparte mit Beschäftigungsmöglichkeiten für Hilfskräfte.<br />
Gemessen an der relativen Bedeutung der Einsatzmöglichkeiten für Hilfskräfte treten<br />
in der Befragung kleinere Sparten wie Gartenbau/Landwirtschaft, Bereiche des<br />
Produzierenden Gewerbes, das Baunebengewerbe und die Gastronomie in den<br />
Vordergrund. Für gezielte Informationskampagnen versprechen deshalb diese Sparten<br />
die besten Erfolge bei der Suche nach geeigneten Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
für die Zielgruppe des Modellversuchs.<br />
Zur Besetzung von derartigen Stellen werden von den Betrieben am häufigsten persönliche<br />
Kontakte (Bekannte, Kollegen oder Verbindungen über bereits im Betrieb<br />
beschäftigte Arbeitnehmer) genutzt. 60% der Betriebe haben Erfahrung mit diesem<br />
Weg der Personalakquisition. 38<br />
Selbst geschaltete Stellenanzeigen (mit einem Erfahrungsanteil von 30,2%) und die<br />
Einschaltung des Arbeitsamtes (26,7%) sind die beiden nächst wichtigen Akquisitionswege.<br />
Alle anderen Möglichkeiten liegen unter 10% wobei die Einschaltung von<br />
Personaldienstleistern (Zeitarbeitsfirmen) mit 9,3% noch mit Abstand den höchsten<br />
Anteil aufweist.<br />
38 Da viele Betriebe Erfahrungen mit mehreren Möglichkeiten der Stellenbesetzung haben, waren Mehrfachnennungen<br />
möglich; die Summe der Anteile ist deshalb größer als hundert Prozent.<br />
97
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Abbildung 25: Methoden der Stellenbesetzung durch die Betriebe<br />
Printmedien<br />
Arbeitsagentur<br />
private Personalagenturen<br />
Kommunale Arbeitsförderung<br />
Zeitarbeitsfirmen<br />
Übernahme von Leiharbeitnehmern<br />
private Kontakte/Empfehlungen<br />
Sonstiges<br />
Anteile in Prozent<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Quelle: Auswertung der Betriebsbefragung, eigene Darstellung.<br />
Die Frage 11 zielte darauf ab, den konkreten Bedarf an Hilfskräften quantifizieren zu<br />
können. Angesichts der angespannten konjunkturellen Situation zum Zeitpunkt der<br />
Befragung war dies jedoch schwierig, denn der „normalerweise“ vorhandene Bedarf<br />
wäre dadurch deutlich unterschätzt worden. Aus diesem Grund wurde die für den<br />
Fragehintergrund anscheinend unlogische Antwortmöglichkeit „ja, aber momentan<br />
kein Bedarf“ aufgenommen.<br />
Frage 11. Sind Sie in Ihrem Betrieb an der Einstellung von Hilfskräften<br />
interessiert?<br />
nein, grundsätzlich nicht weiter mit Frage 13<br />
ja, aber momentan kein Bedarf<br />
ja, aber mit befristetem Arbeitsvertrag<br />
ja, unbefristet<br />
Die Vermutung, dass der aktuelle Bedarf nicht dem grundsätzlichen Bedarf entspricht,<br />
bestätigte sich in den Antworten, denn 61% der Betriebe, die Arbeitsplätze<br />
für Hilfskräfte anbieten, gaben an, im Prinzip wohl Bedarf zu haben, diesen aber<br />
momentan nicht realisieren zu wollen bzw. zu können. 29% haben aktuellen Bedarf<br />
an Hilfskräften, sind jedoch (zunächst?) nur an befristeten Einstellungen interessiert.<br />
Nur in 10% der Fälle besteht die Bereitschaft Hilfskräfte unbefristet einzustellen.<br />
98
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Abbildung 26: Beschäftigungsmöglichkeiten von Hilfskräften bei den befragten Betrieben<br />
ja, unbefristet<br />
ja, befristet<br />
ja, aber aktuell kein Bedarf<br />
Anteile in %<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Quelle: Auswertung der Betriebsbefragung, eigene Darstellung.<br />
Differenziert nach Sparten entsprachen sich zum Zeitpunkt der Befragung grundsätzliche<br />
Beschäftigungsmöglichkeit und aktuell bestehender Bedarf in den Bereichen<br />
Gartenbau/Landwirtschaft und beim Baunebengewerbe am ehesten. In beiden<br />
Fällen waren rd. 50% des latenten Bedarfs auch aktuell vorhanden. Bei Handel,<br />
persönlichen Dienstleistungen, Gastronomie und im produzierenden Bereich lag<br />
diese Quote jeweils etwa bei einem Viertel bis einem Drittel.<br />
Eine grobe Konkretisierung des Bedarfs auf Berufstypen bzw. Sparten wurde in<br />
Frage 12 ermittelt.<br />
Frage 12. Für welche Art von Tätigkeiten hätten Sie Bedarf?<br />
einfache produzierende Tätigkeiten<br />
einfache produktionsnahe Hilfstätigkeiten (z.B. Fahrer, Lagerarbeiter)<br />
einfache verwaltende bzw. Büro-Tätigkeiten<br />
einfache Dienstleistungen (z.B. in den Bereichen Hotel/Gaststätte, Reinigung,<br />
Verkauf)<br />
einfache soziale Dienste (Hauswirtschaftshelfer, Pflegekräfte, Erziehungshilfen)<br />
Sonstige, bitte nennen: ............................................................................................<br />
Da einige Betriebe offenbar für mehrere Hilfskräfte mit unterschiedlichen Einsatzgebieten<br />
Bedarf haben, waren in Frage 12 genau 100 Antworten auswertbar. Der<br />
Schwerpunkt des Bedarfs liegt mit 29 Nennungen bei den einfachen Dienstleistungen<br />
(z.B. in den Bereichen Hotel/Gaststätte, Reinigung, Verkauf). Zusammen mit<br />
99
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
den 21 Nennungen für einfache produktionsnahe Hilfstätigkeiten stellen diese beiden<br />
Gruppen genau die Hälfte der potenziellen Beschäftigungsmöglichkeiten. Einfache<br />
verwaltende und einfache produzierende Tätigkeiten folgen mit 19 bzw. 12<br />
Nennungen. Im Bereich der sozialen Dienste gibt es offensichtlich nur wenig<br />
Einsatzmöglichkeiten für Hilfskräfte (2 Angaben). Hinter Sonstiges, das 17-mal genannt<br />
wurde, verbergen sich Tätigkeiten in den Bereichen Gartenbau/Landwirtschaft,<br />
Frisör/Kosmetik, aber auch der Wunsch nach Fachpersonal mit abgeschlossener<br />
Berufsausbildung. Es kann vermutet werden, dass in einigen Betrieben<br />
über das Vehikel des Niedriglohnbereichs bzw. der finanziell geförderten Beschäftigung<br />
versucht wird, durchaus anspruchsvoll qualifizierte Arbeitnehmer „günstig zu<br />
bekommen“. Bei der Vermittlung muss darauf geachtet werden, dass derartige unerwünschten<br />
Effekte nicht realisiert werden.<br />
Als Nebenziel wurde die Betriebsbefragung auch dazu genutzt, für die Betriebe, die<br />
bislang mit dem Modell nicht vertraut waren, eine Kontaktmöglichkeit zur KAF herzustellen.<br />
Dies wurde durch Frage 13 ermöglicht:<br />
Frage 13. Wollen Sie Kontakt zur Kommunalen Arbeitsförderung, dann benennen<br />
Sie bitte eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner<br />
Firma.................................................................................<br />
Frau/Herr...........................................................................<br />
Telefon/Fax:.............................................…E-Mail: ................................................<br />
Obwohl die Befragung anonym angelegt war, stieß Frage 13 auf eine unerwartet<br />
hohe Resonanz: 88 Teilnehmer (das sind 38,8% des Rücklaufs) gaben Name und<br />
Adresse und/oder Telefon/Fax-Anschluss bzw. E-Mail-Adresse an. Dass diese<br />
grundsätzliche Aufgeschlossenheit nicht eng mit einem vorhandenen aktuellen Bedarf<br />
an Hilfskräften zusammen hängt, wird daran deutlich, dass von diesen Betrieben<br />
lediglich rd. ein Viertel aktuell an einer Vermittlung einer Hilfskraft interessiert<br />
war. Nur drei Betrieben, die ihre Adresse angegeben haben, waren die kommunale<br />
Arbeitsvermittlung und der Modellversuch bekannt, so dass diese offensichtlich<br />
durch die Befragungsaktion davon erfahren und erkannt haben, dass - evtl. unter<br />
mittelfristigen Aspekten – eine Verbindung zur KAF nützlich sein könnte.<br />
Zwischenzeitlich wurden die gewünschten (Erst-)Kontakte geknüpft und es haben<br />
sich Einstellungen dadurch ergeben.<br />
100
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
10 Einbeziehung der KAF in den Evaluierungsprozess<br />
Die Kommunale Arbeitsförderung der Stadt Kassel wurde vom Auftraggeber (Hessisches<br />
Sozialministerium) und der Auftragnehmerin vor Projektbeginn über die vorgesehene<br />
Evaluierung in Kenntnis gesetzt und über Einzelheiten der geplanten Vorgehensweise<br />
und des zeitlichen Ablaufs informiert.<br />
Nach Beginn des Projektes wurde in einem ganztägigen Workshop Art und Inhalt<br />
der Zusammenarbeit zwischen den Evaluatoren und der KAF diskutiert und festgelegt.<br />
Einen zentralen Punkt stellten dabei die geplanten Teilnehmer- und Arbeitgeberbefragungen<br />
dar, weil ein Teil des Adressenmaterials von der KAF zugeliefert<br />
werden bzw. aus Gründen des Datenschutzes im alleinigen Zugriff der KAF bleiben<br />
musste. Wichtig war beiden Seiten, dass es sich um eine offene und permanente<br />
Zusammenarbeit handeln solle, weil nur so ein Einspeisen der Evaluierungserkenntnisse<br />
in den laufenden Umsetzungsprozess möglich war.<br />
Die KAF war sehr kooperativ in der Zusammenarbeit und hat zur Verbesserung des<br />
Rücklaufs bei der Befragung der Arbeitgeber, die eine geförderte Person beschäftigten,<br />
den Versand der Fragebogen (mit einem Anschreiben der Dezernentin) übernommen.<br />
Ebenso wurden die beiden Teilnehmer/innenbefragungen von der KAF<br />
vor Ort logistisch unterstützt.<br />
Während des Evaluierungsprozesses haben zwei weitere intensive gemeinsame<br />
Termine von Vertretern der KAF und dem Evaluatorenteam in Kassel stattgefunden,<br />
um (Zwischen-)Ergebnisse aus dem Evaluierungsprozess zu transportieren und zu<br />
diskutieren sowie mögliche Korrekturen bei der Umsetzung zu besprechen bzw. anzuregen.<br />
• So hatte zum Beispiel die Befragung der Arbeitgeber ohne geförderte<br />
Beschäftigte u.a. zum Ergebnis, dass die Fördermöglichkeit im Rahmen von<br />
KaMoKo in der Region weitgehend unbekannt geblieben ist. Die KAF hat ihre<br />
Öffentlichkeitsarbeit daraufhin verändert, was zu einer neuen Zusammenarbeit<br />
mit der HNA in Form einer Artikelserie geführt hat.<br />
Über diese Gesprächstermine in Kassel hinaus, hat es eine Vielzahl telefonischer<br />
und schriftlicher (E-Mail) Kontakte gegeben, in denen z.B. Fragebogeninhalte abgestimmt<br />
wurden oder über Befragungstermine und Zwischenergebnisse der Befragungsauswertung<br />
informiert wurde.<br />
101
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
11 Zusammenfassung und Empfehlungen<br />
Die Ergebnisse des Kasseler Modells Kombilohn, das mit seiner Namensgebung insofern<br />
in die Irre führt, als Kombilohn nur ein Element in einem ganzen Bündel von<br />
anderen unterstützenden und fördernden Instrumenten darstellt (Lohnkostenzuschüsse,<br />
Beratung, Qualifizierung, Coaching), stehen durchaus im Einklang mit Begleitforschungen<br />
und Einschätzungen, die zu den verschiedenen Varianten der Förderung<br />
von Beschäftigung im Niedriglohnbereich in den letzten Jahren veröffentlicht<br />
wurden 39 .<br />
Von besonderer Bedeutung erscheinen die folgenden Ergebnisse. Da es sich um<br />
einen Modellversuch handelt, sind auch Anmerkungen und Anregungen aufgenommen,<br />
die allgemeingültig sind, die jedoch nicht unbedingt in besonderem Maße bei<br />
der Umsetzung in Kassel auffällig oder zu kritisieren waren.<br />
• Im Modellversuch wurden 109 Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger in<br />
Teil- oder Vollzeitarbeitsverhältnisse des allgemeinen Arbeitsmarktes<br />
vermittelt. Darüber hinaus erfolgten – ohne den Einsatz von Fördermitteln –<br />
weitere 9 Vermittlungen in Mini-Jobs.<br />
• Schwierigkeiten bei der Implementation des Programms (schlechte<br />
Wahrnehmung z.B. von durch die IHK vermittelten Informationen durch die<br />
Arbeitgeber) sind nicht zu übersehen. Nachdem durch die begleitende Evaluierung<br />
diese Wahrnehmungsschwierigkeiten offenkundig geworden waren, hat die<br />
Kommunale Arbeitsförderung ihre Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit<br />
der regionalen Presse neu ausgerichtet und dadurch eine erheblich verbesserte<br />
Breitenwirkung erzielt. Bei vergleichbaren Projekten ist es deshalb notwendig,<br />
frühzeitig zu überprüfen, inwieweit durch eingesetzte Mittel der Öffentlichkeitsarbeit<br />
die Zielgruppe auch tatsächlich erreicht wird.<br />
• Nur eine permanente Ansprache bzw. die mehrmalige Präsentation von Informationen<br />
haben Erinnerungswert und damit dauerhaften Effekt. Es müssen<br />
noch weitere Möglichkeiten genutzt werden, um die Zielgruppe – mehrfach, evtl.<br />
durch verschiedene Medien – zu erreichen (Veranstaltungen für besondere Zielgruppen,<br />
Unternehmerstammtisch, Nutzung von branchenspezifischen (Print-)<br />
Medien, regelmäßige Besuche oder telefonische Kontakte usw.). Dies sind<br />
jedoch Maßnahmen, die, wegen ihrer vergleichsweise hohen Kosten und um<br />
Streuverluste zu vermeiden, bei genau identifizierten und definierten Zielgruppen<br />
eingesetzt werden müssen.<br />
39 Vgl. u. a. dazu die Quellen im Literaturverzeichnis.<br />
102
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
• Die Erwartung, neue und dauerhafte Arbeitsstellen im Niedriglohnsektor,<br />
besonders bei Privatpersonen zu schaffen, hat sich nicht erfüllt. Trotz intensiver<br />
Akquisebemühungen (Kontaktaufnahme mit Privatpersonen, die auf Basis einer<br />
geringfügigen Beschäftigung Haushaltshilfen suchen; Presseerklärung) sind im<br />
Privatsektor nur sehr wenige Beschäftigungsverhältnisse entstandenen (2 Vermittlungen).<br />
• Die Arbeitgeber haben im Modellprojekt teilweise Mitnahmeeffekte realisiert.<br />
Dies ist jedoch nur schwer auszuschließen. Die KAF hat sich bemüht durch eine<br />
genaue einzelfallbezogene Steuerung und durch individuelle Anpassung des<br />
Fördersatzes diesen Effekten entgegen zu wirken. Für ähnliche Förderprogramme<br />
kann deshalb die Anregung abgeleitet werden, dass bei der<br />
Bewilligung von Lohnkostenzuschüssen eine einzelfallbezogene Anpassung der<br />
Förderung angezeigt ist. Diese Anpassung könnte z.B. sowohl in einer<br />
Nichtausschöpfung des Maximalsatzes des Lohnkostenzuschusses oder in einer<br />
degressiven Ausgestaltung des Fördersatzes im Laufe des Förderzeitraums<br />
bestehen. Eine weitere Maßnahme zur Vermeidung von Mitnahmeeffekten wäre<br />
es, die Vermittlung eines weiteren, geförderten Arbeitnehmers bei demselben<br />
Arbeitgeber zu unterlassen, wenn der vorherige Arbeitnehmer (mit der gleichen<br />
Tätigkeit) nicht in dauerhafte Beschäftigung übernommen wurde. Dies ist<br />
allerdings insbesondere dann schwer zu kontrollieren, wenn zwischen<br />
unterschiedlichen fördernden Institutionen (z.B. Arbeitsverwaltung und KAF)<br />
gewechselt wird.<br />
• Nicht auszuschließen sind Substitutionseffekte, d.h. das Ersetzen eines<br />
„regulären“ Beschäftigten durch einen geförderten Beschäftigten. Dieser<br />
unerwünschte Austausch ist allerdings bei bzw. vor der Vermittlung durch die<br />
vermittelnde Stelle schwer festzustellen. Handelt es sich bei dem zu besetzenden<br />
Arbeitsplatz um die Wiederbesetzung eines vorhandenen Arbeitsplatzes und<br />
nicht um eine neu geschaffene, zusätzliche Tätigkeit, könnte dies ein Indiz für<br />
eine Substitution sein. Bei der Akquisition von Stellen sollte versucht werden,<br />
beim Arbeitgeber entsprechende Informationen zu erhalten.<br />
• Eine stigmatisierte Personengruppe – wie es Sozialhilfeempfänger sind –<br />
verbessert ihre Chancen auf Einstellung, wenn Anreize für den Arbeitgeber<br />
geboten werden. Die Ergebnisse und die Zufriedenheit der Arbeitgeber zeigen,<br />
dass die zunächst vorhandenen Vorbehalte zumeist abgebaut werden konnten.<br />
Aus Sicht der einzelnen Arbeitnehmer stellt das Programm insofern ein<br />
wirksames Instrument dar, beweisen zu können, dass ihre Fähigkeiten<br />
unterschätzt werden.<br />
103
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
• Eine schlechte Arbeitsmarktlage – wie sie während der Modellphase allgemein<br />
und in besonderem Maße in Kassel vorlag -, erschwert die Stellenakquisition und<br />
begünstigt, dass die Arbeitnehmer unterhalb ihrer eigentlichen Qualifikation im<br />
Niedriglohnbereich eingesetzt werden (z.B. Köchin als Küchenhilfe).<br />
• Neben der Vermittlung von Vollzeitbeschäftigung im Rahmen des Modellprojektes<br />
wurde in Kassel auch die Vermittlung in Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse<br />
praktiziert. Dies kommt sowohl der angespannten Arbeitsmarktlage<br />
entgegen, entspricht aber auch den Wünschen von vielen Sozialhilfeempfängerinnen<br />
(z.B. alleinerziehende Mütter) oder von Personen der aus<br />
anderen familiären oder individuell psychosozialen Gründen nur einer<br />
Teilzeitbeschäftigung nachgehen können. Dieser Personenkreis kann so<br />
schrittweise in den Arbeitsmarkt integriert werden.<br />
• Der „Klebeeffekt“ von praktischer Tätigkeit bestätigt sich im Kassler Modell<br />
Kombilohn. Allerdings konnte diese positive Wirkung auch schon in anderen<br />
Programmen bezüglich der dort vermittelten Betriebspraktika, die eine Dauer von<br />
1-3 Monaten hatten, festgestellt werden. Im Vergleich dazu stellt die Förderung<br />
durch das Programm KaMoKo allerdings dann eine einjährige billige Probearbeit<br />
dar. Angesichts der besonders schwierigen Arbeitsmarktlage in Kassel ist es<br />
jedoch nicht auszuschließen, dass die einjährige Förderphase als Anreiz<br />
gerechtfertigt ist. Gute Erfahrungen wurden in Kassel mit einem<br />
beschäftigungsbegleitenden Coaching des/der Teilnehmers/in durch die<br />
fördernde Stelle und auch mit der Pflege des Kontaktes zum Arbeitgeber<br />
gemacht. Beide Maßnahmen sind wichtig für den Übergang in dauerhafte<br />
Beschäftigung und damit für die Nachhaltigkeit der Integration durch Förderung.<br />
• Das Programm ist angesichts der vielfältigen Aufgaben und beschäftigungsflankierenden<br />
Maßnahmen absolut und bezogen auf den Eingliederungsfall mit<br />
hohen finanziellen Aufwendungen verbunden. Eine Übertragung auf andere<br />
hessische Kommunen mit einer vergleichbaren Arbeitsmarktsituation wäre<br />
deshalb nur mit Unterstützung des Landes und/oder der EU denkbar und deshalb<br />
aus fiskalischen Gründen kaum realisierbar.<br />
• Die Möglichkeit einer (geförderten) Arbeit nachzugehen erhöht die Zufriedenheit<br />
der geförderten Personen erheblich und verbessert die Bewertung der<br />
persönlichen Situation deutlich. Insofern hat das Modellprojekt für die<br />
vermittelten Teilnehmer/innen neben der arbeitsmarktpolitischen Komponente<br />
einen wichtigen positiven sozialpolitischen Effekt.<br />
104
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
• Die Zusammenarbeit mit der KAF wird von den geförderten Arbeitnehmern und<br />
von den Arbeitgebern, die sich an dem Modellprojekt beteiligten, ausgesprochen<br />
positiv beurteilt. Hier scheint das Optimum weitgehend erreicht zu sein.<br />
• Die KAF bewertet das Modellprojekt sehr positiv und hat es nach Auslaufen<br />
der Förderung durch das Land und den ESF zunächst unverändert weiter<br />
geführt. Die Förderung neuer Arbeitsverhältnisse durch Kombilohn für den<br />
Arbeitnehmer wurde allerdings zum 31.08.2004 eingestellt, weil sich im Zuge der<br />
Umstellung der aktiven Arbeitsmarktpolitik die Rahmenbedingungen des SGB II<br />
verändert haben.<br />
105
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle<br />
Seite<br />
1 Beratungsfälle und Arbeitgeberkontakte der Kommunalen Arbeitsförderung 19<br />
2 In Arbeit vermittelte Sozialhilfeempfänger/innen 2002/2003 22<br />
3 Berufsausbildung der Teilnehmer/innen nach Altersstruktur in % 31<br />
4 Vergleich der Strukturmerkmale 36<br />
5 Einschätzung der persönlichen Situation vor Beginn des Modellversuchs 40<br />
6 Strukturmerkmale der Teilnehmer/innen in Arbeit im Vergleich 44<br />
7 Dauer der Erwerbslosigkeit der Teilnehmer/innen in Arbeit 45<br />
8 Teilnehmer/innen am Modellversuch und ihre Beteiligung an den Befragungen 48<br />
9 Vergleich der Strukturmerkmale 49<br />
10 Art der Förderung der Befragungsteilnehmer/innen durch KaMoKo 50<br />
11 Beurteilung der Lebenssituation 2004 in Abhängigkeit vom Erwerbsstatus 59<br />
12 Beurteilung der Lebenssituation 2002 und 2004 62<br />
106
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung<br />
Seite<br />
1 Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 1997-2003 5<br />
2 Entwicklung der Arbeitslosenquote 1997-2003 7<br />
3 Entwicklung der Arbeitslosenzahl 1997 – 2003 8<br />
4 Entwicklung der Langzeitarbeitslosen 1997-2003 9<br />
5 Arbeitslosigkeit von Frauen und Männern 1997-2003 10<br />
6 Altersstruktur der Teilnehmer/innen 26<br />
7 Altersstruktur der Teilnehmer/innen nach Geschlecht 27<br />
8 Altersstruktur der Teilnehmer/innen nach Nationalität 28<br />
9 Struktur der Teilnehmer/innen nach dem Familienstand 28<br />
10 Kinderzahl der Teilnehmer/innen 29<br />
11 Schulausbildung der Teilnehmer/innen 30<br />
12 Berufsausbildung der Teilnehmer/innen 31<br />
13 Dauer der Erwerbslosigkeit 37<br />
14 Genannte Gründe für die Erwerbslosigkeit 39<br />
15 Zufriedenheit der Teilnehmer/innen mit ausgewählten Lebenssituationen 41<br />
16 Erwartungen der Teilnehmer/innen an den Modellversuch 42<br />
17 Teilnahme an einzelnen Maßnahmen im Modellversuch 43<br />
18 Persönliche Situation im Modellversuch 46<br />
19 Bewertung der Lebenssituation differenziert nach dem Geschlecht 54<br />
107
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
Abbildung<br />
Seite<br />
20 Zufriedenheit der Befragten mit Arbeit im Modellprojekt im Vergleich zu<br />
denen ohne Vermittlung 59<br />
21 Verteilung der befragten Betriebe auf Betriebsgrößenklassen 88<br />
22 Verteilung der Befragungsteilnehmer auf Branchen 90<br />
23 Bekanntheitsgrad der Kommunalen Arbeitsförderung bei den befragten<br />
Betrieben in Kassel 91<br />
24 Bekanntheitsgrad des „Kasseler Modell Kombilohn“ bei den befragten<br />
Betrieben in Kassel 92<br />
25 Methoden der Stellenbesetzung durch die Betriebe 98<br />
26 Beschäftigungsmöglichkeiten von Hilfskräften bei den befragten Betrieben 99<br />
108
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>– Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Literatur<br />
Cristante, Osvaldo; Mugabushaka, Alexis-Michel (2003): Evaluation von Maßnahmen der<br />
Kommunalen Arbeitsförderung Kassel. Institut für Arbeitswissenschaft an der Universität<br />
Kassel. Kassel 2003<br />
Dann, S.; Kirchmann, A.; Spermann, A.; Volkert, J. (Hrsg.) (2002): Kombi-Einkommen-<br />
Ein Weg aus der Sozialhilfe? Baden-Baden 2002.<br />
Hartmann, Josef (2004): Lohnkostenzuschüsse und Integration schwer vermittelbarer Personen<br />
in den ersten Arbeitsmarkt – eine Evalution mit Daten aus Betriebsbefragungen.<br />
Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nr. 284. Nürnberg 2004.<br />
Eichhorst, Werner; Thode, Eric; Winter, Frank (2004): Benchmarking Deutschland 2004 –<br />
Arbeitsmarkt und Beschäftigung. Bericht der Bertelsmann Stiftung. Berlin 2004.<br />
Eichhorst, Werner: Mainz and more? Lohnkostenzuschüsse, Kombilöhne, Mini- und Midijobs<br />
und weitere Entlastungen niedriger Einkommen. In: J. Lange (Hrsg.), Ende der Verschiebebahnhöfe:<br />
die Umsetzung der Arbeitsmarktreform, Loccum: S. 179-194, Loccumer<br />
Protokoll Nr. 61/2003.<br />
Hujer, Reinhardt; Caliando, Marco (2003): Lohnsubvention in Deutschland – Wie sieht eine<br />
optimale Evaluierungsstrategie aus? In: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung<br />
72,I, S. 109-123.<br />
Jahn, Elke; Wiedemann, Eberhard (Hrsg.) (2003): Beschäftigungsförderung im Niedriglohnsektor.<br />
Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nr. 272. Nürnberg 2003.<br />
Spermann, Alexander (2003): Ergebnisse und Lehren aus Modellversuchen mit Kontrollgruppen<br />
– Einstiegsgeld in Baden-Württemberg und Hessischer Kombilohn. In: Beiträge<br />
zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nr. 272. Nürnberg 2003.<br />
Trabert, Lioba (2002): „Möglichkeiten und Grenzen für einen Niedriglohnsektor“ (FEH-<br />
Werkstattbericht 4)<br />
Walwei, Ulrich (1996): Aktive Arbeitsmarktpolitik in den OECD-Ländern Entwicklungstendenzen<br />
und Effekte. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 29. Jg<br />
1996.<br />
Walwei, Ulrich (2002): Kombilohn - ein neuer Weg zu mehr Beschäftigung?. In: Wirtschaftsdienst,<br />
Jg. 82 (2002), H. 2. S. 82-91.<br />
109
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
110
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
Anhang 1<br />
Faksimileabdrucke der Fragebogen<br />
1. Teilnehmerbefragung Seite 1<br />
2. Teilnehmerbefragung Seite 5<br />
1. Arbeitgeberbefragung Unternehmen mit Kamoko-Beschäftigten Seite 7<br />
2. Arbeitgeberbefragung Unternehmen mit Kamoko-Beschäftigten Seite 9<br />
Arbeitgeberbefragung Unternehmen ohne Kamoko-Beschäftigte Seite 11
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
1
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
2
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
3
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
4
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
5
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
6
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
7
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
8
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
9
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
10
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Wirtschafts- und Regionalforschung –<br />
11
Evaluierung Kasseler Modell Kombilohn (KaMoKo)<br />
12