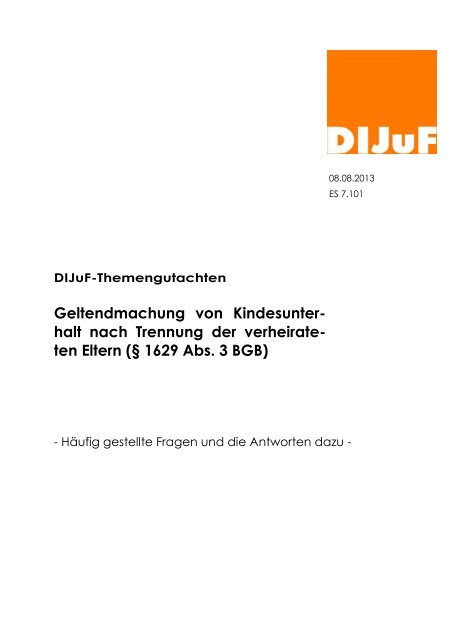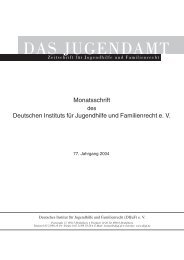1629 Abs. 3 BGB - DIJuF
1629 Abs. 3 BGB - DIJuF
1629 Abs. 3 BGB - DIJuF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
08.08.2013<br />
ES 7.101<br />
<strong>DIJuF</strong>-Themengutachten<br />
Geltendmachung von Kindesunterhalt<br />
nach Trennung der verheirateten<br />
Eltern (§ <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong>)<br />
- Häufig gestellte Fragen und die Antworten dazu -
2<br />
Inhalt<br />
1 Warum kann nach einer Trennung verheirateter Eltern ein<br />
gemeinschaftliches Kind seinen Unterhalt gegen den<br />
barunterhaltspflichtigen Elternteil nicht im eigenen Namen geltend<br />
machen? ........................................................................................................ 3<br />
2 Kann nach Scheidung der Eltern der auf ein Elternteil lautende Titel auf<br />
das Kind umgeschrieben werden? .............................................................. 4<br />
3 Wie hat eine urkundliche Rechtsnachfolgeklausel zugunsten eines<br />
Kindes zu lauten? ........................................................................................... 4<br />
4 Kann ein Notar Gebühren für die Titelumschreibung auf das Kind<br />
verlangen? ..................................................................................................... 5<br />
5 Kann ein in Verfahrensstandschaft für ein Kind erwirkter Titel unmittelbar<br />
für einen Sozialleistungsträger als Rechtsnachfolger umgeschrieben<br />
werden? .......................................................................................................... 5<br />
6 Kann aus einem Titel, der ungeachtet des § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong> das Kind<br />
als Gläubiger aufführt, vollstreckt werden? ................................................ 7<br />
7 Kann ein verheirateter Elternteil nach der Trennung eine Beistandschaft<br />
zur Geltendmachung von Kindesunterhalt trotz gesetzlich geregelter<br />
Verfahrensstandschaft (§ <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong>) beantragen? ........................ 8<br />
7.1 Vorrang der Beistandschaft vor der Verfahrensstandschaft ...................... 8<br />
7.2 Wesentliche Argumente ...................... 8<br />
7.3 Meinungsstand in der Literatur ...................... 9<br />
7.5 Handlungsempfehlungen für die Praxis .................... 12<br />
7.6 Ausblick .................... 13
3<br />
1 Warum kann nach einer Trennung verheirateter Eltern ein<br />
gemeinschaftliches Kind seinen Unterhalt gegen den barunterhaltspflichtigen<br />
Elternteil nicht im eigenen Namen geltend<br />
machen?<br />
Im Gesetz ist zur elterlichen Sorge geregelt, dass bei Trennung von verheirateten Eltern<br />
ein Elternteil Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil nur<br />
im eigenen Namen geltend machen kann (§ <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong>). Die Vorschrift des<br />
§ <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong> will zum einen bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Scheidung in<br />
der Ehesache und im Rechtsstreit auf Kindesunterhalt Parteiidentität gewährleisten.<br />
Denn der Anspruch auf Kindesunterhalt ist während der Rechtshängigkeit der Ehesache<br />
als Folgesache im Scheidungsverbundverfahren geltend zu machen (BGH<br />
11.05.2005, XII ZB 242/03 = JAmt 2005, 530 = FamRZ 2005, 1164). Zusätzlich will die Regelung<br />
aber auch eine Konfliktsituation für das Kind während der Trennungszeit und<br />
des Scheidungsverfahrens verhindern (BGH aaO). In der Einzelbegründung des<br />
KindRG-RegE ist zur Neufassung der Vorschrift Folgendes ausgeführt worden (BT-<br />
Drucks. 13/4899, 96):<br />
„<strong>Abs</strong>atz 3 Satz 1 enthält – als verfahrensrechtliche Ergänzung von <strong>Abs</strong>atz<br />
2 Satz 2 – eine gesetzliche Prozessstandschaft des für Unterhaltsansprüche<br />
alleinvertretungsberechtigten Elternteils. Mit dieser Regelung<br />
soll verhindert werden, dass das Kind in den Streit der Eltern (bei sonstigen<br />
Ehesachen oder bei Getrenntleben) oder in das Scheidungsverfahren<br />
förmlich als Partei einbezogen wird (vgl. die Begründung in BT-<br />
Drucks 10/4514 S. 23 und 7/65 S. 174, 176).<br />
In anderen Fällen der gemeinsamen Sorge (nach Scheidung oder bei<br />
nicht miteinander verheirateten Eltern) ist eine gesetzliche Prozessstandschaft<br />
nicht notwendig, da es in diesen Fällen nicht zu einem Zusammentreffen<br />
mit Scheidungs- oder Ehesachen kommen kann.“<br />
Deshalb kann bis zur Scheidung der Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind befindet,<br />
den Kindesunterhalt nur im Wege der „Prozessstandschaft“ (in der Gesetzessprache<br />
des FamFG nunmehr „Verfahrensstandschaft“) geltend machen, nicht aber das Kind<br />
im eigenen Namen. Folglich lautet der entsprechende Titel auf den Elternteil als<br />
Gläubiger, der auch hieraus im eigenen Namen vollstrecken kann. Das gilt sowohl für<br />
gerichtliche Entscheidungen als auch für Urkunden, zB im Rahmen einer notariellen<br />
Trennungs- und Scheidungsvereinbarung.
4<br />
2 Kann nach Scheidung der Eltern der auf ein Elternteil lautende<br />
Titel auf das Kind umgeschrieben werden?<br />
Das Kind selbst kann aus dem auf den Elternteil lautenden Titel nicht einfach vollstrecken,<br />
da es nicht als Gläubiger benannt worden ist. Ist die Verfahrensstandschaft<br />
nach Scheidung der Ehe fortgefallen, so ist eine vollstreckbare Ausfertigung des in<br />
Verfahrensstandschaft erstrittenen Titels auf Antrag dem materiell berechtigten Kind<br />
zu erteilen. Da das Kind im Titel nicht als Gläubiger genannt worden ist, ist allerdings<br />
nicht eine einfache, sondern eine qualifizierte Klausel zu erteilen (OLG Zweibrücken<br />
16.11.1998, 5 WF 119/98 = FamRZ 2000, 964). Zwar liegt im wörtlichen Sinne keine<br />
Rechtsnachfolge vor, da dem Kind immer schon der Unterhaltsanspruch zustand.<br />
Jedoch wird nach ganz hM die Vorschrift des § 727 <strong>Abs</strong>. 1 ZPO auf diesen Fall entsprechend<br />
angewandt (vgl OLG Hamm 27.03.2000, 7 WF 132/00 = FamRZ 2000, 1590;<br />
diese Entscheidung beruft sich für ihre Auslegung wiederum auf die gleichlautenden<br />
Erkenntnisse des OLG Frankfurt 17.10.1983, 5 WF 224/83 = FamRZ 1983, 1268 und des<br />
OLG Köln 14.03.1985, 4 WF 19/85 = FamRZ 1985, 626. Sie wird auch in der Kommentarliteratur<br />
zustimmend zitiert, vgl zB Zöller/Stöber § 727 ZPO Rn. 13). Ablehnende Entscheidungen<br />
oder Fundstellen des Schrifttums, die sich grundsätzlich gegen eine<br />
analoge Anwendung der Vorschrift über die Erteilung der Rechtsnachfolgeklausel in<br />
diesen Fällen aussprechen, sind nicht bekannt.<br />
Deshalb muss vor einer Vollstreckung im Namen des jeweiligen Kindes zunächst der<br />
Titel entsprechend umgeschrieben werden.<br />
3 Wie hat eine urkundliche Rechtsnachfolgeklausel zugunsten<br />
eines Kindes zu lauten?<br />
Vorab ist anzumerken, dass ein Elternteil, der in Verfahrensstandschaft für mehrere<br />
Kinder die Titulierung des Kindesunterhalts erreicht hat, für jedes Kind eine eigene<br />
vollstreckbare Ausfertigung beantragen sollte.<br />
Eine Vollstreckungsklausel zugunsten eines Kindes hinsichtlich eines von einem Elternteil<br />
in Verfahrensstandschaft erwirkten Titels könnte sinngemäß lauten:<br />
„Ausgefertigt mit dem Bemerken, dass hinsichtlich der von Herrn … urkundlich<br />
übernommenen und der sofortigen Vollstreckbarkeit unterliegenden<br />
Verpflichtung zum Kindesunterhalt nunmehr der Anspruch un-
5<br />
mittelbar dem Unterhaltsberechtigten … zusteht aufgrund der Rechtskraft<br />
des Scheidungsurteils zwischen den Eltern und der damit beendeten<br />
Verfahrensstandschaft von Frau … für die Kinder. Nachgewiesen<br />
durch Vorlage des Scheidungsurteils des AG … vom … Az … mit<br />
Rechtskraftvermerk.“<br />
Eine solche Klausel ermöglicht dem jeweiligen Kind, wie ein Rechtsnachfolger im engeren<br />
Sinn, ab dem Zeitpunkt der Umschreibung aus dem Titel sowohl hinsichtlich<br />
aufgelaufener Rückstände als auch künftig fällig werdender Ansprüche zu vollstrecken.<br />
4 Kann ein Notar Gebühren für die Titelumschreibung auf das<br />
Kind verlangen?<br />
Beurkundungen von Verpflichtungen zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen eines<br />
Kindes sind gebührenfrei. Dies ergab sich bis zum 31.07.2013 aus § 55a KostO iVm § 62<br />
<strong>Abs</strong>. 1 BeurkG. Seit dem 01.08.2013 ist die Kostenordnung durch das Gesetz über die<br />
Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare (GNotKG) abgelöst<br />
worden. Die Gebührenfreiheit von Beurkundungen nach § 62 <strong>Abs</strong>. 1 BeurkG ergibt<br />
sich aktuell aus der Vorbemerkung 2, <strong>Abs</strong>atz 3, zum Teil 2 (die Notargebühren betreffend)<br />
der Anlage 1 zu § 3 <strong>Abs</strong>. 2 GNotKG.<br />
Es ist sehr gut vertretbar, dass die Gebührenfreiheit auch die Erteilung einer Rechtsnachfolgeklausel<br />
für ein Kind umfasst, wenn zuvor in einer notariellen Urkunde der<br />
Kindesunterhalt wegen der Verfahrensstandschaft eines Elternteils für diesen als<br />
Gläubiger – ggf nicht gebührenbefreit – festgelegt worden war. Der Notar ist also<br />
allenfalls befugt, Auslagen für das Amtsgeschäft zu fordern, nicht aber Gebühren.<br />
Sollte er das wider Erwarten anders sehen, müsste er das unter Würdigung der vorgenannten<br />
Vorschriften eingehend begründen.<br />
5 Kann ein in Verfahrensstandschaft für ein Kind erwirkter Titel<br />
unmittelbar für einen Sozialleistungsträger als Rechtsnachfolger<br />
umgeschrieben werden?<br />
Nach erbrachten Sozialleistungen für ein Kind kommt die Rechtsnachfolge auf den<br />
Sozialleistungsträger in Betracht (zB gem. § 7 <strong>Abs</strong>. 1 UVG oder § 33 <strong>Abs</strong>. 1 SGB II). Das
6<br />
gilt etwa dann, wenn ein Jugendamt nach Errichtung des in Verfahrensstandschaft<br />
für ein Kind errichteten Titels Unterhaltsvorschuss geleistet und die Höhe dieser Leistung<br />
durch beurkundete Zusammenstellung nachgewiesen hat. Insoweit liegt bei<br />
geleistetem Unterhaltsvorschuss und hieraus folgendem Gläubigerwechsel nach § 7<br />
<strong>Abs</strong>. 1 UVG zwar keine „echte“ Rechtsnachfolge bezüglich der titulierten Forderung<br />
vom Titelgläubiger – Mutter oder Vater des Kindes – auf das Land vor. Nach dieser<br />
Vorschrift geht der Unterhaltsanspruch des Kindes über; der Titel weist aber einen Elternteil<br />
als Gläubiger aus.<br />
In der Rechtsprechung wird jedoch die Vorschrift des § 727 <strong>Abs</strong>. 1 ZPO für entsprechend<br />
anwendbar gehalten (vgl OLG Dresden 28.05.1998, 10 WF 160/98 = DAVorm<br />
1999, 713; OLG Zweibrücken 16.11.1998, 5 WF 119/98 = FamRZ 2000, 964). In der letztgenannten<br />
Entscheidung wird ausgeführt:<br />
„Soweit das beschwerdeführende Land auf der Grundlage eines entsprechenden<br />
Bewilligungsbescheides Leistungen nach dem UVG erbracht<br />
hat, ist die Unterhaltsforderung des Kindes kraft Gesetzes gemäß<br />
§ 7 <strong>Abs</strong>. 1 S. 1 UVG ohne weitere Anzeige auf das Land übergegangen<br />
und dieses Rechtsnachfolger des Kindes geworden (vgl. OLG Zweibrücken,<br />
FamRZ 1987, 736, 737). Insoweit kann das Land grundsätzlich die<br />
Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung in entsprechender Anwendung<br />
des § 727 <strong>Abs</strong>. 1 ZPO verlangen.<br />
Die Vorschrift des § 727 <strong>Abs</strong>. 1 ZPO ist auf die hier vorliegende "Rechtsnachfolge"<br />
entsprechend anzuwenden. Der in Prozessstandschaft gemäß<br />
§ <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong> erstrittene Titel wirkt unmittelbar für und gegen<br />
das vertretene Kind. Ist die Prozessstandschaft daher fortgefallen - etwa<br />
nach Volljährigkeit des Kindes oder nach Scheidung der Ehe -, so ist eine<br />
vollstreckbare Ausfertigung auf Antrag dem materiell Berechtigten,<br />
also dem Kind zu erteilen. Denn zu den Wirkungen einer Entscheidung<br />
gehört auch das Recht, aus ihr zu vollstrecken. Da das Kind als Titelinhaber<br />
nicht genannt worden ist, ist allerdings nicht die einfache Klausel<br />
gemäß § 724 ZPO zu erteilen, sondern nur die qualifizierte Klausel nach<br />
§ 727 ZPO. Entsprechendes gilt für den neuen Gläubiger, der die<br />
Rechtsnachfolge des Kindes angetreten hat (OLG Düsseldorf, FamRZ<br />
1997, 826; siehe auch KG, FamRZ 1989, 417 und 1985, 627; Göppinger/Wax/van<br />
Els, Unterhaltsrecht, 6. Aufl., Rdnr. 1669).“
7<br />
Zur Klarstellung ist darauf hinzuweisen, dass das OLG Dresden (aaO) in seiner im gleichen<br />
Sinne argumentierenden Entscheidung ausdrücklich bemerkt hat:<br />
„Die Vorschrift des § 727 <strong>Abs</strong>. 1 ZPO ist auf die hier vorliegende Rechtsnachfolge<br />
jedoch entsprechend anzuwenden - ungeachtet dessen, ob<br />
die Prozessstandschaft noch andauert oder nicht.“<br />
Daraus ergibt sich, dass das Land als Rechtsnachfolger des jeweiligen Kindes gem.<br />
§ 7 <strong>Abs</strong>. 1 UVG in entsprechender Anwendung des § 727 <strong>Abs</strong>. 1 ZPO eine Rechtsnachfolgeklausel<br />
gewissermaßen „im Durchgriff“ unmittelbar aus einem wegen<br />
§ <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong> auf den Elternteil lautenden Titel beanspruchen kann. Das gilt unabhängig<br />
davon, ob die Scheidung bereits rechtskräftig geworden und aus diesem<br />
Grund die Verfahrensstandschaft des Elternteils für die Kinder entfallen ist.<br />
6 Kann aus einem Titel, der ungeachtet des § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong><br />
das Kind als Gläubiger aufführt, vollstreckt werden?<br />
Wurde ungeachtet der gesetzlichen Verfahrensstandschaft des Elternteils die Titulierung<br />
des Kindesunterhalts im Namen des Kindes beantragt, so hätte der Antrag wegen<br />
§ <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong> abgewiesen werden müssen. Wird ein Verfahren jedoch unbeanstandet<br />
unter Beteiligung des Kindes als „Antragsteller“ geführt und durch Vergleich<br />
beendet, ist der Titel auch beim Wort zu nehmen. Der festgesetzte Anspruch<br />
steht dem Kind als „Antragsteller“ und damit als Titelgläubiger zu.<br />
Insoweit kann nichts anderes gelten als in sonstigen Fällen, in denen eine inhaltlich<br />
falsche gerichtliche Entscheidung ergeht. Sobald diese rechtskräftig ist, bindet ihr<br />
tenorierter Ausspruch, mag er auch materiellrechtlich unhaltbar sein oder etwa einen<br />
unzutreffenden Gläubiger bezeichnen.<br />
Anders wäre dies nur in den seltenen Fällen, in denen eine gerichtliche Entscheidung<br />
sich so weit von allen denkbaren Rechtsgrundlagen entfernt, dass sie den Makel der<br />
Unwirksamkeit „auf der Stirn trägt“ und somit als nichtig zu bezeichnen ist. Davon<br />
kann aber bei dem hier vorliegenden Verfahrensvergleich keine Rede sein. Er enthält<br />
eine allgemein übliche und zulässige Tenorierung, die lediglich unter den Besonderheiten<br />
des konkreten Falles nicht hätte ergehen dürfen. Das ist zwar ein Fall der materiellen<br />
Unrichtigkeit, der aber keinesfalls zur Nichtigkeit der Vereinbarung führt.
8<br />
7 Kann ein verheirateter Elternteil nach der Trennung eine Beistandschaft<br />
zur Geltendmachung von Kindesunterhalt trotz<br />
gesetzlich geregelter Verfahrensstandschaft (§ <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3<br />
<strong>BGB</strong>) beantragen?<br />
7.1 Vorrang der Beistandschaft vor der Verfahrensstandschaft<br />
Grundsätzlich ist zwar zu beachten, dass unter den Voraussetzungen des § <strong>1629</strong><br />
<strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong> bei der Geltendmachung des Kindesunterhalts nur der dort bezeichnete<br />
Elternteil das Kind als Verfahrensstandschafter vertreten kann und infolgedessen<br />
bspw auch befugt ist, im eigenen Namen den Antrag auf Festsetzung des Kindesunterhalts<br />
im vereinfachten Verfahren nach §§ 249 ff FamFG zu stellen (vgl<br />
MüKo/Macco § 249 FamFG Rn 13).<br />
Wenn aber ein Elternteil durch seinen Antrag beim Jugendamt wirksam eine Beistandschaft<br />
nach §§ 1712 ff <strong>BGB</strong> errichtet hat, ist der Beistand auch uneingeschränkt<br />
berechtigt, das Kind bei der Geltendmachung des Unterhalts zu vertreten. Die Beschränkung<br />
des § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong>, welche verhindern soll, dass vor einer Scheidung<br />
das Kind gewissermaßen in einen Rechtsstreit seiner getrennt lebenden Eltern hineingezogen<br />
wird, entfällt für diesen Fall. Das hat das OLG Stuttgart in einer überzeugend<br />
begründeten Entscheidung (OLG Stuttgart 09.10.2006,17 UF 182/06 = JAmt 2007, 40<br />
mit zust. Anm. Knittel) erkannt.<br />
7.2 Wesentliche Argumente<br />
Die wesentliche Argumentationslinie hierfür lautet:<br />
Es war der erklärte Wille des Gesetzgebers beim Kinderrechteverbesserungsgesetz im<br />
Jahre 2002, mit der Erweiterung der Antragsbefugnis in § 1713 <strong>Abs</strong>. 1 S. 2 <strong>BGB</strong> die Beistandschaft<br />
als Hilfestellung auch den betreuenden Elternteilen mit gemeinsamer<br />
Sorge anzubieten. Die noch bei Inkrafttreten der Kindschaftsrechtsreform zum<br />
01.07.1998 vorgenommene Beschränkung auf Elternteile mit alleiniger Sorge hatte<br />
sich in der Praxis als zu restriktiv erwiesen; ein Bedürfnis nach Unterstützung bei der<br />
Geltendmachung des Unterhalts auch im Falle der gemeinsamen Sorge war offenkundig<br />
vorhanden.<br />
Bei der Erweiterung der Antragsbefugnis für die Beistandschaft im Jahr 2002 war keine<br />
Beschränkung hinsichtlich verheirateter und getrennt lebender Eltern vorgesehen<br />
worden. Deshalb kann jedenfalls nicht argumentiert werden, dass der Gesetzgeber
9<br />
diese Personengruppe von der Beistandschaft ausschließen wollte: Vielmehr kann<br />
auch und gerade nach Trennung der Eltern ein Bedürfnis für eine baldige Regelung<br />
des Kindesunterhalts bestehen.<br />
Dass der Gesetzgeber auch nicht etwa umgekehrt ausdrücklich den Vorrang des<br />
§ 1713 <strong>Abs</strong>. 1 S. 2 <strong>BGB</strong> betonen musste, ergibt ein Vergleich mit dem früheren Recht:<br />
Bei Bestellung eines Beistands nach § 1690 <strong>BGB</strong> aF – dessen Vertretungsmacht an die<br />
Stelle derjenigen des obsorgenden Elternteils trat – konnte das Kind in einem Unterhaltsrechtsstreit<br />
mit dem anderen Elternteil auch dann als durch den Beistand vertretene<br />
Partei auftreten, wenn der betreuende Elternteil selbst ein entsprechendes Verfahren<br />
nur in Prozessstandschaft nach § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong> führen durfte (vgl KG Berlin<br />
22.10.1997, 3 UF 1976/97 = FamRZ 1998, 378 f mwN). Es lag deshalb nicht nahe, im<br />
neuen Recht insoweit nochmals ausdrücklich eine gesetzliche Klarstellung vorzunehmen.<br />
Diese Überlegungen sollten an sich schon hinreichend für eine Lösung des Problems<br />
im hier befürworteten Sinne sprechen.<br />
Selbst wenn man aber einen offenen Wertungswiderspruch zwischen den beiden<br />
Vorschriften in § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 und § 1713 <strong>Abs</strong>. 1 S. 2 <strong>BGB</strong> erkennen wollte, den der Gesetzgeber<br />
nicht durch die jüngere Bestimmung eindeutig entschieden habe, kann<br />
nicht einfach ein Vorrang der erstgenannten Regelung behauptet werden.<br />
Sieht man den Schwerpunkt der gesetzlichen Zielsetzung darin, zu verhindern, dass<br />
das Kind in einem Unterhaltsrechtsstreit gerade durch den die Obhut innehabenden<br />
Elternteil gegen seinen Ehegatten vertreten wird, also das Kind am Rechtsstreit der<br />
Eltern „als durch einen Elternteil vertretene Partei“ teilnimmt (KG Berlin aaO), sollte<br />
§ <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong> der Geltendmachung des Unterhalts durch den Beistand von<br />
vornherein nicht entgegenstehen. Denn diese Konfliktstellung ist gerade dann ausgeschlossen,<br />
wenn der Beistand als gesetzlicher Vertreter des Kindes auftritt.<br />
7.3 Meinungsstand in der Literatur<br />
Dem hat sich der überwiegende Teil der Kommentarliteratur angeschlossen (zB<br />
BeckOK/Veit § <strong>1629</strong> <strong>BGB</strong> Rn 51; BeckOK/Enders § 1712 <strong>BGB</strong> Rn 22; MüKo/ v. Sachsen<br />
Gessaphe § 1713 <strong>BGB</strong> Rn 8; MüKo/ Huber § <strong>1629</strong> <strong>BGB</strong> Rn 86; Palandt/Götz § 1713 <strong>BGB</strong><br />
Rn 3; NomosKo /Zempel § 1712 <strong>BGB</strong> Rn 19; Schulz/Hauß/Hüßtege § 1713 <strong>BGB</strong> Rn 5;
10<br />
Schomburg Kind-Prax 2002, 75, 79; Meysen JAmt 2008, 120 f; Knittel JAmt 2007, 40;<br />
<strong>DIJuF</strong>-Rechtsgutachten JAmt 2002, 243 mwN).<br />
Es sei allerdings nicht verschwiegen, dass auch eine Gegenmeinung findet: Zöller/Lorenz<br />
kommentiert zu § 234 FamFG unter Rn 5 wie folgt:<br />
„... Abgrenzung. Soweit bei verheirateten Eltern ein Elternteil gegen den<br />
anderen Unterhaltsansprüche des Kindes im Falle des Getrenntlebens<br />
bzw. bei anhängige Ehesache in Verfahrensstandschaft, § <strong>1629</strong> III <strong>BGB</strong>,<br />
geltend zu machen hat (zwingend: „kann … nur“), ist eine Unterhaltsdurchsetzung<br />
durch das Jugendamt als Beistand bzw. gesetzlicher Vertreter<br />
des Kindes (sic !) ausgeschlossen (Staudinger/Rauscher § 1713 Rn.<br />
6c; PH/Bömelburg § 234 Rn. 5; AG Regensburg JAmt 2003, 366; aA OLG<br />
Stuttgart JAmt 2007, 40; Palandt/Diederichsen § 1713 Rn. 3; MK-Huber<br />
§ <strong>1629</strong> Rn. 97). Dies folgt aus dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Verfahrensbeistandschaft<br />
(sic!) nach § <strong>1629</strong> III <strong>BGB</strong>. Die Vorschrift will zum<br />
einen bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Scheidungspartei- bzw. Beteiligtenidentität<br />
gewährleisten. Zum anderen will sie eine Konfliktsituation<br />
für das Kind während der Trennungszeit und des Scheidungsverfahrens<br />
verhindern (BGH NJW-RR 2005, 1237, 1238). Dieses Ziel würde beschädigt,<br />
wenn das Jugendamt als Beistand namens des Kindes den<br />
Unterhaltsanspruch geltend machen sollte (zutr Staudinger/Rauscher<br />
§ 1713 Rn. 6 c).“<br />
Dass diese Argumente allerdings nicht unbedingt überzeugen, ergibt sich bereits aus<br />
den oben zuvor genannten Fundstellen sowie den unter 7.2 dargelegten Erwägungen<br />
zum Zweck des § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong>.<br />
Selbst wenn man insoweit allein auf den Gesichtspunkt der Beteiligtenidentität abstellen<br />
wollte, kann dies nicht als Beleg für einen umfassenden Vorrang des § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3<br />
<strong>BGB</strong> gegenüber § 1713 <strong>Abs</strong>. 1 S. 2 <strong>BGB</strong> dienen: Zumindest in den Fällen, in denen<br />
nicht bereits eine Ehesache anhängig ist, sondern isolierte Verfahren durch einen<br />
Beistand während der Trennungsphase der noch miteinander verheirateten Eltern<br />
eingeleitet werden sollen, steht der angenommene Zweck des § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong><br />
dem nicht entgegen.
11<br />
7.4 Neuere Entscheidung des OLG Celle<br />
Zuletzt hat der 10. Zivilsenat – Senat für Familiensachen – des OLG Celle (10.04.2012,<br />
10 UF 65/12 = JAmt 2012, 599) die Ansicht vertreten, dass im Fall der Verfahrensstandschaft<br />
nach § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong> eine Beistandschaft ausgeschlossen sei. Anschließend<br />
hat das Gericht (OLG Celle 08.05.2012, 10 UF 65/12 = NJW-RR 2012, 1409) in dem Verfahren<br />
einen Endbeschluss erlassen, der inhaltlich iW der Ankündigung vom<br />
10.04.2012 entspricht. Dort wird zur Begründung ausgeführt:<br />
„Während der Trennung der Kindeseltern war die Antragstellerin nicht<br />
befugt, das Verfahren gegen den Antragsgegner zu führen. Der Auffassung<br />
des Oberlandesgerichts Stuttgart, dass Kinder getrennt lebender<br />
Eltern, die gemeinsam die elterliche Sorge ausüben, durch einen Beistand<br />
gerichtlich vertreten werden dürfen, weil die einschränkende<br />
Vorschrift des § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong> verdrängt werde vermag sich der Senat<br />
nicht anzuschließen. Aus § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 S. 1 <strong>BGB</strong> ergibt sich vielmehr,<br />
dass der Kindesunterhalt während des Getrenntlebens nur durch den<br />
obhutsberechtigten Elternteil gerichtlich geltend gemacht werden<br />
kann (so auch Prütting/Helms/Bömelburg FamFG 2. Aufl., § 234 Rn. 5;<br />
Zöller/Lorenz ZPO, 29. Aufl., § 234 FamFG Rn. 5).“<br />
Die Überzeugungskraft dieser Ausführungen hätte es allerdings gestärkt, wenn sich<br />
der Senat auch mit dem Meinungsstand in der Literatur und den dort angeführten<br />
Argumenten näher auseinander gesetzt hätte. „Dass § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong> die speziellere<br />
Norm ist, die durch die §§ 1712, 1713 <strong>BGB</strong> nicht verdrängt werden kann“ – so die<br />
erstgenannten Entscheidung vom 10.04.2012 –, ist nach alldem eine bloße Behauptung<br />
des Senats, die nicht hinreichend auf den Zweck und die Entstehungsgeschichte<br />
des Gesetzes eingeht.<br />
Im Übrigen könnte einer derart formalistischen Betrachtungsweise auch entgegengehalten<br />
werden: Mit Eintritt der Beistandschaft ist die Vertretung durch den sorgeberechtigten<br />
Elternteil ausgeschlossen (§ 234 FamFG). Das gilt allgemein und unabhängig<br />
davon, ob dieser Elternteil das Kind unmittelbar oder nur im Wege der Prozessstandschaft<br />
vertreten kann (vgl NK/Zempel § 1712 <strong>BGB</strong> Rn 19; <strong>DIJuF</strong>-<br />
Rechtsgutachten JAmt 2002, 243; hierzu auch Staudinger/Rauscher § 1713 <strong>BGB</strong> Rn 6<br />
ff mwN zu dieser Auffassung).
12<br />
Ebenso sind die weiteren Argumente des OLG aus dem Beschluss vom 10.04.2012<br />
wenig tragfähig:<br />
- Dass die Unterhaltsansprüche der Kinder „oft eng verwoben mit den Unterhaltsansprüchen<br />
des betreuenden Elternteils“ sind, „sodass es auch aus diesem Grund<br />
verfahrensökonomisch sinnvoller erscheint, alle Ansprüche von einer Person aus zu<br />
verfolgen,“ mag zutreffen. Wenn aber wie häufig der betreffende Elternteil zunächst<br />
nur den Kindesunterhalt geltend machen will, trägt diese Überlegung<br />
nichts zur Frage der formellen Vertretungsberechtigung des Beistands bei.<br />
- Sollte die Beistandschaft während eines rechtshängigen Verfahrens von dem betreuenden<br />
Elternteil gegenüber dem Jugendamt gekündigt werden – so ein weiteres<br />
Bedenken des Senats –, müsste folgerichtig im Wege eines Beteiligtenwechsels<br />
der Antrag des Kindes einfach in einen solchen des Elternteils umgestellt werden.<br />
Das verhindert unschwer „die Situation die der Gesetzgeber mit der Schaffung<br />
des § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong> gerade vermeiden wollte.“<br />
Im Übrigen wird hingewiesen auf die eingehende Kritik der Entscheidung von Mix<br />
(JAmt 2013, 122). Jedenfalls gibt der Beschluss keinen Anlass, die von der ganz hM<br />
mit schlüssiger Argumentation vertretene Auslegung aufzugeben.<br />
7.5 Handlungsempfehlungen für die Praxis<br />
Außerhalb des Bezirks des 10. Senats im OLG Celle besteht für die jugendamtliche<br />
Praxis bis auf weiteres kein Anlass, von der bisherigen Handhabung der Beistandschaften<br />
auch für getrennt lebende Eltern abzugehen. Ganz allgemein gilt, dass eine<br />
überraschende Rechtsprechungsänderung eines einzelnen Senats eines bestimmten<br />
Oberlandesgerichts nicht gleich zu alarmistischen Reaktionen der jugendamtlichen<br />
Praxis in anderen Bezirken führen sollte. Abgewogen werden sollte stets die inhaltliche<br />
Qualität und Überzeugungskraft der neuen Entscheidung und die Wahrscheinlichkeit,<br />
dass ihr andere Obergerichte folgen werden. Jedenfalls muss nicht jede veröffentlichte<br />
Mindermeinung gleich Anlass zur der besorgten Frage geben, ob womöglich<br />
eine bewährte und eingespielte eigene Handhabung geändert werden<br />
müsse.<br />
Nach wie vor sollte eine Beistandschaft für zulässig gehalten werden, allerdings sollte<br />
sich das Jugendamt gleichzeitig eine Vollmacht des betreffenden Elternteils ausstellen<br />
lassen und diese bei der Aufforderung an den unterhaltspflichtigen Elternteil zur
13<br />
Erteilung von Auskunft gem. § 1605 <strong>Abs</strong>. 1 <strong>BGB</strong> bzw bei Mahnungen vorlegen. Das<br />
könnte mit dem Begleitvermerk geschehen: Das Jugendamt handle im Rahmen einer<br />
bestehenden Beistandschaft. Für den Fall, dass in einem anschließenden Rechtsstreit<br />
womöglich deren Zulässigkeit bezweifelt werde, sei hilfsweise eine Beratung und<br />
Unterstützung im Rahmen von § 18 <strong>Abs</strong>. 1 Nr. 1 SGB VIII anzunehmen. Zu diesem<br />
Zweck werde vorsorglich eine Vollmacht beigefügt.<br />
Damit könnte jedenfalls gewährleistet werden, dass Unterhaltsansprüche eines Kindes<br />
nicht allein deshalb verloren gehen, weil im Nachhinein die Vertretungsbefugnis<br />
des Jugendamts (zB bei Inverzugsetzungen im Sinne von § 1613 <strong>Abs</strong>. 1 S. 1 <strong>BGB</strong>) bezweifelt<br />
wird.<br />
7.6 Ausblick<br />
Es ist kaum vorstellbar, dass das Jugendamt auch bei dieser hilfsweise geltend gemachten<br />
Vertretungsbefugnis irgendwelche Schwierigkeiten bekommt. Denn wenn<br />
ein Gericht schon entgegen der hM und den Bedürfnissen der Praxis zuwider eine<br />
Beistandschaft in den Fällen des § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong> für unzulässig hält und dem Elternteil<br />
ansinnen will, die Kindesansprüche selbst im eigenen Namen geltend zu machen,<br />
muss es dann wenigstens eine Beratung und Unterstützung dieses Elternteils hierbei<br />
durch das Jugendamt nach § 18 <strong>Abs</strong>. 1 Nr 1 SGB VIII für zulässig halten. Folgerichtig<br />
wäre sogar, auch die gerichtliche Vertretung des Elternteils im Verfahren noch zu der<br />
zulässigen Unterstützung zu zählen. Das beliebte Argument, einer solchen Auslegung<br />
bedürfe es nicht, weil die Beistandschaft das sachgerechte Instrument der Unterstützung<br />
durch unmittelbare Vertretung des Kindes sei, entfällt logischerweise, wenn<br />
gleichzeitig die Beistandschaft im hier vorliegenden Zusammenhang für unzulässig<br />
gehalten wird.<br />
Nicht zu verkennen ist, dass das vorgeschlagene Vorgehen nur eine Notlösung ist,<br />
deren Risiken und Nebenwirkungen auch nicht vollständig abschätzbar sind.<br />
Solange aber durch eine nicht besonders praxisnahe Rechtsauslegung eines einzelnen<br />
Senats eines einzigen Oberlandesgerichts Unruhe und Unsicherheit bei den Jugendämtern<br />
entstehen kann, sollte hierauf – soweit dies in einzelnen Bezirken überhaupt<br />
für notwendig gehalten wird – einigermaßen kreativ reagiert werden, um den<br />
betreffenden Elternteilen nach wie vor eine möglichst wirksame Unterstützung bieten<br />
zu können.
14<br />
Literatur:<br />
Beck‘scher Online Kommentar <strong>BGB</strong>. Bamberger, H. / Roth, H. (Hrsg), Enders, W., (Redakteur).<br />
Ed.7 - Stand: 01.05.2013, C.H.Beck, München (zit. BeckOK/Bearbeiter)<br />
Knittel, B., Gerichtliche Vertretung eines Kindes durch den Beistand. Zust. Anm zu OLG<br />
09.10.2006.17 UF 182/06, JAmt 2007, 40<br />
Meysen, Th., Beginn und Ende von Beistandschaften, JAmt 2008, 120<br />
Mix, B., Die Beistandschaft nach §§ 1712, 1713 <strong>BGB</strong> in Konkurrenz zur Verfahrensstandschaft<br />
nach § <strong>1629</strong> <strong>Abs</strong>. 3 <strong>BGB</strong>, JAmt 2013, 122<br />
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (2012). Bd 8, Familienrecht II,<br />
§§ 1589-1921. SGB VIII, Säcker, F. J./Rixecker, R. (Hrsg), Born, W. (Redakteur), 6. Aufl.,<br />
C. H. Beck, München (zit. MüKo/Bearbeiter)<br />
NomosKommentar <strong>BGB</strong> - Familienrecht. (2010). Kaiser, D ua (Hrsg). 2. Aufl., Nomos<br />
Verlagsgesellschaft Baden-Baden (zit. NomosKo/Bearbeiter)<br />
Palandt, O. (Hrsg). (2013). Bürgerliches Gesetzbuch, 72. Aufl. C.H.Beck, München (zit.<br />
Palandt/Bearbeiter)<br />
Schomburg, G., Das Gesetz zur weiteren Verbesserung von Kinderrechten (Kinderrechteverbesserungsgesetz),<br />
Kind-Prax 2002, 75<br />
Schulz, W./ Hauß, J. (Hrsg) (2012) Familienrecht. Handkommentar. 2. Aufl., Nomos Verlagsgesellschaft<br />
Baden-Baden (zit. Schulz/Hauß/Bearbeiter)<br />
Staudinger, J. v. (Hrsg) (2006). Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Rauscher,<br />
Th. (Red) Sellier/de Gruyter, Berlin (zit. Staudinger/Bearbeiter)<br />
Zöller, R., (Hrsg) (2012), Zivilprozessordnung mit FamFG. Kommentar. 29. Aufl., Verlag<br />
Dr. Otto Schmidt, Köln (zit. Zöller/Bearbeiter)