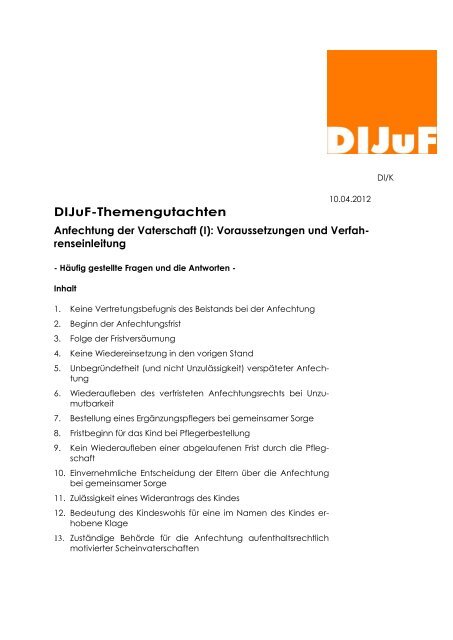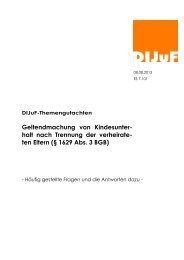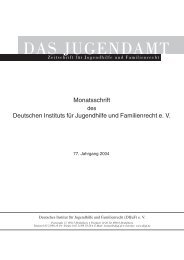DIJuF-Themengutachten
DIJuF-Themengutachten
DIJuF-Themengutachten
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>DIJuF</strong>-<strong>Themengutachten</strong><br />
10.04.2012<br />
Anfechtung der Vaterschaft (I): Voraussetzungen und Verfahrenseinleitung<br />
- Häufig gestellte Fragen und die Antworten -<br />
Inhalt<br />
1. Keine Vertretungsbefugnis des Beistands bei der Anfechtung<br />
2. Beginn der Anfechtungsfrist<br />
3. Folge der Fristversäumung<br />
4. Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand<br />
5. Unbegründetheit (und nicht Unzulässigkeit) verspäteter Anfechtung<br />
6. Wiederaufleben des verfristeten Anfechtungsrechts bei Unzumutbarkeit<br />
7. Bestellung eines Ergänzungspflegers bei gemeinsamer Sorge<br />
8. Fristbeginn für das Kind bei Pflegerbestellung<br />
9. Kein Wiederaufleben einer abgelaufenen Frist durch die Pfleg-<br />
schaft<br />
10. Einvernehmliche Entscheidung der Eltern über die Anfechtung<br />
bei gemeinsamer Sorge<br />
11. Zulässigkeit eines Widerantrags des Kindes<br />
12. Bedeutung des Kindeswohls für eine im Namen des Kindes erhobene<br />
Klage<br />
13. Zuständige Behörde für die Anfechtung aufenthaltsrechtlich<br />
motivierter Scheinvaterschaften<br />
Dl/K
2<br />
1. Kann das Jugendamt als Beistand das Kind bei einer Anfechtung der Vater-<br />
schaft vertreten?<br />
Die Anfechtung der Vaterschaft gehört nicht zu den Aufgaben des Beistands, wie<br />
sich aus § 1712 Abs. 1 BGB ergibt (vgl OLG Nürnberg MDR 2001, 219 zur Anfechtung<br />
eines Vaterschaftsanerkenntnisses; Rauscher, in: Staudinger, BGB, § 1712 Rn 18 mit<br />
ausführlicher Begr.; Enders, in: Beck'scher Online-KommBGB, Stand: 01.03.2011, § 1712<br />
Rn 18), unabhängig davon, ob die Vaterschaft auf der gesetzlichen Vermutung der<br />
Geburt in einer Ehe (§ 1592 Nr 1 BGB) oder auf der Anerkennung (§ 1592 Nr 2 BGB)<br />
beruht.<br />
Das OLG Nürnberg aaO hat hierzu nach einem Hinweis auf den Wortlaut des § 1712<br />
Abs. 1 BGB ausgeführt:<br />
„Gegen eine Ausweitung des Gegenstands der Beistandschaft über den<br />
Wortlaut hinaus auch auf die Vertretung des Kindes bei der Anfechtung<br />
der Vaterschaft spricht auch, dass der Gesetzgeber mit der Neuregelung<br />
des Beistandschaftsrechts eine kostenlose gesetzliche Vertretung durch<br />
das Jugendamt in dem geregelten Aufgabenkreis zur Verfügung gestellt<br />
hat, unabhängig von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des<br />
Kindes und dessen Eltern oder irgend eines zu prüfenden Fürsorgebedürf-<br />
nisses. Es sollten nur die Angelegenheiten von diesem freiwilligen und kos-<br />
tenlosen Institut erfasst werden, in denen neben der besonderen Situation<br />
allein sorgeberechtigter Elternteile, elementare Rechte des Kindes betrof-<br />
fen sind und ein besonderes Eigeninteresse des Staates an der Durchset-<br />
zung dieser Rechte besteht (so Sonnenfeld in Familienrechtsreformkom-<br />
mentar, 1998, Rdn. 10 zu § 1712 BGB). Die Vertretung des Kindes bei der<br />
Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung wird vom Aufgabenkreis des<br />
§ 1712 Abs. 1 BGB nicht erfasst. Ein Bedürfnis dafür besteht nicht, insbeson-<br />
dere besteht kein öffentliches Interesse daran, dass das Kind seinen<br />
"rechtlichen" Vater verliert, also die Person als Vater verliert, die die Vater-<br />
schaft anerkannt hat. Der Schutz des Kindes durch Beratungshilfe, Prozess-<br />
kostenhilfe und den zu Gunsten des Kindes eingeschränkten Untersu-<br />
chungsgrundsatz (§§ 640 Abs. 1, 616 Abs. 1, 640 d ZPO) bedarf keiner Er-<br />
gänzung durch eine erweiternde Auslegung des § 1712 Abs. 1 Nr. 1 BGB<br />
(vgl. Sonnenfeld, a.a.O., Rdn. 14 zu § 1712 BGB).
3<br />
Es ist Sache des Inhabers der elterlichen Sorge für die Klägerin, also der<br />
Kindsmutter, als gesetzliche Vertreterin der Klägerin die Anfechtung der<br />
Vaterschaft zu betreiben.“<br />
Erst nach erfolgreicher Vaterschaftsanfechtung ohne seine Beteiligung ist es wiede-<br />
rum Aufgabe des Beistands, ggf. erneut eine Vaterschaftsfeststellung gegen den<br />
wirklichen Erzeuger zu betreiben.<br />
2. Wann beginnt die Frist zur Anfechtung der Vaterschaft?<br />
Gem. § 1600b Abs. 1 S. 1 BGB ist die Vaterschaft binnen zwei Jahren gerichtlich anzu-<br />
fechten. Die Frist beginnt gem. § 1600b Abs. 1 S. 2 BGB mit dem Zeitpunkt, in dem der<br />
Anfechtungsberechtigte von den Umständen erfährt, die gegen die bestehende<br />
Vaterschaft sprechen. Hierfür muss er sichere Kenntnis von den Tatsachen erlangt<br />
haben, aus denen sich die nicht ganz fern liegende Möglichkeit einer Abstammung<br />
des Kindes von einem anderen Mann als dem rechtlichen Vater ergibt, was bei-<br />
spielsweise dann der Fall sein kann, wenn der Mann erfährt, dass die Mutter in der<br />
Empfängniszeit mit anderen Männern Verkehr hatte (vgl BGH MDR 2006, 1171, mwN;<br />
Thüring. OLG FamRZ 2010, 1822).<br />
Da die Frist nach § 1600b Abs. 1 S. 1 BGB durch „gerichtliche” Anfechtung zu wahren<br />
ist, setzt dies die Rechtshängigkeit des Anfechtungsantrags durch Zustellung voraus;<br />
allerdings wirkt eine „demnächst” erfolgende Zustellung nach § 167 ZPO auf den<br />
Zeitpunkt der Einreichung der Antrags zurück (BGH NJW 2008, 3061 und NJW 1994,<br />
2752 = FamRZ 1994, 1313; Hammermann, in: Erman, BGB, 13. Aufl., § 1600b Rn 5).<br />
3. Welche Folge hat die Versäumung der Anfechtungsfrist?<br />
Die Wahrung dieser Frist ist von Amts wegen zu beachten. Es handelt sich trotz An-<br />
wendung der Hemmungsvorschriften der §§ 206, 210 BGB um eine Ausschlussfrist (vgl<br />
BGH NJW 2008, 3061; OLG Hamburg FamRZ 1997, 1171, 1172; OLG BB FamRZ 2000,<br />
1031; Wellenhofer, in: MünchKommBGB, 6. Aufl. 2012, § 1600b Rn 3). Mit ihrer Ver-<br />
säumung erlischt das Anfechtungsrecht dieses Anfechtungsberechtigten und zwar<br />
auch dann, wenn außergerichtlich bewiesen ist, dass das Kind nicht von diesem<br />
Mann abstammt (OLG Hamm NJW-RR 1995, 643).
4. Gibt es eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Fristversäumnis?<br />
4<br />
Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Fristversäumung ist nicht möglich<br />
(Rauscher, in: Staudinger, BGB, Neub. 2011, Rn 5; Wellenhofer aaO). In der einschlä-<br />
gigen Rechtsprechung des BGH zu den Fällen, in denen sich der Anfechtungsbe-<br />
rechtigte auf eine unverschuldete Fristversäumnis berufen hat, wurde die Möglichkeit<br />
einer derartigen Wiedereinsetzung nicht einmal erörtert (vgl BGH NJW 1975, 1465 und<br />
NJW 1982, 96).<br />
Der einzig denkbare Ansatzpunkt wäre die Behauptung, eine vor Fristende aufgetre-<br />
tene Erkrankung sei ein Fall „höherer Gewalt“, der zur Hemmung des Fristablaufs ent-<br />
sprechend § 1600b Abs. 6 S. 2 iVm § 206 BGB geführt habe. Jedoch kann für die<br />
letztgenannte Vorschrift und ihre Vorgängerregelung in § 203 BGB aF als gesicherte<br />
höchstrichterliche Auslegung gelten: Schwere Erkrankung ist erst dann ein Grund für<br />
die Hemmung der Verjährung, wenn dem Berechtigten infolge seines Zustands die<br />
Besorgung seiner Angelegenheiten schlechthin unmöglich wird (vgl RG JW 1912, 384;<br />
BGH VersR 1963, 93; Grothe, in: MünchKommBGB, 5. Aufl., § 206 Rn 8).<br />
5. Ist eine Anfechtung nach Fristablauf unzulässig oder unbegründet?<br />
Zur Bedeutung der Frist des § 1600b Abs. 1 und 2 BGB bemerkt Rauscher, in: Staudin-<br />
ger, BGB, Neubearb. 2011, § 1600b Rn 70:<br />
„Der Fristablauf ist von Amts wegen zu beachten (Palandt/BrudermüllerRn<br />
2). Erhebt der Anfechtungsberechtigte Anfechtungsklage nach Ablauf<br />
der Frist (unbeschadet eines neuen Laufs nach Abs 3, 4 oder 5), so ist, trotz<br />
Ausgestaltung des Anfechtungsrechts als prozessuales Gestaltungsrecht,<br />
diese nicht als unzulässig, sondern als unbegründet abzuweisen (BGH LM<br />
§ 1594 aF BGB Nr 23); denn das Anfechtungsrecht ist mit Fristablauf erlo-<br />
schen. Dem steht auch nicht entgegen, wenn der Anfechtungsberechtig-<br />
te im Verfahren durch Vorlage eines Gutachtens nachweist, dass das Kind<br />
nicht von ihm abstammen kann, so dass das Gericht sehenden Auges ei-<br />
ne den wahren Abstammungsverhältnissen zuwiderlaufende Entschei-<br />
dung zu fällen hat (OLG Hamm NJW-RR 1995, 643, 644).“
5<br />
Denn die Frist dient ua der Rechtssicherheit, dem Rechtsfrieden und speziell der Be-<br />
standskraft des Kindschaftsstatus (BGH NJW 1999,1862).<br />
6. Kann das Anfechtungsrecht des Kindes trotz Fristablauf wieder aufleben?<br />
Grundsätzlich kann nach § 1600b Abs. 6 BGB auch nach regulärem Fristablauf das<br />
Anfechtungsrecht des Kindes unter bestimmten Voraussetzungen wieder aufleben.<br />
Hierzu bemerkt Hahn, in: Beck'scher Online-Kommentar zu § 1600b BGB Rn 1:<br />
„Abs 6 erweitert das Anfechtungsrecht des Kindes, das sich von seinem<br />
rechtlichen Vater lösen will, über Abs 3 hinausgehend auf Fälle, in denen<br />
die Folgen der Vaterschaft für es unzumutbar geworden sind. Das Anfech-<br />
tungsrecht des Kindes lebt also wieder auf (Krit Gaul FamRZ 1997, 1441,<br />
1459). Damit wird der Rechtsgedanke des § 1596 aF, aus dem sich An-<br />
haltspunkte zur Ausfüllung der Generalklausel ergeben können, fortge-<br />
führt. Danach war bis zum Inkrafttreten des KindRG die Anfechtung unbe-<br />
fristet möglich, wenn sie wegen ehrlosen oder unsittlichen Lebenswandels<br />
des Mannes, einer schweren Verfehlung des Mannes gegen das Kind<br />
(§ 1596 Abs 1 Nr 4 aF) oder wegen einer schweren Erbkrankheit des Man-<br />
nes (§ 1596 Abs 1 Nr 5 aF) sittlich gerechtfertigt war. Man wird aber auch<br />
in den Fällen des § 1596 Abs 1 Nr 2 und 3 aF eine Unzumutbarkeit der ent-<br />
standenen Situation bejahen können, also insbes bei Scheidung oder Auf-<br />
hebung der Ehe und bei dauerhafter Trennung der Ehegatten oder nicht-<br />
ehelichen Lebensgefährten, da mit der Auflösung der sozialen Familie der<br />
Grund für das bisherige Absehen von einer Anfechtung – Rücksichtnahme<br />
auf den Familienfrieden – entfällt (BT-Drucks 13/4899 S 56; OLG Celle JAmt<br />
2006, 143). Maßstab ist die persönliche Unzumutbarkeit einer Aufrechter-<br />
haltung der Vaterschaftszuordnung. Die Anfechtungsfrist von zwei Jahren<br />
beginnt mit Kenntnis der Umstände, welche die unzumutbare Situation<br />
begründen.“<br />
7. Mutter und Scheinvater haben die gemeinsame Sorge. Falls für beide die Frist<br />
zur persönlichen Anfechtung der Vaterschaft bereits abgelaufen ist: Wie kann<br />
die Anfechtung im Namen des Kindes bewirkt werden?
6<br />
Bei gemeinsamer Sorge können die Eltern das Kind nur gemeinsam vertreten (§ 1629<br />
Abs. 1 S. 2 Halbs. 1 BGB), dh, auch eine Klage (nach Sprachgebrauch des FamFG ei-<br />
nen Antrag) nur gemeinsam einreichen bzw das Kind als Beklagten/Antragsgegner<br />
nur gemeinsam vertreten.<br />
Es geht aber nicht an, dass der rechtliche Vater bei einer vom Kind erhobenen Kla-<br />
ge dieses gegen sich selbst vertritt. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn der Mann als<br />
Kläger (bzw Antragsteller) auftritt und bei gemeinsamer Sorge zugleich das insoweit<br />
„gegnerische“ Kind mit vertreten müsste. Beides verstieße gegen den Grundsatz,<br />
dass in einem Rechtsstreit eine Partei nicht auf beiden Seiten auftreten kann (BGH<br />
NJW 1996, 658). In einem derartigen Fall wird auch nicht etwa der andere Elternteil<br />
als allein zur Vertretung des Kindes befugt angesehen.<br />
Vielmehr ist die Bestellung eines Ergänzungspflegers notwendig.<br />
8. Ab wann beginnt im Fall der Pflegerbestellung die Frist für die Anfechtung<br />
durch das Kind zu laufen?<br />
Da erst mit dem Auftreten des Pflegers im Fall der Befugnis zum aktiven Betreiben<br />
der Anfechtung ein Anfechtungsantrag des Kindes zulässig wird, muss bei einem<br />
Aktivantrag des Kindes der Fristbeginn nach § 1600b Abs. 1 BGB auf den Zeitpunkt<br />
gelegt werden, in welchem der Pfleger Kenntnis von den zur Anfechtung berechti-<br />
genden Umständen hatte (Rechtsgedanke des § 166 Abs. 1 BGB, vgl OLG Köln<br />
FamRZ 2001, 245 = JAmt 2001, 140; OLG Frankfurt 13.09.2001, 1 UF 344/99).<br />
Denn bei der Anfechtungsklage – bzw nunmehr seit 01.09.2009 dem entsprechen-<br />
den Antrag – eines minderjährigen Kindes kommt es für den Beginn der Anfech-<br />
tungsfrist nicht auf die persönliche Kenntnis des Kindes, sondern auf die Kenntnis des-<br />
jenigen gesetzlichen Vertreters an, der befugt ist, das Kind in dem Anfechtungs-<br />
rechtsstreit zu vertreten (vgl zB OLG Nürnberg NJW-RR 1987, 389; OLG Bamberg<br />
FamRZ 1992, 220).<br />
9. Die ursprünglich gegebene gemeinsame Sorge ist seit mehr als zwei Jahren<br />
beendet (durch Übertragung der Alleinsorge auf die Mutter oder durch Tod<br />
des Scheinvaters). Kann durch Bestellung eines Ergänzungspflegers die Frist<br />
erneut in Lauf gesetzt werden?
7<br />
Wenn bereits zuvor das rechtliche Hindernis der gemeinsamen Sorge entfallen war,<br />
weil die Mutter infolge gerichtlicher Übertragung oder aufgrund des Todes des mit-<br />
sorgeberechtigten Vaters die alleinige Sorge hatte, konnte sie in dem entsprechen-<br />
den vorangegangenen Zeitraum das Kind auch allein vertreten. Hat sie in dem mit<br />
Eintritt der Alleinsorge eröffneten Zweijahreszeitraum gem. § 1600b Abs. 1 und 2 BGB<br />
die Anfechtung unterlassen, ist mit Fristablauf auch die Antragsmöglichkeit für das<br />
Kind – bis zum Eintritt seiner Volljährigkeit – entfallen.<br />
Dies kann – entgegen einer verbreiteten irrigen Annahme in der jugendamtlichen<br />
Praxis – auch nicht durch die nachträgliche Bestellung eines Ergänzungspflegers kor-<br />
rigiert werden. Abgesehen davon, dass hierfür bereits die gesetzlichen Voraussetzun-<br />
gen fehlen (vgl § 1909 Abs. 1 BGB), muss der Pfleger die verfahrensrechtliche Situati-<br />
on so aufnehmen, wie er sie bei seiner Bestellung vorfindet. Eine ggf vor der Bestel-<br />
lung bereits abgelaufene Frist für die Anfechtung wird nicht allein dadurch erneut in<br />
Gang gesetzt, dass nunmehr ein Pfleger bestellt wird.<br />
10. Eltern mit gemeinsamer Sorge sind uneinig darüber, ob im Namen des Kindes<br />
die Vaterschaft angefochten werden kann. Das Jugendamt wird zum Ergän-<br />
zungspfleger bestellt. Kann es in dieser Lage einen zulässigen Antrag stellen?<br />
In der hier vorliegenden Konstellation, in welcher die Eltern jedenfalls nicht nach-<br />
weisbar einig über die Anfechtung sind, bedürfte es darüber hinaus einer sorgerecht-<br />
lichen Klärung, ob das Jugendamt als Ergänzungspfleger – im Fall eines ihm konkret<br />
zugewiesenen Wirkungskreises der Anfechtung der Vaterschaft – diesen Antrag stel-<br />
len darf. Nach neuester Rechtsprechung des BGH schließt die Bestellung zum Ergän-<br />
zungspfleger nicht automatisch die Befugnis ein, auch über das Ob der Anfechtung<br />
zu entscheiden, wenn sich die Eltern darüber nicht einig sind.<br />
Hierzu hat der BGH am 18.02.2009 (BGHZ 180, 51 = FamRZ 2009, 861) ausweislich der<br />
Leitsätze 2 und 3 seines Urteils entschieden:<br />
„2. Die Zulässigkeit der Anfechtungsklage des minderjährigen Kindes setzt<br />
die Entscheidung des Inhabers der elterlichen Sorge voraus, dass das Kind<br />
sie erheben soll. Daran fehlt es, solange die gemeinsam sorgeberechtig-<br />
ten Eltern sich nicht einig sind und das Gericht auch nicht auf Antrag des<br />
die Anfechtung befürwortenden Elternteils diesem die Entscheidung ge-
8<br />
mäß § 1628 Abs. 1 Satz 1 BGB übertragen hat (Rn. 28) (Rn. 30) (Rn. 31) (Rn.<br />
33).<br />
3. Bestellt das Gericht (hier: der Rechtspfleger) einen Ergänzungspfleger für<br />
das Kind mit dem Wirkungskreis der Vertretung in einem Anfechtungsver-<br />
fahren des Kindes, ist darin bei gemeinsamem Sorgerecht der Eltern re-<br />
gelmäßig nicht zugleich auch die konkludente Entscheidung zu sehen,<br />
dem anfechtungsunwilligen Elternteil oder gar beiden Eltern insoweit das<br />
Sorgerecht zu entziehen und dem Ergänzungspfleger auch die Entschei-<br />
dung über das "ob" der Anfechtung zu übertragen (Rn. 34) (Rn. 38).“<br />
Wünscht zB der Vater die Anfechtung und ist die Haltung der Mutter hierzu ist nicht<br />
ersichtlich, nachdem diese auf Schreiben des Jugendamts nicht reagiert, kann nicht<br />
davon ausgegangen werden, dass eine einvernehmliche Entscheidung der Eltern<br />
über die Erhebung der Anfechtungsklage im Namen des Kindes vorliegt. Insoweit<br />
müsste entweder dem Vater die Entscheidung nach § 1628 S. 1 BGB übertragen<br />
werden, damit dieser wiederum sein Einverständnis dem Jugendamt als bestelltem<br />
Ergänzungspfleger mitteilt. Oder es müsste von vornherein in dieser Hinsicht beiden<br />
Elternteilen die sorgerechtliche Befugnis, über das Ob eines Anfechtungsantrags zu<br />
entscheiden, entzogen werden.<br />
Zu näheren Einzelheiten wird auf die zitierte BGH- Entscheidung verwiesen.<br />
11. Das Jugendamt ist zum Ergänzungspfleger des Kindes ausschließlich für die<br />
Vertretung in einem Anfechtungsverfahren auf Antrag des Vaters bestellt wor-<br />
den. Kann es seinerseits einen Anfechtungsantrag für das Kind stellen, zB wenn<br />
es erkennt, dass der Antrag des Vaters verspätet gestellt wurde?<br />
Diese Befugnis müsste dem Jugendamt gesondert zugewiesen werden, damit es ei-<br />
nen eigenen Antrag stellen kann. Dieser könnte ggf auch im Wege der „Widerkla-<br />
ge“, nach dem Sprachgebrauch des FamFG des „Widerantrags“ – vgl § 113 Abs. 5<br />
FamFG –, bei Gericht anhängig gemacht werden, solange noch der offenbar we-<br />
gen Verfristung unbegründete Antrag des Vaters nicht zurückgewiesen bzw zurück-<br />
genommen worden ist.
9<br />
Zur Zulässigkeit der Widerklage in dieser Fallkonstellation sei aus einem Beschluss des<br />
OLG BB (FamRZ 2004, 471) zitiert, der noch die Vorschriften der ZPO anführt, jedoch in<br />
der Substanz nach wie vor Gültigkeit haben sollte:<br />
„Allerdings wird im Anwendungsbereich von § 640c Abs. 1 ZPO zum Teil ein<br />
Rechtsschutzbedürfnis für Widerklagen angenommen, deren Streitgegen-<br />
stand mit demjenigen der Klage identisch ist. So wird ausnahmsweise in<br />
Bezug auf die Anfechtung der Vaterschaft nach § 640 Abs. 2 Nr. 2 ZPO ei-<br />
ne Widerklage auch dann zugelassen, wenn der Widerkläger ebenfalls die<br />
Vaterschaft anficht (OLG Köln, NJW 1972, 1721, 1722; Wieczo-<br />
rek/Schütze/Schlüter, a.a.O., § 640c, Rz. 6; Stein/Jonas/Schlosser, a.a.O.,<br />
§ 640c, Rz. 4; MünchKomm/Coester-Waltjen, a.a.O., § 640c, Rz. 6; Mu-<br />
sielak/Borth, ZPO, 3. Auflage, § 640c, Rz. 3; Zöller/Philippi, a.a.O., § 640c,<br />
Rz. 5; Baumbach/Lauterbach/Albers, a.a.O., § 640c, Rz. 2). In einem sol-<br />
chen Fall muss nämlich der Widerkläger vor der Möglichkeit geschützt<br />
werden, dass der Kläger seine Anfechtungsklage zurücknimmt und infolge<br />
Ablaufs der Anfechtungsfrist eine spätere eigenständige Klage des Wider-<br />
klägers nicht mehr in Betracht kommt. Ebenso muss der auf Anfechtung in<br />
Anspruch genommene Beklagte den prozessualen Nachteil ausgleichen<br />
können, der ihn dadurch trifft, dass er mangels Klägereigenschaft der Be-<br />
rücksichtigung anfechtungsfeindlicher Tatsachen gem. § 640d ZPO nicht<br />
widersprechen könnte (OLG Köln, a.a.O.; Wieczorek/Schütze/Schlüter,<br />
a.a.O.; Stein/Jonas/Schlosser, a.a.O.; MünchKomm/Coester-Waltjen,<br />
a.a.O.)“.<br />
Die Formulierung eines derartigen Antrags weist – außer seiner Bezeichnung als Wi-<br />
derantrag – keine Besonderheiten auf. Zweckmäßigerweise sollte unter Hinweis auf<br />
die vorstehenden Argumente dessen Zulässigkeit dargelegt werden.<br />
12. Welche Bedeutung hat das Kindeswohl für eine im Namen des Kindes erhobe-<br />
ne Klage?<br />
a) Die Erhebung der Anfechtungsklage im Namen des Kindes ist nach § 1600b Abs. 4<br />
BGB nur dann zulässig, wenn sie dem Wohl des Vertretenen dient. Wegen der erheb-<br />
lichen Rechtsfolgen der Vaterschaftsanfechtung soll hier eine zusätzliche gerichtliche<br />
Prüfung stattfinden. Da ohnehin das FamG nach § 621 Abs. 1 Nr 10, § 640 Abs. 2 Nr 2
10<br />
ZPO zuständig ist, kann dieses Gericht die erforderliche Prüfung aus eigener Sach-<br />
kunde vornehmen. Ein zusätzliches Genehmigungsverfahren vor dem Vormund-<br />
schaftsgericht, das bis zur Kindschaftsrechtsreform 1998 notwendig war, wurde ent-<br />
behrlich.<br />
Die (Kindes-)Wohlprüfung ist nicht tatbestandliche Voraussetzung der Anfechtungs-<br />
berechtigung des gesetzlichen Vertreters, sondern Klagevoraussetzung (OLG Köln<br />
FamRZ 2001, 245; Rauscher, in: Staudinger, BGB, § 1600b Rn 63). Entspricht die An-<br />
fechtung nicht dem Wohl des Vertretenen oder bleibt diese Frage offen, so ist die<br />
Klage als unzulässig abzuweisen (Wellenhofer, in: MünchKommBGB, 6. Aufl., § 1600b<br />
Rn 14 mwN in Fn 35). Das Gericht entscheidet in diesem Fall nicht in der Sache, also<br />
nicht über die Vaterschaft, sondern trifft lediglich eine Entscheidung über die (aktuel-<br />
len) Auswirkungen eines Anfechtungsverfahrens auf das Wohl des Vertretenen. Eine<br />
erneute Klage zu einem späteren Zeitpunkt bleibt möglich.<br />
b) Zu den Beurteilungsgesichtspunkten führt Wellenhofer aaO Rn 15 f aus (bei der<br />
folgenden Wiedergabe des Zitats wurde von der aufwändigen Einarbeitung der Fuß-<br />
noten mit den jeweiligen Nachweisen abgesehen):<br />
„Bei der Prüfung, ob die Anfechtung dem Wohl des Vertretenen ent-<br />
spricht, erfolgt eine Abwägung der konkreten Vor- und Nachteile, die mit<br />
dem Anfechtungsverfahren für den Vertretenen verbunden sind. Diese<br />
beziehen sich auf die Auswirkungen der Verfahrensdurchführung selbst,<br />
die Erfolgsaussichten des Verfahrens, vor allem aber auf die praktischen<br />
und rechtlichen Vor- und Nachteile der rechtskräftigen Feststellung, dass<br />
die Vaterschaft besteht oder nicht besteht. Die Darlegungs- und Beweis-<br />
last trifft den Anfechtenden.<br />
Bei der Anfechtung in Vertretung des Kindes ist davon auszugehen, dass<br />
im Normalfall ein natürliches Interesse des Kindes an der Feststellung seiner<br />
wirklichen Abstammung besteht. Die Feststellung der blutsmäßigen Ab-<br />
stammung ist gerade auch im Anschluss an die Thesen des BVerfG zum<br />
Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung von besonderem Gewicht,<br />
wenn auch nicht immer ausschlaggebend. Das Kindeswohl kann auch für<br />
die Beibehaltung der bisherigen sozialen Familie und damit gegen die Klä-<br />
rung der wirklichen Abstammung sprechen, insbes. wenn fraglich ist, ob<br />
die Vaterschaft tatsächlich endgültig geklärt werden bzw. keine neue<br />
rechtlich abgesicherte Vater-Kind-Beziehung begründet werden kann.
11<br />
Außerdem sind die Auswirkungen auf den Familienfrieden und die persön-<br />
lichen Beziehungen zwischen Mutter und Kind zu berücksichtigen. Daher<br />
ist auch zu berücksichtigen, ob die Mutter mit der Anfechtung einverstan-<br />
den ist. Besteht jedoch keine sozial-familiäre Beziehung zum Scheinvater,<br />
etwa weil die Ehe der Mutter mit ihm inzwischen aufgelöst ist, und sind so-<br />
mit infolge der Anfechtung keine Nachteile für das Kind zu befürchten, so<br />
genießt das grundrechtlich geschützte Interesse an der Klärung der wirkli-<br />
chen Abstammung Vorrang. Das gilt erst recht dann, wenn mit der Klä-<br />
rung der Abstammung Vorteile, zB Unterhaltsansprüche gegen den wirkli-<br />
chen Vater, verbunden sind. Von Bedeutung sind somit gerade auch die<br />
Aussichten, nach Beseitigung des Vaterschaftstatbestands nach § 1592<br />
Nr. 1 oder 2 einen anderen Mann durch Anerkennung oder gerichtliche<br />
Feststellung als Vater feststellen zu können“.<br />
c) In einem einschlägigen Gutachten-Fall hatte das Institut ausgeführt:<br />
„Im vorliegenden Fall nimmt es das FamG offenbar besonders genau mit<br />
seiner Prüfungspflicht, was ihm grundsätzlich nicht verwehrt werden kann.<br />
Insbesondere ist es nicht möglich, allein mit dem Hinweis auf das Recht<br />
des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung jegliche weitere Prüfung der<br />
Kindeswohldienlichkeit der Anfechtung zu unterbinden. Als Beleg dafür,<br />
dass dieser Gesichtspunkt von besonderem Gewicht, aber nicht immer<br />
ausschlaggebend sei, werden bei Wellenhofer aaO folgende Zitate ange-<br />
führt: „Vgl BayObLG FamRZ 1995, 185 u. FamRZ 1996, 1297; OLG Karlsruhe<br />
FamRZ 1991, 1337, 1339; OLG Hamm FamRZ 1984, 81; LG Berlin DAVorm.<br />
1984, 498, 500; Soergel/Gaul § 1597 aF RdNr. 9; ausdrücklich Coester JZ<br />
1992, 809, 810 in allg. Zusammenhang; s. aber auch LG Frankenthal FamRZ<br />
1983, 733; dem Gesichtspunkt der genetischen Vaterschaft des Anerken-<br />
nenden räumt dagegen den Vorrang ein OLG Köln FamRZ 1974, 266, 267<br />
(m. krit. Anm. Bosch); Staudinger/Rauscher RdNr. 55).<br />
Gleichwohl sollte aus dem Katalog der übrigen Kriterien hier besonders<br />
betont werden, dass die Feststellung des genetischen Vaters möglich ist<br />
(das frühere Abstreiten der Mutter mag durchaus mit der Heftigkeit der<br />
Scheidungsauseinandersetzung erklärt werden) und im Übrigen auch eine<br />
soziale Elternschaft im Rahmen der jetzt bestehenden Ehe mit dem wirkli-<br />
chen Vater zu erwarten ist. Demgegenüber sollten finanzielle Erwägungen
12<br />
wohl zurücktreten. Diese können im Zweifel als Argument für eine Anfech-<br />
tung herangezogen werden, wenn sich die materielle Lage des Kindes<br />
hierdurch bessert. Jedoch erscheint es verfehlt, eine Alternative aufzustel-<br />
len: „armer Vater – wohlhabender Scheinvater“ und im Zweifel die An-<br />
fechtung allein deshalb zu unterlassen.<br />
Zu den eher psychologischen Gesichtspunkten sollte ggf nach Rückspra-<br />
che mit der Mutter der Versuch einer Antwort gefunden werden. Dieser<br />
Prüfpunkt entzieht sich einer allgemeinen Wertung ohne Kenntnis der fami-<br />
liären Gegebenheiten.<br />
Zusammenfassend ist daher festzuhalten: Das FamG nimmt mit der ent-<br />
sprechenden Fragestellung die ihm durch § 1600b Abs. 4 BGB gesetzlich<br />
eingeräumte Befugnis zur Prüfung der Kindeswohldienlichkeit einer An-<br />
fechtung durch den gesetzlichen Vertreter wahr. Dem kann das Jugend-<br />
amt als Ergänzungspfleger nicht grundsätzlich entgegentreten. Es sollte al-<br />
lerdings in der Stellungnahme zu den Fragen des Gerichts durch eine ent-<br />
sprechende Gewichtung der für die Anfechtung sprechenden Gesichts-<br />
punkte seinen Standpunkt verdeutlichen.“<br />
13. Welche Behörden sind zur Anfechtung der Vaterschaft befugt bei einer mut-<br />
maßlich missbräuchlichen Anerkennung aus aufenthaltsrechtlichen Motiven?<br />
Welcher Behörde jeweils diese Aufgabe übertragen wird, ist nach § 1600 Abs. 6 BGB<br />
landesinterner Regelung vorbehalten.<br />
In einer Antwort zu einer Kleinen Anfrage hat die Bundesregierung in BT-Drucks.<br />
17/1096 vom 18.03.2010, 4 zu Frage 6 die jeweils zuständigen Behörden wie folgt auf-<br />
gelistet:<br />
„6. Welche Behörden sind nach Kenntnis der Bundesregierung für die An-<br />
fechtung in den verschiedenen Bundesländern zuständig?<br />
Die anfechtungsberechtigten<br />
Behörden<br />
lassen sich der folgenden<br />
Tabelle entnehmen.<br />
Bundesland<br />
Anfechtungsberechtigte Behörde(n)<br />
Baden-Württemberg Regierungspräsidium Freiburg<br />
Bayern Regierung von Mittelfranken
Berlin Bezirke<br />
Brandenburg Landkreise und kreisfreie<br />
Städte<br />
Bremen Stadtamt Bremen/Magistrat<br />
Bremerhaven<br />
Hamburg Behörde für Inneres<br />
Hessen Regierungspräsidien<br />
Mecklenburg-<br />
Landesamt für innere Verwal-<br />
Vorpommern<br />
tung<br />
Niedersachsen Landkreise und kreisfreie<br />
Städte<br />
Nordrhein-Westfalen Bezirksregierungen Köln und<br />
Arnsberg<br />
Rheinland-Pfalz Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion<br />
Saarland Landesverwaltungsamt<br />
Sachsen Landesdirektionen<br />
Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt<br />
Schleswig-Holstein Landräte der Kreise/Bürgermeister<br />
der kreisfreien<br />
Städte“<br />
13