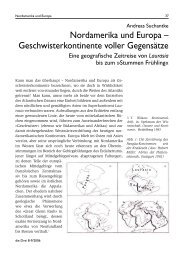Hartmut Traub - Die Drei
Hartmut Traub - Die Drei
Hartmut Traub - Die Drei
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.diedrei.org<br />
<br />
gut begründet behaupten, kommt ihr der anthroposophische<br />
Steiner sehr nahe.<br />
Woods Hinweis auf Steiners Wie erlangt man<br />
Erkenntnisse höherer Welten? (W1, 30) ist in<br />
diesem Zusammenhang deshalb sehr missverständlich.<br />
<strong>Die</strong>ses Buch ist kein »Suchbuch«,<br />
sondern ein »Lehrbuch«. In ihm tritt der Unterschied<br />
zwischen dem Schüler, als dem Suchenden<br />
und Strebenden, und dem Lehrer, als<br />
dem Wissenden und Eingeweihten, klar hervor<br />
(vgl. T, 934ff.).<br />
Im Hinblick auf Woods These vom variablen<br />
Sprachgebrauch und der Multiperspektivität<br />
(W1, 32f.) hat diese Bedeutungsverschiebung<br />
im Gelehrtenideal eine gravierende Konsequenz.<br />
Denn, weil der Gelehrte nach Fichte,<br />
der Eingeweihte bei Steiner, über das Wahrheitswissen<br />
verfügt, kann der von Wood geforderte<br />
freie Sprachgebrauch bei Fichte und Steiner<br />
eine sprachphilosophische »Begriffskunst«<br />
genannt werden. Ohne klare Orientierung und<br />
Begründung des Wissens in der Wahrheit fehlt<br />
der Sprache und auch der Perspektive das entscheidende<br />
Kriterium für ein Urteil über eine<br />
entweder angemessene oder weniger angemessene<br />
Rede oder über eine umfassende oder verkürzte<br />
Ansicht der Dinge. Dichtung und Wissenschaft<br />
beziehen die Überzeugungskraft ihrer<br />
Sprache aus ihrer Begründung in der Wahrheit.<br />
Ohne diesen Bezug bleiben sie Glasperlenspiele<br />
oder hypothetische Spekulation.<br />
Ich bin deshalb von Woods These nicht überzeugt,<br />
dass es das »Ideal« des Wahrheitsstrebens<br />
war, das Steiner bei Fichte angezogen hat.<br />
Meines Erachtens ist es Fichtes Konzept eines<br />
wahrheitsbegründeten Gelehrtentums, das sich<br />
der Idee einer ganzheitlichen Bildung verpflichtet<br />
weiß, worin Steiner das »Ideal« gesehen hat,<br />
dem er nachzueifern sich als junger Mann entschlossen<br />
hatte (vgl. T, u.a. 32).<br />
<br />
<br />
Der zweite Kritikpunkt im ersten Teil seines Essays<br />
betrifft das Problem der »retrospektiven<br />
Interpretation«. Wood glaubt in meiner eigenen<br />
Argumentation den Fehler entdecken zu können,<br />
den ich der anthroposophischen Steinerdeutung<br />
vorwerfe, nämlich Steiners frühe philosophischen<br />
Schriften im Licht der späteren<br />
Anthroposophie auszulegen (W1, 38). Woods<br />
Kritik stützt sich darauf, dass ich sowohl Steiners<br />
späte Urteile über die Bedeutung Fichtes<br />
für seinen eigenen philosophischen Werdegang<br />
als auch Steiners späte Urteile über seine religiöse<br />
Prägung sozusagen als biografische Tatsachen<br />
verstehe, obwohl sie sich auf Aussagen<br />
Steiners aus Mein Lebensgang (1923-25) stützen.<br />
Für die Kritik an meiner vermeintlich retrospektiven<br />
Interpretation bezieht sich Wood<br />
zum einen auf die Fußnote 329 auf der Seite<br />
530f. und zum anderen auf das Kapitel 9.2.2<br />
im dritten Teil meines Buches. In beiden Fällen<br />
handelt es sich aber nicht um eine retrospektive<br />
Interpretation. Denn im ersten Fall beruhen<br />
meine Analysen nicht allein auf Steiners<br />
Bekenntnissen aus Mein Lebensgang, sondern<br />
an vielen Stellen wird auf den Briefwechsel<br />
Steiners verwiesen, der belegt, dass das, was<br />
Steiner später über sein Verhältnis zu Fichte<br />
geurteilt hat, mit dem übereinstimmt, was er<br />
auch damals, in den frühen 1880er Jahren, geschrieben<br />
hat.<br />
Was die religiöse Sozialisation Steiners betrifft,<br />
geht auch hier der Vorwurf retrospektiver Interpretation<br />
ins Leere. Denn es gibt kaum authentische<br />
Quellen, die mittels retrospektiver<br />
Interpretation umgedeutet werden könnten.<br />
Hier sind wir weitgehend auf Steiners eigene<br />
Lebenserinnerungen angewiesen. Meine Arbeit<br />
zum Kapitel 9.2.2 in Teil 3 bestand nicht in der<br />
Interpretation, sondern in der Ausleuchtung<br />
des von Steiner übermittelten Sozialisationskontextes.<br />
Hier geht es nicht um retrospektive<br />
Interpretation, sondern um eine umfassendere<br />
Würdigung dessen, was Steiner uns über seine<br />
Kindheit mitgeteilt hat. Meine Kritik an der<br />
anthroposophischen Lesart der einschlägigen<br />
Passagen aus Mein Lebensgang besteht darin,<br />
dass sie diese einseitig rezipiert (T, 793ff.). Im<br />
Übrigen halte ich meine Lesart der religiösen<br />
Sozialisation Steiners für »anthroposophiekompatibler«<br />
als die gängige Auffassung vom<br />
technikvernarrten und liberalistisch erzogenen<br />
jungen Steiner. Denn aus meiner Auffassung<br />
<br />
<br />
Printausabe bestellen: www.diedrei.org/bestellung/einzelheft/index.php