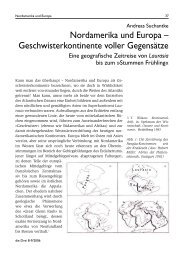Hartmut Traub - Die Drei
Hartmut Traub - Die Drei
Hartmut Traub - Die Drei
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.diedrei.org<br />
<br />
renommierten Steiner-Forschern (Lindenberg/<br />
Zander) ignorierte Bekenntnis Steiners zu I. H.<br />
Fichte einzusetzen (T, 901f.). Ehret wird von<br />
mir als die löbliche Ausnahme geschätzt, von<br />
der aus eine Grundlegung der Anthroposophie<br />
aus dem Geist der Philosophie I. H. Fichtes<br />
nachvollzogen werden kann (T, 974).<br />
Mit Bezug auf Aristoteles und Thomas von Aquin<br />
kritisiert Wood: »<strong>Traub</strong>s Studie zu den Wurzeln<br />
der Anthroposophie reicht jedoch nur bis zu<br />
I. H. Fichte und Troxler und verzichtet völlig<br />
auf eine Diskussion dieser beiden frühen Denker«<br />
(W2, 49). Wer sich die Mühe macht, über<br />
das Namensregister meines Buches die Stellen<br />
aufzusuchen, an denen ich auf Aristoteles<br />
und Thomas mit Bezug auf die Entstehungsgeschichte<br />
der Anthroposophie eingehe, wird<br />
feststellen, dass dies bereits ausdrücklich im<br />
Vorwort geschieht (vgl. T, 22). Darüber hinaus<br />
wird zu Thomas und »Steiners Neugründung<br />
der Theologie/Theosophie« mit einigen anthroposophischen<br />
Autoren eine ausführliche Diskussion<br />
über diesen epochalen theologischen<br />
Anspruch geführt (T, 857ff.). Dass ich auf eine<br />
Diskussion über die Bedeutung von Aristoteles<br />
und Thomas im Blick auf die Grundlegung von<br />
Steiners Anthroposophie »völlig verzichtet«<br />
hätte, kann man wohl nicht behaupten. Was<br />
die Textstelle betrifft, auf die sich Wood bezieht,<br />
so ist festzustellen, dass auch an ihr eine<br />
Fundamentalkritik des »völligen Verzichts« auf<br />
Aristoteles und Thomas nicht angebracht ist.<br />
Denn auf derselben Seite, auf der der Satz steht,<br />
den Wood gegen mich verwendet, wird sowohl<br />
der Einfluss »nichtphilosophischer, das heißt<br />
mystischer und esoterischer, europäischer wie<br />
asiatischer Quellen auf die spezifische Ausprägung<br />
der Anthroposophie Steiners« als auch<br />
die Bedeutung von Aristoteles und Thomas<br />
von Aquin erwähnt: »Für die Beurteilung von<br />
Steiners Anthroposophie als philosophische<br />
Position sind sie [Aristoteles und Thomas von<br />
Aquin] – etwa was den Aufbau der Seelenlehre<br />
oder die Theorie von Form und Materie betrifft<br />
– gleichwohl wichtige Referenzpunkte« (T,<br />
905). Woods Kritik, ich hätte auf die Einbettung<br />
der in die europäische und asiatische Geistesgeschichte<br />
sowie auf die spezifischen Referenzen<br />
zu Aristoteles und Thomas »völlig verzichtet«,<br />
halte ich daher für ziemlich überzogen.<br />
Ernst Haeckel: Zu Beginn des zweiten Teils<br />
seines Essays trägt Wood seine Einschätzung<br />
zu Steiners »originellster und dauerhaftesten<br />
philosophischen Errungenschaft« vor. <strong>Die</strong>se<br />
besteht nach Wood darin, Haeckels »materialistische<br />
Evolutionstheorie« mit der »idealistischen<br />
Philosophie von menschlicher Freiheit<br />
und Moral« in Einklang gebracht zu haben (W2,<br />
47). Auf dieses Argument kann ich mich an<br />
dieser Stelle nicht ausführlich einlassen. Dass<br />
ich starke Bedenken gegen die »Krönungszeremonie«<br />
habe, der zufolge Steiners ethischer Individualismus<br />
die Krone dessen sein soll, was<br />
die Evolutionstheorie Darwins und Haeckels<br />
für die Naturwissenschaften angestrebt haben<br />
(GA 4, 200), 4 ist im Kapitel 7.6 des dritten Teils<br />
meines Buches unter dem Titel »<strong>Die</strong> Philosophie<br />
der Freiheit am Abgrund« (T, 766ff.) ausgeführt.<br />
Entscheidend ist Woods Kritik an meiner<br />
»unbegründeten Spekulation« (W2, 48), nämlich,<br />
dass sich Steiner mit seiner Philosophie<br />
der Freiheit dem Haeckelschen Materialismus<br />
auch deswegen angenähert habe, weil er sich<br />
von dem berühmten Professor Unterstützung<br />
für die eigene akademische Karriere versprach.<br />
Wood behauptet nun, es existiere für diese<br />
These keinerlei »Textgrundlage und <strong>Traub</strong> liefert<br />
auch keine« (W2). Zunächst einmal gilt es<br />
festzuhalten, dass ich nicht behauptet habe,<br />
Steiners Karrieredenken sei das einzige Motiv<br />
für seine Annäherung an Haeckel (vgl. T, 792).<br />
Den Vorwurf, dass es für die Stützung dieser<br />
karrierestrategischen Seite der Beziehung von<br />
Steiner zu Haeckel keine Textgrundlage gäbe,<br />
wie Wood behauptet, kann ich nicht nachvollziehen.<br />
Denn, wie ich im Text (S. 792) belege,<br />
bringt Steiner in seinem Brief vom 21. März<br />
1894 5 gegenüber Pauline Specht nicht allein seine<br />
Hoffnung zum Ausdruck, dass er im Kampf<br />
gegen religiöse Vorurteile, sondern dass er auch<br />
persönlich, mit seinen »eigenen Bestrebungen«,<br />
4 GA 4: Rudolf Steiner: <strong>Die</strong> Philosophie der Freiheit<br />
(1894/1918; GA 4), Dornach 1995.<br />
5 Rudolf Steiner: Briefe Band II: 1890-1925 (GA 39),<br />
Dornach 1987, S. 207ff.<br />
<br />
<br />
Printausabe bestellen: www.diedrei.org/bestellung/einzelheft/index.php