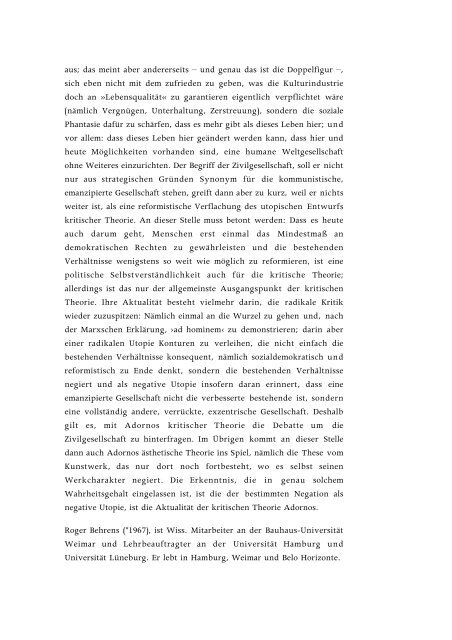Vier Fragen zu Th. W. Adorno - Roger Behrens
Vier Fragen zu Th. W. Adorno - Roger Behrens
Vier Fragen zu Th. W. Adorno - Roger Behrens
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
aus; das meint aber andererseits – und genau das ist die Doppelfigur –,<br />
sich eben nicht mit dem <strong>zu</strong>frieden <strong>zu</strong> geben, was die Kulturindustrie<br />
doch an »Lebensqualität« <strong>zu</strong> garantieren eigentlich verpflichtet wäre<br />
(nämlich Vergnügen, Unterhaltung, Zerstreuung), sondern die soziale<br />
Phantasie dafür <strong>zu</strong> schärfen, dass es mehr gibt als dieses Leben hier; und<br />
vor allem: dass dieses Leben hier geändert werden kann, dass hier und<br />
heute Möglichkeiten vorhanden sind, eine humane Weltgesellschaft<br />
ohne Weiteres ein<strong>zu</strong>richten. Der Begriff der Zivilgesellschaft, soll er nicht<br />
nur aus strategischen Gründen Synonym für die kommunistische,<br />
emanzipierte Gesellschaft stehen, greift dann aber <strong>zu</strong> kurz, weil er nichts<br />
weiter ist, als eine reformistische Verflachung des utopischen Entwurfs<br />
kritischer <strong>Th</strong>eorie. An dieser Stelle muss betont werden: Dass es heute<br />
auch darum geht, Menschen erst einmal das Mindestmaß an<br />
demokratischen Rechten <strong>zu</strong> gewährleisten und die bestehenden<br />
Verhältnisse wenigstens so weit wie möglich <strong>zu</strong> reformieren, ist eine<br />
politische Selbstverständlichkeit auch für die kritische <strong>Th</strong>eorie;<br />
allerdings ist das nur der allgemeinste Ausgangspunkt der kritischen<br />
<strong>Th</strong>eorie. Ihre Aktualität besteht vielmehr darin, die radikale Kritik<br />
wieder <strong>zu</strong><strong>zu</strong>spitzen: Nämlich einmal an die Wurzel <strong>zu</strong> gehen und, nach<br />
der Marxschen Erklärung, ›ad hominem‹ <strong>zu</strong> demonstrieren; darin aber<br />
einer radikalen Utopie Konturen <strong>zu</strong> verleihen, die nicht einfach die<br />
bestehenden Verhältnisse konsequent, nämlich sozialdemokratisch und<br />
reformistisch <strong>zu</strong> Ende denkt, sondern die bestehenden Verhältnisse<br />
negiert und als negative Utopie insofern daran erinnert, dass eine<br />
emanzipierte Gesellschaft nicht die verbesserte bestehende ist, sondern<br />
eine vollständig andere, verrückte, exzentrische Gesellschaft. Deshalb<br />
gilt es, mit <strong>Adorno</strong>s kritischer <strong>Th</strong>eorie die Debatte um die<br />
Zivilgesellschaft <strong>zu</strong> hinterfragen. Im Übrigen kommt an dieser Stelle<br />
dann auch <strong>Adorno</strong>s ästhetische <strong>Th</strong>eorie ins Spiel, nämlich die <strong>Th</strong>ese vom<br />
Kunstwerk, das nur dort noch fortbesteht, wo es selbst seinen<br />
Werkcharakter negiert. Die Erkenntnis, die in genau solchem<br />
Wahrheitsgehalt eingelassen ist, ist die der bestimmten Negation als<br />
negative Utopie, ist die Aktualität der kritischen <strong>Th</strong>eorie <strong>Adorno</strong>s.<br />
<strong>Roger</strong> <strong>Behrens</strong> (*1967), ist Wiss. Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität<br />
Weimar und Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg und<br />
Universität Lüneburg. Er lebt in Hamburg, Weimar und Belo Horizonte.