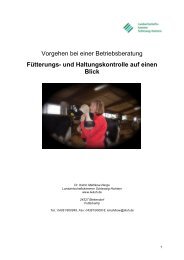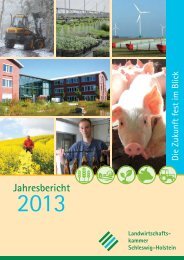Impfstoff PregSureBVD bestätigt Ausmerzung mittels Impfung
Impfstoff PregSureBVD bestätigt Ausmerzung mittels Impfung
Impfstoff PregSureBVD bestätigt Ausmerzung mittels Impfung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
42 Tier BAUERNBLATT l 11. Januar 2014 ■<br />
Tödliche Krankheit Blutschwitzen<br />
<strong>Impfstoff</strong> <strong>PregSureBVD</strong> <strong>bestätigt</strong><br />
Das Bundesministerium für Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutzhatindenvergangenen<br />
drei Jahren ein Forschungsprojekt<br />
an den tiermedizinischen Hochschulen<br />
in Berlin, Gießen, Hannover<br />
und München gefördert. Unter<br />
demTitel„Ursachenermittlungder<br />
Bovinen Neonatalen Pancytopenie“<br />
wurde jetzt der Abschlussbericht<br />
im Internet veröffentlicht.<br />
Seit 2007 ist das Krankheitsbild in<br />
Europa bekannt. In der Folge hat das<br />
Pharmaunternehmen Pfizer (jetzt Zoetis)<br />
2010 den <strong>Impfstoff</strong> vom Markt<br />
genommen. Im Jahre 2011 traten<br />
auch erste Fälle in Neuseeland auf,<br />
woraufhin auch hier der <strong>Impfstoff</strong>verkauf<br />
gestoppt wurde. Die Erkrankung<br />
zeigt sich bei Kälbern innerhalb<br />
der ersten drei Lebenswochen durch<br />
Schwäche und sichtbare Blutungen<br />
(„Blutschwitzen“) auf der Haut. Die<br />
betroffenen Kälber verbluten innerhalb<br />
weniger Tage und eine Therapie<br />
bringt nur sehr selten Heilung.<br />
Auslöser<br />
<strong>Impfstoff</strong>zusammensetzung<br />
Das jetzt veröffentlichte Forschungsprojekt<br />
unter der Leitung<br />
von Prof. Klaus Doll von der Justus-<br />
Liebig-Universität Gießen kommt zu<br />
dem Schluss, dass der <strong>Impfstoff</strong>Preg-<br />
SureBVD ursächlich für das Krankheitsbild<br />
bei den Kälbern verantwortlich<br />
ist. Dabei konnten die Forscher<br />
unter anderem zeigen, dass<br />
Die Erkrankung zeigt sich bei Kälbern<br />
in den ersten drei Lebenswochen.<br />
Foto: Dr.Mark Holsteg<br />
der <strong>Impfstoff</strong>neben dem erwünschten<br />
BVD-Virus auch fremde Rinderzellen<br />
enthält. Die Rinderzellen<br />
stammen von der Zellkultur, die für<br />
die Vermehrung des Virus bei der<br />
Herstellung notwendig ist. Durch die<br />
<strong>Impfung</strong> wurden die Rinder nicht<br />
nur gegen BVD immunisiert, sondern<br />
auch gegen die Rinderzellen<br />
aus der Zellkultur. Geimpfte Tiere<br />
zeigen selbst keine Krankheitserscheinungen,<br />
aber sie verfügen über<br />
unerwünschte Antikörper (Abwehrstoffe)<br />
gegen fremde Rinderzellen.<br />
Geimpfte Muttertiere übertragen<br />
diese unerwünschten Antikörper<br />
auf das Kalb und können damit das<br />
Krankheitsbild des Blutschwitzens<br />
auslösen. Ob die Krankheit ausbricht,<br />
hängt in erster Linie vom<br />
„Verwandtschaftsgrad“ von Kalb<br />
und Mutter beziehungsweise Vater<br />
und der Zellen aus der Zellkultur ab.<br />
Blutzellen<br />
werden zerstört<br />
Bei erkrankten Kälbern fehlen<br />
die für die Blutgerinnung erforderlichen<br />
Blutplättchen (Thrombozyten).<br />
Die über das Kolostrum von<br />
der Mutter aufgenommenen Antikörper<br />
führen zu einer Zerstörung<br />
der Blutplättchen und der blutbildenden<br />
Zellen im Knochenmark.<br />
Durch die Schädigung des Knochenmarks<br />
ist nicht nur die Produktion<br />
der Blutplättchen gestört, sondern<br />
auch weiße Blutzellen (Leukozyten)<br />
werden nicht mehr in ausreichender<br />
Menge gebildet. Ohne weiße<br />
Blutzellen ist der gesamte Organismus<br />
immungeschwächt und damit<br />
einer erhöhten Infektionsgefahr<br />
ausgesetzt. Daher müssen in Preg-<br />
SureBVD geimpften Herden häufiger<br />
Behandlungen bei den Kälbern<br />
durchgeführt werden. Dies wurde<br />
durch die Arbeitsgruppe aus München<br />
beschrieben und <strong>bestätigt</strong><br />
auch die Erfahrungen aus dem Versuchs-<br />
und Bildungszentrum Landwirtschaft<br />
Haus Riswick der Landwirtschaftskammer<br />
NRW.<br />
Verwendung<br />
von Kolostrum<br />
Auch drei Jahre nach dem Verbot<br />
des <strong>Impfstoff</strong>es treten immer noch<br />
Fälle auf. Betroffen sind Kälber von<br />
alten geimpften Kühen. Daher<br />
muss in <strong>PregSureBVD</strong> geimpften<br />
Betrieben weiterhin das Kolostrum<br />
geimpfter Kühe verworfen werden,<br />
um die Kälber vor der Erkrankung<br />
zu schützen. Geimpfte Kühe produzieren<br />
wahrscheinlich lebenslänglich<br />
gefährliches Kolostrum.<br />
Schadensersatz<br />
für Kälberverluste<br />
Betroffene Betriebe sollten Ihre<br />
Schäden noch bis Ende des Jahres<br />
bei Zoetis (Pfizer) geltend machen,<br />
um einer möglichen Verjährung<br />
der Schadensersatzansprüche vorzubeugen.<br />
Durch einen Beitritt<br />
in die Interessengemeinschaft<br />
Blutschwitzer (Internet: www.igblutschwitzer.de)<br />
können berechtigte<br />
Ansprüche gebündelt und<br />
geltend gemacht werden. Durch<br />
das jetzt veröffentlichte Gutachten<br />
der Bundesanstalt für Landwirtschaft<br />
und Ernährung sind die<br />
Chancen gegenüber dem Hersteller<br />
einen finanziellen Ausgleich<br />
durchzusetzen sehr gut. Es sollten<br />
dabei nicht nur die Kälberverluste,<br />
sondern auch Mehraufwendungen<br />
für Betreuung und Behandlung<br />
eingebracht werden.<br />
Der gesamte Projektbericht ist im<br />
Internet auf der Homepage des BLE<br />
einzusehen unter: http://down<br />
load.ble.de/09HS025/index.html<br />
Dr. Mark Holsteg<br />
Fachtierarzt für Rinder und<br />
Zuchthygiene<br />
Tel.: 02 28-703-23 32<br />
Mark.Holsteg@lwk.nrw.de<br />
Entstehung, Bekämpfung und Ausblick in puncto Blauzungenkrankheit<br />
<strong>Ausmerzung</strong> <strong>mittels</strong> <strong>Impfung</strong><br />
VorfünfJahrenhatdieBlauzungenkrankheit<br />
für Verunsicherung auch<br />
inhiesigenRinder-undSchafbetrieben<br />
gesorgt. Heute ist sie kein Thema<br />
mehr.Wir blicken zurück auf die<br />
Behandlungsstrategie.<br />
Blauzungenkrankheit trat erstmals<br />
am 21. August 2006 in Deutschland,<br />
nahezu zeitgleich mit den ersten Ausbrüchen<br />
in Belgien und den Niederlanden,<br />
auf. Weitergehende Untersuchungen<br />
zeigten, dass es sich um den<br />
Serotyp 8(BTV-8) handelte. Vordem<br />
Hintergrund westlicher Windrichtungen<br />
breitete sich die Seuche rasch in<br />
östliche Richtung aus mit dem Ergebnis,<br />
dass im Jahr 2008 weite Teile<br />
Deutschlands betroffen waren. Die<br />
klassischen Methoden der Tierseuchenbekämpfung<br />
waren vor dem<br />
Hintergrund der Insektenübertragung<br />
der Tierseuche wenig hilfreich;<br />
die Ausbreitungsgeschwindigkeit<br />
konnte durch Verbringungsbeschränkungen<br />
lediglich verlangsamt,<br />
jedoch nicht entscheidend beeinflusst<br />
werden. Zugelassene <strong>Impfstoff</strong>e<br />
standen (noch) nicht zur Verfügung.<br />
Über einen groß angelegten<br />
Feldversuch konnte mit drei „Prototypen“<br />
in Rind und Schaf gezeigt<br />
werden, dass sie sowohl wirksam als<br />
auch unschädlich waren. Folgerichtig<br />
wurde mit einer Ausnahmegenehmigung<br />
des Bundesministeriums für Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
ermöglicht, diese<br />
nicht zugelassenen <strong>Impfstoff</strong>e anzuwenden.<br />
Groß angelegte Impfkampagnen<br />
starteten im Mai 2008 (<strong>Impfung</strong><br />
aller Rinder,Schafe und Ziegen).<br />
In der Folge gingen die Ausbruchszahlen<br />
drastisch zurück. 2009 wurde<br />
letztmalig flächendeckend geimpft,<br />
ab 2010 konnten die Tierhalter freiwillig<br />
weiter impfen. Durch intensive<br />
Untersuchungen (serologisch, PCR)<br />
konnte in den Jahren 2010 und 2011<br />
gezeigt werden, dass BTV-8 nicht<br />
mehr in der Nutztierpopulation zirkuliert.<br />
Deutschland hat sich mit Wirkung<br />
vom 15. Februar 2012 nach Artikel<br />
8.3.3 des Tiergesundheitskodex<br />
der Weltorganisation für Tiergesundheit<br />
frei von BTV-8 erklärt.
■ BAUERNBLATT l 11. Januar 2014<br />
Tier<br />
43<br />
Blauzungenkrankheit wurde in<br />
Mittel-und Nordeuropa als eine Tierseuche<br />
angesehen, die primär in<br />
warmen Klimazonen auftritt. Als<br />
BTV-8 erstmals 2006 in Deutschland<br />
festgestellt wurde, zeigte sich sehr<br />
schnell, dass mit den „klassischen<br />
Methoden“ der Tierseuchenbekämpfung<br />
eine Tilgung nicht zu erreichen<br />
war. Vor dem Hintergrund,<br />
dass der für die Übertragung in<br />
Deutschland verantwortliche Vektor<br />
unbekannt war und <strong>Impfstoff</strong>e nicht<br />
zur Verfügung standen, schien auch<br />
insoweit eine Tilgung in weiter Ferne.<br />
Mit der Durchführung eines entomologischen<br />
Monitorings und<br />
den Anstrengungen der pharmazeutischen<br />
Industrie, innerhalb von<br />
kurzer Zeit <strong>Impfstoff</strong>e zur Verfügung<br />
zu stellen, erschien eine Tilgung<br />
realistisch.<br />
Beobachtung<br />
der Krankheitsübertragung<br />
BTV-8 traf Deutschland im August<br />
2006 unvorbereitet. Insbesondere<br />
war nicht bekannt, welche Insekten<br />
in Mittel-/Nordeuropa und insbesondere<br />
in Deutschland in der Lage sind,<br />
den Erreger zu übertragen, denn die<br />
in Afrika überwiegend verantwortliche<br />
Gnitze „Culicoides imicola“ ist<br />
auf dem europäischen Kontinent<br />
nicht heimisch. Insoweit wurde in<br />
2007 und 2008 ein groß angelegtes<br />
entomologisches Monitoring durchgeführt.<br />
Zwischen Mai 2007 und<br />
April 2008 wurden in den primär von<br />
der Tierseuche betroffenen Landesteilen<br />
89 Fallen aufgestellt (Abbildung<br />
1), die gefangenen Gnitzen<br />
gezählt und anhand ihrer Flügelzeichnung<br />
in Culicoides obsoletus, C.<br />
pulicaris und andere C. subspezies<br />
differenziert.<br />
Ergebnis dieses Monitorings war,<br />
dass<br />
● eine vektorfreie Periode nicht<br />
existiert (->dies war für die Bekämpfung<br />
von Bedeutung, da zu verbringende<br />
empfängliche Tiere auch in<br />
der kalten Jahreszeit (der vermeintlichen<br />
vektorfreien Zeit) vor dem<br />
Verbringen untersucht werden<br />
mussten),<br />
● die differenzierten Gnitzen überwiegend<br />
dem C. obsoletus-Komplex<br />
zuzuordnen waren, gefolgt vom C.<br />
pulicaris-Komplex.<br />
Aus den einzelnen C.-Komplexen<br />
wurden bis zu 50 Gnitzen gepoolt<br />
und am Nationalen Referenzlabor<br />
für Blauzungenkrankheit am Friedrich-Loeffler-Institut<br />
(Mecklenburg-<br />
Vorpommern) <strong>mittels</strong> PCR auf BTV-8<br />
untersucht. Insgesamt wurden etwa<br />
25.000 Pools untersucht, davon 585<br />
Pools mit positivem Ergebnis. Von<br />
Für Menschen besteht keine Gefahr der Ansteckung durch Fleisch und Milch –<br />
bei diesen gesunden Spitzenkühen schon gar nicht.<br />
diesen 585 Pools konnten 562 Pools<br />
aus dem C. obsoletus-Komplex, 16<br />
Pools aus dem C. pulicaris-Komplex<br />
und sieben Pools anderen C.-Komplexen<br />
zugeordnet werden. 401 der<br />
585 positiven Pools stammten von<br />
Gnitzen, die im Oktober gefangen<br />
worden sind (ein Pool positiv im Juni,<br />
zwei im Juli, 26 im August, 133 im<br />
September und immerhin noch 22<br />
Pools von im November gefangenen<br />
Gnitzen).<br />
Durch dieses Monitoring wurde<br />
ein Überblick erlangt über die in<br />
Abbildung 1: Geographische Stationierung der Fallen<br />
(rote Punkte); blauschraffierte Fläche stellt die Ausdehnung der BTV Anfang<br />
2007 dar (Quelle: Friedrich-Loeffler-Institut)<br />
Deutschland für die Übertragung<br />
der BTV-8 verantwortlichen Gnitzen.<br />
Trotz dieses Wissens war es aussichtslos,<br />
die Brutgebiete und damit die<br />
Vermehrung der Gnitzen einzudämmen.<br />
Die Bekämpfungsstrategie<br />
musste also an anderer Stelle ansetzen,<br />
denn auch die „klassischen“<br />
Methoden der Tierseuchenbekämpfung<br />
(Untersuchung und Tötung<br />
und unschädliche Beseitigung bei<br />
positiven Ergebnissen) waren nicht<br />
geeignet, die Seuche zu tilgen. Andererseits<br />
konnte man auch nicht<br />
auf ein „spontanes Verschwinden“<br />
des Erregers hoffen; zudem sprachen<br />
auch Tiergesundheits- und Tierschutz-<br />
sowie insbesondere auch<br />
Handelsgesichtspunkte gegen ein<br />
Abwarten.<br />
Entwicklung<br />
eines <strong>Impfstoff</strong>es<br />
Zugelassene <strong>Impfstoff</strong>e gegen<br />
BTV-8 standen nicht zur Verfügung.<br />
Gleichwohl arbeiteten verschiedene<br />
Tierimpfstoffhersteller mit Hochdruck<br />
an der Entwicklung einer entsprechenden<br />
Vakzine. Im Jahr 2008<br />
waren die <strong>Impfstoff</strong>e noch nicht zulassungsreif,<br />
aber im Labormaßstab<br />
soweit geprüft, dass sie wirksam und<br />
unschädlich schienen. Da aber eine<br />
Tilgung nur mit einer großangelegten<br />
Impfkampagne, in die alle empfänglichen<br />
Tiere einbezogen werden<br />
mussten, zu erreichen war und<br />
eine derartige Impfkampagne mit<br />
nicht zugelassenen <strong>Impfstoff</strong>en,<br />
nicht zuletzt auch wegen möglicher<br />
Schadenersatzansprüche, zu problematisch<br />
erschien, wurde unter wissenschaftlicher<br />
Federführung des<br />
nationalen Referenzlabors in MV ein<br />
Impfversuch durchgeführt. In den<br />
Versuch wurden 893 Rinder eines Betriebes<br />
und 1.132 Schafe aus zwei<br />
Betrieben einbezogen. Jeweils ein<br />
Drittel der Tiere wurde mit jeweils einem<br />
der drei zur Verfügung stehenden<br />
<strong>Impfstoff</strong>e geimpft. Die Rinder<br />
wurden grundimmunisiert (zwei Applikationen<br />
im Abstand von 21 bis 28<br />
Tagen). Drei Wochen nach der<br />
Grundimmunisierung wurden die<br />
Tiere geblutet und auf Antikörper<br />
gegen BVT-8 untersucht: mehr als<br />
95 %der Rinder hatten BVT-8-spezifische<br />
Antikörper entwickelt. Impfreaktionen<br />
gingen nicht über solche<br />
hinaus, die auch bei anderen <strong>Impfung</strong>en<br />
beobachtet wurden. Um<br />
nachzuweisen, ob die Tiere auch gegen<br />
eine BTV-8-Infektion geschützt<br />
sind, wurden aus jeder Impfgruppe<br />
jeweils sechs Rinder sowie jeweils<br />
sechs naive sero-negative Rinder als<br />
Kontrolltiere mit dem BTV-8 infiziert<br />
mit dem Ergebnis, dass alle geimpf-
44 Tier BAUERNBLATT l 11. Januar 2014 ■<br />
Auch kleine Wiederkäuer waren stark betroffen.<br />
Fotos: Isa-Maria Kuhn<br />
ten Rinder nicht nur nicht geschützt<br />
waren, sondern zudem auch keine<br />
Virämie entwickelten und insoweit<br />
auch kein BTV ausgeschieden wurde.<br />
Die Kontrolltiere zeigten typische<br />
klinische Symptomatik und<br />
schieden den Erreger aus.<br />
Die Situation bei den Schafen stellte<br />
sich vergleichbar dar. Auch hier<br />
wurde jeweils ein Drittel der Tiere<br />
mit jeweils einem der in Rede stehenden<br />
<strong>Impfstoff</strong>e geimpft. Im Unterschied<br />
zu den Rindern wurde der<br />
Merial-<strong>Impfstoff</strong> und der <strong>Impfstoff</strong><br />
der Firma CZ Veterinaria als Grundimmunisierung<br />
nur einmal verabreicht,<br />
der <strong>Impfstoff</strong>von Fort Dodge<br />
wurde zweimal im Abstand von 21<br />
bis 28 Tagen appliziert. Drei Wochen<br />
nach Abschluss der Grundimmunisierung<br />
wurden die Schafe geblutet<br />
mit dem Ergebnis, dass die Serokonversionsrate<br />
bis zu 100 %betrug, eine<br />
zweimalige Applikation (Fort<br />
Dodge) eine höhere Antikörperprävalenz<br />
erzielte, die Impfreaktionen<br />
denen entsprachen, die auch bei anderen<br />
<strong>Impfung</strong>en zu beobachten<br />
sind.<br />
Wie beim Rind auch wurden jeweils<br />
sechs seropositive Schafe aus<br />
jeder Impfgruppe mit dem BTV infiziert;<br />
bis auf ein Schaf waren alle Tiere<br />
gegen die Infektion geschützt<br />
und schieden kein BTV aus. Warum<br />
ein Tier nicht geschützt war,ließ sich<br />
nicht klären; möglicherweise wurde<br />
der <strong>Impfstoff</strong> „in die Wolle“ appliziert.<br />
Die infizierten Kontrolltiere erkrankten<br />
mit BTV-typischen Symptomen<br />
bei gleichzeitiger Virusausscheidung.<br />
Die Ergebnisse dieses Feldversuches<br />
zeigten, dass die noch nicht zugelassenen<br />
drei BTV-8-<strong>Impfstoff</strong>e<br />
hochwirksam und zudem sicher waren.<br />
Dieser Umstand führte dazu,<br />
dass das Bundesministerium für Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Forsten<br />
im Rahmen einer Ausnahmeregelung<br />
die Anwendung der drei nicht<br />
zugelassenen BTV-8-<strong>Impfstoff</strong>e ermöglichte.<br />
In die Ausnahme wurde<br />
auch der BTV-8-<strong>Impfstoff</strong> der Firma<br />
Intervet einbezogen, der in den Niederlanden<br />
im Feldversuch getestet<br />
worden ist. Folglich begann im Mai<br />
2008 eine verpflichtende <strong>Impfung</strong> aller<br />
Rinder, Schafe und Ziegen, ungeachtet<br />
der Tatsache, dass ein Teil der<br />
zu impfenden Tiere bereits durch eine<br />
Infektion immun war. Insgesamt<br />
wurden in 2008 etwa 10,6 Mio. Rinder<br />
(Gesamtpopulation 12,9 Mio. Rinder),<br />
2,6 Mio. Schafe (Gesamtpopulation<br />
etwa 3Mio. Schafe) und<br />
0,16 Mio. Ziegen (Gesamtpopulation<br />
etwa 0,2 Mio. Ziegen) sowie auf freiwilliger<br />
Basis etwa 55.500 Stück Gatterwild<br />
gegen BTV-8 geimpft. Die verpflichtende<br />
<strong>Impfung</strong> wurde 2009<br />
fortgesetzt und bezog sich insbesondere<br />
auf die nachgeborenen Tiere,<br />
denn es konnte gezeigt werden, dass<br />
die Antikörperpräsenz nach der<br />
Grundimmunisierung lang anhielt,<br />
sodass der Fokus in 2009 auf der <strong>Impfung</strong><br />
der Nachkommen lag. In 2009<br />
wurden insgesamt weitere 5Mio.<br />
Rinder und 0,8 Mio. Schafe gegen<br />
BTV-8 geimpft.<br />
Obschon die <strong>Impfung</strong> ein Erfolg<br />
war (Antikörperabdeckung bei Rindern<br />
und Schafen etwa 83 %ohne<br />
weitere Differenzierung, ob die Antikörper<br />
impf- oder infektionsinduziert<br />
waren) und zunächst nicht sicher<br />
war,obBTV-8 aus der empfänglichen<br />
Tierpopulation getilgt werden<br />
konnte, wurde seitens der zuständigen<br />
Behörden Ende 2009 beschlossen,<br />
die verpflichtende <strong>Impfung</strong><br />
in 2010 nicht fortzusetzen, sondern<br />
den Tierhaltern zu ermöglichen,<br />
ihre Tiere freiwillig impfen zu<br />
lassen. Die Gründe für die Nichtfortsetzung<br />
der verpflichtenden <strong>Impfung</strong><br />
waren:<br />
● in benachbarten Staaten wurde<br />
auch nicht verpflichtend geimpft,<br />
● in der empfänglichen Wildtierpopulation<br />
könnte ein permanentes<br />
BTV-8-Reservoir vorhanden sein,<br />
welches eine Tilgung fraglich erscheinen<br />
ließ,<br />
● nach etwa zwei Jahren verpflichtender<br />
<strong>Impfung</strong> sollte ein ausreichender<br />
Schutz der Population gewährleistet<br />
sein und<br />
● insbesondere die Kosten beliefen<br />
sich für die <strong>Impfung</strong> 2008 auf etwa<br />
45,5 Mio. € und 2009 auf etwa<br />
16,5 Mio. €,die von der öffentlichen<br />
Hand getragen wurden.<br />
Seit 2010<br />
freiwillige <strong>Impfung</strong><br />
Unabhängig von der Strategieänderung<br />
–von der verpflichtenden<br />
<strong>Impfung</strong> 2008 und 2009 hin zur freiwilligen<br />
<strong>Impfung</strong> 2010<br />
–haben die zuständigen<br />
Behörden darüber<br />
nachgedacht, wie der<br />
BTV-Freiheitsstatus<br />
wieder erreicht werden<br />
kann. Grundlage dieser<br />
Überlegungen war einerseits<br />
die in der Europäischen<br />
Union einschlägige<br />
Vorschrift<br />
(Artikel 6Absatz 2in<br />
Verbindung mit Anhang<br />
INummer 1.3 und<br />
1.1.2.2 der Verordnung<br />
(EG) Nr.1266/2007) und<br />
andererseits Kapitel<br />
8.3.16 bis 8.3.21 des<br />
Tiergesundheitskodex<br />
der Weltorganisation für Tiergesundheit.<br />
Im Kern geht es darum<br />
nachzuweisen, dass in einem epidemiologisch<br />
relevanten Gebiet (=<br />
Deutschland) BTV-8 über einen Zeitraum<br />
von zwei Jahren nicht zirkuliert.<br />
Die zitierte Verordnung (EG) Nr.<br />
1266/2007 gibt vor,dass pro 2.000 km<br />
2<br />
Blutproben von 29 zufällig ausgewählte<br />
Rindern mit negativem Ergebnis<br />
untersucht werden müssen.<br />
Das Friedrich-Loeffler-Institut hat insoweit<br />
einen Untersuchungsschlüssel<br />
erarbeitet: Deutschland wurde in 180<br />
jeweils 2.000 km 2 große Gebiete aufgeteilt<br />
(Abbildung 2), in denen jeweils<br />
mindestens 29 Proben möglichst<br />
ungeimpfter Rinder zu untersuchen<br />
waren, das heißt, in 2010 und<br />
2011 waren jeweils mindestens 5.200<br />
Rinder zu untersuchen.<br />
Tatsächlich wurden in 2010 aber<br />
57.857 Proben untersucht (davon<br />
17.126 serologisch im Nachweisverfahren<br />
ELISA und 46.979 auf Virusantigen<br />
in der PCR). 6.066 der<br />
17.126 Proben, die im ELISA reaktiv<br />
waren, wurden <strong>mittels</strong> PCR nachuntersucht,<br />
jeweils mit negativem Ergebnis.<br />
In 2011 wurden 43.939 Proben<br />
untersucht (13.135 im ELISA und<br />
35.102 in der PCR). 4.298 ELISA-positive<br />
Proben wurden <strong>mittels</strong> PCR jeweils<br />
mit negativem Ergebnis nachuntersucht.<br />
Freiwillig wurden in<br />
2010/2011 noch 1.896 Seren von<br />
Schafen und Ziegen untersucht. 552<br />
der 1.896 Seren wurden im ELISA mit<br />
positivem Ergebnis untersucht; die<br />
entsprechenden Nachuntersuchungen<br />
<strong>mittels</strong> PCR fielen auch hier negativ<br />
aus. Zusätzlich wurden 3.023<br />
Seren von empfänglichen Wildtieren<br />
(Damwild, Mufflons, Rehwild,<br />
Rotwild) aus den Jagdjahren<br />
Abbildung 2: Darstellung der Aufteilung Deutschlands in<br />
180 epidemiologisch relevante Gebiete<br />
(Quelle: Friedrich-Loeffler-Institut)
■ BAUERNBLATT l 11. Januar 2014<br />
FAZIT<br />
Insgesamt wurden in den Jahren<br />
2010 und 2011 weniger als<br />
101.706 (30.261 im ELISA und<br />
81.899 in der PCR) Rinderseren<br />
und 1.896 Proben von Schafen<br />
und Ziegen (904 in ELISA und<br />
1.544 in der PCR) untersucht;<br />
die ELISA-positiven Proben<br />
wurden jeweils in der PCR mit<br />
negativem Ergebnis nachuntersucht.<br />
Zusätzlich hat auch<br />
die Untersuchung von 3.023<br />
Proben BTV-empfänglicher<br />
Wildtiere im ELISA beziehungsweise<br />
der PCR keinen Hinweis<br />
auf eine Zirkulation des BTV ergeben,<br />
sodass sich Deutschland<br />
im Ergebnis der 2010 und 2011<br />
durchgeführten Untersuchungen<br />
in Übereinstimmung mit<br />
Artikel 8.3.3 des Tiergesundheitskodex<br />
der Weltorganisation<br />
für Tiergesundheit mit Wirkung<br />
vom 15. Februar 2012 als<br />
frei von BTV erklärt hat. Um<br />
diesen Status aufrechtzuerhalten,<br />
werden die Untersuchungen<br />
fortgesetzt (so wurden im<br />
Jahr 2012 (ohne Einrechnung<br />
der „Exportuntersuchungen“)<br />
insgesamt 4.474 Rinderseren<br />
(2.706 Proben im ELISA und<br />
1.768 Proben in der PCR), 1.105<br />
Schaf- und Ziegenseren (207<br />
Proben im ELISA und 898 Proben<br />
in der PCR) sowie 3.821 Seren<br />
von Wildtieren (2.075 Proben<br />
im ELISA und 1.746 Proben<br />
in der PCR) jeweils mit negativem<br />
Ergebnis auf BTV untersucht.<br />
Mittels einer groß angelegten,<br />
etwa zwei Jahre andauernden<br />
Impfkampagne konnte,<br />
nicht zuletzt auch dank der<br />
zur Verfügung stehenden potenten<br />
<strong>Impfstoff</strong>e gezeigt werden,<br />
dass auch bei Vektor übertragenen<br />
Tierseuchen der Erreger<br />
aus einer empfänglichen<br />
Population getilgt werden<br />
kann.<br />
2008/09, 2009/10 und 2010/11 <strong>mittels</strong><br />
ELISA untersucht. Davon waren<br />
1.560 Seren im ELISA positiv und in<br />
der Nachuntersuchung in der PCR<br />
negativ. Die höchste Seroprävalenz<br />
wurde beim Rotwild (im Jagdjahr<br />
2010/11 10,7 %) beobachtet.<br />
Prof. Dr. Hans-Joachim Bätza<br />
Bundesministerium für<br />
Ernährung und Landwirtschaft,<br />
Verbraucherschutz<br />
Tel.: 02 28-9 95 29-34 57<br />
hans-joachim.baetza@<br />
bmel.bund.de