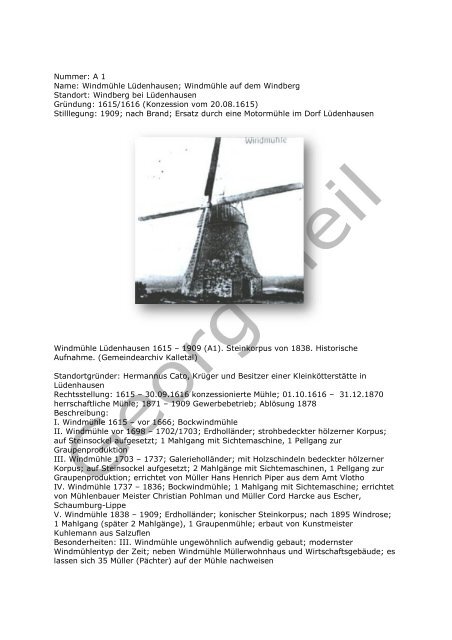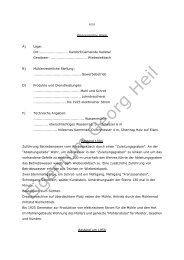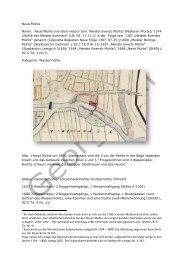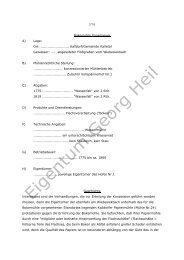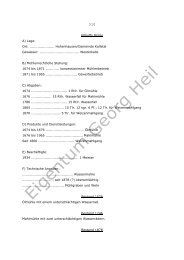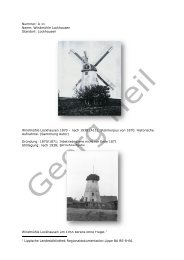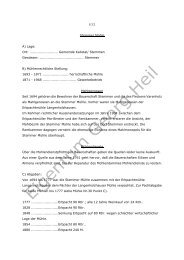Windmühle auf dem Windberg Standort: Windberg bei ...
Windmühle auf dem Windberg Standort: Windberg bei ...
Windmühle auf dem Windberg Standort: Windberg bei ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nummer: A 1<br />
Name: Windmühle Lüdenhausen; Windmühle <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Windberg</strong><br />
<strong>Standort</strong>: <strong>Windberg</strong> <strong>bei</strong> Lüdenhausen<br />
Gründung: 1615/1616 (Konzession vom 20.08.1615)<br />
Stilllegung: 1909; nach Brand; Ersatz durch eine Motormühle im Dorf Lüdenhausen<br />
Windmühle Lüdenhausen 1615 – 1909 (A1). Steinkorpus von 1838. Historische<br />
Aufnahme. (Gemeindearchiv Kalletal)<br />
<strong>Standort</strong>gründer: Hermannus Cato, Krüger und Besitzer einer Kleinkötterstätte in<br />
Lüdenhausen<br />
Rechtsstellung: 1615 – 30.09.1616 konzessionierte Mühle; 01.10.1616 – 31.12.1870<br />
herrschaftliche Mühle; 1871 – 1909 Gewerbebetrieb; Ablösung 1878<br />
Beschreibung:<br />
I. Windmühle 1615 – vor 1666; Bockwindmühle<br />
II. Windmühle vor 1698 – 1702/1703; Erdholländer; strohbedeckter hölzerner Korpus;<br />
<strong>auf</strong> Steinsockel <strong>auf</strong>gesetzt; 1 Mahlgang mit Sichtemaschine, 1 Pellgang zur<br />
Graupenproduktion<br />
III. Windmühle 1703 – 1737; Galerieholländer; mit Holzschindeln bedeckter hölzerner<br />
Korpus; <strong>auf</strong> Steinsockel <strong>auf</strong>gesetzt; 2 Mahlgänge mit Sichtemaschinen, 1 Pellgang zur<br />
Graupenproduktion; errichtet von Müller Hans Henrich Piper aus <strong>dem</strong> Amt Vlotho<br />
IV. Windmühle 1737 – 1836; Bockwindmühle; 1 Mahlgang mit Sichtemaschine; errichtet<br />
von Mühlenbauer Meister Christian Pohlman und Müller Cord Harcke aus Escher,<br />
Schaumburg-Lippe<br />
V. Windmühle 1838 – 1909; Erdholländer; konischer Steinkorpus; nach 1895 Windrose;<br />
1 Mahlgang (später 2 Mahlgänge), 1 Graupenmühle; erbaut von Kunstmeister<br />
Kuhlemann aus Salzuflen<br />
Besonderheiten: III. Windmühle ungewöhnlich <strong>auf</strong>wendig gebaut; modernster<br />
Windmühlentyp der Zeit; neben Windmühle Müllerwohnhaus und Wirtschaftsgebäude; es<br />
lassen sich 35 Müller (Pächter) <strong>auf</strong> der Mühle nachweisen
Zustand: 1918 abgerissen; verschwunden; Wohnhaus in stark veränderten Zustand<br />
erhalten<br />
Quellen: StA Detmold L 92 C Tit.12 Nr.10 Vol. I – IV; L 92 N Nr. 1030; L 92 C Tit.I Nr.4;<br />
L 92 R Tit.VII Nr.3; L 92 R Tit. VII.6 Nr.1<br />
Die Lüdenhauser Windmühlen<br />
Im Nordlippischen Bergland, <strong>bei</strong> Lüdenhausen, liegt der 250 m hohe <strong>Windberg</strong>. Er war<br />
zwischen 1615 und 1909 nacheinander <strong>Standort</strong> von 5 Windmühlen, die die Bewohner<br />
der Bauerschaften Lüdenhausen, Asendorf und Henstorf mit Gemahl versorgten.<br />
Mindestens 35 Müllern diente der <strong>Windberg</strong> als Wohn- und Ar<strong>bei</strong>tsplatz.<br />
Die Windmühlen II. und III. gehörten wegen ihrer Bauart zu den modernsten, damals im<br />
deutschen Raum existierenden Windmühlen.<br />
I. Windmühle (1615 - vor 1666)<br />
a) Bauherr<br />
Bauherr der ersten Mühle <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Windberg</strong> war Hermannus Cato aus Lüdenhausen.<br />
Cato stand bis 1600 im landesherrlichen Dienst <strong>bei</strong>m Amt Sternberg. Seine jährlichen<br />
Bezüge von 100 Tlr. deuten <strong>auf</strong> eine höhere Position in der Amtsverwaltung hin. Er besaß<br />
in Lüdenhausen eine Kleinkötterstätte mit etwa 10 Morgen Land und einen Krug. Vor<br />
1615 hatte er die Stätte verk<strong>auf</strong>t und sich <strong>auf</strong> eine Leibzuchtstätte begeben. 1 Das<br />
Privileg zum Bau und Betrieb einer Wind- oder Wassermühle <strong>bei</strong> Lüdenhausen, erhielten<br />
er und seine Ehefrau Lucien am 20.8.1615 von Graf Simon VII..<br />
b) Beschreibung der Mühle<br />
Die Mühle wurde 1615/1616 <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Windberg</strong> <strong>bei</strong> Lüdenhausen erbaut. Von der Mühle<br />
existieren keine Beschreibungen. Es kann sich jedoch nur um eine Bockwindmühle<br />
gehandelt haben, da um 1615 in Deutschland, bis <strong>auf</strong> die steinerne Turmmühle, kein<br />
anderer Windmühlentyp errichtet wurde. 2 Ein Müllerwohnhaus und Nebengebäude<br />
werden nicht erwähnt.<br />
C) Besitz- und Rechtsverhältnisse<br />
Die Konzession zum Betrieb einer Mühle erhielten Cato und Ehefrau in Erbpacht. Mühle<br />
und Einrichtung waren Eigentum des Ehepaars. Sie konnten die Mühle frei vererben oder<br />
veräußern. Simon VII. verblieb lediglich ein Obereigentum, daß nur zum Tragen kam,<br />
wenn der Besitzer ohne Erben verstarb. Bei Verk<strong>auf</strong> und technischen Verbesserungen<br />
musste wahrscheinlich die Einwilligung Simons eingeholt werden. Mit Erteilung der<br />
Konzession wurden der Mühle Mahlgenossen zugewiesen. Sie durften nur <strong>auf</strong> dieser<br />
Mühle mahlen lassen. Bei Verstößen gegen diesen Mahlzwang wurden vom zuständigen<br />
Gogericht Geldbußen verhängt. Zu den Mahlgenossen gehörten die Bewohner von<br />
Lüdenhausen, Asendorf, Helberg, Herbrechtsdorf, Henstorf und Niedermeien 3 .<br />
Ursprünglich waren sie Mahlgenossen einer Wassermühle, gelegen an einem Quell<strong>auf</strong> der<br />
Alme im Hüttenhau, <strong>auf</strong> Sternbergischem Gebiet. Sie war <strong>auf</strong> Veranlassung Simon VI.<br />
1 Stöwer, H. u. Verdenhalven F., Salbücher der Grafschaft,(1969), Seite 258.<br />
2 Siehe hierzu: Notebaart, J.C., Windmühlen, (1972), Seite 297 ff..<br />
3 Wir haben hier den seltenen Fall einer konzessionierten Mühle, der Mahlgenossen<br />
zugewiesen wurden. Üblich war dies in der Regel nur <strong>bei</strong> herrschaftlichen Zeit- oder<br />
Erbpachtmühlen. 1616 beendete Simon VI. diese Ausnahme und erwarb die Mühle, was<br />
ihm eine höhere Rendite einbrachte.
erbaut worden, war jedoch vor 1614 wegen chronischen Wassermangels <strong>auf</strong>gegeben<br />
worden. 4 Durch die Erteilung der Konzession ersparte Simon den Lüdenhausern die bis<br />
dahin weiten Wege zu anderen Mühlen 5 . Für die Erteilung der Konzession zahlte Cato<br />
einen Weink<strong>auf</strong> von 50 Tlr. und eine jährliche Konzessionsgebühr von 20 Tlr. an das<br />
Amtshaus zu Varenholz. Am 1.10.1616 verk<strong>auf</strong>te Cato die Mühle für 320 Tlr. an Simon<br />
VII. Am 7.10.1616 ließ Simon die Mühle an den Müller Hans Voigten 6 in Zeitpacht <strong>auf</strong> ein<br />
Jahr vergeben. Voigten zahlte eine Pachtsumme von 120 Tlr. Er war bereits Müller unter<br />
Cato gewesen. Durch den Erwerb Simons erhielt die Mühle den rechtlichen Status einer<br />
herrschaftlichen Mühle, die in Zeitpacht vergeben wurde. Der Bezirk der<br />
Mahlgenossenschaft wurde nicht verändert. Interessant ist, das Voigten mit <strong>dem</strong><br />
Zeitpachtvertrag auch die Konzession erhielt, im Dorfe <strong>auf</strong> Kosten Simons eine<br />
Wassermühle mit einem Mahlgang zu erbauen. Die Wassermühle wurde jedoch nicht<br />
errichtet. 7<br />
d) Konjunkturverl<strong>auf</strong><br />
Zu der wirtschaftlichen Entwicklung der Mühle liegen nur spärliche Quellenaussagen vor.<br />
An Mahlgenossen waren der Mühle aus den Baurschaften Lüdenhausen, Asendorf<br />
(inkl.Herbrechtsdorf und Helberg) und Henstorf (inkl.Niedermein) etwa 82 Kolonate mit<br />
4 StADt L92 N Nr.1030. Die Mühle, die <strong>auf</strong> Lüdenhauser und Sternberger Gemeinheit lag,<br />
ist nach ihrer Stilllegung in eine Wohnstätte umgewandelt worden. Sie war die erste<br />
Wohnstätte im Hüttenhau. Vgl.: Stöwer, H. u. Verdenhalven, F., Salbücher der<br />
Grafschaft Lippe, (1969), Seite 258 Nr.1962 und Seite 311.<br />
5 Die nächstgelegenen Mühlen waren die Wassermühlen Göstrup im Amt Sternberg und<br />
Hillentrup im Amt Brake. 1614 schrieben die Lüdenhauser an Simon VII., der Weg nach<br />
Göstrup sei weit und beschwerlich, sie müssten "das Korn mitt großer Ar<strong>bei</strong>t <strong>auf</strong> den<br />
Achsell nach der Muhlen dragen". StADt C 92 N 1030.<br />
6 Hans Voigten (oder Voigt) war wahrscheinlich Inhaber einer Kleinkötterstätte in<br />
Lüdenhausen.<br />
Vgl. Stöwer, H. / Verdenhalven, F., Salbücher der Grafschaft Lippe, (1969), Seite 257,<br />
Nr.1947.<br />
7 Es scheint so, dass niemand mit <strong>dem</strong> Mühlenstandort <strong>Windberg</strong> so recht zufrieden war,<br />
denn immer wieder tauchen Pläne <strong>auf</strong>, im Dorf an der Osterkalle und anderen<br />
<strong>Standort</strong>en eine Wassermühle zu errichten. Nach<strong>dem</strong> die Windmühle irgendwann vor<br />
1666 abgebrannt war, wurde im Dorf tatsächlich an der Osterkalle 1666/1667 von <strong>dem</strong><br />
Müller Arndt Rügge eine Wassermühle erbaut. Sie ist jedoch nach 1678 wegen<br />
Wassermangels wieder eingegangen. Rügge war, wahrscheinlich bis 1651, 20 Jahre<br />
Müller <strong>auf</strong> der Göstruper Wassermühle gewesen und hatte 1651 eine Wohnstätte in<br />
Lüdenhausen erworben. StADt C 92 N 1030. Vgl. weiter zur Geschichte der Lüdenhauser<br />
Wassermühle: Heil, G., Wassermühle Lüdenhausen, (1985). Weiter Pläne zum Bau einer<br />
Wassermühle fassten 1733 der Lüdenhauser Johan Cord Krüger, der Windmüller Statius<br />
Hermann Harcke 1797 und der Windmüller Johan Christian Keßler 1822. Das sind<br />
Hinweise, dass der <strong>Standort</strong> <strong>Windberg</strong> für eine Windmühle nicht der günstigste war.<br />
1822 schrieb der Windmüller Keßler, <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Windberg</strong> herrschten mangelnde Winde,<br />
die zu<strong>dem</strong> noch häufig die Richtung wechselten. Auch die häufigen Beschädigungen und<br />
mehrfachen Zerstörungen der Mühlen durch Unwetter deuten <strong>auf</strong> einen ungünstigen<br />
<strong>Standort</strong> hin.
ca. 588 Bewohnern zugewiesen. In der Bevölkerungsdichte unterschieden sich die<br />
Baurschaften nicht von den übrigen im nordlippischen Bergland. 8 Die Bodennutzung<br />
wurde vom Getreideanbau dominiert, wo<strong>bei</strong> Roggen das Leitgetreide darstellte. Wie alle<br />
herrschaftlichen Mühlen hatte die Lüdenhauser den Mehlbedarf der Bevölkerung zur Brotund<br />
Getreidebreiherrstellung, den wichtigsten Nahrungsmitteln der Bevölkerung,<br />
sicherzustellen. Vermahlen wurde vorwiegend Roggen. Roggenschrot wurde für die<br />
zahlreichen kleinen örtlichen Kornbrennereien produziert. Alle anderen Dienstleistungen,<br />
wie Schroten von Malz, Produktion von Weizenmehl, Hafergrütze und Gerstengraupen<br />
fielen, wie <strong>bei</strong> allen herrschaftlichen Zwangsmühlen, nicht unter den Mahlzwang. Für<br />
diese Dienstleistungen konnten sich die Mahlgäste unter den Mühlen der Umgebung frei<br />
entscheiden. 1791 heißt es in einem Schreiben der Varenholzer Amtsverwaltung, dass<br />
die Lüdenhauser Mühle "seit alten Zeiten schon (über) eine Handgrützemühle" verfüge,<br />
so das anzunehmen ist, dass bereits zu den Dienstleistungen der ersten Mühle die<br />
Produktion von Hafergrütze <strong>auf</strong> einer Handmühle gehörte. Zumindest in der Gründerzeit<br />
der Mühle bis in den Dreißigjährigen Krieg hinein muss die Ertragslage der Mühle sehr<br />
gut gewesen sein, daß erklärt zum einen ihre Gründung, zum andern der hohe<br />
Zeitpachtzins von 120 Tlr. und Weink<strong>auf</strong> von 50 Tlr. 1666 wird berichtet, dass die Mühle<br />
"vor Jahren durch einen Unglücksfall" abgebrannt sei. Zugunsten einer kleinen<br />
Wassermühle im Dorf wurde sie nicht wieder <strong>auf</strong>gebaut (Vgl. Fußnote 8). Sie reichte<br />
scheinbar für den zurückgegangenen Mehlbedarf aus.<br />
e) Pächter und Müller<br />
Dokumentiert wird lediglich ein Zeitpächter: Hans Voigten, Zeitpächter. Kleinkötter aus<br />
Lüdenhausen. Erwähnt 1616.<br />
II. Windmühle (vor 1698 - 1702/1703)<br />
a) Bauherr<br />
Der Bauherr ist quellenmäßig nicht belegbar. Es kann jedoch nur der Landesherr<br />
gewesen sein. 1698, <strong>bei</strong> ihrer ersten Erwähnung, erscheint die Mühle wieder als<br />
herrschaftliche Zeitpachtmühle.<br />
b) Beschreibung der Mühle 9<br />
Das Mühlenhaus mit Stroh gedeckt - "Das von Stroh gemachte Dach". 10 Die Segel -<br />
"Flügell Lacken mit allen zubehörigen Seillern und Lienien".<br />
Die Böden: Der oberste Boden - "oberste Boden"; mit: Flügelwelle - "große Walle so die<br />
Flügel hält"; großes Achsrad - "große Kammradt"; Bremse - "Preße"; Stockgetriebe -<br />
"Dreff, so mit 4 Eißern Bänder umzogen ist" 11 .<br />
Der mittlere Boden - "mittelste Boden"; mit: Stirnrad - "groß Kamrad"; König - "große<br />
8 Asendorf wies 1617 eine Bevölkerungsdichte von 21 Einwohnern je km 2 <strong>auf</strong>, Henstorf<br />
von 27. Der Kirchort Lüdenhausen war mit 40 Einwohnern je km 2 naturgemäß dichter<br />
besiedelt. Alle Siedlungen verzeichneten bis 1648 einen Bevölkerungsrückgang, Asendorf<br />
<strong>auf</strong> 17, Henstorf <strong>auf</strong> 21 und Lüdenhausen einen besonders drastischen <strong>auf</strong> 25<br />
Einwohnern je km 2 . Zahlenangaben nach:<br />
Kuhlmann, M., Bevölkerungsgeographie, (1954).<br />
9 Nach einer Inventarisation, angefertigt am 17.8.1702.<br />
10 Hochdeutsche Terminologie nach: Möhn, D., Fachsprache der Windmüller, (1986). In<br />
Anführungszeichen die in den benutzten lippischen Quellen verwandte Terminologie, die<br />
ein Gemisch von Mundart und Hochsprache (Schriftsprache) darstellt.<br />
11 Zum Begriff "Dreff": Drube, F., Mühlen in Schleswig Holstein, (1935), Seite 75 f. Nr.11<br />
- Begriff "Gedrief" bzw. "driff".
stehende Walle"; 2 Stockgetriebe - "2 dreffe"; 2 Mahlgangsspindeln - " 2 kleine stehende<br />
Wallen"; Sack<strong>auf</strong>zug - "Rad mit eisernen Krönken und groß Seill damit das Korn<br />
<strong>auf</strong>gewonnen wird".<br />
Der unterste Boden - "Unterste Boden"; mit: Mahlgang und Pellgang - "zwey große<br />
Mühlsteine zum mahlen, mit einer Bohnen und Rump (Steinkiste und Trichter) und zwey<br />
kleine Steine zur Perrelmühle (Perlmühle), mit Brettern bedeckedt und kleiner Rump.<br />
Zwey Coupen 12 mit durchgeschlagenen Blech zur Perrelmühle". Reinigungsvorrichtung<br />
zur Vorreinigung der zum Pellen bestimmten Gerste - "Sechterey mit einer ledernen<br />
Sevet" 13<br />
Erdgeschoß - "Unten in der Mühle"; mit: Sichtmaschine des Mahlganges - "Beutelt und<br />
Sichtetrog von der großen Mahlmühlen"; "Weyzerey mit aller ihrer Zubehör" (?); zwei<br />
Türen.<br />
Kappe und Hebelbalken zum Drehen der Kappe - "der Schwantz, womit das Tach herum<br />
gedrehet wird".<br />
Die vor <strong>dem</strong> Jahre 1698 errichtete II. Windmühle war eine Mühle mit drehbarer Kappe,<br />
die mittelst eines bis zum Erdboden herabreichenden Hebelbalkens in den Wind gedreht<br />
werden konnte. Das Mühlenhaus war eine mit Stroh bedeckte dreistöckige<br />
Holzkonstruktion, die <strong>auf</strong> einem massiven Steinsockel <strong>auf</strong>gesetzt war 14 . Auf <strong>dem</strong> ersten<br />
Boden befanden sich ein Mahlgang zur Schrot- und Mehlproduktion und ein Pellgang zur<br />
Graupenproduktion. Im Erdgeschoß befand sich eine Sichtemaschine zur Mehlproduktion.<br />
Nach der Beschreibung läßt sich die Mühle als ein sogenannter "Holländer", genauer<br />
gesagt als "Erdholländer" oder Bodensegler identifizieren.<br />
Die Mühle ist zwischen August 1702 und Februar 1703 abgebrannt.<br />
Zur Windmühletypologie 15 :<br />
Für Westfalen-Lippe liegt bisher keine Untersuchung über die Typologie der in diesem<br />
Raum errichteten Windmühlen vor. Wegen des Fehlens einer regionalen Typologie ist der<br />
Autor gezwungen ein System zur Bestimmung der Typologie der verschiedenen<br />
Lüdenhauser Windmühlen zu nutzen, die das Einordnen dieser Mühlen in bereits<br />
vorhandene regionale Typologien ermöglicht. Hier bietet sich die Typologie von<br />
J.C.Notebaart an, die es erlaubt, sämtliche bekannte Windmühlen der Welt zu erfassen<br />
und zu vergleichen. Da<strong>bei</strong> konzentriert er sich <strong>auf</strong> die äußeren Erscheinungsformen der<br />
Windmühle, die wie er zeigt, in der ganzen Welt <strong>auf</strong> eine relativ geringe Anzahl von<br />
Formen zurückgeführt werden können. Andere Aspekte, wie technische, funktionale,<br />
rechtliche u.a. berücksichtigt er nicht. Notebaarts Typologie unterscheidet Hauptklassen,<br />
Klassen, Typen und Varianten. Von den 2 Hauptklassen ist für den deutschen Raum nur<br />
die Hauptklasse B - die vertikale Windmühle - von Bedeutung. Er unterteilt sie in 3<br />
Klassen - I. die nicht drehbare Mühle/ II. die Mühle mit drehbarem Gehäuse/ III. die<br />
Mühle mit drehbarer Haube. Die II. Lüdenhauser Windmühle gehört ohne Zweifel zur<br />
Klasse III. 16 Schwieriger ist es den Typ zu bestimmen - Notebaart unterscheidet deren 4,<br />
wo<strong>bei</strong> ein Typ noch 2 Varianten <strong>auf</strong>weist. Die Schwierigkeit erklärt sich aus <strong>dem</strong><br />
12 Hölzerne Verkleidung der Steine, die mit gelochtem Blech beschlagen war. Die nach<br />
Innen stehenden scharfen Kanten ergaben die Wirkung einer Reibe.<br />
13 Vgl.: Drube, F., Mühlen in Schleswig - Holstein, (1935), Seite 86 f.<br />
14 Zum Vorhandensein eines Steinsockels vgl. Fußnote 19.<br />
15 Literatur: Notebaart, J.C., Windmühlen, (1972).<br />
16 Die I. Lüdenhauser Windmühle ist der Klasse II, der Mühlen mit drehbarem<br />
Mühlenhaus, zuzuordnen.
Umstand, dass die Quelle nur dürftig die äußere Erscheinung der Mühle dokumentiert.<br />
Durch das Inventarium ist belegt, dass das Mühlenhaus aus Holz erbaut und die<br />
Mühlenbekleidung aus Stroh bestand. Typ a. - die zylindrische Turmmühle - scheidet<br />
aus, da für sie als Baumaterial Holz nicht benutzt wurde. Typ b. - die leicht konische<br />
Turmmühle - weist als Baumaterial ebenfalls nur Haus- oder Backsteine <strong>auf</strong>, mit<br />
Ausnahme eines Gebietes in Polen. Er scheidet ebenfalls aus. Typ c. - die konische<br />
Turmmühle - wurde "meistenteils" aus Backstein, "aber auch" Hausstein errichtet,<br />
"selten" aus Holz. Typ d. - die eckige Turmmühle - wies "gewöhnlich" acht Seitenwände<br />
<strong>auf</strong> und wurde "gewöhnlich" aus Holz erbaut, "manche" aber auch aus Stein. Sie<br />
weisen oft einen senkrechten Unterbau aus Stein oder Holz <strong>auf</strong>. Typ d./ Variante 1 -<br />
zeigt eine nicht - taillierte Form <strong>auf</strong>. Typ d./ Variante 2 - zeigt eine taillierte Form. Die<br />
Lüdenhauser Mühle kann also <strong>dem</strong> Typ c. (weniger wahrscheinlich) oder <strong>dem</strong> Typ d., mit<br />
<strong>bei</strong>den Varianten, zugeordnet werden. Zur näheren Eingrenzung können die Art und<br />
Weise wie die Mühle gegen den Wind gerichtet wird vernachlässigen werden. Es<br />
existieren zwar mehrere Möglichkeiten, die aber mehr oder weniger <strong>bei</strong> allen Typen zu<br />
beobachten sind. Als weiteres Kriterium bietet sich zunächst das "Verbreitungsgebiet" an.<br />
Es schließt noch einmal die Typen a. und b. aus, da sie Mühlen des Mittelmehrgebietes<br />
sind. Typ c. und d. sind <strong>bei</strong>de "typisch für Nord - Europa". Sie werden gewöhnlich als<br />
"holländische Mühle" bezeichnet. Zur weiteren Eingrenzung können <strong>bei</strong> <strong>bei</strong>den Typen<br />
folgende Unterscheidungen gemacht werden: 1. Mühlen deren Flügel <strong>bei</strong>m Drehen<br />
<strong>bei</strong>nahe den Boden berühren. 2. Mühlen die <strong>auf</strong> künstlichen Bodenerhöhungen oder <strong>auf</strong><br />
Wälle gesetzt sind, um sie höher an den Wind zu bringen. 3. Mühlen mit hoch<br />
<strong>auf</strong>geführten Mühlenhäusern, die mit einem L<strong>auf</strong>steg versehen sind, um die Flügelsegel<br />
ausspannen oder reffen zu können. Die unter 2. gefassten Mühlen sind für die<br />
Lüdenhauser ausschließen, da eine künstliche Bodenerhöhung <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> exponiert<br />
liegenden <strong>Windberg</strong> sicher nicht nötig war. Die unter 3. gefassten Mühlen können<br />
ebenfalls ausgeschlossen werden, da die Mühle über keinen L<strong>auf</strong>steg verfügte. Er wäre<br />
im Inventarium erwähnt worden. Bleiben die unter 1. gefassten Mühlen. Sie werden <strong>bei</strong><br />
uns in Deutschland gewöhnlich als "Erdholländer" bezeichnet. Notebaart zieht die<br />
neutrale Bezeichnung "Bodenmühle" oder "Bodensegler" vor. Näher ist die Typologie der<br />
II. Lüdenhauser Windmühle nicht zu bestimmen. Es muss offen bleiben, ob sie <strong>dem</strong> Typ<br />
c. oder d. angehört. Einiges spricht aber für Typ d., die eckige Turmmühle, entweder mit<br />
taillierter oder nicht taillierter Form.<br />
c) Eigentums- und Rechtsverhältnisse<br />
Bis zu ihrer Zerstörung waren ausschließlich Zeitpächter <strong>auf</strong> der Mühle. Die Mühle befand<br />
sich im Eigentum des Landesherrn, war also eine herrschaftliche Zeitpachtmühle, der ein<br />
Zwangsrecht <strong>auf</strong> die zugewiesenen Mahlgenossen zustand.<br />
d) Konjunkturverl<strong>auf</strong><br />
1703 gehörten an Mahlgenossen etwa 102 Kolonate mit ca.620 Menschen zur Mühle. 17<br />
Der vorletzte Zeitpächter der Mühle (Müller Bulte) musste im Dezember 1700 die Mühle<br />
heimlich verlassen, da gegen ihn die "Execution" (Pfändung) verfügt worden war. Das er<br />
den Pachtzins nicht <strong>auf</strong>bringen konnte, weist <strong>auf</strong> eine schlechte Ertragslage hin. Um<br />
einen Nachfolger zu finden, was sich anscheinend <strong>bei</strong> der schlechten Ertragslage<br />
schwierig gestaltete, schlug der Amtmann Wistinghausen vor, <strong>auf</strong> einen Pachtzins in Geld<br />
zu verzichten und statt dessen vom Müller den 3. oder 4. Teil des Mattkorns 18 zu<br />
erheben, oder aber <strong>dem</strong> Müller einen "Tagelohn" zu geben, da er dann "wenig nach<br />
frage, ob viel oder wenig zu mahlen sei".<br />
17 Kuhlmann, M., Bevölkerungsgeographie, (1954), Seite 115.<br />
18 Mattkorn - der Anteil den der Müller vom Mahlgut als Bezahlung für seine<br />
Dienstleistung mattet (ausmißt).
Erst im August 1702 übernahmen zwei neue Zeitpächter die Mühle, nach<strong>dem</strong> sie mit<br />
großem Aufwand repariert worden war. Amtmann Wistinghausen schreibt, dass allein<br />
zum Heranfahren des Baumaterials über 100 Fuhren erforderlich waren.<br />
1703 wurde <strong>bei</strong> der Mühle ein Müllerwohnhaus <strong>auf</strong> Landesherrliche Kosten errichtet.<br />
e) Pächter und Müller<br />
Bulte, Zeitpächter.<br />
Flieht im Dez.1700 von der Mühle.<br />
Koch, Henrich, Zeitpächter.<br />
Ab <strong>dem</strong> 17.8.1702.<br />
Piper, Hans Henrich (Hindrick).<br />
Zeitpächter seit <strong>dem</strong> 17.8.1702.<br />
III. Windmühle (1703 - 1737)<br />
a) Bauherr<br />
Bauherr war der Landesherr Friedrich Adolf. Verantwortlich für die Durchführung des<br />
Baues und Zahlung der Baukosten war die Rentkammer. Vor Ort waren verantwortlich<br />
der Vogt der Vogtei Hohenhausen, Johan Christopf Wistinghausen (Überwachung der<br />
Bauar<strong>bei</strong>ten und Abrechnung) und der hochgräfl. lipp. Waldvogt Hermann Adolph Böger<br />
(Auszahlung der Rechnungsbeträge an die Ar<strong>bei</strong>ter, Handwerker und Lieferanten).<br />
Errichtet wurde die Mühle von Henrich Piper, in der Bauakte mit "Mühlenbauherr"<br />
betitelt.<br />
Baugeschichte<br />
Bauzeit 18.9.1703 - 21.8.1705.<br />
a. Grundgerüst <strong>auf</strong>gerichtet 6.12.1704.<br />
b. Mühle äußerlich fertiggestellt 14.1.1705.<br />
c. Mühlenbau beendet 21.8.1705.<br />
Ar<strong>bei</strong>ten zu a.:<br />
18.9.1703 bis 9.2.1704 - 92 Ar<strong>bei</strong>tstage.<br />
Fällen Bauholz in herrschaftlichen Forst, Zubereitung und Zuschneiden durch Piper,<br />
seinen Knecht und 6 "Sägeschneider". Anfertigung "Kam- und Tackrad" durch Piper und<br />
Knecht.<br />
11.2.1704 bis 6.12.1704 - 252 Ar<strong>bei</strong>tstage.<br />
Zimmermannsar<strong>bei</strong>ten durch Piper, Knechte und Tagelöhner aus umliegenden Orten.<br />
bis 6.10.1704 - Schmiedear<strong>bei</strong>ten.<br />
U.a. eiserne Bänder um die Wellen und Dreffscheiben, d.h. Ar<strong>bei</strong>ten am gehenden Werk.<br />
August 1704 - Maurerar<strong>bei</strong>ten - 10 1/2 Tage.<br />
U.a. Setzen von Gründen unter das Grundgerüst 19 , Einsetzen eines herrschaftlichen<br />
Wappen.<br />
Material<br />
Nicht näher bezifferte Mengen an Buchen-, Eichen-, Fichten- und Pappelholz aus <strong>dem</strong><br />
herrschaftlichen Forst. Ein großes Seil (Gewicht ca.142 kg). Zwei Fuder Kalk. 2.000<br />
Nägel ("halbe Kavennägel"). 2 Rollen "Kanfas" (?), 8 Ellen "Hollans Dock" (?), 4 Stücke<br />
Segelgarn und 4 Seilnadeln (zur Herstellung der Segel). Große Anzahl an<br />
Metallgegenständen, wie Türhespen, Bolzen, Eisenbänder um die Wellen, Klammern,<br />
Ringe, Metallplatten usw. und 1.050 Nägel unterschiedlicher Größe. 200 Ziegelsteine<br />
19 Während des Mühlenbaus finden keine Fundamentierungsar<strong>bei</strong>ten und keine Ar<strong>bei</strong>ten<br />
zur Errichtung eines massiven Sockels, <strong>auf</strong> den das Grundgerüst <strong>auf</strong>gesetzt wird, statt.<br />
Im August 1704 schlagen, laut Baurechnung, jedoch die Maurer "durch das Mauerwerk"<br />
2 Türen. Da die Baurechnungen komplett vorliegen, ist davon auszugehen, daß der<br />
Steinsockel bereits vorhanden war. Er kann nur von der Vorgängermühle stammen.
("Dach Ziegelsteine"). 209 mtr. Eichenbretter. Handwerker 20 und Lieferanten<br />
Meister Piper und Tagelöhner.<br />
Schmied Jobst Lüderssen aus Obernkirchen. Maurermeister mit Sohn und Helfer.<br />
Reipschläger<br />
Meister Peter Wißmanns Witwe, Detmold.<br />
Friedrich Volmers und Dietrich Nauteß (Bremen?).<br />
Ziegelei Varenholz.<br />
Ar<strong>bei</strong>ten zu b.:<br />
8.12.1704 bis 14.1.1704 - 29 Ar<strong>bei</strong>tstage.<br />
Zimmermannsar<strong>bei</strong>ten durch Piper, Knechte und Tagelöhner.<br />
Nov./Dez. 1704 - Verkleiden des Mühlengerüstes.<br />
Zuschneiden der Holzschindeln ("Späne") durch einen Meister und 2 Helfer. Insgesamt<br />
38 Ar<strong>bei</strong>tstage. Aufnageln der Holzschindeln <strong>auf</strong> Grundgerüst und Türen.<br />
bis 8.1.1705 - Schmiedear<strong>bei</strong>ten.<br />
Ar<strong>bei</strong>ten am gehenden Werk, u.a. Anfertigung von eisernen Stockgetrieben ("trielen"),<br />
eiserne Bänder um die Wellen, Ausbesserung der Windfahne, Ar<strong>bei</strong>ten am<br />
Mühlenschwanz ("Schwanß") und Ar<strong>bei</strong>ten an der Presse.<br />
Material<br />
37.000 Nägel zum Aufnageln der Holzschindeln <strong>auf</strong> das Grundgerüst. Nicht bezifferte<br />
Anzahl von Holzschindeln 21 . 90 Bretter ("1 1/2 Schock Dielen"). 595 Nägel<br />
unterschiedlicher Größe ("Dielnägell, kleine Nägel"). Bolzen und Metallplatten für<br />
Stockgetriebe, eiserne Bänder um die Wellen, Hespen und Haken, Eisenplatten u.a..<br />
237 mtr. Eichenbretter.<br />
Handwerker und Lieferanten<br />
Meister Piper und Tagelöhner.<br />
Schmied Jobst Lüderssen, Obernkirchen.<br />
Meister Hanß Schnitker und 2 Helfer (Holzschindeln schneiden).<br />
Herm. Sülwold, Hohenhausen (Holzschindeln <strong>auf</strong>bringen).<br />
Herman Dohm, Rinteln (Holzlieferant).<br />
Schmied Henrich Kisow, Lüdenhausen.<br />
Ar<strong>bei</strong>ten zu c.:<br />
bis 5.3.1705 - Schmiedear<strong>bei</strong>ten.<br />
20 Gezahlte Tagelöhne:<br />
Meister Piper 12 gr. und 4 Maaß Bier a 8 Pf. bzw. 18gr. und 2 Maaß Bier a 8 Pf. (1 Maaß<br />
= 1,25 Ltr.)<br />
Holzfäller 12 gr. und 2 Maaß Bier.<br />
Sägeschneider 8 gr. und 2 Maaß Bier.<br />
Knechte und Tagelöhner 8 gr. und 2 Maaß Bier.<br />
Maurermeister 9 gr.<br />
Maurermeister mit Sohn 16 gr.<br />
Spänemacher 8 gr.<br />
Helfer 7gr.<br />
Schmie<strong>dem</strong>eister 14 gr.<br />
21 Zum Vergleich: Die im Westfälischen Freilichtmuseum Detmold <strong>auf</strong>gestellte<br />
Kappenwindmühle ist mit 12.000 Eichenschindeln bedeckt. Großmann, G.U. u. Schulte<br />
I., Die Kappenwindmühle, (1980), Seite 25.<br />
Die im Museumsdorf Cloppenburg befindliche "Bokeler Mühle" ist sogar mit über 20.000<br />
genagelten Holzschindeln bedeckt. Brüning, H., Die Mühlen des Museumsdorfes<br />
Cloppenburg, (1988), Seite 26.
Anfertigung vieler Nägel unterschiedlicher Größe.<br />
bis 21.8.1705 - Zimmermannsar<strong>bei</strong>ten.<br />
Durch Piper und Knechte.<br />
Mai 1705 - Maurerar<strong>bei</strong>ten.<br />
Untermauern der Ständer der Galerie. ("Schwickstellunge"), Balken der Galerie<br />
zugemauert. 4 Ar<strong>bei</strong>tstage.<br />
bis Mai 1705<br />
Anfertigung der Segel ("Flügellacken").<br />
bis Juli 1705 - Schmiedear<strong>bei</strong>ten.<br />
u.a. Anfertigung einer Haue ("Mühlen Kreutz"), Bicken geschärft, Anfertigung einer<br />
Spindel ("Mühlen spillen an die Perrel Mühlen"), einer Fußspindel ("unterste Spillen"),<br />
eines gelochten Blechs für die Perlmühle, Ar<strong>bei</strong>ten an den Flügeln.<br />
bis August 1705 - Schmiedear<strong>bei</strong>ten.<br />
U.a. Ar<strong>bei</strong>ten am Beutelgang.<br />
August 1705<br />
Anbringen der Segel an die Flügel.<br />
7 Ar<strong>bei</strong>tstage.<br />
Material<br />
178 mtr. Eichenbretter. 48 mtr. Bretter. 3.326 Nägel unterschiedlicher Größe<br />
("Diellennägell, kleine Nägell, Lattennägell, große Nägell"), 50 Eisenringe, Bolzen u.a.. 18<br />
kg Stricke für die Segel. Ein Strick von 5 kg zum Aufziehen der Mühlsteine. 5,6 kg<br />
Haartuch (Haartuchsieb für Beutelgang). 40 Blechtafeln. Große Anzahl Eisengeräte, wie<br />
eiserne Bänder um die Wellen, Zapfen ("Tappen"), Bügel, Hespen, Spillen, Bolzen, Stifte,<br />
Haken, 2 Flaschenzüge ("Blöcke mit Eisen Räder"), Ringe, 2 Bicken, 2 Schlösser, Ketten<br />
und 402 Nägel unterschiedlicher Größe. 30 Fichtenbretter ("Tannen Bohlen/ Tannen<br />
Dielen"). 3.320 Nägel unterschiedlicher Größe ("Hespe Negel, Lattennegel, Stakenegel,<br />
Mittlnegel, kleine Diköppe, Langstiffte, Cuphnegel"). Teer und Baumöl. Eine Kuhhaut für<br />
den Beutelgang. 16 Metallkrampen an die Flügel. 4 Fichtenbalken a 24,65 m (aus<br />
Hameln).<br />
Handwerker und Lieferanten<br />
Meister Piper (Abb.2)<br />
Schmied Henrich Kisow, Lüdenhausen.<br />
Reibschläger Hans Herman Schabbehaar, Varenholz.<br />
Blechschläger Christoffer Gießeken, Lemgo.<br />
Maurermeister und Sohn.<br />
Schmied Johann Helling.<br />
Schmied Johan Henrich Sasse, Lüdenhausen.<br />
Baukosten<br />
Lohnkosten ca. 700 Tlr.<br />
Materialkosten ca. 400 Tlr.<br />
b )Beschreibung der Mühle 22<br />
a. Mühlengetriebe<br />
Flügelwelle - "große Walle"; Bremse - "Preße"; große Achsrad - "große Kamrath";<br />
Stirnrad - "Tackrath".<br />
b. Mahlgänge<br />
2 Mahlgänge - "große und kleine Mühle"; ein großer und ein kleiner Bodenstein -<br />
"Unterleger"; ein großer und ein kleiner Läuferstein - "Leuffer"; Steinverkleidung -<br />
"Böhnen"; Trichter - Rump"; Rüttelschuh - "Schu"; Schlitten - "Stuel". 2 Beutelgänge<br />
(Sichtemaschinen) - "Mehlkasten oder Sichttröge"<br />
22 Nach einer Inventarisation, angefertigt 1722.
Abb.2 Rechnung des Hindrick Piper: „Vom 22. (Okto-)bris 1703 biß den 9. Febr. 1704<br />
<strong>auf</strong>f beyden seiten inclusive, habe ich nebst meinem Knechte an <strong>dem</strong> mühlenwercke<br />
behueff Lüdenhauser windmühle gear<strong>bei</strong>tet in Summa – 92 tage, verdienet täglich<br />
zusammen – 12 gr. (Groschen) 4 maaß bier jede a 8 d. (Pfennige), facit – 37 ß (Taler)<br />
17 gr. 4 d. Hindrik Piper<br />
Auf Mstr. (Meister) henrich Pieper Vorgesetzter Maßen bey Verfertigung des Kam= und<br />
Tack Rades mit seinem Knecht gearbeytet und desfals auch von <strong>dem</strong> H.<br />
(Herrschaftlichen?) Wald Vogt Bögern mit dreißig Sieben Tlr. (Taler) bezahlet worden.<br />
Attestiret Wistinghausen. Lüdenhausen 28. Febr. 1704<br />
(StADt. L 92 C Tit. 12 Nr. 10 Vol. I)<br />
c. Pellgang<br />
2 Steine mit Blech umgeben - "Perrelmühle mit Blech umschlagen"; hölzerne Verkleidung<br />
- "Kupe".<br />
d. Mühlenhaus<br />
Steinsockel - "Mauerwerk"; Galerie - "Zwickstellung".
Die 1705 in Betrieb genommene III. Windmühle verfügte über eine drehbare Kappe, die<br />
mittelst eines bis zur Galerie herunterreichenden Hebelbalkens gedreht werden konnte.<br />
Das Mühlenhaus war eine mit Holzschindeln bedeckte Holzkonstruktion, die <strong>auf</strong> einen<br />
Steinsockel <strong>auf</strong>gelegt war.<br />
Sie verfügte über zwei Mahlgänge und einen Pellgang. Die Mahlgänge waren mit<br />
Sichtemaschinen zur Mehlproduktion ausgestattet. Der Typologie Notebaarts folgend<br />
kann die Windmühle der Hauptklasse B - vertikale Windmühlen - und der Klasse III -<br />
Mühle mit drehbarer Haube - zuordnet werden. Wie die II. Lüdenhauser Windmühle<br />
gehört sie zum Typ c. oder d., wo<strong>bei</strong> eine hohe Wahrscheinlichkeit für Typ d. - die eckige<br />
Turmwindmühle - spricht. Die <strong>bei</strong>den Varianten - taillierte bzw. nicht taillierte Form -<br />
lassen sich nicht bestimmen. Anders als <strong>bei</strong> der II. Lüdenhauser Mühle nähern die Flügel<br />
sich nicht <strong>dem</strong> Erdboden, sondern sind höher an den Wind gebracht. Flügelsegel und<br />
Hebelbalken werden von einem L<strong>auf</strong>steg - Galerie - aus bedient. Die Mühle lässt sich<br />
damit als "Holländer", genauer gesagt, als "L<strong>auf</strong>stegmühle" bestimmen. Dieser<br />
Mühlentyp wird oft auch "Galerieholländer" genannt. 23<br />
c) Eigentums- und Rechtsverhältnisse<br />
Bis zu ihrer Zerstörung im Jahre 1737 waren ausschließlich Zeitpächter <strong>auf</strong> der Mühle.<br />
Sie war eine herrschaftliche Zeitpachtmühle, der ein Zwangsrecht <strong>auf</strong> die zugewiesenen<br />
Mahlgenossen zustand.<br />
d) Konjunkturverl<strong>auf</strong><br />
Von 1703 bis 1737 erhöhte sich die Anzahl der potentiellen Mahlgenossen nur<br />
unwesentlich <strong>auf</strong> etwa 660 Personen 24 . Von Beginn an stellt sich die Ertragslage der<br />
Mühle ungünstig dar, obwohl den Pächtern der damals modernste Windmühlentyp zur<br />
Verfügung stand und der Zeitpachtzins mit 40 Tlr. jährlich sehr gering war. Die Ursachen<br />
sind vielfältig und zum Teil Resultat der damaligen prekären wirtschaftlichen Lage der<br />
Grafschaft Lippe. 1711 erhielt der Zeitpächter Piper <strong>bei</strong>spielsweise einen 3jährigen<br />
Zeitpachtvertrag, in <strong>dem</strong> er sich verpflichtete, alle Unterhaltskosten der Mühle zu<br />
übernehmen, auch die, die durch "Unglücksfälle, durch Feuer oder sonsten" entstanden.<br />
Die Rentkammer entlastete sich damit von allen Unterhaltskosten. Lediglich das<br />
notwendige Bauholz wurde frei angewiesen. Weiter war es offensichtlich ein Fehler<br />
gewesen, eine Mühle nach <strong>dem</strong> neuesten Stand der Technik zu errichten. Sie war<br />
technisch noch nicht genügend ausgereift; die Mühle <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Windberg</strong> <strong>dem</strong> Wetter zu<br />
exponiert ausgesetzt, was die vielen Schäden und Reparaturen verdeutlichen. Auch<br />
scheinen viele Pächter Probleme mit der Handhabung der Technik gehabt zu haben.<br />
Immerhin war die Technik so kompliziert und umfangreich, daß sie der Müller nicht<br />
allein, sondern nur mit Hilfe eines Mühlenknechtes vornehmen konnte. Die ständige<br />
Beschäftigung eines Knechtes erhöhte die bereits hohen Unterhaltskosten zusätzlich.<br />
1713 weigert sich Piper die Mühle weiterhin zu pachten. Es wird festgestellt, daß der<br />
Schlitten <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> großen Mahlgang zerbrochen ist. 1722 ist dieser Schaden immer noch<br />
nicht behoben, so daß davon auszugehen ist, daß in den 9 Jahren nur ein Mahlgang<br />
benötigt worden ist. Weiter sind 1713 <strong>bei</strong>de Beutelgänge (Sichtemaschinen)<br />
unbrauchbar. Die Galerie ist b<strong>auf</strong>ällig.<br />
Am 5.3.1714 zerstört ein Sturm die Flügel und zerbricht die Flügelwelle. Die Mühle steht<br />
längere Zeit still. 1718 wird der Zeitpächter Bauer von den Mahlgenossen beschuldigt zu<br />
ihren Ungunsten zu matten. Derartige Betrügereien der Müller können <strong>auf</strong> eine schlechte<br />
23 Die im Westfälischen Freilichtmuseum Detmold <strong>auf</strong>gebaute "Kappenwindmühle" gehört<br />
<strong>dem</strong> Typ des "Galerieholländers" an. Ähnlich, vielleicht mit einem konischen Mühlenhaus,<br />
muß die Lüdenhauser Windmühle ausgesehen haben.<br />
24 Schätzung nach: Kuhlmann, M., Bevölkerungsgeographie, (1954), Seite 115.
Ertragslage der Mühle hinweisen. 25 Im Januar 1722 ist die Galerie verfallen und der<br />
"Cupring" 26 so "verschoben und verdorben", daß die Kappe <strong>bei</strong> Sturm nur schwer<br />
umgedreht werden kann. Von April 1722 bis Oktober 1722 steht die Mühle wegen<br />
Reparaturar<strong>bei</strong>ten still. Bauer flüchtet im April 1722, unter Hinterlassung von 30 Tlr.<br />
Schulden, von der Mühle. Im Juni 1724 muss der Zeitpächter Kühnemann vor <strong>dem</strong><br />
Gogericht gegen die Mahlgenossen klagen, da sie die Mühle nicht mehr <strong>auf</strong>suchen,<br />
sondern umliegende Wassermühlen. Zu<strong>dem</strong> verlangt er eine Verfügung, daß das Korn 3<br />
Tage vor der Vermahlung <strong>auf</strong> die Mühle zu bringen sei. Zu diesen Wartezeiten waren die<br />
Mahlgenossen sicher nicht bereit. Im Dezember 1724 zerstört ein Sturm die Flügel und<br />
reißt die Flügelwelle herunter. Das große Achsrad und die Bremse werden ebenfalls<br />
zerstört, die Kappe und die Galerie durch die herunterfallende Flügelwelle beschädigt. Bei<br />
der Besichtigung der Schäden erweist sich der König als vermodert, da es bereits seit<br />
längerem in die Mühle hinein regnete. 1726 müssen neue Flügel angeschafft werden.<br />
1733 steht der Zeitpächter Frevert vor <strong>dem</strong> Ruin und kann sich nur durch Entlassung aus<br />
<strong>dem</strong> Zeitpachtvertrag retten. 1734 beschädigt ein Sturm erneut die Mühle. Sie wird nicht<br />
wieder in einen funktionsfähigen Zustand versetzt, sondern bleibt wüst liegen.<br />
Anscheinend bringt die Rentkammer die notwendigen Gelder für eine Reparatur nicht<br />
mehr <strong>auf</strong>. 1737 zerstört ein Sturm die Mühle vollständig. Die Reste der Mühle (Holz, 1<br />
Mühlstein und 1 Stück Eisen) werden 1738 für 16 1/2 Tlr. öffentlich versteigert. Der<br />
übriggebliebene steinerne Sockel wurde von <strong>dem</strong> nachfolgenden Pächter Harcke mit<br />
einem primitiven Dach versehen und dient zum Unterstellen der Pferde der<br />
Mahlgenossen, die die Harckes neue Mühle <strong>auf</strong>suchen.<br />
e) Pächter und Müller<br />
Hans Henrich Piper, Müller und Zeitpächter 1702 - 1713.<br />
Piper ist offensichtlich mit jenem im Lüdenhauser Kirchenbuch verzeichneten Henrich<br />
Jantzen Pipers identisch, der aus <strong>dem</strong> preußischen Amt Vlotho stammte und am<br />
7.1.1703 Philippina Elisabeth Freundts aus Lüdenhausen heiratete (StADt L 112 A<br />
Lüdenhausen Nr.3). Piper muss, wahrscheinlich von holländischen Mühlenbauern, das<br />
Mühlenbauhandwerk erlernt haben.<br />
Johan Dietrich Röteken, Zeitpächter 1713 - 1716. Forstverwalter zu Hohenhausen, dort<br />
u.a. Eigentümer der unteren Mühle (Althoffs Mühle). Er hatte einen namentlich nicht<br />
bekannten angestellten Müller oder Afterpächter <strong>auf</strong> der Mühle.<br />
Johan Henrich Bauer, Müller und Zeitpächter 1716 - 1722. Flieht 1722 heimlich von der<br />
Mühle.<br />
Johan Berndt Kamp, Müller und Zeitpächter 1722.<br />
Tönnies Lau, Müller und Zeitpächter 1723 - 1724. Aus der Grafschaft Bückeburg.<br />
Cordt Philip Kühnemann, Müller und Zeitpächter 1724 - 1726.<br />
25 Siehe zum Vorwurf des betrügerischen Mattens: StADt L 89 AI Nr.342 , S. 317, Wruge<br />
des Küsters zu Lüdenhausen gegen Windmüller Bauer, Jahre 1718. Durch den Verdacht<br />
der Betrügerei verlor Bauer anscheinend viele Mahlgenossen, denn 1719 wrugt er vor<br />
<strong>dem</strong> Gogericht gegen 16 Mahlgenossen, weil sie nicht <strong>bei</strong> ihm mahlen lassen (S.397).<br />
26 Die bewegliche Lagerung der Kappe, "womit die oberste gantze Mühle regiret und <strong>auf</strong><br />
eiserne gegossene Trilen hin und her gedrehet werden muß". Der "Cupring" besteht aus<br />
einem "Krantz von Eichenholz worin die Trilen gehen". Beschreibung des "Cupringes" der<br />
Lüdenhauser Windmühle im März 1722.
Phillip Frevert, Müller und Zeitpächter 1726.<br />
Hans Henrich Frevert, Müller und Zeitpächter 1726 - 1734. Bruder von Phillip Frevert,<br />
<strong>bei</strong>de aus Niedermeien.<br />
IV. Windmühle (1737 - 1836)<br />
a) Bauherr<br />
Der 4. Mühlenbau erfolgte unter der vormundschaftlichen Regierung der Gräfin<br />
Johannette Wilhelmine. Errichtet wurde die Mühle <strong>auf</strong> Kosten des Müllers und<br />
Zeitpächters Cord Harcke. Die Rentkammer verrechnete Harcke die Baukosten mit einer<br />
6jährigen Befreiung vom Zeitpachtzins. Errichtet wurde die Mühle von Meister Christian<br />
Pohlman. 27<br />
Baugeschichte<br />
Bauzeit 24.4.1737 bis 24.8.1737.<br />
Meister Pohlman und 3 Gesellen - 104 Ar<strong>bei</strong>tstage.<br />
Festpreis bis zur Fertigstellung 100 Tlr.( Abb.3). Kost Meister (tägl. 4 gr.) 11 Tlr. 20 gr.<br />
Vorkost und Gedeck. Gesellen (a 2 gr.) 17 Tlr. 12 gr..<br />
Meister Christoff Böcken aus Asendorf für Tischlerar<strong>bei</strong>ten 25 Tlr..<br />
Christian Sieker und Helfer für Holz fällen und schneiden 14 Tlr. 20 gr..<br />
Jost Herman Bigeman Abtransport Bäume 18 gr..<br />
Diederich Bode von Heidelbeck für Holz schneiden 4 Tlr. 34 gr..<br />
Christoff Henrich Bekendorf aus Seltze liefert eine "eiserne Dreff", eine neue "Haue,<br />
Spille und Pfanne 28 ". 35 Tlr..<br />
Schmied Hanß Herman Kisau aus Lüdenhausen für Schmiedear<strong>bei</strong>ten 38 Tlr. 35 gr..<br />
Maurer Johann Henrich Spangenberg aus Lüdenhausen für Maurerar<strong>bei</strong>ten 6 Tlr. 4 gr..<br />
Hans Cord Böcken aus Asendorf liefert Kalk 3 Tlr..<br />
Der Ziegelmeister Frantz Hille von Möllenbeck liefert 400 Hangsteine, 100 Backsteine und<br />
24 "Krimpsteine" 4 Tlr. 3 gr..<br />
Schmied Otto Wilhelm Lüdersen aus Silixen für die Lieferung von 2.750 Nägeln 6 Tlr. 7<br />
gr..<br />
Johan Diderich Starcke für die Anfertigung von Fensterrahmen und Türen 1 Tlr. 14 gr..<br />
Glaser Arendt Dieterich Wege aus Lemgo für die Lieferung und Einsetzen von Fensterglas<br />
2 Tlr. 30 gr..<br />
Windmüller Cord Harcke für 4 Monate Ar<strong>bei</strong>t <strong>bei</strong>m Mühlenbau 16 Tlr..<br />
Gesamtkosten Mühlenbau 287 Tlr. 17 gr..<br />
27 Einer der Nachkommen des Mühlenbaumeisters Christian Pohlman war vielleicht jener<br />
Johann Heinrich Pohlmann, der 1787 die Bockwindmühle zu Machtsum (Harsum, Kreis<br />
Hildesheim - Marienburg) erneuerte. Zur Bockwindmühle zu Machtsum siehe:<br />
Großmann, G.U./ Schulte I., Die Bockwindmühle, (1986), Seite 77.<br />
28 Eisernes Lager für die Spille, die den Läuferstein trägt.
Abb. 3 Zahlungsbeleg von Meister Christian Pohlman: „Daß ich Endes benanter habe von<br />
cordt Harcken vor die neuen windt Mühlen zu bauen habe Endtfangen 100 Tlr. schreibe<br />
Hundert thaler bezahlet und einen freyen thisch und vor meine gesellen die vorkost<br />
solches wirt hirmit quitiret und bescheiniet dießes<br />
Lühn haußen d. 24ten august 1737. Mstr. Christian Pohlman“<br />
(StADt L 92 C Tit. 12 Nr. 10 Vol. II)<br />
Weitere Ausgaben:<br />
Ein neuer Mühlenstein 32 Tlr..<br />
Meister Christian Pohlmann für die Zubereitung und Aufbringung des Steines 5 Tlr..<br />
Schmied Hanß Hermann Kisau für Anbringung eines eisernen Bandes um den Stein und<br />
Anfertigung von Ar<strong>bei</strong>tszeug (?) 4 Tlr. 31 gr..<br />
Der Reipschläger Jacob Schamhard für 2 neue Seile (Gewicht 32 Pf. = 15 kg) für<br />
Sackwinde 4 Tlr. 20 gr..
Jacob Schamhard für ein neues Steinseil (Zum Abheben der Mühlsteine 29 / Gewicht 28<br />
kg) 7 Tlr. 13 gr..<br />
b) Beschreibung der Mühle 30<br />
Mühlenhaus mit Fichtenbrettern bekleidet. Hebelbalken zu Drehen des Mühlenhauses -<br />
"Der Stehrt womit die Mühle umgedrehet wird". Treppen<strong>auf</strong>gang - "Treppe an der<br />
Mühle". Eingang - "Tür vor der Mühlen". Fenster unterste Boden - "3 runde Aus Lüchte,<br />
inwendig mit hölzernen Schufers (Schieber, Anm. Autor) versehen". Fenster oberste<br />
Boden - "An <strong>bei</strong>den Seiten 2 runde Aus Lüchte, welche mit 2 inwendigen Schöfers<br />
versehen." Ladeluke oberster Boden -Hinterwärts die Lucke, wofür eine Tür". Flügel -<br />
"<strong>bei</strong>de Flügel mit Lackens". Das Dach mit Holzschindeln gedeckt. Der Bock 31 : Untere und<br />
obere Schwelle - "Gründe unter der Mühle". Streben - "8 Schrath Stender unter der<br />
Mühlen". Hausbaum - "Mühlen Pfahl". Hammer - "Mehl Balcken". Unterste Boden oder<br />
Mehlboden: Dielenlage - "Unterste Beschuß in der Mühlen aus Dannen Pösten".<br />
Sichtemaschine - "Mehlkasten und Trog". Treppen<strong>auf</strong>gang zum obersten Boden oder<br />
Steinboden - "Vom untersten Theil der Mühle gehet man mittelst einer aus 9 Tritte<br />
befindlichen Treppe <strong>auf</strong> den obersten Theil der Mühle". Oberste Boden oder Steinboden:<br />
Auflager des Bodensteins und Steinkiste - "Mühlenbett benebst der Bühne". Läuferstein -<br />
"Oberläufer 14 Zoll dick (340 mm), 5 1/2 Fuß lang (Durchmesser 1,595 mtr.)".<br />
Bodenstein - "Unterste Mühlenstein 1 Fuß dick (290 mm), 5 1/2 Fuß lang". Trichter -<br />
"der Rump". Mühleisen - "Spille". Kammrad und Flügelwelle - "Kam Radt und die Welle<br />
im Kam Radt". Bremse - "die Preße mit 2 Ketten". Halsblock und Ahnwellbalken (Lager<br />
der Flügelwelle) - "Halß Balcken worin die Welle läuft" und "der Tref Balcke (?)".<br />
Sackwinde - "die Winde wor<strong>auf</strong> das Korn <strong>auf</strong>gezogen". Sichtemaschine - "Stecke (?),<br />
nebst denen Beutel und Sieben".<br />
Einer Inventarisation vom Januar 1833 und zwei Protokollen des Lüdenhauser<br />
Zimmermeisters Nacken aus den Jahren 1804 und 1823 sind folgende Maße zu<br />
entnehmen: Schwellen - 26 Fuß lang und 26 Zoll Kantenhöhe (7,54 m/ 620 mm).<br />
Streben - 14 Fuß lang und 12 Zoll Kantenhöhe (4,06 m/ 289 mm). Hebelbalken - 42 Fuß<br />
lang und 18 Zoll Kantenhöhe (12,18m/ 434 mm). Ortständer (Eckständer Mühlenhaus) -<br />
22 Fuß lang und 12 Zoll Kantenhöhe (6,38 m/ 289 mm; das Mühlenhaus hat damit eine<br />
max. Höhe bis Dachkante von 6,38 m). Halsblock - 14 Fuß lang und 24 Zoll Kantenhöhe<br />
(4,06 m/ 579 mm). Flügelwelle - 21 Fuß 2 Zoll lang lang und 2 Fuß Durchmesser (6,14<br />
m/ 580 mm). Flügelkreuz - 66 Fuß im Durchmesser (19,14 m). Kammrad - 10 Fuß im<br />
Durchmesser (2,90 m) mit 84 Kämme. Stockgetriebe - mit 12 Stöcke ("Stecken").<br />
Firstpfette - 22 Fuß lang (6,38 m). Bremse - 37 Fuß lang (10,73 m). Bodenstein - 5 Fuß<br />
5 Zoll Durchmesser (1,57 m). Läufer - 3 Fuß 6 Zoll Durchmesser (1,015 m).<br />
Notebaarts Typologie folgend gehört die Mühle zur Hauptklasse B und zur Klasse II., den<br />
Mühlen mit drehbarem Mühlenhaus. Er unterscheidet da<strong>bei</strong> in 4 Typen. Die Lüdenhauser<br />
Mühle gehört <strong>dem</strong> Typ a. an, der "Bockmühle" 32 , d.h.,"das ganze Mühlenhaus ist drehbar<br />
um einen dicken, runden Pfahl gebaut, den sogenannten Bock". Weiter unterscheidet er<br />
in 4 Varianten, die sich entweder an der Konstruktion des Bockes (Variante 1. und 2.)<br />
orientiert, oder aber an der Form des Schutzes des Bockes vor Witterungseinflüsse<br />
29 Vorläufer des Steinkrans.<br />
30 Nach einer Inventarisation vom 21.9.1765.<br />
31 Hochdeutsche Terminologie nach: Großmann, G.U. u. Schulte I., Die Bockwindmühle,<br />
(1986).<br />
32 Windmühlen, S.15, S.18 ff. Die anderen Typen: b. die Wipp- oder Köchermühle, c. die<br />
Paltrockmühle, d. die Schreckmühle.
(Variante 3. und 4.). Da sich Baulichkeiten zum Schutz des Bockes <strong>bei</strong> der Lüdenhauser<br />
Mühle quellenmäßig nicht belegen lassen, läßt sie sich der Variante 2. zuordnen, <strong>bei</strong> der<br />
der Bock "durch einige schräge Balken gestützt" wird 33 . Notebaart bezeichnet diese<br />
Variante als "offene Bockmühle". Der <strong>bei</strong> uns gewöhnlich verwendete Ausdruck für die<br />
"Bockmühle" ist Bockwindmühle. 1837 wird die Lüdenhauser Mühle "Pfahlwindmühle"<br />
genannt. Cord Harcke schreibt 1736, er wolle die Mühle "uff einen Pfahl" bauen.<br />
c) Eigentums- und Rechtsverhältnisse<br />
Auch diese Mühle blieb Zeit ihres Bestehens eine herrschaftliche Mühle mit zugeordneten<br />
Zwangsmahlgästen. Seit 1765 wurde sie jedoch in Erbpacht vergeben. Sie war damit die<br />
letzte herrschaftliche Mühle im Amt Varenholz, deren Zeitpacht in eine Erbpacht<br />
umgewandelt wurde 34 . Die Umwandlung des Pachtverhältnisses wurde, wie <strong>bei</strong> vielen<br />
herrschaftlichen Mühlen, aktiv von der Rentkammer betrieben, um von den Unterhalts- ,<br />
Reparatur- und Baukosten entlastet zu werden. In Johan Henrich Harcke hatte man den<br />
geeigneten, vertrauenswürdigen Partner gefunden. Bereits sein Vater hatte 22 Jahre zur<br />
Zufriedenheit der Rentkammer der Mühle vorgestanden. Denn die Rentkammer hatte <strong>bei</strong><br />
der Erbverpachtung auch eine wichtige Funktion der herrschaftlichen Mühlen Rechnung<br />
zu tragen, nämlich als öffentliche Versorgungseinrichtung der Wohlfahrt der Untertanen<br />
zu dienen. Sie hatten die Mahlgenossen jederzeit mit ausreichend und qualitativ gutem<br />
Brotmehl zu versorgen. War die Rentkammer mit einem Zeitpächter nicht zufrieden,<br />
konnte sie ihn nach Abl<strong>auf</strong> der Pachtzeit leicht von der Mühle setzen. Beim Erbpächter<br />
gestaltete sich dies schwieriger. Laut den standardisierten Erbpachtbriefen war dies nur<br />
möglich, wenn der Erbpächter den Erbpachtzins für ein ganzes Jahr "drey Monate über<br />
die Verfallzeit unabgeführet" ließ, oder die Mühle "nicht im gehörigen Stand und Bau"<br />
erhielt. 35 Hielt er sich an diese Bedingungen waren er und seine Erben im Besitz der<br />
Mühle geschützt.<br />
d) Konjunkturverl<strong>auf</strong><br />
Von 1737 bis 1836 nahm die Bevölkerung in allen 3 Baurschaften beträchtlich zu. Von<br />
etwa 660 Personen <strong>auf</strong> etwa 1500 36 . Cordt Harcke hatte 1737 mit <strong>dem</strong> Bau einer<br />
Bockwindmühle mit einem Mahlgang eine wirtschaftlich vernünftige Entscheidung<br />
getroffen. Zusammen mit einer Handgrützemühle reichte der Mahlgang aus, die<br />
Grundbedürfnisse der Bevölkerung abzudecken. Die einfache und althergebrachte<br />
Technik der Bockwindmühle verursachte über Jahrzehnte kaum Kosten an Reparaturen<br />
und Verdienstausfall während des Stillstandes der Mühle. Lediglich 1757 und 1758 waren<br />
kleinere Reparaturen erforderlich. 1765 mußten allerdings der Hammer, eine Welle, ein<br />
33 Diese Beschreibung ist nicht korrekt. Die Hauptfunktion der "schrägen Balken", die<br />
besser als "Streben" zu bezeichnen sind, ist nicht das "Stützen" des Pfahls oder<br />
Hausbaumes, sondern die, das Gewicht des Mühlenhauses <strong>auf</strong> die Steinsockel unter den<br />
Gründen abzuleiten. Es sei noch dar<strong>auf</strong> hingewiesen, daß die Verwendung "doppelter<br />
Streben" (d.h. statt 4 Streben deren 8 Streben) wie <strong>bei</strong> der Lüdenhauser Mühle<br />
belegbar, einem älteren Konstruktionsprinzip entspricht. In neuerer Zeit wurden nur 4<br />
Streben verwandt. Vgl. hierzu: Großmann, G.U. u. Schulte I., Die Bockwindmühle,<br />
(1986), Seite 38 f. und Seite 77.<br />
34 Zusammen mit der Steinmühle <strong>bei</strong> Lemgo, die ebenfalls erst 1765 in Erbpacht<br />
vergeben wurde.<br />
Die anderen herrschaftlichen Mühlen des Amtes Varenholz: Erbpachtmühle<br />
Langenholzhausen 1659; Stemmer Mühle 1694; Niedernmühle 1659.<br />
35 Zitat: Erbpachtbrief für Statius Hermann Harcke vom 15.1.1788.<br />
36 Geschätzt nach: Kuhlmann, M., Bevölkerungsgeographie, (1954), Seite 115.
Flügelbalken und eine Schwelle erneuert werden. Auch hatte die Rentkammer in der<br />
Müllerfamilie Harcke Pächter gefunden, die ihr Handwerk verstanden und mit<br />
Gewissenhaftigkeit über mehrere Generationen versahen. Die Rentkammer konnte ohne<br />
Protest Cordt Harckes den Erbpachtzins von 50 Tlr. im Jahre 1737 bis 1754 <strong>auf</strong> 108 Tlr.<br />
erhöhen; Zeichen einer guten Ertragslage. So nahmen Ar<strong>bei</strong>t und Leben <strong>auf</strong> <strong>dem</strong><br />
<strong>Windberg</strong> bis in die 70er Jahre einen ruhigen L<strong>auf</strong>. Erst die Krisenjahre zu Beginn der<br />
70er Jahre, in denen nur wenig Korn <strong>auf</strong> die Mühlen zum Mahlen gebracht wird, bringen<br />
die Lüdenhauser Mühle in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Allerdings liegen von Harcke,<br />
im Gegensatz zu anderen Müllern des Amtes Varenholz, keine Gesuche um Minderung<br />
des Erbpachtzinses vor. Die wirtschaftliche Situation war jedoch so schlecht, daß die<br />
Wartung der Mühle vernachlässigt werden musste. So muss Statius Hermann Harcke<br />
1787, nach <strong>dem</strong> Tode seines Vaters, der Rentkammer melden, daß die Mühle sich in<br />
"einem erbärmlichen Zustand" befinde. Wegen der schlechten Ertragslage versucht<br />
Harcke 1790 eine Verringerung des Erbpachtzinses zu erreichen, und begründet dies<br />
besonders mit <strong>dem</strong> "starken Kartoffelanbau" der dazu führe, "daß viel weniger Korn<br />
gemahlen und geschrotet wird". 1791 schreibt er der Rentkammer: "Ich könnte die<br />
Mühle in Erbpacht, wenn ich ein ehrlicher Mann dabey bleiben solle, gewißenhaft nicht<br />
behalten". 1801 verstirbt Statius Hermann im 38. Lebensjahr und hinterlässt 6<br />
unmündige Kinder. Die Obervormundschaft für die Kinder übernimmt das Amt Varenholz,<br />
die Vormundschaft der "Chirurgus" Diederich Adolpf Mosel aus Silixen, Großvater<br />
mütterlicherseits der Kinder und der Bruder des Verstorbenen, Müller Johann Henrich<br />
Harcke, Pächter der Langenbrücker Mühle zu Lemgo. Die Afterpacht der Windmühle<br />
übernimmt Mosel. 1804 sucht Mosel um Verringerung der Pacht nach und weist <strong>auf</strong> den<br />
schlechten baulichen Zustand der Mühle hin, die umfangreiche Reparaturen erforderlich<br />
macht. Auch das Wohnhaus und das Backhaus waren reparaturbedürftig. Die Ertragslage<br />
der Mühle hat sich weiter verschlechtert, da die <strong>bei</strong>den Branntweinbrennereien Bode und<br />
Freund in Lüdenhausen ihren Betrieb eingestellt hatten und der Mühle damit wöchentlich<br />
18 Scheffel Schrotkorn verloren gegangen waren (etwa 720 kg Roggen). Die Reparatur<br />
der Mühle, die laut Mosel vor <strong>dem</strong> Einsturz stand, unterblieb. Mosel gibt die Mühle <strong>auf</strong>,<br />
Hußmann, der nächste Afterpächter, muss nachts heimlich von der Mühle fliehen. Der<br />
nächste Müller, Afterpächter Pätig, vormals Pächter der St.Johannis Mühle in Lemgo, ist<br />
bereits nach einem Jahr wirtschaftlich ruiniert. Er hatte die Mühle nach Stellung einer<br />
Kaution von 440 Tlr., der Übernahme des Pachtzinses von 108 Tlr. und zusätzlich 22 Tlr.<br />
an den Vormund der Harckschen Kinder übernommen. 1810 schreibt er der<br />
Rentkammer, er könne "trotz allen Fleiß und Wissen nicht von der Mühle leben". Für die<br />
Reparatur der Mühle blieb kein Geld, so daß sie weiter verfiel. Zu allem Unglück<br />
erkrankte Pätig schwer, so daß seine Familie Hunger leiden musste. Nach Pätig wird in<br />
den Jahren 1815/1816 noch ein Pächter Bock erwähnt. Im Dezember 1816 tritt<br />
schließlich Statius Hermanns ältester Sohn Bernhard Wilhelm August im Alter von 26<br />
Jahren die Erbpacht an und übernimmt die Mühle; verlässt sie jedoch im Januar 1819<br />
wieder, nach<strong>dem</strong> die Rentkammer einer Verringerung des Erbpachtzinses nicht<br />
zugestimmt hatte. Im März 1819 verk<strong>auf</strong>t er Mühle und Erbpacht für 1.500 Tlr. an den<br />
Müllergesellen Johan Christian Keßler aus Heidelbeck. Mit Antritt der Erbpacht Ostern<br />
1722 setzt er mittelst hoher Investitionskosten die Mühle wieder in Stand. Am<br />
31.10.1823, morgens 9 Uhr, wirft ein Sturm die Mühle um. Der inzwischen vollkommen<br />
verarmte Keßler ist nicht mehr in der Lage die Mühle aus eigenen Mitteln wieder<br />
<strong>auf</strong>zubauen. Mit finanzieller Hilfe aus der Leihkasse investiert Keßler 400 Tlr. <strong>bei</strong>m<br />
Wieder<strong>auf</strong>bau der Mühle. Aufgebaut hat die Mühle ein Mühlenbaumeister aus Minden.<br />
Keßler wollte auch noch einen Graupengang einrichten, um mit den umliegenden Mühlen<br />
konkurrieren zu können, die seine Mahlgenossen mehr und mehr <strong>auf</strong>suchten. Sie gaben<br />
sich nicht mehr mit der Qualität des Brotmehls zufrieden, die Keßler mit seinem<br />
Mahlgang erzielen konnte. Sie verlangten nun, daß vor der Vermahlung das Brotkorn<br />
(Roggen und Gerste) <strong>auf</strong> einem Graupengang geschält wird, um feineres Mehl zu
erhalten. Die finanziellen Mittel Keßlers reichten jedoch nicht mehr zu dieser Investition.<br />
1826 konnte sich Keßler nur durch einen Vergleich mit seinen Gläubigern vor <strong>dem</strong><br />
Konkurs retten. Gesuche um Senkung der Erbpacht werden von der Rentkammer<br />
abgelehnt. 1826 verpachtet Keßler die Mühle an den Müller Heinrich Krüger aus<br />
Herbrechtsdorf. Nach dessen Tod Ende 1827 übernimmt der Müller Henrich Friedrich<br />
Meyer aus Flegesen als Afterpächter des inzwischen unter Subhastation stehenden<br />
Keßler die Mühle. Ihm folgt der Müller Henrich Meier aus Heinbüchenbruch. Im Oktober<br />
1836 verlässt auch er die Mühle. Ein mehrmaliger Versuch der Rentkammer die Erbpacht<br />
zu versteigern scheitert, da niemand an ihrer Übernahme interessiert ist. In ihrem<br />
Auftrage betreibt der Zimmermeister Nacke aus Lüdenhausen bis Oktober die Mühle. Der<br />
bauliche Zustand der Mühle ist jedoch bereits so desolat, daß sie kaum noch betrieben<br />
werden kann. Schließlich weigert sich Nacke die Mühle weiter zu betreiben, da er um sein<br />
Leben fürchtet. In der Nacht vom 29.11.1836 wird die Mühle durch einen Sturm<br />
vollständig zerstört. Da<strong>bei</strong> verletzte der berstende Mühlenschwanz den Müllergesellen<br />
Petig schwer, der mit mehreren Mahlgenossen vermutlich versucht hatte, die Mühle zu<br />
retten. Am 3.12.1836 wird ein Teil des Holzes meistbietend für 24 Tlr. öffentlich<br />
versteigert.<br />
e) Pächter und Müller<br />
Cord Harcke, Müller und Zeitpächter 37 .<br />
* 1699, # 9.12.1759 Lüdenhausen. ? * 1700,<br />
# 25.1.1761 Lüdenhausen.<br />
Bis 1737 Windmüller zu Escher, Kreis Schaumburg Lippe.<br />
1737 - 1759 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Kd. 1 S./1 T., weitere nicht bekannt.<br />
Johan Henrich Harcke, Müller und Zeitpächter,<br />
seit 1765 Erbpächter.<br />
Sohn von Cord Harcke.<br />
* 3.1727, # 14.4.1786 Lüdenhausen. 6.4.1753 Lüdenhausen Webers, Anna Margarete<br />
(aus Göstrup, Kolonat Nr.21 im Hüttenhau).<br />
1759 - 1786 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Kd. 5 S./5 T.<br />
Statius Hermann Harcke, Müller und Erbpächter.<br />
4. Kind von Johan Henrich Harcke.<br />
~ 27.8.1762 Lüdenhausen, + 24.2.1801 Lüdenhausen.<br />
21.9.1787 Lüdenhausen Mosels, Marie Elisabeth (aus Silixen).<br />
1782 - 1784 Geselle <strong>auf</strong> der Bergischen Windmühle im Amt Pyrmont <strong>bei</strong> Müller Hermann<br />
Ernst Herbst.<br />
1787 - 1801 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Kd. 5 S./1 T.<br />
Diederich Adolpf Mosel, Afterpächter, "Chirurgus" zu Silixen, Schwiegervater von Statius<br />
Hermann Harcke, Vormund von Bernhard Wilhelm August Harcke.<br />
37 Quellen zur Genealogie der Familie Harcke: StADt L 112 A Lüdenhausen<br />
Bd.3/Bd.4/Bd.5.<br />
StADt Kirchenbuchkartei, Kirchengemeinde Bad Salzuflen.<br />
Abkürzungen: # - begraben/ + verstorben/ * - geboren/ ~ - get<strong>auf</strong>t/ verheiratet/ Kd. -<br />
Kinder/ S. - Sohn/ T. - Tochter
Afterpächter 1801 - ?.<br />
Hußmann (oder Hausmann), Müller und Afterpächter.<br />
Afterpächter frühestens 1805 bis 1809.<br />
Friederich Wilhelm Petig, Müller und Afterpächter.<br />
Vorher Pächter der St.Johannis Mühle zu Lemgo.<br />
Afterpächter 1809 - 1815.<br />
Bock, Müller und Afterpächter.<br />
Später <strong>auf</strong> der Steinmühle <strong>bei</strong> Lemgo.<br />
Afterpächter 1815 - 1816.<br />
Bernhard August Wilhelm Harcke, Müller und Erbpächter.<br />
2. Kind von Statius Hermann Harcke.<br />
* 24.4.1790 Lüdenhausen, + 27.2.1851 Salzuflen.<br />
21.12.1813 Salzuflen Kuhlemann, Johanne Friederike Henriette (aus Salzuflen).<br />
1816 - 1819 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Lebte seit 1819 als Salinenar<strong>bei</strong>ter und Zimmermann in Bad Salzuflen.<br />
Kd. 3 S./1 T.<br />
Johan Christian Keßler, Müller und Erbpächter.<br />
1819 - 1822 Afterpächter, Erbpächter bis 1837.<br />
* Heidelbeck.<br />
3 Jahre Lehre <strong>auf</strong> der Schlingmühle <strong>bei</strong> Müller Hillebrecht. 8 Jahre Müllergeselle <strong>auf</strong> der<br />
Niedernmühle Kalldorf.<br />
1819 - 1826 Windmüller zu Lüdenhausen. Erbpacht bis 1837 unter Zwangsverwaltung<br />
(Verwalter Bürgermeister Petri, Lemgo). Verzieht nach Lachendorf <strong>bei</strong> Celle.<br />
Heinrich Krüger, Müller und Afterpächter.<br />
Aus Herbrechtsdorf.<br />
1826 - 1827 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Heinrich Friedrich Meyer, Müller und Afterpächter.<br />
Aus Flegesen.<br />
1828 - 1831 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Verzieht nach Schönhagen.<br />
Henrich Meyer, Müller und Afterpächter.<br />
1831 bis 1836 Windmüller zu Lüdenhausen.
Seit 1837 Windmühlenpächter zu Eisbergen <strong>bei</strong> Rinteln..<br />
V. Windmühle 1838 - 1909<br />
a) Bauherr<br />
Während des 3.Versteigerungstermin im Mai 1837 wurde die vakante Erbpacht <strong>dem</strong><br />
bisherigen Posthalter aus Uchte ,Heinrich Ludewig Thiermann, zugesprochen. Der am<br />
7.7.1837 von der Rentkammer ausgestellte Erbpachtbrief gestattete Thiermann Bau und<br />
Betrieb einer Windmühle mit einem Mahl- und einem Graupengang. An der Errichtung<br />
der Mühle war die Rentkammer weder finanziell noch sonst beteiligt. Baubeginn war<br />
1838; in Betrieb gehen konnte die Mühle Anfang März 1839. Errichtet wurde sie von <strong>dem</strong><br />
"Kunstmeister" Kuhlemann aus Salzuflen. Thiermann gab gegenüber der Rentkammer<br />
an, daß die Baukosten <strong>bei</strong> etwa 4.000 Tlr. gelegen hätten. Für das Brandkataster wurde<br />
die Mühle wie folgt taxiert:<br />
Mauerwerk 507 Tlr. 27gr. 3 Pf..<br />
hölzerne Teile 367 Tlr. 27gr. 3 Pf..<br />
Schmiedesachen 295 Tlr. 32gr. - Pf..<br />
gehende Werk 992 Tlr. 5gr. 3 Pf..<br />
Gesamtwert 2.163 Tlr. 20gr. 3 Pf..<br />
b) Beschreibung der Mühle<br />
Die Windmühle ist nach "Art der Holländischen" erbaut worden und wird von Thiermann<br />
als "Massive Holländische Windmühle" bezeichnet. D.h. die Mühle verfügte über eine<br />
drehbare Kappe und das Mühlenhaus war aus Stein (wahrscheinlich Naturstein) errichtet.<br />
Die "hölzernen Teile": Hebelbalken - "Drehbaum" 38 Fuß lang (11,02 m), Stärke am Fuß<br />
14 x 16 Zoll (337 mm x 386 mm), an der Spitze 8 x 9 Zoll (193 mm x 217 mm),<br />
Eichenholz.<br />
Die Kappe: Bewegliche Lagerung der Kappe - "Drehkranz", Eichenholz. Windbalken -<br />
"Windbalken", Eichenholz. Schwertbalken 38 - "langes Spret", Eichenholz. Fughölzer - "2<br />
Lochbalken" a 22 Fuß lang (6,38 m), Eichenholz.<br />
Die Flügel: Bruststücke - "2 Blockruten" a 40 Fuß lang (11,6 m), Eichenholz. Spitzen - "4<br />
Spitzen zum Flügel" a 36 Fuß lang, 13 Zoll Kantenhöhe (10,44 m/314 mm), Fichtenholz.<br />
Das Mühlengetriebe: Sprüütbalken - "2 Spillbalken" a 9 Fuß (2,61 m), Eichenholz.<br />
Flügelwelle - "Hauptwelle", Eichenholz. König - "Kronwelle", Eichenholz. Stirnrad -<br />
"Kronspille", 10 Fuß Durchmesser (2,9 m), Eichenholz. Mahlgangsspindeln -<br />
"Spindel", 14 Fuß lang (4,06 m); "Spindel", 26 Fuß lang (7,54 mtr.), Fichtenholz 39 .<br />
Steinhebevorrichtung: Ständer - "2 Stender zum Stege", Eichenholz. Brüggbalk - "1<br />
Stech", 8 1/2 Fuß lang (2,46 m), Eichenholz.<br />
An Mahlgängen verfügte die Mühle über einen Roggenmahlgang und eine Graupenmühle<br />
(Pellgang).<br />
1839 besichtigte der Mühlenbauer Lambrecht aus Pötzen die Mühle und attestierte, er<br />
kenne "im ganzen Lippischen Lande und Umgebung keine Windmühle, die zweckmäßiger<br />
und vollkommender eingerichtet" sei.<br />
Die 1839 in Betrieb genommene V. Windmühle verfügte über eine drehbare Kappe, die<br />
mittelst eines Hebelbalkens gedreht werden konnte. Das Mühlenhaus war massiv aus<br />
Steinen <strong>auf</strong>geführt. Sie verfügte über einen Mahlgang und einen Pellgang (später 2<br />
Mahlgänge). Nach Notebaarts ist sie der Hauptklasse B - vertikale Windmühlen - und der<br />
Klasse III - Mühle mit drehbarer Haube - zuzuordnen. Erhaltene Abbildungen (Abb. 4, 5,<br />
6, 7) erlauben, sie <strong>dem</strong> Typ c. - konische Turmmühle - zuzuordnen. Bei der Mühle<br />
handelte es sich um einen sogenannter "Holländer", genauer gesagt ein "Bodensegler"<br />
38 Langer Balken, der <strong>auf</strong> <strong>bei</strong>den Seiten aus der Kappe herausragt. Mit einem zweiten,<br />
kürzeren Balken, dient er als Hebelarm zum Drehen der Kappe, wozu sie mit <strong>dem</strong><br />
Hebelbalken verbunden sind.<br />
39 Die unterschiedliche Länge der Mahlgangsspindeln läßt den Schluß zu, daß die<br />
Graupenmühle einen Boden tiefer als der Mahlgang lag.
oder "Erdholländer".<br />
Nach 1895 hat die Mühle eine neue Kappe mit einer Windrose erhalten (Umbau<br />
wahrscheinlich nach einem Brand).<br />
c) Eigentums- und Rechtsverhältnisse<br />
Bis 1878 blieb die Mühle eine herrschaftliche Erbpachtmühle. 1878 löste der<br />
Erbpachtmüller Karl Meyer die Erbpacht mit einer Zahlung von 7.000 RM ab. Die Mühle<br />
ging damit in alleiniges Eigentum Meyers über. Als Gewerbebetrieb existierte die Mühle<br />
bis 1909. Die Zwangsmahlgäste, durch den Erbpachtbrief vertraglich zugesprochen,<br />
verlor die Erbpachtmühle faktisch 1871 durch die Einführung der Gewerbefreiheit 40 in<br />
Lippe. Die Mahlgäste konnten sich frei zwischen den vorhandenen Mühlenbetrieben<br />
entscheiden.<br />
d) Konjunkturverl<strong>auf</strong><br />
Abb.4 Dorf Lüdenhausen mit Windmühle <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Windberg</strong>, um 1900. (Weltpostkarte.<br />
Kommunalarchiv Kalletal)<br />
1838 lebten in den 3, der Mühle zugeordneten Baurschaften, ca. 1.550 Menschen, die bis<br />
1880 <strong>auf</strong> etwa 1900 41 anwuchs. Ursprünglich wollte Thiermann im Erdgeschoß der Mühle<br />
noch eine Flachs - Bockemühle einbauen, einen Plan den er jedoch fallen ließ, zu Gunsten<br />
eines 2. Mahlganges, für den er problemlos eine Konzession von der Rentkammer erhielt.<br />
40 Bundes - Gewerbe - Ordnung vom 21.6.1869, Paragraphen 7 - 10. Lippische<br />
Landesverordnung vom 3.8.1870, Gesetzessammlung Nr.14, "die Aufhebung<br />
ausschließlicher Gewerbeberechtigungen, so wie der Berechtigungen zur Ertheilung<br />
gewerblicher Concessionen und zur Auferlegung gewerblicher Abgaben".<br />
41<br />
Kuhlmann, M., Bevölkerungsgeographie, (1954), Seite 115.
Abb.5 Windmühle Lüdenhausen, 1895. (Zeichnung Ernst Meier - Niedermeien.<br />
Kommunalarchiv Kalletal)<br />
Wahrscheinlich konnte er die gehobenen Ansprüche der Mahlgäste in Hinsicht <strong>auf</strong><br />
Feinheit und Qualität des Mehls nur so erfüllen. Noch vor Errichtung des 2. Mahlganges<br />
gerät Thiermann in finanzielle Schwierigkeiten und muss um Pachterlaß <strong>auf</strong> einige Jahre<br />
bitten. Die Rentkammer senkt 1839 den Erbpachtzins von 70 <strong>auf</strong> 30 Tlr. 1840 legt<br />
Thiermann schließlich einen neuen Mahlgang und eine neue Graupenmühle an, eine<br />
Investition die ihn scheinbar finanziell überforderte, denn 1842 verk<strong>auf</strong>t er die Mühle an<br />
den Müller Johann Heinrich Mohrlüder. Neben finanziellen Schwierigkeiten wird<br />
Thiermann wohl daran gescheitert sein, daß er berufsunerfahren war und das<br />
Müllerhandwerk seit 1837 sozusagen in einem "Crashkurs" erlernt hatte. Unverständlich<br />
bleibt, wie die Rentkammer <strong>bei</strong> der Versteigerung der Erbpacht 1837 diese Thiermann<br />
zuschlagen konnte, der der Rentkammer auch offen erklärt hatte, er "habe das<br />
Mühlenwesen bisher nicht betrieben, wolle es noch lernen". Da<strong>bei</strong> hatten gelernte Müller<br />
zum Teil ein höheres Pachtzinsangebot abgegeben. 1843 wird der Antrag Mohrlüders <strong>auf</strong><br />
Erteilung einer Konzession für einen Weizengang von der Rentkammer abgelehnt. Er<br />
begründete seinen Antrag, er habe zwar 2 Mahlgänge, "wor<strong>auf</strong> auch Weizenmehl<br />
verfertigt werden kann, daß Publikum verlangt aber eine besondere sogenannte<br />
Weizenmühle". Er müsse "sie anlegen, wenn er weiter von der Mühle leben will". Das<br />
Zitat zeigt deutlich, wie sehr sich mittlerweile auch ein Erbpachtmüller nach den<br />
Wünschen seiner Zwangsmahlgäste richten musste, um sie nicht an die Konkurrenz zu<br />
verlieren. Versuche die Zwangsmahlgäste durch mögliche juristische Mittel wieder an die<br />
Mühle zu binden, unternahmen weder Mohrlüder noch die Rentkammer. Unverständlich<br />
ist, daß die Rentkammer vor diesem Hintergrund den Weizenmahlgang nicht
konzessionierte. Denkbar ist, daß sie sich anderen konzessionierten Müllern gegenüber<br />
verpflichtet fühlte. Mohrlüder legt trotz fehlender Konzession 1844 einen<br />
Weizenmahlgang an,<br />
Abb.6 Windmühle Lüdenhausen, um 1900. (Zeichnung Ernst Meier - Niedermeien.<br />
Kommunalarchiv Kalletal)<br />
der nachträglich konzessioniert wird. Insgesamt erhöhte sich der Erbpachtzins dadurch<br />
<strong>auf</strong> 86<br />
Tlr.. Seit 1848 gerät Mohrlüder in wirtschaftliche Schwierigkeiten und verk<strong>auf</strong>t Mühle und<br />
Erbpacht. Seit <strong>dem</strong> Erbpachtmüller Friedrich Krüger wird die Mühle offensichtlich zu<br />
einem Spekulationsobjekt und wird bis 1877 siebenmal verk<strong>auf</strong>t (Reihenfolge und Name<br />
der Erbpächter siehe e. Pächter und Müller). Der Verkehrswert und Erbpachtzins der<br />
Mühle entwickelte sich da<strong>bei</strong> folgendermaßen:<br />
1852 8.125 Tlr. (Erbpacht 82 Tlr. 15 sgr.)<br />
1859 6.600 Tlr. (Erbpacht 102 Tlr.)<br />
1862 9.250 Tlr. (Erbpacht 102 Tlr.)<br />
1868 3.950 Tlr. (Erbpacht 102 Tlr.)<br />
Die Minderung des Verkehrswertes 1859 erklärt sich aus der Anlage der Bavenhauser<br />
Windmühle 1853, die sich zur bedeutenden Konkurrenz der Lüdenhauser Mühle<br />
entwickelte. Die Mahlgenossen suchten lieber diese Mühle <strong>auf</strong>, um sich den<br />
beschwerlichen Weg <strong>auf</strong> den <strong>Windberg</strong> zu ersparen. Später ist deshalb wegen der<br />
schlechten Erreichbarkeit der Mühle der Erbpachtzins um 3 Tlr. gemindert worden. Beim<br />
Verk<strong>auf</strong> 1868 waren sowohl das Wohnhaus als auch die Mühle in einem schlechten<br />
baulichen Zustand. Über lange Zeit verfügte die Mühle nur über einen Flügel. Der<br />
verantwortliche Erbpächter Karl Meyer ist 1868 in Konkurs gegangen. In dieser Zeit ist<br />
wohl der Mühle vom Volksmund der Beiname "Bankrottmühle" gegeben worden 42 . Nach<br />
Einführung der Gewerbefreiheit zum 1.1.1771 verschärft sich die wirtschaftliche Situation<br />
der Mühle weiter, bedingt durch die nun zahlreich möglich gewordenen<br />
42 Schäfer, H., Beiträge zur Geschichte des Dorfes Lüdenhausen, (1979), Seite 67.
Mühlenneugründungen. Der Müller Karl Meyer, seit 1877 Erbpächter, löst die Erbpacht<br />
1878 ab. Er wird 1894 wegen "Verschwendung" entmündigt 43 und der in Konkurs<br />
geratene Besitz im gleichen Jahr versteigert. Unter <strong>dem</strong> neuen Eigentümer, Müller<br />
Heinrich Meier aus Göstrup, brannte die Mühle wahrscheinlich ab 44 , und wurde noch<br />
einmal <strong>auf</strong>gebaut. 1909 gibt Meyer den Mühlenstandort <strong>auf</strong>, verk<strong>auf</strong>t den Besitz an den<br />
Landwirt Schnormeier und errichtet im Dorf eine Motormühle. Schnormeier lässt die<br />
Windmühle abreißen und verwendet die Steine zum Bau einer Stallung.<br />
Abb.7 Windmühle Lüdenhausen, um 1909. Foto, Kommunalarchiv Kalletal)<br />
e) Pächter und Müller<br />
Heinrich Ludwig Thiermann, Erbpächter.<br />
Posthalter aus <strong>dem</strong> Hannoverschen Amt Uchte.<br />
Erbauer der V.Windmühle.<br />
1837 - 1843 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Johann Heinrich Mohrlüder, Müller und Erbpächter.<br />
Aus Muntze, Amt Blumenau.<br />
Hat zeitweise Afterpächter <strong>auf</strong> der Mühle.<br />
1843 - 1851 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Reitemeier, Afterpächter von Mohrlüder.<br />
1843 - ?.<br />
Aus Vallentrup.<br />
Heinrich Scharringhausen, Müllergeselle und Afterpächter des Mohrlüder.<br />
Friedrich Krüger, Erbpächter.<br />
Bedienter zu Hannover, anschließend mehrere Jahre Eigentümer des Kruges zu Almena.<br />
Nach Verk<strong>auf</strong> des Kruges Erwerb der Mühle.<br />
1851 - 1852 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Frevert (oder Klemme), Müller und Erbpächter.<br />
Vor Mühlenpacht Landwirt <strong>auf</strong> Nr.26 zu Henstorf.<br />
43 Amtsblatt Nr.36, vom 5.5.1894.<br />
44 Schäfer, H., Beiträge zur Geschichte des Dorfes Lüdenhausen, (1979), Seite 67.
1852 - 1857 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Richterberg, Erbpächter.<br />
Von Lüdenhausen Nr.7.<br />
1857 - 1859 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Georg Quadfasel, Müller und Erbpächter.<br />
1859 - 1862 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Heinrich Kracke, Müller und Erbpächter.<br />
Aus Sehnde <strong>bei</strong> Burgdorf.<br />
1862 - 1864 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Karl Meyer, Müller und Erbpächter.<br />
Aus Hannover.<br />
1868 in Konkurs gegangen.<br />
1864 - 1868 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Richterberg (oder Sieker), Erbpächter.<br />
Von Lüdenhausen Nr.7.<br />
Hat Afterpächter <strong>auf</strong> der Mühle.<br />
1868 - 1877 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Ernst Kruse, Müller und Afterpächter.<br />
Bis 1878 Afterpächter von Meyer bzw. Richterberg.<br />
1879 bis etwa 1910 Pächter der Wassermühle Korfesmeier zu Hohenhausen.<br />
Karl Meyer, Müller und Erbpächter bzw. Eigentümer.<br />
Aus Nammen <strong>bei</strong> Hausberge. Schwiegersohn des Richterberg.<br />
Löst am 11.10.1878 Erbpacht ab.<br />
1894 in Konkurs geraten.<br />
1877 - 1894 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Heinrich Meier, Müller und Eigentümer.<br />
Aus Göstrup.<br />
Verk<strong>auf</strong>t die Mühle 1909 und erbaut in Lüdenhausen <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> Kolonat Nr.88 eine<br />
Motormühle.<br />
1894 - 1909 letzter Windmüller zu Lüdenhausen.<br />
Quellenangabe:<br />
Soweit im Text nicht angegeben sind folgende Quellen benutzt worden:<br />
StADt L 92 C Tit.12 Nr. 10 Vol. I/II/III/IV<br />
StADt L 92 N Nr. 1030<br />
StADt L 92 C Tit.I Nr.4<br />
StADt L 92 R Tit. VII Nr.3<br />
StADt L 92 C Tit.12 Nr.2 Vol. I<br />
StADt L 92 R Tit. VII.6 Nr.1