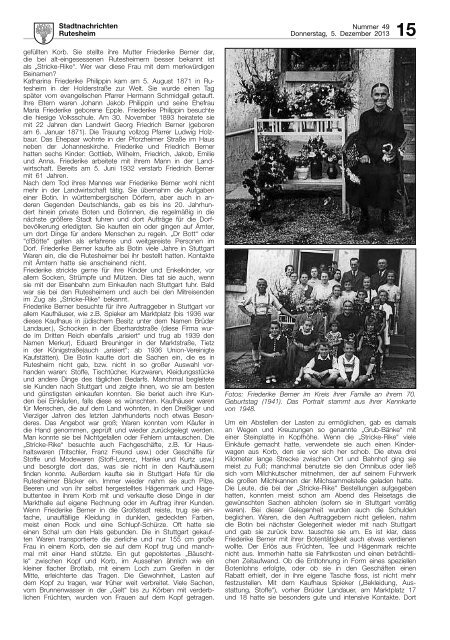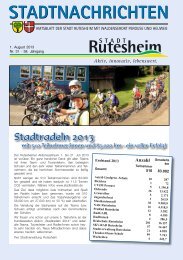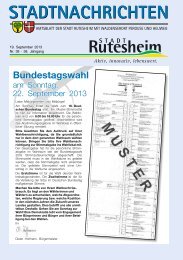Ausgabe Nr. 49 vom 05. Dezember 2013, Teil I - Rutesheim
Ausgabe Nr. 49 vom 05. Dezember 2013, Teil I - Rutesheim
Ausgabe Nr. 49 vom 05. Dezember 2013, Teil I - Rutesheim
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Stadtnachrichten<br />
<strong>Rutesheim</strong><br />
gefüllten Korb. Sie stellte ihre Mutter Friederike Berner dar,<br />
die bei alt-eingesessenen <strong>Rutesheim</strong>ern besser bekannt ist<br />
als „Stricke-Rike“. Wer war diese Frau mit dem merkwürdigen<br />
Beinamen?<br />
Katharina Friederike Philippin kam am 5. August 1871 in <strong>Rutesheim</strong><br />
in der Holderstraße zur Welt. Sie wurde einen Tag<br />
später <strong>vom</strong> evangelischen Pfarrer Hermann Schmidgall getauft.<br />
Ihre Eltern waren Johann Jakob Philippin und seine Ehefrau<br />
Maria Friederike geborene Epple. Friederike Philippin besuchte<br />
die hiesige Volksschule. Am 30. November 1893 heiratete sie<br />
mit 22 Jahren den Landwirt Georg Friedrich Berner (geboren<br />
am 6. Januar 1871). Die Trauung vollzog Pfarrer Ludwig Holzbaur.<br />
Das Ehepaar wohnte in der Pforzheimer Straße im Haus<br />
neben der Johanneskirche. Friederike und Friedrich Berner<br />
hatten sechs Kinder: Gottlieb, Wilhelm, Friedrich, Jakob, Emilie<br />
und Anna. Friederike arbeitete mit ihrem Mann in der Landwirtschaft.<br />
Bereits am 5. Juni 1932 verstarb Friedrich Berner<br />
mit 61 Jahren.<br />
Nach dem Tod ihres Mannes war Friederike Berner wohl nicht<br />
mehr in der Landwirtschaft tätig. Sie übernahm die Aufgaben<br />
einer Botin. In württembergischen Dörfern, aber auch in anderen<br />
Gegenden Deutschlands, gab es bis ins 20. Jahrhundert<br />
hinein private Boten und Botinnen, die regelmäßig in die<br />
nächste größere Stadt fuhren und dort Aufträge für die Dorfbevölkerung<br />
erledigten. Sie kauften ein oder gingen auf Ämter,<br />
um dort Dinge für andere Menschen zu regeln. „Dr Bott“ oder<br />
“d´Bötte“ galten als erfahrene und weitgereiste Personen im<br />
Dorf. Friederike Berner kaufte als Botin viele Jahre in Stuttgart<br />
Waren ein, die die <strong>Rutesheim</strong>er bei ihr bestellt hatten. Kontakte<br />
mit Ämtern hatte sie anscheinend nicht.<br />
Friederike strickte gerne für ihre Kinder und Enkelkinder, vor<br />
allem Socken, Strümpfe und Mützen. Dies tat sie auch, wenn<br />
sie mit der Eisenbahn zum Einkaufen nach Stuttgart fuhr. Bald<br />
war sie bei den <strong>Rutesheim</strong>ern und auch bei den Mitreisenden<br />
im Zug als „Stricke-Rike“ bekannt.<br />
Friederike Berner besuchte für ihre Auftraggeber in Stuttgart vor<br />
allem Kaufhäuser, wie z.B. Spieker am Marktplatz (bis 1936 war<br />
dieses Kaufhaus in jüdischem Besitz unter dem Namen Brüder<br />
Landauer.), Schocken in der Eberhardstraße (diese Firma wurde<br />
im Dritten Reich ebenfalls „arisiert“ und trug ab 1939 den<br />
Namen Merkur), Eduard Breuninger in der Marktstraße, Tietz<br />
in der Königstraße(auch „arisiert“; ab 1936 Union-Vereinigte<br />
Kaufstätten). Die Botin kaufte dort die Sachen ein, die es in<br />
<strong>Rutesheim</strong> nicht gab, bzw. nicht in so großer Auswahl vorhanden<br />
waren: Stoffe, Tischtücher, Kurzwaren, Kleidungsstücke<br />
und andere Dinge des täglichen Bedarfs. Manchmal begleitete<br />
sie Kunden nach Stuttgart und zeigte ihnen, wo sie am besten<br />
und günstigsten einkaufen konnten. Sie beriet auch ihre Kunden<br />
bei Einkäufen, falls diese es wünschten. Kaufhäuser waren<br />
für Menschen, die auf dem Land wohnten, in den Dreißiger und<br />
Vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts noch etwas Besonderes.<br />
Das Angebot war groß; Waren konnten <strong>vom</strong> Käufer in<br />
die Hand genommen, geprüft und wieder zurückgelegt werden.<br />
Man konnte sie bei Nichtgefallen oder Fehlern umtauschen. Die<br />
„Stricke-Rike“ besuchte auch Fachgeschäfte, z.B. für Haushaltswaren<br />
(Tritschler, Franz Freund usw.) oder Geschäfte für<br />
Stoffe und Modewaren (Stoff-Lorenz, Hanke und Kurtz usw.)<br />
und besorgte dort das, was sie nicht in den Kaufhäusern<br />
finden konnte. Außerdem kaufte sie in Stuttgart Hefe für die<br />
<strong>Rutesheim</strong>er Bäcker ein. Immer wieder nahm sie auch Pilze,<br />
Beeren und von ihr selbst hergestelltes Hägenmark und Hagebuttentee<br />
in ihrem Korb mit und verkaufte diese Dinge in der<br />
Markthalle auf eigene Rechnung oder im Auftrag ihrer Kunden.<br />
Wenn Friederike Berner in die Großstadt reiste, trug sie einfache,<br />
unauffällige Kleidung in dunklen, gedeckten Farben,<br />
meist einen Rock und eine Schlupf-Schürze. Oft hatte sie<br />
einen Schal um den Hals gebunden. Die in Stuttgart gekauften<br />
Waren transportierte die zierliche und nur 155 cm große<br />
Frau in einem Korb, den sie auf dem Kopf trug und manchmal<br />
mit einer Hand stützte. Ein gut gepolstertes „Bäuschtle“<br />
zwischen Kopf und Korb, im Aussehen ähnlich wie ein<br />
kleiner flacher Brotlaib, mit einem Loch zum Greifen in der<br />
Mitte, erleichterte das Tragen. Die Gewohnheit, Lasten auf<br />
dem Kopf zu tragen, war früher weit verbreitet. Viele Sachen,<br />
<strong>vom</strong> Brunnenwasser in der „Gelt“ bis zu Körben mit verderblichen<br />
Früchten, wurden von Frauen auf dem Kopf getragen.<br />
Nummer <strong>49</strong><br />
Donnerstag, 5. <strong>Dezember</strong> <strong>2013</strong> 15<br />
Fotos: Friederike Berner im Kreis ihrer Familie an ihrem 70.<br />
Geburtstag (1941). Das Portrait stammt aus ihrer Kennkarte<br />
von 1948.<br />
Um ein Abstellen der Lasten zu ermöglichen, gab es damals<br />
an Wegen und Kreuzungen so genannte „Grub-Bänke“ mit<br />
einer Steinplatte in Kopfhöhe. Wenn die „Stricke-Rike“ viele<br />
Einkäufe gemacht hatte, verwendete sie auch einen Kinderwagen<br />
aus Korb, den sie vor sich her schob. Die etwa drei<br />
Kilometer lange Strecke zwischen Ort und Bahnhof ging sie<br />
meist zu Fuß; manchmal benutzte sie den Omnibus oder ließ<br />
sich <strong>vom</strong> Milchkutscher mitnehmen, der auf seinem Fuhrwerk<br />
die großen Milchkannen der Milchsammelstelle geladen hatte.<br />
Die Leute, die bei der „Stricke-Rike“ Bestellungen aufgegeben<br />
hatten, konnten meist schon am Abend des Reisetags die<br />
gewünschten Sachen abholen (sofern sie in Stuttgart vorrätig<br />
waren). Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Schulden<br />
beglichen. Waren, die den Auftraggebern nicht gefielen, nahm<br />
die Botin bei nächster Gelegenheit wieder mit nach Stuttgart<br />
und gab sie zurück bzw. tauschte sie um. Es ist klar, dass<br />
Friederike Berner mit ihrer Botentätigkeit auch etwas verdienen<br />
wollte. Der Erlös aus Früchten, Tee und Hägenmark reichte<br />
nicht aus. Immerhin hatte sie Fahrtkosten und einen beträchtlichen<br />
Zeitaufwand. Ob die Entlohnung in Form eines speziellen<br />
Botenlohns erfolgte, oder ob sie in den Geschäften einen<br />
Rabatt erhielt, der in ihre eigene Tasche floss, ist nicht mehr<br />
festzustellen. Mit dem Kaufhaus Spieker („Bekleidung, Ausstattung,<br />
Stoffe“), vorher Brüder Landauer, am Marktplatz 17<br />
und 18 hatte sie besonders gute und intensive Kontakte. Dort