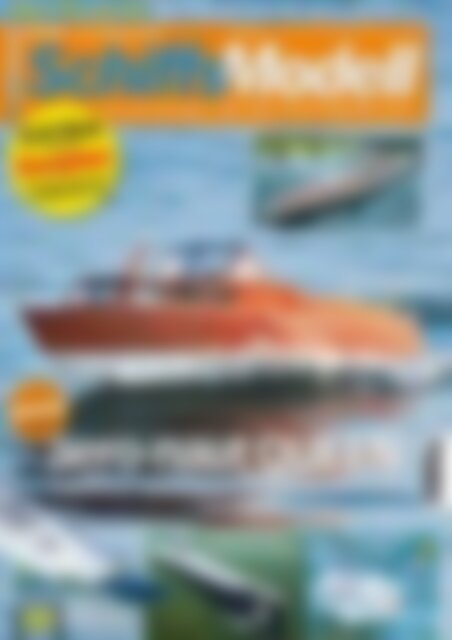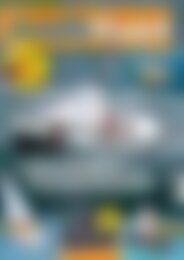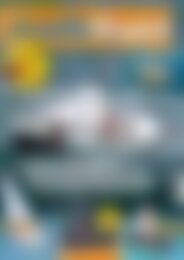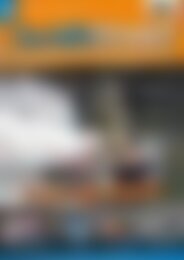Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Joker 185 von EPV: Mit neuem Antrieb über 150 km/h!<br />
01/02 Januar/Februar 2014<br />
5,90 EUR A: 6,70 Euro . CH: 11,80 sFr . BeNeLux: 6,90 Euro . I: 7,90 Euro<br />
EXTRA<br />
im Heft:<br />
Bauplan<br />
Mahagoni-Rennboot<br />
CHICKIE IV<br />
DIE ZEITSCHRIFT FÜR DEN SCHIFFSMODELLBAU<br />
Graf Spee in 1:50<br />
Star beim Flottentreffen<br />
in Gelsenkirchen<br />
<strong>SchiffsModell</strong><br />
PRAXIS<br />
TEST<br />
<strong>aero</strong>-<strong>naut</strong> <strong>QUEEN</strong><br />
Edelflitzer mit Doppel-Brushless-Antrieb<br />
U-Boot Typ XXIII<br />
von Bronco Models<br />
Wasserskispaß mit<br />
MasterCraft 300<br />
GROSSER<br />
FOTO<br />
REPORT<br />
Deutsche<br />
Meisterschaft<br />
der TenRater
H.M.S BLUE BELL | Best.-Nr. 2200<br />
PREMIUM LINE<br />
Rumpflänge ca. 1280 mm<br />
BAUSATZ MULTIBOAT | Best.-Nr. 2129<br />
Mit umfangreichem Dekorsatz. Enthält<br />
Aufkleber für das Feuerlösch- und Polizeiboot.<br />
Rumpflänge ca. 600 mm<br />
H.M.S PRINCE OF WALES | BEST.-NR. 2159<br />
PREMIUM LINE<br />
Rumpflänge ca. 1500 mm<br />
U-BOOT TYP VII | BEST.-NR. 2059<br />
PREMIUM LINE<br />
Rumpflänge ca. 1390 mm<br />
Mit vollwertiger Nautic-Steuerung<br />
Integrierte Funktionen<br />
ersetzen die herkömmlichen<br />
Schaltbausteine.<br />
MC-16 HOTT | BEST.-NR. 33016<br />
8 Kanäle (erweiterbar auf bis<br />
zu 22 Kanäle)<br />
20 Modellspeicher<br />
MC-20 HOTT | BEST.-NR. 33020<br />
12 Kanäle (erweiterbar auf bis<br />
zu 26 Kanäle)<br />
24 Modellspeicher<br />
MC-32 HOTT | BEST.-NR. 33033<br />
16 Kanäle (erweiterbar auf bis<br />
zu 30 Kanäle)<br />
80 Modellspeicher<br />
Weitere Informationen und Zubehör zu unseren Produkten unter:<br />
AZ_33<br />
www.facebook.com/GraupnerNews www.youtube.com/GraupnerNews WWW.GRAUPNER.DE
EDITORIAL<br />
Willkommen<br />
an Bord!<br />
Liebe Leser,<br />
mit dieser Ausgabe startet SCHIFFSMODELL nicht nur in ein neues Jahr,<br />
sondern läuft auch in vielerlei Hinsicht in neue Fahrwasser aus.<br />
Mit der Übernahme des größten Teils des Modellbauprogramms des Neckar-<br />
Verlages durch den GeraMond Verlag in München wechselte im Oktober<br />
des Jahres 2013 auch die Reedereiflagge der Zeitschrift SCHIFFSMODELL.<br />
Und während die Ausgabe 12/2013 noch auf dem Weg zu den Lesern war, kam<br />
das Magazin ins Trockendock, um ein umfangreiches Refit durchführen zu<br />
lassen. Neben vielen von außen nicht sichtbaren technischen Veränderungen<br />
an der Maschinenanlage, arbeiteten wir vor allem kräftig am optischen Auftritt<br />
und an der Ausstattung, sodass SCHIFFSMODELL mit der vorliegenden<br />
ersten Ausgabe des Jahrgangs 2014 in komplett neuem und hochwertigem<br />
Outfit wieder in See stechen kann.<br />
Auch das Fahrgebiet wird sich erweitern: Unser Magazin wird künftig an mehr<br />
Verkaufsstellen präsent sein und dort Monat für Monat seine attraktive und<br />
bunt gemischte Ladung an interessanten Beiträgen zu Ihnen bringen. Und<br />
schließlich gibt es einen Wachwechsel auf der Brücke von SCHIFFSMODELL:<br />
Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich der langjährige „Kapitän“ Hans-Jörg<br />
Welz. Wir sagen ihm von Herzen Dankeschön für das große Engagement, mit<br />
dem er das Kommando über 28 Jahre lang geführt hat. Von der nächsten großen<br />
Fahrt an – sprich: mit der nächsten Ausgabe – übernimmt dann Sebastian Greis<br />
das Kommando. Wir wünschen ihm schon heute allzeit gute Fahrt und immer<br />
eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!<br />
Die vor Ihnen liegende Ausgabe erscheint mit erweitertem Umfang als Doppel-<br />
Nummer für die Monate Januar und Februar. Ende Februar kommt dann mit<br />
der März-Ausgabe das nächste Heft von SCHIFFSMODELL zu Ihnen. Damit<br />
Ihnen die Zeit bis dahin nicht lang wird, finden Sie in diesem Heft als<br />
besonderes Bonbon das erste Planblatt eines kostenlosen Bauplanes. Der edle<br />
Mahagoni-Renner CHICKIE IV ist heute schon ein Modellbau-Klassiker und<br />
wird dank des Bauplanes sicherlich in dieser Wintersaison in vielen<br />
Kellerwerften auf Kiel gelegt werden. Alles Weitere zum Modell und zum Plan<br />
lesen Sie ab Seite 28.<br />
Daneben stellt in diesem Heft Jörg Dreischulte mit dem Praxistest der <strong>QUEEN</strong><br />
ein weiteres klassisches Holzmodell aus dem Programm von <strong>aero</strong>-<strong>naut</strong> vor.<br />
Ingrid Blüm berichtet mit beeindruckenden Bildern von der deutschen Meisterschaft<br />
der 10Rater und Milan Lulic hat den aktuellen Junsi iCharger 308 DUO<br />
auf seinem Prüfstand ganz genau unter die Lupe genommen.<br />
Viel Spaß bei der Lektüre!<br />
Redaktion und Verlag<br />
P.S.: Steigende Energie- und Papierkosten zwingen uns, den Verkaufspreis<br />
von SCHIFFSMODELL – für unsere Abonnenten übrigens erstmals seit<br />
12 Jahren! – anzuheben, und zwar auf 5,90 Euro am Kiosk. Der Preisvorteil<br />
eines Jahres-Abonnements beträgt 10 Prozent gegenüber dem Kauf am Kiosk !<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
1
Fundiert und umfassend.<br />
NEU!<br />
Die Entwicklung der Bundesmarine<br />
von ihrer Gründung bis<br />
1990: Dargestellt anhand ihrer<br />
vielfältigen Boote und Schiffstypen.<br />
Ein umfassender Überblick.<br />
144 Seiten · ca. 250 Abb.<br />
22,3 x 26,5 cm<br />
€ [A] 27,80<br />
sFr. 36,90 € 26,99<br />
ISBN 978-3-86245-733-5<br />
Auch als eBook erhältlich<br />
Der Autor beschreibt in diesem Buch die Seestreitkräfte der<br />
DDR, den gesamten Schiffs- und Bootsbestand. Umfangreiches,<br />
zum Teil erstmals veröffentlichtes Bildmaterial, exakte technische<br />
Daten, Infos zur Bewaffnung, zu In- und Außerdienststellung<br />
sowie Beschreibung der Besonderheiten bei Planung,<br />
Entwicklung, Bau und Einsatz der einzelnen Typen erklären die<br />
Volksmarine im Detail.<br />
144 Seiten · ca. 270 Abb. · 22,3 x 26,5 cm<br />
€ [A] 27,80<br />
sFr. 36,90 € 26,99<br />
ISBN 978-3-86245-649-9<br />
Die Schiffs- und Bootsklassen<br />
der Deutschen Marine, detaillierte<br />
Informationen zu den Marineeinheiten<br />
und attraktive<br />
Fotos: Ein umfassender Überblick.<br />
144 Seiten · ca. 250 Abb.<br />
22,3 x 26,5 cm<br />
€ [A] 27,80<br />
sFr. 36,90 € 26,99<br />
ISBN 978-3-86245-727-4<br />
Die Geschichte der Gorch Fock<br />
und ihrer fünf Schwesterschiffe.<br />
Brillant bebildert und<br />
mit fundierten <strong>naut</strong>ischen und<br />
historischen Hintergrundinfos.<br />
168 Seiten · ca. 180 Abb.<br />
22,3 x 26,5 cm<br />
€ [A] 30,80<br />
sFr. 39,90 € 29,95<br />
ISBN 978-3-86245-672-7<br />
Faszination Technik<br />
www.geramond.de<br />
oder gleich bestellen unter<br />
Tel. 0180-532 16 17 (0,14 €/Min.)
DM der TenRater<br />
36<br />
Großer Praxis-Test: die <strong>QUEEN</strong><br />
10<br />
Inhalt Heft 1-2/2014<br />
6<br />
8<br />
Neu auf dem Markt<br />
Neuheiten, Nachrichten und Markt<br />
Faszination Modellbau<br />
Rückblick auf die Messe in Friedrichshafen<br />
Wassserskispaß<br />
auf dem Teich<br />
Flottentreffen<br />
mit Graf Spee<br />
18<br />
42<br />
Motorschiffe<br />
10<br />
18<br />
22<br />
24<br />
28<br />
30<br />
32<br />
34<br />
Kens heimliche Geliebte<br />
Die <strong>QUEEN</strong> von <strong>aero</strong>-<strong>naut</strong> im großen Praxis-Test<br />
Skispaß auf dem Teich<br />
Die Mastercraft 300 mit Wasserskiläufer<br />
Meier in Form<br />
Der Seitenfänger-Fischdampfer CUXHAVEN<br />
Speed ohne Bürsten<br />
Joker-Powerboat mit neuer Antriebstechnik<br />
Edler Renner<br />
Bauplan für einen Klassiker: die CHICKIE IV<br />
Motorisiertes Schätzchen<br />
Kellerfund: Torpedoboot PT 117 jetzt mit Motor<br />
Eine Etage zu viel<br />
Umbau der SMS SCHLESIEN<br />
Auf dem Teller drehen<br />
Revells Harbour Tug Boat mit Bugstrahlruder<br />
Szene<br />
36<br />
42<br />
46<br />
Königsklasse<br />
Deutsche Meisterschaft der TenRater in Geldern<br />
Parade zur See<br />
Großes Flottentreffen in Gelsenkirchen<br />
Vor Anker in Lemmer<br />
Traditionstreffen der KNRM in Holland<br />
Junsi 308 DUO<br />
54<br />
Technik<br />
54<br />
58<br />
62<br />
Starkes Doppel<br />
Der Junsi iCharger 308 DUO im Praxis-Test<br />
Mehr Power<br />
Gute Performance: neue Blackhorse LiPo-Akkus<br />
Neuer Wein in alten Schläuchen<br />
Umrüstung der Graupner FM 4014 auf JETI 2,4 GHz<br />
Specials<br />
64<br />
70<br />
Zum Hecht gemacht<br />
Das Bronco-U-Boot XXIII mutiert zu U-HECHT<br />
Durchgeschleust!<br />
Funktionstüchtige Modell-Schleusenanlage<br />
Modellbau<br />
74<br />
78<br />
Reizende Schwestern<br />
Die Motortankschiffe BIRGITTA und CISCA<br />
Neuer Liegeplatz<br />
Sammlung von Hans Huckauf in der MTS Parow<br />
Tankschiff<br />
BIRGITTA 74<br />
Rubriken<br />
51<br />
82<br />
Kleinanzeigen, Markt<br />
<strong>Vorschau</strong>, Impressum<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
5
NEU AUF DEM MARKT<br />
RC Technik Peter Herr<br />
Ergonomisch steuern<br />
Neu bei RC Technik Peter Herr ist ein neuartiger,<br />
innovativer Knüppelschalter.<br />
Der Steuerknüppel verfügt oben über ein proportionales Drehpoten -<br />
ziometer und ist mit einem Taster im Daumenbereich für zusätzliche<br />
Schaltprozesse ausgestattet. Damit lassen sich diverse Zusatzfunktionen<br />
steuern, ohne dass der Steuerknüppel losgelassen werden muss. Der<br />
aus Aluminium gefertigte Knüppel ist ergonomisch gestaltet, der Einbau<br />
kann dank einer ausführlichen und leicht verständlichen Einbauanleitung<br />
selbst durchgeführt werden. Lieferbar ist der Knüppel für Sender der<br />
Fabrikate Graupner, robbe/Futaba, Jeti und Spektrum.<br />
RC Technik Peter Herr, Müllerweg 34, 83071 Stephanskirchen<br />
Tel. 08036/303380, www.rctechnik.de<br />
Neu bei Smoke-EL<br />
Umweltfreundlich<br />
<strong>SchiffsModell</strong><br />
NEU<br />
AUF DEM<br />
MARKT<br />
Für den besonders umweltfreundlichen Betrieb auf allen Gewässern<br />
hat die Fa. Smoke-EL passend zum SmokeBlock (siehe Test in<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 12/2013) nun auch ein neues Smoke-Öl fertig gestellt.<br />
Das RedOil aqua hat – wie der Name schon vermuten lässt – Wasser zur<br />
Grundlage. Es ist daher kein Gefahrgut, ist nicht gewässerschädigend und<br />
darf sogar im Abwasser entsorgt werden. Damit ist RedOil aqua auch<br />
optimal für den Einsatz in der Halle bzw. auf Messebecken geeignet.<br />
Nun braucht also keiner mehr ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn er<br />
mit „Volldampf“ unterwegs ist. RedOil aqua wird in Gebinden zu einem<br />
(15 Euro) und drei Litern (39 Euro) angeboten.<br />
Der neue SmokeDriver zur Ansteuerung des SmokeBlocks ist nun auch<br />
mit einer speziellen Schiffs-Software lieferbar. In der Schiffs-Version sind<br />
Heizung und Lüfter proportional mit dem Sendersignal steuerbar, außerdem<br />
ist nur ein freier Kanal am Empfänger notwendig.<br />
Horizon Hobby<br />
Sport<br />
Ladegerät<br />
Die drei neuen Prophet Sport-Ladegeräte von<br />
Dynamite sind die optimale Ergänzung für alle RTR-Sets,<br />
in denen kein oder ein nicht sehr leistungsfähiges<br />
Ladegerät enthalten ist.<br />
Die Bedienung von Prophet Sport NiMH und LiPo erfolgt über<br />
einen einzelnen Knopfdruck, wobei die Ladeleistung von 35 W<br />
für einen zügigen Ladevorgang sorgt. Das Prophet Sport Plus<br />
lässt sich zusätzlich zwischen NiMH und LiPo umschalten<br />
und lädt mit 5 A/50 W.<br />
Alle drei Ladegeräte haben verständliche LED-Anzeigen, mit<br />
denen man sie einstellen und den Ladeprozess verfolgen kann.<br />
Prophet Sport NiMH und LiPo (jeweils 29,99 Euro) sind für den<br />
Betrieb am Stromnetz ausgelegt, das Prophet Sport Plus (39,99)<br />
kann sowohl am Netz als auch an einer 12-V-Stromquelle betrieben<br />
werden.<br />
Immer mehr Modellbauer befassen sich schon mit dem Filmen<br />
aus dem Modell heraus und viele andere haben an dieser Technik<br />
großes Interesse. In jedem Fall benötigt man dafür eine<br />
leichte und möglichst robuste „Action-Cam“.<br />
Ab sofort gibt es im Angebot von Horizon Hobby die neue Magic-<br />
Cam SD22W. Der Hersteller AEE ist bereits seit fast 20 Jahren<br />
im Markt für Kameras erfolgreich tätig. Die SD22W besitzt ein<br />
wassergeschütztes Gehäuse, ist Wi-Fi kompatibel mit Android<br />
oder auch IOS Apps (Wi-Fi Rückseitenteil separat erhältlich),<br />
kann Videos im Format 1080 x 60 oder auch Fotos mit 8 Mega -<br />
pixel aufnehmen und besitzt sogar einen Laserpointer zur optimalen<br />
Ausrichtung. Im Basis-Set für 199,99 Euro ist die Kamera<br />
und eine ganze Reihe von sinnvollem Zubehör enthalten, z. B.<br />
ein externer Akku für längere Betriebsdauer, eine kabellose<br />
Fernsteuerung, ein Unterwasser-Gehäuse, diverse Montageplatten<br />
usw. Alle Neuheiten von Horizon Hobby sind ab sofort<br />
im Fachhandel erhältlich.<br />
www.horizonhobby.de<br />
Smoke-EL ON-LiNE Software & Modellbau e. K.<br />
Dipl.-Ing Gunter Zielke, Sünnerholm 5, 24885 Sieverstedt<br />
Tel. 04603/1575, www.smoke-el.de<br />
Anzeige<br />
Neu im Angebot von<br />
Horizon Hobby: die neue MagicCam SD22W.<br />
6
Neues von HerbundSab Modellbausätzen<br />
Zurück gemeldet<br />
In den letzten eineinhalb Jahren war es sehr<br />
still um den Kleinserienhersteller HerbundSab<br />
Modellbausätze geworden.<br />
Modellbautechnik Kuhlmann<br />
Klassischer<br />
Drachen<br />
Modellbautechnik Kuhlmann aus Bielefeld<br />
hat neben dem 1,2 m langen Holz-„Drachen“<br />
nun auch einen GfK-„Drachen“ im Angebot.<br />
Im Maßstab 1:6 wird das Modell dieses Klassikers 149 cm lang.<br />
Der Rumpf ist komplett aus GfK gefertigt und bereits mit dem im<br />
Sandwich-Verfahren hergestellten Deck verklebt. Der Kiel ist<br />
angeformt und wird einfach mit Blei gefüllt. Das Ruder ist schon<br />
mit der Ruderwelle verklebt und wird durch ein abschraubbares<br />
Lager am Kiel gelagert. Der Rumpf ist ab sofort lieferbar,<br />
aufbauend auf dem Rumpf wird es bei Kuhlmann demnächst<br />
auch einen kompletten Bausatz geben.<br />
Modellbautechnik Kuhlmann, Feuerdornstr.3, 33699 Bielefeld<br />
Tel. 05202/925743, www.segelboot-modelle.de<br />
CN Development & Media<br />
Neue Akkus<br />
Die Produkte dieses Herstellers<br />
wie z. B. hochdetaillierte Scheinwerferbausätze<br />
etc. hatten sich<br />
ja in kürzester Zeit einen guten<br />
Ruf in der Szene erworben. Wie<br />
jetzt bekannt wurde, war der<br />
Grund für die lange Funkstille die<br />
häusliche Pflege eines schwerkranken<br />
Angehörigen.<br />
Nun hat sich HerbundSab aber<br />
zurückgemeldet. Nach der er -<br />
zwungenen Auszeit beschäftigt<br />
man sich nun mit Hochdruck mit<br />
dem Abbau des entstandenen<br />
Liefer-Rückstandes und auch<br />
etliche Neuheiten sind schon in<br />
Vorbereitung. In den nächsten<br />
Wochen will sich der Kleinserienhersteller<br />
auch mit einer umfangreichen<br />
Aktion bei allen treuen<br />
Kunden für das entgegen -<br />
gebrachte Verständnis bedanken.<br />
Aktuelle Informationen finden<br />
sich dann auf der Homepage<br />
www.herbundsab.de und in<br />
den aktuellen Newslettern.<br />
HerbundSab Modellbausätze<br />
Wachtelstieg 6a, 38118 Braunschweig<br />
Tel. 0531/2504767, www.herbundsab.de<br />
Zur Unterstützung des GeraMond Verlags suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Volontär mit dem<br />
Schwerpunkt (RC-)Modellbau.<br />
Erneut wurde das Sortiment an 30C-LiPo-<br />
Akkus der Marke YUKI MODEL erweitert.<br />
Ab sofort sind folgende neue Typen über den<br />
Fachhandel lieferbar: 2s1p (7,4 V) mit 600 und<br />
1.000 mAh Nennkapazität (BEC-Verbinder) oder<br />
mit 1.360 mAh (XT60-Verbinder), 3s1p (11,1 V)<br />
mit 1.000, 1.350, 1.800, 2.200, 2.600 und 3.300<br />
mAh (XT60-Verbinder) sowie 4s1p (14,8 V) mit<br />
2.600 und 3.300 mAh (XT60-Verbinder).<br />
Alle Packs haben eine Laderate von maximal<br />
2C sowie eine dauerhafte Endladerate von 30C<br />
und sind mit einem XH-Balanceranschluss<br />
ausgestattet. Die Preise reichen von 5,50 bis<br />
39,90 Euro<br />
CN Development & Media<br />
Haselbauer & Piechowski GbR<br />
Dorfstraße 39, 24576 Bimöhlen<br />
Tel. 04192/8919083<br />
www.yuki-model.de<br />
Volontär mit dem Schwerpunkt (RC-)Modellbau (m/w)<br />
Ihre Aufgaben:<br />
Als Volontär unterstützen Sie uns in allen Bereichen eines Zeitschriftenverlages. Hierbei werden<br />
Sie u.a. die Grundlagen der Konzeption und Planung von Magazinen, der Themen- und Autorenrecherche<br />
sowie des Redigierens kennenlernen und aktiv an der Heftproduktion mitwirken.<br />
Ihr Profil:<br />
Sie sind Hochschulabsolvent/in und haben schon erste redaktionelle Erfahrungen (z.B. Praktika)<br />
gesammelt. Sie haben eine hohe Affinität zu den Themen des GeraMond Verlages, besitzen sehr<br />
gute PC- und Englischkenntnisse, arbeiten gerne kreativ und strukturiert, sind vor allem team- und<br />
begeisterungsfähig.<br />
Wenn Sie Freude an einer vielseitigen und spannenden Aufgabe haben und gerne Teil eines hoch motivierten<br />
und sympathischen Teams sein möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Ihre ausführlichen<br />
Unterlagen senden Sie bitte an:<br />
Verlagshaus GeraNova Bruckmann GmbH, Frau Irina Dörrscheidt, Infanteriestraße 11a, 80797 München<br />
oder per Email an irina.doerrscheidt@verlagshaus.de<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
7
SZENE Vereine | Termine<br />
FRIEDRICHSHAFEN 2013<br />
Faszination<br />
Modellbau<br />
Die Modellbau-Messe war 2013<br />
der Publikumsmagnet. Die Besucherzahl<br />
erreichte neue Rekorde<br />
M<br />
an kann ohne Übertreibung sagen,<br />
dass Friedrichshafen für<br />
Endverbraucher die wichtigste<br />
Messe in Europa geworden ist und ich<br />
denke, dass gerade in diesem Jahr die<br />
Messe gezeigt hat, dass das vielfältige Angebot<br />
sehr gut angenommen wird. Die<br />
breite Ausstellerschaft von großen wie<br />
auch kleinen Herstellern zieht das Pub -<br />
likum einfach an“, resümiert Jörg Schamuhn,<br />
Vice-President von Horizon<br />
Hobby, die letztjährige Faszination Modellbau<br />
Friedrichshafen. Mit dieser Meinung<br />
steht er nicht alleine: „Es ist die<br />
Messe, zu der man hin muss. Es ist<br />
meiner Meinung nach die Leitmesse in<br />
Europa, wenn nicht gar weltweit. Wir<br />
waren auch in Amerika auf Messen, aber<br />
es ist kein Vergleich. Wir sind mit dem<br />
Ergebnis höchst zufrieden“, bestätigt Johann<br />
Kolm von Kolm Engines aus Österreich<br />
die Aussagen von Jörg Schamuhn.<br />
Gerade auch die Spezialisten unter den<br />
Ausstellern berichteten von einem ausgezeichneten<br />
Messeverlauf, vor allem auch<br />
am Sonntag, der gemeinhin als Fami lien -<br />
tag gilt. Die Nähe des Veranstaltungsortes<br />
zu Österreich und der Schweiz sorgte auf<br />
der Faszination Modellbau in Friedrichs -<br />
hafen auch dieses Jahr wieder für sehr hohe<br />
Erstmals in der zwölfjährigen<br />
Geschichte der Messe<br />
überstieg die Besucherzahl<br />
die 50.000er-Marke<br />
8<br />
Zuschauerzahlen. Erstmals in der zwölfjährigen<br />
Geschichte der Messe überstieg die Besucherzahl<br />
die 50.000er-Marke. Ein Drittel<br />
der Besucher kam aus dem Ausland: 3,5 Prozent<br />
aus Italien, acht Prozent aus Österreich<br />
und 16 Prozent aus der Schweiz. Auch das<br />
ist neuer Rekord. Es war daher die erfolgreichste<br />
Modellbau-Messe am Bodensee: „Es<br />
war, als hätte jemand am Freitag um 9.00<br />
Uhr die Schleusen aufgemacht“, beschreibt<br />
Gerhard Reinsch von Tony Clark Practical<br />
Scale den Messe-Auftakt am Freitag. „Innerhalb<br />
von zwei Minuten war die ganze Halle<br />
A3 gefüllt.“ Gleiches galt auch für alle<br />
anderen Messe-Hallen.<br />
Schon 2012 war ein Besucherrekord zu<br />
verzeichnen gewesen. Den nochmaligen Besucherzuwachs<br />
führt Andreas Wittur, Prokurist<br />
der Messe Sinsheim als Ausrichter der<br />
Faszination Modellbau, auf das stimmige<br />
Gesamtkonzept der Messe zurück: „Die Faszination<br />
Modellbau bietet sowohl Familien<br />
als auch den aktiven Modellbauern einen hohen<br />
Erlebnis- und Nutzwert. Die Messe ist<br />
für alle attraktiv.“<br />
Einige Anbieter hochwertiger, teurer Modellbauprodukte<br />
waren erstmals dabei und<br />
markierten mit ihren Produkten einen<br />
Sprung in die qualitativ höchste Liga des<br />
Modellbaus. Gerade sie attestierten der Faszination<br />
Modellbau ein fachkundiges und<br />
auch kauffreudiges Publikum. Einige Anbieter<br />
waren am Ende der Messe sogar restlos<br />
ausverkauft. Gerade das beweist, dass der<br />
Spagat zwischen breitem Publikumsinteresse<br />
und hoch spezialisiertem Fachbe -<br />
sucher der Faszination Modellbau in diesem<br />
Jahr so gut gelungen ist wie noch nie zuvor.<br />
Auch die Nachwuchs arbeit ist ein zen -<br />
trales Thema der Organisatoren. Deshalb legen<br />
sie großen Wert auf zahlreiche, viel -<br />
fältige Angebote und sind damit führend unter<br />
den Modellbau-Messen. Grund genug,<br />
sich schon heute auf die nächste Faszination<br />
Modellbau zu freuen, die vom 31.10.–2.11.2014<br />
stattfinden wird.<br />
Wer nicht so lange warten möchte, kann<br />
die Faszination ModellTECH vom 21.–23.<br />
März 2014 in Sinsheim besu chen. Wermutstropfen<br />
auf dieser Messe ist aber die Tat -<br />
sache, dass dort der Bereich des Schiffs -<br />
modellbaus weiterhin außen vor bleibt.
Schiffe und Meer …<br />
Das neue Schifffahrt-Magazin ist da!<br />
Jetzt am Kiosk!<br />
Online blättern oder Abo mit Prämie unter:<br />
www.schiff-classic.de/abo
MOTORSCHIFFE<br />
<strong>QUEEN</strong> von <strong>aero</strong>-<strong>naut</strong><br />
<strong>QUEEN</strong> VON AERO-NAUT<br />
Kens heimliche<br />
Geliebte<br />
10
Als die <strong>QUEEN</strong> auf der Nürnberger Spielwarenmesse<br />
vorgestellt wurde, verriet Peter Eggenweiler<br />
augenzwinkernd: „Die <strong>QUEEN</strong> ist in 1:6 – das ist der<br />
Barbie-Maßstab“. Die Edelholzyacht ließe sich<br />
also gut mit den Modellen aus den femininen Puppenstuben<br />
bemannen – oder andersherum:<br />
eine <strong>QUEEN</strong> darf keinem Ken fehlen!<br />
TEXT UND FOTOS: Jörg Dreischulte<br />
Nach den beiden Erfolgsmo del -<br />
len PRINCESS und DIVA<br />
brachte <strong>aero</strong>-<strong>naut</strong> ein weiteres<br />
Holzboot auf den Markt. „Die<br />
<strong>QUEEN</strong> ist quasi eine vergrößerte<br />
DIVA“, so beschreibt der Hersteller<br />
selbst den Baukasten. Der Rumpf mit dem<br />
bewährten Knickspant wurde übernommen,<br />
erhielt neue Aufbauten und einen neuen<br />
Maßstab, der zu den in vielen Haushalten<br />
eingerichteten Puppenstuben passt.<br />
Der Baukasten der <strong>QUEEN</strong> kommt in<br />
einem flachen, recht großen Karton zum<br />
Kunden. Da es sich um einen reinen Holzbaukasten<br />
handelt, findet man logischer -<br />
weise keine tiefgezogenen Kunststoffteile für<br />
Rumpf und Deck im Inneren, stattdessen<br />
eine ganze Menge an gelaserten Holzplatten<br />
sowie eine Handvoll Profilstäbe und Leisten.<br />
Als Besonderheit gibt es dann sogar Ätzteile<br />
aus Neusilber, ebenso alle anderen Beschlagteile<br />
inkl. Stevenrohr, Welle, Kupplung und<br />
Propeller. Beim Öffnen des Kastens fällt einem<br />
neben einer weißen Depron-Platte auch<br />
die Bauanleitung in Form eines DIN A4-Heftes<br />
in die Hand. Wie schon bei der DIVA ist<br />
die Anleitung hervorragend gestaltet und mit<br />
zahlreichen Abbildungen versehen.<br />
Bau auf der Leichtschaumhelling<br />
Für den Aufbau des Rumpfes bzw. des Spantengerüsts<br />
ist die erwähnte Depron-Platte<br />
zuständig, sie dient als Helling zum Aufstellen<br />
der Spanten. Diese lassen sich hervorragend<br />
aus den gelaserten Platten heraustrennen<br />
und sollten an den Laserkanten noch etwas<br />
überschliffen werden. Sind alle Span ten<br />
und auch die Holzteile für den Steven und<br />
den Heckbereich vorbereitet, kann mit dem<br />
Aufstellen des Rumpfgerippes begonnen<br />
Pracht am Steg: Mit der <strong>QUEEN</strong> gewinnt<br />
Ken überall Aufmerksamkeit<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
11
MOTORSCHIFFE<br />
<strong>QUEEN</strong> von <strong>aero</strong>-<strong>naut</strong><br />
DATEN BAUSATZ<br />
<strong>aero</strong>-<strong>naut</strong> <strong>QUEEN</strong><br />
Länge<br />
Breite<br />
Gewicht fahrfertig<br />
Preis<br />
Bezugsquelle<br />
ca. 950 mm<br />
ca. 315 mm<br />
ca. 4,5 kg<br />
179,– Euro<br />
Fachhandel,<br />
www.<strong>aero</strong>-<strong>naut</strong>.de<br />
Von der Herstellerempfehlung abweichende<br />
Ausrüstung des Modells:<br />
Antrieb durch zwei bürstenlose Außenläufer,<br />
frei laufende Wellenanlagen,<br />
Bugstrahlruder, Beleuchtung<br />
Der Vergleich mit der DIVA verdeutlicht die Dimensionen der <strong>QUEEN</strong><br />
Verleimen zu fixieren. Wich tig beim Arbei -<br />
ten mit Holzleim sind natür lich die Wartezeiten<br />
bis zum Aushärten des Klebers. Ich<br />
habe diese Warte zei ten immer schon für das<br />
Vorbereiten der weiteren Bauteile genutzt.<br />
Eine gute Idee des Herstellers ist auch die<br />
Lasergravur der Bauteile (mit Ausnahme des<br />
Sichtholzes). Dadurch sind die einzelnen<br />
Teile leicht den Bauabschnitten in der Anleitung<br />
zuzuordnen.<br />
Für die nun folgenden Bauabschnitte<br />
sollte man sich etwas Zeit nehmen. Es wird<br />
mit dem Beplanken der Rumpfseiten begonnen.<br />
Hierfür werden nicht einzelne Planken<br />
werden. Das ist dank der mitgelieferten Helling<br />
einfach, da die Spanten in das Depron<br />
eingedrückt werden und dadurch fast von<br />
alleine stehen. Nun noch den Steven und<br />
die weiteren Verstrebungen auf bzw. in die<br />
Span ten stecken. Nach dem Verleimen der<br />
Bauteile gewinnt das Gerippe zunehmend<br />
an Stabilität, gleichzeitig wächst der Rumpf<br />
sehr schnell und man hat neben dem ersten<br />
Erfolgserlebnis auch gleich die zukünftigen<br />
Abmessungen des Modells vor Augen. Es ist<br />
halt keine DIVA mehr, sondern eine <strong>QUEEN</strong><br />
mit fast doppelter Länge und Breite!<br />
Danach werden außen an den Span ten<br />
weitere Leisten für die Rumpf verstär kung<br />
eingeleimt, ebenso die drei Leisten für die<br />
Eckverstärkung. Hier auf die Tipps in der<br />
Bauanleitung achten, nämlich die Leisten<br />
im vorderen Bereich neben einander zu verleimen<br />
und erst nach dem Aushärten weiter<br />
nach hinten zu biegen und an den Spanten<br />
zu verleimen. So formen sich die Leisten von<br />
einem Flach- zu einem L-Profil und der<br />
Rumpf wird an der Kante optimal verstärkt.<br />
Vom Spant zur Planke<br />
Durch die großen Abstände der Span ten ist<br />
es ein Leichtes, die Leisten mit Klammern<br />
und Nadeln oder auch Kreppband für das<br />
Das Spantengerippe entsteht, Beplankung der Bordwände und des Rumpfbodens<br />
12
auf die Spanten geleimt, sondern die gesam -<br />
te Rumpfseite ist am Stück bereits passend<br />
ausgelasert. Bevor man diese Bauteile an das<br />
Spantengerippe leimt, sollte man kontrollieren,<br />
ob die Seitenteile auch an allen Stellen<br />
sauber anliegen. Zur weiteren Vorbereitung<br />
des Arbeitsgangs werden die vorderen Kan -<br />
ten im Winkel angeschliffen, damit man hinten<br />
eine saubere Mahagonifuge hat, ohne<br />
die innere, helle Holzschicht zu sehen.<br />
Damit beim Verleimen nichts schief läuft,<br />
empfiehlt es sich, die Sichtholzteile zuvor<br />
mit einem Anstrich zu versiegeln. Alternativ<br />
– so habe ich es gemacht – kann man die<br />
Teile mit Kreppband oder Tesafilm vor herausquellendem<br />
Leim schützen. Die beiden<br />
großen Seitenplanken werden am Bug mit<br />
Kreppband miteinander verbunden. Dann<br />
heißt es, die Klammern und Nadeln bereitzulegen<br />
und das Spantengerippe kann mit<br />
Leim versehen werden. Dann werden die<br />
Planken an die Spanten gedrückt und mit<br />
vielen Nadeln und Klammern für das Austrocknen<br />
fixiert. Hierbei sind die Tipps aus<br />
der Bauanleitung sehr hilfreich. Bevor man<br />
das Ganze in Ruhe trocknen lässt, sollte man<br />
nochmal den richtigen Sitz der Teile prüfen,<br />
jetzt ist die letzte Gelegenheit zur Korrektur.<br />
Kreppband ist Pflicht<br />
Ähnlich geht es dann an der Rumpf unter -<br />
seite weiter. Hier brauchen die Teile aber<br />
nicht geschützt zu werden, da die Bodenplatten<br />
aus 1,5-mm-Sperrholz beste hen. Die Platten<br />
müssen zur Mitte hin aber ebenfalls angeschrägt<br />
werden. Dann wieder mit ein paar<br />
Kreppstreifen miteinander verbinden und<br />
Beim Aufleimen sollte das Deck gegen Verrutschen gesichert werden<br />
auf das Spantengerüst trocken auflegen. Die<br />
Bodenplatten werden jetzt über die Mitte mit<br />
noch mehr Kreppband miteinander verbunden.<br />
Dadurch entsteht die Form des Unterwasserschiffs.<br />
Wichtig dabei ist, dass die<br />
Stoßkante der beiden Platten in der Mitte<br />
keine Lücken aufweist.<br />
Nach der Klebeband- Orgie können die<br />
Teile vom Rumpf abgenommen, mit Leim<br />
versehen und dann auf dem Spantengerippe<br />
verklebt werden. Es hilft, die Flächen bis zur<br />
Trocknung des Klebers noch mit Gewichten<br />
zu beschweren und ggf. im Bugbereich noch<br />
Nadeln einzuschlagen, damit nichts verrutschen<br />
kann.<br />
Während der Trockenzeit habe ich schon<br />
einmal den Bootsständer zusammengebaut,<br />
dessen Teile ebenfalls im Baukasten ent -<br />
halten sind. Der Ständer fällt allerdings etwas<br />
klein aus, deswegen habe ich mir aus 10-mm-<br />
Sperrholz einen etwas stabileren für siche -<br />
ren Stand beim Transport gebaut.<br />
Nach dem Abnehmen des Rumpfes von<br />
der Helling kann man alle Leimverbindungen<br />
zwischen den Spanten und den Beplankungsplatten<br />
noch einmal gründlich von innen<br />
nachleimen, sicher ist sicher. Die Baustützen<br />
an den Spanten werden im nächsten<br />
Arbeitsschritt entfernt, dies gelingt gut mit<br />
einer Laubsäge oder einem Seitenschneider.<br />
Dann die Oberseiten noch plan schleifen.<br />
Ausschnitt für modifizierte Wellenanlagen Die Wellenböcke entstehen aus Messing<br />
Rumpfdurchführungen der neuen Doppelwellenanlage<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
Zwei, drei Anstriche Bootslack<br />
Jetzt geht es weiter mit dem Einbau der Wellenanlage<br />
und des Motors. Hier weicht mein<br />
Modell von der Baukastenvariante ab, da ich<br />
statt der einmotorigen Baukastenversion<br />
zwei Motoren mit außenbords frei laufenden<br />
Wellenanlagen eingebaut habe. Hierzu sind<br />
einige Modifikationen an den Spanten notwendig.<br />
Auf den Abbildungen kann man<br />
neben den aus Messing gefertigten Wellenstützen<br />
auch die einge bau ten Wellen anlagen<br />
sehen. Ich habe mich hier für die Kompaktanlagen<br />
von der Fa. Gundert entschieden,<br />
dann fluchtet auf jeden Fall der Motor immer<br />
sauber mit der Welle und es lässt sich alles<br />
leichter einbauen. Wer bei der Baukasten -<br />
variante bleibt, hat es einfacher, denn alle<br />
Bohrungen für den Motor und die Welle sind<br />
bereits in den Spanten und im Rumpfboden<br />
vorgesehen. Der Motorspant ist schräg angeordnet,<br />
dadurch ist auch hier die Montage<br />
von Motor und Wellenanlage sehr einfach.<br />
13
MOTORSCHIFFE<br />
<strong>QUEEN</strong> von <strong>aero</strong>-<strong>naut</strong><br />
Verleimen der Plicht: Der kleine Querstab gibt den Seitenteilen die richtige Form<br />
Auch die Kajüte ist eine Spantenkonstruktion. Sie wird direkt im Aufbau zusammengeleimt<br />
Im Vergleich zum Rumpfboden lässt sich das Dach recht einfach aufleimen<br />
Eine weitere Abweichung zum Baukasten<br />
ist das Bugstrahlruder, das ich in meine<br />
<strong>QUEEN</strong> eingebaut habe. Auch hier sind die<br />
nachträglichen Anpassungen an den Span -<br />
ten zwar nicht ganz einfach, aber noch gut<br />
machbar, bevor das Deck auf dem Rumpf<br />
Platz nimmt.<br />
Kommen wir zurück zum weiteren Aufbau<br />
des Modells nach Bauanleitung. Da mit<br />
das Deck eine stabile Auflagefläche erhält,<br />
werden von oben in die Spanten Leisten eingeleimt.<br />
Hierbei hilft unter ande rem auch<br />
der Plichtboden als Fixierhilfe. Man sieht,<br />
der Baukasten ist in vielen Details einfach<br />
toll durchdacht, sodass der Bau gut klappt.<br />
Bevor das Deck auf den Rumpf geleimt wird,<br />
empfiehlt es sich, diesen von innen zu versiegeln.<br />
Nach zwei bis drei Anstrichen mit<br />
z. B. klarem Bootslack ist das Holz vor Spritzwasser<br />
ausreichend geschützt.<br />
Gummiband und Schleifklotz<br />
Auch für das Verkleben des Decks kommt<br />
wieder reichlich Kreppband zum Einsatz.<br />
Um den Anpressdruck zu erhöhen, habe ich<br />
an mehreren Stellen auch noch Gummibänder<br />
um den Rumpf gespannt und reichlich<br />
Leimzwingen eingesetzt. Das Deck wird dadurch<br />
gut auf die Spanten und die Rumpfaußenwand<br />
gedrückt und dicht verklebt.<br />
Nach dem Aushärten und dem Entfernen aller<br />
Hilfsmittel kann der minimale Überstand<br />
der Deckskante mit einem Schleifklotz abgeschliffen<br />
werden. Auch hier zeigt sich wieder,<br />
wie gut die Bauteile aufeinander abgestimmt<br />
sind.<br />
Um das Sichtholz an der Rumpfaußen -<br />
haut zu komplettieren, muss noch das Mahagonibrettchen<br />
für den Heckspiegel auf<br />
den letzten Spant geklebt werden. Auch hier<br />
empfiehlt sich der Ein satz von Kreppband.<br />
Als Nächstes geht es mit den Seitenwänden<br />
des Aufbaus weiter. Diese werden zwischen<br />
Deck und Spanten eingesetzt und an<br />
einem der Decksstringer verleimt. Um den<br />
Aufbau weiter zu schließen, setzt man nun<br />
die Fensterrahmen für die Frontscheibe ein.<br />
Auch hier gilt es, die Stoßkanten in der Mitte<br />
der beiden Teile vorher leicht winklig anzuschleifen.<br />
Dadurch entsteht dann beim Verleimen<br />
kein unschö ner Spalt. Zum Fixieren<br />
hilft – Sie ahnen es schon – wieder Kreppband.<br />
Während des gesamten Baus habe ich<br />
neben einer ganzen Flasche Weißleim auch<br />
eine komplette Rolle Malerkrepp verbraucht,<br />
er ist einfach genial dazu geeignet, die Bauteile<br />
schnell zueinander auszurichten und<br />
zu fixieren.<br />
Stäbchen statt Klammern<br />
Während der Frontscheibenrahmen noch<br />
trocknet, kann schon an der Plicht weitergearbeitet<br />
werden. Hierfür werden die Seitenteile<br />
der Plicht in den Rumpf gestellt und an<br />
die Außenseiten gedrückt. Nun den Plicht-<br />
14
Der Fahrstand und der Heckspiegel (r.)<br />
Der „Kleinkram“ macht die ses recht große Modell<br />
lebendiger und detaillierter<br />
boden und die beiden Endteile einsetzen. Alles<br />
wird jetzt miteinander verleimt. Damit<br />
sich die Seitenteile dabei nicht ungewollt<br />
zusammenziehen, sondern stattdessen die<br />
Außenkontur übernehmen, wird im oberen<br />
Bereich der Plicht ein Stab eingesetzt. Auch<br />
dieser Tipp stammt aus der Bauanleitung.<br />
Damit die Form der Seitenteile erhalten<br />
bleibt, doppelt man die obere Kante der Seitenteile<br />
von innen mit einem weiteren Brettchen<br />
auf.<br />
Der Einbau der Ruderanlage unterschied<br />
sich bei meinem Modell von der Baukastenvariante<br />
durch die Verwendung von zwei Ruderanlagen<br />
der Fa. Raboesch. Für die Baukasten-Ruderanlage<br />
liegen alle Teile bei,<br />
selbst der Anlenkhebel wurde nicht vergessen.<br />
Für den Einbau des Empfängers und<br />
des Stellers sind im Rumpf zwei Holzplatten,<br />
auch an dieser Stelle habe ich die Anordnung<br />
nach meinen Wünschen etwas modifiziert.<br />
Klebefilm als Trennmittel<br />
Weiter geht es gemäß Bauanleitung wie der<br />
mit dem Dach der Kajüte. Das Dach selbst<br />
besteht aus 1,5-mm-Sperrholz und wird auf<br />
zwei Spanten mit Leisten geklebt. Hierzu<br />
wird erst besagtes Spanten-Leisten-Gestell<br />
im Aufbau vorsichtig zusammengeleimt.<br />
Hier hilft etwas Tesafilm als „Trennmittel“<br />
zwischen Aufbauwand und den Leimstellen,<br />
damit auch nur die gewünschten Teile miteinander<br />
verleimt werden. Ist diese Konstruktion<br />
ausgehär tet, wird das Dach auf die<br />
Leisten und die Spanten geleimt und mit<br />
Kreppband zum Trocknen fixiert.<br />
Es folgt die Montage des Rahmens für<br />
die Windschutzscheibe auf der Flybridge.<br />
Der Zusam men bau gleicht dem der Scheibenrahmen<br />
an der Vorderseite des Aufbaus.<br />
Jetzt kann am das ganze Arrangement auf<br />
das Dach setzen. Die Bauteile haben kleine<br />
Zapfen und das Dach passende Taschen die<br />
ineinander greifen. Dadurch lässt sich alles<br />
leicht ausrichten und verleimen.<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
An dieser Stelle sollte man aber nur den<br />
Scheibenrahmen verleimen und diesen erst<br />
nach den Lackierarbeiten auf das Dach<br />
kleben. So lassen sich die Teile getrennt<br />
lackieren und man spart sich viel Abklebe -<br />
arbeit.<br />
Neben der Windschutzscheibe sitzt auf<br />
dem Dach noch der Mast. Dessen Teile ha -<br />
ben mir von der Form her nicht zugesagt,<br />
deswegen habe ich die Teile für den Bug<br />
(Teile Nr. 34) für den Mast verwendet. Da der<br />
Mast aus zwei zusammengeleimten Bauteilen<br />
besteht, konnte ich auf den jeweiligen<br />
Innenseiten kleine Schlitze für die Kabel der<br />
Der Mast wurde aus Deko-Teilen, die am Bug<br />
angebracht werden sollten, gebaut<br />
Beleuchtungskörper einfräsen. Die Laternen<br />
aus dem Modellbaukaufhaus wurden dann<br />
passend verkabelt.<br />
„Kleinkram“<br />
Das Schott zur Kabine wird mit weiteren Teilen<br />
verfeinert. So findet sich in den gelaser -<br />
ten Platten ein Türrahmen sowie einige Einzelteile,<br />
aus denen das Fahrpult zusammengebaut<br />
wird. Auch alle Teile für den Gashebel<br />
sind mit dabei. Dieser setzt sich aus einem<br />
Holzteil und Ätzteilen zusammen.<br />
Es folgt weiterer „Kleinkram“, der die ses<br />
doch recht große Modell lebendiger und de-<br />
Die „Polstermöbel“<br />
Diese werden ebenfalls komplett aus<br />
Holz gefertigt. Einige Bearbeitungsstufen<br />
später sind verblüffend echt aussehende<br />
Sitzmöbel entstanden.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Die Polster, am Anfang jeweils ein Klotz (1)<br />
Die Polsterflächen entstehen aus Balsa (2)<br />
Fertige Polster vor der Lackierung (3)<br />
15
MOTORSCHIFFE<br />
<strong>QUEEN</strong> von <strong>aero</strong>-<strong>naut</strong><br />
Barbie und Ken machen auf der <strong>QUEEN</strong> eine gute Figur – auch auf dem Trockenen<br />
taillierter macht. Dazu gehört z. B. auch der<br />
Tisch aus einem Alurohr als Standfuß und<br />
einer bereits vorgefertigten Tischplatte. Alle<br />
„Polstermöbel“ für die Aus stattung des Achterdecks<br />
sind als Holzklötze im Baukasten<br />
enthalten. Hier gilt das Motto „schleifen,<br />
schleifen, schleifen“, bis aus den Klötzchen<br />
die Rückenlehnen und die Sitzflächen für<br />
die Bank und die Sitze geformt sind. Die abgenäh-ten<br />
Felder habe ich dabei aus Balsa -<br />
holz geschnitten und geschliffen. Diese Teile<br />
wurden dann auf die Trägerbrettchen ge -<br />
leimt und die „Polster“ nach dem Grun die -<br />
ren mattweiß lackiert.<br />
Insgesamt habe ich die Bauteile achtmal<br />
damit gestrichen. Zwischen jedem Anstrich<br />
sollte man mind. 36 Stunden Trocknungs -<br />
zeit einplanen, dann wird das Holz wieder<br />
angeschliffen. Das Unter wasserschiff habe<br />
ich nach dieser Pro zedur er neut angeschlif -<br />
fen und mit einer Schicht Grundierung für<br />
die weiteren Arbeitsschritte vorbereitet. Der<br />
finale Farbauftrag erfolgte dann mit weißem<br />
matten Auto lack aus der Sprühdose. Auch<br />
das Dach des Aufbaus wurde nach der Grundierung<br />
weiß lackiert, dadurch entsteht am<br />
fertigen Modell ein schöner Kontrast.<br />
Im Baukasten liegen Aufkleber für den<br />
Wasserpass und Schriftzüge für das Mo dell<br />
bei. Da ich mich mit den Farben (Gold und<br />
Grün) nicht anfreunden konnte, habe ich<br />
den Wasserpass mit einem 4 mm breiten Silberstreifen<br />
dargestellt, als Scheuerleiste habe<br />
ich eine 3 mm breite, selbstklebende Chromleiste<br />
aus dem Autozubehör verwendet. Nun<br />
können endlich die letz ten Bauschritte vorgenommen<br />
werden. Hierzu zählen die Montage<br />
der Reling, der Badeleiter, des Flaggenmastes<br />
und der Klampen am Rumpf.<br />
Fehlt nur noch das Innenleben. Der Einbau<br />
der Fernsteuertechnik geht sehr leicht<br />
von der Hand, da der Innenraum des<br />
Modells dank der großen Decksöffnung sehr<br />
gut zugänglich ist. Der Einbau der beiden<br />
Ein 4 mm breiter Silbersteifen<br />
Während der nun immer wieder auftre ten -<br />
den Trockenpausen beim Lackieren kann<br />
man sich schon wunderbar um die weiteren<br />
Beschlagteile kümmern. So sind in der Bauanleitung<br />
Schablonen für die Reling abgedruckt,<br />
damit man den vernickelten Draht<br />
in die passenden Formen biegen kann.<br />
Allgemein finde ich es sehr gut, dass viele<br />
Details bzw. Beschlagteile selbst gebaut werden<br />
können. Der beiliegende Ätzteilesatz<br />
enthält weitere feine Details.<br />
Auch der Rahmen der Vorschiffsluke ist<br />
so ein Ätzteil, das auf dem fertig lackierten<br />
Vorschiff richtig was her macht. Toll, dass<br />
man dank dieser guten Bau kastenaus stat -<br />
tung keinen separaten Beschlagsatz kaufen<br />
muss. Aus ein paar Holzteilen wird dann<br />
noch das Schiebeluk für den Aufbau zusammengesetzt,<br />
der Fahrstand wird ebenfalls<br />
mit einem Ätz teil, nämlich der Instrumententafel,<br />
komplettiert.<br />
Bevor es mit der Montage der letzten<br />
Beschlagteile weitergeht, muss alles noch<br />
gründlich lackiert werden. Hier hat wohl<br />
jeder Modellbauer so seine bevorzugten Produkte.<br />
Schon bei meinem ersten Mo dell von<br />
<strong>aero</strong>-<strong>naut</strong>, der DIVA, verwendete ich „G4“<br />
von VossChemie. Diesen 1-K- Polyurethan-<br />
Bootslack kann man nicht an jeder Ecke kaufen,<br />
aber gut sortierte Farbenläden oder z. B.<br />
Versandhändler für Bootszubehör führen<br />
dieses Produkt. Ich habe Rumpf und Aufbau<br />
mit G4 behan delt.<br />
Die große Decksöffnung vereinfacht Einbau und Wartung der RC-Komponenten<br />
Für den Vortrieb sorgen zwei Brushless-Außenläufer. Beim Bugstrahlruder genügt ein<br />
preiswerterer Bürstenmotor<br />
16
Klarer Lack und edle Hölzer verleihen<br />
der <strong>QUEEN</strong> eine noble Ausstrahlung<br />
Brushless-Außenläufer-Motoren und der<br />
Anlagenkomponenten ging folglich leicht<br />
von der Hand. Die Antriebsmotoren werden<br />
von einem 4s-LiPo (14,4 V) mit 4000 mAh<br />
versorgt, für die Sonderfunktionen (Beleuchtung<br />
und Bugstrahlruder) sind fünf NiMH-<br />
Zellen (6 V) mit 2000 mAh zuständig. Bei<br />
einem kurzen Funktions- und Dichtigkeitstest<br />
in der Badewanne habe ich noch etwas<br />
mit der Positioniereung der Akkus expe -<br />
rimen tiert, um das Modell ohne zusätzliches<br />
Ballastblei optimal auszutrimmen.<br />
Wie auf Schienen<br />
Einschalten, Funktionstest der Anlage und<br />
ab mit der <strong>QUEEN</strong> ins Wasser. Bei den ersten<br />
vorsichtigen Runden mit lang sa mer Fahrt<br />
und dem Austesten der Kurvenradien wird<br />
klar, dass die <strong>QUEEN</strong> mit den beiden Antriebs-<br />
und Ruderanlagen wie auf Schienen<br />
fährt und jeden Ruderschlag direkt umsetzt.<br />
Bei Hartruderlagen driftet das Heck seitlich<br />
weg, ansonsten liegt das Modell während der<br />
Fahrt ruhig im Wasser und kommt auch<br />
schnell in die Gleitphase. Dann kommt das<br />
weiße Unterwasser schiff richtig gut zur Geltung<br />
und auch das weiße Dach bietet einen<br />
tollen Kon trast zu den Holztönen des Modells.<br />
Bei Vollgas entwickelt die <strong>QUEEN</strong> ein<br />
beachtliches Wellenbild, in schnell gefahrenen<br />
Kurven neigt sich das Modell leicht nach<br />
innen und macht dadurch einen sehr dynamischen<br />
Eindruck. Auch höhere Wellen können<br />
dem Rumpf nichts anhaben, der Knickspant<br />
pflügt sich förmlich durch. Auch die<br />
Fahrzeit geht bei diesem Setup in Ordnung.<br />
Mit den 4000 mAh ergibt sich bei Dauer-<br />
Vollgas eine Fahrzeit von ca. 20 min. Aber<br />
mit einer solchen Yacht fährt man ja nicht<br />
nur Vollgas, gerade das eingebaute Bugstrahlruder<br />
und die getrennt ansteuerbaren<br />
Motoren ergeben viele „Spielmöglichkeiten“<br />
z. B. beim An- und Ablegen. n<br />
DER AUTOR<br />
Jörg Dreischulte hat sich auf das Thema<br />
Motoryachten spezialisiert und ist Mitglied<br />
der I. G. Yachtmodellbau.<br />
Fazit<br />
Der <strong>aero</strong>-<strong>naut</strong> Baukasten überrascht<br />
positiv. Die Holzteile passen sauber<br />
aneinander und die ausführliche Bau -<br />
anleitung ermöglicht auch weniger<br />
erfahrenen Modellbauern den Aufbau<br />
des Modells. Für den fortgeschrittenen<br />
Modellbauer bietet sich der Reiz, die<br />
<strong>QUEEN</strong> mit weiteren Funktionen aus -<br />
zustatten. Für jeden, der einmal ein<br />
Modell nach Bauplan bauen möchte, ist<br />
dieser Bausatz ein passendes Übungs -<br />
objekt, um sich mit dem Rumpfbau auf<br />
Spant vertraut zu machen. Das Modell<br />
lässt sich in überschaubarem Zeit -<br />
rahmen zusammenbauen und ich hatte<br />
dabei viel Spaß. Auch am Teich überzeugt<br />
die <strong>QUEEN</strong> – Ken durch den<br />
Fahrspaß und Barbie durch das schicke<br />
Aussehen.<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
17
MOTORSCHIFFE MasterCraft 300<br />
WASSERSKILÄUFER FÜR MASTERCRAFT 300<br />
Skispaß<br />
auf dem Teich<br />
Profi-Wasserskiläufer<br />
vollführen spektakuläre<br />
Kunststücke, während sie auf<br />
Brettern stehend von einem<br />
Sportboot gezogen werden.<br />
Ein Profi ist der Wassersportler<br />
in 1:20 von Markus Laimgruber<br />
zwar nicht, Aufsehen erregt<br />
er trotzdem am Sportgewässer.<br />
18<br />
TEXT UND FOTOS:<br />
Markus Laimgruber<br />
Angefangen hatte alles mit der Idee,<br />
einmal etwas zu bauen, das die<br />
Zuschauer bei unseren wöchentlichen<br />
Ausfahrten am<br />
nahegelegenen See verblüfft.<br />
Schwim mende RC-Tiere, Paddler usw. gab<br />
es ja des Öfteren, da ich aber etwas sehr<br />
selten zu Sehen des haben wollte, kam ich<br />
auf die Idee, einen Wasserskifahrer im Maßstab<br />
von 1:20 für ein Motorboot zu fertigen.<br />
Nun wollte ich aber keine Neuauflage des<br />
seinerzeit recht bekannten Wasserski-Fah -<br />
rers von Hegi stellen, sondern eine Figur, die<br />
wie im Original aus dem Wasser startet und<br />
nach Ende der Fahrt darin auch wieder versinkt.<br />
Was ich zu diesem Zeit punkt noch<br />
nicht ahnte: Der kleine Maßstab bescherte<br />
mir viele Probebauten und Fahrver suche.<br />
Nach diversen Versuchen mit Seil sys te -<br />
men, Trimmgewichten, Auftriebskörpern,<br />
usw. kam mir irgendwann die rettende Idee:<br />
Diese bestand darin, hinter dem Boot einen<br />
transparenten und folglich im Wasser nicht<br />
sichtbaren Kunststoffstreifen herzuziehen,<br />
auf dessen Ende der Sportler befestigt wird.<br />
Über eine kleine Gelenkplatte wird der<br />
Kunststoffstreifen am Heck des Bootes befestigt.<br />
Es brauchte zwar noch einige Tests<br />
und Veränderungen, aber ich kam meinem<br />
Ziel immer näher.<br />
Kopf aus dem Wasser<br />
Der jetzige Stand ist ein Wasserski fahrer, der<br />
bei Stillstand langsam im Was ser ver sinkt,<br />
bis nur noch Schultern und Kopf aus dem<br />
Nass ragen. Gibt man Gas, kommt Wasserströmung<br />
unter die Kunststoffplatte und<br />
hebt somit die Person aus dem Wasser. In<br />
den Kurven kommt es dann mitunter auch<br />
zu diversen Kunst stücken.
Der Cockpitbereich ist offen gestaltet. Bis zu zwölf Personen können sich dort amüsieren<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
Der Wasserskifahrer erhielt natürlich wie<br />
in echt ein Zug seil in die Hände, das mit<br />
einer kleinen Feder am Zugschiff befestigt<br />
ist. Die Feder hält das Seil immer leicht auf<br />
Span nung und so entsteht die Illusion, dass<br />
die Person allein dadurch gezogen wird.<br />
Als Wasserskifahrer kam eine robbe-Biegefigur<br />
im Maßstab 1:20 zum Einsatz. Die<br />
Figur wurde vorsichtig entkleidet und per<br />
Farbe mit einer Badehose versehen. Wäh -<br />
rend der Fahrt kann man die Kunststoff -<br />
plattenverbindung nicht erkennen, und so<br />
kommt es, dass alle Zuschauer sehr verblüfft<br />
sind, meist lächeln und über die Technik dahinter<br />
diskutieren, bis es zur Auflösung des<br />
Rätsels kommt.<br />
Da ich für die Tests meines Fahrers kein<br />
korrektes Modell eines Original-Motorzug -<br />
boo tes hatte, kam in folglich der Wunsch<br />
nach einem „richtigen“ Zugboot auf. Wegen<br />
19
MOTORSCHIFFE MasterCraft 300<br />
Der Sportler wird am Ende eines im Wasser unsichtbaren Kunststoffstreifens hinterhergezogen<br />
des kleinen Maßstabes scheiden viele Vorbilder<br />
mit Rumpflängen unter 9 m aus, und<br />
so stieß ich als Yachtfan nach ei niger Suche<br />
im Internet auf die „MasterCraft 300“.<br />
Ordentliche Portion Extravaganz<br />
Diese wurde auf der Miami Boat Show im<br />
Jahr 2009 als neues Spitzenmodell der<br />
Firma MasterCraft aus Tennessee vorgestellt.<br />
Eine handlaminierte Kunststoff-Yacht, die<br />
mit zwei Wellenantrieben in speziellen Wellentunneln<br />
ausgerüstet ist. Als Antriebs -<br />
motoren stehen entweder zwei Indmar V8-<br />
Benziner mit je 257 kW oder zwei Cummins-<br />
Mercruiser-Diesel mit je 294 kW zur Wahl.<br />
Reichlich Leistung für die 10,29 m lange und<br />
3,35 m breite Power-Yacht. Bei einem Ge -<br />
wicht von mindestens 5.670 kg erreicht sie<br />
dabei maximal 34,4 km/h, was locker für<br />
Wasserskifahren und Wakeboarden reicht.<br />
Vor allem verfügt diese kleine Yacht aber<br />
über eine extravagante Optik, die sich sehr<br />
von der großen Masse vergleichbarer Boote<br />
unterscheidet. Nebenbei kann man auch<br />
noch aus 20 verschiedenen Farben wählen.<br />
Am Heck befindet sich ein ausgeklügeltes<br />
System, um aus den Sitzbänken eine Son -<br />
Erst in Fahrt hebt sich der Körper<br />
aus dem Wasser<br />
20
Auf einem GfK-Eigenbau entstehen Deck<br />
und Aufbauten aus ABS-Platten. Als Vorlage<br />
dienen Zeichnungen und Fotos<br />
nen liege zu gestalten. Maximal zwölf Personen<br />
können sich so auf der Yacht vergnügen.<br />
Bau des Modells<br />
Der Bau orientierte sich an meiner allgemein<br />
üblichen Vorgehensweise, über die ich ja<br />
schon mehrfach in der <strong>SchiffsModell</strong> und<br />
auch im Sonderheft zum Thema Motoryachten<br />
berichtet habe: Auf einem GfK-Eigenbaurumpf<br />
werden Deck und Aufbauten auf<br />
ABS montiert. Draufsicht und Seitenansicht<br />
sowie genügend Bildansichten fand ich im<br />
Internet.<br />
Um eine zu hohe Schwerpunktlage zu<br />
vermeiden, verzichtete ich jedoch auf ein<br />
Hardtop. Für den Antrieb kamen zwei vor -<br />
han de ne Graupner SPEED 400 7,2 V aus<br />
der Bastelkiste zum Einsatz, der Rumpf<br />
erhielt zwei kleine Wellen tunnel mit zwei<br />
selbstgebauten Rudern aus Messing. Ein<br />
7,2-V-Akku mit 2000 mAh reicht für rund<br />
zehn Minuten Fahrzeit und sorgt damit für<br />
einen ausgepowerten Wasserskifahrer.<br />
Diese Modellkombination sorgt immer<br />
für viel Spaß am See.<br />
n<br />
DER AUTOR<br />
Markus Laimgruber befasst sich schon<br />
seit Jahren mit dem Komplett-Eigenbau<br />
aktueller Motoryachten.<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
Für Vortrieb sorgen zwei Wellenanlagen, die in leicht ausgeformten Wellentunneln verlaufen<br />
21
MOTORSCHIFFE<br />
Fischdampfer Cuxhaven<br />
Fischdampfer aus den 50er- und 60er-<br />
Jahren als Modell am Modell teich anzutreffen,<br />
geschieht nicht gerade häufig.<br />
Eigentlich nicht weiter verwunderlich, denn<br />
es gibt praktisch keine Baukästen und auch<br />
nur selten tauchen Planunterlagen dieser Art<br />
von Schiffen auf.<br />
Durch Zufall geriet mir beim Aufräumen<br />
meines Archivs eine Seite aus der ehema -<br />
ligen Zeitschrift „HANSA“ aus dem Jahr 1957<br />
in die Hände. Auf diesem Zeichnungsblatt<br />
war der Generalplan dieses Schiffstyps abgedruckt,<br />
allerdings ohne Spantenriss. Ich<br />
ließ mir also dieses Blatt so vergrößern, dass<br />
ich auf einen Nachbaumaßstab von 1:50 kam.<br />
Somit ergab sich eine Modelllänge von 1,2 m<br />
und eine Breite von 20 cm. Anhand des Seitenrisses,<br />
der Draufsicht und der Vorderansicht<br />
habe ich mir nun den Spantenriss<br />
selbst ausgetüftelt.<br />
Nach den so entstandenen Bauunterlagen<br />
wurde der Rumpf dann in üblicher Spantenbauweise<br />
aus Holz auf einem Hellingbrett<br />
erstellt. Die einzelnen Spanten aus Buchensperrholz<br />
wurden innen ausgesägt, um<br />
einen entsprechenden Freiraum im Rumpfinneren<br />
zu erhalten.<br />
Beplankung aus dem Sperrmüll<br />
Im Kielbrett hatte ich bereits die Durch -<br />
brüche für Ruderkoker und Antriebswelle<br />
berücksichtigt. Nach dem Verbinden der<br />
Spanten mit Längsstringern aus 2 x 5-mm-<br />
Kiefernleisten konnte ich mit der Beplan -<br />
kung des Rumpfgerippes mit 2 x 15-mm-<br />
Nussbaumleisten beginnen. Das Material<br />
für die Beplankung habe ich übrigens aus<br />
einer Holzplatte, die ich auf dem Sperrmüll<br />
gefunden hatte, mit meiner Bandsäge selbst<br />
zurechtgesägt. Im Bug- und Heckbereich,<br />
wo das Beplanken den Spanten wegen der<br />
FISCHDAMPFER CUXHAVEN<br />
Meier in Form<br />
In den 50er- und 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts<br />
bevölkerten sie in großer Zahl die Fischereihäfen an<br />
der Nordseeküste: klassische Seitenfänger-Fischdampfer.<br />
TEXT UND FOTOS: Dietrich Schletter<br />
starken Krümmungen mit Leisten sehr aufwendig<br />
geworden wäre, habe ich stattdessen<br />
Balsaholz-Füllklötze eingesetzt. Nach wiederholtem<br />
Schleifen und Spachteln konnte<br />
der fertige Rumpf schließlich vom Hellingbrett<br />
gelöst werden und als Nächstes stand<br />
die Anfertigung eines passenden Ständers<br />
an.<br />
Da das Hauptdeck auf dem Original mit<br />
Holz beplankt ist, wollte ich dies auch bei<br />
meinem Modell nachempfinden. Hierfür<br />
erhielt ich bei einer Möbeltischlerei helles<br />
Nussbaumfurnier, aus dem ich dann 4 mm<br />
breite Streifen ausgeschnitten und auf das<br />
Deck aufgeleimt habe. Ähnlich verfuhr ich<br />
beim Backdeck. Diese Arbeit war sehr langwierig<br />
und erforderte deshalb auch eine<br />
Menge an Geduld.<br />
Nach Abschluss der Arbeiten am Rumpf<br />
konnte ich diesen mit Acryllack aus Sprühdosen<br />
lackieren, das Deck wurde farblos seidenmatt,<br />
das Schanzkleid innen grau, der<br />
Rumpf hat im Unterwasserschiffbereich<br />
eine rotbraune Farbe, über Wasser ist er<br />
schwarz. Der relativ breite Wassergang ist<br />
grün abgesetzt. Für die Beschriftung verwendete<br />
ich Aufklebe-Buchstaben.<br />
Die Aufbauten, die fast das komplette hintere<br />
Drittel des Modells dominieren, entstanden<br />
aus 2-mm-Polystyrol-Platten. Vor dem<br />
Ausschneiden der entsprechenden Teile<br />
habe ich mir aber erst einmal Kartonschablonen<br />
erstellt. Um einen guten Zugang zum<br />
Rumpfinneren zu erhalten, ist der gesamte<br />
Aufbau einschließlich des Oberdecks abnehmbar.<br />
Spillköpfe aus Kugelschreibern<br />
Auch bei den Detailarbeiten am Aufbau blieb<br />
ich Kunststoff als Baumaterial treu, so bestehen<br />
zum Beispiel die Rahmen der Fenster<br />
aus 1-mm-ABS. Gleiches gilt zum Beispiel<br />
für die Luken der Kühlräume, die ebenfalls<br />
aus 1-mm-ABS entstanden.<br />
Am Original waren ein Rettungsboot sowie<br />
ein Schlauchboot an Bord. Das Schlauchboot<br />
entstand im Eigenbau auf Basis eines<br />
Gummischlauches mit 10 mm Durch mes -<br />
ser, beim Rettungsboot auf der Backbord -<br />
seite griff ich auf ein käufliches Fertigteil zurück.<br />
Die Davits für das Rettungsboot entstanden<br />
hingegen wieder im Eigenbau aus<br />
ABS und Messingrohr. Für die Masten auf<br />
dem Hauptdeck und dem Achterdeck sowie<br />
22
die Ladebäume verarbeitete ich Alu- und<br />
Messingrohr.<br />
Für die Masten auf dem Hauptdeck und<br />
dem Achterdeck sowie die Ladebäume verarbeitete<br />
ich Alu- und Messingrohr.<br />
Insgesamt gesehen habe ich für den Bau<br />
des Modells nur relativ wenige Fertigteile<br />
verwendet, dafür aber viele Einzelteile im<br />
Eigenbau erstellt. So wurden zum Beispiel<br />
Blöcke und Seilrollen mit der Hilfe von Locheisen<br />
ausgestanzt und entsprechend zusammengeklebt.<br />
Lüfter entstanden aus Kugelschreiberminen<br />
und Flaschenverschlüssen,<br />
andere Beschlagteile wurden aus ABS und<br />
Holz gefertigt, die Poller haben als Basis zum<br />
Beispiel Pinnwandstifte. Auch die Netz -<br />
winde entstand im kompletten Eigenbau, als<br />
Seilrollen dienen hier Rollen vom Nähmaschinengarn,<br />
die Spillköpfe sind aus Kugelschreiber-Zubehör<br />
gefertigt. Auch die Suchscheinwerfer<br />
bestehen aus umgearbeiteten<br />
Kugelschreiberhülsen, die vorne mit einer<br />
Plastikscheibe versehen wurden.<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
Ein klassischer Seitenfänger im<br />
kompletten Eigenbau bietet dem<br />
Modellbauer auch überreichlich<br />
Möglichkeiten zur umfangreichen<br />
Detaillierung<br />
Neben den Fahrfunktionen ist das Modell<br />
noch mit einer Beleuchtung, einem Dieselgeräuschgenerator<br />
sowie einem Kühlwasseraustritt<br />
ausgestattet, wobei letzterer nicht<br />
nur der Show dient, sondern das ausgestoßene<br />
Kühlwasser durchfließt auch zuerst<br />
den Drehzahlsteller.<br />
Für den Antrieb ist ein Mabuchi 540 eingebaut,<br />
der direkt auf einen Propeller von<br />
55 mm Durchmesser wirkt. Für die Stromversorgung<br />
sind zwei parallel geschaltete Akkus<br />
6 V/11 Ah zuständig, die für eine lange<br />
Fahrzeit sorgen. Auch die Fernsteueranlage<br />
wird mittels BEC-System aus den Fahrakkus<br />
mit Strom versorgt.<br />
Bei täglich etwa ein bis zwei Bastel stun -<br />
den dauerte der Bau zwei Jahre.<br />
n<br />
DER AUTOR<br />
Dietrich Schletter ist in Husum an der<br />
Nordseeküste zuhause und hat die<br />
große Zeit der klassischen Fischdampfer<br />
selbst noch erlebt.<br />
DAS VORBILD<br />
Klassischer Schiffstyp<br />
Fischdampfer der hier vorgestellten<br />
Bauart bevölkerten in den 50er- bis Mitte<br />
der 60er-Jahre die Häfen von Hamburg,<br />
Cuxhaven und Bremerhaven.<br />
Bremerhaven beherbergte seinerzeit den<br />
größten Fischmarkt sowie die größten Fisch -<br />
verarbeitungs-Betriebe und Fischversteigerungs-Märkte<br />
an der Nordseeküste.<br />
Diese Fischdampfer wurden zum größ ten Teil<br />
auch in Bremerhaven auf der Rickmers-Werft<br />
gebaut, die in dieser Hinsicht die meisten<br />
Erfahrungen vorzuweisen hatte.<br />
Diese Fischdampfer waren als Seitenfänger<br />
ausgelegt, das heißt das Netz wurde über jeweils<br />
zwei Galgen steuerbords bzw. backbords<br />
zu Wasser gelassen und mittels der großen<br />
Netzwinde, die mittig vor dem Brückenaufbau<br />
montiert war, bedient. An solch einen Fischdampfer<br />
wurden große Anforderungen gestellt:<br />
Hohe Seetüchtigkeit, große Ladekapazität,<br />
dazu ausreichend Platz an Deck für die Ver -<br />
arbeitung des Fangs und ein gutes Steuer -<br />
verhalten während der Schleppfahrt.<br />
Aus diesen Anforderungen entwickel te sich<br />
ein ganz bestimmter Schiffstyp. Er war auf<br />
Balkenkiel gebaut, hecklastig ausgelegt und mit<br />
starker Aufkimmung versehen, um eine gute<br />
Schleppleistung zu erbringen. Sehr wichtig<br />
für die Seetüchtigkeit war der Sprung der<br />
Decks linien im Vorschiff. Die Erhöhung des<br />
Bugs, der ursprünglich eher flach gehalten war,<br />
führte später durch die Erhöhung der Back zur<br />
neuzeitlichen „Meierform“. Die Querwölbung im<br />
Deck, die sogenannte Balkenbucht, war eher<br />
gering gehalten, um ein leichtes Verarbeiten des<br />
Fangs an Deck zu ermöglichen.<br />
Die Meierform hat sich bei Fischdampfern<br />
bewährt und durchgesetzt, da die Bugform<br />
insbesondere für ein gegen überkommendes<br />
Seewasser geschütztes Arbeitsdeck sorgte,<br />
was ein sicheres Arbeiten an Deck überhaupt<br />
erst möglich machte.<br />
Die achtern angeordneten Aufbauten enthielten<br />
die Maschinenanlage sowie die Unterkünfte<br />
für die Besatzung. Das Arbeitsdeck lag also<br />
unmittelbar vor dem Deckshaus.<br />
Über die schon erwähnten Galgen wur den die<br />
Schleppnetze mit den Scherbrettern (diese<br />
dienen dazu, die Netzöffnung auseinander zu<br />
halten) zu Wasser gelassen. Die Galgen wurden<br />
aus U-förmig gebogenen Profileisen gefertigt<br />
und an der Bordwand befestigt, sie sind leicht<br />
nach außen gebogen. Im Bogen dieser Galgen<br />
hängen die Rollen zur Führung der Kurrleinen.<br />
Die Fanggebiete dieser Schiffe lagen vor Grönland<br />
und Neufundland, eine durchschnittliche<br />
Fangfahrt dauerte zwischen 30 und 40 Tagen,<br />
an Besatzung waren bei diesem Schiffstyp<br />
zwischen 20 und 30 Mann an Bord.<br />
Die Schiffe hatten im Schnitt eine Länge von<br />
60 m zwischen den Loten, bei einer Breite von<br />
10 m, einer Seitenhöhe von 5,5 m und einem<br />
Konstruktionstiefgang von 4,5 m. Die Vermessung<br />
lag bei 950 BRT.<br />
Der Antrieb erfolgte über einen Dieselmotor mit<br />
ca. 1.500 PS, mit dem eine Geschwindigkeit von<br />
12 bis 14 kn er reicht wurde. Übrigens war die<br />
Mannschaft am Fangerfolg prozentual beteiligt.<br />
23
MOTORSCHIFFE Joker 185<br />
Speed<br />
JOKER 185 VON EPV<br />
ohne Bürsten<br />
Brushless-Motoren und LiPo-Akkus verhelfen inzwischen auch sehr großen Powerboats zu<br />
Fahrleistungen , die noch vor wenigen Jahren für Elektroantriebe unerreichbar waren.<br />
TEXT UND FOTOS: Dieter Jaufmann<br />
Wenn ich an das Jahr 2006<br />
zurückdenke, so hatte ich<br />
mir damals meinen heiß ersehnten<br />
Traum verwirklicht,<br />
einen großen Rennkatamaran,<br />
der von zwei Antriebsmotoren vorangetrieben<br />
wird. Der Joker-Rumpf stammte von<br />
der Firma EPV, die diesen seiner zeit in drei<br />
unterschiedlichen Größen pro duzierte: Zum<br />
einen die kleinste Version mit einer Länge<br />
von 135 cm, die mittlere kam auf 160 cm und<br />
die große Variante auf stolze 185 cm.<br />
Die Joker ist ein Klassiker<br />
Dieses Powerboat wurde damals von zwei<br />
Plettenberg 355/45/4 befeuert, der Strom<br />
kam aus jeweils 2 x 36 Zellen NiMH GP 3300<br />
mAh. Die Fahreigen schaften der großen „Joker“<br />
waren wie aus dem Bilderbuch und der<br />
Sound der beiden Plettis war ein Hörgenuss<br />
vom Feinsten. Mit diesem Setup fuhr ich<br />
schließlich das Modell begeistert über drei<br />
Jahre lang, aber leider war den beiden Antriebsaggregaten<br />
die Anstrengung nach<br />
jeder Fahrt deutlich anzumerken. Fahrzeiten<br />
von mehr als 3 Minuten am Stück waren wegen<br />
thermischen Problemen einfach nicht<br />
möglich, ansonsten wäre unweigerlich Lötzinnverlust<br />
die Folge gewesen.<br />
Mit dem Einsatz von bürstenlosen Motoren<br />
erreichen derartige Modelle heutzutage<br />
aber in punkto Leistung ganz neue Dimensionen.<br />
Eigentlich führt an Brushless moto -<br />
ren kein Weg mehr vorbei und die Tage der<br />
Bürstenmotoren sind inzwischen wohl wirklich<br />
gezählt.<br />
Dieses Bild verdeutlicht recht schön die<br />
Größenverhältnisse<br />
Obwohl die Bürsten-Plettis gute Dienste<br />
geleistet hatten, entschloss ich mich, diese<br />
doch nicht weiter in der „Joker“ zu quälen,<br />
son dern sie durch neue Brushless-Treiblinge<br />
zu ersetzen.<br />
Kaum gesagt, schritt ich bereits zur Tat<br />
und demontierte den kompletten Inhalt aus<br />
dem großen Rumpf. Die einlaminierten Motor-<br />
und Akkuhalter erwärmte ich zunächst<br />
vorsichtig mit einem Föhn und entfernte sie<br />
danach gefühlvoll mit der schon oft erwähnten<br />
sanften Gewalt … aber Vorsicht, dass das<br />
GfK-Laminat des Rumpfes dabei nicht zu<br />
heiß wird, ansonsten sind Schäden vorprogrammiert.<br />
Somit stand der Rumpf nach einer gewissen<br />
Zeit wieder ganz „nackt“ vor mir, so dass<br />
ich die Gelegenheit gleich nutzte und ihn<br />
zum Lackierer brachte. Eigentlich hatte ich<br />
dies ja schon seit über zwei Jahren vor …,<br />
aber irgendwie kam immer etwas dazwischen.<br />
Vorerst entschied ich mich, die<br />
„Joker“ ausschließlich in Weiß Metallic zu<br />
spritzen und anschließend die Farbe noch<br />
mit einer Schicht Autoklarlack zu schützen.<br />
In der Zwischenzeit erkundigte ich mich<br />
bei einigen Hobbykollegen, die ähnlich gro -<br />
ße Boote betreiben, nach der von ihnen bevorzugten<br />
Hardware. Nun ja, das bekannte<br />
24
Sprichwort von den zwei Befragten mit den<br />
drei Meinungen traf auch in diesem Fall wieder<br />
einmal zu: Die einen empfahlen mir Motoren<br />
aus dem Hause Plettenberg, die anderen<br />
wiederum Lehner-Aggregate, und die<br />
Empfehlungen nannten Motoren mit den<br />
unterschiedlichsten Windungszahlen, so<br />
dass ich im Nachhinein genauso schlau war<br />
wie vorher. Mein Ziel war es aber, keinen Kat<br />
für SAW-Geschwindigkeitsrekorde aufzubauen,<br />
sondern das Modell sollte ein sicheres<br />
und schönes Fahrbild bei ordentlicher Fahrleistung<br />
zeigen.<br />
Letztendlich fiel meine Wahl auf zwei luftgekühlte<br />
Lehner 3060/10. Jedes dieser Aggregate<br />
ist rund 1250 g schwer, 112 mm lang,<br />
und hat 60 mm Durchmesser. Bei 10 Windungen<br />
machen sie 700 Umdrehungen pro<br />
Minute pro Volt und erreichen bis zu 8 kW<br />
an Leistung. Als Regler kamen die bewähr -<br />
ten Schulze 40/160 WK zum Einsatz. Den<br />
ganzen Strom für mein Vorhaben sollen fürs<br />
Erste 4 x 40 Zellen GP 3.700 mAh liefern.<br />
Einbau der Komponenten<br />
Nachdem der Rumpf vom Lackierer wieder<br />
in den heimischen Modellbaukeller zurückgekehrt<br />
war, begann natürlich gleich der Aufbau.<br />
Die Motoren wurden mit zwei LMT-<br />
Haltern perfekt im Rumpf befestigt, die Verbindung<br />
zwischen den 6,35-mm-Flexwellen<br />
und den 10-mm-Motorwellen wurde durch<br />
passende Spannzangenkupplungen hergestellt.<br />
Am Heck kamen aufs Neue die beiden<br />
schon zuvor verwendeten MTC 2000-<br />
Powertrimms zum Einsatz, zusätzlich baute<br />
ich mir noch zwei kleine Halter aus Alu, welche<br />
das Messingrohr nun abstützen. Die<br />
Reglerhalter entstanden aus einer GfK-Platte<br />
und wurden anschließend an die Seiten -<br />
wand jeweils neben dem zugehörigen Motor<br />
60 LiPos fertig verlötet, noch ohne Halter<br />
Zwei LiPo-Packs in speziellen Haltern<br />
Die Lehner-<br />
Motoren<br />
mit den<br />
Schulze-<br />
Reglern<br />
laminiert. In beide Schwimmer kamen die<br />
Akkuhalter, welche jeweils 80 Zellen fassen<br />
können, die mittels Klettband und Klettschlaufen<br />
fest in Position gehalten werden.<br />
Somit war der Neuaufbau schnell erledigt<br />
und die Akkus konnten geladen werden.<br />
Hier wurde es nun doch ein bisschen unübersichtlich,<br />
da gleichzeitig acht Ladegeräte<br />
zum Einsatz kamen, um die insge samt<br />
160 Zellen auf einen Schlag aufzula den.<br />
Erste Fahrerprobung<br />
Als Propeller montierte ich zwei Octura<br />
X457, die nach außen schlagen. Am See angekommen,<br />
schloss ich erst mal alles gespannt<br />
an und setzte die „Joker“ ins Wasser.<br />
Mit zittrigen Händen schob ich den Gasknüppel<br />
etwas hoch und die „Joker“ bewegte<br />
sich gelassen Richtung Seemitte, wo ich<br />
schließlich den Gashebel zügig nach vorn<br />
drückte. Es war einfach unbeschreiblich, mit<br />
welcher spielerischer Leichtigkeit die beiden<br />
Lehner die 25 kg Kampfgewicht in Bewe -<br />
gung setzten. Die Joker schoss förmlich aus<br />
Alte und neue<br />
Stromspender im<br />
Vergleich<br />
Die beiden<br />
Powertrimms<br />
konnten<br />
weiter<br />
verwendet<br />
werden.<br />
Einer der Motoren<br />
fertig montiert<br />
Jeweils zwei Motorhalter fixieren ein Lehner-Aggregat<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
25
MOTORSCHIFFE<br />
dem Wasser und erreichte nach wenigen Metern<br />
bereits ihre Top Speed. Aber schon auf<br />
der dritten Gerade fuhr der Kat bei Vollgas<br />
plötzlich eine ungesteuerte Kurve und einer<br />
der Motoren drehte hörbar hoch. Also erst -<br />
mal ganz langsam wieder Richtung Steg fahren<br />
und das Modell aus dem Wasser neh -<br />
men. Nun war auch sofort die Ursache klar,<br />
denn der Propellerschaft der linken Antriebsanlage<br />
war schlicht und ergreifend abgebrochen<br />
und ruht mitsamt dem Propeller<br />
nun auf dem Grund meines Fahrgewässers.<br />
Ende der Probefahrt!<br />
Sprung aus dem Wasser<br />
Ausgerüstet mit einem neuen Schaft und einem<br />
neuem Pärchen 57er-Octura-Pro pel ler<br />
ging es am nächsten Wochenende wieder an<br />
den See. Mit nun mehr Mut gab ich gleich<br />
etwas mehr Gas und die „Joker“ sprang auf<br />
Anhieb förmlich aus dem Wasser und „flog“<br />
anschließend wie auf Schienen davon: Kein<br />
Wippen, Aufschaukeln oder Sonstiges, einfach<br />
nur wie aus dem Bilderbuch!<br />
Nach fast fünf Minuten Fahrzeit holte ich<br />
mein Traummodell sicherheitshalber wieder<br />
zurück an den Steg, um die Komponenten<br />
auf Temperatur zu prüfen. Die Schulze-Regler<br />
und die Lehner-Motoren hatten sich nur<br />
minimal erwärmt, die Akkus waren auf guter<br />
Was sich auf dem Wasser abspielt, kann man<br />
schon fast als brutal bezeichnen …<br />
Betriebstemperatur. Die Höchstgeschwindigkeit<br />
lag laut dem mitgefahrenen GPS bei<br />
118,4 km/h, was für mich vollkommen ausreichend<br />
ist.<br />
Nach rund einem Jahr im Einsatz, beschloss<br />
ich, die „Joker“ auf die Energieversorgung<br />
aus LiPo-Akkus umzurüsten. Hierfür<br />
entschied ich mich für eine 12s5p-Abstimmung,<br />
wobei jeweils ein Satz 12s2p in den<br />
Schwimmern und ein Satz 12s1p auf dem<br />
Tunnel ihre Plätze finden. Das Verlöten der<br />
ganzen Zellen und vor allem der Bau der Akkuhalter<br />
hat dann doch noch viel Zeit und<br />
Mühe gekostet, aber ich glaube, dass sich<br />
das Ergebnis durchaus sehen lassen kann.<br />
Bei den LiPos fiel die Wahl auf Kokams<br />
mit 4.000 mAh (30 C), welche 120 A Dauerstrom<br />
und kurzfristig 200 A vertragen. Die<br />
Gewinnen Sie jeden Monat…<br />
…und beantworten Sie die Frage auf unserer Homepage!<br />
gewinnspiel.flugmodell-magazin.de<br />
Gewinnspiel Dezember 2013<br />
gesponsert von Hacker-Motor GmbH<br />
Im Dezember verlosen wir<br />
3 x Hacker-Gutscheine<br />
im Wert von jeweils<br />
100,- Euro
LiPos werden mit Klettschlaufen und Klettband<br />
sicher in Position gehalten.<br />
Mit der neuen Akkubestückung ging es<br />
nun erneut an den See. Statt der ca. 14.000<br />
mAh der NiMH-Variante standen nun<br />
20.000 mAh zu Verfügung, wobei das Gewicht<br />
der „Joker“ in etwa gleich geblieben<br />
ist, da die GfK-Halter der LiPos auch einiges<br />
an Gewicht auf die Waage bringen. Die Fahreigenschaften<br />
haben sich demzufolge kaum<br />
geändert, allerdings ist das Modell mit 125<br />
km/h noch einen Tick schneller geworden<br />
und die Fahrzeit hat sich auch etwas verlängert.<br />
Irrwitzige Geschwindigkeit<br />
Nach der einen oder anderen Fahrt hatte ich<br />
hin und wieder das Problem, dass sich im -<br />
mer wieder ein Blatt von den Octura-Schauben<br />
verabschiedete. Als Ersatz montierte ich<br />
daher testweise einmal ein Pärchen 5518/3<br />
vom Prop Shop. Was sich damit auf dem<br />
Wasser abspielte, konnte man schon fast als<br />
brutal bezeichnen … die „Joker“ schoss in einer<br />
irrwitzigen Geschwindigkeit über den<br />
See, dabei lag sie aber sehr stabil im Wasser<br />
und man konnte ziemlich sicher auf dem<br />
Gas bleiben. Nach rund vier Minuten Fahr -<br />
zeit raste das Boot wieder die Gerade hoch,<br />
als es aus heiterem Himmel plötzlich aus<br />
dem Wasser aufstieg, einige 360-Grad-Drehungen<br />
absolvierte und anschließend heftig<br />
auf das Wasser aufschlug. Der ganze Abflug<br />
dauerte gefühlt eine halbe Ewigkeit! Natür -<br />
lich wurde der Kat sofort geborgen und der<br />
Schaden umgehend analysiert. Auf der rechten<br />
Seite hatte sich die Naht komplett geöff -<br />
net und der Akkuhalter samt der 24 LiPo-<br />
Zellen war aus dem Rumpf herausgeflogen.<br />
Als letzte gemessene Geschwindigkeit standen<br />
151 km/h auf dem GPS-Display …<br />
Wieder zuhause angekommen wurde erst<br />
einmal die ganze Technik ausgebaut und mit<br />
der Reparatur begonnen. Die ganze Naht<br />
wurde mit einer Schicht GfK verstärkt, zusätzlich<br />
habe ich ganz neue Akkuhalter konzipiert.<br />
Außerdem entschied ich mich, die<br />
Akkubestückung auf 12s4p zu reduzieren.<br />
Mittlerweile läuft die „Joker“ wieder einwandfrei<br />
und von dem Abflug ist auch keine<br />
Spur mehr zu sehen. Das Setup ist nun aber<br />
so gewählt, dass max. 110 bis 120 km/h er -<br />
reicht werden können, das reicht mir für die<br />
große „Joker“ aus. Wenn es dann doch mal<br />
„richtig schnell“ gehen soll, habe ich auch<br />
noch andere Boote dafür.<br />
n<br />
DER AUTOR<br />
Dieter Jaufmann beantwortet weitere Fragen<br />
zum Modell unter dieter.25@freenet.de<br />
Fazit<br />
Für mich ist und bleibt die große „Joker“<br />
einfach ein Traummodel. Mit den Bürstenmotoren<br />
symbolisierte die Abstimmung<br />
dieses Modells die Grenze des Mach -<br />
baren, aber dank der Brushless-Antriebe<br />
sieht das nun wieder ganz anders aus:<br />
Die Kraft der Lehner-Motoren kann wirklich<br />
als brutal bezeichnet werden und<br />
es war die richtige Wahl zu der Version mit<br />
10 Windungen zu greifen.<br />
Für mich persönlich reicht die Geschwindigkeit<br />
von 100 bis 120 km/h vollkommen<br />
aus. Es stecken eine Menge Zeit und Geld<br />
in solch einem großen Projekt und es<br />
ist viel zu schade, so ein Modell in einem<br />
kurzen Moment komplett zu verlieren.<br />
Hinzu kommt ja auch die Tatsache, dass<br />
diese Rümpfe seit vielen Jahren nicht<br />
mehr produziert werden und es somit<br />
kaum möglich ist, noch einmal an eine<br />
neue „Joker“ heranzukommen.<br />
Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei<br />
Jörg Marschall für seine große Hilfe und<br />
seine sehr wertvollen Tipps recht herzlich<br />
bedanken.<br />
www.krick-modell.de • www.krick-modell.de • www.krick-modell.de<br />
Cux 87<br />
Maßstab 1:33<br />
Länge 550 mm<br />
Segelboot<br />
Discovery II<br />
RC-Modell RTS<br />
Länge 620 mm<br />
mit elektrischem<br />
Hilfsantrieb<br />
Bilgepumpe<br />
und viel weiteres Zubehör<br />
Über 250 Seiten<br />
Bausätze<br />
und Zubehör !<br />
krick<br />
Modellbau vom Besten<br />
Klaus Krick Modelltechnik<br />
Postfach 1138 · 75434 Knittlingen<br />
Müritz<br />
Laserbausatz<br />
Länge 650 mm<br />
Fordern Sie den<br />
krick - Hauptkatalog Nr.42<br />
gegen € 10,- Schein (Europa € 20,-) an.<br />
IMMER MIT<br />
AKTUELLSTEN<br />
NEUHEITEN !
MOTORSCHIFFE<br />
Bauplan CHICKIE IV<br />
Bauplan<br />
BEILAGE<br />
im Heft<br />
Bauanleitung zum Download:<br />
www. schiffsmodell-magazin.de<br />
MAHAGONI-RENNBOOT CHICKIE IV<br />
Edler Renner<br />
„Sie sind Modellbauer und ein Freund schneller Kisten? Sie haben<br />
ein Faible für hölzerne Schachteln und wollen dennoch schnell<br />
fahren? Vielleicht weckt dann ja dieser Bauplan Ihr Interesse?“<br />
Die Titelseite<br />
des Beitrags aus<br />
der <strong>SchiffsModell</strong>-<br />
Ausgabe 11/99<br />
Mit diesen fragenden Zeilen begann<br />
ein Beitrag in der <strong>SchiffsModell</strong> -<br />
Ausgabe 11/1999, der sich mit dem<br />
Modell eines klassischen Holz-Rennbootes<br />
befasste, aber bereits kurze Zeit nach der<br />
Veröffent lichung selber zum Klassiker<br />
wurde. Kein Wunder also, dass besagte<br />
Ausgabe von <strong>SchiffsModell</strong> bald nach dem<br />
Verkaufsstart restlos vergriffen war.<br />
In dem erwähnten Beitrag wurde die Entstehungsgeschichte<br />
des damals neuesten<br />
<strong>SchiffsModell</strong>-Bauplanes, nämlich dem des<br />
Mahagoni-Renners CHICKIE IV, erzählt.<br />
Ende der 1990er-Jahre begeisterten sich viele<br />
Schiffsmodellbauer für klassische Sportbzw.<br />
Rennboote aus den 1920er- bis 1950er-<br />
Jahren. Kleiner Wermutstropfen: Das Baukastenangebot<br />
für Modelle dieser Art war<br />
damals sehr überschaubar und stammte in<br />
erster Linie aus den USA. Seinerzeit waren<br />
die Bestellung, die Bezahlung und der Versand<br />
eines Baukastens aus Übersee aber<br />
etwas absolut Exotisches. Leider waren aber<br />
auch keine ordentlichen Baupläne für den<br />
kompletten Eigenbau aufzutreiben.<br />
Grund genug für Rüdiger Götz, damals<br />
fester Mitarbeiter von <strong>SchiffsModell</strong>, die<br />
Konstruktion und den Bau eines entsprechenden<br />
Modells in die Wege zu leiten,<br />
damit die <strong>SchiffsModell</strong>-Leser schließlich einen<br />
stimmigen Bauplan zur Verfügung haben<br />
würden.<br />
Basierend auf einigen wenigen Fotos in<br />
der entsprechenden Fachliteratur über die<br />
Originale konstruierte er einen Nachbau<br />
eines der legendärsten Boote aus der goldenen<br />
Zeit des Bootsrennsports.<br />
Die CHICKIE wird Kult<br />
Das Modell sollte auf dem Wasser etwas hermachen<br />
und im Gegensatz zu vielen<br />
anderen schnellen Booten eine ausreichende<br />
Durchsetzungsfähigkeit auch auf etwas bewegteren,<br />
größeren Gewässern haben.<br />
Der gewählte Maßstab von 1:5 sorgte für<br />
ein 97,5 cm langes, allerdings auch beacht -<br />
28
Eine gut gebaute CHICKIE IV<br />
ist die Schau an jedem Teich!<br />
liche 40 cm breites Modell, das mit einer<br />
Verdrängung von 7–8,5 kg bereits in einen<br />
Größenbereich vorstößt, der heutzutage<br />
gerne mit dem griffigen Ausdruck „Powerboat“<br />
tituliert wird.<br />
Die Kombination aus edler Optik, wuchtigem<br />
Auftreten und sehr überzeugenden<br />
Fahrleistungen sorgte dafür, dass die<br />
CHICKIE IV in den folgenden Jahren von<br />
sehr vielen Modellbauern nachgebaut wur -<br />
de. Trotz der beachtlichen Größe und der<br />
feinen Ausführung mit viel sichtbarem Edelholz<br />
war das Modell dabei kein „Experten-<br />
Projekt“: Eine äußerst durchdachte Konstruktion,<br />
bei der die Teile des Rumpf -<br />
gerippes fast von selber zusammenfinden,<br />
und eine ausführliche Bauanleitung sorgten<br />
dafür, dass auch viele Einsteiger in den Holzbootsmodellbau<br />
mit der CHICKIE ihr erstes<br />
großes Erfolgserlebnis genießen durften.<br />
Viele Modellbauer sorgten auch mit individuellen<br />
Ausstattungen, Beschlägen oder<br />
verschiedenen Lackiervarianten dafür, dass<br />
man auf kaum einem Treffen oder einer Ausstellung<br />
zwei völlig identische CHICKIEs<br />
finden wird.<br />
Kostenloser Bauplan<br />
Heute, über 14 Jahre nach der ersten Präsentation<br />
des Bauplanes, schwappt eine neue<br />
Begeisterungswelle für klassische Motorboote<br />
in Mahagoni-Optik durch die Bastelkeller.<br />
Was liegt da näher, als passend zum<br />
Neustart der <strong>SchiffsModell</strong> in neuer Optik<br />
den Lesern eine besondere Freude in Form<br />
einer kostenlosen Planbeilage der CHICKIE<br />
IV zu machen? Natürlich auch genau pas -<br />
send zur winterlichen Bausaison. Wer<br />
aktuell noch kein neues Projekt auf der<br />
Helling liegen hat, sollte sich also schon mal<br />
ausreichend Material und die Laubsäge<br />
bereitlegen. Das gilt natürlich vor allem für<br />
diejenigen, die anno 1999 Schiffs Modell<br />
noch gar nicht gelesen haben.<br />
In dieser Ausgabe von <strong>SchiffsModell</strong> finden<br />
Sie das erste Planblatt, im nächsten Heft<br />
gibt es dann das zweite Planblatt mit allen<br />
weiteren, zum Bau des Modells erforder -<br />
lichen Zeichnungen. Die ausführliche Bauanleitung<br />
inkl. Stückliste finden Sie auf der<br />
Rückseite des Planblattes in dieser Ausgabe<br />
und außerdem zum Download im Internet<br />
auf www.schiffsmodell-magazin.de.<br />
Wer jetzt zwar Lust am Nachbau dieses<br />
Modell-Klassikers bekommen hat, trotzdem<br />
aber etwas schneller ans Ziel kommen<br />
möchte, der kann bei der Firma Bayer CNC-<br />
Technik, Dr.-Kurt-Schumacher-Ring 27 in<br />
85139 Wettstetten (Tel. 0841/993397-20,<br />
www.cnc-modellbautechnik.de) einen Frästeilesatz<br />
mit Spanten und Längsträgern zum<br />
Aufbau des Rumpfgerippes bestellen.<br />
Also dann: Viel Spaß beim Bau dieses tollen<br />
Stücks Modellbaugeschichte! n<br />
Die ausgefeilte Konstruktion sorgt für<br />
hohe Passgenauigkeit der Rumpfteile<br />
Das fertig aufgestellte Spantengerippe vor der Beplankung<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
29
MOTORSCHIFFE Torpedoboot PT 117<br />
TORPEDOBOOT PT 117<br />
Motorisiertes Schätzchen<br />
Wohl bei jedem Modellbauer findet sich im Bastelkeller oder im Modellbauzimmer noch<br />
das eine oder andere verstaubte „Schätzchen“. Ein genaueres Ansehen lohnt mitunter.<br />
TEXT UND FOTOS: Martin Kiesbye<br />
Beim Ausmisten eines sel -<br />
ten genutzten Kellerraumes<br />
fiel mir ein älterer<br />
Bau satz von Revell in die Hän -<br />
de: das Torpedoboot PT 117 im<br />
Maßstab 1:72. Der Karton war fast<br />
schon auf dem direkten Weg in den Abfall,<br />
aber dann habe ich mir den Baukasten<br />
doch noch einmal angesehen. Als Funktionsmodellbauer<br />
beginnen bei so et was natürlich<br />
auch gleich die Über legungen hinsichtlich<br />
des Einbaus einer Fernsteuerung.<br />
Nach den Erfahrungen mit meinem letzten<br />
Kleinmodell (Sunseeker PREDATOR,<br />
siehe <strong>SchiffsModell</strong> 3/2013) wollte ich nun<br />
auch dieses noch etwas kleinere Plastik -<br />
mo dell zum Fahrmodell ausbauen.<br />
Der Baukasten hat auch schon einige<br />
Jahre auf dem Buckel, er stammt aus den<br />
1990er-Jahren, was sich sowohl in der Detailqualität<br />
als auch bei den Bauunterlagen<br />
zeigt.<br />
Aber als Fingerübung für Zwischendurch<br />
und unter dem Anspruch eines einsatztauglichen<br />
Spaß-Modells (statt eines Vitrinenobjektes)<br />
ist er absolut geeignet, da in diesem<br />
Fall die recht geringe Detaillierung in Verbindung<br />
mit den relativ gut abzudichtenden<br />
Aufbauten eher einen Vorteil darstellt.<br />
Performance nach Wahl<br />
Der eigentliche Bau des Baukastens braucht<br />
in diesem Rahmen nicht erwähnt zu werden,<br />
da man bei der recht einfachen Montage nur<br />
der relativ spartanischen Anleitung zu folgen<br />
braucht. Hinsichtlich der Änderungen für<br />
den Fahrbetrieb ergeben sich natürlich eini -<br />
ge Umbauten.<br />
Anstelle der drei Antriebsanlagen<br />
habe ich hier einen kleinen<br />
Brushless-Motor (Hobbywing<br />
Ezrun 18) nebst ent spre chendem<br />
Drehzahlregler ein ge baut. Neben<br />
der Performance war vor allem die flache<br />
Einbaulage des nur 20 mm durch messen -<br />
den Treiblings der Haupt grund für die Wahl.<br />
Das einzelne Ruderblatt, das im Hinblick auf<br />
gute Wendigkeit deutlich vergrößert wurde,<br />
wird über ein liegendes Miniservo (9-g-<br />
Klas se) angesteuert. Zusammen mit einem<br />
kompakten 2,4-GHz-Empfänger (robbe<br />
R60904FF) und einem passenden 2s-LiPo-<br />
Akku (7,4 V/650 mAh) ist die Technik dann<br />
schon komplett.<br />
Um die Komponenten später auch einmal<br />
problemlos weiterverwenden zu können,<br />
habe ich trotz des resultierenden Mehrgewichtes<br />
alle Stecker und Gehäuse beibehalten.<br />
Hier gäbe es also hinsichtlich des Ge-<br />
Ein günstiger Westentaschen-Flit zer, der mit<br />
entsprechender Technik viel Spaß auf dem Wasser macht<br />
30
1 2<br />
3 4<br />
Der Baukasteninhalt (Bild 1) kann heutige Ansprüche nicht mehr befriedigen, aber im Rumpf<br />
ist Platz für die Komponenten (Bild 2). Der verbliebene Raum wurde mit Auftriebs hilfen<br />
ausgefüllt (Bild 3) und zum Schluss wird das Deck endgültig mit dem Rumpf verklebt (Bild 4)<br />
Mit der Brushless-Antriebsanlage ist das<br />
Modell deutlich übermotorisiert<br />
wichts durchaus Optimierungspotenzial.<br />
Um etwaigem Wassereinbruch zu begeg -<br />
nen, wurde der Empfänger mit Klettband<br />
unter dem Dach der achteren Aufbauten<br />
befestigt und der verbleibende Raum im<br />
Rumpf mit Auftriebshilfen (Ü-Ei und Styropor)<br />
aufgefüllt. Im Fall der Fälle kann so ein<br />
Totalverlust vermieden werden.<br />
Erstklassige Beschleunigung<br />
Nach dem Einbau der kompletten Technik<br />
und dem Aufkleben des Decks erfolgte die<br />
abschließende Lackierung. Für ein Kriegsschiff<br />
typisch kommt hierbei fast nur Grau<br />
und Schwarz zur Verwendung, was das Fotografieren<br />
des Modells in schneller Fahrt<br />
nicht eben erleichtert. Nach der Komplettierung<br />
mit Waffen und Personal (die Figuren<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
liegen dem Baukasten bei) konnte dann an<br />
einem einigermaßen sonnigen Tag der Testbetrieb<br />
starten.<br />
Erwartungsgemäß ergab sich eine erstklassige<br />
Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit,<br />
wobei sich Letztere natürlich<br />
weit jenseits der „Scale“-Geschwindigkeit<br />
befindet. Auch die Manövrierfähigkeit war<br />
okay. Bei den vorherrschenden Bedingungen<br />
auf unserem Vereinsgewässer war auch an<br />
der Fahrstabilität für ein solch kleines Modell<br />
nicht zu mäkeln, allerdings kam relativ viel<br />
Wasser über, so dass eine gute Abdichtung<br />
der zu öffnenden Aufbauten zwingend erforderlich<br />
ist.<br />
Insgesamt ist zu sagen, dass man mit der<br />
PT 117 von Revell einen Westentaschen-Flit -<br />
zer bauen kann, der zwar nur bedingt die<br />
heutigen Ansprüche an einen Plastik-Baukasten<br />
erfüllt, der mit der entsprechenden<br />
Technik aber viel Spaß beim Einsatz auf dem<br />
Wasser macht, und das zu einem sehr überschaubaren<br />
Preis.<br />
n<br />
DER AUTOR<br />
Martin Kiesbye hat schon einige Plastikbausätze<br />
zu Fahrmodellen umgebaut.<br />
Für Nachfragen kann man ihn unter<br />
kiesbye@t-online erreichen.<br />
DAS VORBILD<br />
Mit Kennedy an Bord<br />
Das Vorbild stammt aus der Zeit<br />
des Zweiten Welt krieges und gehört<br />
zur Klasse Elco 80.<br />
Gebaut von der Fa. Electric Launch Company<br />
Ltd. (Elco) hatte es eine Länge von 80 Fuß,<br />
also ca. 26,4 m. Bestellt im Januar 1942,<br />
wurde es im Juli 1942 geliefert und im<br />
August in Dienst gestellt. Sein Einsatzgebiet<br />
war der Südpazifik, wo es im August 1943<br />
bei den Salomonen bei einem japanischen<br />
Bomberangriff beschädigt wurde und<br />
danach aufgegeben werden musste.<br />
Die PT 117 hatte eine Verdrängung von 56 t<br />
und konnte mit den drei Hauptmaschinen<br />
(Packard W-14 M 2500, je 1.500 WPS) eine<br />
beachtliche Maximalgeschwindigkeit von<br />
41 Knoten (76 km/h) erreichen.<br />
Die Besatzung betrug üblicherweise 12–14<br />
Mann, davon 2–3 Offiziere, die Bewaffnung<br />
bestand neben den vier Torpedos (21“ =<br />
533 mm) aus zwei Zwillings-Maschinen -<br />
gewehren vom Kaliber .50 (12,7 mm).<br />
Bekannt wurden die Torpedoboote der<br />
Elco-80-Klasse vor allem, weil der spätere<br />
US-Präsident J. F. Kennedy Kommandant auf<br />
der PT 109 war und in den 1960er-Jahren<br />
hierüber sogar ein Kinofilm gedreht wurde.<br />
31<br />
Bild: Wikipedia
MOTORSCHIFFE<br />
SMS „Schlesien“<br />
SMS „SCHLESIEN“<br />
Eine Etage zu viel<br />
SMS „Schlesien“ wurde 1904 auf Kiel gelegt und war bis 1945 aktiv. Einiges wurde in dieser Zeit<br />
am Schiff geändert. Möchte man sein Modell in einer bestimmten Epoche wiedergeben,<br />
empfiehlt sich, den Bauzustand zuvor genau zu studieren, um Überraschungen zu vermeiden.<br />
Die Basis für mein Modell der „Schlesien“<br />
lieferte ein halb kompletter Bausatz<br />
der „Deutschland“ von MZ-Modellbau,<br />
den ich von einem Modellbaukollegen<br />
aus München übernommen hatte. Als<br />
ich mich mit den Teilen befasste, stellte sich<br />
mir vor allem die Frage, welches Vorbild<br />
dieser Schiffsklasse ich nachbauen wollte.<br />
Meine Wahl fiel deshalb auf die „Schlesien“<br />
da der Großvater meiner Frau aus Schlesien<br />
stammt. Da er mir auch noch zusicherte, das<br />
fertige Modell zu taufen, war die Wahl des<br />
Vorbilds damit entschieden.<br />
Als Nächstes stellte sich dann aber gleich<br />
die Frage nach dem zu wählenden Bauzustand,<br />
denn während seiner langen Einsatzzeit<br />
wurde das Vorbild ja mehrere Male umgebaut.<br />
Die Wahl fiel dann auf den Bauzustand<br />
der Jahre 1909/10.<br />
Neben einigen Fotos lag mir noch ein<br />
Bauplan aus dem Einsatzjahr 1927 vor. Mit<br />
diesen Informationen glaubte ich, das Mo -<br />
32<br />
Aus der „Deutschland“ wird die „Schlesien“<br />
dell nachbauen zu können, wie sich später<br />
herausstellte, war das aber ein fataler Irrtum.<br />
Aber der Reihe nach. Der fertige GfK-<br />
Rumpf war sauber laminiert und gut detailliert,<br />
es waren nur wenige Fehlstellen zu beseitigen,<br />
so dass bereits nach zwei Wochen<br />
der fertig grundierte Rumpf auf meiner<br />
Werkbank stand. Für den Antrieb verbaute<br />
ich zwei Langsamläufer der Baugröße 600<br />
mit 12 Volt Betriebsspannung.<br />
Den Aufbau abgeschnitten<br />
Nachdem das Deck eingeklebt war, konnte<br />
ich mit dem Beplanken desselben beginnen.<br />
Parallel baute ich am Aufbaudeck, welches<br />
als komplettes Resin-Guss teil vorlag. Unter<br />
Zuhilfenahme meiner Pläne baute ich das<br />
Deck fast fertig, als ich von meinem Modellbaukollegen<br />
Jürgen einen Hinweis auf die<br />
Internetseite eines Modellbauers bekam, der<br />
gerade die „Pom mern“ baute, das der „Schlesien“<br />
am ähnlichste Schwesterschiff. Außer-
dem schickte er mir etliche Fotos, die die<br />
„Schlesien“ von achtern zeigten. Hier war<br />
eindeutig zu sehen, dass die oberste Etage<br />
des hinteren Aufbaudecks beim Vorbild zu<br />
diesem Zeitpunkt nicht vorhanden war, bei<br />
meinem Modell leider schon. Einen derartigen<br />
Baufehler konnte ich nicht einfach kaschieren<br />
oder bestehen lassen. Nach einigen<br />
Tagen des Überlegens wurde kurzerhand das<br />
oberste Stockwerk des achteren Aufbaus abgeschitten,<br />
ein neues Deck eingezogen und<br />
das Schanzkleid angebracht. Nach einer Woche<br />
Arbeit waren die Spuren des Malheurs<br />
beseitigt und es konnte wieder vorangehen.<br />
Masten, Schornsteine, Kräne usw. wur -<br />
den angefertigt, ebenso auch die kom plet te<br />
Bewaffnung.<br />
Flottenparade und Taufe<br />
Im Sommer 2012 konnte das Modell erst -<br />
mals beim Heiligenstätter Seefest in seinem<br />
Element getestet werden Die Probefahrt verlief<br />
ausgezeichnet und danach war ich motiviert,<br />
mit Hochdruck an der Fertigstellung<br />
zu arbeiten.<br />
Masten, Schornsteine, Kräne – in den Details steckt viel Fingerfertigkeit<br />
Am 4. September 2012 war es dann so -<br />
weit: Die fertige SMS „Schlesien“ konnte bei<br />
unserer jährlichen Flottenparade vom Großvater<br />
meiner Frau getauft werden. Dieser Augenblick<br />
und das Lob meiner Modellbaukollegen<br />
ließen die vergan ge nen Probleme vergessen<br />
und machten auch ein wenig stolz<br />
auf das geschaffene Modell, welches noch<br />
bis zum Saisonende bei jeder Gelegenheit<br />
zu Wasser gelassen wurde.<br />
n<br />
DER AUTOR<br />
Peter Dorschner beantwortet Fragen gern per<br />
E-Mail unter tirpitzpeter@gmx.de<br />
Fazit<br />
Aus dem Bausatz von Zinnecker kann<br />
ein wendiges Modell gebaut werden,<br />
das auch bei höherem Wellengang stabil<br />
im Wasser liegt. Man sollte jedoch beim<br />
Nachbau gewissenhaft recherchieren<br />
und die Unterschiede der einzelnen<br />
Bauzustände und Schwesterschiffe<br />
genauestens miteinander vergleichen,<br />
um Fehler, wie sie mir passiert sind,<br />
zu vermeiden.<br />
DAS VORBILD<br />
Stapellauf in Anwesenheit des Kaisers<br />
Die SMS „Schlesien“ war ein Linienschiff der Deutschland-Klasse mit<br />
den Schwesterschiffen „Deutschland“, „Pommern“, „Hannover“<br />
und „Schleswig Holstein“. Sie wurde im Jahr 1908 in Dienst gestellt.<br />
Der Bauauftrag für die „Schlesien“ erfolgte<br />
als „Linienschiff R“ am 11. Juni 1904 an die Werft<br />
F. Schichau in Danzig, die Kiellegung fand<br />
am 19. November 1904 statt. Der Stapellauf<br />
erfolgte am 28. Mai 1906 in Anwesenheit des<br />
Kaisers. Im März des Jahres 1908 erfolgte<br />
die Überführung nach bzw. die Endausrüstung<br />
in Kiel und am 5. Mai 1908 wurde die „Schlesien“<br />
in Dienst gestellt.<br />
Mit dem Bau der „Dreadnought“ in England<br />
waren die Linienschiffe der Deutschland-Klasse<br />
und damit auch die „Schlesien“ aber schon bei<br />
ihrer Indienststellung veraltet, was sich auch<br />
auf ihre spätere Verwendung auswirken sollte.<br />
Beim Kriegsausbruch im August 1914 war die<br />
„Schlesien“ im Sicherungsdienst in der Deutschen<br />
Bucht eingesetzt, später als Zielschiff für<br />
Unterseeboote und Torpedoboote. 1916 nahm<br />
sie unter Kommandant Friedrich Behncke als<br />
Teil des Geschwaders von Admiral Scheer<br />
an der Skagerrakschlacht teil, jedoch spielten<br />
die älteren Linienschiffe nur eine untergeordnete<br />
Rolle. Gerade der Verlust der „Pommern“<br />
mit ihrer gesamten Besatzung durch einen<br />
Torpedotreffer in der zweiten Hälfte der<br />
Schlacht machte die Überlegenheit der modernen<br />
Schlachtschiffe deutlich.<br />
Anschließend wurde die „Schlesien“ mit ver -<br />
ringerter artilleristischer Ausstattung als Schulschiff<br />
verwendet. Bei Ausbruch der Novemberrevolution<br />
1918 verließ die „Schlesien“ am<br />
5. November Kiel, ehe sich der Kieler Matrosenaufstand<br />
an Bord ausbreiten konnte. Als das<br />
SMS „Schlesien“ kurz nach der Indienststellung<br />
Schiff vor Flensburg ankerte,<br />
erlaubte der Kommandant den<br />
Besatzungsangehörigen, die<br />
sich zur Revolution bekannten,<br />
das Schiff zu verlassen. Es blieb weniger als<br />
die Hälfte der Besatzung und nur wenig Maschinenpersonal<br />
zurück. Zwischen dem 6. und<br />
9. November befand sich die „Schlesien“ auf<br />
einer Irrfahrt durch die Ostsee, um den revolutionären<br />
Kräften zu entgehen.<br />
Die an Bord befindlichen Seekadetten der<br />
Offizierscrew VII/18 ersetzten das Maschinenpersonal<br />
und bezeichneten ihre Crew fortan<br />
als „Schlesien-Crew“.<br />
Am 10. November 1918 bzw. am 1. Dezember<br />
1918 wurde die Schlesien außer Dienst gestellt.<br />
Sie gehörte jedoch nicht zu den Schiffen, die<br />
ausgeliefert und nach Scapa Flow überführt<br />
wurden, da sie keinen großen militärischen<br />
Wert mehr besaß.<br />
Nach einem großen Umbau wurde die »Schlesien«<br />
stattdessen am 1. März 1927 als Ersatz für<br />
das Linienschiff „Hannover“ in die Reichsmarine<br />
übernommen und wieder in Dienst gestellt.<br />
Unter anderem wurden die ursprünglich drei<br />
Schornsteine zu zwei Rauchgasabzügen zusammengefasst<br />
und neben einem großen Röhrenmast<br />
wurde achtern auch ein großes Aufbaudeck<br />
eingebaut. Die „Schlesien“ war daraufhin<br />
im Flottendienst der Reichsmarine auch auf<br />
einigen Auslandsreisen aktiv. In den Jahren<br />
1938/1939 wurde die Antriebsanlage komplett<br />
auf Ölfeuerung umgestellt. Im Zweiten Weltkrieg<br />
war sie als Kadettenschulschiff im Einsatz.<br />
1940 nahm die „Schlesien“ an der Besetzung<br />
Dänemarks während des Unternehmens Weserübung<br />
teil. Die 88-mm-Geschütze der Mittel -<br />
artillerie wurden an verschiedene Hilfskreuzer<br />
(z. B. „Thor“ und „Atlantis“) abgegeben, anschließend<br />
erfolgte erneut der Einsatz als Schul- und<br />
Ausbildungsschiff sowie für Eisbrecherdienste in<br />
der Ostsee. Mitte April 1942 verlegte das Schiff<br />
zusammen mit dem beschädigten Schlachtschiff<br />
„Gneisenau“ nach Gotenhafen. Gegen Ende des<br />
Krieges beschoss die „Schlesien“ Landziele an<br />
der pommerschen Küste. In der Nacht des 3. Mai<br />
1945 lief sie auf eine britische Grundmine. Der<br />
Minentreffer ereignete sich im Bereich des Vorschiffs<br />
und beschädigte das Schiff schwer, die<br />
Artillerie blieb jedoch einsatzfähig. Am Tag darauf<br />
wurde das Schiff in der Nähe von Swinemünde<br />
bei einem Luftangriff von Bomben verschiedener<br />
Größen getroffen. Um das Sinken des Schiffs<br />
zu verhindern, wurde es mit dem Heck voran auf<br />
den Strand gesetzt, anschließend von der Besatzung<br />
gesprengt und das Wrack durch Torpedoschüsse<br />
des Flottentorpedoboots T 36 weiter<br />
zerstört.<br />
Mit der Verschrottung wurde im Jahr 1949<br />
begonnen. Die Arbeiten zogen sich sehr in die<br />
Länge, sogar 1980 waren noch Reste zu sehen,<br />
welche in den Folgejahren abgebrochen wurden.<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
33
MOTORSCHIFFE<br />
Harbour Tug Boat<br />
REVELL HARBOUR TUG BOAT MIT BUGSTRAHLRUDER<br />
Auf dem Teller drehen<br />
Als Bernd Karnargel den Rumpf in 1:108 in Händen hielt, wurde er skeptisch. Würde alles hineinpassen<br />
und das klitzekleine Schiff dann noch schwimmen? Schließlich sollte der Plastikbausatz<br />
neben den üblichen RC-Komponenten auch mit einem Bugstrahlruder ausgestattet werden.<br />
TEXT UND FOTOS: Bernd Karnagel<br />
Harbour Tug Boat“ stand auf dem Plastikbaukasten<br />
von Revell und die<br />
Schiffsillustration auf der Schachtel<br />
zeigte einen Ha fenschlepper, der mir sofort<br />
gefiel. Angeregt durch einige Artikel in der<br />
<strong>SchiffsModell</strong>, in denen über funktions -<br />
tüchtig gemachte Plastikmodelle berichtet<br />
worden war, hatte ich schon die SMIT ROT-<br />
TERDAM von Heller als RC-Modell gebaut.<br />
Somit würde sich der Revell-Schlepper doch<br />
als optimales Nach folgemodell anbieten und<br />
der Baukasten wurde gekauft.<br />
Als ich dann den winzigen Rumpf sah,<br />
war ich doch etwas erschrocken, denn es sollten<br />
ja Antrieb, Bugstrahlruder, Ruderservo,<br />
Empfänger, Akkupack, ein 2-K-Schalter,<br />
Span nungsregler und eine Servoelektronik<br />
(als Drehzahlsteller) darin untergebracht<br />
werden. Der Plastikbaukasten von Revell<br />
erwies sich aber in der Folge als vollständig<br />
und von guter Qualität und trotz des kleinen<br />
Maßstabes von 1:108 (Länge 231 mm) waren<br />
viele Details gut nachgebildet worden.<br />
Zuerst bereitete ich die Antriebseinheit<br />
vor. Die Fertigung der Wellenanlage erfolgte<br />
aus einem 5-mm-Messingrohr mit einer Län -<br />
34<br />
ge von 30 mm. Auf der Propellerseite wurde<br />
das Originallager eines käuflichen Stevenrohres<br />
eingeklebt, auf der Rumpfinnenseite<br />
presste ich eine Kunststoffbuchse ein.<br />
Hart aufgelötet<br />
Da der dem Baukasten beiliegende Propeller<br />
für den Fahrbetrieb natürlich nicht geeignet<br />
war, musste dieser neu gefertigt wer den.<br />
Hierzu habe ich drei passend zugeschnittene<br />
Messing-Rondellen (Durchmes ser je 5 mm)<br />
mit Hilfe einer Lötvorrichtung auf eine 2-<br />
mm-Edelstahlwelle hart auf gelötet. So entstand<br />
ein Propeller von ca. 13 mm Durch-<br />
Länge<br />
Breite<br />
Preis<br />
Baukasten:<br />
Antriebe:<br />
DATEN BAUSATZ<br />
Harbour Tug Boat<br />
Beleuchtung:<br />
ca. 231 mm<br />
ca. 60 mm<br />
14,90 Euro<br />
Revell<br />
Mikromotor MD12,<br />
Akku NI 160 1,2 V;<br />
www.mikroantriebe.de<br />
Mikro-LEDs,<br />
LED superhell;<br />
Conrad-Electronic<br />
messer, der für den Antrieb des Schleppers<br />
völlig ausreichend ist.<br />
Für das Bugstrahlruder habe ich in ähnlicher<br />
Bauweise eine Art Schaufelrad zusammengelötet.<br />
Als Kupplung zwischen den Motoren-<br />
und Antriebswellen fungieren zwei<br />
zylindrische Kunststoffdrehteile mit Nut und<br />
Feder als einfache Mitnehmer. Das Bugstrahlruder<br />
entstand aus zwei Kunststoffröhrchen<br />
mit 12 bzw. 8 mm Durchmesser.<br />
Das 12-mm-Röhrchen wurde mit einem<br />
8-mm-Fräser bis zum halben Durchmessereingefräst<br />
und in diese Vertiefung nun das<br />
8-mm-Röhrchen eingeklebt. Erst nach Aushärten<br />
der Verklebung habe ich im Inneren<br />
den Überstand verklebt. Die Aufnahme des<br />
Schaufelrades erfolgte dann in zwei Buchsen.<br />
Nun noch eine Portion Fett zwischen<br />
die Buchsen und alles war dicht. Nachdem<br />
der Kupplungsmitnehmer aufgepresst war,<br />
erfolgte die Prüfung auf Leichtgängigkeit,<br />
erst dann konnte die Stirnseite verschlossen<br />
werden.<br />
Als letztes Bauteil wurde noch die Ruder -<br />
anlenkung gefertigt, als Ruderkoker dient<br />
ein 4-mm-Messingrohr, dem eine auf gelö -
tete Messing-U-Scheibe sicheren Halt am<br />
Rumpfboden bietet. Ein 3-mm-Messingrohr<br />
mit angelötetem Ruderhebel dient als Ruderschaft,<br />
beidseitig verspannte Angelsehne<br />
stellt die Verbindung zum Anlenkhebel des<br />
Ruderservos her.<br />
Löcher im Rumpf<br />
Alle Einbauteile waren nun vorgefertigt und<br />
der Rumpf konnte für die Montage aller<br />
Komponenten vorbereitet werden. Als Erstes<br />
habe ich die Öffnungen für das Bugstrahl -<br />
ruder eingearbeitet, zuerst mit kleinem Bohrerdurchmesser<br />
vorgebohrt und dann mit<br />
Gefühl ausgefräst, damit der Rumpf an die -<br />
ser Stelle nicht reißt. Da der selbst gefertigte<br />
Propeller ja etwas größer als der eigentlich<br />
vorgesehene war, musste ich das Loch für<br />
die Durchführung des Stevenrohres etwas<br />
höher platzieren. Danach wurde der Rumpf<br />
innen noch etwas aufgeraut und dann konnten<br />
alle Bauteile eingeklebt werden, wofür<br />
ich UHU PLUS sofortfest verwendete. Die -<br />
ser Klebstoff klebt schnell und lässt sich,<br />
wenn nötig, mit sanfter Gewalt wieder lösen.<br />
Auf die beiden Enden des Bugstrahl ru -<br />
ders wurden vor dem Einsetzen zwei kleine,<br />
mit UHU-Plastikkleber getränkte Glasgewebestücke<br />
aufgeschoben, um eine bessere<br />
Verbindung zum Rumpf her zustellen und<br />
den Spalt zwischen Rumpf und Rohr von<br />
innen zu verdecken. Dies ergab eine sichere<br />
Verbindung. Von außen wurde dann noch<br />
mit UHU PLUS verspachtelt. Nach dem<br />
Trocknen konnte ich die Überstände der<br />
Röhrchen entfernen und mit der Rumpf -<br />
außenseite bündig verschleifen.<br />
Die beiden Servoelektroniken fanden in<br />
einer kleinen Halterung im Bug Platz, nun<br />
noch alle Anlagenkomponenten mit dem<br />
Die Beleuchtung ermöglicht Nachteinsätze<br />
Jeti-Empfänger und dem Akku-Pack ver -<br />
kabeln und schon konnte die erste Funktionsprobe<br />
in der Badewanne erfolgen. Die<br />
Antriebsleistung des Motors war völlig ausreichend<br />
und das Bugstrahlruder drehte den<br />
Schlepper ziemlich flott „auf dem Teller“.<br />
Eine wichtige Erkenntnis der Probefahrt war<br />
aber auch, dass im weiteren Bauverlauf am<br />
Gewicht gespart werden musste.<br />
Erkenntnis der Probefahrt<br />
Als Nächstes wurde das Deck vorbereitet und<br />
die Seitenwände des Deckshauses miteinander<br />
verklebt. Das fertige Deckhaus diente<br />
dann als Schablone für ein kleines Kunststoff-L-Profil,<br />
welches ich in den Decksaus -<br />
schnitt klebte. Dieses dient als Süllrand ge -<br />
gen überkommendes Wasser und hat gleichzeitig<br />
die Aufgabe, die Aufbauten zu halten.<br />
Fazit<br />
Es hat einfach Spaß gemacht, diesen<br />
kleinen Schlepper zu bauen, vor allem<br />
weil viele Arbeiten „einfach so“ am<br />
Schreibtisch erledigt werden konnten.<br />
Zum Transport kommt ein kleiner Koffer<br />
zum Einsatz, ansonsten findet das Modell<br />
auf einem Ständer auf dem Schreibtisch<br />
seinen Platz.<br />
Durch mehrmaligen Einschnitt des Profils<br />
mit einer feinen Säge, konnte die Rundung<br />
gut gebogen werden. Die Seitenwände der<br />
Brücke und des Schornsteinaufbaus wurden<br />
jetzt verklebt und schon war alles fertig zum<br />
Lackieren. Fast alle Teile wurden mit der Airbrush<br />
lackiert, wegen der Spachtelarbeiten<br />
am Bugstrahlruder erhielt der Rumpf vor der<br />
Farblackierung noch eine Grundierung.<br />
Wie eingangs schon erwähnt, sollte das<br />
Modell eine funktionstüchtige Beleuchtung<br />
erhalten. Bei den Signallaternen ersetzte ich<br />
die Originalteile durch Mikro-LEDs, die Lötfüßchen<br />
wurden mittels Lackdraht verlän -<br />
gert. Im Falle der Mastlaterne dient eines der<br />
Stagen als Zuleitung (Lackdraht).<br />
Der Scheinwerfer war wieder ein kleines<br />
Lötteil, er nimmt eine superhelle LED auf.<br />
Nun hatte ich aber ein Problem, denn die<br />
Motoren zogen so viel Strom aus den Akkus,<br />
dass die Beleuchtung im Fahrbetrieb fast<br />
ausging. Zwei Spannungsregler (je einer für<br />
den Scheinwerfer und die Signallaternen)<br />
sollten helfen.<br />
Da ich ja eigentlich von der segelnden<br />
Zunft komme und mir Elektronik ein Graus<br />
ist, musste Hilfe her. Ein Hobbykollege sorg -<br />
te für Schaltplan nebst Stückliste und mein<br />
Sohn brachte alles auf einer kleinen Platine<br />
unter. Das Ganze wurde dann mit einem 2-<br />
K-Memory-Schalter verbunden und unter<br />
das Dach des Deckshauses geklebt. Über<br />
einen Schaltkanal lassen sich nun verschie -<br />
dene Optionen bedienen.<br />
n<br />
DER AUTOR<br />
Bernd Karnagel, Autor bei <strong>SchiffsModell</strong>,<br />
kann über die Redaktion erreicht werden.<br />
1 2<br />
3<br />
Die Beleuchtung (Bild oben)<br />
wurde wie die Ruder- und<br />
Wellenanlage (Bild 1) funktionstüchtig<br />
gemacht. Die dazu notwendige<br />
Elektronik befindet<br />
sich unter dem Steuerhausdach<br />
(Bild 2), Antrieb, Ruderanlenkung<br />
und Bugstrahlruder sind<br />
im Rumpf untergebracht (Bild 3)<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
35
SZENE DM der TenRater<br />
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT DER TENRATER IN GELDERN<br />
Königs<br />
TenRater, oft auch als Zehner bezeichnet, sind die Königsklasse<br />
des Modellsegel-Regattasports. In Deutschland sind<br />
die Regatten selten, die Teilnehmerfelder traditionell klein.<br />
TEXT UND FOTOS: Ingrid Blüm<br />
36
klasse<br />
Diese Tradition wurde bei der<br />
mit 22 Teilnehmern besetzten<br />
Deutschen Meisterschaft in<br />
Gel dern gebrochen. Der Ausrichter,<br />
die WSG Gelderland,<br />
freute sich über Meldungen aus der ganzen<br />
Republik sowie aus den Niederlanden – und<br />
aus Großbritannien hatte sich hoher Besuch<br />
angekündigt: Graham Bantock kam, um mit<br />
seinem Geschäftspartner Augustin Moreno<br />
an der Regatta teilzunehmen.<br />
Graham Bantock segelt seit Jahren international<br />
auf den vorderen Plätzen und vielen<br />
Lesern werden die Bootsnamen „Topiko“<br />
und „Picanto“ ein Begriff sein. Beides sind<br />
von ihm entwickelte Designs in der International<br />
One Meter Class (IOM).<br />
Bantock entwickelt, baut und vertreibt<br />
auch TenRater. Zwölf der teilnehmenden<br />
Schiffe stammten aus seiner Design -<br />
schmiede. Am bekanntesten ist die „Diamond“,<br />
die er auch selbst segelt. Seine Designs<br />
und Pläne stellt Bantock Modellbauern<br />
zum Herunterladen im Internet zur Ver -<br />
fügung.<br />
So gehandhabt von Klaus Peter Schmidt,<br />
der beide „Graffito“s baute, die im Rennen<br />
waren. Oder die „Iona“, die G. Bantock vor<br />
einigen Jahren für den amerikanischen<br />
Markt entwarf, um die TenRater-Klasse dort<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
37
SZENE DM der TenRater<br />
Siegerschiff „Diamond“, Skipper Graham Bantock<br />
Die Platzierung der Bantock-Designs im Rennen zeigt,<br />
wie maßgeblich die Leistung des Skippers ist<br />
etwas bekannter zu machen. Auch dieses<br />
Modell war zwei mal vertreten, eine segelte<br />
Ingo Jung, der sich für dieses Modell entschied,<br />
weil er „einfach mal ein Boot selbst<br />
bauen“ wollte. Die andere „Iona“ wurde von<br />
Chris Vaes aus den Niederlanden gesegelt,<br />
der dieses Modell durch eine Verlängerung<br />
etwas modifiziert hat. Sinngemäß nennt er<br />
es daher „Iona-L“.<br />
Alte Klassenregel<br />
Die TenRater-Klasse zeichnet sich ja dadurch<br />
aus, dass sie nur sehr wenige Vor gaben im<br />
Hinblick auf den Bau hat. Es gilt immer das<br />
Verhältnis von Wasserlinienlänge zu Segelfläche<br />
nach der Vermessungs-formel: Wasserlinienlänge<br />
x Segelfläche/ 122903 = < 10.<br />
Sprich, je länger die Boote sind, desto kleiner<br />
werden die Segel. Diese Klas sen regeln sind<br />
schon 120 Jahre alt.<br />
Chris segelte mit der „Iona-L“ auf einen<br />
beachtlichen Platz 9, aber er hatte an dem<br />
Tag einige Probleme mit der Segel einstel -<br />
lung, sonst wäre er sicherlich noch viel weiter<br />
nach vorne gesegelt.<br />
Exklusiv für RT-Sails (www.rt-sails.de)<br />
entwarf Graham Bantock das Schiff „Satori“.<br />
Die „Satori“ wird in Carbon-Prepreg gebaut,<br />
Segeln im Schatten des Kiesbaggers:<br />
das Revier in Geldern<br />
38
„Diamond“, Design Graham Bantock, Skipper Hans Dieter Krings<br />
Zweikampf zwischen „Prime Number“ (Marblehead<br />
mit 10R-Vermessungsrigg), Skipper Augustin Moreno<br />
und „Diamond“, Skipper Heinz Bohn<br />
„Druff und Weg“,<br />
ein Design von Eberhard Schuch, Skipper Henning Faas<br />
„Kamsin“, Design und Bau sowie Skipper Gerd Mentges<br />
39
SZENE DM der TenRater<br />
d. h. die Rümpfe werden dabei im Druckofen<br />
„gebacken“. Daher hat das Modell kürzeste<br />
Liefer zeiten – man kann es schon innerhalb<br />
einer Woche nach Bestellung bekommen.<br />
Der Segelmacher muss sich dann ganz<br />
schön beeilen, um noch rechtzeitig ein Segel<br />
liefern zu können.<br />
Gerd Mentges designt und baut selbst.<br />
Vom ersten Strich bis zum fertigen Boot benötigt<br />
er dafür etwa ein Jahr. Sein neuestes<br />
Design, die „Kamsim“, ist nach Mentges’<br />
Aussage der derzeit schmals te TenRater im<br />
Feld. Mit ihr belegte er den 4. Platz.<br />
„Diamond“ mit Swingrigg, Skipper Gerhard Schmitt<br />
„Satori“, Design Graham Bantock,<br />
Skipper Ralph Tacke<br />
Zwei Gruppen, 18 Läufe<br />
Die Deutsche Meisterschaft fand an zwei<br />
Tagen statt. Der Samstag begann mit viel Regen<br />
und nicht ganz so idealen Windverhältnissen,<br />
aber im Laufe des Tages besserte sich<br />
das Wetter und auch der Wind drehte auf die<br />
richtige Richtung und nahm immer mehr<br />
zu. Der Sonntag war trocken und die Windbedingungen<br />
ideal. Insgesamt segelten bei -<br />
de Gruppen je 18 Läufe. Den Titel des Deutschen<br />
Meisters in der TenRater-Klasse er -<br />
segelte sich Graham Bantock. Ebenfalls auf<br />
„Diamond“ segelte Jürgen Peters auf Platz<br />
2, gefolgt von Ger hard Schmitt, der eine auf<br />
Swingrigg umgebaute „Diamond“ segelte.<br />
Die Vielfalt der Bantock-Designs im Rennen<br />
zeigte aber auch, wie stark die Platzie -<br />
rung von der Leistung des Skippers abhängig<br />
ist, denn sowohl die ersten drei als auch die<br />
letzten drei Plätze wurden von Bantock-<br />
Designs besetzt.<br />
n<br />
40
12x SCHIFFSMODELL<br />
+ Geschenk<br />
Buch »Die Gorch Fock und ihre<br />
Schwesterschiffe«<br />
Die Geschichte der Gorch Fock und ihrer fünf Schwesterschiffe.<br />
Brillant bebildert und mit fundierten <strong>naut</strong>ischen<br />
und historischen Hintergrundinfos.<br />
GRATIS!<br />
Mein Vorteilspaket<br />
✓ Ich spare 10% (bei Bankeinzug sogar 12%)!<br />
✓ Ich erhalte mein Heft 2 Tage vor dem Erstverkaufstag<br />
bequem nach Hause (nur im Inland) und verpasse keine<br />
Ausgabe mehr!<br />
✓ Ich kann nach dem ersten Jahr jederzeit abbestellen und<br />
erhalte zuviel bezahltes Geld zurück!<br />
Das SCHIFFSMODELL-Vorteilspaket<br />
❑<br />
JA, ich möchte mein SCHIFFSMODELL-Vorteilspaket<br />
Bitte schicken Sie mir SCHIFFSMODELL ab sofort druckfrisch und mit 10 % Preisvorteil<br />
für nur 5,31 €* statt 5,90 €* pro Heft (Jahrespreis: 63,72 €*) monatlich frei Haus. Ich erhalte<br />
als Willkomebsgeschenk das Buch »Gorch Fock«**. Versand erfolgt nach Bezahlung<br />
der ersten Rechnung. Ich kann das Abo nach dem ersten Bezugsjahr jederzeit kündigen.<br />
Vorname/Nachname<br />
❑<br />
Bitte informieren Sie mich künftig gern per E-Mail, Telefon<br />
oder Post über interessante Neuigkeiten und Angebote<br />
(bitte ankreuzen).<br />
Ihr Geschenk<br />
Sie möchten noch mehr sparen?<br />
Dann zahlen Sie per Bankabbuchung (nur im Inland möglich)<br />
und Sie sparen zusätzlich 2% des Abopreises!<br />
❑ Ja, ich will sparen und zahle künftig per Bankabbuchung***<br />
Straße/Hausnummer<br />
PLZ/Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail (für Rückfragen und weitere Infos)<br />
Datum/Unterschrift✗<br />
WA-Nr. 620SIMO60419 – 62145672<br />
IBAN: DE — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — —<br />
Bankname<br />
Datum/Unterschrift✗<br />
Bankleitzahl<br />
Kontonummer<br />
Bitte ausfüllen, ausschneiden oder kopieren und gleich senden an: SCHIFFSMODELL<br />
Leserservice, Postfach 1280, 82197 Gilching oder per Fax an 0180-532 16 20 (14 ct/min.)<br />
* Preise inkl. Mwst, im Ausland zzgl. Versandkosten<br />
** Solange Vorrat reicht, sonst gleichwertige Prämie<br />
*** SEPA ID DE15ZZZ000001142650<br />
www.schiffsmodell-magazin.de/abo
SZENE<br />
Flottentreffen in Gelsenkirchen<br />
Parade<br />
FLOTTENTREFFEN IN GELSENKIRCHEN<br />
zur See<br />
Für die Freunde der Grauen Flotte gibt es inzwischen jedes Jahr an<br />
unterschiedlichen Orten in Deutschland verschiedene Veranstaltungen,<br />
bei denen man Hobbykollegen zu „Flottenmanövern“ treffen kann.<br />
Dabei sind auch ehemalige Gegner gemeinsam friedlich unterwegs.<br />
TEXT UND FOTOS: Peter Behmüller<br />
42
Das Flottentreffen, von machen<br />
auch Flottenparade genannt, ist<br />
ein Schaufahren für Freunde<br />
der grauen Dampferlinien,<br />
sprich von Marineschiffen aller<br />
Epochen und Nationen. Die erste Veranstaltung<br />
dieser Art wurde im Norden Deutschlands,<br />
in Glücksburg, durchgeführt. Schnell<br />
fand die Idee auch im Süden Anklang, wo es<br />
ebenfalls viele Marine-Interessierte gibt. Die<br />
Flottenparade in Weißenburg/Franken ist<br />
inzwischen auch schon ein fester Begriff.<br />
Im vergangenen Jahr hatten die Schiffsmodell-Freunde<br />
aus Gelsenkirchen diese<br />
Idee übernommen, um auch im tiefen Westen<br />
unseres Landes den vielen Freunden der<br />
Marineschiffe eine solche Veranstaltung anbieten<br />
zu können.<br />
Eingeladen hatte der Schiffsmodellbau-<br />
Club Gelsenkirchen e. V., Veranstaltungsort<br />
war der Lohmühlenteich in Gelsenkirchen-<br />
Buer.<br />
Da ich von der ersten Flottenparade West<br />
viel Gutes gehört hatte, wollte ich die zweite<br />
Flottenparade der Schiffsmodellbau-Kol le -<br />
gen aus Gelsenkirchen nicht verpassen.<br />
Und ich kann sagen: Der weite Weg aus<br />
Leonberg (Baden Würt temberg) von immerhin<br />
450 Kilometern hat sich gelohnt, denn<br />
das Gelsenkirchener Flottentreffen konnte<br />
sich sehen lassen. Nicht nur was Organisa -<br />
tion und Zuschauerzahlen betraf, sondern<br />
auch, was die aktiven Teilnehmer mit teilweise<br />
sehr interessanten und seltenen Modellen<br />
anging, die man nicht oft auf den<br />
Modell teichen zu sehen bekommt.<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
43
SZENE<br />
Flottentreffen in Gelsenkirchen<br />
Es waren ausreichend Pavillons zum Ausstellen<br />
der Modelle vorhanden und auch die<br />
Küchen-Mannschaft des S.M.C. Gelsenkirchen<br />
war gut vorbereitet. Für eine gelungene<br />
Veranstaltung sorgte auch das trockene und<br />
schöne Wetter an diesem Tag. Der Einladung<br />
waren 60 Modellbauer mit gut 100 Modellen<br />
gefolgt. Die weiteste Anreise hatten die Modellbauer<br />
der IG Marine aus Hamburg und<br />
der Modellbouwvrienden-Hofstade aus Belgien<br />
sowie der IG Deutsche Marine aus Weißenburg.<br />
Die verschiedenen Epochen der Vorbilder<br />
waren in die Gruppen „Kaiserliche Marine“<br />
(bis 1918), „Kriegsmarine“ (bis 1945) und<br />
„Neuzeit“ (nach 1945 bis heute) eingeteilt<br />
worden. Am stärksten besetzt war hierbei<br />
die Epoche der Kriegsmarine, hier wurden<br />
praktisch alle Einheiten von U-Booten über<br />
Zerstörer, Versorger und Kriegsfischkutter<br />
bis hin zum Schlachtschiff gezeigt. Beeindruckend<br />
war vor allem das Modell des Panzerschiffs<br />
„Admiral Graf Spee“ im Maßstab<br />
1:50, gebaut vom Gelsenkirchener Vereinsmitglied<br />
Heinrich Kollmer. Daneben gab es<br />
Zerstörer der<br />
Kriegsmarine,<br />
davor ein<br />
„Schwarzer<br />
Geselle“<br />
Kleine Unterstützer: Modelle<br />
von Kriegsfischkuttern (KfK)<br />
Stilvolle Eröffnung in Gelsenkirchen<br />
auch noch zwei Zerstörer im Maßstab 1:50<br />
zu sehen. Die belgischen Modellbau-Kolle -<br />
gen aus Hofstade haben den Schwerpunkt<br />
ihrer Modellbauaktivitäten auf die alliierte<br />
Landung in der Normandie gelegt.<br />
In der Gruppe „Neuzeit der Marine“ wurden<br />
etliche Schnellboote der Deutschen Marine<br />
gezeigt, aber auch der sowjetische Zerstörer<br />
„Otlichny“ von Steffen Kanis zog seine<br />
Runden auf dem See. Natürlich würde es<br />
hier zu weit füh ren, alle Modelle zu nennen,<br />
die an diesem Flottentreffen beteiligt waren.<br />
Insgesamt eine schöne Veranstaltung, die<br />
allen Teilnehmern und Besuchern viel Spaß<br />
gemacht hat.<br />
Ganz klar, dass sich daher alle Teilnehmer<br />
schon auf das nächste Flottentreffen in Gelsenkirchen<br />
freuen.<br />
Wer mehr über den SMC Gelsenkirchen<br />
e. V. wissen möchte, wende sich bitte an den<br />
Vorstand, Herrn Daniel Gayko, E-Mail:<br />
vorstand@smc-ge.de. Auch die Ho me page<br />
www.smc-ge.de lohnt den Besuch. n<br />
Modell eines<br />
sowjetischen Lenkwaffenzerstörers<br />
Dürfen nicht fehlen:<br />
Bundesmarine-Schnellboote<br />
44
Beeindruckend: die „Admiral Graf Spee“ in 1:50<br />
Auch die Vertreter der Royal Navy<br />
durften nicht fehlen<br />
Die großmaßstäbliche „Admiral Graf Spee“ ist<br />
gespickt mit Details, dementsprechend lange lässt<br />
das Modell Betrachter verweilen<br />
Obwohl kein „Grauer“, war auch der SEEFALKE<br />
ein gerne gesehener Gast. Schließlich benötigen<br />
auch Kampfeinheiten mitunter Schlepperhilfe<br />
Hilfskreuzer in attraktiver<br />
Tarnlackierung<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
45
SZENE<br />
Traditionstreffen der KNRM<br />
TRADITIONSTREFFEN DER KNRM<br />
Vor Anker<br />
in Lemmer<br />
Ungezählt sind in Deutschland die Freunde der<br />
Seenot-Rettungseinheiten. Das ist auch in<br />
unserem nordwestlichen Nachbarland, den<br />
Niederlanden, nicht anders. Dort gibt es ein<br />
besonderes Spektakel, nämlich ein alljährliches<br />
Treffen historischer Rettungsboote.<br />
TEXT UND FOTOS: Manfred Sievers<br />
Zum inzwischen 15. Mal trafen sich Ende September letzten<br />
Jahres Freunde historischer Rettungseinheiten beim alljährlichen<br />
Traditionstreffen von ausgemusterten Rettungsbooten<br />
der niederländischen KNRM in Lemmer.<br />
Ich war gemeinsam mit meiner Frau bereits am Freitagvormittag<br />
angereist, und nach dem Einchecken im Hotel ging es ab<br />
zum Hafen. Dort konnten wir bei schönem Herbstwetter unseren<br />
Kaffee im Freien trinken und den Anblick der schon eingetroffenen<br />
Schiffe genießen. Die Stille wurde plötzlich vom Klang eines Nebelhorns<br />
unterbrochen, mit dem sich die nächsten Schiffe ankündigten.<br />
Diese hatten sich im Vorhafen gesammelt und fuhren nun als<br />
Verband in den Hafen ein.<br />
Rettungsboote in bestem Pflegezustand<br />
Im Hafenbecken wendete dann jedes der Schiffe erst einmal in aller<br />
Ruhe um 180 Grad und steuerte anschließend seinen Liegeplatz an.<br />
Dabei ging es sehr gelassen und diszipliniert zu, jeder Boots füh rer<br />
wartete geduldig ab, bis er mit seinem Schiff an die Reihe kam. Der<br />
ganze Ablauf war eine wahre Augenweide, erst recht natürlich der<br />
Anblick, als am Schluss 28(!) ehemalige Rettungsboote in bestem<br />
Pflegezustand festgemacht hatten.<br />
Das älteste war die im Jahr 1907 erbaute »Jhr. JWH Rutgers van<br />
Rozenburg«. Besonders interessant: Das ausgemusterte ehem. Tochterboot<br />
»Hein Muck« des deutschen Zollkreuzers »Bremerhaven«<br />
hatte man umlackiert, damit es farblich zu den anderen Einheiten<br />
passte. Alle vorgestellten Schiffe sind übrigens im Privatbesitz oder<br />
gehören Interessengemeinschaften, die diese histo rischen Einheiten<br />
46
Der Hafen von Lemmer wird im<br />
wahrsten Sinne des Wortes zur<br />
Showbühne, wenn die historischen<br />
Rettungseinheiten einlaufen und<br />
sogar der Shanty-Chor an Bord singt<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
47
SZENE<br />
Traditionstreffen der KNRM<br />
Auch der Modellbau kommt auf dieser Veranstaltung nicht zu kurz.<br />
Gut gebaute Modelle der unterschiedlichsten Rettungsboot-Typen<br />
können in der Ausstellung, aber auch im Betrieb begutachtet werden<br />
unterhalten, restaurieren und pflegen. Zwei der Schiffe kamen<br />
übrigens aus dem Rettungsmuseum in Den Helder, wo noch zwei<br />
weitere historische Rettungseinheiten vorhanden sind.<br />
Der Besuch dieses Museums soll sehr interessant sein, unter anderem<br />
gibt es dort Simulatoren, mit denen man ausprobieren kann,<br />
ob man selber in der Lage wäre, bei starkem Wind und hohem<br />
Seegang Menschen zu retten.<br />
Auch der Modellbau ist vertreten<br />
Aber nicht nur die „großen“ Einheiten konnten ausgiebig be sichtigt<br />
werden, denn die Veranstaltung in Lemmer zeichnet sich dadurch<br />
aus, dass auch der Modellbau berücksichtigt wird. Dieses Mal<br />
wurden 31 Modelle gezeigt, und dabei reichte die Bandbreite von<br />
Nachbauten historischer Einheiten bis hin zu Schiffen, die sich<br />
derzeit im aktiven Einsatz befinden. Natürlich wurden etliche der<br />
Modelle auch im Einsatz im Hafenbecken gezeigt. Hierfür war extra<br />
ein Ponton vorhanden, von dem aus die Modelle ins Wasser gesetzt<br />
werden konnten.<br />
Federführend für den Modellbaubereich auf dieser Veranstaltung<br />
ist Jan Smitz, der immer die Modellbauer anschreibt und zu den<br />
Treffen einlädt. Natürlich können sich interessierte Modellbauer<br />
auch direkt bei ihm melden, wenn sie ihre Modelle von Rettungs -<br />
einheiten zeigen wollen (E-Mail: smits183@upcmail.nl). Dabei<br />
dürfen das natürlich gerne auch Modelle von Vorbildern anderer<br />
Rettungsdienste sein.<br />
Die Veranstaltung in Lemmer ist mit einem passenden Rahmenprogramm<br />
ausgestattet. Dazu gehören Shantie-Chöre, die ihr<br />
Können zu Gehör brachten und die verschiedensten Verkaufsstände<br />
mit maritimen Waren, von Literatur und „schiffigem“ Zubehör bis<br />
zur Literatur zum Themenbereich Schifffahrt.<br />
Zum Abschluss kann ich nur sagen: Eine sehr interessante Veranstaltung,<br />
die den Ausflug gelohnt hat, eine nette und kameradschaftliche<br />
Atmosphäre und vor allem kann man sich viele Anregungen<br />
für zukünftige Projekte holen.<br />
n<br />
48
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
49
Flugfertig,<br />
abheben!<br />
JETZT AM<br />
KIOSK!<br />
Online blättern oder Abo mit Prämie bestellen unter:<br />
www.flugmodell-magazin.de/abo
PRIVATE KLEINANZEIGEN KOSTENLOS!<br />
Joker 185 von EPV: Mit neuem Antrieb über 150 km/h!<br />
01/02 Januar/Februar 2014<br />
5,90 EUR A: 6,70 Euro . CH: 11,80 sFr . BeNeLux: 6,90 Euro . I: 7,90 Euro<br />
Anzeigencoupon bitte senden an:<br />
Anzeigenredaktion <strong>SchiffsModell</strong>,<br />
Postfach 40 02 09, 80702 München,<br />
Fax: (089) 13 06 99-100,<br />
Für gewerbliche Anzeigen:<br />
Tel.: (089) 13 06 99-520<br />
EXTRA<br />
Bauplan<br />
im Heft:<br />
Mahagoni-Rennboot<br />
CHICKIE IV<br />
DIE ZEITSCHRIFT FÜR DEN SCHIFFSMODELLBAU<br />
Graf Spee in 1:50<br />
Star beim Flottentreffen<br />
in Gelsenkirchen<br />
GROSSER<br />
FOTO<br />
REPORT<br />
<strong>SchiffsModell</strong><br />
PRAXIS<br />
Anzeigenschluss für die Ausgabe 03/2014<br />
ist der 31.1.2014<br />
Hiermit gebe ich folgende Rubrik-Anzeige/n auf:<br />
TEST<br />
Bitte die vollständige Adresse angeben und den Coupon deutlich lesbar ausfüllen!<br />
Keine Haftung für eventuelle Übermittlungs- und Satzfehler.<br />
<strong>aero</strong>-<strong>naut</strong> <strong>QUEEN</strong><br />
Edelflitzer mit Doppel-Brushless-Antrieb<br />
Deutsche<br />
Meisterschaft<br />
der TenRater<br />
U-Boot Typ XXIII Wasserskispaß mit<br />
von Bronco Models MasterCraft 300<br />
Die Anzeige ist: privat gewerblich mit Bild (nur online möglich)<br />
Der Text soll in die Rubrik: Verkauf Literatur Sonstiges Suche<br />
EINFACH UND BEQUEM<br />
Private Kleinanzeigen kostenlos<br />
online aufgeben unter<br />
www.schiffsmodell-magazin.de<br />
Persönliche Angaben:<br />
Name, Firma<br />
Vorname<br />
Straße, Nr. (kein Postfach)<br />
PLZ/Ort<br />
Telefon inkl. Vorwahl<br />
Fax<br />
E-Mail<br />
Einzugsermächtigung (nur bei gewerblichen Anzeigen erforderlich):<br />
Den Betrag von<br />
buchen Sie bitte von meinem Konto ab:<br />
Konto-Nr., Bankleitzahl<br />
Kreditinstitut<br />
Rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel, Datum<br />
GEWERBLICHE<br />
ANZEIGEN<br />
JETZT<br />
NUR 13,50 EUR<br />
pro Anzeige<br />
für 3 Zeilen Fließ text* s/w<br />
bei 42 mm Spaltenbreite,<br />
jede weitere Zeile 4,50 EUR<br />
+ Bild zzgl. 25,00 EUR<br />
zzgl. MwSt<br />
Chiffre-Gebühr entfällt<br />
*keine Nachlässe, Belegexem plare<br />
und Agenturprovision<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1–2/2014<br />
51
MARKT Kleinanzeigen | Handel<br />
PLZ 0<br />
Uranus, Janus der Reederei Harms Bergung.<br />
Tel. 04732/2348 oder 0160/2040783.<br />
PLZ 1<br />
Verkaufe 16 Pläne, Fracht-, Passagier-,<br />
Fischereischiffe u. Schlepper, überwiegend<br />
aus der ehem. DDR, Preis auf Nachfrage,<br />
Tel. 030/9754791.<br />
Verkaufe Eisbrecher Coast Guard, L= 1,70<br />
m, Kümo, L= 1,60 m, Schnellboot, L= 1,50 m,<br />
Schlepper und Fischkutter ohne FB, Antriebe<br />
und Steuerung vorhanden, zum Materialpreis<br />
an Selbstabholer abzugeben,<br />
Tel. 03375/290827.<br />
Elde Modellbau<br />
Tel. 038755/20120<br />
www.elde-modellbau.com<br />
EINFACH<br />
UND BEQUEM<br />
Private Kleinanzeigen kostenlos online aufgeben<br />
unter www.schiffsmodell-magazin.de<br />
PLZ 2<br />
Suche Bauunterlagen Billing Boats Marie<br />
Jeanne, Spantenriss, Aufbauten etc., ebenfalls<br />
Werftpläne Okertal der Reederei<br />
Reinecke, Schlepper Primus, Taurus, Magnus,<br />
PLZ 3<br />
Verkaufe perfekt gebaute Glasgow von<br />
Graupner mit Transportkiste. Tel. 05604/5845<br />
od. 0178/9051520.<br />
Suche gut gebaute Schiffsmodelle aller<br />
Art für ein Schifffahrtsmuseum,<br />
Tel. 05604/5845 oder 0178/9051520,<br />
E-Mail: e.fern@gmx.de<br />
PLZ 4<br />
Suche Bauplan/Schaltplan oder Bauplan/<br />
Schaltplankopie für robbe-Berlin, Seenotrettungskreuzer,<br />
Bauanleitung ist vorhanden.<br />
Tel. 0172/2842669<br />
PLZ 5<br />
Wegen Hobbyaufgabe zu verkaufen: Haus -<br />
boot Helena, Länge 75 cm, Breite 28 cm,<br />
Höhe 32 cm, Antrieb 2 x E-Motor 6 V, 1 Akku<br />
6,5 Ah, 2 Ladebuchsen auf dem Vordeck,<br />
Sonderfunktionen, Positionslampen,<br />
Innenbeleuchtung, Rundumbeleuchtung,<br />
Transparentbeleuchtung Bund LEDs, 1<br />
Deckstrahler am Mast. Mast kann beim<br />
Transport abgenommen werden. Boot ist<br />
ausgetestet mit Möbeln und fahrbereit, Preis<br />
VB 350 Euro, Boot kann geschickt werden,<br />
Tel. 02637/2512.<br />
Sammler kauft alte Fernsteuerungen bis<br />
1970. Tel. 0221/394538, 0163/9296575<br />
PLZ 6<br />
PLZ 7<br />
Suche Kortdüse von robbe, Best.-Nr. 1433,<br />
neu oder gebraucht, Tel. 07808/2269 oder<br />
E-Mail: idehde@t-online.de<br />
PLZ 8<br />
Zahle Höchstpreise: Für alte Diesel- und<br />
Benzinmotoren bis 1970, auch defekt. D.<br />
Rother, Welzenbachstr. 29, 80992 München,<br />
Tel. 089/145739, Fax 1417041.<br />
Wir fertigen Ihre 3-D fähige CNC-gesteuerte Portalfräsmaschine mit Ihren gewünschten<br />
Verfahrwegen mit Ihrer Wunschsteuerung und in individueller Farbe<br />
Pulver beschichtet in bester Qualität und Stabilität zu einem sagenhaften Preisleistungsverhältnis.<br />
Bitte besuchen Sie unsere Homepage www.cnc-frank.de<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
„Hessens größte Modellbaubörse”<br />
Samstag, 22. Februar, Hans-Pfeiffer-Halle in 68623 Lampertheim.<br />
Für Modell-Flugzeuge, -Autos, -Schiffe, -Motoren und Zubehör.<br />
Bitte Tische reservieren!<br />
Einlass: ab 6.30 Uhr für Verkäufer<br />
ab 8.00 Uhr für Käufer<br />
Modellsportverein Hofheim e.V.<br />
Michael Braner, Tel. 0179/3925017, E-Mail: branermichael@aol.com<br />
52
EINFACH UND BEQUEM<br />
Private Kleinanzeigen kostenlos online aufgeben<br />
unter www.schiffsmodell-magazin.de<br />
SCHWEIZ<br />
Suche alle Graupner Bellaphon- und<br />
Standard-Fernsteuerungen, auch Teile wie<br />
Empfänger, Servos etc., sowie Original -<br />
verpackungen dazu.<br />
Angebote bitte an Tel. 0721/5439391 oder<br />
E-Mail: eolo1@web.de<br />
PLZ 9<br />
Graupner Außenbordmotor GTX 800<br />
2337, Rennschraube 2318.39 und .45<br />
sowie weiteres Zubehör, nur komplett zu<br />
110 Euro, alle Teile unbenutzt.<br />
Tel. 02224/9892501.<br />
Schiffsschrauben zu verschenken: vorw.<br />
GRP Plastik rot, 2 – 4 Flügel 25 – 70 mm,<br />
Tel. 0911/6722088.<br />
Verkaufe Commodore Motoryacht, GRP<br />
1969. Neubau nach Plan auf Original-Rumpf.<br />
Unfertig, auf Wunsch Zubehör wie Wellen,<br />
Motoren etc. Tel. 0911/6722088<br />
Modellbau - Zubehör - Reparaturen<br />
Lerchenfeldstrasse 54 - CH-3603 Thun<br />
Tel. +41 33 345 08 71 - Fax +41 33 345 08 72<br />
www.hobby-technik.ch - info@hobby-technik.ch<br />
MODELLBAU DIND<br />
Flug-, Schiffs- und Automodelle<br />
Funkfernsteuerungen<br />
Illnauerstrasse 14, CH-8307 Effretikon<br />
Tel. +41 (0) 52 343 32 55 Fax +41 (0) 52 343 78 62<br />
e-mail: mobadi@bluewin.ch Internet: www.mobadi.ch<br />
EINFACH UND BEQUEM<br />
Private Kleinanzeigen kostenlos online aufgeben<br />
unter www.schiffsmodell-magazin.de<br />
www.NESSEL-ELEKTRONIK.de<br />
PVC-SCHRUMPFSCHLAUCH, PolyOlefine / mit Kleber,<br />
Goldverbinder 0,8–8 mm, Balancer-, Servokabel + Verlängerung,<br />
Silikonlitze bis 82, Crimp-Zange, Crimp-Set,<br />
Power-FET, Klappferrit, Händleranfrage erwünscht<br />
Tel. 0049-6182-1886 FAX 06182-3703<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Feinmechanik und Schilder für Modell-Enthusiasten<br />
Individuelle Anfertigung nach Zeichnung oder Skizze<br />
www.sdfkft.com<br />
Tel.: 0 1 6 0 - 9 0 9 5 4 8 2 9 / E-Mail: anfrage@sdfkft.com<br />
Schwarzer DF Kft, Jokai ut 5/C, H 8142 Urhida<br />
WWW.ARKOWOOD-SHOP.DE<br />
Holz und mehr....<br />
Leisten und Brettchen für den anspruchsvollen Modellbauer.<br />
Gegen 5,– € erhalten Sie unsere aktuelle Preisliste<br />
mit integrierter Holzmusterkarte.<br />
O.C.König, Schlossring 12, 72290 Loßburg. 07446-3619 FAX: 916270<br />
E-Mail: arkowood@t-online.de<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1–2/2014<br />
53
TECHNIK<br />
Junsi iCharger 308 Duo<br />
<strong>SchiffsModell</strong><br />
PRAXIS<br />
TEST<br />
JUNSI ICHARGER<br />
Starkes<br />
Doppel<br />
Knapp ein halbes Jahr nach dem großen iCharger 4010 DUO<br />
brachte Junsi nun den handlicheren 308 DUO auf den Markt.<br />
TEXT UND FOTOS: Milan Lulic<br />
Für all diejenigen, denen der Junsi<br />
iCharger 4010 DUO möglicherweise<br />
eine Nummer zu groß war, hat Junsi<br />
einen zwar kleineren, aber dennoch leistungsfähigen<br />
Lader im Angebot. Der iCharger<br />
308 Duo glänzt mit einem Ladestrom<br />
von 30 Ampere pro Ladeausgang, einer maximalen<br />
Ladeleistung von 1300 Watt, starken<br />
Balancern für 2 x 8 Li-Akkus, USB-Port, Kartenslot<br />
für SD-Card und einer reichhaltigen<br />
Software. Junsi hat uns über den deutschen<br />
Händler MTTEC ein Testmuster zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Für seine eindrucksvolle Leistung von<br />
1300 Watt ist der iCharger 308 DUO (im Weiteren<br />
nur noch 308 DUO genannt) mit 170 x<br />
115 x 56 mm Größe und ca. 920 g Gewicht<br />
ein sehr kompaktes und leichtes Gerät, welches<br />
in einem soliden blauen Kunststoffgehäuse<br />
untergebracht ist. Der Lader beherbergt,<br />
wie das DUO im Namen schon andeutet,<br />
zwei gleich starke und autarke<br />
Ladeausgänge.<br />
Deutsch oder Englisch<br />
Auf der Frontseite befinden sich alle wich -<br />
tigen Buchsen für Ladekabel, Tempera tur -<br />
sen soren und Balancer für beide Ausgänge.<br />
Auf der Rückseite sind ein ausreichend<br />
dimensioniertes 12-Volt-Anschluss kabel<br />
(10 AWG), der Mini-USB-Anschluss, der<br />
54<br />
USB-Lade-Port, der MikroSD-Kartenslot und<br />
die Schlitze für beide Lüfter untergebracht.<br />
Das nur 10 cm lange 12-Volt-Anschlusskabel<br />
ist mit EC5(5-mm)-Steckern ausgerüstet, an<br />
welchen ein ca. 60 cm langes (mitgeliefertes)<br />
Kabel mit EC5-Buchsen angesteckt wird. So<br />
kann das lange Kabel jederzeit angesteckt<br />
oder zu Transportzwecken entfernt werden.<br />
Die beiden anderen Kabelenden sind<br />
ohne Stecker, daher kann jeder Benutzer hier<br />
seine bevorzugten Stecker oder Polzangen<br />
anlöten. Die EC5-Stecker bzw. -Buchsen sind<br />
von ausgezeichneter Qualität und sicherlich<br />
den Ladebelastungen (Eingangsstrom max.<br />
60 A) gewachsen. An der rechten Seite sind<br />
noch zwei Servoanschlüsse für die Servotester-Funk<br />
tion untergebracht. An der Ober -<br />
seite des Gehäuses befindet sich ein exzellentes,<br />
hochauflösendes, 13-zeiliges 2,8"-<br />
TFT-Farbdisplay, aufgeteilt in CH-1 (blau)<br />
und CH-2 (grün).<br />
Darunter finden sich fünf Bedientasten<br />
und ein Drehgeber mit Tastfunktion. Das<br />
Farbdisplay kann für bessere Ablesbarkeit in<br />
vier Raststellungen aufgeklappt werden, natürlich<br />
lassen sich auch Kontrast und Helligkeit<br />
individuell anpassen. Von einem aktuellen<br />
32-Bit-Prozessor gesteuert, arbeitet<br />
der Lader mit einem Buck-Boost-DC/DC-<br />
Wandler fortschrittlicher Technologie mit<br />
einer Taktfrequenz von ca. 70 kHz bei einem<br />
Die Platine<br />
des iCharger<br />
308 DUO<br />
Großzügig<br />
dimensionierter<br />
Kühlkörper<br />
Serienmäßiges Zubehör:<br />
Installations-CD mit Software,<br />
zwei Ladekabel zum<br />
Selbstkonfektionieren und<br />
Balancer-Adapterplatinen
TECHNISCHE DATEN<br />
Junsi Charger 308 DUO<br />
Hochauflösendes<br />
TFT-Farbdisplay,<br />
darunter Bedienfeld<br />
mit fünf<br />
Tasten und Drehgeber<br />
mit Tastfunktion<br />
Das starke Chargery Power S1200-Schaltnetzgerät<br />
versorgt den iCharger 308 DUO. Wer das ganze<br />
Potenzial des Laders ausnutzen möchte, muss aber<br />
zu noch leistungsfähigeren Stromquellen greifen!<br />
Spannungsversorgung<br />
10–30 V DC<br />
Eingangsstrom Limit<br />
60 A<br />
Ruhestromaufnahme bei 13,8 V ca. 180 mA<br />
Abschaltschwelle Eingangsspann. 10–29 V<br />
Zellenzahl CH-1, CH-2<br />
1–25 NiCd/NiMH<br />
1–18 Pb<br />
1–8 LiFe/LiIo/LiPo<br />
1–8 NiZn<br />
Ladestrom<br />
max. 30 A/50 A (synchron)<br />
Ladeleistung pro Ausgang<br />
bei >23,5 V<br />
max. 1300 W/800 W<br />
bei 12 V<br />
max. 420 W<br />
Entladestrom<br />
max. 30 A/50 A (synchron)<br />
Entladeleistung pro Ausgang:<br />
intern<br />
max. 130 W/80 W<br />
regenerativ<br />
max. 1300 W<br />
extern<br />
max. 2100 W<br />
Erhaltungs-Ladeströme (NiCd/NiMH) 0,02–1 A (Default 0,05 A)<br />
Einstellbare Zeit<br />
1–999 Min. (Default 5 Min.)<br />
Einstellb. Lithium-Voll/Leer/Lager- ja (siehe separate Tabelle)<br />
Spannung<br />
Anzahl Balancer 2 x 8<br />
Max. Balancer-Strom je Zelle 1,2 A (2,4 A Synchronmod.)<br />
Temperatur-Abschaltung 20–80 °C<br />
Lademengen-Limiter 50–200 %<br />
Timer<br />
1–9999 min/aus<br />
Abwärtswandler/Aufwärtswandler ja/ja<br />
Wandler-Taktfrequenz<br />
ca. 70 kHz<br />
Verpolungsschutz Eingang/Ausgang ja/ja<br />
Antiblitz Ausgänge<br />
ja<br />
Interne Lüfter<br />
2 x<br />
Serielle Schnittstelle<br />
mini-USB<br />
USB-Lade-Port 5 V/1 A (Strom-Limit 1,2 A)<br />
Anzeige optisch<br />
2,8" TFT-Farb-Display<br />
Anzeige akustisch<br />
Piepser<br />
LCD-Kontrast/Helligkeit<br />
einstellbar<br />
Logfile-Speicher<br />
ja<br />
Speicherplätze<br />
je nach Kapazität<br />
Micro-SD-Card<br />
Maße (B/T/H)<br />
170 x 115 x 56 mm<br />
Gewicht (ohne Kabel)<br />
ca. 920 g<br />
Preis (inkl. Zubehör)<br />
269,95 Euro<br />
Bezugsquelle<br />
www.mans-toy.de<br />
maximalen Wirkungsgrad (je nach Eingangsspannung)<br />
von 88 bis ca. 93 %.<br />
Eine Bedienungsanleitung in englischer<br />
Sprache sowie LogView Software, Upgrader<br />
und USB-Treiber befinden sich auf der mitgelieferten<br />
CD-ROM. Gewiefte Internet-Nutzer<br />
werden auch die deutsche Anleitung<br />
zum Download leicht finden.<br />
Was viele Benutzer erfreuen wird, ist die<br />
Tatsache, dass die Menü-Sprache beim 308<br />
Duo in Deutsch und Englisch gewählt wer -<br />
den kann. Wenn man die nahezu unbe -<br />
grenz ten Einstellmöglichkeiten des Laders<br />
alle nutzen möchte, muss man sich aller -<br />
dings mit der Bedienungsanleitung auch ein<br />
wenig beschäftigen. Dank gut strukturierter<br />
Menüs mit vielen Informationen wird man<br />
sich aber schnell zurechtfinden.<br />
Natürlich kann jeder Benutzer auch ohne<br />
lange Einarbeitung alle gängigen Akkutypen<br />
laden, entladen und pflegen. Dafür bietet der<br />
Lader sehr gute Grundeinstellungen für die<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
Akkutypen LiPo, LiIo, LiFe, NiMH, NiCd, Pb<br />
und NiZn. Falls gewünscht, ist es leicht, den<br />
einen oder anderen Parameter zu ändern.<br />
Wer sehr viele Akkus mit unterschiedlichen<br />
Kapazitäten und Zellenzahlen hat, wird<br />
dafür gewiss die Einstelldaten bzw. Akkuparameter,<br />
hier als „Programme“ bezeichnet,<br />
im Speicher ablegen, um sie immer wieder<br />
zum Laden zu nutzen. Bis zu 64 dieser Akkuprogramme<br />
können in einem Speicher<br />
(als bak-Datei) hinterlegt werden. Für jeden<br />
Namen des Programms können max. 37 Zeichen<br />
eingegeben werden, das sollte wohl<br />
reichen.<br />
Im System-Menü können viele Para me -<br />
ter programmiert werden, so z. B. Tempe ra -<br />
tur und Lüfter, Piepstöne, Aus gangsleis tung,<br />
Versorgungsquelle (Netzteil oder Batterie),<br />
Speichern bzw. Laden von Konfigu rationen<br />
und Kalibrieren. Das zu letzt genannte Feature<br />
ist sicherlich nur für Profis interessant<br />
und zulässig!<br />
Außerdem stellt der Lader noch drei Sonderfunktionen<br />
zur Verfügung, nämlich Log<br />
Files, Servotest und Impulstest.<br />
Die folgenden Daten sind für beide Ladeausgänge<br />
identisch: Im NiCd-/NiMH-Mo -<br />
dus können 1–25 Zellen, im Pb-Modus 1–18<br />
Zellen, im NiZn-Modus 1–8 Zellen und im<br />
Lithium-Modus 1–8 Zellen geladen werden.<br />
Der Ladestrom ist für alle Akkutypen von<br />
0,05 bis 30 Ampere (50 Ampere im Synchronmodus)<br />
einstellbar. Die max. Ladeleistung<br />
auch dieses Laders ist aber abhängig<br />
von der Versorgungsspannung der Batterie<br />
bzw. des Netzteils. Die volle Leistung von<br />
1300 Watt wird ab einer Eingangsspannung<br />
von 23,5 Volt erreicht. Das reicht, um je einen<br />
5000er-8s-LiPo mit ca. 4C (knapp 20 Ampere)<br />
zu laden. Hier wird deutlich, warum<br />
wir bei großen Akkus bzw. Kapazitäten nicht<br />
auf ein starkes Netzgerät verzichten können.<br />
Bei einer Versorgungsspannung von 12<br />
Volt steht bei unserem Testmuster eine max.<br />
55
TECHNIK<br />
Junsi iCharger 308 Duo<br />
Ladeleistung von ca. 420 Watt zur Verfü -<br />
gung, sofern nur ein Ladeausgang benutzt<br />
wird. Das reicht, um einen 5000er-6s-LiPo<br />
mit über 3C (>15 Ampere) zu laden. Werden<br />
beide Ladeausgänge benutzt, kann an jedem<br />
Ladeausgang zum Beispiel ein 5000er-5s-<br />
LiPo mit 3C (15 Ampere) geladen werden.<br />
Das sollte man wissen, da viele Benutzer<br />
keine 24-Volt-Versorgungsquelle nutzen<br />
kön nen. Auch am Modellteich hat man in<br />
der Regel oft nur 12 Volt zur Verfügung.<br />
Bei einer Eingangsspannung von 15 Volt<br />
steht schon eine Ladeleistung von 525 Watt<br />
bereit, sofern nur ein Ladeausgang benutzt<br />
wird.<br />
Der Entladestrom ist ebenso für alle Akkutypen<br />
von 0,05 bis 30 Ampere (50 Ampere<br />
im Synchronmodus) einstellbar, und das bei<br />
einer max. Entladeleistung von 130 Watt (2 x<br />
65 Watt). Wird nur ein Ausgang benutzt, haben<br />
wir eine Entladeleistung von 80 Watt<br />
zur Verfügung. Die durchgeführten Messungen<br />
der Entladeleistung korrespondierten<br />
gut mit den von Junsi angegebenen Werten.<br />
Bei voller Entladeleistung liegt die innere<br />
Temperatur des Laders bei etwa 50 °C. Die<br />
wirkungsvollen Lüfter werden nur zugeschaltet<br />
(Einsetzpunkt von 30–50 °C einstellbar)<br />
und in der Drehzahl geregelt, falls es<br />
notwendig ist. Nur bei sehr hoher bzw. max.<br />
Drehzahl sind sie gut zu hören.<br />
Für NiCd-/NiMH- und Blei-Akkus stehen<br />
die Modi Normal- und Reflex-Laden, Ent la -<br />
den und Zyklen zur Wahl, für NiZn-Akkus<br />
Laden, Entladen und Zyklen. Bei den Lithium-Modi<br />
kann man sich zwischen Laden<br />
im Balance- oder Non-Balance-Mode, Storage-Mode,<br />
Entlade-Mode und Zyklen entscheiden,<br />
dazu gibt es ein sicherlich sehr interessantes<br />
Feature, nämlich Balance only.<br />
In diesem Modus können die Balancer die<br />
Lithium-Zellen autark angleichen, ohne dass<br />
ein Lade-/Entlade-Vorgang läuft.<br />
LiPo-Advanced<br />
Für die meisten Benutzer reichen die Grundeinstellungen<br />
auch für Li-Akkus vollkom -<br />
men aus. Diejenigen Spezialisten, die gerne<br />
möglichst viel selber einstellen (und speichern)<br />
wollen, haben im LiPo-Charge-Setup<br />
alles zur Verfügung.<br />
Für die Pflege von Li-Akkus ist das Storage-Programm<br />
unentbehrlich: Hier kön -<br />
nen nicht nur die Lagerungsspannung pro<br />
Zelle, sondern auch noch die „Kompensation“<br />
(0,0 bis 0,2 Volt in 0,01-V-Schritten)<br />
und ein beschleunigter Lagerungsvorgang<br />
eingestellt werden. Für alle Akkutypen steht<br />
noch ein Lade-Sicherheits-Setup zur Verfügung:<br />
Abschalttemperatur (20–80 °C), max.<br />
Kapazität (50 bis 200 %) und Sicherheits -<br />
timer (aus, 1–9999 min).<br />
Sind LiPo-Zellen zu tief entladen, verweigern<br />
manche Lader die Ladung. Der 308<br />
DUO hat für solche Fälle im LiPo-Chargea:<br />
Neun Speicher, in<br />
denen sich die selbst<br />
erstellten Programme<br />
befinden<br />
b: Hier die sechs selbst<br />
erstellten Akku-Programme<br />
(von 08–13)<br />
c: Die selbst erstellten<br />
Akku-Programme<br />
können editiert,<br />
sortiert, kopiert, neu<br />
erstellt und gelöscht<br />
werden<br />
a: Nach Anlegen der Betriebsspannung<br />
erscheinen im Display das iCharger-<br />
Logo, der Name des Geräts, die Software-Versionsnummer,<br />
Seriennummer,<br />
Eingangs-Spannung und -Quelle<br />
b: Nach ca. 5 sec erscheint das Haupt-<br />
Menü mit Informations-Display für CH 1<br />
und CH 2 und Status-Anzeige<br />
c: Mit einem längeren Druck auf die Tab/<br />
Sys-Taste gelangen wir zum System-<br />
Menü, wo wir die entsprechenden<br />
Lader-Einstellungen vornehmen können,<br />
z. B. Temperatur und Lüfter, Piepstöne,<br />
Displaykontrast und -helligkeit<br />
usw. Außerdem stehen noch drei Extrafunktionen<br />
zur Verfügung<br />
d: In der Save & Load-Configuration werden<br />
die selbst erstellten Akkupro -<br />
gramme (Konfigurationen) auf der<br />
SD-Karte gespeichert bzw. von der SD-<br />
Karte oder den Default-Konfigurationen<br />
heruntergeladen<br />
e: Hier stehen sieben Akkutypen-Programme<br />
zur Wahl bereit (NiZn nicht<br />
sichtbar). Diese Programme unterscheiden<br />
sich von selbst erstellten Programmen<br />
dadurch, dass sie in der Anzeige<br />
unterstrichen sind. Diese Programme<br />
können editiert, sortiert und neu erstellt<br />
werden, die Funktionen Löschen<br />
und Kopieren sind gesperrt.<br />
56
Diagramm 1 Diagramm 2<br />
Bei den Lade-/Entlade-Vorgängen<br />
werden alle wichtigen Daten<br />
auf drei Displayfenstern Zellen,<br />
IR und Info angezeigt<br />
Setup noch ein erweitertes Programm im<br />
Ärmel: LiPo-AdvancedSetup. Hier können<br />
der niedrigste Wiederherstellungs-Spannungswert<br />
(0,5–2,5 Volt), Ladezeit (1–5 min)<br />
und Ladestrom (0,02–0,5 Ampere) eingestellt<br />
werden. Dazu kann noch gewählt werden,<br />
ob anschließend eine Normalladung erfolgen<br />
soll.<br />
Nachfolgend noch einige interessante<br />
Features und Fakten.<br />
Sofort nach Einstecken des Balancer -<br />
kabels am Lader können die Einzelzellen-<br />
Spannungen und deren max. Differenz abgelesen<br />
werden (LiPo-Checker-Funktion).<br />
Will man auch noch den Innenwiderstand<br />
des Akkus und der Einzelzellen erfahren,<br />
schließt man zusätzlich noch die Akkukabel<br />
an und drückt die betreffende Status-Taste<br />
länger als zwei Sekunden. Nach einigen<br />
Sekunden haben wir alles auf dem Display:<br />
Innenwiderstand jeder Zelle, Gesamt-Innenwiderstand<br />
aller Zellen und Akku-Innen -<br />
widerstand (inkl. Akkukabel-Innenwider -<br />
stand).<br />
Zellendrift<br />
Während des Lade-/Entladevorgangs, kön -<br />
nen durch längeres Drücken der zugehö ri -<br />
gen Status-Taste der Lade-/Entladestrom<br />
und die Entladespannung, falls gewünscht,<br />
neu eingestellt bzw. korrigiert werden.<br />
Die Genauigkeit der Spannungsanzeige<br />
und des Ladestroms ist bei unserem Testmuster<br />
sehr gut. Auch die Anzeige der Einzelzellenspannungen<br />
(Auflösung 0,001 V)<br />
ist sehr genau, unser Messinstrument zeigte<br />
lediglich eine Differenz von +1 mV!<br />
In Diagramm 1 sind die Ladekurven eines<br />
3300er-6s-LiPo-Akkus abgebildet. Dia -<br />
gramm Im LiPo-Charge-Setup wurden folgende<br />
Parameter eingestellt: Balancen Nor-<br />
SPANNUNGSWERTE<br />
Entlade-, Lade- und Storagespannungen für verschiedene Zellentypen<br />
Zellentyp Entlade-Endspannung Lade-Endspannung Storage-Spannung<br />
LiFe 2,00–3,50 3,30–3,80 3,10–3,40<br />
LiIo 2,50–4,00 3,75–4,35 3,60–3,80<br />
LiPo 3,00–4,10 3,85–4,35 3,70–3,90<br />
mal, Balancer Start CV – 0,2 V, und Lade-<br />
Ende bei 10 % des Ladestroms. Beim<br />
Ladestart haben wir noch eine Zellendrift<br />
von ca. 140 mV. Deutlich zu sehen ist, wie<br />
der Lader ab einer Zellenspannung von 4,0<br />
V (CV – 0,2 V), die Zellen angleicht und ab<br />
etwa 4,18 V die Zellen trichterförmig genau<br />
auf 4,20 Volt angleicht. Bei einem Rest-Ladestrom<br />
von ca. 0,33 Ampere (10 %) wird der<br />
Ladevorgang beendet. In der LogView-<br />
Tabelle kontrollieren wir die Ladeendspannung<br />
der Einzelzellen: 4,199; 4,199; 4,200;<br />
4,200; 4,119; 4,119 Volt. Am Ladeende haben<br />
wir perfekt ausbalancierte Zellen mit einer<br />
maximalen Spannungsdifferenz von nur 1<br />
mV. Das kann sich sehen lassen – hervorragend!<br />
In Diagramm 2 sind die Ladekurven eines<br />
10000er-8s LiNANO(LiFe)-Akkus abge -<br />
bildet. ´In der LogView Tabelle kontrollieren<br />
wir die Ladeendspannung der Einzelzellen:<br />
3,597; 3,598; 3,597; 3,600; 3,597; 3,598, 3,597;<br />
3,597 Volt. Zellendifferenz = 3 mV – Nicht<br />
schlecht für einen 10000er-8s-LiNANO-<br />
Akku. Die kräftigen Balancer-Stufen erledigen<br />
ihre Arbeit also tadellos.<br />
n<br />
Fazit<br />
Was wir schon über seinen größeren und<br />
stärkeren Genossen (iCharger 4010 DUO)<br />
geschrieben haben, gilt auch für den kleineren<br />
iCharger 308 DUO: Ein professionelles Lade -<br />
gerät mit zwei starken und autarken Lade -<br />
ausgängen, starken integrierten Balancern,<br />
einer Lade- bzw. Entladeleistung von 1300 Watt<br />
bzw. 120 Watt und einer umfangreichen Hardund<br />
Software.<br />
Durch die weit einstellbaren Strombereiche<br />
ist der Lader sowohl für kleine Sender- und<br />
Empfängerakkus als auch für die Ladung<br />
und Pflege von großen LiPo- und LiFe-Akkus<br />
geeignet. Der iCharger 308 DUO ist inzwischen<br />
mein Favorit und somit Referenz-Lader ge -<br />
worden. Ein hervorragendes Ladegerät für alle<br />
Lader-Freaks, welche nicht nur die üppige<br />
Leistung für ihre großen Akkus benötigen,<br />
sondern auch alles selbst einstellen wollen.<br />
Ein von Profis für anspruchsvolle Modellbauer<br />
konzipierter Lader und das für einen außer -<br />
ordentlich günstigen Preis von knapp 270 Euro.<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
57
TECHNIK<br />
Blackhorse-Lipo Akkus<br />
NEUE BLACKHORSE-LIPO-AKKUS<br />
Mehr<br />
Power<br />
Etikettenschwindel ist im Bereich der LiPo-Akkus leider<br />
ein weit verbreitetes Übel: Nur selten ist auch wirklich<br />
das drin, was drauf steht. Die neuen Blackhorse-LiPos<br />
hingegen konnten mit sehr guter Performance glänzen.<br />
TEXT UND FOTOS: Peter Koller<br />
Diagramm 1<br />
Die Dauerlastmessungen in den Diagrammen 1<br />
bis 4 zeigen die Dauerstromentnahmen aller<br />
Packs mit Belastungen von 10 bis 30C. Diagramm<br />
1 bescheinigt den 1800er-Packs bei<br />
diesen Belastungen (18 bis 54 Acc) eine durchweg<br />
gute Spannungslage Um von 3,708 V bis<br />
3,55 V/Z. Entsprechend der vereinbarten Vorgabe,<br />
nur bis zum Erreichen der Nennkapazität<br />
zu entladen und auch die Temperaturgrenze<br />
von max. 65 °C während der Stromentnahme<br />
nicht zu überschreiten, wurde die 30C-Entladung<br />
bei 95 % E.T. „automatisch“ abgebrochen.<br />
Dadurch wurde die Nennkapazität von 1800<br />
mAh geringfügig (– 5 %) unterschritten, was<br />
aber bei derart hohen Strömen nahe der Belastungsgrenze<br />
vernachlässigbar ist.<br />
58
TECHNISCHE DATEN<br />
Blackhorse-LiPo-Akkus<br />
Nennkapazität 1800 mAh 3300 mAh 3700 mAh 4200 mAh<br />
Energiedichte b. 10C 133,6 Wh/kg 131,6 Wh/kg 132,2 Wh/kg 128,2 Wh/kg<br />
Energiedichte b. 20C 130,2 Wh/kg 128,3 Wh/kg 128,8 Wh/kg 124,8 Wh/kg<br />
DC-Ri/Z, gemittelt 6,05 mΩ 3,31 mΩ 2,91 mΩ 2,45 mΩ<br />
Ladestrom max. 9 A (5C) 16,5 A (5C) 18,5 A (5C) 21 A (5C)<br />
Maße 102 x 35 x 21 mm 137 x 42 x 22 mm 137 x 43 x 24 mm 154 x 45 x 23 mm<br />
Hochstromkabel 14AWG = 2,08 mm² 10AWG = 5,26 mm² 10AWG = 5,26 mm² 8AWG = 8,37 mm²<br />
Länge ca. 105 mm ca. 105 mm ca. 105 mm ca. 105 mm<br />
Zellenableitermaße 12 x 0,18 mm = 2,16 mm² 15 x 0,2 mm = 3 mm² 15 x 0,2 mm = 3 mm² 18 x 0,22mm = 3,93 mm²<br />
Balancerbuchse EHR (2,54-mm-Raster) EHR (2,54-mm-Raster) EHR (2,54-mm-Raster) EHR (2,54-mm-Raster)<br />
Gewicht 150 g mit, 139 g ohne Kabel 278 g mit, 261 g ohne Kabel 311 g mit, 292 g ohne Kabel 366 g mit, 345 g ohne Kabel<br />
Preis 26,99 € 46,99 € 57,99 € 64,99 €<br />
Erklärung einiger Abkürzungen: Acc = Konstantstrom, DC-Ri = Gleichstrominnenwiderstand, D.O.D. oder E.T. = Entladetiefe, Im = mittlerer<br />
Entladestrom, Um = mittlere Entladespannung, Ue = Entladeschlussspannung<br />
Fabian Schwaiger, der Inhaber der<br />
Firma Blackhorselipo, führt in seinem<br />
Shop neben LiPos aller Art und Leistungsklassen<br />
seit geraumer Zeit auch Zubehör,<br />
wie Lader, Netzteile und diverse Messgeräte.<br />
Speziell hat er sich aber auf die<br />
Fahnen geschrieben, qualitativ hochwertige<br />
Akkupacks aus selbst vermessenen Einzelzellen<br />
zu konfektionieren. Es werden also<br />
keinesfalls 08/15-Akkus angeboten. Aus der<br />
neuen 35C-LiPo-Serie wurden mir je zwei 3s-<br />
Packs mit Kapazitäten von 1800, 3300, 3700<br />
und 4200 mAh zu ausführlichen Hochstromtests<br />
übergeben.<br />
Alle LiPo-Packs wurden direkt nach der<br />
Lieferung auf Lagerspannung überprüft, die<br />
mit ~ 3,85 V/Z der Herstellernorm entsprach.<br />
Dem heute üblichen Standard entspre-<br />
chend, sind die 3s-Packs ordentlich konfektioniert<br />
und der Länge nach mit solidem<br />
Kunststoffband umschlossen. Zwischen den<br />
Ableiterfahnen der Einzelzellen verhindert<br />
isolierendes Material und Kaptonband Kurzschlüsse,<br />
zusätzlich werden die Kopf- und<br />
Fußseiten mit Polstermaterial vor Stoßbelastungen<br />
geschützt. Selbstverständlich ist<br />
alles sauber eingeschrumpft. Die Balancerund<br />
Hochstromkabel sind gegenüber -<br />
liegend herausgeführt. Der Querschnitt der<br />
ca. 10,5 cm langen, hochflexiblen Silicon-<br />
Hochstromkabel ist für alle Packs absolut<br />
lastgerecht dimensioniert. Die 4200er-Packs<br />
sind mit 8AWG(= 8,36 mm²)-Hochstromkabel<br />
sogar außergewöhnlich gut ausgestattet!<br />
Die Balancerkabel, ebenfalls in geschmeidiger<br />
Silicon-Ausführung, sind etwa<br />
Händleradresse<br />
Inh. Fabian Schwaiger<br />
Schmellerstraße 21<br />
80337 München<br />
Tel, 089/46224240<br />
www.blackhorselipo.de<br />
office@blackhorselipo.de<br />
Diagramm 2<br />
Diese Übersicht (3300er-<br />
Packs) zeigt bei gleichem<br />
Belastungsmuster eine<br />
ähnlich gute Performance:<br />
Top-Spannungslage von<br />
Um 3,698 V/Z bei 10C und<br />
immerhin noch Um 3,534<br />
V/Z bei 30C. Allerdings sind<br />
auch hier leichte „Abstriche“,<br />
wie schon bei Diagramm<br />
1 erwähnt, während<br />
der 30C-Entladung zu<br />
verzeichnen. Hier wurden<br />
bis zur Temperaturabschaltung<br />
immerhin noch 94,66<br />
% Entladetiefe, also 3124<br />
mAh erreicht.<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
59
TECHNIK<br />
Blackhorse-Lipo Akkus<br />
So wurde getestet<br />
Basis für LiPo und LiFe-Testmessungen<br />
ist eine praxisorientierte<br />
Methode, wobei die Impulsmessungen<br />
u. a. dem Belastungsmuster in<br />
stark motorisierten Modellen<br />
angenähert werden.<br />
Zuerst erfolgt eine Konditionierung<br />
der neuen Zellen, wobei mit 0,5C<br />
geladen wird und anschließend<br />
jeweils eine Entladung mit 2C, 4C,<br />
6C, 8C und 10C erfolgt.<br />
Nach der Konditionierung erfolgt die<br />
Ladung jeweils mit 1C oder eventuell<br />
höheren Laderaten, sofern der<br />
Hersteller diese frei gibt. Nach 10<br />
Minuten oder entsprechend angegebener<br />
Ruhezeit, die vom Zellentyp<br />
abhängig ist, erfolgt die jeweilige<br />
Entladung für die entsprechenden<br />
Messreihen.<br />
Alle Entladungen erfolgen grundsätzlich<br />
an einer Stromsenke<br />
(elektronische Last) mit Konstantstrom<br />
(Acc).<br />
Bis 10C Belastung werden die<br />
Messungen bei 3,3 Volt/Zelle (LiPo)<br />
und 2,5V/Zelle (LiFe) beendet. Über<br />
10C (auch bei Impulsbelastungen)<br />
wird nach Möglichkeit (Temperaturverlauf)<br />
bis 3,2 Volt/Zelle (LiPo) und<br />
2,25 Volt/Zelle (LiFe) entladen.<br />
Bei Temperaturen über 65 °C wird<br />
die Messung abgebrochen, da eine<br />
höhere Temperatur den LiPos/LiFes<br />
dauerhaften Schaden zufügt. Der<br />
Gleichstrominnenwiderstand wird<br />
entweder bei 50 % Entladetiefe<br />
ermittelt oder es wird aus mehreren<br />
Hochstromimpulsen der Mittelwert<br />
aus ∅U / ∅I, gebildet. Die jeweils<br />
angewandte Methode ist aus den<br />
Diagrammen ersichtlich (∅U / ∅I<br />
bedeutet Spannungsdifferenz durch<br />
Stromdifferenz).<br />
Grundsätzlich werden die auf den<br />
Diagrammen dargestellten Spannungen<br />
immer auf eine Zelle normiert.<br />
5,5 cm lang und enden in einer 2,54-mm-<br />
Raster-EHR-Buchse (Graupner, robbe etc.).<br />
Der max. zulässige Ladestrom wird für alle<br />
Packs mit 5C angegeben, wobei dieser im<br />
Verlauf dieses Tests jedoch nur bis 2C ausgereizt<br />
wurde. Die Verarbeitung ist<br />
insgesamt betrachtet astrein.<br />
Zwischenüberschrift<br />
Die Hochstrommessungen wurden erst<br />
nach den üblichen Konditionierungszyklen<br />
vorgenommen. Das aktuelle Testprozedere<br />
wird im Text-Kasten unter der Überschrift<br />
„So testet die Redaktion“ erläutert.<br />
Zur besseren Übersicht und Vergleichbarkeit<br />
sind alle Packspannungen auf eine<br />
Zelle heruntergerechnet bzw. normiert. Außerdem<br />
tauchen in den Legendeneinträgen<br />
der Diagramme zu den Endtemperaturen<br />
zwei Werte auf. Die erste Temp.-Angabe entspricht<br />
der Abschalttemperatur zum Entladeschluss,<br />
die zweite Angabe ist die maximal<br />
erreichte „Nachglühtemperatur“, die je nach<br />
Stromentnahme variieren kann, bzw. bei<br />
entsprechender Zwangskühlung im Modell<br />
gar nicht auftreten muss! Außerdem sind<br />
für alle, die es ganz genau interessiert, die<br />
Temperaturwerte bei 50, 70, 80 und 90 %<br />
Entladetiefe auf den Dauerlastdiagrammen<br />
notiert. n<br />
DER AUTOR<br />
Peter Koller beantwortet weitere Fragen unter<br />
p.koller@ahlencom.biz<br />
Ein solcher Akku-Pass liegt jedem LiPo bei<br />
Fazit<br />
Bei den Akkus der Fa. Blackhorslipo handelt<br />
es sich um qualitativ hochwertige Ware. Während<br />
aller Messungen gab es sehr wenig zu<br />
beanstanden. Von den kleinen 1800er-Zellen<br />
mal abgesehen, überraschten alle Probanden<br />
mit durchweg überdurchschnittlichen Ergebnissen.<br />
Daher sind mit Blick auf die normalen<br />
Modellbauanwendungen allen Packs durchaus<br />
35 bis 40C zu bescheinigen. Also wurde<br />
bei den C-Rates nicht auf den Putz gehauen!<br />
Nachzutragen ist noch der Akkupass, der<br />
jedem ausgelieferten LiPo beigefügt wird. Er<br />
ist ausgefüllt mit Serien-Nummer, Zellenspannungen<br />
bei Auslieferung usw. Allerdings handelt<br />
es sich bei diesen Zellen um keine Billigangebote,<br />
Qualität hat nun mal ihren Preis!<br />
Wegen der erfreulich guten Ergebnisse lautet<br />
mein Fazit: sehr gut!<br />
Diagramm 3<br />
Hier (3700er Packs) weicht<br />
es prinzipiell nur in Kleinigkeiten<br />
von den vorherigen<br />
Diagrammen ab. Einerseits<br />
wurden hier alle Belastungen<br />
bis 30C (111 Acc) ohne<br />
„Übertemperatur“ (>65 °C)<br />
und die Nennkapazität bei<br />
ausgezeichneter mittlerer<br />
Spannungslage von Um<br />
3,521 V/Z erreicht! Andererseits<br />
fällt jedem Akkufachmann<br />
der bis kurz vor 100 %<br />
E.T. (Nennkapazitätsende)<br />
relativ gleichförmige Spannungsverlauf<br />
auf, vor allem<br />
der extrem langsame Spannungsabfall<br />
innerhalb der<br />
letzten 10 % Entladetiefe).<br />
60
Diagramm 4<br />
Das Diagramm (4200er-<br />
Packs) zeigt bei gleichen<br />
Belastungen die relativ<br />
beste Spannungslage Um<br />
von 3,725 V/Z bis 3,54 V/Z<br />
während aller Entladungen.<br />
Anhand der bis knapp vor<br />
der Abschaltung nahezu<br />
linear verlaufenden Spannungskurve<br />
erkennt nicht<br />
nur der Fachmann, welch<br />
ein Potenzial in diesen<br />
Zellen steckt! Wodurch klar<br />
sein sollte, dass hier deutlich<br />
mehr Kapazitätsreserven<br />
vorhanden sind, die<br />
(von den 1800-mAh-Packs<br />
mal abgesehen) mit + 5 bis<br />
8 % bei den anderen Packs<br />
zu Buche schlagen!<br />
Pulslastentladungen offenbaren<br />
anhand der Spannungseinbrüche<br />
während<br />
der Höchststromimpulse<br />
die „wahre“ Qualität jeder<br />
Zelle<br />
Diagramm 5<br />
Hier sind alle Kapazitäten bzw. Packs von 1800 bis 4200<br />
mAh mit Spannungslage und Stromverlauf gemeinsam<br />
aufgeführt. Damit alle Packs gleichzeitig auf einem Diagramm<br />
dargestellt werden können, muss der Strom jedes<br />
Packs bzw. jeder Zelle (Y-Achse im Diagramm) in entsprechende<br />
C-Rates umgerechnet werden. Das heißt, alle<br />
Spannungsverläufe entsprechen den in den C-Rates angegebenen<br />
Strömen. Bei den 10/50C-Pulslasten fällt erfreulicherweise<br />
keiner der Probanden durch extrem tiefe Spannungseinbrüche<br />
auf. Ganz im Gegenteil, die ersten, tiefsten<br />
Spannungseinbrüche liegen um 3,36 V/Z, (für alle Zellen)<br />
bei einer 5,5s dauernden 50C-Pulslast. Ein außergewöhnlich<br />
starkes Ergebnis!<br />
Beim ersten Blick auf den Spannungsverlauf sticht die<br />
Homogenität aller Zellenspannungen über fast den gesamten<br />
Entladeverlauf positiv ins Auge. Die sehr kleinen<br />
Unterschiede während der letzten paar Sekunden der<br />
Entladung sind den Überkapazitäten einiger Packs geschuldet,<br />
da bei diesen Messungen nicht nach „Nennkapazität“,<br />
sondern nur nach Endspannung der jeweiligen<br />
Packs abgeschaltet wurde!<br />
Vergleicht man die einzelnen Ent ladekurven, erkennt man,<br />
dass dermaßen homogen übereinstimmende Zellen nicht<br />
aus einer „normalen“ Serienpro duktion stammen können.<br />
Da hat die Firma Blackhorselipo ihre selektierenden Finger<br />
positiv ins Spiel gebracht!<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
61
RC TECHNIK Umrüstung Graupner FM 4014<br />
UMRÜSTUNG GRAUPNER FM 4014 AUF JETI 2,4 GHZ<br />
Neuer Wein<br />
in alten Schläuchen<br />
2,4 GHz sind derzeit angesagt. Aber es muss kein<br />
Neukauf sein, sogar sehr betagte MHz-Sender lassen<br />
sich auf die neue Über tragungsechnik umrüsten.<br />
TEXT UND FOTOS: Peter Kohnke<br />
Schon mal ein fremdgesteuertes Schiff<br />
gesehen? Auf einer Modellbauver -<br />
anstaltung in Neumünster, wurde<br />
mein Modell beim Nachtfahren im Stadtbad<br />
leider nicht nur fern- sondern vor allem auch<br />
fremd gesteuert: Die Beleuchtung spielte verrückt,<br />
das Boot fuhr unkontrolliert auf dem<br />
Wasser und ich war heilfroh, dass es nicht<br />
zu Zusammenstößen mit anderen Modellen<br />
kam. Natürlich hatte ich mir vor dem Fahren<br />
das entsprechende „Kanaltäfelchen“ bei der<br />
Veranstaltungsleitung geholt, doch offensichtlich<br />
hatte sich irgendein Kollege nicht<br />
an die Frequenzdisziplin gehalten und war<br />
auf demselben Kanal unterwegs wie ich. Die<br />
Kollegen, die schon mit 2,4 GHz unterwegs<br />
waren, hatten solche Probleme nicht, Funke<br />
an und los ging’s.<br />
Folglich wuchs auch in mir der Wunsch<br />
nach einer Umrüstung auf 2,4 GHz. In den<br />
verschiedensten Internet-Foren wurden die<br />
Umrüst-Module der Fa. JETI allgemein empfohlen,<br />
doch gingen die Meinungen hinsichtlich<br />
der Nutzbarkeit mit den Graupner<br />
Nautic-Expert-Schaltbausteinen weit auseinander:<br />
Von „Geht“ bis „Geht nicht“ war alles<br />
dabei. Festzustellen ist aber, dass grundsätzlich<br />
nur PPM-Modulation von den JETI-Modulen<br />
unterstützt wird, mit PCM funktioniert<br />
das nicht. Eine PCM-Anlage muss folglich<br />
auf PPM umstellbar sein, damit man die<br />
JETI-Module benutzen kann.<br />
Dann habe ich einen in Fernsteuer -<br />
technik versierten Modellbaukollegen kennen<br />
gelernt, der mir mitteilte, dass man die<br />
Nautic-Expert-Schaltbausteine mit den JETI-<br />
Modulen betreiben könnte, man benötige<br />
aber die sog. Jetibox, um entsprechende Programmierungen<br />
durchzuführen.<br />
Neue JETI-Module waren mir erstmal zu<br />
teuer, also habe ich mich in einem Internetauktionshaus<br />
umgeschaut – und schon nach<br />
kurzer Zeit nannte ich ein JETI-TU-Modul,<br />
einen R8-Empfänger und eine Minibox<br />
mein Eigen. Jetzt ging es erst einmal an die<br />
Mechanik. Am Sender habe ich eine Abdeckung<br />
für den MHz/GHz-Sicherheitsumschalter<br />
angefertigt, dann wurden Löcher für<br />
die Antenne und die Minibox gesetzt und<br />
der Staub von der Anlage runtergeputzt. Abdeckungen<br />
wurden entfernt, um sie neu zu<br />
lackieren.<br />
Vom Wunsch zur Tat<br />
Mit der Unterstützung meines Kollegen ging<br />
es nun mit dem elektronischen Teil des Umbaus<br />
los.<br />
Das eigentliche Umrüsten auf das ältere<br />
TU-Modul (das aktuelle Modul TU2 ist der<br />
Nachfolger) war einfach: Den Stecker des<br />
HF-Teils von der NF-Platine abziehen und<br />
dort den JETI-Sicherheitsumschalter einstecken.<br />
Dann die andere Schalterkabelseite mit<br />
dem Input-Platz auf dem TU-Modul verbinden,<br />
den NF-Out mit dem 40-MHz-HF Stecker<br />
zusammenstöpseln, fertig! Die ganze<br />
Aktion hat keine fünf Minuten gedauert und<br />
nun kann ich ganz nach Bedarf entweder auf<br />
MHz oder auf GHz senden. Jetzt noch<br />
schnell den Empfänger gebunden und dann<br />
ran an die Empfängerprogrammierung.<br />
Unter dem Menüpunkt „Main Settings“<br />
wurde die „Output Period“ von 20 ms Standardwert<br />
auf „By Transmitter“ geändert. Unter<br />
„Channel Set“ wurde die Neutrallage<br />
der Kanäle des Senders, die von den 1,5 ms<br />
etwas abweichen, angeglichen. Für die Kanäle,<br />
auf denen ich Servos und Drehzahl-<br />
Der FM 4014-Sender kann den<br />
Umbau auf 2,4 GHz nicht verhehlen:<br />
In den Blick fallen die<br />
doppelte Antennen anlage,<br />
der mittige Umschalter und<br />
die JETI-Minibox links unten<br />
62
steller anschließen wollte, war damit die Programmierung<br />
abgeschlossen.<br />
Für den Kanal, auf dem ich den Nautic-<br />
Expert-Schaltbaustein (Graupner Best.-Nr.<br />
4159) betreiben wollte, musste unter „Set<br />
Output Pin“ das ATV HighLimit auf 2,2 ms<br />
erhöht und das ATV LowLimit auf 0,8 ms<br />
abgesenkt werden.<br />
Das sollte es gewesen sein. Und was<br />
machte nun mein Nautic-Expert-Schaltbaustein?<br />
Leider nicht das, was er sollte! Wir<br />
schauten uns ratlos an.<br />
Probleme beim Schaltbaustein<br />
Die Schalter-Stellungen A, B und C nach<br />
oben wurden nicht korrekt erkannt, die Ausgänge<br />
flackerten nur. Eine Erklärung und<br />
vor allem der Fehler musste gefunden werden.<br />
Also haben wir einen Testaufbau in<br />
Form von zwei LEDs und einem Widerstand<br />
angefertigt und dieser wurde auf einem<br />
anderen Nautic-Expert-Schaltbaustein Aus -<br />
gang für Ausgang gesteckt. Komisch, dieser,<br />
für eine spätere Verwendung schon einmal<br />
angeschaffte Schaltbaustein funktionierte<br />
tadellos! Aber warum? Alle anderen Bausteine,<br />
die in den bisherigen Modellen ihre<br />
Dienste verrichten, flackerten nur. Aufschrauben!<br />
Aha, so sehen also die nicht korrekt<br />
funktionierenden Schaltbausteine von<br />
innen aus. Beim Betrachten des korrekt<br />
funktionierenden Exemplars fielen drei<br />
kleine zusätzliche Bauteile über dem IC links<br />
oben ins Auge. Sollte das Fehlen dieser drei<br />
Bauelemente auf dem „alten“ Schaltbaustein<br />
etwa der Quell des Übels sein?<br />
Nachgehakt<br />
Eine Nachfrage bei der Fa. Graupner wurde<br />
also unumgänglich. Nach ein paar gewechselten<br />
E-Mails bekam ich eine Serviceadresse<br />
genannt und sollte meine Module zum<br />
Nachrüsten einsenden. Allerdings teilte man<br />
mir mit, dass Graupner trotzdem<br />
keine Garantie geben<br />
würde, dass die modifi zier -<br />
ten Schaltbausteine auch<br />
mit der 2,4-GHz-JETI-Umrüstung<br />
funktionieren würden.<br />
Gut, das ist verständ -<br />
lich. Drei Wochen später<br />
waren die beiden nachge rüs -<br />
teten Module wieder bei mir<br />
(Kosten punkt 54 Euro) und die<br />
Spannung war groß.<br />
Von den beiden Modulen funktio -<br />
niert nur eines problemlos an meinem JETI-<br />
Umbau, das andere nicht. Also nur ein Teilerfolg,<br />
wobei festzustellen bleibt, dass die<br />
aktuellen Nautic-Expert-Schaltbausteine generell<br />
GHz-tauglich sind. (Siehe hierzu auch<br />
die Hinweise in zurückliegenden Heften der<br />
<strong>SchiffsModell</strong>, z. B. 6/2012.)<br />
Module für angemessene Preise<br />
Gibt es vielleicht für meinen Fall irgendwelche<br />
Alternativen? Beim Stöbern im Internet<br />
bin ich auf den 16-K-Multiswitch- Decoder<br />
2 A für Graupner Encoder (4108) von der<br />
Firma GPK Elektronik + Modellbau ge -<br />
stoßen. Dort gibt es empfängerseitige Mo -<br />
dule für einen wirklich angemessenen Preis.<br />
Als ich auf die Frage nach der Graupner-<br />
JETI-Kompatibi lität auch noch ein klares „Ja“<br />
erhielt, wurde solch ein Baustein geordert.<br />
Das Modul musste noch auf die Sender -<br />
impulslänge eingestellt werden, was aber<br />
problemlos war. Zudem bietet dieses Modul<br />
noch die nicht zu vernachlässigende Option,<br />
die 16 Schaltausgänge mit einer Memoryfunktion<br />
programmieren zu können! n<br />
DER AUTOR<br />
Peter Kohnke gibt ausführliche Informationen<br />
unter Peter.Kohnke@t-online.de<br />
Fazit<br />
Der weiße Stecker<br />
mit den drei<br />
weißen und<br />
dem roten Kabel<br />
auf der Hauptplatine<br />
ist der<br />
Verbindungs -<br />
stecker zwischen<br />
dem NF- und dem<br />
HF-Teil. Er führt<br />
das PPM-Signal,<br />
Minus, Plus und NC.<br />
Ganz bewusst wollte ich in diesem<br />
Beitrag die Höhen und Tiefen beim Umbau<br />
auf GHz beschreiben. Generell ist<br />
die Umrüstung einer „alten“ Fernsteuerung<br />
auf 2,4 GHz nicht sonderlich<br />
schwierig. Die Pinbelegung musste ich in<br />
meinem Fall durch die genau passenden<br />
Kabel nicht einmal überprüfen, ansonsten<br />
muss das natürlich gemacht werden.<br />
Bei der Verwendung von Kanalexpandern<br />
wie z. B. den Graupner<br />
Nautic-Expert-Schaltbausteinen kann es<br />
hingegen zu Problemen kommen, wenn<br />
man noch Bausteine früherer Baujahre<br />
verwenden möchte. Da hilft dann u. U.<br />
nur Ausprobieren und die Umrüstung<br />
beim Service. Aber mit dem Modul von<br />
GPK Elektronik + Modellbau gibt es ja<br />
eine Alternative!<br />
Für diejenigen Modellschiffskapitäne, die<br />
ohne Multi-Switch-Bausteine auskommen,<br />
ist es aber sicher einfacher, eine<br />
neue preiswerte 2,4-GHz-Anlage zu<br />
kaufen. Dann kann man wieder problemlos<br />
fahren, ohne sich um Kanaltafeln und<br />
undisziplinierte Kollegen kümmern zu<br />
müssen.<br />
Innenleben des Schaltbausteins der<br />
neuen Generation (rechts an einem<br />
Ausgang die LED-Testschaltung)<br />
So sehen meine Schaltbausteine der<br />
alten Generation nach dem Aufenthalt<br />
beim Graupner-Service aus<br />
Rechts unter der Steuerknüppeleinheit ist das<br />
JETI-TU-Modul zu sehen. Die Anlage wird schon<br />
lange mit einem 3s-LiPo-Akku betrieben<br />
63
SPECIALS U-Boot Typ XXIII<br />
Kollege einen Plastikbausatz der Fa. Bronco<br />
für das deutsche U-Boot vom Typ XXIII an<br />
den See mitbrachte. Dieser Bausatz im Maßstab<br />
1:35 ist hinsichtlich der Details hervorragend<br />
und die Länge des Modells von 991 mm<br />
schreit förmlich nach dem Ausbau zu einem<br />
Funktionsmodell. Also habe ich mir noch<br />
am selben Tag online einen dieser Bausätze<br />
bestellt.<br />
Das Modell<br />
Nachdem der Bausatz angekommen war,<br />
musste ich mich entscheiden, ob es ein Einhüllen-<br />
oder ein Zweihüllenboot werden<br />
sollte. Ich wollte auf jeden Fall die Ausfahrgeräte<br />
funktionstüchtig gestalten. Das hätte<br />
auf jeden Fall eine Gewichtszunahme des<br />
Während der Beschäftigung<br />
mit größeren Projekten benötige<br />
ich zwischendurch<br />
oft mal einen kleinen Tapetenwechsel.<br />
Nach so einer Abwechslung<br />
mit einem einfacheren Objekt ist<br />
es für mich dann leichter, mit frischer Ener -<br />
gie das aufwendigere Boot zu vollenden. Genauso<br />
ein Tapetenwechsel war das hier vorgestellte<br />
Modell vom Typ XXIII.<br />
Ich befand mich gerade mitten im Nachbau<br />
des Forschungs-U-Bootes MAKAKAI,<br />
das mir besonders bei der Realisierung der<br />
speziellen Antriebsanlage Probleme machte.<br />
Da kam es mir gerade recht, dass ein U-Bootohnehin<br />
schon massigen Turms zur Folge<br />
gehabt. Die meisten Typ XXIII-Modelle verhalten<br />
sich im Wasser ohnehin schon sehr<br />
wackelig, also ist es nicht von Vorteil, den<br />
Turm unnötig schwer zu bauen. Da der Turm<br />
im Bausatz aus sehr dünnem Polystyrol besteht,<br />
fallen später, im getauchten Zustand,<br />
aber nur die zusätzlichen Metallteile ins Gewicht.<br />
Deswegen konnte ich mein Vorhaben<br />
wagen und ein Einhüllenboot konzipieren.<br />
Diese Konstruktion verhilft dem Boot zu<br />
mehr Volumen. Dadurch vergrößert sich<br />
nicht nur der zur Verfügung stehende Einbauraum,<br />
auch die Verdrängung erhöht sich<br />
gegenüber einer Zweihüllen-Konstruktion.<br />
Das Original<br />
Bilder: Wikipedia<br />
Die Boote vom Typ XXIII waren, ebenso wie ihre größeren Schwestern vom Typ XXI, diesel -<br />
elektrische U-Boote, die speziell auf gute Unterwasserfahreigenschaften ausgelegt waren.<br />
Die Boote vom Typ XXIII stehen in der U-Boot-Geschichte<br />
bis heute immer im Schatten des größeren<br />
und bekannteren Typs XXI, der zeitlich fast parallel<br />
entwickelt und gebaut wurde. Vom Typ XXIII wurden<br />
insgesamt 61 Boote gebaut, von denen das erste<br />
als U 2321 am 12. Juni 1944 vom Stapel lief.<br />
30 weitere Boote wurden noch in Dienst gestellt,<br />
die restlichen Boote wurden nicht mehr vollendet.<br />
Der Bootstyp war seiner Zeit weit voraus. Die relativ<br />
geringe Größe hatte ihren Ursprung in der Forderung<br />
nach einer realistischen Transportfähigkeit per<br />
Bahn und Binnenschiff.<br />
Wegen ihrer geringen Größe waren die Boote<br />
schwierig zu orten, zwei Boote wurden auch mit<br />
einer Anti-ASDIC-Schicht überzogen, bekannt als<br />
Alberich-Tarnung. Der E-Motor für den Schleich -<br />
antrieb war schwingungsfrei gelagert und per Keilriemen<br />
mit der Schiffswelle verbunden. Somit<br />
konnte das Boot getaucht bei 4,5 kn Fahrt nicht mit<br />
Horchgeräten erkannt werden. Bei dieser Geschwindigkeit<br />
lag die Reichweite mit einer Akkuladung bei<br />
194 Seemeilen (359 km).<br />
Die Boote vom Typ XXIII waren mit einer Schnorchelanlage<br />
aus gestattet, die auch eine getauchte Fahrt<br />
mit dem Diesel im Volllastbereich zuließ. Die getauchte<br />
Maximalgeschwindigkeit betrug 10,75 kn<br />
und lag damit dank des geringeren Wellenwiderstands<br />
höher als die Geschwindigkeit an der Oberfläche.<br />
Zudem war der Schnorchelkopf mit sog.<br />
Weschmatten ausgestattet, die die Radarortung<br />
erschwerten. Die Radarreflexion des schnorchelnden<br />
Bootes betrug damit nur 10 Prozent gegenüber<br />
der des aufgetaucht fahrenden Bootes. Auf dem<br />
Schnorchel befand sich eine dm-Antenne, die vor<br />
Radarortung warnen konnte.<br />
Ein Nachteil des Typs XXIII war, dass sich die Tauchzellen<br />
ohne Flutkappen bei Seegang langsam fluteten.<br />
Daher war es notwendig von Zeit zu Zeit die<br />
Tanks anzublasen und die Trimmung zu kontrollieren.<br />
Aufgrund des geringen Reserveauftriebs von<br />
10,5 Prozent und wegen der empfind lichem Trimmstabilität<br />
konnten die Boote bei Unachtsamkeit<br />
schnell außer Kontrolle geraten.<br />
Dies war die Ursache für die Unfälle mit U-HAI und<br />
U 2331. Nur diese zwei Boote sind gesunken. Alle<br />
anderen wurden kontrolliert selbst versenkt oder<br />
später von den Alliierten übernommen.<br />
Im Jahr 1956 wurden die Boote vom Typ XXIII für den<br />
Aufbau der Bundesmarine interessant. Für neue<br />
Boote war kein Geld vorhanden und die verbliebenen<br />
Boote vom größeren Typ XXI befanden sich alle<br />
noch im Besitz der Siegermächte. Also suchte man<br />
nach „vergessenen“ U-Booten vom Typ XXIII, die<br />
bei der Selbstversenkung nicht noch zusätzlich<br />
unbrauchbar gemacht worden waren. Man entschied<br />
sich für U 2365 (später U-HAI) und U 2367<br />
(später U-HECHT). Die Suche nach den Booten war<br />
für die Bergungsfirma Bekkedorf nicht einfach,<br />
dennoch konnten sie auf dem Meeresgrund lokalisiert<br />
und gehoben werden. Beide Boote wurden bei<br />
den Kieler Howaldtswerken gereinigt, zerlegt und für<br />
2,5 Mio. DM komplett überholt. Sie erhielten unter<br />
anderem einen neuen Bug, im oberen Bereich mit<br />
dem Angriffssonar M1 der Fa. Atlas und einem stark<br />
vergrößerten Gruppenhorchgerät mit 2 x 24 Kristallempfängern<br />
unter dem Bug. Zusätzlich wurden<br />
Sender und Empfänger einer UT-Anlage hinter den<br />
vorderen Tiefenrudern installiert.<br />
Leider kam es am 14. September 1966 zum<br />
schlimmsten Unfall der Bundesmarine, als U-HAI vor<br />
Helgoland im Sturm aufgrund der langsam voll -<br />
laufenden Tauchzellen sank. Dabei überlebte nur<br />
der Smut. U-HECHT wurde daraufhin am 30. September<br />
1968 außer Dienst gestellt und verschrottet.<br />
64
Platziert man dann noch Ballastblei und<br />
Tauchtank im unteren Bereich des Druckkörpers,<br />
sorgt das für eine günstige Schwerpunktlage,<br />
die den großen Turm wieder<br />
kompensiert. Durch das Einhüllen-Konzept<br />
ergeben sich aber natürlich auch Nachteile,<br />
und hierzu gehört der 8-förmige Druck-körper<br />
des Typ XXIII. Im Bereich der „Taille“ ist<br />
der Druckkörper instabil und kann leicht zerdrückt<br />
werden. Daher muss dieser Bereich<br />
mit dem Technikgerüst abgestützt werden.<br />
Der Vorteil ist, dass das Technikgerüst dadurch<br />
aber als Einschub sehr stabil befestigt<br />
ist.<br />
Da sich dieser Plastikbausatz sehr für einen<br />
Umbau zu einem RC-Modell anbietet,<br />
ging ich davon aus, dass in den nächsten Jahren<br />
etliche dieser Boote auf den U-Boot Treffen<br />
auftauchen würden. Um mich etwas vom<br />
Bausatzmodell zu unterscheiden, änderte<br />
ich einige Details auf das Boot U-HECHT<br />
der Bundesmarine ab. Hierzu erhielt der Bug<br />
sein Sonargerät und weitere Schwinger am<br />
Gruppenhorchgerät. Der Turm verblieb in<br />
der Variante der Anfangsphase von U-<br />
HECHT, so musste nur eine Hecklaterne<br />
eingefügt werden. Der verlängerte Turm der<br />
späteren Version hätte wieder mehr Gewicht<br />
bedeutet.<br />
Vorbereitungen am Bausatz<br />
Ich hatte vor, am Modell Bug und Heck abnehmbar<br />
zu gestalten, wobei am Heckteil<br />
das Technikgerüst direkt angeflanscht wer -<br />
den sollte. Dazu war es sehr praktisch, dass<br />
die Plastik-Rumpfteile mit dünnen Spanten<br />
versehen waren. Diese Spanten verlaufen genau<br />
parallel zur Vertikalen des Bootes, daher<br />
war es eine Leichtigkeit, mit dem Cutter an-<br />
TYP XXIII VON BRONCO MODELS<br />
Zum Hecht<br />
gemacht<br />
Bild: Wikipedia<br />
Der Plastik-Bausatz des U-Boot Typs XXIII eignet<br />
sich aufgrund seiner Abmessungen zum Ausbau<br />
auf RC. Guido Faust suchte gerade nach einer<br />
Ablenkung von einem anderen Projekt, als er auf<br />
das Kit stieß. Um ein individuelles Modell zu haben,<br />
baute er das Bronco-Modell als U-HECHT.<br />
TEXT UND FOTOS: Guido Faust<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
65
SPECIALS<br />
U-Boot Typ XXIII<br />
hand dieser Spanten den Bug und das Heck<br />
abzuschneiden. Ich nutzte beim Heckteil<br />
den vierten und beim Bugteil den dritten<br />
durchgehenden Spant. Die Plastikschotten<br />
habe ich herausgeschnitten und die Spanten<br />
im Mittelteil herausgeschliffen. Zum Auslaminieren<br />
wurden die halben Mittelteile von<br />
außen komplett mit Klebeband geschützt.<br />
Dadurch konnte ich beim Laminieren die<br />
Teile mit klebrigen Fingern anfassen, ohne<br />
die Oberfläche zu beschädigen. Nachdem<br />
die beiden Hälften auslaminiert waren, habe<br />
ich sie direkt zusammengesetzt, mit Sekundenkleber<br />
zusammengeheftet und mit Nahtbändern<br />
nass in nass zusammenlaminiert.<br />
Dazu habe ich den Pinsel mit einem Holz -<br />
stab verlängert und das Glasgewebe auf eine<br />
lange Papierrolle gelegt.<br />
Nach diesem kniffligen Bauabschnitt<br />
fühlte sich der Plastik-Druckkörper schon<br />
wesentlich stabiler an. Um dem Wasser -<br />
druck widerstehen zu können, musste die<br />
Taille des Druckkörpers dennoch verstärkt<br />
werden. Hierzu klebte ich beidseitig U-Pro -<br />
file aus Poystyrol von innen in den Druckkörper<br />
ein. Damit diese auch wirklich paral -<br />
lel zum Rumpf ausgerichtet waren, wurden<br />
sie zuerst mit Knete in Position gebracht und<br />
danach mit Gießharz fixiert. Im Zusammenspiel<br />
mit dem Technikgerüst ist der Plastik -<br />
rumpf jetzt so stabil, dass ihm der Wasserdruck<br />
nichts mehr anhaben kann.<br />
Bug- und Heckverschluss<br />
Um den ovalen Druckkörper perfekt nutzen<br />
zu können, war für mich von Anfang an klar,<br />
dass der Heckverschluss auch oval werden<br />
musste. Erste Überlegungen tendierten zu<br />
einer aufgesetzten O-Ring-Nut, die zusammen<br />
mit der Dichtung auf einen planen Ring<br />
gedrückt wird.<br />
Dieses Prinzip wurde zwar schon in diversen<br />
Modell-U-Booten realisiert, es hat<br />
aber leider den Nachteil starker Zugkräfte<br />
auf dem Technikgerüst. Außerdem muss das<br />
Boot dabei mit einer Schraube im Bug verschlossen<br />
werden. Eine Bajonettlösung ohne<br />
Werkzeug und Zugkräfte gefiel mir besser.<br />
Da der Verschluss bei meinem Boot ja aber<br />
oval werden sollte und ich ihn deswegen<br />
nicht verdrehen konnte, musste ich beide<br />
Verschlusssysteme miteinander kombinieren.<br />
Der Heckverschluss ist folglich herkömmlich:<br />
Ein Einschub mit O-Ring-Nut,<br />
der in einen Ring geschoben wird und von<br />
Teile für den Bugverschluss (links) und die entsprechenden Teile für den Heckverschluss<br />
Neue Gestaltung des Bugbereichs<br />
Ausbau des Heckbereichs<br />
Montierte Bugnase mit Servo<br />
66
muss das Technikgerüst zusammen mit<br />
dem Heckteil eingeschoben, der Bug aufgesteckt<br />
und gerade gedreht werden. Die einzigen<br />
Zugkräfte, die jetzt auf das Technik -<br />
gerüst wirken können, werden durch den<br />
Innendruck des gefluteten Bootes an der<br />
Wasseroberfläche verursacht.<br />
Phantombild des kompletten Bootes (oben) und gesamtes Technikgerüst<br />
selbst abdichtet. Am Einschub des Heckverschlusses<br />
wurde das Technikgerüst direkt<br />
angeschraubt. Der vordere Verschluss dich -<br />
tet nach demselben System ab. Er ist aber<br />
rund gehalten, damit man den Bug verdre -<br />
hen kann. Die runde Öffnung des Bugverschlusses<br />
befindet sich in der unteren Hälfte<br />
eines GfK-Spants. Durch diese Öffnung ragt<br />
ein innerer Warzenverschluss, der direkt am<br />
Technikgerüst angeschraubt wurde. Unter<br />
der Bugsektion sitzt das äu ßere Gegenteil<br />
des Warzenverschlusses mit der O-Ring-<br />
Dichtung. Um das Boot zu verschließen,<br />
Technikgerüst<br />
Bei diesem Boot wollte ich mit wenig Aufwand<br />
Wartungen und Reparaturen durchführen<br />
können. Ich habe das Technikgerüst<br />
daher in drei trennbare Sektionen aufgeteilt.<br />
Die Hecksektion ist an das Heckteil geschraubt<br />
und beherbergt die Servos, den<br />
Drehzahl- und den Tiefenregler. Der Kolbentank<br />
bildet die mittlere Sektion. Auf der Getriebeplatte<br />
und dem Tankboden sind jeweils<br />
Hecksektion von oben<br />
Bei schneller Überwasserfahrt muss man<br />
die Tiefenruder leicht nach oben anstellen<br />
Getriebeplatte des<br />
Kolbentanks mit<br />
Magnetmitnehmer<br />
Endabschalter am Tank, oben Rückmeldepoti<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
67
SPECIALS<br />
U-Boot Typ XXIII<br />
zwei Gewindebuchsen eingelassen. Darüber<br />
kann man die beiden äußeren Sektionen<br />
schnell anflanschen. Die elektrischen Verbindungen<br />
zwischen Bug- und Hecksektion<br />
werden über zwei SUB-D-Stecker getrennt.<br />
Der Kolbentank an sich hat sich nicht sonderlich<br />
gegenüber der Bauform in meinen<br />
anderen Modellen verändert. Er wird von einem<br />
Maxxon-Motor über eine Getriebestufe<br />
angetrieben. Begrenzt wird der Weg über<br />
zwei Endabschalter, allerdings habe ich die<br />
Rückmeldung, über die die letzten 40 mm<br />
des Wegs abgefragt werden, verbessert.<br />
Hier zu habe ich auf die trockene Wand<br />
des Kolbens einen Ring aus magnetischem<br />
Edel stahl geklebt. Das Linearpoti zur Wegüberwachung<br />
wird von einer runden Schub -<br />
stange mitgenommen. Auf dem anderen<br />
Ende dieser Schubstange sitzt ein kleiner<br />
Neodymmagnet. Sobald der Kolben auf den<br />
Magneten aufläuft, nimmt er das Poti automatisch<br />
mit. Wird der Tank gelenzt, trennt<br />
sich der Magnet bei Poti-Vollauschlag und<br />
verweilt an dieser Stelle. Zur besseren Gängigkeit<br />
der Schubstange sitzt sie zusätzlich<br />
in einer Linearführung, dadurch werden<br />
BAUSATZ<br />
U-Boot Typ XXIII<br />
Länge<br />
99,1 cm<br />
Breite<br />
8,57 cm<br />
Maßstab 1:35<br />
Hersteller Bronco Models<br />
Preis<br />
79,90 Euro<br />
keine lästigen Kuli-Federn, Gummis oder<br />
Seilzüge benötigt.<br />
Damit im Bereich des Kolbentanks der<br />
Wasserdruck gut aufgefangen werden kann,<br />
habe ich vier 8-mm-Alu-Spanten auf den<br />
Tank geklebt, die auch gleichzeitig den Tank<br />
in den Einschubschienen führen. In der<br />
Bugsektion befinden sich im oberen Bereich<br />
die restliche Elektronik und die Schlauchpumpe<br />
für die Ausfahrgeräte.<br />
Im unteren Bereich liegen die<br />
vier Lithium-Ionen-Zellen mit<br />
2000 mAh. Die Kolbentankstange<br />
kann mittig durch die<br />
vier Zellen bis in den Bug ausfahren.<br />
Der Rest der Bugsek -<br />
tion wird für die Aggregate am Kolbentank<br />
benötigt, wie z. B. Motor und Endabschalter.<br />
Turm und Ausfahrgeräte<br />
Um bei diesem Boot nicht komplett auf Sonderfunktionen<br />
verzichten zu müssen, wollte<br />
ich die Positionslichter und die Ausfahrgeräte<br />
funktionstüchtig bauen. Um keine lästigen<br />
Stecker im Einschub an- und abstecken<br />
zu müssen, habe ich die elektrischen Verbindungen<br />
zwischen Technik ge rüst und<br />
Druckkörper mittels Federkon tak ten und<br />
Kontaktpads realisiert. Unter dem Turm sitzt<br />
eine selbst hergestellte, wasserdichte Steckverbindung,<br />
die auf Pin-Kontakten basiert.<br />
Die Ausfahrgeräte werden mit tels einer<br />
Schlauchpumpe herausgedrückt und per<br />
Unterdruck wieder hereingezogen.<br />
Der Druckanstieg bei Endanschlag entweicht<br />
über ein Überdruckventil. Dieses be-<br />
Auf Schleichfahrt ...<br />
Fertiger Turm<br />
Phantombild<br />
des Turms<br />
Ausfahrgeräte mit Überdruckventil<br />
68
steht aus einer Feuerzeugdichtung, die über<br />
eine kleine Edelstahlfeder auf die Druckzuführbohrung<br />
gedrückt wird. Der Federdruck<br />
lässt sich mit einer M3-Schraube einstellen.<br />
Die Druckleitung zu den Ausfahrgeräten<br />
wird automatisch beim Zusammenschieben<br />
des Bootes am Heckverschluss verbunden.<br />
Sehrohr und Schnorchel sitzen in Edelstahlzylindern<br />
und besitzen jeweils einen Kolben<br />
mit O-Ring-Dichtung. Die Zylinder werden<br />
von einem Rahmen gehalten, in dem sich<br />
die Wasserleitung zu den Ausfahrgeräten<br />
und dem Überdruckventil befindet. Solange<br />
das System blasenfrei bleibt, funktioniert<br />
alles tadellos, selbst die Geschwindigkeit des<br />
Aus- und Einfahrens wirkt nicht zu hastig.<br />
Ruder und Propeller<br />
Die Tiefenruder habe ich vergrößert und profiliert,<br />
um später keine hydrodynamischen<br />
Probleme zu bekommen. Es stellte sich heraus,<br />
dass es ausreicht, die Ruder bis zu den<br />
Stabilisatoren zu verbreitern und die hinte -<br />
ren Tiefenruder zusätzlich um 8 mm zu verlängern.<br />
Da der Bootskörper im Be reich des<br />
Seitenruders sehr eng wird, habe ich dieses<br />
mittels Zahnriemen angesteuert. Das treibende<br />
Zahnriemenrad sitzt im durchfluteten<br />
Heckteil und wird über ein herkömmliches<br />
Rudergestänge angetrieben.<br />
Um die vorderen Tiefenruder anzutrei -<br />
ben, verwende ich das kleine wasserdichte<br />
Hitec-Servo. Das war die unkomplizierteste<br />
Variante, dieses Problem zu lösen.<br />
Der im Plastikbausatz liegende Propeller<br />
eignet sich natürlich nicht zum Antrieb des<br />
Modells, er wurde deswegen per CNC aus<br />
Polystyrol neu gefräst. Der Propeller wird<br />
wie bei den echten Booten mittels einer Mutter<br />
auf einen in der Schiffswelle sitzenden<br />
Querstab gedrückt. Das Drehmoment wird<br />
so über den in der Welle sitzenden Querstab<br />
auf den Propeller übertragen.<br />
n<br />
DER AUTOR<br />
Guido Faust, langjähriger Autor im Bereich<br />
U-Boote, ist unter sub-01@web.de erreichbar.<br />
Fazit<br />
Es war nicht gerade einfach, die Übergänge<br />
zwischen Bug, Mittelteil und Heck so genau<br />
anzupassen, dass anschließend nicht mehr<br />
gespachtelt werden musste. Ist das aber<br />
geschafft, wird man mit einem detailreichen,<br />
handlichen U-Boot belohnt, das auch noch<br />
Reserven für Sonderfunktionen beinhaltet.<br />
Das Boot ist im aufgetauchten Zustand zwar<br />
etwas rank, allerdings krängt es in keinem<br />
Fahrzustand zu stark. Es empfiehlt sich, bei<br />
Überwasserfahrt die vorderen Tiefenruder<br />
auf Auftauchen zu stellen, damit ein ungewolltes<br />
Untertauchen des Bugs bei voller Fahrt<br />
verhindert wird.<br />
Fährt das Boot getaucht, krängt es überhaupt<br />
nicht mehr, auch bei starkem Seitenruder -<br />
ausschlag legt es sich nur leicht in die Kurve.<br />
Dann neigt es auch dazu, bei Rechtskurven<br />
leicht aufzutauchen und bei Linkskurven leicht<br />
abzutauchen. Dieses Phänomen habe ich mit<br />
einem freien Mischer, der bei Seitenruderausschlag<br />
die vorderen Tiefenruder um 10 Prozent<br />
mitzieht, aber schnell in den Griff bekommen.<br />
Seitenruder-Anlenkung<br />
über Zahnriemen<br />
Details unten am Bug<br />
Antriebswelle mit Querstift<br />
Montierter Propeller<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
69
SPECIALS<br />
Miniaturschleuse<br />
FUNKTIONSTÜCHTIGE MODELL-SCHLEUSENANLAGE<br />
Durchgeschleust!<br />
Aus dem Alltag unserer Vorbilder sind sie nicht wegzudenken:<br />
Schleusenanlagen. Und dabei reduziert sich der Einsatz dieser<br />
Technik zur Überwindung verschiedener Wasserlevel nicht nur<br />
auf die Binnenschiffahrt. Auch in so manchen Seehäfen benötigt<br />
man Schleusen an den Zugängen zu einzelnen Hafenbecken.<br />
TEXT UND FOTOS: Christian Grontzki<br />
Beim letzten Schaufahren des<br />
Schiffsmodell-Club Rheintal aus<br />
der Schweiz gab es ein ganz<br />
besonderes Highlight zu sehen,<br />
nämlich eine voll funktionstüchtige<br />
Modell-Schleusenanlage. Dazu muss<br />
man wissen, dass dieses Schaufahren in<br />
einer Badeanstalt durchgeführt wird. Für<br />
den Modellbetrieb können sowohl das<br />
Schwimmer- als auch das Nichtschwimmer-<br />
Becken genutzt werden. Beide Becken sind<br />
zwar nebeneinander angeordnet, haben aber<br />
keine direkte Verbindung miteinander. Dank<br />
der Schleusenanlage konnten nun aber<br />
dennoch die Modelle ganz nach Belieben von<br />
einem ins andere Becken wechseln.<br />
Wie kam es aber nun zu dieser eindrucksvollen<br />
Schleusenanlage? Die ganze Aktion<br />
war ein Projekt der Firma OC Oerlikon Balzers<br />
AG. Die „Lernenden“ (in Deutschland<br />
würde man „Auszubildende“ sagen) dieser<br />
Firma sollten für den Schiffsmodell-Club<br />
Rheintal die Schleusenanlage entwickeln,<br />
konstruieren und bauen.<br />
Ein recht anspruchsvolles Projekt, bei<br />
dem auch verschiedene Berufsgruppen zusammenarbeiten<br />
mussten. Die Arbeit begann<br />
mit der Ideenfindung, bei der sich<br />
Konstrukteure, Polymechaniker und Automatiker<br />
mit der Aufgabenstellung befassten:<br />
Die Schleusenanlage übernimmt die Auf -<br />
gabe eines Kanals, der ein Wasserniveau aufweist,<br />
das über dem der beiden Becken liegt.<br />
In der einen Schleusenkammer wird das<br />
Schiff auf das Niveau des Kanals gehoben,<br />
durchquert den Kanal und wird in der<br />
zweiten Schleusenkammer wieder auf Beckenniveau<br />
abgesenkt.<br />
Konstruktion und Bau<br />
Nachdem man sich für die technischen<br />
Grundlagen entschieden hatte, konnten die<br />
Konstrukteure die Zeichnungen erstellen,<br />
nach denen die Polymechaniker die erforderlichen<br />
Bauteile fertigten. Die Teile mussten<br />
je nach Ausführung gefräst, gedreht und<br />
gebohrt werden, die Anlagen- und Apparatebauer<br />
konnten die benötigten Bleche be -<br />
70
Wie im Original: Einfahrt in die Schleusenkammer, gemeinsam geht es abwärts, Schleusentore auf, freie Fahrt voraus!<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
71
SPECIALS<br />
Miniaturschleuse<br />
TECHNISCHE DATEN<br />
Modell-Schleusenanlage<br />
Gesamtlänge<br />
6,6 m<br />
(vier Segmente mit je 1,5 m)<br />
Gesamtbreite<br />
76,3 cm<br />
Gesamthöhe<br />
74,6 cm<br />
Gesamtgewicht<br />
145 kg<br />
Gesamtvolumen<br />
ca. 1950 l<br />
Arbeitsdruck<br />
6 bar<br />
Pumpe<br />
2 x je 13.000 l/h<br />
Steuerung<br />
manuell<br />
Spannung<br />
230 Volt<br />
Durchfahrzeit<br />
ca. 5 min<br />
Max. Tiefgang (Schiff)<br />
155 mm<br />
Max. Breite (Schiff)<br />
545 mm<br />
Pumpniveau (Höhe)<br />
ca. 300 l<br />
Bauzeit<br />
2,5 Jahre<br />
arbeiten und miteinander verschweißen. Die<br />
Automatiker hatten parallel dazu die Pneumatikanlage<br />
geplant und realisiert. Pneumatikzylinder<br />
schließen und öffnen über Hebel<br />
die Schleusentore.<br />
Belastungstest beim Schaufahren<br />
Als alle Teile fertig waren, konnte die Schleu -<br />
se zum ersten Mal in den Testbetrieb gehen.<br />
Natürlich waren alle Beteiligten sehr gespannt,<br />
die Schleuse in Aktion zu sehen.<br />
Mitglieder des Schiffsmodell-Club Rheintal<br />
hatten dann nach dem Testlauf noch kleine<br />
Verbesserungen vorgeschlagen, die anschließend<br />
erledigt wurden. Für die Auszubildenden<br />
stellte das Projekt eine sehr realistische<br />
Praxiserfah rung dar, denn wie in der realen<br />
Berufswelt mussten verschiedene Berufsgruppen<br />
miteinander kommunizieren,<br />
Lösungen erarbeiten und diese umsetzen.<br />
Die Mitglieder des Schiffsmodell-Clubs und<br />
die Gastfahrer waren von der Schleuse begeistert<br />
und entsprechend viel befahren war<br />
sie dann auch beim Schaufahren.<br />
Während des Schaufahrens waren Mike<br />
Looser, Rafael Schelling und Pascal Vogt als<br />
Schleusenwärter im Einsatz und beantworteten<br />
natürlich vielfältige Fragen rund um<br />
das Projekt.<br />
Die Schleuse hatte damit den Dauertest<br />
bestan den und wird sicherlich auch im Jahr<br />
2014 beim Schaufahren wieder im Einsatz<br />
sein.<br />
n<br />
DER AUTOR<br />
Christian Grontzki, Autor bei <strong>SchiffsModell</strong>,<br />
beantwortet weitere Fragen unter<br />
Christian.Grontzki@clinch.ch<br />
72
Die Schleuse hat den Dauertest bestanden und wird sicherlich auch im Jahr 2014 beim Schaufahren wieder im Einsatz sein<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
73
MODELLBAU<br />
Tankschiffe BRIGITTA und CISCA<br />
Die Vorbilder sind die BIRGITTA und die CISCA aus der Zeit,<br />
in der sie für die deutsche Elbe-Reederei liefen<br />
Schon vor ein paar Jahren fielen mir<br />
Bauunterlagen von zwei ungewöhnlichen<br />
Schiffen in die Hän -<br />
de, nämlich Pläne der beiden<br />
Tankschiffe BIRGITTA und<br />
CISCA. Im folgenden Beitrag möchte ich<br />
beide Schiffe gleichzeitig vorstellen, da sich<br />
die Bauweise der Modelle sehr ähnelt und<br />
die Originale bei derselben Reederei liefen<br />
und mit der gleichen Fracht unterwegs<br />
waren, nämlich – Speisefetten und Speiseölen.<br />
Beide Modelle entstanden im Maßstab<br />
1:100 als Standmodelle. Da die Abmessungen<br />
doch recht übersichtlich sind, entschied ich<br />
mich, die Rümpfe aus Polystyrol tiefziehen<br />
zu lassen. Hierfür fertigte ich jeweils einen<br />
massiven Rumpfkern aus Holz an. Die markantesten<br />
Spanten sägte ich aus Sperrholz<br />
aus und befestigte sie auf einem Stück Sperrholz,<br />
welches einen vertikalen Schnitt durch<br />
MOTORTANKSCHIFFE BRIGITTA UND CISCA<br />
Reizende<br />
Schwestern<br />
Tankschiffe werden nur sehr selten nachgebaut. Vielleicht<br />
liegt das auch am schlechten Öko-Image eines Tankers?<br />
Diese beiden Tanker müssen sich aber nichts vorwerfen<br />
lassen, denn sie transportieren Speiseöl und Speisefett!<br />
TEXT UND FOTOS: Alexander Mehl<br />
74
die Rumpfmitte bildet. Die Zwischenräume<br />
füllte ich mit MDF-Stücken auf, die zuvor<br />
auf der Bandsäge zurechtgesägt worden waren.<br />
Nachdem der Leim abgebunden war, bearbeitete<br />
ich die Rohlinge mit einem Winkelschleifer<br />
und einer Putzscheibe. Diese Arbeit<br />
fand im Freien statt und ging zügig von<br />
der Hand. Zur genaueren Bearbeitung kamen<br />
diverse Schleifklötze und Feilen zum<br />
Einsatz. Hier und da musste etwas nachgespachtelt<br />
werden.<br />
Rumpf und Deck<br />
Der Rumpf der BIRGITTA war etwas leichter<br />
zu bearbeiten, da er durchlaufende Linien<br />
aufweist. Dagegen hat der Rumpf der CISCA<br />
im Heckbereich sehr scharfe Kanten, die<br />
sauber dargestellt werden sollten. An tiefgezogenen<br />
Rümpfen müssen solch scharfe Linien<br />
aber immer am endgültigen Rumpf<br />
ausgearbeitet werden, da das Tiefziehen ja<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
keine scharfen Kanten zulässt. Hat man jedoch<br />
an der Form schon sauber gearbeitet,<br />
fällt dieser Arbeitschritt später etwas leichter.<br />
Mit Ziehklingen und Schleifklötzen konnte<br />
der Heckbereich der CISCA vorbildgetreu<br />
erstellt werden. Nach dem Zusam men kle -<br />
ben der tiefgezogenen Rumpfhälften klebte<br />
ich einige Spanten zur Stabilisierung ein,<br />
ebenso einige massive Messingbuchsen mit<br />
eingeschnittenem M5-Gewinde, die einen sicheren<br />
Stand des fertigen Modells auf der<br />
späteren Sockelplatte ermöglichen.<br />
Anschließend wurden die Decks in die<br />
Rümpfe geklebt, die dadurch genug Stabi -<br />
lität erhielten, um richtig verschliffen zu werden.<br />
Bei der CISCA lötete ich das achtere<br />
Schanzkleid aus Messing, da es ausschließlich<br />
durch die Schanzkleidstützen gehalten<br />
wird. Ebenso arbeitete ich die Öffnungen für<br />
Klüsen und Speigatten aus. Im Bereich der<br />
Back musste der Rumpf ausgedünnt wer -<br />
den, da das Schanzkleid ansonsten unverhältnismäßig<br />
dick erscheinen würde. Auf<br />
den Fotos der Originale war erkennbar, dass<br />
der Handlauf auf der Schanz bei der BIR-<br />
GITTA aus Halbrundmaterial und bei der<br />
CISCA aus Flachprofil bestand. Entsprechende<br />
Polystyrolprofile wurden für die Modelle<br />
erstellt und mit Sekundenkleber an die<br />
jeweiligen Stellen geklebt. Überhaupt habe<br />
ich an den Modellen beinahe alles mit dünnflüssigem<br />
Sekundenkleber geklebt. Entsprechende<br />
Profile für die Scheuerleisten klebte<br />
ich an die Rümpfe. Auf der Höhe des Hauptdecks<br />
bildet bei beiden Schiffen ein 0,3 x<br />
1-mm-Polystyrolstreifen die Fußreling.<br />
Weitere Arbeiten am Rumpf<br />
Da es sich um Standmodelle handeln sollte,<br />
konnten die Ruder recht einfach aus Polystyrolplatten<br />
hergestellt werden, das Profil<br />
schliff ich auf einem Tellerschleifer zu recht.<br />
75
MODELLBAU<br />
Tankschiffe BRIGITTA und CISCA fe B<br />
Als Stevenrohr dient ein Stück Messingrohr.<br />
Für die Schiffsschrauben drehte ich die Naben<br />
aus Messing und sägte dann mit einem<br />
Kreissägeblatt in einem Teilapparat auf meiner<br />
Fräse jeweils vier Schlitze ein.<br />
Für jeden der Propeller wurde nun ein<br />
Blatt mit dem entsprechenden Außenprofil<br />
ausgesägt. Für alle weiteren Blätter schnitt<br />
ich entsprechende Messingplättchen zu -<br />
recht und lötete diese mit dem zuerst erstellten<br />
Blatt als Schablone obendrauf zu einem<br />
Päckchen zusammen. Mit einer Feile fand<br />
dann die Formgebung der Pakete statt, anschließend<br />
wurden die Pakete wieder ent -<br />
lötet. Jedes Blatt erhielt nun ein Profil und<br />
einen Feinschliff. Um die jeweils vier Blätter<br />
gleichzeitig in der Nabe verlöten zu können,<br />
muss jedes Blatt allein in seinem Schlitz halten.<br />
Erst dann erhitze ich den ganzen Propeller<br />
und lasse mit Hilfe von Lötwasser das<br />
Lot in die Propellerschlitze ziehen. Anschließend<br />
kann man die Propeller verputzen und<br />
auf Hochglanz polieren. Hat man hier erst<br />
einmal einige Erfahrung gesammelt, geht<br />
der Bau von Propellern in dieser Art und<br />
Weise schnell von der Hand und der Schiffspropeller<br />
entspricht dann zu 100 Prozent<br />
dem Original.<br />
Um den Bau der Rümpfe abzuschließen,<br />
mussten noch diverse Schanzkleidstützen<br />
auf der Back montiert werden. Da ich mir<br />
komplizierte Abklebearbeit ersparen wollte<br />
(Rumpf grau, Deck grün, Schanzkleidinnenseite<br />
weiß bzw. grau), musste ich mir etwas<br />
einfallen lassen: Die eigentlichen Decks sind<br />
Einschiebedecks aus 0,2 mm starker Phosphorbronze.<br />
Die Schanzkleidstützen hängen<br />
also quasi in der Luft. Das fertig grün<br />
lackierte Deck wird erst eingeschoben, wenn<br />
der Rumpf und die Innenseite des Schanzkleides<br />
lackiert sind. So erhält man einen absolut<br />
sauberen Farbübergang zwischen den<br />
einzelnen Elementen. Damit war der Roh -<br />
bau der Rümpfe abgeschlossen.<br />
Die Aufbauten<br />
Auffallend ist, dass es in den Rümpfen der<br />
Schiffe keine Bullaugen gibt. Das liegt daran,<br />
dass sich alle Unterkünfte für die Mann -<br />
schaft in den Aufbauten befinden. Außer -<br />
dem sind die gesamten Aufbauten auf<br />
schwingungsdämpfenden Elementen gelagert.<br />
Die BIRGITTA hat einen Aufbau, der<br />
eher etwas klassisch wirkt, der Aufbau der<br />
CISCA wirkt hingegen sehr modern. Bei beiden<br />
Aufbauten waren etliche Fensterrahmen<br />
anzufertigen. Hier griff ich auf eine Methode<br />
zurück, wie sie Herr Karl Möller vor Jahren<br />
einmal beim Bau seiner fantastischen<br />
Schleppermodelle anwendete. Diese Methode<br />
stelle ich hier etwas vereinfacht dar:<br />
Man fertigt einen leicht konischen Vierkantstempel<br />
und eine Matrize, die so groß ist,<br />
wie die Öffnung des Fensters im Aufbau.<br />
Nun sticht man auf der Drehbank Ringe von<br />
Deck der CISCA: Die Handräder der Ventilstationen sorgen für attraktive Farbtupfer<br />
einem Rohr ab. Das Rohr, eventuell selbst<br />
aus Vollmaterial gefertigt, sollte in der Wandstärke<br />
dem künftigen Rahmen entsprechen.<br />
Mitunter kann es nötig sein, die abgestochenen<br />
Ringe vorsichtig auszuglühen.<br />
Nun befestigt man den Stempel in einer<br />
Säulenbohrmaschine oder Ähnlichem. Ei -<br />
nen Ring legt man auf die Matrize und<br />
drückt die Pinole nach unten. Durch die<br />
leicht konische Form des Stempels formt<br />
sich nun aus dem Ring der eckige Fensterrahmen.<br />
Es soll nicht unerwähnt bleiben,<br />
dass etliche Versuche von Durchmessern<br />
und verschiedenen Materialien nötig waren,<br />
um brauchbare Ergebnisse zu erhalten.<br />
Letztendlich war ein Alurohr der geeignete<br />
Werkstoff. Die Rahmen konnten nun mit Sekundenkleber<br />
auf den Aufbau geklebt werden.<br />
Anschließend arbeitete ich die Öffnung<br />
im Inneren mit Schlüsselfeilen aus.<br />
Im Wesentlichen entstanden die Aufbauten<br />
aus 1-mm-Polystyrol. Die Schornsteine<br />
baute ich separat, um mir das Lackieren zu<br />
erleichtern.<br />
Beide Schiffe führen je zwei Rettungsboote<br />
und ein Motorboot mit sich. Die orangenen<br />
Boote sind natürlich schöne „Farbtupfer“<br />
auf den Modellen. Alle Beiboote sind<br />
Fertigteile, die jedoch in der Länge und in<br />
der Breite angepasst werden mussten, um<br />
die nötigen Abmessungen zu erhalten. Die<br />
jeweiligen Davits fertigte ich aus Messing<br />
und vervollständigte sie mit etlichen Rollen<br />
und Blöcken. Die Reling entstand, wie bei<br />
mir üblich, aus den geätzten Stützen der Fa.<br />
Saemann. Bei Aufbauten aus Polystyrol<br />
schmelze ich die Stützen ein, richte sie aus,<br />
biege den Handlauf und löte ihn auf. Jetzt<br />
kontrolliere ich die Ausrichtung noch<br />
einmal. Erst jetzt führe ich die Durchzüge<br />
ein und verlöte sie mit Zinn und Lötwasser.<br />
Die Reling auf den Aufbauten wurde direkt<br />
am Modell mit dem Pinsel lackiert.<br />
Etliche weitere Ausrüstungsgegenstände<br />
mussten nun noch gebaut werden, ich den -<br />
ke, hier sprechen die Fotos für sich. Die Masten<br />
der Schiffe entstanden aus Messing. Die<br />
Schiffslaternen drehte ich aus einem 2-mm-<br />
Plexirundstab. Hierfür schliff ich mir einen<br />
extra dünnen Abstechstahl, mit dem sich die<br />
Arbeit gut bewerkstelligen ließ.<br />
Ein markantes Detail ist sicherlich das<br />
Reedereilogo, welches im Original nicht einfach<br />
auf den Schornstein gemalt ist, sondern,<br />
aus Blech gefertigt, auf Abstandshaltern sitzt.<br />
So sollte es auch an den Modellen sein. Die<br />
wehende Fahne schnitt ich aus 0,2-mm-<br />
Bronzeblech aus, der Flaggenstock aus 0,5 x<br />
0,2-mm-Bronze ist angelötet. Zunächst lackierte<br />
ich alles weiß. Dann klebte ich die innere<br />
Raute ab und lackierte alles hellblau.<br />
Nun musste der äußere Rand mit dünnstem<br />
Zierlinienband abgeklebt werden, um das<br />
Innere der Flagge dunkelblau zu lackieren.<br />
Schließlich erhielt der Flaggenstock einen<br />
braunen Anstrich. Den roten Schriftzug<br />
„Elbe“ druckte ich 2 mm hoch auf durchsichtiger<br />
Folie in Rot aus und klebte ihn in<br />
die Raute. Die fertigen Reedereisymbole sind<br />
gerade mal 1,5 x 1 cm groß und konnten nun<br />
mit Abstandshaltern an den Schornsteinen<br />
befestigt werden.<br />
Blickfang Deck<br />
Das Hauptdeck ist bei Tankschiffen natürlich<br />
das wichtigste Element. Das Bild des ganzen<br />
Schiffes wird von den unzähligen Rohrleitungen<br />
geprägt. Da ich mich ansonsten<br />
hauptsächlich mit dem Bau von Bohrinselversorgern<br />
beschäftige, konnte mich das<br />
76
DIE VORBILDER<br />
Gleiche Reederei, gleiche Fracht<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
Rohrgeflecht an Deck dieser Tanker jedoch<br />
nicht mehr beeindrucken. Wichtig ist es jedoch,<br />
sehr systematisch vorzugehen. Alle<br />
Leitungen müssen abnehmbar sein, um eine<br />
saubere Lackierung zu gewährleisten. Das<br />
System zerlegte ich gedanklich in einzelne<br />
Ebenen. Auf einem Montagebrett begann<br />
dann der Bau aus entsprechendem Messingrohr<br />
mit der untersten Ebene. Hierfür<br />
fertigte ich eine ausreichende Anzahl von<br />
Rohrflanschen an, die einfach über die Rohre<br />
geschoben und an entsprechender Stelle verlötet<br />
wurden. Auf den Vorbildern sind die<br />
Leitungen auf U-förmigen Böcken gelagert.<br />
Diese Böcke entstanden aus sehr dünnen<br />
Abschnitten verschiedener Messing-U-Profile,<br />
die mit den Leitungen dann verlötet werden<br />
konnten. Die einzelnen Ebenen verlötete<br />
ich an einigen Punkten miteinander. Zuguterletzt<br />
bohrte ich mit einem 0,5-mm-Bohrer<br />
Löcher in die Stellen, an denen später ein<br />
Handrad (Ventil) montiert werden sollte. In<br />
die Löcher lötete ich kleine Drahtstückchen<br />
ein, an denen die geätzten Handräder befestigt<br />
wurden. Zuallerletzt erhielten die<br />
Bauteile jeweils vier Haltezapfen aus 1,5-mm-<br />
Draht angelötet, die in entsprechende Bohrungen<br />
an Deck passen. Damit konnten<br />
dann die separat lackierten Bauelemente an<br />
Deck befestigt werden.<br />
Das Leitungssystem der BIRGITTA war<br />
etwas komplizierter anzufertigen. Hier gibt<br />
es eine Leitung mit Omega-förmigen Ausdehnungsschleifen,<br />
die exakt gebogen sein<br />
wollten. Bei der BIRGITTA gelangt man<br />
über den sog. „Catwalk“ zu den einzelnen<br />
Ventilstationen an Deck. Der Catwalk ermöglicht<br />
es ebenfalls, bei voll beladenem Schiff<br />
trockenen Fußes vom Aufbau zur Back zu<br />
gelangen. Der Catwalk entstand aus Bronzeblech,<br />
die jeweiligen Niedergänge sind, wie<br />
alle anderen auch, wiederum Ätzteile aus<br />
dem Hause Saemann. Diese konnte ich einfach<br />
an den Catwalk anlöten. Auch die Reling<br />
konnte nun komplett verlötet werden.<br />
Die Vorbilder für der Modelle sind die BIRGITTA und die CISCA aus der Zeit, in der sie für<br />
die deutsche Elbe-Reederei liefen. Sie beförderten vor allem Speiseöle und -fette.<br />
Die BIRGITTA wurde im Januar 1976 bei der<br />
Bayerischen Schiffbau GmbH am Main mit der<br />
Baunummer 1041 fertig gestellt. Ja, sie haben<br />
richtig gelesen, das Schiff wurde im tiefsten<br />
Binnenland, in Bayern gebaut und fand dann<br />
wohl über Flüsse und Kanäle seinen Weg an<br />
die Küste. Oft werden bei derartigen Über -<br />
führungen Teile der Aufbauten oder Masten an<br />
Deck bis zur Küste transportiert, um unterwegs<br />
alle Brücken passieren zu können.<br />
Die BIRGITTA ist 73,6 m lang und 11,6 m breit,<br />
der Tiefgang beträgt 4,6 m. Angetrieben wird<br />
das Schiff durch einen 1.600 PS starken Diesel,<br />
der auf einen Propeller wirkt, die Geschwin -<br />
digkeit wird mit 12 kn angegeben. 1986 wurde<br />
die BIRGITTA nach Dänemark verkauft und lief<br />
dort bis ins Jahr 2006 als ANETTE THERESA.<br />
Davor wurden einige Umbauten an Deck vor -<br />
genommen und das Schiff erhielt einen roten<br />
Anstrich. 2006 wurde das Schiff dann nach<br />
Russland verkauft und läuft dort unter dem<br />
Namen ANATOLY BILICHENKO bis heute.<br />
Die CISCA wurde 1982 bei der türkischen<br />
Werft Meltem Beykoz Tersanesi in Istanbul mit<br />
der Baunummer 40 gebaut und verließ die<br />
Werft noch mit dem Namen REGINA. Das<br />
Schiff ist 85 m lang und 13 m breit, der Tiefgang<br />
beträgt 4,7 m. Für den Antrieb sorgt ein<br />
1.800 PS starker Krupp MaK-Dieselmotor,<br />
der auf einen Propeller wirkt und dem Schiff<br />
eine Geschwindigkeit von 11,7 kn verleiht.<br />
Daneben verfügt der Frachter über einen Bug -<br />
strahler, der – das kommt uns Modellbauern<br />
doch bekannt vor – jedoch nicht wie üblich mit<br />
einem Propeller, sondern mit Wasserpumpen<br />
arbeitet. Die Öffnungen im Rumpf sind daher<br />
rechteckig.<br />
1986 erhielt das Schiff den Namen CISCA.<br />
Im Jahr 2000 wurde sie verkauft und hieß von<br />
nun an CHEYENNE. Im Jahr 2007 wurde sie,<br />
wie die BIRGITTA, von der dänischen Reederei<br />
Herning Shipping übernommen und lief unter<br />
dem Namen ELLEN THERESA. Seit 2008 trägt<br />
das Schiff den Namen SAN ANDRES 2.<br />
Farbtupfer an Deck<br />
Auf dem Deck der CISCA gibt es an Stelle<br />
des Catwalk Brücken über die Rohr leitun -<br />
gen. Von jeder Brücke kann man über immerhin<br />
sechs Niedergänge zu den Ventilstationen<br />
gelangen. Hier fertigte ich wiederum<br />
alles aus Blech an. Bei einer Bauweise aus<br />
Polystyrol wäre die gesamte Konstruktion sicherlich<br />
sehr labil geworden. Mit dem Blech<br />
hingegen kann in maßstäblicher Materialstärke<br />
vorbildgetreu und stabil gebaut werden.<br />
Die Handräder der Ventilstationen sind<br />
bei der CISCA farbig, manche sogar zweifarbig<br />
gestaltet. Diese „Farbtupfer“ lockern<br />
das Erscheinungsbild des Decks angenehm<br />
auf. Auf Halterungen über den zentralen<br />
Rohrleitungen der CISCA werden einige textile<br />
Schläuche mitgeführt. Ich benötigte einige<br />
Versuche, um diese nachzubilden.<br />
Schließlich färbte ich eine Schnur mit passender<br />
Webart in Kaffee. Danach spannte<br />
ich die Schnur zwischen zwei Schraubstöcken<br />
und tränkte sie mit dünnflüssigem Sekundenkleber.<br />
Obwohl die Modelle nun schon recht<br />
fertig wirkten, mussten noch etliche, eher<br />
unspektakuläre Details angefertigt werden.<br />
Alle Bauteile, die an Deck montiert sind, erhielten<br />
einen kleinen Zapfen aus Messingdraht<br />
an der Unterseite. Alle Polystyrolteile<br />
erhielten dann einen Überzug aus Filler und<br />
wurden anschließend noch einmal nass geschliffen.<br />
Teile aus Buntmetall erhielten eine<br />
1-K-Grundierung mit einem hohen Anteil<br />
von Phosphorsäure (Ätzprimer). Nun<br />
konnte ich die Lacke auf sprühen. Wie bei<br />
vielen anderen meiner Modelle kamen auch<br />
hier 2-K-Autolacke zum Einsatz.<br />
Die Bauweise in Sektionen zahlt sich immer<br />
wieder aus. Wo mir das Abkleben dennoch<br />
nicht erspart blieb, klebte ich mit einem<br />
(nicht ganz billigen) Zierlinienband die Kanten<br />
ab, so z. B. an den Aufbauten oder der<br />
Farbtrennung von Über- und Unterwasserschiff.<br />
So entsteht eine sehr saubere Kante<br />
zwischen den einzelnen Farben. Zum Abkleben<br />
größerer Flächen nahm ich dann normales,<br />
glattes Malerkrepp.<br />
Restarbeiten<br />
Nachdem alle Teile ihre Farbe erhalten hat -<br />
ten, konnten noch einige kleine Staubeinschlüsse<br />
nass mit einem 1000er-Papier herausgeschliffen<br />
werden. Dann erhielten alle<br />
Teile einen dünnen Überzug aus einem 2-K-<br />
Mattlack. Dieser gilbt, im Vergleich zu 1-K-<br />
Klarlacken auf Kunstharzbasis, nicht nach.<br />
Bei Lackierarbeiten bin ich immer wieder<br />
froh, mir vor Jahren eine zwar etwas teurere,<br />
aber wunderbare kleine Spritzpistole angeschafft<br />
zu haben: Es ist eine Sata Minijet.<br />
Luftmenge und Farbmenge lassen sich dabei<br />
fein regulieren. Damit ist die Gefahr recht<br />
gering, feine Details mit Farbe „zuzukleistern“.<br />
Mit verschiedenen Düsensätzen kann<br />
die Pistole dem Einsatz angepasst werden.<br />
Die Endmontage ist dann immer wieder<br />
ein toller Moment, da alle mühsam ange -<br />
fertigten Teile endgültig an ihren Platz kom -<br />
men und das Schiff schnell Gestalt an -<br />
nimmt. Mit der Beschriftung des Rumpfes<br />
und der Beflaggung war der eigentliche Bau<br />
nun abgeschlossen.<br />
Nun hatte ich zwei hübsche Modelle, die<br />
ich auch angemessen präsentieren wollte.<br />
Also entschloss ich mich, bei einem Tischler<br />
zwei Sockelplatten aus Mahagoni anfertigen<br />
zu lassen. Diese Platten erhielten eine umlaufende<br />
Nut, in die eine Glasvitrine eingreifen<br />
sollte. Der Preis dafür war, zugegeben,<br />
etwas happig. Für jedes Modell drehte ich<br />
mir elegante Säulen aus Messing und<br />
polierte sie. Mit M5-Schrauben befestigte ich<br />
die Modelle dann auf den Sockelplatten.<br />
In den Vitrinen mit den Sockeln aus Mahagoni<br />
sehen die kleinen Tanker wirklich<br />
sehr schön aus und kommen bestens zur<br />
Geltung. Kein Wunder also, dass mir der Bau<br />
viel Freude bereitet hat.<br />
n<br />
DER AUTOR<br />
Alexander Mehl kann bei weiteren Fragen<br />
über die Redaktion kontaktiert werden.<br />
77
MODELLBAU<br />
Sammlung Huckauf in der MTS Parow<br />
SAMMLUNG HUCKAUF<br />
Neuer<br />
Liegeplatz<br />
Eine der eindrucksvollsten Sammlungen von Modellen deutscher<br />
Kriegsschiffe hat nach vielen Jahren der Unsicherheit endlich einen<br />
angemessenen Liegeplatz gefunden.<br />
TEXT UND FOTOS: Helmut Harhaus<br />
Die etwas älteren Modellbauer kennen<br />
ihn noch gut, unser „Hänschen<br />
Huckauf“, den quirligen<br />
Wirbelwind aus Rödinghausen.<br />
Er war noch einer von der alten<br />
Garde, einer, der den Schiffsmodellbau zu<br />
seiner Lebensaufgabe erkoren hatte. Ohne<br />
maritime Basteleien hatte er sich sein Leben<br />
gar nicht vorstellen können! Seine Leidenschaft<br />
war die „Graue Flotte“, im Schwerpunkt<br />
die deutsche Kriegsmarine. Ich denke,<br />
es gab kaum ein Typ-Schiff, das er nicht gebaut<br />
hat. Aber auch Modelle von Einheiten<br />
der Kaiserlichen Marine und der Bundes -<br />
marine liefen auf seiner Hobbywerft vom<br />
Stapel.<br />
Viele Jahre lang baute er GfK-Rümpfe<br />
unter dem Label POLYSOLID für die Szene.<br />
Für Werften und Reeder hat er Hunderte von<br />
1:500-Modellen in exzellenter Qualität ge -<br />
baut, die nahezu in jeder Chef etage zu finden<br />
sein dürften. Mit großem Eifer organisierte<br />
er das legendäre Dickschifftreffen in Espelkamp<br />
über viele Jahre mit. Und wenn dort<br />
ein Modell nach Torpedotreffer buchstäblich<br />
in die Luft flog, dann hatte Hänschen wieder<br />
mal gezündelt<br />
Lange Jahre der Unsicherheit<br />
Im Mai 2004 verstarb Hans Huckauf. Nach<br />
langen und vielfältigen Bemühungen, den<br />
Verbleib seiner Flotte – immerhin über<br />
30 Top-Modelle – zu sichern, konnte 2012<br />
endlich eine angemessene Lösung gefunden<br />
werden. Die MTS, die Marinetechnikschule<br />
in Parow bei Stralsund, signalisierte Inter -<br />
78<br />
Hans Huckauf (rechts), wie man ihn kannte<br />
esse an dem Huckauf-Vermächtnis. Das ist<br />
natürlich eine ganz tolle Lösung, die Verbleib<br />
und Präsentation aufs Beste vereinigt: Die<br />
Sammlung konnte zusammenbleiben, die<br />
Modelle mussten nicht verramscht werden<br />
und sie fanden ihr neues Domizil ganz in<br />
der Nähe von Hänschens Geburtsort auf der<br />
Insel Rügen.<br />
Den fachkundigen Transport, bei über<br />
30 Modellen keine Kleinigkeit, organisierte<br />
die MTS. Die Reise überstanden die Modelle<br />
ohne Schäden. Mit viel Sachverstand und<br />
Recherchearbeit wurden Informationen zu<br />
den Modellen zusammengestellt und auf<br />
Info-Tafeln dargelegt. So konnten fachkundige<br />
Schwerpunktthemen gefunden werden,<br />
die, mit diesen Modellen illustriert, dem Betrachter<br />
bzw. den Auszubildenden erläutert<br />
werden können. Da gibt es zum Beispiel die<br />
Entwicklung der Schweren Artillerie, die<br />
Entwicklung der Panzerung oder die Einführung<br />
der Radar- und Feuerleittechnik. Aber<br />
auch politische und geschichtliche Aspekte<br />
des Flottenbaus lassen sich mit Hilfe der<br />
Huckauf-Modelle eindrucksvoll darstellen.<br />
Im Lehrgebäude 201 konnten so die<br />
Wandvitrinen im Flur sehr informativ und<br />
sehenswert ausgestattet werden. Viele der<br />
Lehrgangsteilnehmer erleben nun Marinetechnik<br />
und Marinegeschichte eindrucksvoller,<br />
als es nur anhand von Bildern oder mit<br />
Büchern möglich wäre. Entsprechend groß<br />
ist das Interesse. Diese „Politische Lehrsammlung“<br />
kann in Breite und Qualität mit<br />
jedem Museumsangebot mithalten!<br />
Präsentation am Tag der offenen Tür<br />
Am 24. August 2013, dem Tag der offenen<br />
Tür bei der MTS, wurde die „Stiftung Huckauf“<br />
der Öffentlichkeit vorgestellt und die<br />
Lehrsammlung ihrer Bestimmung über -<br />
geben. Der Kommandeur der MTS, Kapitän<br />
z. S. Rahner, würdigte die modellbauerische<br />
Leistung von Hans Huckauf und äußerste<br />
sich hocherfreut, diese Sammlung von exzellenten<br />
Schiffsmodellen nun am Standort<br />
Parow präsentieren zu können. Ebenfalls<br />
lobenswert ist, das Engagement der MTS-<br />
Offiziere, die sich intensiv um die Informationen<br />
zu den Modellen und die Präsentation<br />
gekümmert haben. Man spürt hier in der Tat<br />
die Liebe zum Thema und die Verbunden -<br />
heit zur Grauen Flotte.<br />
Zum Tag der offenen Tür gab es natürlich<br />
für die Besucher viel zu sehen. Am Hafen
Die Huckauf-Sammlung fand ihren Platz in den<br />
Wandvitrinen im Schulgebäude<br />
Politische und geschichtliche Aspekte des Flottenbaus lassen sich<br />
mit Hilfe der Huckauf-Modelle eindrucksvoll darstellen<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
79
MODELLBAU<br />
Sammlung Huckauf in der MTS Parow<br />
waren Vorführungen mit Marinehubschraubern<br />
und modernste Technik vom Schleudersitz<br />
bis zum FlaRakSystem „Patriot“ zu<br />
sehen. Die Werkstätten der MTS waren geöffnet<br />
und fachkundiges Personal zeigte, was<br />
die Marine in Sachen Ausbildung zu bieten<br />
hat: Werkstätten mit modernsten Fräs- und<br />
Drehmaschinen stehen für die Ausbildung<br />
bereit, die Chemiker, Elektriker, Fernmelder<br />
und Elektroniker haben alles nur erdenk -<br />
liche Ausbildungs-Equipment zur Verfügung.<br />
Alle Dieselmotoren, die die Marine<br />
auf den Schiffen im Einsatz hat, stehen hier<br />
in Sälen zur Einführung bzw. Ausbildung<br />
zur Verfügung.<br />
Faszinierende Technik<br />
Schon beeindruckend, wenn ein Schnellbootdiesel<br />
angeworfen und im Lehrsaal auf<br />
Drehzahl gefahren wird! Nicht weniger interessant:<br />
„Opa“, der erste Dieselmotor (Einblasediesel<br />
von MAN Baujahr 1912), natür -<br />
lich gepflegt „wie neu“ und funktionsfähig<br />
wie am ersten Tag. Übrigens ist dieser der<br />
80<br />
Ausstellung im<br />
Freigelände – gut<br />
besucht zum Tag<br />
der offenen Tür<br />
weltweit einzige funktionstüchtige Einblase -<br />
diesel. Aber auch die moderne Kaserne ist<br />
sehenswert, vorbei sind die Zeiten der 8-<br />
Mann-Stube und der Toilette für alle am<br />
Ende des Flures!<br />
Die MTS verfügt aber auch über eine Modellbau-AG,<br />
in der die Soldaten in ihrer Freizeit<br />
Eisenbahnen, Flugzeuge und natürlich<br />
Schiffe in verschiedenen Maßstäben bauen.<br />
Hier können die Lehrgangsteilnehmer das<br />
ihnen im Dienst vermittelte Wissen in der<br />
Freizeit im Hobby vertiefen. Dafür steht ein<br />
riesiger Saal zur Verfügung, ausgestattet mit<br />
allem, was sich ein Modellbauerherz nur<br />
wünschen kann. In Verbindung mit den mechanischen,<br />
elektrischen und elektronischen<br />
Ausbildungswerkstätten der MTS ergibt das<br />
ungeahnte Möglich keiten in Ausführung,<br />
Funktionen und Steuerungstechniken. Zahlreiche<br />
Besucher kamen aus dem Staunen<br />
nicht mehr heraus – die Marine ist schon<br />
eine interessante Berufs-Alternative!<br />
Insgesamt haben an diesem Tag 5630 Besucher<br />
das Informationsangebot der MTS<br />
genutzt. Dass die „blauen Jungs“ von der<br />
MTS, speziell seien hier wieder die Modellbauer<br />
genannt, auch ein großes Herz haben,<br />
zeigt sich in ihrem sozialen Engagement:<br />
Seit 2005 sammeln sie Spendengelder für<br />
die Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe, eine<br />
Tochter der Deutschen Krebshilfe. Zusammen<br />
mit dem Panzerpionierbatallion 1 aus<br />
Holzminden präsentieren sie ihre Modelle<br />
bei Modellbauausstellungen für den guten<br />
Zweck. So werden z. B. Sachpreise eines Modellbauherstellers<br />
im Rahmen einer Wohltätigkeitsverlosung<br />
vergeben. Hierbei kam<br />
am Tag der offenen Tür ein Erlös von 2.800<br />
Euro zusammen.<br />
Mit weiteren, über das Jahr gesammelten<br />
1.000 Euro sind die Modellbauer aus Parow<br />
nach Holzminden gefahren und haben dort<br />
an einem Wochenende das Rekordergebnis<br />
von 52.000 Euro (!) für den guten Zweck gesammelt.<br />
Die nächste Gelegenheit, die Marinetechnikschule<br />
mit all ihren Facetten zu erleben,<br />
bietet sich beim nächsten Tag der offenen<br />
Tür am Samstag, dem 30. August 2014. In<br />
Verbindung mit einem Kurzurlaub, könnte<br />
man dabei sogar noch die Region Fischland-<br />
Darß erkunden oder sogar auf den Spuren<br />
von unserem „Hänschen Huckauf“ auf der<br />
Insel Rügen wandeln.<br />
n<br />
DER AUTOR<br />
Helmut Harhaus, beantwortet Fragen unter<br />
blickpunkt-harhaus@freenet.de
Blick in die Werkräume der<br />
MTS-Modellbau-AG<br />
Dieselmotoren in der Maschinenhalle<br />
Vorführungen im MTS-Hafen Parow<br />
Ein ehemaliges DDR-Boot in der Sammlung alter Einheiten<br />
<strong>SchiffsModell</strong> 1-2/2014<br />
81
VORSCHAU auf Heft 03/2014<br />
Das<br />
neue Heft<br />
erscheint am<br />
26.<br />
FEBRUAR<br />
Impressum<br />
1-2/2014 | Januar-Februar | 36. Jahrgang<br />
Internet: www.schiffsmodell-magazin.de<br />
Redaktionsanschrift:<br />
<strong>SchiffsModell</strong><br />
Infanteriestraße 11a, 80797 München<br />
Tel. +49 (0) 89 13.06.99.720<br />
Fax +49 (0) 89 13.06.99.700<br />
E-Mail: redaktion@schiffsmodell-magazin.de<br />
Redaktion: Hans-Jörg Welz<br />
Redaktionsleitung: Michael Krische<br />
Mitarbeiter dieser Ausgabe:<br />
Jörg Dreischulte, Markus Laimgruber,<br />
Dietrich Schletter, Dieter Jaufmann,<br />
Martin Kiesbye, Peter Dorschner, Bernd Karnagel,<br />
Ingrid Blüm, Peter Behmüller, Manfred Sievers,<br />
Milan Lulic, Peter Koller, Peter Kohnke,<br />
Guido Faust, Christian Grontzki,<br />
Alexander Mehl, Helmut Harhaus<br />
Layout: Ralf Puschmann (Ltg.), Sabine Loos,<br />
Jens Wolfram, Sebastian Dreifke<br />
Die „Bismarck“ ist das deutsche Kriegsschiff schlechthin. Der Plastikbausatz<br />
von Trumpeter im Maßstab 1:200 ist nicht nur exzellent detailliert, sondern bietet sich<br />
mit geringen Änderungen auch als Fahrmodell an<br />
Power S1200<br />
Aktuelle Hochleistungs-<br />
Schnellladegeräte benötigen eine<br />
standfeste Spannungsversorgung,<br />
wenn man ihre Performance auch<br />
voll nutzen will. Wir testen die<br />
Chargery Power S1200 von MTTEC<br />
Die „Bismarck“ – das bekannteste<br />
deutsche Kriegsschiff!<br />
Abo-Hotline, Kundenservice,<br />
GeraMond-Programm<br />
Tel. (0180) 5 32 16 17*<br />
Fax (0180) 5 32 16 20*<br />
E-Mail: leserservice@schiffsmodell-magazin.de<br />
(*14 Cent pro Minute)<br />
Gesamtanzeigenleitung:<br />
Rudolf Gruber, Tel. +49 (0) 89.13.06.99.527,<br />
rudolf.gruber@verlagshaus.de<br />
Anzeigenleitung <strong>SchiffsModell</strong>:<br />
Uwe Stockburger, Tel. +49 (0) 7721.89.87-71,<br />
E-Mail: uwe.stockburger@verlagshaus.de<br />
Es gilt Anzeigenpreisliste Nr. 21 vom 1.1.2014<br />
www.verlagshaus-media.de<br />
Litho: Ludwig Media, Zell am See<br />
Druck: Stürtz, Würzburg<br />
Verlag:<br />
GeraMond Verlag GmbH<br />
Infanteriestraße 11a, 80797 München<br />
Geschäftsführung:<br />
Clemens Hahn, Carsten Leininger<br />
Herstellungsleitung: Sandra Kho<br />
Vertriebsleitung: Dr. Regine Hahn<br />
Vertrieb/Auslieferung Handel:<br />
MZV, Unterschleißheim<br />
Im selben Verlag erscheinen außerdem:<br />
Verpassen Sie kein Heft mehr! Sichern Sie<br />
sich bereits heute die nächste Ausgabe von<br />
<strong>SchiffsModell</strong> mit bis zu 40% Preisvorteil<br />
und attraktivem Geschenk – mehr im Internet<br />
unter www.schiffsmodell-magazin.de<br />
Lieber Leser,<br />
C.M.B. 21 BETA<br />
Bella macchina! Rennmotoren<br />
aus Italien sind bei vielen<br />
FSR-Fahrern allererste Wahl.<br />
Christoph Schneider hat sich den<br />
neuen C.M.B. 21 BETA nicht nur<br />
ganz genau angeschaut, sondern<br />
auch schon im Rennen gefahren<br />
Sie haben Freunde, die sich ebenso für Schiffsmodelle mit<br />
all Ihren Facetten begeistern wie Sie? Dann empfehlen Sie<br />
uns doch weiter! Wir freuen uns über jeden neuen Leser.<br />
Ihre Redaktion von <strong>SchiffsModell</strong><br />
FLUGZEUG CLASSIC CLAUSEWITZ<br />
BAHN EXTRA AUTO CLASSIC<br />
LOK MAGAZIN TRAKTOR CLASSIC<br />
STRASSENBAHN MAGAZIN<br />
Preise: Einzelheft € (D) 5,90,<br />
€ (A) 6,70, sFr. (CH) 11,80<br />
(bei Einzelversand zzgl. Versandkosten);<br />
Jahresabopreis (12 Hefte) € 63,72<br />
(inkl. Mehrwert steuer, im Ausland<br />
zzgl. Versandkosten)<br />
ISSN 0722-7108<br />
Erscheinen und Bezug:<br />
<strong>SchiffsModell</strong> erscheint monatlich. Sie erhalten Schiffs -<br />
Modell in Deutschland, in Öster reich und in der Schweiz<br />
im Bahn hofs buch handel, an gut sortierten Zeitschriften -<br />
kiosken, im Fachhandel sowie direkt beim Verlag.<br />
© 2014 by GeraMond Verlag München. Die Zeitschrift und<br />
alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind<br />
urheber rechtlich geschützt. Durch Annahme eines Ma nu -<br />
skripts erwirbt der Ver lag das aus schließ liche Recht zur<br />
Ver öffent lichung. Für unverlangt eingesandte Fotos und<br />
Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Gerichtsstand<br />
ist München.<br />
100-%-Gesellschafterin der GeraMond Verlag GmbH ist<br />
die GeraNova Bruckmann Verlagshaus GmbH. Geschäfts -<br />
führender Gesellschafter: Clemens Schüssler.<br />
Verantwort lich für den redak tionellen Inhalt: Hans-Jörg<br />
Welz; verantwortlich für die Anzeigen: Uwe Stockburger;<br />
beide Klosterring 1, 78050 Villingen-Schwenningen.<br />
82
Aus Liebe<br />
zum Detail<br />
Jetzt am<br />
Kiosk!<br />
Online blättern oder Testabo mit Prämie bestellen unter:<br />
www.modellfan.de/abo