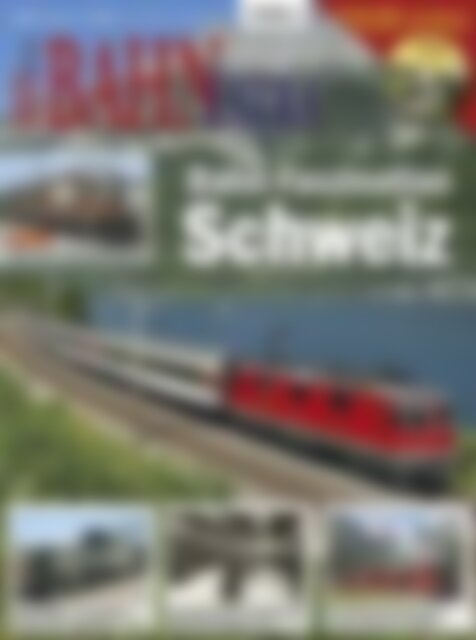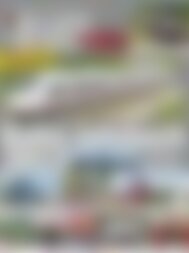Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3|2013 – Mai/Juni • € 12,50 CH: sFr 24,80 • A: € 14,20 • B/NL/L: € 14,60<br />
PLUS DVD: 120 Minuten<br />
Eisenbahn in der <strong>Schweiz</strong><br />
Mit den schönsten<br />
Eisenbahnen unterwegs<br />
in der <strong>Schweiz</strong><br />
ca. 120 Minuten Tonfilm in S/W und Farbe<br />
A le Urheber- und Leistungsschutz rechte vorbehalten.<br />
Wer diesen Film ohne aus drückliche schriftliche<br />
Genehmigung vervielfältigt, ö fentlich vorführt,<br />
INFO-<br />
Programm<br />
sendet, verleiht, vermietet oder sonstwie gewerblich<br />
nutzt, wird zivil- und strafrechtlich verfolgt.<br />
gemäß<br />
§ 14<br />
JuSchG<br />
© 2013 by <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> VIDEO / GeraMond Verlag<br />
www.geramond.de<br />
Beilage-DVD zu <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
SPECIAL:<br />
100 Jahre Lötschbergbahn<br />
<strong>Bahn</strong>-<strong>Faszination</strong><br />
<strong>Schweiz</strong><br />
Fahrzeugbau: Die großen<br />
Firmen, die legendären Loks<br />
Geschichte: Der Aufstieg zum<br />
<strong>Bahn</strong>land Nummer eins<br />
Die Schmalspurparadiese<br />
in den <strong>Schweiz</strong>er Alpen
Das kleine Magazin<br />
über die große <strong>Bahn</strong><br />
Das neue<br />
Heft ist da.<br />
Jetzt am<br />
Kiosk!<br />
Online blättern oder Testabo mit Prämie bestellen unter:<br />
www.lok-magazin.de/abo
Inhalt<br />
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
„stets zu Ihren Diensten“ – so stellten<br />
sich die <strong>Schweiz</strong>erischen Bundesbahnen<br />
Anfang der 60er-Jahre auf einem<br />
Plakat ihren Kunden vor. Gemeint war<br />
zwar der Güterverkehr, aber das Motto<br />
traf nicht minder für den Personenverkehr<br />
zu. Und nicht nur für die SBB,<br />
sondern auch für die vielen anderen<br />
<strong>Bahn</strong>gesellschaften der Eidgenossen.<br />
Ihr Engagement machte und macht die<br />
<strong>Schweiz</strong> zum <strong>Bahn</strong>land Nummer eins<br />
in Europa. Das dichte Streckennetz,<br />
das breite Zugangebot und die Vielfalt<br />
der <strong>Bahn</strong>en begeistern immer wieder<br />
aufs Neue. Anno 2013 kommt noch<br />
ein Jubiläum hinzu: Vor 100 Jahren<br />
wurde mit der Lötschbergstrecke die<br />
zweite große Alpenmagistrale eröffnet.<br />
Der Aufstieg der Bern-Lötschberg-Simplon-<strong>Bahn</strong><br />
(BLS) begann.<br />
Dies alles hat uns bewogen, Ihnen das<br />
faszinierende <strong>Bahn</strong>land <strong>Schweiz</strong> in der<br />
vorliegenden Ausgabe ausführlich vorzustellen.<br />
Kommen Sie mit auf eine interessante<br />
und abwechslungsreiche<br />
Eisenbahn-Tour durch Helvetien.<br />
Viel Vergnügen und, im Sinne der SBB,<br />
stets zu Ihren Diensten.<br />
Ihre Redaktion <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong><br />
Ein passendes Cover für<br />
Ihre DVD zum Ausschneiden<br />
finden Sie in diesem<br />
Heft auf Seite 58<br />
Im August 1981 fahren die BLS-Loks Ae 6/8 205 und Re 4/4 176 mit D 680 aus Spiez aus.<br />
Mehr zur BLS und zur Lötschbergstrecke, die 2013 das 100-jährige Bestehen feiert, ab S. 20<br />
Momentaufnahmen<br />
Berge, Seen und Eisenbahnen<br />
<strong>Bahn</strong>betrieb in der <strong>Schweiz</strong> 4<br />
Im Rhythmus der Zeit<br />
<strong>Bahn</strong>betrieb in den<br />
50er- und 60er-Jahren 62<br />
<strong>Bahn</strong> mal anders<br />
Foto-Impressionen von Tibert Keller 82<br />
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
Die erste Einheitslok<br />
Die Gotthardlok Ae 6/6 46<br />
Züge made in Switzerland<br />
Die Geschichte der <strong>Schweiz</strong>er<br />
Eisenbahnindustrie 50<br />
„Straßenarbeiter“<br />
Die Seetalbahn 59<br />
Markenzeichen Orange-Steingrau<br />
Der Swiss-Express 68<br />
<strong>Bahn</strong> nach Italien<br />
Die Simplonbahn 70<br />
Allegra, Komet, Spatz ...<br />
Neue Schmalspurbahn-Fahrzeuge<br />
in der <strong>Schweiz</strong> 73<br />
Die „kleine Rote“<br />
Wunderwelt Rhätische <strong>Bahn</strong> 76<br />
Im Rohbau fertig<br />
Der Gotthard-Basistunnel 80<br />
Schwerpunkt: BLS/Lötschbergbahn<br />
Die neue Alpenbahn<br />
Die Entwicklung der BLS 20<br />
„Brigue, train direct!“<br />
Eine Lötschberg-Fahrt vor 100 Jahren 34<br />
Von Anfang an elektrisch<br />
Die wichtigsten Triebfahrzeuge der BLS 36<br />
Im Alpentransit ganz vorn<br />
Die Gütertochter BLS Cargo 40<br />
Die ersten Erfahrungen<br />
Der Lötschberg-Basistunnel im Betrieb 42<br />
Tradition und Moderne<br />
Die BLS heute 44<br />
Chronik<br />
Schienen in Helvetien<br />
Die Zeittafel: Eisenbahn in der <strong>Schweiz</strong> 14<br />
Der Sonderweg<br />
Das <strong>Schweiz</strong>er Eisenbahnnetz 16<br />
Das Netz damals<br />
Die <strong>Schweiz</strong>er Streckenkarte von 1939 18<br />
Schnuppertour <strong>Schweiz</strong><br />
Land und <strong>Bahn</strong>en entdecken –<br />
unsere Tipps für Ihre Reise(n) 88<br />
<strong>Vorschau</strong>/Leserservice/Impressum 98<br />
Titelfotos: Florian Martinoff (gr. Bild,<br />
SBB-Ellok Re 4/4 II mit IC), Albert<br />
Schöppner (2, kl. Bilder o.l., u.l.),<br />
Ludwig Rotthowe (kl. Bild u. M.),<br />
Sven Klein (kl. Bild u.r.);<br />
Rücktitel: Peter Kusterer (gr. Bild),<br />
Dr. Dietmar Beckmann (kl. Bild u.l.),<br />
Slg. Andreas Knipping (kl. Bild u.r.);<br />
Bilder auf S. 3: P. Kristl/Slg. Thomas<br />
Wunschel (o.l.), Georg Wagner (o.r.);<br />
Bild DVD-Cover: Florian Martinoff<br />
Autoren in diesem Heft<br />
Dr. Hans-Bernhard Schönborn,<br />
geboren 1952 in Köln und von<br />
Beruf Lehrer, lebte von 1982<br />
bis 2005 in der <strong>Schweiz</strong>. Die<br />
dortigen Eisenbahnen zählen<br />
zu seinen Interessensgebieten;<br />
er hat dazu Bücher und<br />
Beiträge veröffentlicht.<br />
Dr. Dietmar Beckmann, geboren<br />
1956 in Essen, ist Ingenieur<br />
in Bochum und<br />
begeistert sich unter anderem<br />
für die <strong>Schweiz</strong>er Eisenbahnen<br />
und deren Betrieb. Dr. Beckmann<br />
hat dazu Beiträge, Bücher<br />
und Bildbände verfasst.<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
3
Momentaufnahmen<br />
4
<strong>Bahn</strong>betrieb in der <strong>Schweiz</strong><br />
<strong>Bahn</strong>betrieb in der <strong>Schweiz</strong><br />
Berge, Seen und<br />
Eisenbahnen<br />
Dichtes Streckennetz, beeindruckende Fahrzeuge, grandiose<br />
Landschaft machen den <strong>Bahn</strong>betrieb des Alpenlandes aus.<br />
Ob Transitverkehr oder Regionalzug, ob Normalspur,<br />
Schmalspur oder Zahnradbahn, der „Zugsverkehr“ unterm<br />
<strong>Schweiz</strong>erkreuz ist ein Füllhorn voller Überraschungen<br />
Internationaler Reiseverkehr rollt über die<br />
Strecke (Brig –) Lausanne – Genf. Bei<br />
St. Saphorin eilt im November 2011 ein<br />
Triebzug ETR 610 der <strong>Schweiz</strong>erischen<br />
Bundesbahnen durch die herbstliche Landschaft<br />
am Genfer See. Mediterrane Züge<br />
gibt es da im doppelten Sinne; das Fahrzeug<br />
stammt aus italienischer Produktion<br />
und die Orte erinnern auch hier und da an<br />
südliche Nachbarn<br />
Florian Martinoff<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
5
Momentaufnahmen<br />
Aktuell ist der Gotthard im Gespräch. Als Alternative zur Bergstrecke entsteht dort der Basistunnel,<br />
mit 57 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der Welt. Die Röhre als solche haben die<br />
Bergarbeiter schon gegraben (Foto: Durchschlag der Oströhre bei Faido) AlpTransit Gotthard<br />
Land der Berge<br />
Fluch für die Ingenieure, Freude für Touristen:<br />
Die wildromantische Alpenlandschaft stellt die<br />
<strong>Bahn</strong>en vor buchstäblich hohe Anforderungen.<br />
Umso faszinierender, wie die Züge die Berg -<br />
regionen erklimmen. Oder auch umgehen<br />
Gebirgszüge wörtlich<br />
genommen: Auf kühner<br />
Strecke fahren die<br />
Meterspurtriebwagen<br />
der Centovalli-<strong>Bahn</strong><br />
von Locarno über die<br />
Höhen nach Domodossola<br />
in Italien. Faszinierende<br />
Kunstbauten<br />
wie die Stahlbrücke<br />
bei Intragna gibt es<br />
inklusive (Bild vom<br />
August 2012)<br />
Tibert Keller<br />
6
Land der Berge<br />
Im Meterspurnetz der Rhätischen <strong>Bahn</strong><br />
findet die Arosalinie etwas weniger Beachtung,<br />
dabei muss sie sich nicht verstecken.<br />
Die Einfahrt in den Ferienort Arosa auf<br />
1.755 Höhenmetern bietet <strong>Schweiz</strong>er Alpenatmosphäre<br />
par excellence (Foto mit einem<br />
„Allegra“-Triebzug, Oktober 2012) Tibert Keller<br />
Die Gotthard-<strong>Bahn</strong> war die erste Alpenmagistrale<br />
der <strong>Schweiz</strong>. Im Jahr 1882 eröffnet,<br />
setzte sie Maßstäbe bei Bau und Betrieb.<br />
Als sie 1920 elektrifiziert wurde, kamen zuerst<br />
die Elloks Be 4/6 zum Einsatz. Gerade<br />
fährt eine solche Maschine aus dem Gotthard-Tunnel<br />
in Göschenen aus. Rechts die<br />
schmalspurige Schöllenenbahn Slg. B. Rampp<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
7
Momentaufnahmen<br />
Mit einem internationalen Schnellzug<br />
steht Ellok 10908 der Reihe Ae 4/7 anno<br />
1961 im <strong>Bahn</strong>hof Brig. Grüne Lok vor grünen<br />
Wagen – so sieht er aus, der klassische<br />
Reisezug der <strong>Schweiz</strong>erischen Bundesbahnen<br />
(SBB) in den 60er- und frühen<br />
70er-Jahren Peter Kristl/Slg. Thomas Wunschel<br />
Durchblick auf den <strong>Bahn</strong>steig in<br />
Montreux, Juni 1985. Von hier aus<br />
hat man mit den normalspurigen<br />
SBB-Zügen Anschluss nach Brig und<br />
Genf; die schmalspurigen Züge der<br />
Montreux-Oberland-Bernois-<strong>Bahn</strong><br />
(MOB) fahren nach Zweisimmen<br />
Ludwig Rotthowe<br />
8
Land der Vielfalt<br />
Der Güterverkehr spielt seit jeher eine große Rolle im <strong>Schweiz</strong>er <strong>Bahn</strong>verkehr, seien es inländische<br />
Transporte oder Frachtgut im Transit. Dafür entwickelten vor allem SBB und Bern-<br />
Lötschberg-Simplon-<strong>Bahn</strong> kräftige Lokomotiven; im April 1985 ist eine BLS-Doppellok Ae 8/8<br />
mit einem Güterzug zwischen Einigen und Kumm am Thunersee unterwegs Georg Wagner<br />
Land der Vielfalt<br />
In der <strong>Schweiz</strong> entstand das dichteste Eisenbahnnetz<br />
Europas, mehr als 50 Gesellschaften sind heute noch<br />
aktiv. Kurzum, Vielfalt ist Trumpf beim Schienenverkehr.<br />
Dass die <strong>Schweiz</strong>er (und ihre Gäste) traditionell die <strong>Bahn</strong><br />
intensiv nutzen, verwundert da kaum mehr<br />
Als erste Bergbahn Europas nimmt am 21. Mai 1871 die <strong>Bahn</strong> von Vitznau auf die Rigi den Betrieb<br />
auf. Die Fotografie zeigt die Talstation Vitznau mit drei Dampfloks des Typs H 1/2. Die mit<br />
Stehkessel ausgerüsteten Maschinen waren die „Anfangsausstattung“ der <strong>Bahn</strong> Slg. Peter Schricker<br />
9
Momentaufnahmen<br />
Aus dem D 278 Genf – Mailand fällt im September 1973 der Blick auf den entgegen kommenden<br />
D 277 Brig – Paris, den die Ellok 11251 der Reihe Re 4/4 II bespannt. TEE-Farben und das<br />
<strong>Schweiz</strong>erkreuz machen klar, wo die Lok zu Hause ist<br />
Ludwig Rotthowe<br />
Majestätisch reihen<br />
sich die Läutewerke<br />
im SBB-<strong>Bahn</strong>hof<br />
Wettingen auf (Bild<br />
vom September<br />
1977). Traditionell<br />
werden Züge noch<br />
an- und auch abgeläutet;<br />
eine Praxis,<br />
die in der <strong>Schweiz</strong><br />
über Jahrzehnte Bestand<br />
hat<br />
Ludwig Rotthowe<br />
Land der Besonderheiten<br />
Der langsamste Schnellzug der Welt,<br />
ein spektakulärer Kreisviadukt und das<br />
<strong>Schweiz</strong>erkreuz auf Lokomotiven: Das<br />
<strong>Bahn</strong>wesen der Eidgenossen wartet mit<br />
Außergewöhnlichem ebenso auf wie<br />
mit Markantem. Und mit Tradition<br />
10
Land der Besonderheiten<br />
Zeit spielt beim „Glacier-Express“ keine Rolle.<br />
Auf dem Weg zwischen St. Moritz und<br />
Zermatt zählt die sehenswerte Landschaft,<br />
die der Meterspurzug gemächlich durchfährt.<br />
Vor dem Matterhorn hat eine Ellok der Brig-<br />
Zermatt-<strong>Bahn</strong> die Garnitur am Haken; später<br />
werden die Furka-Oberalp-<strong>Bahn</strong> bzw. die Rhätische<br />
<strong>Bahn</strong> übernehmen Slg. Peter Schricker<br />
Der Kreisviadukt von Brusio ist heute eine<br />
Sehenswürdigkeit auf der Berninalinie der<br />
RhB, dabei hatten die Erbauer an diese Lösung<br />
zunächst gar nicht gedacht. Ursprünglich<br />
sollte hier der <strong>Bahn</strong>hof entstehen und<br />
eine S-Kurve den Höhenunterschied überwinden.<br />
Während der Planung kam man dann auf<br />
die Idee des Viadukts; das Wahrzeichen von<br />
Brusio war geschaffen (Okt. 2011) Tibert Keller<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
11
Momentaufnahmen<br />
Die beiden einzigen selbst fahrenden Dampfschneeschleudern<br />
weltweit gingen 1910 und<br />
1912 an die bis 1943 eigenständige Berninabahn.<br />
Erst damit ließ sich ein Ganzjahresbetrieb<br />
über die höchstgelegene Alpentransversale<br />
anbieten. Heute wird die X rot d 9213<br />
praktisch nur noch für Schaufahrten verwendet,<br />
wie im Januar 2011 mit der Zweisystemlok<br />
Gem 4/4 801 zwischen Bernina Lagalb<br />
und Ospizio Bernina<br />
Tibert Keller<br />
12
Der Dampflokbau brachte in der <strong>Schweiz</strong> einige markante Maschinen hervor; die größte war<br />
die C 5/6, auch „Elefant“ genannt. Allerdings setzte man schon ab dem beginnenden<br />
20. Jahrhundert auf Elektrotraktion. Den „schwarzen Riesen“ blieben nur untergeordnete<br />
Dienste oder später Ruhm bei Sonderfahrten wie 1982 in der Nähe von Basel Martin Weltner<br />
Land der berühmten Fahrzeuge<br />
In der <strong>Schweiz</strong>er Bergwelt findet man Gams, Steinbock<br />
und Murmeltier, auf den <strong>Schweiz</strong>er Schienen<br />
tummelten sich einst Elefanten und Krokodile. So<br />
lauteten die Spitznamen für bekannte Lokomotiven.<br />
Nicht nur bei den Krokodilen machte sich der Fahrzeugbau<br />
mit Pionierleistungen einen Namen<br />
Berühmte <strong>Schweiz</strong>er Elloks unter sich im<br />
Depot Basel SBB. Links eine Ce 6/8 II ,<br />
eines der weltberühmten „Krokodile“, die<br />
1919 bis 1923 für Güterzüge am Gotthard<br />
gebaut wurden. Rechts eine Ae 6/6,<br />
die in den 60er- und 70er-Jahren am Gotthard<br />
für Furore sorgte Joachim Seyferth<br />
Größer, stärker, schwerer: Drei Exemplare<br />
beschafften die SBB von der wuchtigen<br />
und überaus kräftigen Doppellok<br />
Ae 8/14. Manche Lokführer zogen jedoch<br />
die kleineren, wendigeren Elloks<br />
der Reihe Ae 4/7 vor Slg. Peter Schricker<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
13
Chronik<br />
Mit Normal- und Schmalspurstrecken erschlossen <strong>Schweiz</strong>er <strong>Bahn</strong>gesellschaften die Berge.<br />
Im Bild die meterspurige, teils mit Zahnstange versehene Brünigbahn Luzern – Meiringen –<br />
Interlaken<br />
Slg. Peter Schricker<br />
Reiseverkehr im Jahr 1961: Zugführer und<br />
Schaffner an einem Schnellzug im <strong>Bahn</strong>hof<br />
Brig<br />
Dr. Peter Kristl/Slg. Thomas Wunschel<br />
Zeittafel: Eisenbahn in der <strong>Schweiz</strong><br />
Schienen in Helvetien<br />
Es begann mit einer grenzüberschreitenden Strecke und der „Spanisch-Brötli-<strong>Bahn</strong>“, ein steiler<br />
Aufstieg folgte. Heute ist die <strong>Schweiz</strong> das <strong>Bahn</strong>land Nummer eins in Europa. Ein Überblick<br />
Die Deutschschweiz und das Tessin<br />
1844 – 1845<br />
Die aus Strasbourg kommende Strecke erreicht<br />
Basel.<br />
1847<br />
Die 1845 gegründete <strong>Schweiz</strong>erische Nordbahn<br />
(SNB) eröffnet die erste innerschweizerische Strecke,<br />
Zürich – Baden („Spanisch-Brötli-<strong>Bahn</strong>“).<br />
1852 – 1857<br />
In der Deutschschweiz werden einige größere <strong>Bahn</strong>gesellschaften<br />
gegründet: die St. Gallisch-Appen -<br />
zellische Eisenbahngesellschaft, die mit der<br />
<strong>Schweiz</strong>erischen Südostbahn und der Glattalbahn zu<br />
den Vereinigten <strong>Schweiz</strong>er <strong>Bahn</strong>en (VSB) fusioniert,<br />
die <strong>Schweiz</strong>erische Centralbahn (SCB), die <strong>Schweiz</strong>erische<br />
Nordostbahn (NOB) als Fusion von SNB und<br />
Zürich–Bodenseebahn. Diese <strong>Bahn</strong>en eröffnen<br />
schrittweise eine rund 1.000 Kilometer lange Ost–<br />
West-Verbindung Bodensee – Zürich – Olten – Herzogenbuchsee<br />
– Solothurn – Neuchâtel – Lausanne<br />
– Genf, an die auch Bern, Chur, St. Gallen, Luzern,<br />
Schaffhausen und Basel angeschlossen werden.<br />
1870 – 1897<br />
Um das Monopol der „Herrenbahnen“ NOB, SCB<br />
und SO in der Westschweiz zu brechen, eröffnet die<br />
als „Volksbahn“ gegründete <strong>Schweiz</strong>erische Nationalbahn<br />
(SNB) die Strecke Konstanz – Singen – Winterthur<br />
(1875) – Baden – Zofingen (1877); wegen<br />
finanzieller Probleme wird sie 1878 zwangsliquidiert,<br />
die NOB übernimmt 1880 die Konkursmasse.<br />
1874<br />
Die 1871 gegründete Gotthard-<strong>Bahn</strong> (GB) eröffnet die<br />
Strecke Bellinzona – Locarno. Es folgen 1880 der<br />
Durchschlag des 15 Kilometer langen Gotthard-Scheiteltunnels<br />
und 1882 die Betriebsaufnahme auf der<br />
mehr als 200 Kilometer langen Strecke Immensee –<br />
Chiasso sowie der Zweiglinie Bellinzona – Luino.<br />
NOB und SCB vervollständigen – teilweise mit gemeinsamen<br />
Tochtergesellschaften – ihr Netz und<br />
stellen Anschlüsse zur Gotthard-<strong>Bahn</strong> her durch<br />
die Linien Brugg – Pratteln, Rupperswil – Immensee<br />
und Hendschiken – Brugg.<br />
1897<br />
Die GB eröffnet die Strecken Luzern – Immensee<br />
und Zug – Arth-Goldau und erweitert ihr Netz auf<br />
rund 270 Kilometer.<br />
Die Westschweiz<br />
1855 – 1890<br />
In der Westschweiz entstehen zahlreiche Eisenbahngesellschaften,<br />
die oft nur kürzere Abschnitte<br />
betreiben und unter finanziellen Nöten leiden.<br />
Die größte Gesellschaft ist die 1855 gegründete<br />
Compagnie de l’Ouest-Suisse (OS); daneben gibt<br />
es unter anderem die 1858 gegründete Chemin de<br />
fer Lausanne – Fribourg – Berne (LFB) sowie die<br />
1859 gegründeten Ligne d’Italie (LI) und Compag -<br />
nie Franco-Suisse (FS).<br />
Ab 1872 gibt es mehrere Fusionen. So schließen<br />
sich 1884 die Jura bernois (JB) und die Bern-Luzern-<strong>Bahn</strong><br />
(BLB) zur Jura-Bern-Luzern-<strong>Bahn</strong> (JBL)<br />
mit einem Streckennetz von 371 Kilometern zusammen.<br />
Dazu gehört auch die meterspurige Brünigbahn<br />
(1888 eröffnet).<br />
1890 entsteht die Jura–Simplon-<strong>Bahn</strong> (JB), die<br />
im gleichen Jahr die JBL kauft, in 35 Jahren<br />
20 Vorgängergesellschaften hatte und deren<br />
knapp 1.000 Kilometer langes Netz von Basel<br />
über die Grenzübergänge Delle, La Chaux-de-<br />
Fonds, Les Verrières, Vallorbe, Genf und Brig bis Luzern<br />
reicht.<br />
Gesamte <strong>Schweiz</strong><br />
1898<br />
Ein Volksentscheid votiert für die Verstaatlichung der<br />
Eisenbahnen. Daraufhin entstehen 1902 aus SCB,<br />
NOB, VSB und JS die <strong>Schweiz</strong>erischen Bundesbahnen<br />
SBB, denen 1909 die Gotthardbahn eingegliedert<br />
wird. Damit umfasst das Netz der SBB rund<br />
2.700 Kilometer. Es wird in den Folgejahren erweitert,<br />
so durch die Eröffnung des Simplontunnels (1906<br />
bzw. 1922), die Eröffnung des Hauenstein-Basistunnel<br />
(1916) sowie die Angliederung von Tösstal-<br />
(1918) und Seetalbahn (1922).<br />
1906 – 1913<br />
Als Privatbahn wird die Alpenbahngesellschaft Bern-<br />
Lötschberg-Simplon BLS gegründet. Sie kauft 1907<br />
die 1901 eröffnete Frutigen–Spiez-<strong>Bahn</strong> und fusioniert<br />
1913 mit der Thunerseebahn. Ebenfalls 1913 eröffnet<br />
die BLS die Lötschbergstrecke Frutigen – Brig und<br />
1915 die Grenchenberglinie Moutier – Lengnau. Die<br />
Strecken sind von Beginn an elektrifiziert.<br />
Ab 1920<br />
Die Elektrifizierung der Gotthardbahn und die Ausweitung<br />
der Elektrotraktion fordern robuste Elloks für<br />
die anspruchsvollen Bergstrecken. Wiederholt wird<br />
die <strong>Schweiz</strong> mit bedeutenden Fahrzeugen Vorreiter<br />
der technischen Entwicklung (s. S. 50-56).<br />
Der Transitverkehr nimmt nach einem Abschwung<br />
während des Ersten Weltkriegs wieder zu.<br />
Nach 1945<br />
Nach dem Rückgang im Zweiten Weltkrieg steigt der<br />
<strong>Bahn</strong>transitverkehr durch die <strong>Schweiz</strong> abermals an.<br />
14
Eisenbahn in der <strong>Schweiz</strong><br />
<strong>Schweiz</strong>er Formsignalparade, aufgenommen im <strong>Bahn</strong>hof Renens bei<br />
Lausanne im September 1973. Die bei den Eidgenossen übliche Bauform<br />
bestand aus gelochten Blechen<br />
Ludwig Rotthowe<br />
In Arth-Goldau treffen sich die Strecken von Basel – Luzern und Zürich<br />
– Zug zum Gotthard. Zwischenhalt eines Reisezugs mit einer<br />
Ellok der Serie Re 6/6<br />
Oliver Edingshaus<br />
Slg. Toni Burger<br />
Slg. Josef Kempiak<br />
Eine <strong>Schweiz</strong>er Fahrzeug-Berühmtheit ist der „Rote Pfeil“ genannte<br />
SBB-Schnelltriebwagen, hier als Einteiler RAe 2/4 Slg. Peter Schricker<br />
1957<br />
Die SBB beteiligen sich am System der Trans-<br />
Europ-Express-Züge.<br />
1968<br />
Bei den SBB fährt der letzte Dampfzug. Zuglok ist<br />
eine C 5/6.<br />
1974<br />
Die SBB eröffnen die Heitersberglinie.<br />
1982<br />
Einführung eines Taktfahrplans bei fast allen<br />
<strong>Schweiz</strong>er <strong>Bahn</strong>en.<br />
1992/1998<br />
Zwei Volksentscheide ebnen den Weg für die „Neuen<br />
Eisenbahn-Alpentransversalen“ (NEAT) mit zwei Basistunneln<br />
am Gotthard und Lötschberg sowie deren<br />
Finanzierung mit anderen Projekten (FiNöV).<br />
1997<br />
Die BLS fusioniert mit den mitbetriebenen <strong>Bahn</strong>en<br />
zur BLS Lötschberg AG.<br />
1999 – 2001<br />
Auf die Privatisierung der SBB und deren Aufgliederung<br />
in Personenverkehr, Cargo und Infrastruktur<br />
folgte die Basisvereinbarung SBB – BLS zur<br />
Neuaufteilung der Aufgabenbereiche.<br />
2004<br />
Eröffnung der Neubaustrecke Mattstetten – Rothrist,<br />
die mit 200 km/h befahren werden darf.<br />
2007<br />
Inbetriebnahme des Lötschberg-Basistunnels.<br />
2010/2011<br />
Durchschlag der Ost- bzw. Weströhre des Gotthard-<br />
Basistunnels.<br />
Schmalspur- und Bergbahnen (in Auswahl)<br />
1871<br />
Die Vitznau–Rigi-<strong>Bahn</strong> (VRB), die erste Bergbahn<br />
Europas (Normalspur und Zahnrad), wird eröffnet.<br />
1888<br />
Mit der Gründung der Schmalspurbahn Landquart–<br />
Davos AG, die 1895 in „Rhätische <strong>Bahn</strong>“ (RhB) umbenannt<br />
und 1897 durch einen kantonalen<br />
Volksentscheid zur „Staatsbahn Graubündens“ wird,<br />
entsteht das größte Meterspurnetz der <strong>Schweiz</strong>. Es<br />
umfasst die Strecken Landquart – Klosters (1889) –<br />
Davos (1890), Reichenau-Tamins – Ilanz (1903) –<br />
Disentis (1912), Chur – Thusis – Celerina (1903) –<br />
St. Moritz (1904), Samedan – Pontresina (1908),<br />
Davos Platz – Filisur (1910) sowie Bever – Scuol-<br />
Tarasp (1913).<br />
1891<br />
Die Visp–Zermatt-<strong>Bahn</strong> (VZ) nimmt die Strecke<br />
Visp – Zermatt in Betrieb.<br />
1907 – 1914<br />
Eröffnung der Strecke Bellinzona – Mesocco (1907),<br />
der Bernina-<strong>Bahn</strong> St. Moritz – Tirano (1910) und der<br />
Chur–Arosa-<strong>Bahn</strong> (1914). Sie werden alle von eigenen<br />
Gesellschaften betrieben, die 1942/43 mit der<br />
RhB fusionieren.<br />
1915<br />
Die Brig–Furka–Disentis-<strong>Bahn</strong> (BFD) nimmt die Teilstrecke<br />
Brig – Gletsch in Betrieb, geht aber 1922<br />
in Konkurs. VZ und RhB setzen den Bau fort.<br />
1917<br />
Die Schöllenenbahn eröffnet die Strecke Göschenen<br />
– Andermatt<br />
1930<br />
Der erste „Glacier Express“ fährt von St. Moritz<br />
über Chur, Brig nach Zermatt.<br />
1961<br />
Die Furka–Oberalp-<strong>Bahn</strong> löst sich aus der Betriebsgemeinschaft<br />
mit der VZ.<br />
1981<br />
Die Furka-Bergstrecke wird stillgelegt. Die Züge<br />
fahren hier fortan in einem Tunnel.<br />
1999<br />
Die RhB eröffnet die Vereina-Linie Klosters –<br />
Selfranga mit dem 19 Kilometer langen Tunnel und<br />
erweitert ihr Netz auf rund 400 Kilometer.<br />
2003<br />
Furka–Oberalp- und Brig–Visp–Zermatt-<strong>Bahn</strong> fusionieren<br />
zur Matterhorn–Gotthard-<strong>Bahn</strong>.<br />
2004<br />
Die Luzern–Stans–Engelberg-<strong>Bahn</strong> kauft die Brünigbahn<br />
der SBB und bildet die neue Zentralbahn (zb).<br />
2008<br />
Albula- und Bernina-Strecke der RhB werden in das<br />
UNESCO-Welterbe aufgenommen.<br />
DR. HANS-BERNHARD SCHÖNBORN/GM<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
15
Chronik<br />
Die Gotthard-Bergstrecke ist nach<br />
wie vor eine wichtige Transitroute.<br />
Im Bild zwei Pärchen aus Re 4/4<br />
und Re 6/6 (Re 10/10 genannt)<br />
mit einem Zug des Kombinierten<br />
Ladungsverkehrs Florian Martinoff<br />
Das <strong>Schweiz</strong>er Eisenbahnnetz<br />
Der Sonderweg<br />
Im Vergleich zu ihren Nachbarn machte die <strong>Schweiz</strong> in der Eisenbahn-Entwicklung manches anders.<br />
Viele <strong>Bahn</strong>gesellschaften schufen ein dichtes Netz, selbst der Aufstieg des Individualverkehrs sorgte<br />
bestenfalls für eine gebremste Reduzierung des Schienennetzes. Wie war das möglich?<br />
Mit einer Streckenlänge von 4.876 Kilometern<br />
(Stand: 2010) hat die<br />
<strong>Schweiz</strong> bezogen auf ihre Fläche von<br />
41.285 Quadratkilometern neben der Tschechischen<br />
Republik das dichteste Eisenbahnnetz<br />
der Welt. Es ist zu fast 79 Prozent normalspurig<br />
und fast vollständig elektrifiziert.<br />
Die Züge verkehren bis auf wenige Ausnahmen<br />
nach einem festen Taktfahrplan, wobei<br />
die Knotenbahnhöfe in der Regel weniger als<br />
60 Minuten voneinander entfernt sind. Nach<br />
dem <strong>Schweiz</strong>er Eisenbahngesetz gehören auch<br />
Straßen- und schienengebundene Bergbahnen<br />
(z. B. Standseilbahnen) zu den Eisenbahnen<br />
– was die „Verkehrsdichte“ rechnerisch erhöht.<br />
Der Anteil der <strong>Bahn</strong> am gesamten Verkehrsaufkommen<br />
liegt beim Personenverkehr bei<br />
17 Prozent und beim Güterverkehr bei<br />
39 Prozent, einem Spitzenwert.<br />
Mit diesen Zahlen steht die <strong>Schweiz</strong> bestens<br />
da. Den Ruf als <strong>Bahn</strong>land Nummer eins<br />
in Europa verteidigt sie wacker – nicht zuletzt<br />
durch hohe Fahrgastzahlen. Dass die Verhältnisse<br />
so sind, verdankt sie einer kontinuierlichen<br />
Entwicklung und besonderen landesbezogenen<br />
Gegebenheiten.<br />
Schrittweiser Aufbau<br />
Die <strong>Bahn</strong>-Historie begann in dem Alpenland<br />
am 7. August 1847. Damals verkehrte der erste<br />
Zug in der <strong>Schweiz</strong>, die „Spanisch-Brötli-<br />
<strong>Bahn</strong>“ von Zürich nach Baden. Danach ging<br />
Kontinuierlicher Aufbau und landesbezogene Eigenheiten<br />
machten die <strong>Schweiz</strong> zum <strong>Bahn</strong>land Nr. 1<br />
es – mit einigen Irrungen und Wirrungen –<br />
steil bergauf. Das Eisenbahngesetz von 1852<br />
eröffnete Privatbahnen die Möglichkeit zum<br />
Streckenbau. Der Bedarf, viele, auch unwegsame<br />
Regionen zu erschließen, sorgte für reges<br />
Bauinteresse. Bis 1865 wuchs das Schienennetz<br />
auf 1.263 Kilometer an. Alle wichtigen<br />
Städte zwischen Bodensee und Genfersee waren<br />
angebunden, auch wenn die <strong>Bahn</strong>en unter<br />
finanziellen Problemen litten. Ein neues<br />
Eisenbahngesetz hielt am Privatbahnbau fest,<br />
gab dem Bund aber mehr Einfluss durch das<br />
Erteilen und Erneuern von Konzessionen. Politische<br />
Umwälzungen machten die <strong>Bahn</strong> zum<br />
Objekt der Machtpolitik, führten zu Parallelplanungen<br />
und zum Bankrott einer <strong>Bahn</strong>gesellschaft.<br />
Trotzdem war 1880 das normalspurige<br />
Schienennetz 2.448,5 Kilometer lang.<br />
Der Gotthard als Transitstrecke und die Zufahrtslinien<br />
Luzern – Immensee und Zug –<br />
Arth-Goldau wurden gebaut. Damit war das<br />
Hauptstreckennetz vollständig, als es die<br />
<strong>Schweiz</strong>erischen Bundesbahnen (SBB) am<br />
1. Januar 1902 übernahmen. Einziger „Sonderling“<br />
im SBB-Netz blieb die meterspuri-<br />
16
Das Eisenbahnnetz<br />
Vor dem <strong>Bahn</strong>hofsgebäude von Brig fahren die Züge der schmalspurigen<br />
Brig-Visp-Zermatt-<strong>Bahn</strong> ab (Bild von 1983)<br />
Peter Kusterer<br />
Betrieb bei der Rhätischen <strong>Bahn</strong>: Im Dezember 1988 steht ein Triebwagen<br />
mit einem Schneepflug im Depot Sand in Chur<br />
Slg. Toni Burger<br />
ge, teilweise mit Zahnstange ausgerüstete Brünigbahn<br />
Luzern – Meiringen – Interlaken Ost.<br />
Allgemein wuchs der Transitverkehr durch die<br />
<strong>Schweiz</strong>, bei Personen wie Gütern, was die Eisenbahn<br />
noch mehr förderte (und forderte).<br />
Touristische <strong>Bahn</strong>en<br />
Dazu kam seit dem späten 19. Jahrhundert der<br />
wachsende Tourismus. Ob nebelgeplagte Briten<br />
im sonnigen St. Moritz oder betuchte<br />
Deutsche und Russen auf Sommerfrische an<br />
den Alpenpässen, der Urlaubsverkehr boomte<br />
und mit ihm die Eisenbahn. Zahlreiche<br />
neue <strong>Bahn</strong>gesellschaften errichteten Schmalspur-<br />
und Bergbahnen mit touristischer Orientierung.<br />
Aus all diesen regionalen, lokalen,<br />
touristischen <strong>Bahn</strong>en und Bähnchen ragte die<br />
Rhätische <strong>Bahn</strong> (RhB) als „Bündner Staatsbahn“<br />
hervor, deren Stammnetz durch Fusionen<br />
erweitert wurde.<br />
Der Erste Weltkrieg und die anschließende<br />
Weltwirtschaftskrise bedeuteten für zahlreiche<br />
Bauvorhaben das Aus. Das Streckennetz veränderte<br />
sich in den nächsten Jahren kaum, bei<br />
den <strong>Bahn</strong>gesellschaften führten finanzielle<br />
Probleme zu Fusionen.<br />
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts<br />
erfasste dann eine Stilllegungswelle Straßenbahnen<br />
und jene (schmalspurigen) Nebenstrecken,<br />
die in oder unmittelbar neben einer<br />
Straße verliefen und dem Autoverkehr Platz<br />
machen mussten. Oft war auch das Rollmaterial<br />
überaltert. Dennoch hielten sich die<br />
Auswirkungen im Vergleich zu anderen europäischen<br />
Ländern in Grenzen. Noch immer<br />
(oder gerade jetzt) gab es vitales touristisches<br />
Interesse an der <strong>Schweiz</strong>, die Eisenbahnen wa-<br />
Der Streckenbau<br />
machte Olten zu<br />
einem der wichtigsten<br />
<strong>Bahn</strong>knoten der<br />
<strong>Schweiz</strong> (Foto mit<br />
ICN und Rangiereinheit,<br />
Juni 2003).<br />
Hier treffen sich die<br />
Strecken aus Basel,<br />
Luzern, Aarau, Bern<br />
und Solothurn<br />
Slg. Toni Burger<br />
ren als Transportmittel gefragt. Außerdem<br />
empfahl sich die Schiene oft als bestmögliche<br />
Verbindung. Buslinien wurden in vielen Fällen<br />
nicht zur Konkurrenz, sondern zum Zubringer<br />
der Eisenbahnen.<br />
Projekte in jüngerer Zeit<br />
In den letzten Jahren gibt es nun wieder namhafte<br />
Erweiterungs- und Modernisierungsprojekte.<br />
1999 wurden die Vereina-Linie und<br />
der Vereina-Tunnel der RhB fertig gestellt<br />
(Länge 22 Kilometer), 2003 und 2004 die<br />
zweite Doppelspur Zürich – Thalwil (zehn Kilometer)<br />
und die Neubaustrecke Mattstetten<br />
– Rothrist (45 Kilometer). 2007 folgte der<br />
Lötschberg-Basistunnel (35 Kilometer).<br />
Bis 2019 sollen die Basistunnels am Gotthard<br />
(57 Kilometer) und Ceneri (15 Kilometer)<br />
fertig sein und die Gotthard-Strecke zu einer<br />
„Flachbahn“ machen. In nächster Zeit<br />
sollen in Zürich der dritte unterirdische <strong>Bahn</strong>hof<br />
samt der „Durchmesserlinie“ Zürich-Oerlikon<br />
– Altstetten sowie die Verbindungen<br />
Genf – Annemasse und Mendrisio – Varese<br />
in Betrieb gehen. Außerdem soll die <strong>Schweiz</strong><br />
besser an das europäische Hochgeschwindigkeits-Netz<br />
angebunden werden. Das Land selber<br />
verfügt aufgrund der Topografie über keine<br />
Hochgeschwindigkeitsstrecken, es sei denn,<br />
man definiert die Neubaustrecke Mattstetten<br />
– Rothrist und die Basistunnel am Lötschberg<br />
und Gotthard als solche.<br />
Ab etwa 2015 sollen unter dem Titel „Zukünftige<br />
Entwicklung der <strong>Bahn</strong>infrastruktur“<br />
(ZEB) systemgefährdende Engpässe im nationalen<br />
Schienennetz beseitigt werden. Eine<br />
weitergehende Entwicklung der <strong>Bahn</strong>infrastruktur<br />
wird zurzeit bei der Erarbeitung der<br />
Programmbotschaft „<strong>Bahn</strong> 2030“ untersucht.<br />
Zuletzt gab es zwar Überlegungen zur Still legung<br />
kleinerer defizitärer Strecken beispielsweise<br />
in der Westschweiz. Dennoch gibt es bis<br />
dato keine Anzeichen dafür, dass der Sonderweg<br />
der <strong>Schweiz</strong> und ihr Ruf als Eisenbahnland<br />
in Gefahr wären.<br />
Dr. Hans-Bernhard Schönborn/MHZ<br />
ANZEIGE<br />
Dampf-Eisenbahn-Event in Chama, New-Mexico, USA:<br />
„Chama-Steam“ Excursions richtet 2013 wieder<br />
ein besonderes Eisenbahn-Event aus unter den Motto:<br />
„All Freight, All Steam, All Rio Grande“<br />
„Chama Steam Fall Madness 2013“<br />
vom 29. September bis 2. Oktober 2013<br />
Es erwartet Sie:<br />
Glühend goldene Espen, die bekannten spektakulären<br />
Scheinanfahrten und<br />
<br />
Wegen der Netzdichte in der <strong>Schweiz</strong> liegen in manchen <strong>Bahn</strong>höfen<br />
Schmalspur- und Normalspurgleise, wie hier in Luzern (1983) Peter Kusterer<br />
www <br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 17
Chronik<br />
Slg. Dr. Dietmar Beckmann<br />
18
Historische Streckenkarte<br />
Streckenkarte 1939<br />
Das<br />
Netz<br />
damals<br />
Die SBB und alle anderen –<br />
so teilt die Karte der späten<br />
30er-Jahre das <strong>Schweiz</strong>er<br />
Netz ein. Erstaunlich viel<br />
blieb bis in die heutigen Tage<br />
erhalten; nur einige wenige<br />
Strecken (und <strong>Bahn</strong>en) sind<br />
seither verschwunden<br />
1939 war auch für die SBB ein besonderes<br />
Jahr: Zur Landesausstellung präsentierte sie<br />
sich unter anderem mit einem Informationsbüchlein<br />
(o.) und mit einer Ellok Ae 8/14<br />
Athletin am Lötschberg: Ellok Be 6/8 (später<br />
Ae 6/8) der BLS, hier eine Lok der ersten Serie<br />
in Ausserberg Slg. Knipping, Slg. Frühwein (o.)<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 19
BLS/Lötschbergbahn<br />
Die Entwicklung der BLS<br />
Die neue Alpenbahn<br />
Mit der Eröffnung der Lötschbergbahn trat im Juni 1913 ein neues <strong>Schweiz</strong>er<br />
Eisen bahnverkehrsunternehmen in Erscheinung. Die Bern-Lötschberg-Simplon-<strong>Bahn</strong><br />
stieg zur zweitgrößten <strong>Bahn</strong>gesellschaft des Alpenlandes auf, machte den SBB<br />
abschnittsweise Konkurrenz und ließ mit wegweisen den Neuerungen aufhorchen<br />
20
Die Entwicklung der BLS<br />
Auf der Lötschberg-Südrampe rollt im September<br />
1961 eine Ellok Ae 6/8 mit einem Reisezug Basel –<br />
Brig talwärts, links die Rhône-Ebene. Zwischen der<br />
Station Goppenstein oben am Berg und dem <strong>Bahn</strong>hof<br />
Brig unten liegen mehr als 500 Höhenmeter<br />
W. Tausche/Slg. Thomas Wunschel, BLS (Logo)<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
21
BLS/Lötschbergbahn<br />
LINKS OBEN Mit der<br />
Drehgestell-Ellok<br />
Ae 4/4 geht die BLS<br />
in den 40er-Jahren<br />
technisch neue<br />
Wege. Noch in den<br />
80er-Jahren werden<br />
die Loks vor Personenzügen<br />
eingesetzt<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
RECHTS OBEN Schon<br />
1926 fuhr die BLS<br />
erste Autos durch<br />
den Lötschbergtunnel.<br />
Ab Frühjahr<br />
1960 gibt es dort<br />
den planmäßigen<br />
„Autoverlad“ zwischen<br />
Kandersteg<br />
und Goppenstein<br />
(Bild in Goppenstein)<br />
Archiv BLS<br />
Slg. Toni Burger<br />
LINKS UNTEN Am<br />
14. Juni 1911 findet<br />
die offizielle Durchschlagsfeier<br />
für den<br />
Lötschbergtunnel<br />
statt. Der Bauzug<br />
bringt die Festgäste<br />
von Kandersteg<br />
nach Goppenstein<br />
Archiv BLS<br />
RECHTS UNTEN Die beiden<br />
größten <strong>Bahn</strong>gesellschaften<br />
der<br />
<strong>Schweiz</strong> beisammen:<br />
Im <strong>Bahn</strong>hof Spiez<br />
machen Züge der<br />
SBB und der BLS<br />
Station<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
22
<strong>Bahn</strong>verkehr im Laufe der Zeit<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
23
BLS/Lötschbergbahn<br />
An der Südrampe liegt die Station Lalden, aufgenommen in der Frühzeit der BLS. Links finden<br />
sich das WC-Häuschen und der akkurat gestaltete Gemüsegarten von Frau Vorstand Archiv BLS<br />
Darstellung der Schienenverbindung von<br />
Bern über die neu eröffnete Lötschberg-<strong>Bahn</strong><br />
nach Brig. Die Berner Alpenbahngesellschaft<br />
Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) hatte ihre<br />
Verkehrsader fertig gestellt – und eine Ungleichheit<br />
im <strong>Bahn</strong>netz ausgeglichen.<br />
Denn mit der Inbetriebnahme der Gotthardbahn<br />
im Jahr 1882 war der Kanton Bern<br />
mit der gleichnamigen Kantons- und Bundeshauptstadt<br />
von der<br />
alpenquerenden Nord–<br />
Süd-Hauptverkehrsachse<br />
abgeschnitten worden.<br />
Deshalb entschloss sich<br />
der Kanton, all seine föderalistischen<br />
Rechte auszuschöpfen<br />
und eine eigene<br />
Transitbahn zu<br />
bauen, was aber zur Folge<br />
hatte, dass keine finanzielle<br />
Unterstützung durch<br />
die Eidgenossenschaft zu<br />
erwarten war. Die Bundesbehörden und Bundesbahnen<br />
wehrten sich vehement gegen eine<br />
mit der Gotthard-Strecke konkurrierende<br />
Transitachse. Unerwartet kam ideelle und finanzielle<br />
Unterstützung aus Frankreich, weil<br />
das Land 1871 das Elsass und Lothringen<br />
samt dem Grenzübergang Basel an Deutschland<br />
verloren hatte; Wirtschaftskreise in Paris<br />
waren sehr an einer internationalen Transitstrecke<br />
Frankreich – <strong>Schweiz</strong> – Italien mit<br />
dem Grenzort Delle interessiert.<br />
Slg. Toni Burger<br />
Reisende in einem Zug vor der Fahrt nach Brig. Mit der Lötschberg-Route gab es von Bern<br />
und Basel eine schnelle Verbindung in die südliche <strong>Schweiz</strong><br />
Archiv BLS (2, auch S. 25 o.)<br />
Slg. Toni Burger<br />
24<br />
Gleich neben der Streckenkarte setzt der<br />
Text ein. „Der sonnige Süden, das<br />
Land der Kunst, und der ernstere Norden<br />
mit seinen vielberühmten Naturschönheiten<br />
reichen sich wiederum nachbarlich die<br />
Hand. Ein weiteres Band verknüpft sie durch<br />
gemeinsame Interessen. Dem modernen Weltfahrer<br />
ist ein neues Tor geöffnet, das auf der<br />
einen Seite in die herbe, hehre Schönheit<br />
der bernischen Alpenwelt<br />
schaut, auf der anderen<br />
nach der malerischen Pracht<br />
der Lombardei gerichtet ist.<br />
Am Lötschberg, auf der<br />
Grenze zwischen Bern und<br />
Wallis, ist dieses Tor geöffnet,<br />
durch den Lötschberg<br />
eine neue Heerstrasse der<br />
Völker geführt worden. Es<br />
ist dies die Berner Alpenbahn,<br />
die künftig neben<br />
Gotthard und mit der<br />
Simplonbahn als gleichwertiges<br />
Instrument des Verkehrs und ebenbürtige<br />
technische Schöpfung dastehen wird.<br />
Die interessantesten Bildungsstätten Italiens<br />
sind dadurch mit dem Herzblatt der <strong>Schweiz</strong>,<br />
mit dem berühmten Naturgarten Berner<br />
Oberland durch einen direkten Schienenstrang<br />
verbunden.“ So poetisch beginnt die<br />
Broschüre „Die Berner Alpenbahn“ 1913 die<br />
Nach dem Bau der Gotthardbahn lag der Kanton<br />
Bern abseits. Also baute er eine eigene Transitbahn<br />
Der Bau der Lötschbergbahn<br />
Für diese Transitstrecke wurden mehrere Linienführungen<br />
via Frutigen und Lötschberg<br />
erarbeitet. Am Schluss standen sich das<br />
Lötschbergprojekt und die Wildstrubelvariante<br />
gegenüber, welche die bernische Kantonsregierung<br />
in zwei Parteien spalteten.<br />
Schließlich gewann das Initiativkomitee „Pro<br />
Lötschberg“, und wenige Monate vor Baubeginn<br />
wurde am 27. Juli 1906 die „Berner Alpenbahngesellschaft<br />
Bern–Lötschberg–Simplon<br />
BLS“ gegründet. Am 1. Januar 1907<br />
übernahm sie für rund 3,6 Millionen <strong>Schweiz</strong>er<br />
Franken die Spiez–Frutigen-<strong>Bahn</strong> (SFB),<br />
die bereits seit dem 24. Juli 1901 zwischen den<br />
im Namen genannten Orten fuhr.<br />
Die Arbeiten an der rund 58 Kilometer langen<br />
Bergstrecke Frutigen – Kandersteg – Brig<br />
wurden an ein französisches Konsortium vergeben.<br />
Die Arbeiten am 13,7 Kilometer langen<br />
Lötschbergtunnel zwischen Kandersteg<br />
und Goppenstein begannen am 15. Oktober<br />
1906, also noch im selben Jahr, in dem der<br />
Simplontunnel zwischen Brig und Iselle eingeweiht<br />
wurde. 1907 verlangten die Bundesbehörden<br />
von der BLS, den Lötschbergtunnel<br />
auf Doppelspur auszubauen und seine Zufahrtsrampen<br />
mit einem entsprechenden Profil<br />
zu projektieren. Während der Tunnel zweispurig<br />
gebaut wurde, scheiterte das Vorhaben,<br />
den Unterbau für ein zweites Gleis auf der Gesamtstrecke<br />
anzulegen, aus finanziellen Gründen.<br />
Als am 24. Juli 1908 während der Ausbrucharbeiten<br />
unter dem Gasterntal große<br />
Mengen Wasser und Sedimentgestein einbrachen,<br />
verloren 25 italienische Mineure ihr Leben.<br />
Die Arbeiten ruhten zunächst ein halbes<br />
Jahr, dann wurde der Stollen zugemauert und
Die Anfänge der BLS<br />
Mit dem eindrucksvollen Kanderviadukt überspannt<br />
die Lötschbergbahn bei Frutigen das<br />
Kandertal. In den 50er-Jahren ist hier eine Ellok<br />
Ae 4/4 samt Personenzug unterwegs<br />
mittels drei Kurven „umfahren“, so dass sich<br />
der Lötschbergtunnel auf 14,6 Kilometer verlängerte.<br />
Am 31. März 1911 war der Berg<br />
durchstoßen.<br />
Die Zufahrtsrampen zum Lötschbergtunnel<br />
erforderten auf beiden Seiten zahlreiche<br />
Kunstbauten, insgesamt 33 Tunnel, drei Lawinenschutzgalerien<br />
und 22 Brücken. Am<br />
19. Juni 1913 wurde die Gesamtstrecke Spiez<br />
– Frutigen – Kandersteg – Brig feierlich dem<br />
Verkehr übergeben. Während die Versuchsstrecke<br />
Spiez – Frutigen zunächst mit 15 Hz<br />
elektrifiziert worden war, wurde die Gesamtstrecke<br />
von Anfang an mit 15 kV 16 2/3 Hz<br />
Wechselstrom betrieben, weil sich die Verwaltungen<br />
von Preußen, Bayern und Baden<br />
auf diesen Wert als <strong>Bahn</strong>frequenz geeinigt hatten.<br />
Die internationalen Transitzüge Frankreich<br />
– <strong>Schweiz</strong> – Italien konnten jedoch nicht<br />
lange geführt werden; bald schon brach der<br />
Erste Weltkrieg aus.<br />
Weiterentwicklung der BLS<br />
Per 1. Januar 1913 fusionierte die BLS mit der<br />
Thunerseebahn (TSB), welche – neben der<br />
Schifffahrt auf dem Thuner- und Brienzersee<br />
– die <strong>Bahn</strong>strecke Scherzligen (Thun) – Spiez<br />
– Interlaken – Bönigen betrieb. 1915 kam<br />
dann die Strecke der Münster–Lengnau-<strong>Bahn</strong><br />
(MLB) hinzu, die aber rechtlich von Anfang<br />
an Bestandteil der BLS war.<br />
HINTERGRUND: DIE RIVALINNEN BLS UND SBB<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts entbrannte in der<br />
<strong>Schweiz</strong> ein heftiger Streit, ob der Privatbahnbau<br />
oder das Prinzip der Staatsbahn zu bevorzugen<br />
sei. Das Eisenbahngesetz von 1852<br />
schrieb die kantonale Eisenbahnhoheit fest,<br />
was zu einer rasanten Entwicklung des Streckennetzes<br />
führte, aber auch zu Wildwuchs,<br />
parallelen Streckenführungen und finanziellen<br />
Problemen bei vier Fünfteln aller <strong>Bahn</strong>gesellschaften.<br />
Daher beschloss das <strong>Schweiz</strong>ervolk<br />
am 20. Februar 1898 die Verstaatlichung der<br />
großen Privatbahnen. Ab 1. Januar 1902 befand<br />
sich das Hauptstreckennetz samt der inzwischen<br />
gebauten Gotthard-Route im Besitz<br />
der <strong>Schweiz</strong>erischen Bundesbahnen SBB.<br />
Nach anfänglicher Skepsis erkannten die Veantwortlichen<br />
im Kanton Bern bald die Entwicklungsmöglichkeiten<br />
der Eisenbahn,<br />
insbesondere der Simplonbahn für den eigenen<br />
Kanton; schließlich brauchte der Simplon-<br />
Tunnel eine Anbindung nach Norden. Daher<br />
unterstützten sie die Jura–Simplon-<strong>Bahn</strong>.<br />
Nach der Verstaatlichung auch dieser <strong>Bahn</strong><br />
zeigten die SBB aber keinerlei Interesse an<br />
einer Lötschberg-Route, war sie doch eine<br />
Konkurrenz für den Gotthard. Also gründete<br />
der Kanton Bern „seine eigene Privatbahn“,<br />
die BLS. Die Zuständigkeiten waren klar: Die<br />
BLS betrieb die Lötschberg-Strecke und die<br />
„mitbetriebenen <strong>Bahn</strong>en“, die SBB waren für<br />
den größten Teil des Normalspurnetzes zuständig,<br />
wobei der Interessenschwerpunkt auf<br />
dem Gotthard und den Zufahrtslinien lag.<br />
Konkurrenz und Kooperation<br />
Auch wenn die Verhältnisse – SBB an erster,<br />
BLS an zweiter Stelle – lange Zeit so blieben,<br />
gab es zeitweilige Rivalitäten. Etwa, wenn<br />
fahrzeugtechnische Innovationen der BLS die<br />
SBB als weniger fortschrittlich erscheinen ließen.<br />
Als in den 1980er-Jahren umsteigefreie<br />
Direktverbindungen etwa von Basel nach Domodossola<br />
eingerichtet wurden, verließen<br />
immer öfter BLS-Fahrzeuge das angestammte<br />
Gebiet und tauchten im SBB-Netz auf. Umgekehrt<br />
fuhren SBB-Garnituren am Lötschberg.<br />
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden in<br />
der Europäischen Union viele ehemalige<br />
Staatsbahnen zu Aktiengesellschaften (im Besitze<br />
des Staates), also (scheinbar) Privatbahnen<br />
mit aufgeteilten Geschäftsbereichen.<br />
Auch die SBB teilte man 1999 in eine Aktiengesellschaft<br />
mit den Divisionen Personenverkehr,<br />
Cargo und Infrastruktur auf. Die verhielt<br />
sich bald darauf kapitalorientiert und entwickelte<br />
eine gewisse Begehrlichkeit, sich die<br />
Konkurrentin am Lötschberg einzuverleiben.<br />
Doch dazu kam es nicht. Vielmehr unterzeichneten<br />
SBB und BLS am 15. Mai 2001 eine Basisvereinbarung,<br />
welche die Aufgabengebiete<br />
der beiden <strong>Bahn</strong>unternehmen neu absteckte<br />
und Synergien schaffen sollte. Die BLS übernahm<br />
ab Ende 2004 die System- und Marktverantwortung<br />
für die S-<strong>Bahn</strong> Bern, die zweitgrößte<br />
S-<strong>Bahn</strong> der <strong>Schweiz</strong>, sowie die RegioExpress-<br />
Züge Bern – Luzern, während die SBB neu den<br />
Personenfernverkehr auf dem BLS-Netz verantwortete.<br />
Im Cargo- und Infrastruktur-Bereich<br />
wurden die Tätigkeiten von SBB und BLS ebenfalls<br />
neu definiert, wobei im Cargo- Bereich teilweise<br />
die Konkurrenz-Situation erhalten blieb.<br />
Bei der Umsetzung dieser Basis vereinbarung<br />
kam es auch zu einem Austausch von Rollmaterial<br />
und Personal.<br />
HBS/MHZ<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
25
BLS/Lötschbergbahn<br />
Lieblich und gemütlich anzuschauen ist der Endbahnhof Bönigen, in dem im Oktober 1963 ein Triebzug die Verbindung nach Interlaken Ost herstellt.<br />
Später ersetzen Autobusse den Zugverkehr auf der Stichstrecke<br />
Friedhelm Ernst<br />
eigenen Verwaltungsräten waren, lagen Betrieb<br />
und Verwaltung bei der BLS (bzw. vorher<br />
bei der TSB). Dadurch konnten Fahrzeuge<br />
und Personal freizügig eingesetzt<br />
werden. Nur über die Rollmaterialbeschaffungen<br />
entschieden die einzelnen Verwaltungsräte,<br />
so dass es in diesem Bereich zu<br />
Unterschieden kam und die Fahrzeuge das<br />
Kürzel der jeweiligen <strong>Bahn</strong>gesellschaft trugen.<br />
Mehrheitseigner aller <strong>Bahn</strong>en war der<br />
Kanton Bern, welcher nach dem Ersten<br />
Weltkrieg wegen des Kohlemangels per Regierungsdekret<br />
entschied, dass die <strong>Bahn</strong>en zu<br />
elektrifizieren seien, was den <strong>Bahn</strong>en den<br />
Spitznamen „Berner Dekretsbahnen“ eintrug.<br />
„Dekretsmühlen“ wurden im Volksmund<br />
die Elektrolokomotiven genannt, die<br />
der Kanton auch gleich bestellte.<br />
Noch ohne Zierstreifen und Wappen präsentiert sich die erste der kräftigen Doppelloks Ae 8/8<br />
im Mai 1959 in Gwatt fürs Foto. Die „Munis“ (Stiere) fuhren vor allem im Güterverkehr Archiv BLS<br />
Betriebsverträge bestanden mit der Spiez–<br />
Erlenbach-<strong>Bahn</strong> und der Erlenbach-Zweisimmen-<strong>Bahn</strong>,<br />
welche 1942 zu der 35 Kilometer<br />
langen Spiez–Erlenbach–Zweisimmen-<strong>Bahn</strong><br />
(SEZ) fusionierten, des Weiteren mit der Gürbetal-<br />
und Bern–Schwarzenburg-<strong>Bahn</strong>, deren<br />
Fusion zur 52 Kilometer langen Gürbetal–<br />
Bern–Schwarzenburg-<strong>Bahn</strong> (GBS) 1944 stattfand,<br />
und mit der 43 Kilometer langen, 1901<br />
eröffneten Bern–Neuenburg-<strong>Bahn</strong> (BN).<br />
Während die „mitbetriebenen <strong>Bahn</strong>en“<br />
rechtlich eigenständige Gesellschaften mit<br />
Die ersten Betriebsjahre<br />
Am 18. September 1913 wurde der internationale<br />
Personenverkehr am Lötschberg aufgenommen.<br />
Er umfasste ein Zugpaar Boulogne<br />
– Paris Est – Delle – Bern – Lötschberg<br />
– Milano, zwei Zugpaare Paris Est – Milano<br />
und je ein Zugpaar Basel SBB – bzw. Bern –<br />
Milano. Außerdem gab es grenzüberschreitenden<br />
Güterverkehr, der zu Beginn des Ersten<br />
Weltkriegs stark zunahm; an Spitzentagen<br />
wurden bis zu acht Kohlezüge Deutschland –<br />
Italien über den Lötschberg befördert. Durch<br />
den Kriegseintritt Italiens 1915 brach der in-<br />
26
Betriebsbeginn und erste Erfolge<br />
ÜBERBLICK KENNZAHLEN DER BLS, 1959<br />
Bern-Lötschberg-Simplon-<strong>Bahn</strong> (BLS)<br />
Eisenbahnfahrzeuge<br />
Elloks 25 (+ MB: 14)<br />
Elektr. Traktoren 9<br />
Dampfloks 1<br />
Triebwagen 7 (+ MB: 19)<br />
Diensttriebfahrzeuge 4 (+ MB: 2)<br />
Personenwagen 95 (+ MB: 27)<br />
Gepäckwagen 24 (+ MB: 5)<br />
Güterwagen 230 (+ MB: 179)<br />
Privatwagen - (+ MB: 3)<br />
Dienstwagen 89 (+ MB: 23)<br />
Länge des Streckennetzes (km) 118 (+ MB: 130)<br />
Beförderungsleistungen<br />
Zugdienst (km) 2.686.351<br />
Vorspann, Rangieren etc. 387.856<br />
Beförderte Personen 6.763.959<br />
Personenkilometer 118.854.576<br />
Einnahmen (CHF) 12.956.417<br />
Beförderte Gesamtgütertonnen 3.256.310<br />
Güterverkehr im Transit (t) 1.645.703<br />
Einnahmen (CHF) 22.771.770<br />
Verkehrs-Einnahmen (CHF) 35.728.187<br />
Motorfahrzeugtransport durch den Lötschbergtunnel<br />
Automobile 7.016<br />
Motorräder 1.205<br />
Mitarbeiter<br />
1.837, davon<br />
allg. Verwaltung 160 (+ 6*)<br />
<strong>Bahn</strong>bewachung 39 (+ 7*)<br />
Stationsdienst 406 (+ 6*)<br />
Zugbegleitung 184<br />
Zugförderung 251<br />
Unterhalt der <strong>Bahn</strong>anlagen 240 (+ 43*)<br />
Elektrische Anlagen 62 (+ 2*)<br />
Unterhalt der Fahrzeuge 411<br />
Schiffsbetrieb Thuner- und Brienzersee 84 (+ 5*)<br />
Schifffahrt auf dem Thunersee<br />
Anzahl der Schiffe 11<br />
Beförderte Personen 1.189.346<br />
Einnahmen (CHF) 1.627.952<br />
Schifffahrt auf dem Brienzersee<br />
Anzahl der Schiffe 5<br />
Beförderte Personen 380.721<br />
Einnahmen (CHF) 277.820<br />
Anmerkungen: MB = Mitbetriebene <strong>Bahn</strong>en; diese Angaben kommen<br />
zum jeweiligen Bestand der BLS noch hinzu<br />
*Aushilfs-Personal<br />
Betriebsleistungen der mitbetriebenen <strong>Bahn</strong>en (MB)<br />
Bern-Neuenburg-<strong>Bahn</strong> (BN)<br />
Betriebslänge (km) 43<br />
Beförderte Personen 2.453.575<br />
Beförderte Fracht (t) 328.597<br />
Einnahmen (CHF) 4.824.095<br />
Simmentalbahn (SEZ)<br />
Betriebslänge (km) 35<br />
Beförderte Personen 806.458<br />
Beförderte Fracht (t) 93.947<br />
Einnahmen (CHF) 2.520.819<br />
Gürbetal-Bern-Schwarzenburg-<strong>Bahn</strong> (GBS)<br />
Betriebslänge (km) 52<br />
Beförderte Personen 2.559.794<br />
Beförderte Fracht (t) 346.956<br />
Einnahmen (CHF) 4.133.281<br />
Quelle: Heft Bern-Loetschberg-Simplon, 3. Auflage, Bern 1960<br />
gebaute Elloks der Reihe<br />
Be 6/8 mit den Nummern<br />
201 bis 204. Die<br />
neuen Lokomotiven besaßen<br />
Einzelachsantrieb<br />
und beeindruckten<br />
durch ihre Leistungswerte:<br />
Sie konnten<br />
die Zughakenlast von<br />
510 Tonnen auf einer<br />
27-Promille-Steigung<br />
mit 50 km/h befördern.<br />
Die Höchstgeschwindigkeit<br />
lag bei<br />
75 km/h, 1939 nach<br />
einem Getriebe-Umbau bei 90 km/h. Damit<br />
erschloss die BLS im Lokomotivbau neue Dimensionen.<br />
Die zweite Serie mit den Nummern<br />
205 bis 208, gebaut 1939 bis 1943 von<br />
SLM und SAAS, hatte runde Führerstände und<br />
eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, so<br />
dass die Typenbezeichnung auf „Ae 6/8“ geändert<br />
wurde. Eine weitere Neuheit war, dass diese<br />
Loks sitzend, nicht mehr stehend bedient<br />
wurden. Die zweite Serie verfügte über eine Siternationale<br />
Verkehr fast vollständig zusammen.<br />
Ebenfalls 1915 eröffnete die BLS zwischen<br />
Moutier und Lengnau die „Grenchenberglinie“<br />
mit dem 8,5 Kilometer langen<br />
Grenchenbergtunnel, welche über den Grenzort<br />
Delle und Grenchen bzw. Biel die internationale<br />
Linie Frankreich – <strong>Schweiz</strong> – Italien<br />
hätte herstellen sollen. 1919 kamen jedoch<br />
durch das Versailler Abkommen das Elsass und<br />
Lothringen wieder zu Frankreich, so dass der<br />
internationale Verkehr über Basel/St-Louis abgewickelt<br />
wurde. Delle verlor seine Bedeutung<br />
für den Transitverkehr.<br />
Die Zwischenkriegszeit<br />
Da der Güterverkehr in den 20er-Jahren<br />
hauptsächlich über die direktere, neu elektrifizierte<br />
Gotthard-Strecke abgewickelt wurde,<br />
wuchs die Belegung der Lötschbergbahn erst<br />
in der zweiten Hälfte der 20er-Jahre wieder<br />
nennenswert. Ab 1924 gab es erneut zwei internationale<br />
Zugpaare, nämlich Boulogne –<br />
bzw. Paris Est – Lötschberg – Milano und Basel<br />
– Milano.<br />
Der zunehmende Zugverkehr in den 20er-Jahren<br />
beseitigte alle Zweifel am Wert der Lötschbergbahn<br />
Auch der Güterverkehr zwischen Deutschland<br />
und Italien über die Lötschberg–Simplon-Route<br />
nahm jetzt zu und der innerschweizerische<br />
Verkehr ins und vom Wallis<br />
erlebte einen großen Aufschwung. Dazu trugen<br />
auch die 1926 beginnenden Autotransporte<br />
zwischen Kandersteg und Goppenstein<br />
bzw. anderen Verladestationen bei. Jetzt zweifelte<br />
niemand mehr am politischen und wirtschaftlichen<br />
Wert der Lötschberg-Strecke.<br />
Weil die vorhandenen Elektrolokomotiven<br />
der Reihe Be 5/7 den steigenden Ansprüchen<br />
nicht mehr genügten, beschaffte die BLS zwischen<br />
1926 und 1931 vier von Breda und SAAS<br />
Slg. Toni Burger<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
27
BLS/Lötschbergbahn<br />
Wie die SBB setzte die BLS im Rangierdienst auf Stangen-Elloks. Im<br />
September 1970 ist eine Ee 3/3 in Spiez im Einsatz Albert Schöppner (2)<br />
Aus dem Traktionsteil der Triebwagen CFe 2/6 entstanden zwei Rangier-Elloks<br />
Te 2/3, genannt „Halbesel“ (Lok 32 in Spiez, 1965)<br />
ÜBERBLICK KENNZAHLEN DER BLS AG, STAND 31.12.2011<br />
Streckennetz<br />
Netzlänge der Betriebsführung<br />
520 km<br />
Netzlänge im Eigentum der BLS AG (Infrastruktur)<br />
436 km<br />
Befahrenes Liniennetz <strong>Bahn</strong> und Bus<br />
700 km<br />
Entwicklung Verkehr und Infrastruktur 2011<br />
Reiseverkehr (Millionen Personen)<br />
Regionalverkehr <strong>Bahn</strong> und Bus 54,8<br />
Schiff 0,9<br />
Total 55,7<br />
Autoverlad (Millionen transportierte Fahrzeuge)<br />
Kandersteg – Goppenstein 1,3<br />
Cargo (Millionen Nettotonnenkilometer) 3.826<br />
Infrastruktur (Millionen Bruttotonnenkilometer)<br />
Transitgüterzüge auf der Lötschbergachse 1.860,2<br />
Trassenkilometer (gefahrene Millionen auf eigener Infrastruktur)<br />
Personenverkehr 11,7<br />
Güterverkehr 2,0<br />
Total 13,7<br />
Energieverbrauch <strong>Bahn</strong>strom<br />
Millionen Kilowattstunden 166,9<br />
Mitarbeitende<br />
Personenverkehr (<strong>Bahn</strong>, Bus und Schiff) 274<br />
Infrastruktur 746<br />
<strong>Bahn</strong>produktion 1.414<br />
Management Services (Stäbe) 199<br />
BLS Cargo AG 80<br />
BLS Cargo Italia s.r.l. 19<br />
BLS Cargo Deutschland 8<br />
Busland AG 96<br />
Total 2.836<br />
Konzernfinanzen in 1.000 CHF<br />
Betriebsaufwand 910.694<br />
Betriebsertrag 895.950<br />
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 14.744<br />
Betriebsergebnis vor Steuern (EBT) 836<br />
Konzerngewinn 233<br />
Aktienkapital in Prozent<br />
Bund 21,70<br />
Kanton Bern 55,75<br />
Nicht stimmberechtigte Aktien 7,83<br />
Natürliche und juristische Personen 6,11<br />
Andere Kantone, Gemeinden 8,61<br />
cherheitssteuerung und die von den <strong>Schweiz</strong>erischen<br />
Bundesbahnen (SBB) eingeführte<br />
Zugsicherung Signum. Die erste Serie wurde<br />
1955/56 – auch äußerlich – angepasst.<br />
Den nächsten, auch international bedeutsamen<br />
Meilenstein im Lokomotivbau setzte die<br />
BLS 1944 mit den Elloks der Reihe Ae 4/4. Bei<br />
ihnen handelte es sich um die erste wirklich leistungsstarke,<br />
laufachslose Drehgestell-Lok, die<br />
Vorbild für viele andere Baureihen im In- und<br />
Ausland wurde. Sie konnte 400 Tonnen auf einer<br />
27-Promille-Steigung mit 75 km/h befördern!<br />
1965/66 wurden die Nummern 253 –<br />
256 in Doppellokomotiven Ae 8/8 umgebaut.<br />
Zweiter Weltkrieg und<br />
Nachkriegszeit<br />
Der Zweite Weltkrieg führte wieder zu einem<br />
Zusammenbruch des Verkehrs über den Lötschberg,<br />
zumal der anschließende Simplon-Tunnel<br />
strategische Bedeutung hatte. Nach dem Krieg<br />
erholte sich der Verkehr nur langsam, so dass erst<br />
1954 das Vorkriegsniveau wieder erreicht wurde.<br />
Erfolgreich gestaltete sich der „Autoverlad“,<br />
der am 1. Juni 1960 fahrplanmäßig aufgenommen<br />
wurde. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung<br />
nahm der Autoverkehr rasant zu, die<br />
geplante Autobahn durch den Rawil bedrohte<br />
den Autoverlad und damit ein wichtiges Standbein<br />
der BLS stark. Doch wurde die Rawil-Autobahn<br />
nach vehementen Protesten der Bevölkerung<br />
zu den Akten gelegt.<br />
Mehr Kapazität für die Strecke: In den 70er-Jahren<br />
begann der Ausbau auf durchgehend zwei Gleise<br />
Angesichts des steigenden Verkehrsaufkommens<br />
drängte sich eine Ausweitung der Streckenkapazitäten<br />
mehr und mehr auf, was die BLS<br />
– mit Unterstützung aus der Politik – ab den<br />
70er-Jahren anging. 1976 genehmigte der Bundesrat<br />
einen Baukredit von 620 Millionen Franken<br />
für den doppelspurigen Ausbau der Lötschbergstrecke<br />
in mehreren Phasen. Ein Jahr später<br />
begannen die Arbeiten, am 8. Mai 1992 konnte<br />
schließlich die durchgehende Doppelspur eingeweiht<br />
werden. 1993 erhielt die BLS vom Bund<br />
den Auftrag, auf ihrer Linie einen Huckepackkorridor<br />
für den Transport von Straßenfahrzeu-<br />
28
Die 50er- bis 90er-Jahre<br />
Güterverkehr im Kleinen mit einem Gepäcktransport bei der BLS. Anno 1959 machte diese Beförderungsart 3,49 % im Gesamtgüterverkehr<br />
der <strong>Bahn</strong> aus. Den Löwenanteil hatte der allgemeine Güterverkehr inne (90,2 %); der Postverkehr lag bei 5,22 %, der Tierverkehr bei 1,09 %<br />
Slg. Toni Burger<br />
gen von 2,5 Metern Breite und<br />
vier Metern Eckhöhe zu ermöglichen.<br />
Die Bauarbeiten begannen<br />
im Januar 1994, doch die<br />
Inbetriebnahme dieses Transitkorridors<br />
verzögerte sich wegen<br />
geologischer Probleme auf der<br />
(italienischen) Simplon-Südseite.<br />
Der Betrieb der „Rollenden<br />
Autobahn“ (RoLa) Novara (I) –<br />
Freiburg im Breisgau (D) begann<br />
erst am 11. Juni 2001.<br />
Auch fahrzeugtechnisch<br />
betrat die BLS Neuland.<br />
Nachdem die SBB ab 1991<br />
mit der Re 460 eine Drehstrom-Ellok beschafft<br />
hatten, zog die BLS 1994–97 mit der Re 465<br />
nach. Sie sieht der SBB-Version ziemlich<br />
ähnlich, übertrifft diese aber leicht an Leistungs<br />
fähigkeit und erreicht mit 6.400 kW einen<br />
Spitzenwert, der seinesgleichen sucht.<br />
Wettbewerb unter den <strong>Bahn</strong>en<br />
Am Ende des 20. Jahrhunderts veränderte<br />
sich das wirtschaftliche, politische und rechtliche<br />
Umfeld für die Eisenbahnen in Europa<br />
so grundlegend, dass auch bei den Schwei-<br />
Die Schifffahrt ist nach wie vor Teil des Angebots der BLS. Hier das Dampfschiff „Lötschberg“<br />
auf dem Brienzersee unterhalb der Gießbachfälle<br />
Archiv BLS (2, auch Bild o.)<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
29
BLS/Lötschbergbahn<br />
Dreifachtraktion mit drei BLS-Ellokgenerationen vor einem RoLa-Zug. Wenn eine Re 465 als „Dolmetscher“ eingereiht<br />
ist, können alle Streckenloks der BLS von einem Lokführer in Vielfachsteuerung gefahren werden Dr. Dietmar Beckmann<br />
Die BLS richtete sich frühzeitig strategisch<br />
neu aus und fusionierte zum 1. Januar 1997<br />
mit den „mitbetriebenen <strong>Bahn</strong>en“ SEZ, GBS<br />
und BN zur „BLS Lötschbergbahn AG“. Es<br />
entstand eine neue Organisationsstruktur, die<br />
auf den drei ergebnisorientierten Kerngeschäften<br />
Personenverkehr, Cargo und Infrastruktur<br />
aufbaute; dabei<br />
wurden die Bereiche<br />
„Infrastruktur“<br />
und „Verkehr“ rechnerisch<br />
und organisatorisch<br />
getrennt.<br />
Im Rahmen ihrer<br />
Neuausrichtungen einigten<br />
sich die Konkurrentinnen<br />
BLS und<br />
SBB auf eine neue Aufgabenteilung, welche in<br />
der „Basisvereinbarung“ vom 15. Mai 2001<br />
festgeschrieben und beim Fahrplanwechsel<br />
vom 12.12.2004 größtenteils umgesetzt wurde<br />
(siehe Kasten).<br />
Slg. Toni Burger<br />
Von 1977 bis 1992 wurde die Lötschberglinie durchgehend zweigleisig ausgebaut. Der <strong>Bahn</strong>verkehr<br />
lief währenddessen weiter<br />
Archiv BLS<br />
zer <strong>Bahn</strong>en Umstrukturierungen unumgänglich<br />
wurden. Unter dem Stichwort „Divisionalisierung“<br />
hielten die Aufteilung in<br />
Personen- und Güterverkehr, die Ausgliederung<br />
der Infrastruktur, die Liberalisierung<br />
und der Wettbewerb bei den großen <strong>Bahn</strong>gesellschaften<br />
Einzug.<br />
Das NEAT-Projekt<br />
Am 27. September 1992 stimmten die<br />
<strong>Schweiz</strong>erinnen und <strong>Schweiz</strong>er mit großer<br />
Mehrheit dem Projekt „Neue Eisenbahn-Alpentransversalen“<br />
(NEAT) zu, das als politischen<br />
Kompromiss einen Basistunnel am<br />
Lötschberg wie am Gotthard vorsah. Beide<br />
sollen dazu dienen, den Güter- und insbesondere<br />
den Lkw-Verkehr durch die Alpen weiter<br />
auf die Schiene zu verlagern.<br />
Der Lötschberg-Basistunnel (LBT) sollte<br />
ursprünglich 41 Kilometer lang sein und aus<br />
zwei Röhren zwischen Frutigen und dem Rhônetal<br />
bestehen. Aus finanziellen Gründen<br />
musste das Projekt erheblich redimensioniert<br />
werden: Die Tunnellänge zwischen Frutigen<br />
im Berner Oberland und Raron im Rhônetal<br />
beträgt nur noch 34,6 Kilometer. Nur eine der<br />
30
NEAT und BLS AG<br />
ÜBERBLICK TRIEBFAHRZEUGE DER BLS, STAND 31.12.2011<br />
Loks und Triebwagen im kommerziellen Einsatz<br />
Elloks<br />
Bezeichnung<br />
Anzahl<br />
Triebzüge<br />
Bezeichnung<br />
Anzahl<br />
Re 420 (Re 4/4 ex SBB) 6 RABe 525 „NINA“ 37<br />
Re 425 (Re 4/4 BLS) 33 RABe 535 „Lötschberger“ 21<br />
RBDe 565 21<br />
Re 456 (vermietet) 2<br />
RBDe 566 I 8<br />
Re 465 18<br />
RBDe 566 II 13<br />
Re 485 20 RABe 526 (GTW) 13<br />
Re 486 10 RABe 515 „MUTZ“ geplant<br />
Historische Fahrzeuge<br />
Bezeichnung Anzahl Inbetriebnahme<br />
Ed 3/3 (GTB 3) (Dampflokomotive) 1 1900<br />
Ec 4/5 (SMB 11) (Dampflokomotive) 1 1911<br />
Ce 4/6 (Nr. 307) 1 1920<br />
Ae 6/8 (Nr. 205) 1 (mietbar) 1939<br />
BDe 4/6 (Nr. 736) 1 1938<br />
Ae 4/4 (Nrn. 251/258) 2 (Nr. 251 mietbar) 1944/1955<br />
Ae 8/8 /Nrn. 273/275) 2 (Nr. 273 mietbar) 1952/1963<br />
Be 4/4 (Nr. 761) „Wellensittich“ 1 (mietbar) 1953<br />
Infrastrukturfahrzeuge<br />
Bezeichnung<br />
Anzahl<br />
Am 843 (Nrn. 501 – 504) 4<br />
selbstfahrende<br />
Erhaltungsfahrzeuge 9<br />
XTmas<br />
Bezeichnung<br />
Anzahl<br />
Tem 225 (Nrn. 56 – 57) 2<br />
Tm 235 (Nrn. 79 … 89) 6<br />
Tm 235 (Nrn. 091 – 094) 4<br />
Bezeichnung<br />
Anzahl<br />
Tm 235 (Nrn. 095 – 097) 3<br />
Tm 235 (Nr. 100) 1<br />
Tm 236 (Nrn. 380 – 384) 5<br />
Tm 235 (Nrn. 201 – 214) 14<br />
Hilfswagen Xas<br />
(Nrn. 502 – 503) 2<br />
Lösch- und Rettungszug (1) 1<br />
XTmas/Xans<br />
(1)<br />
besteht aus 2 Rettungsfahrzeugen, 1 Tanklöschwagen, 1 Gerätefzg.<br />
„MUTZ“ heißt der neue BLS-Nahverkehrstriebzug. Am 20. März 2012<br />
wird MUTZ 01 (515 001) bei Stadler in Erlen präsentiert, Ende 2012<br />
hat die BLS vier der Fahrzeuge im Einsatz<br />
Sven Klein<br />
Die Gütertochter BLS Cargo kommt bei ihren Einsätzen weit über das<br />
Kernnetz hinaus (Foto mit zwei Re 485 in Basel) Slg. Marco Frühwein<br />
beiden Röhren wurde vollständig ausgebrochen,<br />
mit den bahntechnischen Anlagen versehen<br />
und dem Betrieb mit einer Maximalgeschwindigkeit<br />
von 200 km/h übergeben, die<br />
andere Röhre steht nur teilweise dem Verkehr<br />
zur Verfügung, existiert teilweise als Rohbau<br />
und wurde teilweise noch gar nicht ausgebrochen;<br />
der Tunnel ist im Rhônetal vorerst nur<br />
in Richtung Visp – Brig an die Simplon-Strecke<br />
der SBB angebunden.<br />
Für den Bau des Lötschberg-Basistunnels<br />
wurde 1993 die BLS-Tochtergesellschaft BLS<br />
AlpTransit AG geschaffen. Die feierliche Eröffnung<br />
des Tunnels fand am 16. Juni 2007<br />
statt, der kommerzielle Betrieb wurde vollständig<br />
zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember<br />
2007 aufgenommen. Die Kapazität des<br />
Tunnels von 40 Personen- und 70 bis 80 Güterzügen<br />
täglich erweist sich aus heutiger Sicht<br />
als zu gering, so dass sich verschiedene politische<br />
und wirtschaftliche Kreise, unter anderem<br />
das „Lötschberg-Komitee“ für einen Vollausbau<br />
der zweiten Röhre einsetzen. Zwar verlor<br />
die Lötschberg-Bergstrecke mit dem Tunnel<br />
an Bedeutung – der Fernreiseverkehr und<br />
viele Güterzüge nehmen nun diesen Weg.<br />
Ganz entbehrlich ist sie aber nicht; ihr verblieben<br />
der Regionalverkehr, der Autoverlad<br />
und einige Güterzüge. Die Bergstrecke ist Bestandteil<br />
des Güterkorridors Rotterdam – Genua<br />
und zudem als Rückfallebene wichtig.<br />
Durch den Lötschberg-Basistunnel verlor die Bergstrecke<br />
an Bedeutung. Entbehrlich ist sie aber nicht<br />
Nach der Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels<br />
hatte die BLS AlpTransit AG eigentlich<br />
ihren Zweck erfüllt. Gleichzeitig verlangte<br />
aber der Bund, dass die Infrastruktur der<br />
BLS eigentumsmäßig in eine separate AG ausgegliedert<br />
und dem Bund die Mehrheit an dieser<br />
AG übereignet werden sollte. Deshalb<br />
übertrug man die Aktiven und Passiven der<br />
BLS-Infrastruktur auf die BLS AlpTransit AG<br />
und firmierte diese in „BLS Netz AG“ um.<br />
Die Infrastruktur wird aber weiterhin von der<br />
BLS AG geführt, das Personal<br />
ist bei der BLS AG angestellt.<br />
Fusion zur BLS AG<br />
Im Juni 2006 fusionierten<br />
die Regionalverkehr Mittelland<br />
AG (RM) und die BLS<br />
Lötschbergbahn AG mit<br />
der neu geschaffenen BLS<br />
AG, indem die Generalversammlungen<br />
der beiden<br />
<strong>Bahn</strong>en der Fusion<br />
mit der BLS AG zustimmten.<br />
Die Eigner des<br />
neuen Unternehmens<br />
sind der Kanton Bern mit einem<br />
Aktienanteil von 55,8 Prozent, der Bund mit<br />
21,7 Prozent sowie weitere Kantone, Gemeinden<br />
und Private mit 22,5 Prozent. Die eigentliche<br />
Gründung fand am 24. April 2006<br />
mit dem Tausch der BLS- und RM-Aktien gegen<br />
solche der BLS AG statt.<br />
Die BLS AG hat ihren Sitz in Bern und ist<br />
mit einem (normalspurigen) Streckennetz von<br />
436 Kilometern (nach den SBB) heute das<br />
zweitgrößte Eisenbahnverkehrsunternehmen<br />
in der <strong>Schweiz</strong>. Sie ist zugleich die größte Pri-<br />
Slg. Toni Burger<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
31
BLS/Lötschbergbahn<br />
Im <strong>Bahn</strong>hof Zweisimmen besteht die Übergangsmöglichkeit von Normal- auf Schmalspur. Die BLS-Züge kommen von Spiez, die Meterspurzüge<br />
der Montreux-Oberland-Bernois (MOB) stellen die Verbindung zum Genfer See her<br />
Christian Völk, Archiv BLS (u.)<br />
– Zweisimmen, Bern – Luzern sowie Bern –<br />
Brig über die Lötschberg-Bergstrecke. Das<br />
Gütergeschäft wird hingegen von der rechtlich<br />
selbstständigen Tochter BLS Cargo geführt,<br />
während das Gütergeschäft des RM noch vor<br />
der Fusion in die Crossrail AG ausgegliedert<br />
und dieses Unternehmen verkauft worden ist.<br />
Außerdem betreibt die BLS die Schifffahrt auf<br />
dem Thuner- und Brienzersee sowie durch die<br />
Tochtergesellschaft „Busland AG“ ein ausgedehntes<br />
Busnetz im Emmental.<br />
Bei der BLS AG sind zurzeit mehr als 2.800<br />
Mitarbeitende aus 20 Nationen tätig. 2011<br />
wurden durch die BLS AG mit <strong>Bahn</strong>, Bus und<br />
Schiff 55,7 Millionen Passagiere befördert.<br />
Rückblick: Festlich geschmückt steht Ellok Fb 5/7 Nr. 160 am 28. Juni 1913 in Spiez zur<br />
Fahrt mit dem Eröffnungszug bereit. 2013 feiert die BLS das Jubiläum mit diversen Festen<br />
vatbahn des Landes, wenn man in Betracht<br />
zieht, dass die heute ebenfalls privatrechtlichen<br />
<strong>Schweiz</strong>erischen Bundesbahnen SBB als<br />
Staatsunternehmen gegründet sind.<br />
Die BLS AG betreibt den regionalen Personenverkehr<br />
in einem Gebiet zwischen dem<br />
Neuenburger- und Vierwaldstättersee, dem<br />
Juragebirge und dem Simplonmassiv, deckt<br />
also einen Wirtschaftsraum mit 1,5 Millionen<br />
Einwohnern ab. Neben der S-<strong>Bahn</strong> Bern, dem<br />
zweitgrößten S-<strong>Bahn</strong>-System der <strong>Schweiz</strong>, betreut<br />
die BLS AG den Regio- und RegioExpress-Verkehr<br />
auf rund 700 Kilometern z. B.<br />
durch die RE-Züge Bern – Neuchâtel, Bern<br />
Gestern und heute bei der BLS<br />
Im 100. Jahr des Bestehens der Lötschbergbahn<br />
haben bei der BLS AG Tradition wie<br />
Moderne ihren Platz. Man sieht die klassisch<br />
braunen Elloks der Reihe Re 4/4, die modernen<br />
Re 465 und die jungen Nahverkehrs-<br />
Triebwagen „NINA“ oder „Lötschberger“ im<br />
Blau-Grün-Weiß der BLS-Gegenwart. Dabei<br />
gibt sich die <strong>Bahn</strong>gesellschaft durchaus<br />
selbstbewusst. In ihrem Internet-Auftritt<br />
heißt es: „Die BLS ist die starke, selbstständige<br />
Nummer zwei im <strong>Bahn</strong>geschäft.“ In diese<br />
Richtung hatten auch die Autoren der Broschüre<br />
1913 anlässlich des Betriebsstarts auf<br />
der Lötschbergstrecke gedacht.<br />
Dr. Hans-Bernhard Schönborn/MHZ<br />
32
Die Entwicklung der BLS<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Moderner Nahverkehr Marke BLS: Zwei „NINA“-Triebzüge begegnen sich im Juni 2003 im<br />
<strong>Bahn</strong>hof Kerzers in der Westschweiz<br />
Toni Burger<br />
Die Bietschtalbrücke auf der Südrampe ist eines der markantesten Bauwerke der Strecke.<br />
Hier wird sie von Triebwagen Fe 4/5 Nr. 796 mit einem Güterzug befahren Slg. Thomas Wunschel<br />
STICHWORT: JUBILÄUMSFEIERN DER LÖTSCHBERG<strong>BAHN</strong> 2013<br />
Zum 100-jährigen Bestehen der Lötschbergbahn<br />
haben die BLS AG und diverse Partner<br />
ein Jubiläumsprogramm auf die Beine gestellt<br />
und Sonderangebote aufgelegt. So veranstalten<br />
die Volkshochschule Bern und die BLS-<br />
Stiftung Ende Mai eine Vortragsreihe zum<br />
Thema, unter anderem mit einem Besuch des<br />
Historischen Depots in Burgdorf. Weitere Veranstaltungen<br />
sind:<br />
01. Juni 2013: Eröffnung der Sonderausstellungen<br />
„100 Jahre Lötschbergbahn“ im Tropenhaus<br />
Frutigen (läuft bis 31. Januar 2014)<br />
und zum Bau der Lötschbergbahn im Lötschentalermuseum<br />
Kippel (läuft bis März<br />
2014)<br />
29./30. Juni 2013: „Grosses BLS-Eisenbahnfest<br />
in Frutigen“, unter anderem mit historischen<br />
Sonderzügen auf dem Abschnitt<br />
Frutigen – Kandersteg<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
15. Juli 2013: Sonderfahrt mit historischer<br />
Zuggarnitur und Lok Ae 6/8 205 anlässlich<br />
„100 Jahre Betriebseröffnung“<br />
06. September 2013: Einweihung des verlängerten<br />
Südrampen-Wanderwegs von Lalden<br />
bis Brig<br />
07./08. September 2013: „Südrampenfest“,<br />
u.a. mit „großem Publikumsanlass“ entlang<br />
der Südrampe von Goppenstein bis Brig<br />
Vom 1. April bis 31. Dezember 2013 bietet die<br />
BLS täglich je 100 Jubiläums-Tageskarten an,<br />
die für 25 CHFr (1. Klasse: 40 CHFr, ohne<br />
Halbtax jeweils doppelter Preis) Fahrten mit<br />
allen BLS-Verkehrsmitteln gestatten. Der Vorverkauf<br />
für die Fahrkarten beginnt jeweils vom<br />
Stichtag aus zwei Monate im voraus.<br />
Mehr Informationen zu Jubiläumsprogramm<br />
und -angeboten unter www.bls.ch/100 GM<br />
Diese hochwertigen Acryl-Sammelkassetten helfen<br />
Ihnen, Ihre <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong>-Ausgaben zu ordnen.<br />
In jede Kassette passen zwei komplette Jahrgänge.<br />
1 Acryl-Kassette<br />
€ 18,95<br />
Best.-Nr. 75002<br />
15% gespart bei 5 Acryl-Kassetten<br />
€ 79,95<br />
Best.-Nr. 75003<br />
Jetzt bestellen unter:<br />
www.bahn-extra.de oder<br />
Telefon 0180-532 16 17<br />
33<br />
(14 Cent/Minute von 8-18 Uhr)
BLS/Lötschbergbahn<br />
Reisebericht 1913<br />
„Brigue,<br />
train direct!“<br />
Die Lötschbergbahn ist wenige Monate in Betrieb,<br />
als am 12. November 1913 eine Reisegruppe aus der<br />
Ostschweiz die neue Strecke von Bern bis Brig befährt.<br />
Einer der Reisenden hat seine Eindrücke festgehalten.<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> gibt sie auszugsweise wieder<br />
Ziemlich rau und unwirtlich zeigt sich die Lötschberg-Südrampe. Was die Reisenden des Jahres 1913 aber in Verzückung bringt, ist der Ausblick<br />
auf die grandiose, überraschend geometrisch geordnete Landschaft des Rhônetals tief unten<br />
Die Berner Alpenbahn beginnt an der Schwelle des Berner Oberlandes,<br />
in Thun. Der Kopf dieser ganzen, großen Verkehrsposition<br />
ist aber die Bundesstadt Bern, wo ja auch die Verwaltung<br />
der Berner Alpenbahn ihren Sitz hat. Wir lenken ein in den zweiten<br />
Perron, dort, wo sie rufen: Thun, Spiez, Lötschberg, Brigue , Simplon<br />
Mailand, Train direct!<br />
Zwei Eisenbahnlinien verbinden Bern mit Thun und das vielgepriesene<br />
Berner Oberland mit der Zentralschweiz: die Schnellzugslinie<br />
über Münsingen und die mehr lokalen Charakter tragende Linie über<br />
Belp durch das malerische Tal der Gürbe. Wer das stille Genießen landschaftlicher<br />
Schönheit und das Volkstum der raschen Beförderung vorzieht,<br />
wird auf der Gürbethalbahn auf seine Rechnung kommen. Thun,<br />
die Anfangsstation der Berner Alpenbahn, bildet das Eingangstor zum<br />
Berner Oberland und ist ein bedeutender Kurort. Die Stadt gibt auch<br />
dem Thunersee, diesem prächtigen Alpengewässer, seinen Namen.<br />
Auf der Nordrampe hoch zum Lötschbergtunnel<br />
Die <strong>Bahn</strong> führt zunächst nach Scherzligen und von da in großem Bogen<br />
um das westliche Ende des Thunersees herum nach Gwatt. Auf dieser<br />
Strecke zeigen sich links die herrlichen Schneeriesen des Berner<br />
Oberlandes über dem blauen Seespiegel. Inzwischen steigt die <strong>Bahn</strong> am<br />
linken Ufer langsam in die Höhe. Dem Auge bietet sich eine herrliche<br />
Aussicht auf die blauen Fluten des Thunersees, seine blühenden<br />
Ufer und hinüber an die bewaldeten Berglehnen mit den lieblichen<br />
Dörfern. Kurz vor Spiez tritt die <strong>Bahn</strong> hinter einen bewaldeten Hügel,<br />
um plötzlich den Blick auf den an einer Bucht malerisch gelegenen<br />
Kurort, auf den See und die sich besonders hübsch präsentierenden Berge<br />
frei zu geben. Vom hoch gelegenen <strong>Bahn</strong>hof genießt man einen umfassenden<br />
Rundblick auf Schloss, See und<br />
Hochgebirge, während unten ein neues<br />
Bild den Beschauer fesselt. Dort beherrscht<br />
die mächtige Landwarte des Niesen<br />
das Gesichtsfeld. Während wir so in<br />
die Betrachtung versunken sind, wechseln<br />
sie vorn an unserer Wagenreihe die Maschine<br />
und statt mit Dampfkraft geht’s<br />
nun mit der elektrischen vorwärts.<br />
Von hier steigen wir über der Thunerseelinie<br />
sachte zum Fuße des bewaldeten<br />
Hondrichgebirges empor, durchfahren<br />
einen ca. 1,5 Kilometer langen<br />
Tunnel, um jenseits in die unterste Talstufe<br />
des Kandertales einzudringen. Sofort<br />
nach dem Tunnel öffnet sich das Tal<br />
in seiner grandiosen alpinen Pracht. Bad<br />
Heustrich, die erste Station, ist ein Kurort und hat sich zu einem Heilbade<br />
ersten Ranges entwickelt. Die nächste Station, Mülenen-Aeschi,<br />
ist Ausgangspunkt der Drahtseilbahn auf den Niesen. Weiter geht’s in<br />
schnellem Lauf und wir erreichen bald das freundliche Dorf Reichenbach,<br />
eine ruhige Sommerfrische mit interessanten Bauernhäusern.<br />
Von Reichenbach gewinnt die <strong>Bahn</strong> endlich den Hauptplatz des unteren<br />
Kandergeländes, Frutigen an der Ausmündung des Engstligenbaches<br />
in die Kander. Hier erhielten wir wiederum den Eindruck, an<br />
der Schwelle eines eigentlichen Gebirgslandes zu stehen. In der Tat<br />
beginnen hier auch die großen Kunstbauten der Lötschbergbahn, der<br />
technisch interessante Teil.<br />
34
Lötschberg-Fahrt 1913<br />
Zahlreiche Kunstbauten überquert der Zug auf der Nord- wie auf der<br />
Südrampe. Auf Letzterer liegt auch die Jolitobel-Brücke (Foto)<br />
In Spiez löst eine Ellok die Dampflok vor dem Zug ab; es handelt sich<br />
um eine Maschine der Reihe Fb 5/7 Slg. Thomas Wunschel (5)<br />
Der Schienenstrang steigt gleich hinter dem Dorfe sanft an der westlichen<br />
Hügellehne hinan, die von der Ruine Tellenburg gekrönt wird.<br />
Die <strong>Bahn</strong> setzt vor der Tellenburg auf großartigem Steinviadukt von elf<br />
mächtigen Bögen auf die jenseitige Talseite über. Die beiderseitigen<br />
Bergzüge laufen jetzt keilförmig zusammen und verengen das Tal, über<br />
dessen Wiesengründe unten die Weiler und Bauerngehöfte, Stadel und<br />
Scheunen von Kandergrund verstreut liegen.<br />
Ein Pfiff, und weiter rollen die Räder,<br />
um in den Tunnel einzutauchen<br />
Bald ist die Station Blausee-Mitholz erreicht. Ihr Name weist schon<br />
auf ein sehenswertes Naturspiel hin. In geringer Entfernung der Haltestelle<br />
haben gewaltige Naturkräfte im Waldesdickicht aus Riesenblöcken<br />
einen Wall aufgetürmt. Inmitten dieser romantischen Steinwildnis<br />
liegt der winzige, wunderbare Blausee. Noch im engeren<br />
Gesichtskreis dieser seltsamen kleinen Zauberwelt ein anderes Bild: Auf<br />
unzugänglich scheinendem Fels, welchen die <strong>Bahn</strong> im Tunnel unterfährt,<br />
ragt das Turmgemäuer der Felsenburg empor.<br />
Von der Station Blausee-Mitholz an beginnen die hauptsächlichsten<br />
Kunstbauten. Hier finden wir teils offen geführte, teils in Tunnel<br />
gelegte große Schleifen, über welche die <strong>Bahn</strong> auf die Höhe der prächtigen<br />
Bergstation Kandersteg und deren langen, ebenen Talboden<br />
kommt. Reich ausgestattet ist Kandersteg in Bezug auf Naturschönheiten,<br />
mit einem Kranze berühmter Gipfel, wunderbaren Alpentälern,<br />
dem Oeschinensee und den Kanderfällen. Das heimelige Dorfbild weist<br />
neben altertümlichen Gasthäusern auch große neue Hotelbauten auf.<br />
Auf der Südrampe hinab nach Brig<br />
Ein Pfiff, und weiter rollen die unaufhaltsamen Räder, um kurz nachher<br />
in den großen, ca. 14 Kilometer langen Lötschbergtunnel einzutreten.<br />
Bei Goppenstein mündet die Linie ins Walliser Gebiet ein. Unten<br />
im Tale erblicken wir das Dorf Gampel im Rhônetal, während wir<br />
selbst auf hübscher Bogenbrücke die Lonza überschreiten. Von hier aus<br />
wechselt die <strong>Bahn</strong> beständig zwischen Tunnels und offener Geleisestrecke.<br />
Vor der Station Hohtenn wendet sie sich ostwärts, um in das<br />
Rhônetal einzutreten, hoch über der Talsohle.<br />
Die Südhänge des Rhônetales werden mit ihren Felsketten, Alphängen,<br />
Kirchdörfern und Weilern schon bald nach Verlassen von Goppenstein<br />
in der Ferne sichtbar. Doch auch technisch bietet die <strong>Bahn</strong><br />
neuerdings hohes Interesse. Ihr Gelände, der Felsfluss von Bietschhorn<br />
und Breithorn, über welches sie nun allmählich nach Brig hinabsteigt,<br />
ist außerordentlich wild, durch eine Anzahl in das Rhônetal vorspringender<br />
Felsenklippen und die dazwischen liegenden schluchtartigen<br />
Täler. Diese Hindernisse überwindet die <strong>Bahn</strong> durch großartige technische<br />
Anlagen, Tunnels und Viadukte.<br />
Beim Eintritt ins Rhônetal spricht den Beobachter eine neue Kulturwelt<br />
an. An Stelle des leichten, germanischen Holzbaues des Nordens<br />
Der <strong>Bahn</strong>hof Ausserberg auf der Südrampe; die Lötschberglinie hat<br />
man hier aufwendig in den Hang gebettet<br />
findet hier der schwere romanische Steinbau Anwendung. Unmittelbar<br />
unter dem <strong>Bahn</strong>damm kleben solch kleine, malerische Ansiedlungen<br />
aus grauen Steinhäusern primitivster Form wie Adlerhorste zwischen<br />
Felsgruppen und Föhren. Tief unten streckt sich die flache, mehrere Kilometer<br />
weite und von der Rhône durchzogene Talsohle hin. Es haftet<br />
etwas Symmetrisches an der ganzen Kulturanlage da unten. Dazu tritt<br />
noch die geometrische Einteilung der Ackerfelder und der Weinberge.<br />
Doch was sind das für Rinnen, die meilenweit teils dem Berg entlang<br />
geführt werden, teils in den Felsen eingehauen sind? Es sind Bewässerungskanäle.<br />
Diese kühne Anlage dieses uralten, besonders am<br />
Südfuße der Berner Alpen verbreiteten Bewässerungssystems reißt mit<br />
Recht den Beobachter zur Bewunderung hin.<br />
In ebenso hohem Maße sind es die technischen Bauten der <strong>Bahn</strong>,<br />
die unsere Bewunderung wiederum in Anspruch nehmen. Neben den<br />
21 Tunnels der Südseite sind besonders hervorzuheben der Luogelkin-Viadukt<br />
östlich von Hohtenn, die Bietschtalbrücke, die zwischen<br />
den Stationen Ausserberg und Lalden die Baltschiederschlucht überspannende<br />
mächtige Eisenbrücke und der Finnegraben-Viadukt. Hier<br />
ungefähr bietet sich ein herrlicher Ausblick auf Visp und seine Täler.<br />
Bald erreicht die <strong>Bahn</strong> Brig, den Endpunkt unserer Reise, am Nordportal<br />
des Simplontunnels und zugleich Übergangspunkt auf diesem<br />
transalpinen Schienenweg. Brig steigt malerisch an den Ausläufern des<br />
Monte Leone empor und macht in seinen südlichen Teilen ganz den<br />
Eindruck eines mittelalterlichen Bauwerkes. Wehmütig schauen wir<br />
den davoneilenden Simplon-Expressen nach, denn nur allzu gerne wären<br />
wir mit ihnen ins ferne Süden weitergerollt, hinab in die oberitalienischen<br />
Ebenen. Leider aber müssen wir zurückkehren und so setzen<br />
wir uns wieder ins Coupé II. Klasse, um „gemütlich“ heimzufahren.<br />
Quelle: Slg. Thomas Wunschel<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 35
BLS/Lötschbergbahn<br />
Die wichtigsten Triebfahrzeuge der BLS<br />
Von Anfang an elektrisch<br />
Als die BLS im Jahr 1913 den Betrieb auf der Lötschbergbahn aufnahm, kamen gleich Elektro -<br />
lokomotiven zum Einsatz; große Dampfloks hat es dort nie gegeben. Einige der Entwicklungen<br />
schrieben Technikgeschichte. Die wichtigsten BLS-Triebfahrzeuge im Kurzporträt<br />
Serie Be 5/7 – 1913 die stärkste Lok der Welt<br />
Slg. Andreas Knipping<br />
Die ersten Lokomotiven der BLS wurden ab<br />
1913 als Fb 5/7 in Dienst gestellt und galten<br />
damals als die stärksten Normalspurloks<br />
der Welt. Sie übernahmen den Gesamtverkehr<br />
auf der neu eröffneten Lötschbergbahn<br />
(Thun – Brig). 1941 wurden bei der Be 5/7<br />
151 die beiden großen Motoren durch vier<br />
kleinere ersetzt, die eine Leistungssteigerung<br />
um 20 % und eine Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit<br />
auf 90 km/h ermöglichten<br />
(neue Loknummer Ae 5/7 171). Sie wurde<br />
erst nach 51 Betriebsjahren (1964) abgestellt<br />
und ist heute als Ae 5/7 151 im Verkehrshaus<br />
Luzern ausgestellt.<br />
Serie Be 5/7<br />
Hersteller ____________SLM/MFO (/BBC)<br />
Erstes Baujahr ________1913<br />
Anzahl Exemplare______13<br />
Achsfolge ____________1’E1’<br />
Stundenleistung_______1.838 kW (2.207 kW 1) )<br />
Höchstgeschwindigkeit __75 km/h (90 km/h 1) )<br />
Anzahl Motoren _______2 (4 1) )<br />
Gesamtmasse ________107 t<br />
Länge über Puffer _____16,00 m<br />
Letzte Planeinsätze ____1964<br />
Historische Lok _______Ae 5/7 151<br />
1)<br />
nur Ae 5/7 171 (ab 1941)<br />
Serie Ce 4/4 (ex Ce 4/6) – Die „Dekretsmühle“<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
Der Spitzname „Dekretsmühle“ geht auf ein Dekret<br />
zurück, in dessen Folge die Ce 4/6 ab 1920 gebaut<br />
wurde. Die letzte Stangenellok der BLS hatte<br />
anfangs an beiden Enden einen Vorbau und eine<br />
Vorlaufachse, um den Achsdruck auf 12,5 Tonnen<br />
zu beschränken (Achsfolge (1’B)(B1’)). Der Umbau<br />
von zehn Exemplaren auf die Achsfolge (B)(B) ab<br />
1954 erhöhte den Achsdruck auf 16 Tonnen und<br />
die Adhäsionsmasse auf 64 Tonnen. Die acht<br />
Räder der nun als Ce 4/4 bezeichneten Loks<br />
waren nur paarweise gekuppelt, so dass sich während<br />
der Vorbeifahrt auf jeder Seite stets zwei Kuppelstangen<br />
scheinbar unabhängig voneinander auf<br />
und ab bewegten. Bis 1997 fuhren die kleinen<br />
Loks insbesondere zwischen Interlaken und Spiez.<br />
Serie Ce 4/4 (ex Ce 4/6)<br />
Hersteller__________________SLM/(BBC/MFO)<br />
Erstes Baujahr _____________1920<br />
Anzahl Exemplare ___________17<br />
Achsfolge ___________________(B)(B) [(1’B)(B1’) 1) ]<br />
Stundenleistung ____________736 kW<br />
Höchstgeschwindigkeit ______65 km/h 2)<br />
Anzahl Motoren_____________2<br />
Gesamtmasse _____________64 t<br />
Länge über Puffer___________12,34 m 3)<br />
Letzte Planeinsätze _________1997<br />
Historische Lok betriebsfähig __Ce 4/6 307 und<br />
Ce 4/4 312<br />
1)<br />
Vor Umbau als Ce 4/6; 2) Nr. 315-317: 75 km/h<br />
(Be 4/6); 3) Vor Umbau als Ce 4/6: 14,39 m<br />
Serie Ae 4/4 (Ae 415) – Die erste starke Bo’Bo’-Lok der Welt<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
Zur Ablösung der Be 5/7<br />
im Schnellzugverkehr beschafften<br />
die BLS ab<br />
1944 mit der Ae 4/4 die<br />
weltweit erste leistungsstarke<br />
laufachslose Drehgestelllokomotive<br />
mit<br />
Einzelachsantrieb (Achsfolge<br />
Bo’Bo’). Die acht<br />
zwischen 1944 und<br />
1955 gelieferten Loks<br />
übernahmen in den<br />
nächsten 20 Jahren insbesondere<br />
den Schnellzugverkehr<br />
auf der<br />
Lötschbergachse, wobei<br />
Serie Ae 4/4<br />
Hersteller ______________________SLM/BBC<br />
Erstes Baujahr __________________1944<br />
Anzahl Exemplare _______________8<br />
Achsfolge ______________________Bo’Bo’<br />
Stundenleistung ________________2.944 kW<br />
Höchstgeschwindigkeit___________125 km/h<br />
Anzahl Motoren _________________4<br />
Gesamtmasse __________________80 t<br />
Länge über Puffer _______________15,60 m<br />
Letzte Planeinsätze______________2004<br />
Historische Lok _________________Ae 4/4 251<br />
ihr Einsatzbereich bis nach Pontarlier in Frankreich und Domodossola in Italien<br />
reichte. Erst die Serie Re 4/4 verdrängte sie ab 1964 in untergeordnete<br />
Dienste. Bis 2004 bespannten Ae 4/4 unter anderem noch die Touristenzüge<br />
der „Golden-Pass-Route“ zwischen Zweisimmen und Interlaken.<br />
36
Galerie: BLS-Triebfahrzeuge<br />
Serie Ae 6/8 (Ae 015) – 1929 die stärkste Lok der Welt<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
Noch als Be 6/8 lieferte die SAAS in Zusammenarbeit<br />
mit Breda in Mailand 1926 und<br />
1931 die erste Serie der imposanten Maschinen.<br />
Die zweite Serie folgte zwischen 1939<br />
und 1943, wobei nun SLM den mechanischen<br />
Teil fertigte. Die mächtigen Loks waren in der<br />
Lage, auf den Lötschbergrampen (27 Promille)<br />
Schnell- und Güterzüge mit einem Gewicht von<br />
610 Tonnen mit 75 km/h zu befördern. Haupteinsatzgebiet<br />
war somit neben wenigen<br />
schweren Schnellzügen insbesondere der<br />
Güterverkehr auf der Strecke Bern – Brig, zeitweise<br />
mit Durchläufen von Basel bis Domodossola,<br />
bevor die Loks von der Serie Re 4/4<br />
ins Mittelland verdrängt wurden.<br />
Serie Ae 6/8 1)<br />
Hersteller ___________________SAAS/(Breda/SLM)<br />
Erstes Baujahr _____________1926/1939<br />
Anzahl Exemplare ___________8<br />
Achsfolge __________________(1’Co)(Co1’)<br />
Stundenleistung ____________4.146 kW<br />
Höchstgeschwindigkeit ______100 km/h<br />
Anzahl Motoren_____________6X2=12 2)<br />
Gesamtmasse______________140 t<br />
Länge über Puffer ___________20,26 m<br />
Letzte Planeinsätze _________1993<br />
Historische Lok betriebsfähig___Ae 6/8 205<br />
1)<br />
Lieferung erste Serie als Be 6/8, Umbau in<br />
Ae 6/8: 1939; 2) Doppelmotoren<br />
Serie Ae 8/8 (Ae 485) – Die doppelte Ae 4/4<br />
Albert Schöppner<br />
Bei den Doppellokomotiven der Serie Ae 8/8 handelt<br />
es sich technisch um zwei fest gekuppelte<br />
Loks der Serie Ae 4/4, bei denen je ein Führerstand<br />
fehlt. Noch 1956 wurde die Bestellung der<br />
letzten beiden bereits im Bau befindlichen Ae 4/4<br />
zum Auftrag für die erste Ae 8/8 umgewidmet.<br />
1962/63 folgte die Lieferung zwei fabrikneuer<br />
Doppelloks, und die BLS entschied darüber hinaus,<br />
vier Ae 4/4 (253-256) in zwei Ae 8/8 umzubauen.<br />
Ihrer Leistung entsprechend zogen die „Muni“<br />
(Stier) genannten Doppelloks lange Güterzüge,<br />
teils auch schwere Schnellzüge über die Lötschbergrampen.<br />
Ihre letzten Einsätze beschränkten<br />
sich auf Abraum- und andere Bauzüge während<br />
des Vortriebs des Lötschberg-Basistunnels.<br />
Serie Ae 8/8<br />
Hersteller___________________SLM/BBC<br />
Erstes Baujahr ______________1959<br />
Anzahl Exemplare____________5<br />
Achsfolge___________________Bo’Bo’+ Bo’Bo’<br />
Stundenleistung _____________6.476 kW<br />
Höchstgeschwindigkeit _______125 km/h<br />
Anzahl Motoren______________8<br />
Gesamtmasse ______________160 t<br />
Länge über Puffer____________30,23 m<br />
Letzte Planeinsätze __________2003<br />
Historische Lok______________Ae 8/8 273<br />
Serie Re 4/4 (Re 425) – Die Spezialistin für die Berge<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
Etwa gleichzeitig mit der SBB-Serie Re 4/4 II<br />
nahm die BLS ihre eigene Re 4/4 in Betrieb,<br />
die für den schweren Schnellzugdienst auf<br />
den Lötschbergrampen optimiert war. Dort<br />
kann sie problemlos 630 Tonnen mit 80 km/h<br />
die 27-Promille-Steigungen hinaufziehen. Die<br />
moderne Technik mit Gleichrichtern und<br />
Gleichstrommotoren ermöglichte einen enorm<br />
guten Wirkungsgrad, den bei Vergleichsfahrten<br />
auch manch modernere Lok nicht erreichte.<br />
Heute befördern die nach wie vor<br />
braunen Kraftpakete vorwiegend Güterzüge in<br />
Doppeltraktion in der ganzen <strong>Schweiz</strong> mit<br />
einem Schwerpunkt zwischen Basel und Domodossola.<br />
Serie Re 4/4<br />
Hersteller________________________SLM/BBC<br />
Erstes Baujahr ___________________1964<br />
Anzahl Exemplare_________________35<br />
Achsfolge________________________Bo’Bo’<br />
Stundenleistung __________________4.990 kW<br />
Höchstgeschwindigkeit ____________140 km/h<br />
Anzahl Motoren___________________4<br />
Gesamtmasse ___________________80 t<br />
Länge über Puffer_________________15,10 m<br />
(15,47 m)<br />
Stundenzugkraft __________________225 kN<br />
Serie Re 465 – Von Pininfarina gestylt<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
Die BLS-Serie Re 465 stellt eine Weiterentwicklung<br />
der SBB-Serie Re 460 dar. Neben<br />
ihrer blauen Farbgebung unterscheidet sie<br />
sich von ihrer roten Schwestermaschine durch<br />
eine aufwendigere Antriebstechnik mit sechsstatt<br />
vierpoligen Asynchron-Fahrmotoren, die<br />
nicht mehr paarweise, sondern einzeln angesteuert<br />
werden, wodurch eine Leistungssteigerung<br />
von 5 % erreicht werden konnte. Nach<br />
anfänglichem Schnellzugeinsatz am Lötschberg<br />
sind die vom Designer Pininfarina gestylten<br />
Lokomotiven inzwischen vorwiegend vor<br />
RoLa- und Güterzügen auf der Lötschbergachse<br />
sowie mit Wendezügen zwischen Bern<br />
und Luzern zu sehen.<br />
Serie Re 465<br />
Hersteller________________________SLM/ABB<br />
Erstes Baujahr ___________________1994<br />
Anzahl Exemplare _________________18<br />
Achsfolge________________________Bo’Bo’<br />
Dauerleistung ____________________6.400 kW<br />
Höchstgeschwindigkeit ____________230 km/h<br />
Anzahl Motoren___________________4<br />
Gesamtmasse ___________________81 t<br />
Länge über Puffer_________________18,50 m<br />
Dauerzugkraft ____________________242 kN<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
37
BLS/Lötschbergbahn<br />
Serie Re 485/486 – Die ersten Ausländer<br />
Volker Emersleben<br />
Nach der Auflösung der SLM musste auch die<br />
BLS ihre Streckenlokomotiven im Ausland kaufen.<br />
Sie entschied sich für die TRAXX-Familie<br />
aus dem Hause Bombardier und bestellte zunächst<br />
20 Exemplare der Bauart TRAXX F140<br />
AC1 mit Tatzlagerantrieb als Re 485 analog zur<br />
185.1 der DB AG für reinen Wechselstrombetrieb.<br />
Das „<strong>Schweiz</strong>-Paket“ beinhaltete neben<br />
Stromabnehmern mit schmaler Wippe und Kameras<br />
als Rückspiegelersatz die erforderlichen<br />
Zugsicherungssysteme einschließlich ETCS für<br />
den Lötschberg-Basistunnel. 2008 erweiterte<br />
die BLS ihre TRAXX-Flotte mit zehn Loks der<br />
Bauart F140 MS2 als Re 486 für den Einsatz<br />
auch unter Gleichstrom (3 kV) in Italien.<br />
Serie Re 485/486<br />
Hersteller ______________________Bombardier<br />
Erstes Baujahr__________________2002/2008<br />
Anzahl Exemplare _______________20/10<br />
Achsfolge ______________________Bo’Bo’<br />
Stundenleistung ________________5.600 kW<br />
Höchstgeschwindigkeit___________140 km/h<br />
Anzahl Motoren _________________4<br />
Gesamtmasse__________________85 t<br />
Länge über Puffer _______________18,90 m<br />
Serie ABDZe 4/6 – Der Blaue Pfeil<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
Als Pionier auf dem Gebiet der Leichttriebwagen<br />
präsentierte die BLS auf der Landesausstellung<br />
1939 ihren neuen Doppeltriebwagen BCFZe 4/6<br />
(ab 1956: ABDZe 4/6) Nr. 731. Gemeinsam mit<br />
seinen beiden Schwesterfahrzeugen pendelte er zunächst<br />
im Schnellzugdienst zwischen Bern und<br />
Neuenburg. Die Leistung der Triebwagen war so<br />
ausgelegt, dass sie dort rasch auf 110 km/h beschleunigen,<br />
auf der Lötschberg-Nordrampe<br />
(27 Promille Steigung) aber auch eine Anhängelast<br />
von 60 Tonnen ziehen konnten. So waren sie in der<br />
Lage, in der Hauptverkehrszeit einen Einheitswagen<br />
mitzunehmen. 1985 wurden der ABDZe 4/6 731<br />
und 736 an die Sensetalbahn verkauft, wo sie als<br />
BDe 4/6 noch über zehn Jahre im Einsatz standen.<br />
Serie ABDZe 4/6<br />
Hersteller_____________________SIG/SAAS<br />
Erstes Baujahr ________________1938<br />
Anzahl Exemplare ______________3<br />
Achsfolge_____________________Bo’2’Bo’<br />
Stundenleistung _______________706 kW<br />
Höchstgeschwindigkeit _________110 km/h<br />
Anzahl Motoren________________4<br />
Gesamtmasse_________________80 t<br />
Länge über Puffer ______________41,50 m<br />
Letzte Planeinsätze ____________1999 1)<br />
Historischer Triebwagen_________BDe 4/6 736<br />
1)<br />
Als BDe 4/6 auf der Sensetalbahn<br />
Serie RBDe 4/4 (RBDe 565) – Der Privatbahn-Pendelzug<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
Da die BLS mit ihrem überaltertem Triebwagenbestand<br />
die Anforderungen des schweizweiten Taktfahrplans<br />
nicht bewältigen konnte, beschaffte sie<br />
ab 1982 gemeinsam mit drei anderen Privatbahnen<br />
zunächst zehn zwei-, drei- und vierteilige<br />
Pendelzugeinheiten mit einem vierachsigen Motorwagen.<br />
Bis 1992 wuchs die Serie auf 22 Einheiten<br />
an. Um auch niederflurige Einstiege und<br />
Abteile anzubieten, ergänzte die BLS ab 2004<br />
ihre Einheiten um so genannte B-Jumbos. Diese<br />
ungewöhnlichen sechsachsigen Zwischenwagen<br />
entstanden aus den Endabteilen aufgeschnittener<br />
Einheitswagen und dazwischen eingeschweißten<br />
neuen Niederflur-Wagenkästen mit Gelenk, die auf<br />
einem Jakobsdrehgestell ruhen.<br />
Baureihe RBDe 4/4 (RBDe 565)<br />
Hersteller ______________SIG/SWS/SWP/BBC<br />
Erstes Baujahr __________1982<br />
Anzahl Exemplare________22<br />
Achsfolge_______________Bo’Bo’<br />
Stundenleistung _________1.650 kW<br />
Höchstgeschwindigkeit ___125 km/h<br />
Anzahl Motoren _________4<br />
Gesamtmasse __________69 t<br />
Länge über Puffer________25,00 m<br />
Serie RABe 535 – Der „Lötschberger“<br />
Sven Klein<br />
Nachdem die Intercitys ab Dezember 2007<br />
den Weg durch den Lötschberg-Basistunnel<br />
nahmen, beschaffte die BLS für den Regionalverkehr<br />
über die Bergstrecke ab 2008 ganz<br />
spezielle Triebwagen der Serie RABe 535<br />
(„Lötschberger“). Sie waren eine Weiterentwicklung<br />
der RABe 525 („NINA“), aber mit<br />
deutlich höherem Komfort ausgestattet. Eingesetzt<br />
werden die klimatisierten Triebwagen<br />
als RegioExpress Bern – Kandersteg – Brig<br />
mit einem Flügelzug nach Zweisimmen. Nördlich<br />
von Spiez verkehren die Triebwagen vielfach<br />
in Drei- oder sogar Vierfachtraktion, teils<br />
gemischt mit NINA-Zügen.<br />
Baureihe RABe 535<br />
Hersteller_________________Vevey/Bombardier<br />
Erstes Baujahr ____________2008<br />
Anzahl Exemplare __________21<br />
Achsfolge_________________Bo’2’2’2’Bo’<br />
Stundenleistung ___________1.000 kW<br />
Höchstgeschwindigkeit _____160 km/h<br />
Anzahl Motoren____________4<br />
Dienstmasse______________135 t<br />
Länge über Kupplung_______62,71 m<br />
Texte/Tabellen: Dr. Dietmar Beckmann<br />
38
6x <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong><br />
+ Geschenk!<br />
Ihr Willkommensgeschenk<br />
GRATIS!<br />
Buch »Deutsches Lokomotivbild-Archiv«<br />
Ein Juwel herausragender Eisenbahnfotografie ist zurück:<br />
Der großformatige Prachtband zeigt die famosen<br />
Aufnahmen des »Deutschen Lokomotivbild-Archivs«!<br />
✁<br />
❑ JA,<br />
❑<br />
Mein Vorteilspaket<br />
✓Ich spare 15% (bei Bankeinzug sogar 17%)!<br />
✓Ich erhalte mein Heft 2 Tage vor dem Erstverkaufstag<br />
bequem nach Hause (nur im<br />
Inland) und verpasse keine Ausgabe mehr!<br />
✓Bei Nichtgefallen kann ich jede Ausgabe<br />
umgehend zur Gutschrift zurücksenden<br />
✓Ich kann nach dem ersten Jahr jederzeit<br />
abbestellen und erhalte zuviel bezahltes<br />
Geld zurück!<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong>-Vorteilspaket<br />
ich möchte <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> lesen und 15% sparen<br />
✗Bitte schicken Sie mir <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> ab sofort druckfrisch und mit 15 % Preisvorteil für nur € 10,62* pro Heft (Jahrespreis: € 63,72*)<br />
alle zwei Monate frei Haus. Ich erhalte als Willkommensgeschenk das Buch »Deutsches Lokomotivbild-Archiv«**. Versand<br />
erfolgt nach Bezahlung der ersten Rechnung. Ich kann das Abo nach dem ersten Bezugsjahr jederzeit kündigen.<br />
Bitte informieren Sie mich künftig gern per E-Mail, Telefon oder Post über interessante Neuigkeiten und Angebote<br />
(bitte ankreuzen).<br />
Sie möchten noch mehr sparen?<br />
Dann zahlen Sie per Bankab bu chung (nur im Inland möglich)<br />
und Sie sparen zusätzlich 2 % des Abopreises!<br />
Ja, ich will sparen und zahle künftig per Bankabbuchung<br />
❑ pro Jahr<br />
❑ pro Quartal<br />
WA-Nr. 620BE60233 – 6217083<br />
Ihr Geschenk<br />
Vorname/Nachname<br />
Kreditinstitut<br />
Straße/Hausnummer<br />
PLZ/Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail (für Rückfragen und weitere Infos)<br />
✗<br />
Datum/Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
Datum/Unterschrift✗<br />
Bankleitzahl<br />
Bitte ausfüllen, ausschneiden oder kopieren und gleich senden an:<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> Leserservice, Postfach 12890, 82197 Gilching<br />
per Fax an 0180-532 16 20 (14 ct/min.), oder per E-Mail: leserservice@bahnextra.de<br />
www.bahn-extra.de/abo<br />
* Preise inkl. MwSt., im Ausland zzgl. Versandkosten<br />
** Solange Vorrat reicht, sonst gleichwertige Prämie
BLS/Lötschbergbahn<br />
BLS Cargo<br />
Im Alpentransit ganz vorn<br />
Im Frühjahr 2001 gliederte die BLS ihren Güterverkehr als eigene Tochtergesellschaft aus. Zusammen<br />
mit Deutscher <strong>Bahn</strong> und einem italienischen Eisenbahnverkehrsunternehmen stieg BLS Cargo zum<br />
größten Anbieter des <strong>Schweiz</strong>er Transitgüterverkehrs auf. Planungen für weiteres Wachstum laufen<br />
Am 3. April 2001 wurde die BLS Cargo<br />
AG mit Sitz in Bern als hundertprozentige<br />
Tochter der BLS Lötschbergbahn<br />
AG gegründet; zum 1. Juli des Jahres gab der<br />
Mutterkonzern das Güterverkehrsgeschäft an<br />
seine Tochter ab. BLS Cargo konzentrierte sich<br />
mit schlanken Strukturen auf die Beförderung<br />
von Ganzzügen, vor allem von internationalen<br />
Zügen im Alpentransit. Damit wollte die BLS<br />
Anteile im liberalisierten Güterverkehrsmarkt<br />
gewinnen; gleichzeitig strebte sie danach, das<br />
Marktpotenzial im <strong>Schweiz</strong>er Schienengüterverkehr<br />
zu nutzen und hier eine offensivere<br />
Wachstumsstrategie zu verfolgen.<br />
Eine Maßnahme, um die gesetzten Ziele zu<br />
erreichen, war die Suche nach gut aufgestellten<br />
Partnern. So übergab die BLS Lötschbergbahn<br />
AG im Juni 2002 Teile des Aktienkapitals<br />
an ausländische Unternehmen, um<br />
europäische Allianzen aufzubauen und den<br />
grenzüberschreitenden Verkehr zu stärken.<br />
Seither sind neben der BLS AG (mit 52 Prozent<br />
Aktienanteil) die DB <strong>Schweiz</strong> Holding<br />
AG (45 Prozent) und die IMT AG (italienische<br />
Ambrogio-Gruppe) mit drei Prozent an<br />
der BLS Cargo AG beteiligt.<br />
Die Strategie von BLS Cargo ist zweigeteilt: Ganzzüge<br />
im Transit und Gütertransporte in der <strong>Schweiz</strong><br />
Rollende Autobahn und Expansion<br />
Mit fünf täglichen Zugpaaren nahm BLS Cargo<br />
im Juni 2001 die „Rollende Autobahn“<br />
Novara (I) – Freiburg im Breisgau (D) in Betrieb,<br />
welche das Unternehmen als „Key Operator“<br />
im Auftrag der RAlpin AG, einer gemeinsamen<br />
Gesellschaft von SBB, BLS, Hupac<br />
und FS Trenitalia, führt. 2004 wurde das<br />
Angebot auf zehn Zugpaare täglich erweitert,<br />
die mit durchschnittlich 80 Prozent gut ausgelastet<br />
sind. Die „RoLa“ ist zu einem festen,<br />
erfolgreichen Bestandteil in der Angebotspalette<br />
von BLS Cargo geworden.<br />
Weiterhin nahm BLS Cargo im Mai 2003<br />
den Betrieb auf der Gotthard-Route mit zwei<br />
Zügen pro Tag auf und wurde so zur unmittelbaren<br />
Konkurrenz von SBB Cargo. Zugleich<br />
wurde das Unternehmen ein vollwerti-<br />
40
BLS Cargo<br />
LINKS Mit der „Rollenden<br />
Autobahn“ fing<br />
BLS Cargo sein Engagement<br />
im Güterverkehr<br />
an, nach wie<br />
vor sind die Lkw-<br />
Transporte ein fester<br />
Bestandteil des<br />
Angebots. Im Sommer<br />
2007 bringen<br />
zwei 485er einen<br />
RoLa-Zug über die<br />
Lötschberg-Strecke<br />
und befahren dabei<br />
die Bietschtalbrücke<br />
Josef Mauerer<br />
RECHTS Auch am<br />
Gotthard ist BLS<br />
Cargo mittlerweile<br />
mit Leistungen präsent.<br />
Eine BLS-185<br />
und eine Schwesterlok<br />
des Kooperationspartners<br />
DB<br />
Schenker schleppen<br />
im Juli 2012 einen<br />
Zug des Kombinierten<br />
Ladungsverkehrs<br />
bei Wassen bergwärts<br />
V. Emersleben<br />
IN KÜRZE<br />
TRIEBFAHRZEUGE BEI BLS CARGO<br />
BLS Cargo besitzt eine Reihe eigener Lokomotiven: 20 für<br />
Deutschland und die <strong>Schweiz</strong> zugelassene Elloks Re 485<br />
mit Zugsicherungssystem ETCS, zehn für Deutschland, die<br />
<strong>Schweiz</strong>, Österreich und Italien zugelassene Elloks Re 486<br />
mit ETCS sowie 20 Re 425 (früher Re 4/4). Aus dem Lok-Pool<br />
der BLS können weitere Re 425 sowie Re 465 abgerufen<br />
werden. Gemietet oder im internationalen Leistungsaustausch<br />
verkehrt die Ellok-Baureihe 185 von DB Schenker<br />
Rail Deutschland vor allem auf der Gotthard-Strecke. Ab<br />
2014 will BLS Cargo als erste <strong>Bahn</strong> die deutsche Baureihe<br />
187 einsetzen; als „Last-Mile-Lok“ besitzt die Ellok zusätzlich<br />
ein Diesel-Generator-Aggregat, um anstelle von Dieselrangierloks<br />
die Güterwagen auf dem letzten, nicht elektri fi zierten<br />
Streckenabschnitt zuzustellen.<br />
Triebfahrzeuge in eigenem Besitz aus BLS-Pool gemietet<br />
Bezeichnung Re 485 Re 486 Re 425 Re 425 Re 465 185 (DB) 187 (DB)<br />
Stückzahl 20 10 20 14 18 untersch. 3<br />
Inbetriebsetzung 2002–2003 2008–2009 1964–1983 1964–1983 1994–1997 ab 2000 ab 2014<br />
Zulassung CH, D CH, D, I, A CH CH CH D, CH CH, D, A<br />
ETCS ja ja ja nein ja teilweise ja ?<br />
Länge 18,9 m 18,9 m 15,1 m 15,1 m 18,5 m 18,9 m 18,9 m<br />
Gewicht 84 t 84,7 t 80 t 80 t 84 t 85 t 87 t<br />
Leistung 5.600 kW 5.600 kW 4.980 kW 4.980 kW 6.400 kW 5.600 kW 5.600 kW<br />
Höchstgeschw. 140 km/h 140 km/h 140 km/h 140 km/h 230 km/h* 140 km/h 140 km/h<br />
* zugelassen für 160 km/h<br />
ger Anbieter auf beiden Transitachsen durch<br />
die <strong>Schweiz</strong>, konnte den Kunden je nach Herkunfts-<br />
und Bestimmungsort der Fracht den<br />
bestmöglichen Transportweg anbieten und besaß<br />
bei betrieblichen Unregelmäßigkeiten<br />
Ausweichmöglichkeiten. Die Zahl der Züge<br />
über die Gotthard-Route betrug Ende 2003<br />
60 Züge pro Woche, ein Jahr später etwa das<br />
Doppelte, wobei etwa 60 Prozent der Züge aus<br />
dem konventionellen Wagenladungsverkehr<br />
(Papier, Stahl oder Autos) und 40 Prozent aus<br />
dem unbegleiteten kombinierten Verkehr<br />
(UKV) stammten.<br />
Anstieg der Verkehrsleistungen<br />
Von 2002 bis 2008 stiegen die Verkehrsleistungen<br />
von BLS Cargo sprunghaft von<br />
870 Millionen Nettotonnen-Kilometern auf<br />
3.697 Millionen Nettotonnen-Kilometer.<br />
2009 brachen sie wegen der Wirtschaftskrise<br />
auf 2.981 Millionen Nettotonnen-Kilometer<br />
ein und erreichten 2011 wieder 3.826 Millio-<br />
nen Nettotonnen-Kilometer. Damit entwickelte<br />
sich BLS Cargo zur führenden Transit-<br />
<strong>Bahn</strong> durch die <strong>Schweiz</strong>, ist aber stark von der<br />
Wirtschaftsentwicklung in den Nachbarländern<br />
Deutschland und Italien abhängig.<br />
Neben dem unbegleiteten Kombinierten<br />
Verkehr (plus 16 Prozent) und dem konventionellen<br />
Wagenladungsverkehr (plus 25 Prozent)<br />
trug die „Rollende Autobahn“ mit jetzt<br />
elf täglichen Zugpaaren (plus 7 Prozent) zur<br />
positiven Entwicklung bei. Mit RAlpin wurden<br />
Verträge über die Transportleistungen der<br />
Jahre 2012 bis 2018 abgeschlossen und damit<br />
der für BLS Cargo wichtige Verkehr für die<br />
Zukunft gesichert.<br />
Probleme bei der Infrastruktur<br />
Allerdings warnt BLS Cargo seit Jahren vor<br />
Engpässen auf dem Schienennetz. Im Jahr<br />
2011 überstieg denn auch die Nachfrage nach<br />
Trassen für den Verkehr mit Vier-Meter-Profil<br />
das Angebot. Deshalb musste das Unternehmen<br />
in einem Bietverfahren um Trassen auf<br />
der Lötschberg-Simplonachse, der einzigen<br />
<strong>Schweiz</strong>er Transitachse für hochprofiligen Güterverkehr,<br />
kämpfen. Abhilfe könnten der Ausbau<br />
des Lötschberg-Basistunnels und der Gotthardstrecke<br />
als Vier-Meter-Korridor schaffen.<br />
Ein weiteres Problem ist der Zustand der<br />
Schieneninfrastruktur auf der Simplon-Südseite,<br />
der zu Einschränkungen und unvorhergesehenen<br />
Streckenunterbrechungen wegen Bauarbeiten<br />
führt. Hinzu kommt die unzureichende<br />
Ausnutzung der Kapazitäten der großzügig ausgebauten<br />
Rangierbahnhöfe in Domodossola. Als<br />
im Jahr 2012 die Gotthard-Strecke wegen Felsstürzen<br />
mehrmals gesperrt war, stellte die BLS<br />
zusätzliche Trassen für den Umleitungsverkehr<br />
zur Verfügung, die Güterzüge wurden aber in<br />
Domodossola nicht angenommen. Diese Hindernisse<br />
muss BLS Cargo möglichst bald überwinden.<br />
Sonst könnte die Nummer Eins im Alptransit<br />
ihr Ziel weiterer Expansion fürs Erste<br />
verfehlen. Dr. Hans-Bernhard Schönborn<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 41
BLS/Lötschbergbahn<br />
Eine Re 460 der SBB hat mit ihrem Doppelstock-IC den <strong>Bahn</strong>hof Frutigen unterfahren und wird nun in den Basistunnel eintauchen; im Hintergrund<br />
die Auffahrt zur Bergstrecke. Seit 2007 ist der Fernreiseverkehr von der Lötschberg-Bergstrecke in den Basistunnel „abgewandert“<br />
Der Lötschberg-Basistunnel<br />
Die ersten Erfahrungen<br />
Seit nunmehr fünf Jahren donnern Güter- und Reisezüge durch den Lötschberg- Basis tunnel, den<br />
ersten Basistunnel der Alpen. Mit seiner vorwiegend eingleisigen Betriebsführung stößt er aber<br />
bereits an seine Kapazitätsgrenze. Manche Güterzüge müssen deshalb planmäßig über die alte<br />
Bergstrecke fahren – oder auch, weil ihren Loks das im Tunnel geforderte ETCS-System fehlt<br />
Eigentlich hatte das <strong>Schweiz</strong>er Stimmvolk<br />
in der Volksabstimmung zur Neuen Alpen-Transversale<br />
(NEAT) 1992 seine Zustimmung<br />
zu einem Lötschberg-Basistunnel gegeben,<br />
der einen zweigleisigen Zugbetrieb<br />
zwischen Frutigen im Kandertal und Raron an<br />
der Rhone ermöglicht. Alle Güter- und Reisezüge<br />
des Fernverkehrs nach Brig und weiter<br />
durch den Simplontunnel nach Italien sollten<br />
hier den Alpenhauptkamm mit Steigungen von<br />
Die <strong>Schweiz</strong>er stimmten für einen zweigleisigen<br />
Tunnel. Aber Politiker speckten das Projekt ab<br />
maximal 16 Promille (im Basistunnel 10 Promille)<br />
unterqueren. Eigens für den Autoverlad<br />
war ein Abzweig im Tunnel vorgesehen, der zu<br />
einem zweiten Südportal bei Steg/Niedergesteln<br />
mit einer Öffnung in Richtung Westen<br />
führen sollte. Analog zum Gotthard-Basistunnel<br />
waren zwei Einspurtunnel in einem Abstand<br />
von ca. 40 Metern vorgesehen, die durch<br />
104 als Fluchtwege dienende Querschläge miteinander<br />
verbunden sein sollten. Zwei Nothaltestellen<br />
(Ferden und Mitholz) waren wichtiger<br />
Bestandteil des Sicherheitskonzeptes und sollten<br />
mit ihren doppelten Spurwechseln einem<br />
flexiblen Betrieb auch im Störungsfall dienen.<br />
Auf politischen Druck wurde das Projekt im<br />
Nachhinein aber stark abgespeckt. Ein wichtiger<br />
Grund lag in der Befürchtung, die Lötschbergachse<br />
könne langfristig zu große Güterverkehrsanteile<br />
vom Gotthard abwerben und die<br />
Wirtschaftlichkeit des im Bau befindlichen Gotthard-Basistunnels<br />
gefährden. Dabei sind der Hafen<br />
von Genua sowie die großen italienischen<br />
Güterterminals in Gallarate, Busto Arsizio und<br />
Novara vom Lötschberg-Simplon wesentlich besser<br />
erreichbar als aus dem Tessin über die eingleisige<br />
Strecke entlang des Lago Maggiore.<br />
Betrieb der ersten Etappe<br />
Somit wurde bisher nur eine so genannte erste<br />
Etappe des Lötschberg-Basistunnels eröffnet. Lediglich<br />
die südlichen 9,7 Kilometer zwischen Raron<br />
(Südportal) und Ferden sind doppelspurig<br />
ausgebaut. Auf dem mittleren Abschnitt zwischen<br />
den Nothaltestellen Ferden und Mitholz wurden<br />
zwar beide Tunnelröhren ausgebrochen und im<br />
Rohbau fertig gestellt, aber nur in der östlichen<br />
Röhre liegt ein Gleis. In dem daran anschließenden<br />
Abschnitt bis zum Nordportal existiert sogar<br />
nur eine einzige Tunnelröhre, als Fluchtweg<br />
dient hier der parallel verlaufende, deutlich kleinere<br />
Dienststollen Kandertal. Auch wenn die Sicherheit<br />
der Fahrgäste vollständig gewährleistet<br />
ist, erfordert der immerhin ca. 20 Kilometer lange<br />
Einspurabschnitt ohne Kreuzungsmöglichkeit<br />
42
Lötschberg-Basistunnel<br />
Ein stündlicher IC und ein zweistündlicher EC (Foto) lasten den Tunnel zu mehr als der Hälfte<br />
der Kapazität aus. Für Güterzüge bleiben da nicht mehr viele Optionen V. Emersleben (2, auch S. 42)<br />
In Raron zweigt die Strecke in den Tunnel<br />
von der Rhônetalbahn ab<br />
Josef Mauerer<br />
IN KÜRZE<br />
LÖTSCHBERG-BASISTUNNEL<br />
Spurweite<br />
1.435 mm<br />
Planer<br />
BLS AlpTransit AG<br />
Betreiber<br />
BLS Netz AG<br />
Beginn der Arbeiten 5. Juli 1999<br />
Freigabe 14. Juni 2007<br />
Länge des Tunnels<br />
34,6 km<br />
Anzahl der Röhren 2 (im Endausbau)<br />
Zul. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h<br />
Plangeschwindigkeit<br />
200 km/h<br />
Gewicht d. <strong>Bahn</strong>ausrüstung ges. 170.000 t<br />
Sicherungssystem<br />
ETCS<br />
Länge des ges. Stollensystems 88,1 km<br />
Baukosten<br />
4,3 Mrd. CHFr<br />
Projektbeteiligte 2.500<br />
erhebliche betriebliche Einschränkungen gegenüber<br />
der voll ausgebauten Variante. Da die herabgesetzte<br />
Kapazität vollständig für den Fernverkehr<br />
genutzt werden soll, bleibt der Autoverlad<br />
durch den 100 Jahre alten Lötschberg-Scheiteltunnel<br />
in der heutigen Form zwischen Kandersteg<br />
und Goppenstein unverändert bestehen.<br />
Nach lediglich acht Jahren Bauzeit wurde der<br />
Lötschberg-Basistunnel im Sommer 2007 dem<br />
Verkehr übergeben. Seit dem 9. Dezember 2007<br />
ist er in den schweizerischen Taktfahrplan integriert.<br />
Neben dem stündlichen Intercity der Linie<br />
Romanshorn – Brig fährt alle zwei Stunden<br />
ein italienischer Neigezug der Serie ETR 610 als<br />
Eurocity Basel – Mailand (oder ein IC in gleicher<br />
Fahrplanlage) durch den Tunnel. Mit diesen drei<br />
Reisezügen ist der Einspurabschnitt unter Berücksichtigung<br />
der Pufferzeiten bereits zu mehr<br />
als 50 % ausgelastet; für den Güterverkehr bleibt<br />
nur noch Platz für einen Zug pro Stunde in Süd-<br />
Nord-Richtung und drei Züge in der Gegenrichtung.<br />
In den Stunden, in denen der Neigezug<br />
aus Italien kommt, reduziert sich die Anzahl<br />
der Gütertrassen gar auf eine pro Richtung. Deshalb<br />
muss man einen Teil der Güterzüge auf die<br />
alte Bergstrecke schicken. Dafür bevorzugt die<br />
BLS die Süd-Nord-Richtung, weil die Lötschberg-Südrampe<br />
gegenüber der kurvenreichen<br />
Nordrampe günstiger trassiert ist. Zudem kann<br />
auf das Ansetzen einer Vorspann- oder Schublok<br />
in Brig in der Regel verzichtet werden, da<br />
Vorbereitungen für den Tunnelbetrieb: Mon -<br />
tage der Fahrleitung in der Versuchsstrecke<br />
Mitholz<br />
BLS<br />
meist die für die 25-Promille-Rampe Domodossola<br />
– Brig ausgelegte Traktionsleistung der<br />
Züge auch für die Lötschberg-Südrampe mit bis<br />
zu 27 Promille ausreicht.<br />
Ein weiterer Grund für die Nutzung der<br />
Bergstrecke von zum Teil schweren Güterzü-<br />
ANZEIGE<br />
Ihre Prämie<br />
Noch mehr Auswahl unter<br />
www.bahn-extra.de/abo<br />
Neue Röhre unter dem Berg; die Aufnahme<br />
entstand bei der ersten Versuchsfahrt im<br />
Lötschberg-Basistunnel<br />
BLS<br />
gen liegt in dem Sicherungssystem ETCS Level<br />
2, das im Tunnel obligatorisch ist. Abgesehen<br />
von den Portalen existieren im Tunnel<br />
keine optischen Signale, so dass alle Lokomotiven<br />
mit den entsprechenden fahrzeugseitigen<br />
Einrichtungen ausgestattet sein müssen.<br />
Die knappen Trassen im Tunnel führten in<br />
den ersten Betriebsjahren insbesondere bei verspäteten<br />
Reisezügen aus Italien zu Konflikten<br />
nicht nur von Reisezügen untereinander, sondern<br />
auch mit dem Güterverkehr, da BLS Cargo<br />
natürlich auf keine der lukrativen Trassen<br />
verzichten möchte. Meist konnte das Problem<br />
mit dem Tausch von Trassen gelöst werden,<br />
wobei beispielsweise der IC nach Romanshorn<br />
eine halbe Stunde vor Plan auf die Reise geschickt<br />
wurde und der EC in dessen Plan folgte.<br />
Gelegentlich sind aber auch bereits Fernzüge<br />
über die Bergstrecke geschickt worden.<br />
Wann der endgültige Ausbau des Lötschberg-<br />
Basistunnels mit dem Ausbruch der zweiten<br />
Röhre zwischen Frutingen und Mitholz sowie<br />
einer Verlegung der Gleise in den vorhandenen<br />
Tunnelabschnitten das Nadelöhr beseitigt,<br />
ist zurzeit noch nicht abzusehen.<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 43
BLS/Lötschbergbahn<br />
Bereit für den Notfall: der Lösch- und Rettungszug im <strong>Bahn</strong>hof Frutigen,<br />
aufgenommen 2007<br />
Thomas Wunschel<br />
Herr über 5.600 Kilowatt: Lokführer in einer Ellok der Reihe Re 485.<br />
Ende 2011 beschäftigte die BLS mehr als 2.800 Mitarbeiter BLS<br />
Die BLS heute<br />
Tradition und Moderne<br />
Neue Farben, neue Aufgaben, neue Fahrzeuge: Die BLS hat in den letzten zwei Jahrzehnten ihr<br />
Aussehen ziemlich verändert. Manches blieb aber auch in bewährter Manier<br />
44
BLS-Betrieb heute<br />
Die Lenkung des Zugverkehrs im Blick: Fahrdienstleiter-Arbeitsplatz<br />
in der Dispositiv-Operativen Leitstelle in Spiez (DOLS)<br />
BLS<br />
Die BLS übernahm einige Elloks Re 4/4 II der SBB, lackierte sie um<br />
und setzt sie im Nahverkehr ein<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
LINKS Der kürzeste<br />
Weg vom Mittelland<br />
ins Wallis, so wirbt<br />
die BLS für den Autoverlad<br />
Kandersteg<br />
– Goppenstein. Eine<br />
Viertelstunde brauchen<br />
die Züge für<br />
die Strecke, dann<br />
können die Autos<br />
wie hier im abendlichen<br />
Goppenstein<br />
wieder durchstarten<br />
BLS<br />
RECHTS MITTE Bei<br />
spannendem Wetter<br />
fährt „NINA“ für die<br />
S-<strong>Bahn</strong> Bern. Auf der<br />
Linie S 44 sind die<br />
beiden Triebzüge<br />
zwischen Kaufdorf<br />
und Thurnen unterwegs<br />
BLS<br />
RECHTS UNTEN Obwohl<br />
die neueste Lokomotivgeneration<br />
von<br />
BLS Cargo, die Serie<br />
486, auch den<br />
Gleichstrom in Italien<br />
(3 kV) verarbeiten<br />
kann, wird sie<br />
freizügig überall in<br />
der <strong>Schweiz</strong> eingesetzt.<br />
Die 486 508<br />
zieht im Juli 2009 einen<br />
Ölzug bei Twan<br />
am Bielersee entlang<br />
zur Raffinerie<br />
Cressier in Cornaux<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
45
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
Im Sommer 1991 war der EC 100 Brig – Dortmund auf dem Laufweg bis Basel die Starleistung im Umlaufplan der Ae 6/6. Samstags bestand der Zug<br />
aus 14 Wagen und die alten Gotthardloks konnten auf der Lötschberg-Südrampe bei bis zu 27 Promille Steigung ihre Leistungsfähigkeit beweisen. Am<br />
5. August hat die rote Kantonslok die anstrengende Bergfahrt bereits hinter sich und rollt über den Kanderviadukt bei Frutigen Dr. Dietmar Beckmann<br />
Die Gotthardlok Ae 6/6<br />
Die erste Einheitslok<br />
Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2012 schieden die berühmten Gotthard-Elloks der Serie<br />
Ae 6/6 aus dem Plandienst der <strong>Schweiz</strong>erischen Bundesbahnen aus. Doch es gab ein Comeback:<br />
Im März 2013 wurden fünf Exemplare der ersten schweizerischen Universallok reaktiviert<br />
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts<br />
entwickelte sich die 1882 eröffnete Gotthardbahn<br />
zu einer der wichtigsten Magistralen<br />
für den Reise- und insbesondere Güterverkehr<br />
zwischen Deutschland und Italien.<br />
Bis 1939 steigerte sich dort die Jahres-Gütermenge<br />
auf knapp sechs Millionen Tonnen, die<br />
in durchschnittlich 34 Zügen pro Tag durch<br />
den Scheiteltunnel befördert wurden. Zugloks<br />
waren zu jener Zeit fast ausschließlich die berühmten<br />
Krokodile der Serien Ce 6/8 II und<br />
Ce 6/8 III , die hier seit der Aufnahme des elektrischen<br />
Betriebes im Jahre 1920 bis zu<br />
520 Tonnen schwere Züge mit 30 km/h die<br />
26-Promille-Rampen hinauf schleppten.<br />
Der kriegsbedingte Rückgang des Güterverkehrs<br />
auf die Hälfte ließ die Beschaffung<br />
moderner Lokomotiven zunächst als unnötig<br />
erscheinen. Als aber zu Beginn der 50er-Jahre<br />
der wirtschaftliche Aufschwung insbesondere<br />
in Deutschland und Italien einsetzte, stiegen die<br />
Gütermengen auf der Gotthardbahn wieder<br />
steil an. Bereits Ende der 40er-Jahre war abzusehen,<br />
dass die im Güterverkehr eingesetzten,<br />
inzwischen bis zu 30 Jahre alten Stangenelloks<br />
den zukünftigen Anforderungen nicht mehr gewachsen<br />
sein würden. Auch die Elloks Ae 4/7<br />
mit Buchli-Antrieb waren mit den immer<br />
schwerer werdenden Schnellzügen häufig überfordert;<br />
die neuen, ab 1941 eingesetzten Elloks<br />
Ae 4/6 erfüllten die in sie gesetzten Erwartungen<br />
überhaupt nicht. Eine hohe Leistungsfähigkeit<br />
hatten lediglich die drei 14-achsigen<br />
Doppel-Elloks der Serie Ae 8/14.<br />
Start mit zwei Prototypen<br />
In dieser Situation entschieden sich die<br />
<strong>Schweiz</strong>erischen Bundesbahnen (SBB) im Jahre<br />
1949, zunächst zwei Prototypen einer uni-<br />
46
Ae 6/6 vor dem Abschied<br />
Kurz nach ihrer Ablieferung an die SBB wird die Kantonslok Ae 6/6<br />
11413 „Schaffhausen“ Anfang der 60er-Jahre auf der Gotthard-Südrampe<br />
in Szene gesetzt. Bei Rodi-Fiasso hält der BBC-Werksfotograf<br />
die nagelneue Maschine im Bild fest BBC/Slg. M. Niedt, Dr. D. Beckmann (r.)<br />
In der Spätphase der Einsätze, aber noch auf der klassischen Strecke<br />
ist im August 1981 diese Ae 6/6 unterwegs. Mit dem aus Einheitsund<br />
Leichtstahlwagen gebildeten Regionalzug 1870 nach Chiasso hat<br />
sie Bellinzona verlassen und zeigt sich nun vor der Burg Castelgrande<br />
plare lieferte wie bei den Vorserienloks die<br />
BCC, für die übrigen 56 Maschinen die Maschinenfabrik<br />
Oerlikon (MFO). Der Einsatzbereich<br />
der neuen Lokomotiven konzentrierversell<br />
im Güter- und Personenverkehr einsetzbaren<br />
Gotthardlok mit einem höchst anspruchsvollen<br />
Lastenheft zu bestellen. Die<br />
neuen Lokomotiven sollten 600 Tonnen<br />
schwere Züge die langen Gotthard-Rampen<br />
(26 Promille Steigung) mit 75 km/h hinaufbefördern<br />
und auf den Zulaufstrecken bei<br />
125 km/h noch acht Tonnen Zugkraft entwickeln<br />
können. Den Zuschlag für die Herstellung<br />
von zwei Prototypen erhielt ein Konsortium<br />
aus zwei schweizerischen Firmen. Den<br />
mechanischen Teil konstruierte und baute die<br />
<strong>Schweiz</strong>erische Lokomotiv- und Maschinenfabrik<br />
(SLM) in Winterthur, während die<br />
Brown Boveri & Cie (BBC) mit Sitz in Baden<br />
für den elektrischen Teil verantwortlich<br />
war. Die guten Erfahrungen mit dem Einzelachsantrieb<br />
in den ersten laufachslosen Drehgestellloks<br />
der Bern-Lötschberg-Simplon-<br />
<strong>Bahn</strong> (Ae 4/4, 1944) und der SBB (Re 4/4 I ,<br />
1946) führten zu einer vollkommen neu konstruierten<br />
Lokomotive mit zwei dreiachsigen<br />
Drehgestellen, wobei jede Achse von einem<br />
1.000 PS starken Motor angetrieben wurde<br />
(Achsfolge Co’Co’). Mit der Stundenleistung<br />
von 4.300 kW und einem Adhäsionsgewicht<br />
von 6 x 20 Tonnen konnten die Loks die Leistungsanforderungen<br />
problemlos erfüllen. Als<br />
aber der erste Prototyp, die Ae 6/6 11401, am<br />
4. September 1952 erstmals die Hallen des<br />
BBC-Werkes Münchenstein verließ und routinemäßig<br />
gewogen wurde, brachte er<br />
124 Tonnen auf die Waage. Das Gewicht lag<br />
damit deutlich über der Toleranzgrenze von<br />
120 Tonnen ± 2 %, so dass die Lok umgehend<br />
zur Nachbesserung zur SLM zurückgeschickt<br />
wurde. Zusammen mit der am 31. Januar<br />
1953 abgelieferten Schwestermaschine 11402<br />
wurde Lok 11401 nach ihrer Rückkehr einem<br />
umfangreichen Testprogramm unterzogen.<br />
Die SBB stationierten beide Loks in Erstfeld<br />
und schickten sie vor Planzügen über den<br />
Gotthard. Obwohl die beiden Vorserienloks<br />
das Pflichtenheft erfüllten, offenbarten sie<br />
dennoch Optimierungspotenzial für die Serie.<br />
Eine wichtige Änderung betraf die elektrische<br />
Bremse, die sich mit einer Auslegung für<br />
300 Tonnen Zuggewicht bei 20 Promille Gefälle<br />
für die langen Talfahrten mit langen Güterzügen<br />
auf den Gotthardrampen als viel zu<br />
schwach entpuppte. Zu lauftechnischen Problemen<br />
führten die dreiachsigen Drehgestelle<br />
mit starr gelagerten Radsätzen. In den zahlreichen<br />
engen Kurven der Gotthardbahn kam<br />
es zu einem enormen Verschleiß sowohl an<br />
den Rädern und als auch an den Schienen. Als<br />
Gegenmaßnahmen erhielten die Serienloks in<br />
Querrichtung seitenelastisch (weich) gelagerte<br />
Radsätze, der Spurkranz der mittleren Räder<br />
wurde verkleinert.<br />
Die Gotthard-Lok sollte 600 Tonnen schwere Züge<br />
mit 75 km/h über die 26-Promille-Rampen bringen<br />
IN KÜRZE TECHNISCHE DATEN DER AE 6/6<br />
Baureihe Ae 6/6<br />
Hersteller<br />
SLM/BBC/MFO<br />
Inbetriebsetzung Vorserie/Serie<br />
1953/1955-1966<br />
Anzahl Exemplare 120<br />
Achsfolge<br />
Co’Co’<br />
Stundenleistung<br />
4.300 kW<br />
Gesamtmasse<br />
120 t<br />
Höchstgeschwindigkeit 125 km/h<br />
Länge über Puffer<br />
18,40 m<br />
Anzahl Fahrmotoren 6<br />
Stundenzugkraft<br />
221 kN<br />
Serienbau und Einsätze<br />
Von 1955 bis 1966 fertigte die SLM insgesamt<br />
118 Serienloks mit den Nummern 11403 bis<br />
11520. Den elektrischen Teil für 62 Exem-<br />
Die unerwartete Rückkehr: Bei Redaktionsschluss<br />
hatten die SBB fünf Ae 6/6 für Güterzüge<br />
im Raum Zürich reaktiviert. Mit von der<br />
Partie war die chromverzierte 11419, hier am<br />
15. März 2013 bei Birmenstorf Florian Martinoff<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 47
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
Der Frontzierschmuck war ein Charakteristikum der Kantonsloks. Nur<br />
einen Teil des „Schnäuzchens“ trägt diese Ae 6/6, als sie im Dezember<br />
1988 mit zwei Wagen der Südostbahn bei Sattel-Ägeri unterwegs ist<br />
Ebenfalls typisch für die Ae 6/6 sind die wuchtigen Blattfeder-Pakete<br />
als Wiegenfederung. Hier zu sehen an der Ae 6/6 11518 „Herisau“<br />
Jörn Schramm<br />
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit der<br />
Ae 6/6 von 125 km/h erlaubte die durchgehende<br />
Bespannung der Schnellzüge von Zürich<br />
und Luzern bis Chiasso, so dass das zeitraubende<br />
Umspannen oder Ansetzen einer<br />
Vorspannlok in Erstfeld generell entfallen<br />
konnte. Mit Güterzügen und den damals<br />
noch zahlreichen Nachtschnellzügen gelangten<br />
sie im Durchlauf unter Umgehung der<br />
Kopfbahnhöfe von der italienischen Grenze<br />
(Chiasso und ab 1960 auch Luino) über die<br />
aargauische Südbahn (via Muri) bis nach Basel<br />
an der deutschen Grenze.<br />
Die neuen Lokomotiven waren hoch willkommen,<br />
da schon während ihrer Auslieferung<br />
die Jahresgütermenge auf der Gotthardbahn<br />
auf 20 Millionen Tonnen (1963) anstieg<br />
und sich die Zahl der Reisenden innerhalb von<br />
zehn Jahren auf sechs Millionen Fahrgäste pro<br />
Jahr verdoppelte.<br />
Im Jahr 2000 wurden die Ae 6/6 der SBB-Gütersparte zugeteilt, was einigen der Loks eine<br />
neue Lackierung bescherte. Im „SBB-Cargo-Design“ und mit der neuen Nummer 610 420 hat<br />
die Ae 6/6 einen Nahgüterzug übernommen Dr. Dietmar Beckmann, Slg. Karl Laumann (Bild o.l.)<br />
te sich sofort auf die Gotthardstrecke, wo sie<br />
die Traktion regelrecht revolutionierten. Praktisch<br />
alle Reise- und auch alle Güterzüge bis zu<br />
einem Gewicht von 650 Tonnen konnten sie<br />
alleine mit der Streckenhöchstgeschwindigkeit<br />
(75 bzw. 80 km/h) die Rampen hinaufziehen.<br />
Der bewusste Verzicht der SBB auf eine Vielfachsteuerung<br />
schränkte den Betriebsablauf<br />
überhaupt nicht ein, da zu jener Zeit die zulässige<br />
Zughakenlast ohnehin nur 1.000 Tonnen<br />
betrug und somit eine Doppeltraktion<br />
ohne künstliche Leistungsreduktion nicht zulässig<br />
gewesen wäre. Bei schweren Güterzügen<br />
ergänzte meist eine Schwestermaschine gleicher<br />
Baureihe als Zwischenlok den Zugverband,<br />
die ohnehin von einem eigenen Lokführer<br />
bedient werden musste. Vorspann am<br />
Berg leisteten häufig die älteren Loks der Serie<br />
Ae 4/6, wobei die Summe der Grenzlasten beider<br />
Loks (385 Tonnen + 650 Tonnen =<br />
1.035 Tonnen) ziemlich genau der zulässigen<br />
Zughakenlast entsprach.<br />
Dank 125 km/h Spitze konnte die Ae 6/6 Schnellzüge<br />
von Zürich bis Chiasso durchgehend fahren<br />
Gemeinde- und Kantonsloks<br />
Darüber hinaus entwickelte sich die Ae 6/6 zum<br />
Symbol der modernen SBB. Um die Lokomotive<br />
auch in den Regionen abseits der Gotthardachse<br />
zu präsentieren und so die Identifikation<br />
der schweizerischen Bevölkerung mit<br />
ihren Bundesbahnen zu erhöhen, schmückte<br />
man die Loks mit dem <strong>Schweiz</strong>er Kreuz auf der<br />
Stirnseite und Kantons- oder Gemeindewappen<br />
auf den Seitenwänden. Im Rahmen von meist<br />
groß angelegten Tauf-Zeremonien unter Einbeziehung<br />
der örtlichen Folklore erhielten die<br />
Ae 6/6 11426 bis 11450 die Namen der <strong>Schweiz</strong>er<br />
Kantonshauptorte und die höheren Nummern<br />
Namen weiterer Städte und Gemeinden.<br />
Eine ganz besondere Ehre wurde den Loks mit<br />
den Nummern 11401 bis 11425 zuteil, da sie<br />
dazu auserkoren waren, die Wappen der<br />
25 Kantone der <strong>Schweiz</strong> zu tragen. Um sie gegenüber<br />
den „gewöhnlichen“ Ae 6/6 hervorzuheben,<br />
zierte die Kantonsloks nicht nur das entsprechende<br />
Kantonswappen, sondern zusätzlich<br />
entsprechend dem damaligen Zeitgeschmack<br />
eine um laufende Chrom leiste, ergänzt durch<br />
zusätzliche kürzere Leisten unter den Führerstandsfenstern<br />
(„Schnäuzchen“). Auch nach ihrer<br />
Umlackierung in die rote Farbgebung ab<br />
1984 blieb ihnen der Schmuck erhalten.<br />
Mit der Gründung des neuen Kantons Jura<br />
zum 1. Januar 1979 entstand auch eine 26. Kantonslok.<br />
Dazu tauften die SBB die Ae 6/6 11483<br />
von „Porrentruy“ in „Jura“ um. Sie erhielt zwar<br />
48
Der Führerstand der Ae 6/6 entsprach der bei den SBB-Loks der 60er- und 70er-Jahren häufig verwendeten Einheitsbauform (Aufnahme vom<br />
März 1995)<br />
Armin Schmutz<br />
das entsprechende<br />
Wappen, der Chomleistenschmuck<br />
der<br />
übrigen Kantonsloks<br />
blieb ihr aber verwehrt.<br />
Mit der 11482<br />
existierte bereits eine<br />
Lok mit Namen des<br />
neuen Kantonshauptortes<br />
„Delémont“, so<br />
dass die Umbenennung<br />
einer weiteren<br />
Maschine nicht erforderlich<br />
war.<br />
Auch im Ausland<br />
fanden die Ae 6/6 gebührende<br />
Beachtung. So<br />
wurde die „Stadt Genf“<br />
(11450) auf der Weltausstellung in Brüssel von<br />
einem breiten Publikum bestaunt. Als Ende der<br />
60er-Jahre die belgische Staatsbahn (SNCB) den<br />
Bau einer Schnellfahrlokomotive mit dreiachsigen<br />
SLM-Drehgestellen plante (spätere Serie 20),<br />
war die Kantonslok 11414 („Bern“) zu Gast in<br />
Deutschland und erreichte bei Schnellfahrten auf<br />
der Strecke Bamberg – Forchheim mehrfach<br />
200 km/h. Dazu hatte die Lok zuvor eine veränderte<br />
Getriebeübersetzung (1:1,6) erhalten, bei<br />
der Wiegenfederung wurden die beiden Blattfedern<br />
durch Flexicoil-Schraubenfedern ersetzt.<br />
Von den Bergen ins Flachland<br />
Die inzwischen als „Gotthardlok“ bezeichnete<br />
Universallok Ae 6/6 prägte 15 Jahre lang die<br />
Traktion auf der Bergstrecke, wo sie<br />
in den 60er-Jahren fast alle Schnellund<br />
nahezu alle Güterzüge bespannte.<br />
Auch auf der Simplonbahn<br />
mit ihrer 25-Promille-Rampe zwischen<br />
Domodossola und dem Simplontunnel<br />
konnte sie ihre Leistungsfähigkeit<br />
beweisen.<br />
Die ersten Konkurrenten erschienen<br />
am Gotthard Ende der<br />
60er-Jahre mit den Loks der Serie<br />
Re 4/4 II , die in Doppeltraktion<br />
Schnellzüge beförderten, und ab<br />
1971 mit den 20 Loks der Serie<br />
Re 4/4 III , einer Bergvariante der<br />
Re 4/4 II mit angepasster Getriebeübersetzung.<br />
Die endgültige<br />
„Vertreibung“ der Ae 6/6 von<br />
der Bergstrecke vollzogen aber die 85 zwischen<br />
1975 und 1980 beschafften Loks der<br />
Serie Re 6/6, die mit ihren drei zweiachsigen<br />
Drehgestellen und fast doppelter Leistung<br />
(7.850 kW) als neue Universallokomotiven<br />
am Gotthard auserkoren waren.<br />
Das Einsatzgebiet der Ae 6/6 verlagerte sich<br />
nun weitgehend ins Mittelland, wo sie zunächst<br />
hochwertige Güterzüge von den Altbauloks<br />
übernahmen. Dort konnten sie fast<br />
alle Züge in Einfachtraktion ziehen, beispielsweise<br />
die schnellen Transitzüge von Buchs<br />
nach Basel und Genf, die schweren Ölzüge<br />
von Cornaux und St. Triphon ins ganze Land<br />
oder auch die zahlreichen Nahgüterzüge mit<br />
zum Teil beträchtlicher Länge. Aufgrund ihrer<br />
Slg. Peter Kusterer<br />
dreiachsigen Drehgestelle galten sie allerdings<br />
als „Schienenfresser“, so dass sie ab den 90er-<br />
Jahren zunehmend in den weniger kilometerintensiven<br />
Einsatz vor Sammlern auf Nebenbahnen<br />
und Privatbahnen abwanderten.<br />
Im Rahmen der Divisionalisierung der SBB<br />
im Jahre 2000 wurden alle Ae 6/6 dem Geschäftsbereich<br />
SBB Cargo zugeteilt, wodurch<br />
sie ihre letzten Reisezugleistungen abgeben<br />
mussten.<br />
Abschied und plötzliche Rückkehr<br />
Mit dem Planwechsel am 9. Dezember<br />
2012 verloren die bis dahin im Mittelland und<br />
im Jura allgegenwärtigen ehemaligen Gotthardloks<br />
recht plötzlich alle Planleistungen.<br />
Zehn Exemplare wurden Anfang 2013 noch<br />
für Einsätze zu Spitzenzeiten in Reserve vorgehalten.<br />
Aber dann kam im März 2013 die Nachricht,<br />
die einschlug wie eine Bombe: Die SBB<br />
reaktivierten einige Ae 6/6 für Güterverkehrsleistungen<br />
in der Region Zürich, unter<br />
anderem Kieszüge ab Hüntwangen. Bei Redaktionsschluss<br />
waren die Ae 6/6 mit den<br />
Nummern 11419, 11427, 11430 und 11517<br />
im Betriebsdienst. So hat man in diesem Jahr<br />
doch noch die Gelegenheit, die ehemaligen<br />
Gotthardloks vor einem Güterzug zu beobachten.<br />
Vielleicht braucht es dazu etwas<br />
Glück, aber immerhin, die Karriere der Ae 6/6<br />
findet fürs Erste eine Fortsetzung. Wer hätte<br />
das beim Fahrplanwechsel 2012 gedacht?<br />
Dr. Dietmar Beckmann/GM<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
49
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
Elloks mit Buchli-Antrieb prägten lange Zeit den Betrieb bei den SBB. Im Jahr 1981 zählen<br />
Ae 3/6 und Ae 4/7 schon zu den älteren Semestern, sind aber noch unverzichtbar (Bild in<br />
Stein-Säckingen an der Strecke Basel – Brugg)<br />
Martin Weltner<br />
Die Kraftpakete der BLS sind ein beredtes<br />
Beispiel für die Leistungen des <strong>Schweiz</strong>er<br />
Lokomotivbaus. Im BLS-Jubiläumsjahr<br />
1988 schleppen eine Doppellok Ae 8/8<br />
und eine Vorspannlok Re 4/4 einen Güterzug<br />
bei Kumm<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
In der Montagehalle der Maschinenfabrik Oerlikon entstehen in den 20er-Jahren „Krokodile“<br />
für die SBB. Die Gelenk-Elloks für die Gotthard-<strong>Bahn</strong> stellen einen erheblichen Fortschritt dar<br />
und finden weltweite Beachtung<br />
Slg. Marcus Niedt<br />
Die Geschichte der <strong>Schweiz</strong>er Eisenbahnindustrie<br />
Züge made in<br />
Switzerland<br />
Die weltweit anerkannte Perfektion der <strong>Schweiz</strong>er Eisenbahn<br />
beruhte schon immer auf dem Pioniergeist eidgenössischer<br />
Eisenbahnindustrie. Loks wie Wagen aus <strong>Schweiz</strong>er Produktion<br />
waren für den Einsatz auf den Bergstrecken optimiert. Bis<br />
heute setzen sie Maßstäbe in Europa und der ganzen Welt<br />
Begonnen hat das Eisenbahnzeitalter in<br />
der <strong>Schweiz</strong> im Vergleich zu den Nachbarstaaten<br />
und zu Amerika erst sehr<br />
spät, 1847 mit der „Spanisch-Brötli-<strong>Bahn</strong>“.<br />
Zu diesem Zeitpunkt hatte das deutsche Streckennetz<br />
bereits eine Ausdehnung von mehr<br />
als 1.500 Kilometern, eine leistungsfähige Eisenbahnindustrie<br />
versorgte die dortigen <strong>Bahn</strong>gesellschaften<br />
mit Rollmaterial. Im Gegensatz<br />
dazu war in der <strong>Schweiz</strong> Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
die Produktion von Lokomotiven<br />
überhaupt noch nicht angelaufen, so dass man<br />
für den nun beginnenden Aufbau des Schienennetzes<br />
auf den Ankauf aus dem Ausland<br />
angewiesen war. Die Loks trugen ausländische<br />
Fabrikschilder, etwa der Maschinenfabrik Esslingen,<br />
der Sächsischen Maschinenfabrik<br />
Chemnitz (vorm. Rich. Hartmann), von<br />
Krauss & Co in München und von Emil Kessler<br />
aus Esslingen bei Karlsruhe. Von letzterer<br />
stammten auch die vier Dampfloks der „Spanisch-Brötli-<strong>Bahn</strong>“,<br />
die der Eisenbahningenieur<br />
Niklaus Riggenbach von seinem dama-<br />
50
<strong>Schweiz</strong>er Eisenbahnindustrie<br />
ligen Arbeitgeber nach Baden transportieren<br />
ließ.<br />
Erste Ansätze in der <strong>Schweiz</strong><br />
Die <strong>Schweiz</strong>er Industrie begann mit antriebslosem<br />
Rollmaterial. Während die ersten<br />
Wagen in den Hallen der Winterthurer Firma<br />
J.J. Rieter & Cie. gebaut wurden, entstand<br />
am 17. Januar 1853 die erste spezielle<br />
„Waggons-Fabrik“ in Neuhausen am Rheinfall,<br />
die 1863 zur <strong>Schweiz</strong>erischen Industriegesellschaft<br />
(SIG) wurde. Um den Kauf von<br />
Lokomotiven im Ausland zu vermeiden,<br />
gründete die <strong>Schweiz</strong>erische Centralbahn<br />
Anfang 1853 ihre Hauptwerkstätte in Olten.<br />
Als deren Leiter konnte sie Niklaus Riggenbach<br />
aus Deutschland abwerben. Unter seiner<br />
Leitung beschränkte sich die Werkstätte<br />
nicht auf die Reparatur von Lokomotiven,<br />
sondern baute in den nächsten 20 Jahren sogar<br />
selbst 53 eigene Dampfloks, teilweise allerdings<br />
als Lizenznachbau deutscher Konstruktionen.<br />
Eine eigene Konstruktion waren<br />
die ersten sechs Zahnradloks für die Rigibahn,<br />
für die Niklaus Riggenbach das nach<br />
ihm benannte Zahnstangensystem (Patent<br />
vom 12. August 1863) entwickelte. Mit ihnen<br />
wurde am 1. Mai 1871 zwischen Vitznau<br />
und Rigi Staffel die erste europäische Zahnradbahn<br />
in Betrieb genommen. 1873 gründete<br />
Riggenbach seine eigene Fabrik in Aarau,<br />
ging aber bereits nach der neunten<br />
Lokomotive seiner „Internationalen Gesellschaft<br />
für Bergbahnen“ in Konkurs.<br />
Nicht nur die Centralbahn, auch andere<br />
<strong>Bahn</strong>gesellschaften bauten neben Personenund<br />
Güterwagen ihre eigenen Lokomotiven,<br />
beispielsweise die Werkstätte der Nordostbahn<br />
(NOB) in Zürich acht Maschinen und die<br />
Werkstätte der Vereinigten <strong>Schweiz</strong>er <strong>Bahn</strong>en<br />
(VSB) in Rorschach sieben Loks. Darüber hinaus<br />
stellten zu jener Zeit einige Maschinenfabriken<br />
Dampflokomotiven in geringer<br />
Stückzahl her. Escher Wyss in Zürich baute<br />
35 Dampfloks, die Maschinenfabrik Bern<br />
zehn, die Maschinenbaugesellschaft Basel vier<br />
und zwei weitere Firmen jeweils ein Exemplar.<br />
Ein gebürtiger Engländer begründete die SLM und<br />
damit die Tradition großer <strong>Schweiz</strong>er Lokfabriken<br />
Die „Loki“ entsteht<br />
Ein Ende dieses Wildwuchses zeichnete sich<br />
mit der Gründung der <strong>Schweiz</strong>erischen Lokomotiv-<br />
und Maschinenfabrik (SLM) am<br />
21. Oktober 1871 in Winterthur ab. Mitbegründer<br />
der später allgemein als „Loki“ bezeichneten<br />
Firma war der gebürtige Engländer<br />
Charles Brown sen., der seine<br />
Ingenieurkenntnisse in der Maschinenfabrik<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 51
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
Pioniergeist im Dampflokbau: Für die Schmalspurstrecke von St. Gallen nach Gais baute die SLM 1889 drei Lokomotiven der Serie HG 2/3.<br />
Die Einstellung der Adhäsionsantriebsachsen nach dem Kurvenradius wurde durch die entsprechende Stellung des einachsigen Tenders zur<br />
Maschine bewirkt. Diese Verstellung der gekuppelten Achsen bedingte eine Verlängerung bzw. Verkürzung der Kuppelstangen und ermöglichte<br />
auch das Durchfahren enger Radien<br />
Slg. Dr. Daniel Hörnemann<br />
Maudslay Sons & Field in London erworben<br />
und sich 20 Jahre lang bei Sulzer auf den Bau<br />
von Dampfmaschinen spezialisiert hatte. Er<br />
und zwei seiner sechs Söhne waren in den folgenden<br />
Jahrzehnten die entscheidenden Wegbereiter<br />
für den Erfolg der schweizerischen Lokomotivindustrie.<br />
Nach dem anfänglichen Bau von Zahnraddampfloks,<br />
so der siebten Lok für die Rigibahn<br />
als Debüt, und Erfolgen bei Straßenbahnsystemen<br />
entwickelte sich die SLM sehr schnell<br />
zum größten <strong>Schweiz</strong>er Lokomotivhersteller.<br />
Liegen auch die bahnbrechenden Leistungen<br />
in der <strong>Schweiz</strong> auf dem Gebiet der elektrischen<br />
Traktion im 20. Jahrhundert, so<br />
konnte die SLM jedoch schon beim Dampflokbau<br />
beachtliche Leistungen präsentieren.<br />
In der Abteilung für Zahnradloks entstanden<br />
bemerkenswerte Maschinen, wie 1889 die drei<br />
Exemplare umfassende Serie HG 2/3 für die<br />
Appenzeller Straßenbahn.<br />
Auch für das Fernstreckennetz entwickelte<br />
sich die SLM zum Haus- und Hoflieferanten<br />
der großen <strong>Schweiz</strong>er <strong>Bahn</strong>gesellschaften.<br />
Der <strong>Schweiz</strong>er Ingenieur Anatole Mallet erfand<br />
das Prinzip der kurvengängigen Dampflokomotiven<br />
mit zwei Triebwerken, bei dem<br />
das hintere (Hochdruck-) Triebwerk fest im<br />
Rahmen gelagert und das vordere flexibel angelenkt<br />
mit Niederdruckzylindern ausgerüstet<br />
war. Diese weltweit erfolgreiche <strong>Schweiz</strong>er Erfindung<br />
setzte sich im eigenen Land aber nicht<br />
durch.<br />
Einen Teil seiner Erfindung, das Verbundsystem,<br />
griff die SLM aber für den Bau der leistungsfähigen<br />
Hauptbahnloks auf, wobei Dreizylinder-<br />
und Vierzylinder-Verbundtriebwerke<br />
insbesondere in den Loks der berühmten Serien<br />
A 3/5 und B 3/4 verbaut wurden. Auch die<br />
größte bei den SBB eingesetzte Dampflok, die<br />
Serie C 5/6, war eine Verbundlok mit zwei<br />
Hoch- und zwei Niederdruckzylindern. Diese<br />
28 wegen ihrer Masse (128 Tonnen) und ihrer<br />
Leistungsfähigkeit (1.190 kW) als „Elefant“<br />
bezeichneten Maschinen zogen zwischen 1913<br />
Die Verbindung von SLM und jungen Firmen brachte<br />
der <strong>Schweiz</strong> eine Führungsrolle in der Elektrotraktion<br />
und 1920 schwere Güterzüge über die Gotthardbahn<br />
und leisteten auf den Rampen Vorspanndienste<br />
bei mit A 3/5 bespannten<br />
Schnellzügen. Danach waren sie über 40 Jahre<br />
im Flachland tätig, bevor sie 1968 das<br />
Dampflokzeitalter auf den <strong>Schweiz</strong>er Staatsbahngleisen<br />
beendeten.<br />
MFO, BBC, SAAS und Schlieren<br />
Noch während des Ersten Weltkriegs hatte der<br />
Dampflokbau in der <strong>Schweiz</strong> seinen Höhepunkt<br />
erreicht, denn die „schwarze Kohle“ war<br />
rar und teuer zu importieren; die „weiße Kohle“,<br />
der Strom, war insbesondere im Gebirge<br />
günstig mit Wasserkraftwerken zu erzeugen.<br />
Gerade einmal neun Jahre nach der Vorstellung<br />
der ersten mit Gleichstrom betriebenen<br />
Grubenbahn durch Werner von Siemens auf<br />
der Berliner Gewerbeausstellung am 31. Mai<br />
1879 fuhren in der <strong>Schweiz</strong> die ersten <strong>Bahn</strong>en<br />
elektrisch. War das erste Gleichstrom-Tram<br />
von Montreux nach Chillon (1888) noch von<br />
lokaler Bedeutung, erlangte die <strong>Schweiz</strong> ihre<br />
internationale Führungsrolle auf dem Gebiet<br />
der elektrischen Traktion durch die Verbindung<br />
der SLM mit jungen, hoch innovativen<br />
schweizerischen Elektrounternehmen.<br />
Im Jahre 1876 gründete P. E. Huber-Wertmüller<br />
die Maschinenfabrik Oerlikon (MFO).<br />
Dort waren zu Beginn der Mitbegründer der<br />
SLM Charles Brown sen. als Berater und seine<br />
beiden Söhne Charles E.C. und Sidney als<br />
Ingenieure tätig. Während sich der Vater<br />
schnell zurückzog, wurde Charles Brown jun.<br />
Chefelektriker und entwickelte gemeinsam<br />
mit dem Leiter der Montageabteilung, Walter<br />
Boveri, ein Verfahren zur Übertragung von<br />
Gleichstrom über lange Strecken. Das war eine<br />
wichtige Voraussetzung für die Versorgung<br />
elektrischer Eisenbahnen mit Energie.<br />
Im Jahre 1891 machten sich die beiden Ingenieure<br />
selbstständig und gründeten die<br />
Brown, Boveri & Cie (BBC) in Baden, die zu<br />
einem der international führenden Unternehmen<br />
der Elektroindustrie werden sollte.<br />
Ein Spezialgebiet der neuen Firma war die<br />
Erhöhung der Leistungsfähigkeit elektrischer<br />
<strong>Bahn</strong>en. Bereits 1899 stellte BBC die erste elektrische<br />
Lokomotive für Vollbahnen auf die<br />
Schienen. Die D 2/2 der Burgdorf-Thun-<strong>Bahn</strong><br />
(BTB) war mit Drehstrommotoren ausgestattet<br />
und bezog ihre Energie aus einer zweipoligen<br />
Oberleitung, die mit 750 V und 40 Hz gespeist<br />
wurde. Von der BBC stammte auch die<br />
52
<strong>Schweiz</strong>er Lokindustrie<br />
Die C 5/6, der „Elefant“, war die größte Dampflok in der <strong>Schweiz</strong>. In<br />
den 60er-Jahren fuhr sie nurmehr in untergeordneten Diensten. Die abgebildete<br />
C 5/6 2978 zog auch am 30. November 1968 den letzten<br />
Dampfzug der SBB; sie blieb betriebsfähig erhalten Slg. Andreas Knipping<br />
Die 1.000. Lok der SLM im Jahr 1896 war eine elegante dreizylindrige<br />
Verbund-Schnellzuglok für die Jura-Simplonbahn (JS). Mit 147 Exemplaren<br />
war die B 3/4 die größte Dampflokserie der SBB, das letzte<br />
Exemplar kam erst 1945 aufs Abstellgleis Slg. Dr. Daniel Hörnemann<br />
Slg. Toni Burger<br />
elektrische Ausrüstung in<br />
Drehstromtechnik (Dreiphasenwechselstrom)<br />
für bedeutende<br />
Bergbahnen jener Zeit,<br />
wie die Gornergrat- und die<br />
Jungfraubahn (1898) sowie<br />
die Stansstad–Engelberg-<br />
<strong>Bahn</strong> (1899).<br />
Inzwischen war es dem<br />
technischen Direktor der<br />
MFO, Hans Behn-Eschenburg,<br />
gelungen, einen Einphasen-Motor<br />
zu entwickeln,<br />
der direkt mit<br />
Wechselstrom betrieben<br />
werden konnte. Die MFO rüstete in den Jahren<br />
1905 und 1906 ihre Versuchslokomotiven „Eva“<br />
und „Marianne“ damit aus und elektrifizierte<br />
1907 die an ihre Werkstätten angrenzende Strecke<br />
von Seebach nach Wettingen mit Einphasen-<br />
Wechselstrom. Dort konnte sie unter kritischer<br />
Beobachtung der internationalen Fachwelt beweisen,<br />
dass ein elektrischer Zugbetrieb auch mit<br />
einer wesentlich einfacheren einphasigen Oberleitung<br />
möglich ist.<br />
Während die MFO nun den Wechselstrom<br />
favorisierte, hielt die BBC weiterhin am Drehstrom<br />
fest und elektrifizierte bis 1906 auf eigene<br />
Kosten die Strecke von Brig nach Iselle<br />
durch den 20 km langen Simplontunnel mit<br />
der zweiphasigen Oberleitung (3,3 kV,<br />
16 2/3 Hz). Zum Einsatz kamen dort allerdings<br />
keine Lokomotiven von BBC, sondern<br />
bei den SBB als Fb 3/5 bezeichnete Stangenloks<br />
des ungarischen Herstellers Ganz&Cie.<br />
Während die SBB nicht unter Zeitdruck<br />
standen, musste die Bern-Lötschberg-Simplon-<strong>Bahn</strong><br />
(BLS) recht kurzfristig ein Stromsystem<br />
für die Lötschbergstrecke auswählen,<br />
die 1913 in Betrieb gehen sollte. Die aus heutiger<br />
Sicht vollkommen richtige Entscheidung<br />
fiel zugunsten der einpoligen Oberleitung aus,<br />
und die MFO erhielt 1911 gemeinsam mit der<br />
SLM den Auftrag zum Bau einer 13 Lokomotiven<br />
umfassenden Serie Fb 5/7 (später<br />
Be 5/7), die mit ihrer Leistung von 1.838 kW<br />
als die damals stärksten Loks der Welt galten.<br />
Aus terminlichen Gründen wurde auch die<br />
BBC mit der Lieferung elektrischer Komponenten<br />
in die Fertigung mit einbezogen. Im<br />
Betrieb bewährten sich die Lokomotiven be-<br />
Die ersten beiden elektrischen Vollbahnlokomotiven der Welt lieferte BBC im Jahre 1899 als<br />
D 2/2 an die Burgdorf-Thun-<strong>Bahn</strong>. Die Loks leisteten 200 kW; man konnte sie nur in zwei im<br />
Stand einzustellenden Geschwindigkeitsstufen (17,5 und 35 km/h) betreiben Slg. Marcus Niedt<br />
reits im ersten Betriebsjahr so gut, dass sich die<br />
SBB, forciert durch die Kohleknappheit im<br />
Ersten Weltkrieg, für die Elektrifizierung der<br />
Gotthardbahn entschieden, wobei auch das<br />
Wechselstromsystem verwendet werden sollte.<br />
Die BBC schwenkte nun ebenfalls um, so<br />
dass die Drehstromepoche auf den <strong>Schweiz</strong>er<br />
Gleisen mit der Elektrifizierung der letzten<br />
Strecke von Brig nach Sion 1919 ihr Ende<br />
fand. Fast alle Strecken mit zweipoliger Oberleitung<br />
wurden in den 30er-Jahren umelektrifiziert,<br />
die Jungfrau- und die Gornergratbahn<br />
sind aber noch heute Zeugen der<br />
Drehstromepoche in der <strong>Schweiz</strong>.<br />
Für die nächsten Jahrzehnte bestimmten<br />
vier große <strong>Schweiz</strong>er Unternehmen den Bau<br />
der einheimischen Lokomotiven. Die SLM<br />
war stets alleine für den mechanischen Teil verantwortlich,<br />
während die MFO, die BBC und<br />
die ab 1924 eigenständige ehemalige BBC-<br />
Tochter Société Anonyme des Ateliers de Sécheron<br />
(SAAS) aus Genf den elektrischen Teil<br />
übernahmen. Dabei standen die drei Hersteller<br />
der elektrischen Komponenten nicht unbedingt<br />
miteinander in einem direkten Wettbewerb,<br />
sondern teilten den großen Kuchen<br />
oftmals unter sich auf. Auf dem Wagensektor<br />
wurde 1899 die <strong>Schweiz</strong>erische Waggonfabrik<br />
Schlieren gegründet. Ab 1903 erteilten die<br />
SBB große Aufträge zum Bau einheitlicher Personenwagen<br />
an die „Wagi“, wie sie im Volksmund<br />
in Anlehnung an die „Loki“ (SLM) genannt<br />
wurde. 1906 konnte der 1000., 1909<br />
der 2000. Wagen geliefert werden.<br />
Pionierleistungen im Ellok-Bau<br />
Die größte Herausforderung an die Lokomotivindustrie<br />
war der Bau der Lokomotiven für<br />
die Gotthardbahn in einer Leistungsklasse, die<br />
es auf der Welt bis dahin noch nicht gegeben<br />
hatte. Pünktlich zum Abschluss der Elektrifizierungsarbeiten<br />
im Jahre 1920 standen die<br />
ersten Loks der neuen Serien betriebsbereit auf<br />
den Schienen. Für den schnellen Personenverkehr<br />
baute die SLM gemeinsam mit der<br />
BBC 40 Exemplare der Serie Be 4/6, während<br />
die insgesamt 51 weltberühmten Krokodile<br />
(Serien Ce 6/8 II und Ce 6/8 III ) für Güterzüge<br />
von SLM und MFO hergestellt wurden.<br />
Noch während diese großen Elloks mit Stangenantrieb<br />
in den Fertigungshallen standen, hatte<br />
der <strong>Schweiz</strong>er Jakob Buchli als Oberingenieur<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
53
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
Nur die beiden ersten Elloks Re 6/6 hatten noch einen geteilten Lokkasten<br />
mit Gelenk, um die vertikale Flexibilität der drei zweiachsigen<br />
Drehgestelle zu gewährleisten (Foto). Bei den Serienloks konnte die<br />
SLM darauf verzichten<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
Erst spät griff die <strong>Schweiz</strong>er Industrie die Entwicklung moderner<br />
Drehstromloks auf. Die 119 Loks der SBB-Serie 460 tragen heute die<br />
Hauptlast des Fernverkehrs in der <strong>Schweiz</strong> (Bild auf der Bietschtal-<br />
Brücke auf der Lötschberg-Südrampe)<br />
Christian Wenger<br />
Die 240 Tonnen schwere und 31 Meter lange Doppellok Ae 8/14 11801 (Baujahr 1931) besaß<br />
den Buchliantrieb. Dabei waren die einseitig angesetzte Kraftübertragung auf der führenden<br />
Lokhälfte rechts, auf der hinteren links angeordnet<br />
Slg. Peter Schricker<br />
bei der BBC einen vollkommen neuartigen,<br />
nach ihm benannten Antrieb erfunden. Erstmals<br />
wurden die Treibachsen der Lokomotive einzeln<br />
von einem eigenen Motor angetrieben, der im<br />
gefederten Lokkasten befestigt war. Damit waren<br />
Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h<br />
problemlos realisierbar. Die 241 Lokomotiven<br />
der SBB-Serien Ae 3/6 und Ae 4/7 erhielten diesen<br />
Antrieb. Die nach diesem <strong>Schweiz</strong>er Patent<br />
gebauten Lokomotiven fuhren darüber hinaus<br />
in großen Stückzahlen im europäischen Ausland<br />
(etwa Deutschland, Frankreich, Italien) und<br />
auch in Übersee, zum Beispiel Japan und Amerika.<br />
Die überaus robusten Lokomotiven wurden<br />
sehr alt; die Serie Ae 4/7 stand 70 Jahre lang<br />
– bis 1996 – im Dienst der SBB.<br />
Im Jahre 1924 hatte die BBC ihre Aktienmehrheit<br />
bei der SAAS aufgegeben. Das nun<br />
selbstständige Unternehmen konstruierte als<br />
dritter „Elektriker“ im <strong>Schweiz</strong>er Lokomotivbau<br />
fast zeitgleich mit der MFO einen eigenen<br />
Einzelachsantrieb als Weiterentwicklung des<br />
Westinghouse-Federantriebes. Der als Sécheron-Federantrieb<br />
bezeichnete neuartige Hohlwellenantrieb<br />
ermöglichte kleinere Antriebsräder<br />
und wurde erstmals in der Serie Be 6/8<br />
(später Ae 6/8) verbaut, die ab 1926 von einem<br />
Konsortium aus der SAAS und der italienischen<br />
Firma Breda an die BLS geliefert<br />
wurde. Die SLM war zunächst nicht beteiligt,<br />
was für das gesamte 20. Jahrhundert eine der<br />
wenigen Ausnahmen darstellt. Ab der fünften<br />
Maschine (zweite Serie) war wieder die „Loki“<br />
für den mechanischen Teil der mit ihren sechs<br />
Doppelmotoren seinerzeit stärksten Lokomotive<br />
der Welt zuständig.<br />
Die nächste bahnbrechende Erfindung auf<br />
dem Gebiet der Antriebstechnik kam wieder<br />
aus der <strong>Schweiz</strong> mit der ersten laufachslosen<br />
Hochleistungsdrehgestelllok mit Einzelachsantrieb,<br />
dieses Mal mit dem von BBC entwickelten<br />
Federantrieb. Mit der Ae 4/4 der BLS<br />
(und der Doppellokvariante Ae 8/8) begann<br />
die bis heute andauernde Epoche der Achsfolge<br />
Bo’Bo’; auch die SBB entschieden sich für<br />
diese Bauart, allerdings zunächst für eine mit<br />
57 Tonnen leichtere und schnellere Variante.<br />
Die Re 4/4 (später Re 4/4 I ) lösten Ende der<br />
40er-Jahre die Ae 3/6 vor den Städteschnellzügen<br />
ab, die mit den neuen, von der „Wagi“<br />
hergestellten Leichtstahlwagen insbesondere<br />
zwischen Zürich und Genf verkehrten.<br />
Die 50er- bis 80er-Jahre<br />
In den nächsten zwei Jahrzehnten beherrschten<br />
die vier Firmen SLM, MFO, BBC und zum<br />
kleineren Teil auch SAAS den <strong>Schweiz</strong>er Lokomotivbau<br />
und produzierten immer leistungsfähigere<br />
Drehgestelllokomotiven mit je einem<br />
Wechselstrommotor pro Achse. Eine<br />
Ausnahme bildeten die zwischen 1964 und<br />
1983 gebauten Re 4/4 der BLS, die mit einem<br />
Gleichrichter und Gleichstrommotoren ausgerüstet<br />
wurden. In Verbindung mit einer ausgeklügelten<br />
Tiefzugeinrichtung konnten die braunen<br />
Kraftpakete ihre Leistung von 5 MW<br />
ungewöhnlich gut auf die Schiene bringen und<br />
gewannen noch Ende der 90er-Jahre „Wettkämpfe“<br />
mit wesentlich moderneren Loks (beispielsweise<br />
der 152 der DB AG) bei Anfahrversuchen<br />
auf der Lötschberg-Nordrampe.<br />
Trotz der hohen Anforderungen auf den<br />
Bergstrecken wurden in der <strong>Schweiz</strong> nur zwei<br />
große Serien in sechsachsiger Ausführung realisiert:<br />
die Ae 6/6 (s. S. 46-49) und die Re 6/6.<br />
Letztere zeichnete sich durch eine Stundenleistung<br />
von 7,8 MW und durch die Anordnung<br />
von drei zweiachsigen Drehgestellen unter einem<br />
bei den Serienloks einteiligen Lokkasten<br />
aus. Mit ihrer entsprechend guten Kurvengängigkeit<br />
entwickelte sie sich ab Mitte der 70er-<br />
Jahre zur Standardlok am Gotthard. Das vierachsige<br />
Pendant fürs Flachland, die Re 4/4 II ,<br />
wurde von 1967 bis 1985 in Serie gebaut und<br />
erreichte eine Stückzahl von 276 Exemplaren.<br />
Als potenzielles Nachfolgemodell der Einheitsloks<br />
lieferten SLM und BBC im Jahre 1982 vier<br />
als Re 4/4 IV bezeichnete Prototypen mit von<br />
Gleichrichtern gespeisten Wellenstrommotoren.<br />
Da zu diesem Zeitpunkt im Ausland bereits die<br />
ersten Drehstrom-Loks erfolgreich im Einsatz<br />
waren, galten sie aber schon bei Indienststellung<br />
als veraltet, so dass ein Weiterbau unterblieb.<br />
Umstrukturierung und Niedergang<br />
Zu dieser Zeit hatte die <strong>Schweiz</strong>er Eisenbahnindustrie<br />
bereits die ersten tiefgreifenden Umstrukturierungen<br />
hinter sich. 1961 fusionierte<br />
die SLM mit der Sulzer AG, die die beiden Dieselloks<br />
Am 4/4 und die 14 Dieselloks Bm 6/6<br />
für die SBB mit Schiffsdieselmotoren ausgestattet<br />
hatte. 1967 übernahm die BBC die<br />
MFO, die ursprüngliche Arbeitgeberin der beiden<br />
Firmengründer. 1970 erwarb BBC zudem<br />
die Aktienmehrheit bei der SAAS zurück, die allerdings<br />
erst ab 1982 als BBC-Sécheron AG firmierte.<br />
Mit diesen Fusionen baute die BBC ihre<br />
54
<strong>Schweiz</strong>er Lokindustrie<br />
Der TEE-Triebzug RAe (auch TEE II genannt) wurde 1961 bzw. 1967 von SIG und MFO gebaut. Er konnte mit vier verschiedenen Stromsystemen<br />
fahren und machte damit weit über die <strong>Schweiz</strong>er Grenzen hinaus Furore<br />
Slg. Peter Schricker<br />
Position im Ellok-Bau weiter aus und wurde neben<br />
der Siemens AG zum Marktführer für die<br />
elektrischen Komponenten in Europa; der wirtschaftliche<br />
Erfolg blieb aber aus. Anfang 1988<br />
fusionierte sie mit der schwedischen Allmänna<br />
Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) zur<br />
Asea Brown Boveri AG (ABB). Aus dem BBC-<br />
Stammhaus in Baden wurde ABB <strong>Schweiz</strong>.<br />
Auch auf dem Waggonbausektor entstand<br />
Anfang der 80er-Jahre Unruhe. Waren bis dahin<br />
die vier Firmen SIG Neuhausen, SWS<br />
Schlieren, SWP Pratteln und FFA Altenrhein<br />
gemeinsam an der Herstellung der weit über<br />
2.000 Einheitswagen (EW) für Normal- und<br />
Schmalspurbahnen beteiligt, teilten sie sich<br />
1981 in einem „Stillhalteabkommen“ den<br />
Markt auf. Die danach auf die Komponentenfertigung<br />
sowie auf Umbauten und Revisionen<br />
spezialisierte SWS musste bereits 1985 ihre traditionsreiche<br />
„Wagi“ in Schlieren unter großem<br />
Protest der Arbeitnehmerschaft und der<br />
Bevölkerung schließen. Die FFA Altenrhein<br />
wurde 1987 von der SWP aufgekauft. Beide<br />
Werke firmierten ab 1993 als Schindler Waggon<br />
AG (SWG), bis sie 1996 der ABB Daimler<br />
Benz Transportation (ADtranz) einverleibt<br />
wurden. 1997 trennten sich die Wege schon<br />
wieder. Das Werk Altenrhein wurde von Stadler<br />
Rail gekauft. Der Waggonbau in Pratteln<br />
kam 2001 zu Bombardier, die das Werk 2005<br />
mangels Aufträgen schließen musste.<br />
Am erfolgreichsten entwickelte sich die SIG,<br />
die 1961 gemeinsam mit der MFO den elektrischen<br />
TEE-Triebwagen RAe gebaut und für<br />
den Einheitswagen EW III eine Wagenkasten-<br />
steuerung entworfen hatte. Nach der Umstrukturierung<br />
1981 spezialisierte sie sich auf<br />
den Bau von Drehgestellen. Als Konkurrent zu<br />
FIAT in Italien entwickelte sie in den 90er-Jahren<br />
sogar eine eigene Neigetechnik mit elektrischem<br />
Antrieb, die ab 1999 in den neuen ICN-<br />
Triebzügen (SBB-RABDe 500) eingebaut<br />
wurde. Zuvor (1995) hatte FIAT Ferroviaria die<br />
Schienenverkehrssparte der SIG aufgekauft und<br />
kam selber im Jahre 2000 zu Alstom.<br />
Im Ausland hatten sich Drehstrom-Asynchronmotoren<br />
im Lokomotivbau längst<br />
durchgesetzt, als die <strong>Schweiz</strong>er Lokomotivindustrie<br />
mit der Produktion neuer Drehstromloks<br />
begann. Zwischen 1989 und 1997 entstanden<br />
115 Loks der Serie Re 450 für die<br />
S-<strong>Bahn</strong>-Zürich, 119 Maschinen der Serie<br />
Re 460 für den schweren Reise- und Güterverkehr<br />
der SBB sowie 18 Re 465 für die BLS.<br />
Erstmals verzichtete man auf die Herstellung<br />
von Vorserienloks; Erprobung und Optimierung<br />
neuer Komponenten an den Serienloks<br />
geschahen direkt im Betrieb.<br />
Tief für die SLM, Hoch für Stadler<br />
Nach dieser Verjüngungskur war der einheimische<br />
Markt weitgehend gesättigt. Immerhin<br />
begann der Exporterfolg der Re 460 mit der<br />
Lieferung von 46 breitspurigen Exemplaren an<br />
Trotz Exporterfolgen wurde die SLM zerschlagen;<br />
derweil entwickelte sich Stadler zum Global Player<br />
die Finnischen Staatsbahnen (Serie Sr2),<br />
22 Loks nach Norwegen (Serie El 18) und zwei<br />
Maschinen nach Hongkong; trotzdem entschieden<br />
sich die Manager der SLM für die<br />
Entlassung des größten Teils der Belegschaft<br />
und für eine Zerschlagung des Unternehmens.<br />
Einige Produktbereiche gingen unter dem temporären<br />
Firmennamen Sulzer-Winpro an Stadler<br />
Rail, ADtranz/Bombardier und an die Prose<br />
AG, andere Produktbereiche wurden<br />
vollständig eingestellt. Im Jahre 2001 spaltete<br />
sich die Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik<br />
DLM ab, die sich seitdem mit der Konstruktion<br />
und Herstellung moderner Dampflokomotiven<br />
sowie mit deren Reparatur und<br />
Wartung beschäftigt. Neue Dampflokomotiven<br />
aus Winterthur sind beispielsweise auf der<br />
Brienz-Rothorn-<strong>Bahn</strong> im Einsatz.<br />
Nach einem Management-Buy-out der<br />
Reste der SLM im Jahre 2001 wurde die Winpro<br />
AG gegründet, die 2005 komplett von<br />
Stadler Rail übernommen wurde. Die traditionsreiche<br />
„Loki“, die zwischen 1873 und<br />
1997 insgesamt 5.744 Fahrzeuge gebaut hatte,<br />
existierte nicht mehr.<br />
Etwa gleichzeitig mit dem Niedergang der<br />
SLM entwickelte sich eine kleine Firma aus<br />
Bussnang zu einem Global Player auf dem Schienenverkehrssektor.<br />
Die auf einer Unterneh-<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
55
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
Während von den traditionellen <strong>Schweiz</strong>er Fahrzeugherstellern allenfalls noch Reste übrig sind, hat sich Stadler auf dem Markt zu einem bedeutenden<br />
Produzenten aufgeschwungen. Im Werk in Bussnang entstehen im Februar 2012 „FINK“-Triebzüge für die Zentralbahn Armin Schmutz<br />
Die jüngste Lok von<br />
SBB Cargo aus<br />
<strong>Schweiz</strong>er Produktion<br />
ist die Eem 923<br />
von Stadler. Der<br />
1.500 kW starke<br />
Zweiachser kann mit<br />
Dieselmotor fahrdrahtlose<br />
Anschlüsse<br />
bedienen, aber<br />
auch Güterzüge elektrisch<br />
mit 120 km/h<br />
über die Hauptstrecken<br />
befördern<br />
Stadler Rail AG<br />
mensgründung von 1942 basierende Stadler<br />
Fahrzeuge AG begann 1974 in Bussnang mit der<br />
Einzelanfertigung von kleinen Loks und Wagen<br />
in geringem Umfang. Nach dem Tod des Firmengründers<br />
Ernst Stadler 1981 führte seine<br />
Witwe Irma das Unternehmen weiter und übertrug<br />
1989 die Geschäfte einem guten Bekannten,<br />
dem Eishockey-Profi Peter Spuhler. Zu jener<br />
Zeit hatte das Unternehmen gerade einmal<br />
18 Mitarbeiter – heute sind es weltweit ca. 5.000,<br />
davon allein in der <strong>Schweiz</strong> etwa 1.700.<br />
Der Erfolg der seit 1997 als Stadler Rail AG<br />
agierenden Holding begann mit der innovativen<br />
Entwicklung des leichten Gelenktriebwagens<br />
GTW, dessen Komponenten modular je<br />
nach Kundenanforderungen zusammengestellt<br />
werden können. Die Minimalversion des wahlweise<br />
normal- oder schmalspurigen Triebwagens<br />
besteht aus einem mittigen zweiachsigen<br />
Antriebsmodul (mit Stromabnehmer oder<br />
Dieselmotor) und zwei einseitig aufgelegten<br />
Hybrid-Loks und Nahverkehrstriebwagen führen die<br />
innovative Tradition <strong>Schweiz</strong>er Lokomotivbaus fort<br />
leichten Endmodulen mit je einem Drehgestell<br />
unter den Führerständen. Eine Erweiterung<br />
mit Mittelteilen und weiteren Antriebsmodulen<br />
ist möglich. Seit 1997 hat Stadler fast<br />
600 GTW-Triebwagen an zahlreiche <strong>Bahn</strong>gesellschaften<br />
in der <strong>Schweiz</strong>, ins europäische<br />
Ausland und sogar in die USA verkauft.<br />
Ein weiteres Erfolgsmodell von Stadler ist der<br />
als FLIRT (flinker leichter innovativer Regional-<br />
Triebzug) bezeichnete Triebwagen, der in der<br />
<strong>Schweiz</strong> je nach Zusatzausrüstung fürs Nachbarland<br />
als RABe 521, 522, 523 oder 524 verkehrt.<br />
Durch den Export in zehn Länder gibt es<br />
inzwischen mehr als 800 Exemplare. Die in<br />
Bussnang und Pankow (Berlin) gefertigten Fahrzeuge<br />
zeichnen sich gegenüber Konkurrenzfahrzeugen<br />
durch einen ungewöhnlich guten<br />
Laufkomfort aus. Am 30. Juni 2008 erhielt die<br />
Stadler Rail AG von den SBB den Auftrag zum<br />
Bau von 50 Doppelstocktriebzügen für die vierte<br />
Teilergänzung der S-<strong>Bahn</strong>-Zürich und für<br />
mehrere RegioExpress-Linien. Auch diese als<br />
KISS (komfortabler innovativer spurtstarker<br />
S-<strong>Bahn</strong>-Zug) bezeichneten Fahrzeuge verbuchen<br />
Exporterfolge. In Zürich und bei der BLS sind<br />
die ersten Triebzüge bereits im Einsatz.<br />
Auch auf dem Lokomotivbausektor verfolgt<br />
Stadler ganz neue Konzepte. Am 12. Februar<br />
2012 wurde die erste von zunächst 30 Hybrid-<br />
Loks der Serie Eem 923 an SBB-Cargo übergeben.<br />
Die kleine Lok hat einen Dieselantrieb für<br />
die Bedienung fahrdrahtloser Anschlussgleise und<br />
einen 1,5 MW starken elektrischen Antrieb. Die<br />
Besonderheit ist ihre für zweiachsige Lokomotiven<br />
ungewöhnliche Höchstgeschwindigkeit von<br />
120 km/h, die durch die passive Einstellung der<br />
Achsen und durch das neu entwickelte Tilgermassensystem<br />
erreicht wird. So kann sie vor Güterzügen<br />
des Wagenladungsverkehrs auf der Strecke<br />
fahren und auch Anschlussgleise bedienen.<br />
Ob das System zukunftsfähig ist, wird sich zeigen.<br />
Aber diese kleine Lok führt die Tradition der innovativen<br />
Lokomotivindustrie der <strong>Schweiz</strong> fort<br />
und rechtfertigt noch immer den Slogan: Wer<br />
hat’s erfunden? Die <strong>Schweiz</strong>er!<br />
Dietmar und Silvia Beckmann<br />
56
Eisenbahnland <strong>Schweiz</strong>.<br />
Der Bildatlas zu aktuellen und<br />
historischen Loks und Triebwagen<br />
der <strong>Schweiz</strong>erischen<br />
Bundesbahnen – umfassend,<br />
handlich und reich bebildert.<br />
144 Seiten · ca. 180 Abb.<br />
22,3 x 26,5 cm<br />
€ [A] 20,60<br />
sFr. 27,90 € 19,95<br />
ISBN 978-3-86245-103-6<br />
Mit dem langsamsten Schnellzug der Welt durch die <strong>Schweiz</strong>er Alpen zwischen<br />
Zermatt und St. Moritz. Brillante Aufnahmen von Zügen, Stationen<br />
und Panoramen und informative Texte erzählen von Geschichte und Gegenwart<br />
des Glacier Express. Lassen Sie sich begeistern von Viadukten und<br />
Tunnels, von Schluchten und Hochebenen, von spektakulären Streckenabschnitten<br />
und technischen Meisterleistungen. Ein Fest für alle Fans des<br />
<strong>Bahn</strong>wunderlandes <strong>Schweiz</strong>.<br />
144 Seiten · ca. 200 Abb.<br />
22,3 x 26,5 cm<br />
€ [A] 15,40<br />
sFr. 21,90 € 14,95<br />
ISBN 978-3-86245-154-8<br />
Die spannende Geschichte<br />
des Eisenbahnlandes <strong>Schweiz</strong>:<br />
Fundiert recherchiert, herausragend<br />
bebildert und mit<br />
umfassenden Infos zu SBB<br />
und Privatbahnen.<br />
168 Seiten · ca. 140 Abb.<br />
22,3 x 26,5 cm<br />
€ [A] 30,80<br />
sFr. 39,90 € 29,95<br />
ISBN 978-3-86245-139-5<br />
Die <strong>Schweiz</strong> mit dem Zug<br />
entdecken – dieser reich<br />
bebilderte Band zeigt die<br />
50 schönsten Strecken zwischen<br />
Bodensee, Genfer<br />
See und Lago Maggiore.<br />
120 Seiten · ca. 180 Abb.<br />
22,3 x 26,5 cm<br />
€ [A] 20,60<br />
sFr. 27,90 € 19,95<br />
ISBN 978-3-7654-7299-2<br />
Der erfolgreiche, handliche<br />
Reiseführer für Europas<br />
<strong>Bahn</strong>land Nr. 1 in topaktueller<br />
Neuauflage! Mit den<br />
99 schönsten Ausflugszielen<br />
für Eisenbahnfans.<br />
192 Seiten · ca. 190 Abb.<br />
12,0 x 18,5 cm<br />
€ [A] 15,40<br />
sFr. 21,90 € 14,95<br />
ISBN 978-3-86245-124-1<br />
<strong>Faszination</strong> Technik<br />
www.geramond.de<br />
oder gleich bestellen unter<br />
Tel. 0180-532 16 17 (0,14 €/Min.)
DIE WELT DER EISEN<strong>BAHN</strong> AUF DVD<br />
§ 14<br />
JUSchG<br />
Ihre DVD <strong>Schweiz</strong>er Eisenbahnen!<br />
Lust auf weitere Eisenbahn-Filme?<br />
DVD-Gesamtprogramm unter www.geramond.de<br />
p g g gemäß<br />
INFO-<br />
Programm<br />
gemäß<br />
Deutsch<br />
S/W / Farbe,<br />
mono<br />
Menüführung<br />
ca. 120 Min.<br />
Mit historischen<br />
Aufnahmen<br />
Sprache(n)<br />
Bild und Ton<br />
Menü/Kapitel<br />
Spielzeit<br />
Extras<br />
Produktion: van den Burg Video, Coverfoto: F. Martinoff Best.-Nr. 511303<br />
!<br />
Die schönsten und begehrtesten Filme aus der <strong>Bahn</strong>Extra-Videothek jetzt<br />
auch als DVD! Als Einzel-DVD oder in thematisch geschnürten Paketen bieten<br />
die digital neu gemasterten DVD höchstes Seh- und Hörvergnügen. Komfortable<br />
Menüführung und sachkundige Kommentare machen den Umstieg von<br />
der klassischen VHS-Kassette zum DVD-Silberling zu einem großartigen Film-<br />
Vergnügen.<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> VIDEO SPECIAL:<br />
Mit den schönsten Eisenbahnen<br />
unterwegs in der <strong>Schweiz</strong><br />
<strong>Faszination</strong> <strong>Schweiz</strong>er <strong>Bahn</strong>en: Zwei Filme auf einer DVD verdeutlichen,<br />
warum das Alpenland als Eisenbahnparadies gilt. »<strong>Bahn</strong>land <strong>Schweiz</strong>« zeigt<br />
die Entwicklung der <strong>Schweiz</strong>er <strong>Bahn</strong>en von ihren Ursprüngen bis hin zum<br />
modernen Verkehrsträger. Zahlreiche historische Aufnahmen, unter anderem<br />
von den SBB und von der Rhätischen <strong>Bahn</strong>, machen den Film besonders<br />
wertvoll. »<strong>Schweiz</strong>er Gebirgsbahnen« stellt unter anderem die weltberühmte<br />
Gotthardbahn, die spektakuläre Centovallibahn, die dampfbetriebene<br />
Brienz-Rothorn-<strong>Bahn</strong> und die Gornergratbahn vor; eine Reise auf diesen<br />
<strong>Bahn</strong>en ist immer ein Erlebnis!<br />
Mit den schönsten Eisenbahnen<br />
unterwegs in der <strong>Schweiz</strong><br />
SPECIAL<br />
Und so erhalten<br />
Sie das perfekte<br />
Cover dazu:<br />
1<br />
Schneiden Sie das<br />
Cover auf dieser Seite<br />
aus und passen Sie<br />
es dem Format einer<br />
handelsüblichen<br />
DVD-Box an<br />
2<br />
Schieben Sie<br />
das Cover in die<br />
DVD-Box ein ...<br />
DIE WELT DER EISEN<strong>BAHN</strong><br />
AUF DVD<br />
auf einer DVD<br />
Mit den schönsten Eisenbahnen<br />
unterwegs in der <strong>Schweiz</strong><br />
Profi-Filme<br />
aus der Welt der <strong>Bahn</strong><br />
SPECIAL<br />
3<br />
... und fertig ist<br />
Ihre optisch ansprechende<br />
<strong>BAHN</strong><br />
<strong>EXTRA</strong>-DVD!<br />
Zwei Filme
Die beiden klassischen Triebfahrzeuge der Seetalbahn begegnen sich im August 1981 in Birrwil. Ein „Seetal-Krokodil“, De 6/6 15302, wartet<br />
vorn mit Güterzug 67251 Beinwil – Lenzburg die Kreuzung mit Zug 2252 Wildegg – Beinwil ab, der von einem Gepäcktriebwagen De 4/4 bespannt<br />
wird. Kleines Bild Mitte: unmissverständliche Kollisionswarnung an einer Straße in Seon<br />
Dr. Dietmar Beckmann, Daniel Amman (u.)<br />
Die Seetalbahn<br />
„Straßenarbeiter“<br />
Nördlich von Luzern verläuft die Seetalbahn von Emmenbrücke nach Lenzburg.<br />
Wo heute die S9 des S-<strong>Bahn</strong>-Netzes Zentralschweiz unterwegs ist, fuhren lange<br />
Zeit lokbespannte Züge der SBB. Und zwar meist neben oder auf der Straße<br />
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hofften<br />
die Gemeinden des Seetals, dass die<br />
Schienenverbindung von Basel nach Luzern<br />
und zum Gotthard auf der Route entlang<br />
des Baldegger und des Hallwiler Sees gebaut würde.<br />
Nachdem sich die Centralbahn aber für den<br />
weniger steigungsreichen Weg über Zofingen<br />
Die Seetalbahn überwindet nur 114 Höhenmeter,<br />
hat aber durch die Straßenlage viele Steigungen<br />
entschieden hatte, mussten sich die Gemeinden<br />
im Seetal mit einer lokalen Eisenbahn begnügen.<br />
Finanziert von der in London gegründeten<br />
Lake Valley of Switzerland Railway Company,<br />
konnte im Jahre 1883 die normalspurige Strecke<br />
von Emmenbrücke bei Luzern über Beinwil<br />
nach Lenzburg mit einer besonders einfachen<br />
und kostengünstigen Trassierung eröffnet werden.<br />
Die Gleise wurden fast auf der gesamten<br />
Strecke ähnlich einer Straßenbahn innerhalb des<br />
Straßenraums oder unmittelbar daneben verlegt,<br />
wodurch sich mitunter sehr enge Radien<br />
und gewaltige Steigungen ergaben. Obwohl die<br />
Differenz zwischen dem höchsten und dem<br />
niedrigsten Punkt der 43 Kilometer langen Strecke<br />
gerade einmal 114 Höhenmeter beträgt,<br />
weist die Strecke zahlreiche meist kurze Steilstrecken<br />
mit bis zu 36 Promille Längsneigung<br />
auf. Denn die Trasse verzichtet vollkommen auf<br />
größere Kunstbauten und folgt der Topographie<br />
des Geländes. Auch die am 23. Januar 1887 eröffnete<br />
ergänzende Stichstrecke von Beinwil<br />
nach Reinach (ab 1. Oktober 1906 verlängert<br />
bis Beromünster) entsprach diesem Konzept.<br />
Betrieb bei SThB und SBB<br />
1894 übernahm die neu gegründete <strong>Schweiz</strong>erische<br />
Seethalbahn-Gesellschaft (SThB) die<br />
Strecke, konnte sich aber mit ihrer rein lokalen<br />
Bedeutung nicht abfinden. Bereits am<br />
1. Oktober 1895 eröffnete sie im Norden die<br />
vier Kilometer lange Verbindung von Lenzburg<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 59
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
Anfang der 90er-Jahre setzten die SBB planmäßig Pendelzüge mit Elloks Re 4/4 I im Seetal ein. Vorzugsweise verwendeten sie rote Maschinen,<br />
die für die Autofahrer „nebenan“ auffälliger waren (Bild mit Zug 6028 bei Birrwil, Juli 1991)<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
sogar Schnellzüge (Wildegg – Luzern) auf die<br />
Strecke. Die bedeutendste Innovation war aber<br />
die Elektrifizierung der Strecke im Jahre 1910,<br />
und zwar nicht mit dem damals für Nebenbahnen<br />
üblichen Gleichstrom oder dem von<br />
der Firma BBC favorisierten Drehstrom mit<br />
zweiphasiger Oberleitung, sondern bereits mit<br />
dem noch kaum erprobten, aber zukunftsweisenden<br />
Einphasenwechselstrom (5.500 V,<br />
25 Hz). Neben Holzmasten wurden moderne<br />
Stahlmasten aufgestellt, die teils über 100 Jahre<br />
(bis 2011 in Boniswil) in Betrieb blieben.<br />
Zahlreiche kleine Industriebetriebe siedelten<br />
sich entlang der Strecke an, so dass die <strong>Bahn</strong> mit<br />
ihren geringen Betriebskosten zur rentabelsten Eisenbahn<br />
der <strong>Schweiz</strong> aufstieg. Infolge der Kohleknappheit<br />
im Ersten Weltkrieg fuhren sogar<br />
Durchgangsgüterzüge durchs Seetal. Das ungewöhnliche<br />
Konzept war zumindest in wirtschaftlicher<br />
Hinsicht voll aufgegangen, hatte allerdings<br />
aber auch zur Folge, dass die <strong>Schweiz</strong>erischen<br />
Bundesbahnen (SBB) von ihrem Rückkaufrecht<br />
Gebrauch machten und die Strecke zum 1. Januar<br />
1922 ihrem Netz einverleibten.<br />
Die Elektrifizierung der Seetalbahn geschah 1910 mit abenteuerlich aufgerüsteten Personenund<br />
Güterwagen. Den Bauzug bespannte die Dampflok E 3/3 51, die von der BBC als Wiedergutmachung<br />
für Planungsverzögerungen ins Seetal entsandt wurde<br />
Slg. Daniel Amman<br />
nach Wildegg zur Anbindung an die Hauptbahn<br />
Zürich – Bern. Zudem verschaffte die<br />
SThB den Zügen ein hochmodernes Image, indem<br />
sie beispielsweise erstmals in Europa ihre<br />
Dampfloks mit elektrischen Lampen ausrüstete.<br />
Sie kaufte darüber hinaus vierachsige Großraum-Drehgestellwagen,<br />
Speisewagen (1904),<br />
einen Salonwagen (1913) und schickte ab 1913<br />
Krokodile und Gepäcktriebwagen<br />
Um das zunehmende Güteraufkommen zu bewältigen,<br />
brauchte die Seetalbahn nun neue Lokomotiven,<br />
die eine hohe Zugkraft und zugleich<br />
eine gute Kurvengängigkeit aufweisen mussten.<br />
Das Anforderungsprofil entsprach im Prinzip<br />
demjenigen der berühmten Gotthard-Krokodile,<br />
allerdings auf deutlich geringerem Niveau. So<br />
entstanden im Jahre 1926 als kleine Schwestern<br />
der großen, 130 Tonnen schweren „Reptile“ drei<br />
kleine, nur 73 Tonnen schwere „Krokodilchen“<br />
der Serie De 6/6, deren Vorbauten in antriebstechnischer<br />
Hinsicht je einer Rangierlok der<br />
Baureihe Ee 3/3 entsprachen. Sie waren bereits<br />
für die 1930 durchgeführte Umstellung der Seetalbahn<br />
auf die übliche Fahrdrahtspannung von<br />
15.000 V bei 16 Hz vorbereitet. 57 Jahre lang,<br />
bis 1983, blieben die kleinen Krokodile der See-<br />
60
Seetalbahn einst und jetzt<br />
Selbst unübersichtliche <strong>Bahn</strong>übergänge wie hier in Hallwil waren lange<br />
Zeit nur mit einem Warnkreuz gesichert, obwohl die Züge bis zu<br />
50 km/h fuhren (Aufnahme von 1981). Nach zahlreichen Unfällen verbesserten<br />
die SBB die Situation<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
Ende der 90er-Jahre war die große Kreuzung in Beinwil bereits mit<br />
Ampeln gesichert, als eine Ae 6/6 sie mit ihrem Zug überquerte.<br />
Ausnahmsweise handelt es sich bei der Ellok um ein nicht so auffälliges,<br />
da grün lackiertes Exemplar<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
talbahn treu. Sie zogen dort sämtliche planmäßigen<br />
Güterzüge und in der Hauptverkehrszeit<br />
sogar einzelne Reisezüge. Ein Exemplar, die<br />
De 6/6 15301, konnte nach jahrelanger Abstellzeit<br />
in mühevoller Arbeit im Rahmen eines<br />
internationalen Kulturprojektes wieder betriebsfähig<br />
hergestellt werden und ist gelegentlich<br />
vor Sonderzügen im Einsatz.<br />
Noch etwas länger als die drei Krokodile blieben<br />
acht speziell ausgerüstete Gepäcktriebwagen<br />
der SBB-Serie Fe 4/4 (ab 1963 als De 4/4 bezeichnet)<br />
im Einsatz. Abweichend von den<br />
18 Schwesterfahrzeugen hatten sie 1930 für den<br />
Betrieb auf den Steigungen der Seetalbahn eine<br />
spezielle Getriebeübersetzung und eine elektrische<br />
Bremse erhalten. 58 Jahre lang, bis 1988,<br />
zogen sie fast alle Reisezüge auf der Seetalbahn.<br />
Mitte der 60er-Jahre veränderten sie ihr Aussehen<br />
aber vollkommen, als der Holzaufbau durch<br />
einen Stahlkasten ersetzt wurde.<br />
Nachdem die beiden Stammbaureihen der<br />
Seetalbahn, De 4/4 und De 6/6, in den 80er-Jahren<br />
aus dem Personen- und Güterverkehr „abgetreten“<br />
waren, gab es hier rund 15 Jahre lang eine<br />
recht große Fahrzeugvielfalt. Neben zahlreichen<br />
Triebwagen-Baureihen tauchten Elloks aus verschiedenen<br />
Epochen auf, beispielsweise die Baureihen<br />
Ae 3/6 I , Re 4/4 I , Re 4/4 II und Ae 6/6.<br />
Problem Straßenlage<br />
Die charakteristische Trassierung der Seetalbahn<br />
unmittelbar neben dem Straßenraum<br />
entwickelte sich mit zunehmendem Straßenverkehr<br />
zu einem ernsten Problem, das fast zur<br />
Stilllegung der Strecke geführt hätte. Die ursprünglich<br />
600, allenfalls mit einem Warnkreuz<br />
gesicherten Übergänge sorgten für eine<br />
alarmierende Unfallstatistik. Die Hälfte aller<br />
<strong>Bahn</strong>übergangsunfälle der <strong>Schweiz</strong> geschahen<br />
auf dieser Strecke, in manchen Jahren ereignete<br />
sich durchschnittlich jeden Tag ein Unfall.<br />
Wegen des geringen Abstandes zwischen Gleis<br />
und Fahrbahn kollidierten sogar auf der parallelen<br />
Straße fahrende Lkw mit dem Zug. Im<br />
Laufe der Jahre ergriffen die SBB zahlreiche<br />
Maßnahmen, um die Unfallgefahr einzudämmen.1982<br />
erhielten alle De 4/4 gelb-orange<br />
Warnstreifen an der Fahrzeugfront, und die<br />
Züge fuhren auch tagsüber mit Licht. Die ab<br />
1988 eingesetzten grünen Be 4/4 bekamen<br />
ebenfalls Warnfolien, später eine vollständig<br />
Den Gesamtverkehr auf der S9 zwischen Lenzburg und Luzern erbringen heute die nur 2,70 Meter<br />
breiten GTW-2/8-Triebwagen der Serie RABe 520. Das Foto entstand im Juli 2004 an der alten Kantonsstraße<br />
in Eschenbach. Heute trennt dort ein Zaun Gleiskörper und Fahrbahn Dr. Dietmar Beckmann<br />
rote Front. Für die vorwiegend im Güterverkehr<br />
eingesetzten Ae 6/6 stellten die SBB einen<br />
speziellen Seetal-Umlaufplan auf, in dem vorzugsweise<br />
rot lackierte Loks zum Einsatz kamen.<br />
Besonders problematische Abschnitte<br />
wurden umtrassiert – beispielsweise zwischen<br />
Waldibrücke und Emmenbrücke (1998) und<br />
in Boniswil (2011) – und zahlreiche <strong>Bahn</strong>übergänge<br />
aufgehoben. Auf den beiden Stichstrecken<br />
stellte man den Personenverkehr ein:<br />
1984 nach Wildegg, 1992 nach Beromünster.<br />
Eine Ausrüstung der verbliebenen <strong>Bahn</strong>übergänge<br />
auf der Stammstrecke mit konventioneller<br />
Sicherungstechnik (Blinklichtanlagen<br />
oder Schranken) war aus Platzmangel nicht<br />
möglich, so dass sich die SBB für eine maßgeschneiderte<br />
Sonderlösung entschieden, die<br />
während einer Vollsperrung der Strecke im<br />
Sommer 2002 umgesetzt wurde. Seit Dezember<br />
2002 ist das Lichtraumprofil der Seetalbahn<br />
Rote Farbe und Warnbalken an den Elloks sollten<br />
die Autofahrer auf den nahenden Zug hinweisen<br />
nördlich von Hitzkirch auf 3,80 Meter Breite<br />
eingeschränkt, um eine bessere Trennung von<br />
Straßen- und Schienenverkehr zu erreichen und<br />
um eine spezielle Sicherung der <strong>Bahn</strong>übergänge<br />
mit Rundumleuchten zu ermöglichen. Der<br />
Güterverkehr musste deshalb auf den Abschnitt<br />
zwischen Emmenbrücke und Hochdorf beschränkt<br />
werden. Den Personenverkehr bewältigen<br />
seitdem GTW-Triebwagen von Stadler<br />
mit einem besonders schmalen Wagenkasten<br />
(Serie RABe 520), die die Seetalbahn als S9 im<br />
Halbstundentakt bedienen und heute die bewegte<br />
Geschichte dieser Strecke nicht mehr<br />
erahnen lassen. Dr. Dietmar Beckmann<br />
HINTERGRUND<br />
MEHR ZUR SEETAL<strong>BAHN</strong><br />
Weitere Informationen über die Seetalbahn<br />
gibt es im Internet unter www.seetalkroki.ch<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
61
Momentaufnahmen<br />
Verkehrs-Drehscheibe Basel SBB: Im Mai 1967 ist der Schlafwagenzug „Komet“ aus Hamburg<br />
eingetroffen (l.); Züge der SBB stellen die Verbindung in die <strong>Schweiz</strong> her (r.) Ludwig Rotthowe<br />
<strong>Bahn</strong>betrieb in den 50er- und 60er-Jahren<br />
Im Rhythmus<br />
der Zeit<br />
Europas Wirtschaft boomt, Urlaubsreisen sind groß<br />
im Kommen und außerdem gibt es ja noch das<br />
Alltagsgeschäft. Viel zu tun also für die <strong>Schweiz</strong>er<br />
<strong>Bahn</strong>gesellschaften, die ihre Aufgaben mit ganz<br />
verschiedenen Fahrzeugen bewältigen<br />
Slg. Oliver Strüber (2)<br />
In den 60er-Jahren befinden sich die „Krokodile“<br />
einsatzmäßig auf dem absteigenden Ast.<br />
Am Gotthard mussten sie schon jüngeren<br />
Loks wie der Ae 6/6 Platz machen, immerhin<br />
haben die SBB aber noch Verwendung für sie.<br />
Im Bild Lok 14278, eine Ce 6/8 II , mit einem<br />
Güterzug im September 1966 in Brig<br />
Albert Schöppner<br />
62
Momentaufnahmen<br />
Zwei Güterwagen, vier Personenwagen und<br />
eine Ellok HGe 4/4 I umfasst im September<br />
1957 die „Zugskomposition“ des Regionalzugs<br />
von Zermatt nach Visp. Das Foto entstand<br />
kurz nach der Abfahrt in Zermatt<br />
Peter Kusterer<br />
Willkommen im Tessin, genauer, in<br />
Lugano bei der Eisenbahn nach Ponte<br />
Tresa, die hier diesen malerischen <strong>Bahn</strong>hof<br />
unterhält (Foto: September 1969).<br />
Die FLP wird die einzige schmalspurige<br />
<strong>Bahn</strong> Luganos sein, die erhalten bleibt<br />
Theodor Horn<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
63
Momentaufnahmen<br />
64
<strong>Bahn</strong>-Arbeit<br />
Nahverkehr bei der<br />
Rhätischen <strong>Bahn</strong>: Im<br />
Mai 1967 ist Triebwagen<br />
ABDe 4/4 483 im<br />
<strong>Bahn</strong>hof Langwies eingetroffen.<br />
In Kürze<br />
geht es weiter Richtung<br />
Chur Theodor Horn<br />
Slg. Oliver Strüber (l.), Slg. Peter Kusterer<br />
In Diensten des Flügelrads<br />
Der Arbeitsplatz Eisenbahn ist vielfältig. Er<br />
reicht vom Zugdienst im großen <strong>Bahn</strong>hof<br />
über das Rangieren auf Nebengleisen bis zur<br />
Triebwagenfahrt durch die Berge<br />
Die Sonne scheint<br />
und warm ist es<br />
auch; da kann das<br />
Zugpersonal im <strong>Bahn</strong>hof<br />
Brig auch mal mit<br />
der Uniformjacke<br />
überm Arm zum<br />
nächsten Einsatz<br />
schlendern ...<br />
Dr. Peter Kristl/<br />
Slg. Thomas Wunschel<br />
„Tigerli“ ist der<br />
Spitzname der SBB-<br />
Tenderdampflok<br />
E 3/3; im April 1961<br />
hat Lok 8504 gut<br />
sechs Jahrzehnte<br />
Dienst hinter sich,<br />
faucht aber noch<br />
fleißig im Rangierverkehr<br />
im Raum Basel<br />
Kristl/Slg. Wunschel<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
65
Momentaufnahmen<br />
Auf der Gornergratbahn haben die alten Züge der Bauart Rowan im September<br />
1957 eigentlich längst ausgedient. Zwischen den modernen Einzel- und<br />
Doppeltriebwagen erhalten sie aber doch noch einzelne Einsätze Peter Kusterer<br />
Die Alten und die Jungen<br />
Der <strong>Bahn</strong>betrieb der 50er- und 60er-Jahre ist<br />
eine Fundgrube für Technikfreunde. Selten<br />
gab es solch eine reichhaltige Mischung aus<br />
Veteranen und Neulingen<br />
Slg. Oliver Strüber (2)<br />
Interessante Lok an markanter<br />
Stelle: Im Mai 1967 passiert eine<br />
Ae 3/6 I mit einem Personenzug nach<br />
Winterthur den Rheinfall bei Schaffhausen.<br />
Die Elloks dieser Reihe fahren<br />
sieben Jahrzehnte bei den SBB;<br />
erst 1994 wird die letzte Vertreterin<br />
den Dienst quittieren Ludwig Rotthowe<br />
„Großer Töff“ ist der Spitzname für den niederländisch-schweizerischen<br />
TEE-Dieseltriebzug<br />
RAm. Er verkehrt unter anderem als TEE „Bavaria“<br />
zwischen Zürich und München (Foto<br />
vom August 1969); doch findet das 1971 nach<br />
dem schweren Unglück bei Aitrang im Allgäu<br />
ein jähes Ende<br />
SBB/Slg. Willi Reinshagen<br />
66
Die Alten und die Jungen<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
67
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
Der „Swiss Express“<br />
Markenzeichen<br />
Orange-Steingrau<br />
Neuer Zug mit neuen Farben: Ab 1974 setzten die SBB den „Swiss Express“ ein. Der Nachfolger<br />
der „Städteschnellzüge“ sollte neuen Komfort auf die Ost-West-Relation St. Gallen – Genf<br />
bringen. Aber schon 1982 folgte mit dem „Intercity“ -System ein neuer Einschnitt<br />
Der Betriebsbeginn fiel mit einer Streckeneröffnung<br />
zusammen. Zum Fahrplanjahr<br />
1974 ging die „Heitersberglinie“ zwischen<br />
Killwangen-Spreitenbach und Aarau in<br />
Betrieb, ein vorgezogenes Bauwerk der „Neuen<br />
Haupttransversalen (NHT)“. Zur gleichen Zeit<br />
führten die die <strong>Schweiz</strong>erischen Bundesbahnen<br />
(SBB) auf der Ost–West-Achse (Rorschach –) St.<br />
Gallen – Zürich HB – Bern – Lausanne – Genf<br />
eine neue Zugkategorie ein: den „Swiss Express“.<br />
Der Nachfolger der „Städteschnellzüge“ sollte die<br />
Kunden mit neuem Komfort gewinnen.<br />
Feste Zugkompositionen<br />
Beim „Swiss Express“ hatten die SBB einige betriebliche<br />
Besonderheiten umgesetzt. Die Wagengarnituren<br />
bestanden aus 14 klimatisierten<br />
Einheitswagen III, die immer gleich gereiht waren.<br />
In Fahrtrichtung Zürich hatten die Garnituren<br />
die Abfolge Erstklasswagen mit Gepäckabteil<br />
(AD) + fünf Erstklasswagen (A) +<br />
Speisewagen (WR) + sieben Zweitklasswagen<br />
(B). Der Speisewagen, dessen Stromabnehmer<br />
auf der „Seite Zürich“ war, wurde so ausgerichtet,<br />
dass die Fahrgäste der 1. Klasse nicht<br />
durch den engen Gang neben der Küche gehen<br />
mussten. Reichte der Platz im Speisewagen<br />
nicht aus, konnte der erste auf den Speisewagen<br />
folgende Zweitklasswagen zum Saalwagen umgestaltet<br />
werden. Für den Fahrplanbetrieb waren<br />
fünf Kompositionen nötig, eine sechste und<br />
einige Einzelwagen bildeten die Reserve.<br />
Für die Züge wurden acht Elloks des Typs<br />
Re 4/4 II (auch einer der Prototypen) mit nur<br />
einem Stromabnehmer speziell hergerichtet<br />
und wie die Wagen in den Farben Orange/<br />
Steingrau lackiert. Der Stromabnehmer der<br />
Loks befand sich – auch bei der eher seltenen<br />
Doppeltraktion – auf der „Seite Zürich“.<br />
Technische Neuerungen<br />
Auch in technischer Hinsicht unterschieden<br />
sich die „Swiss Express“-Züge vom restlichen<br />
Rollmaterial der SBB. Am auffälligsten waren<br />
die leicht schrägen Seitenwände der Aluminiumkästen<br />
der Swiss-Express-Wagen. Diese waren<br />
darauf zurückzuführen, dass die Garnituren<br />
als Neigezüge verkehren sollten, doch der<br />
Neigemechanismus bewährte sich nicht.<br />
Trotzdem fahren die Wagen – auch heute noch<br />
– nach der Zugreihe „R“ mit einer erhöhten<br />
68
Swiss-Express<br />
OBEN UND LINKS Auszug aus dem Winterfahrplan 1980/81, Strecke Genf – Bern (– Zürich). Schon<br />
früh am Morgen um 4:36 Uhr verlässt ein „Swiss Express“ Genf Richtung Nordosten; die beiden<br />
Sterne kennzeichnen ihn als klimatisierten Zug. Links der Kursbuch-Titel Slg. B. Uesi (2)<br />
1982 an rollten die Fernreisezüge im Taktfahrplan<br />
und wurden in der neuen Zuggattung<br />
„Intercity“ geführt. Die Zugkategorie<br />
„Swiss Express“ hatte ausgedient. Das Rollmaterial<br />
fand im IC-Verkehr Verwendung.<br />
Kupplungen aus. In den Swiss-Express-Farben<br />
lackiert, dienten sie als Zwischenwagen, mit<br />
denen Loks mit konventioneller Kupplung die<br />
mit automatischer Kupplung ausgestatteten<br />
Swiss-Express-Wagen befördern konnten.<br />
GR. BILD Als Intercity<br />
ist ein Swiss- Express-<br />
Zug im Juli 1984 auf<br />
dem Weg von Fribourg<br />
nach Bern (Bild bei<br />
Thörishaus Dorf). Die<br />
Zuglok Re 4/4 II hat<br />
noch die für den<br />
„Swiss Express“ typische<br />
automatische<br />
Kupplung Georg Wagner<br />
Einsatz ab 1982<br />
Dafür ließen die SBB die Fahrzeuge technisch<br />
modifizieren. Um die Austauschbarkeit zu erhöhen,<br />
erhielten ab 1982 die Swiss-Express-<br />
Lokomotiven Schraubenkupplungen und –<br />
gezwungenermaßen – auch die sechs Endwagen<br />
AD auf der Seite ohne Übergang. Ein<br />
siebter AD entstand aus einem Erstklasswagen.<br />
Sieben Zweitklasswagen wurden zu Steuerwagen<br />
mit einer Vielfachsteuerung des SBB-<br />
Systems 3d umgestaltet und erhielten auf der<br />
Seite mit dem Führerstand ebenfalls eine<br />
Zweites Leben bei der BLS<br />
Im Jahr 2004 trafen die SBB und die Bern-<br />
Lötschberg-Simplon-<strong>Bahn</strong> (BLS) eine Rahmenvereinbarung,<br />
womit der Personenverkehr<br />
neu aufgeteilt wurde. Dabei verkauften die SBB<br />
auch die Swiss-Express-Garnituren samt einiger<br />
Loks der Reihe Re 4/4 II an die BLS, welche die<br />
Fahrzeuge renovierte und in den neuen BLS-<br />
Hausfarben Lindengrün, Blau, Grau lackierte.<br />
Auch die Lokomotiven, die nun die Bezeichnung<br />
Re 420.5 trugen, wurden farblich angepasst.<br />
Das neue Einsatzgebiet waren die Regio-<br />
Klimaanlage, feste Reihung, automatische Kupplung:<br />
Nicht alles Neue des „Swiss Express“ bewährte sich<br />
Bogengeschwindigkeit. Außerdem verfügten<br />
die Wagen und die passenden Loks über eine<br />
automatische UIC-Kupplung – eine Neuerung,<br />
welche die SBB nicht weiterverfolgten.<br />
Auf diese Kupplung stützte sich der druckdichte<br />
Durchgang von Wagen zu Wagen ab,<br />
ebenfalls ein neues Element. Die AD-Seitengangwagen<br />
waren eine bei den SBB unübliche<br />
Bauart und das Gepäckabteil erwies sich als für<br />
die damaligen Verhältnisse viel zu klein. Deshalb<br />
wurden drei der ursprünglich sechs Abteile<br />
umgebaut, davon eines zum Büro für das<br />
Zugpersonal.<br />
Acht Jahre lang kam der „Swiss Express“<br />
auf der Ost-West-Achse zum Einsatz, dann<br />
änderten die SBB ihr Fernverkehrsangebot<br />
und gliederten den Zug in dieses ein. Von<br />
Schraubenkupplung. Die Speisewagen wurden<br />
ausgereiht, erhielten auf beiden Seiten<br />
Schraubenkupplungen, die üblichen Gummiwulst-Übergänge<br />
sowie einen rot/steingrauen<br />
Anstrich und kamen bis zu ihrer Ausmusterung<br />
im Jahre 2006 mit Einheitswagen<br />
IV in Intercity-Zügen zum Einsatz. Die IC-<br />
Wendezüge aus umgebauten Swiss-Express-<br />
Wagen verkehrten vor allem auf den Strecken<br />
Luzern – Zürich Flughafen und Luzern – Bern<br />
– Lausanne – Genf.<br />
Um einzelne Swiss-Express-Wagen zum<br />
Unterhalt oder zur Reparatur in die Werkstätten<br />
überführen zu können, statteten die SBB<br />
einige nicht mehr benötigte zweiachsige Güterzug-Begleitwagen<br />
vom Typ Db, auch „Sputnik“<br />
genannt, einseitig mit automatischen<br />
Express-Züge der BLS von Bern nach Langnau<br />
– Luzern, Neuchâtel und über die Lötschberg-<br />
Bergstrecke nach Brig. Dafür wurden neun<br />
sechsteilige, 165 Meter lange und ca. 263 Tonnen<br />
schwere Garnituren gebildet, die 63 Plätze<br />
1. und 280 Plätze 2. Klasse anboten: Re 465<br />
oder Re 420.5 + AD + A + B + B + B + Bt.<br />
Inzwischen wurden die Fahrzeuge, die doch<br />
in die Jahre gekommen sind, vor allem auf der<br />
Lötschberg-Strecke durch die Triebzüge<br />
„Lötschberger“ (RABe 535) ersetzt. Es gibt<br />
aber Überlegungen, den neuen Fernverkehrszügen<br />
der SBB wieder die Bezeichnung „Swiss<br />
Express“ zu geben. Aktuell lebt der Name<br />
noch bei der <strong>Schweiz</strong>er Post fort; seit 2001 bietet<br />
sie ihre Eilsendungen als „Swiss Express“<br />
an. Dr. Hans-Bernhard Schönborn<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 69
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
Neben dem Gotthard ist der Simplon die zweite bedeutende italienisch-schweizerische Eisenbahn-Magistrale. Ellok Ae 4/7<br />
Nummer 10914 rollt mit einem internationalen Schnellzug aus dem Nordportal des Simplon-Tunnels (o.). Die Grenze zwischen<br />
Italien und der <strong>Schweiz</strong> liegt mitten im Tunnel und ist mit einer Tafel gekennzeichnet (r.)Slg. B. Rampp (o.), A. Schmutz (r.)<br />
Die Simplon-Strecke<br />
<strong>Bahn</strong> nach Italien<br />
Der Simplon-Tunnel ist das markanteste Bauwerk der von den <strong>Schweiz</strong>erischen Bundesbahnen<br />
betriebenen Strecke Lausanne – Brig – Domodossola. Bis 1906 abschnittsweise eröffnet, hatte<br />
die Verbindung von Anfang an große Bedeutung für den internationalen Verkehr<br />
Die von den <strong>Schweiz</strong>erischen Bundesbahnen<br />
(SBB) betriebene, rund 185 Kilometer<br />
lange Simplon-Strecke (oder<br />
„Simplonlinie“) ist eine doppelspurige, elektrifizierte<br />
Hauptstrecke mit internationalem Verkehr<br />
von Lausanne am Genfer See (Kilometer<br />
„Null“) über Brig und durch den Simplon-<br />
Tunnel nach Domodossola. Die Staatsgrenze<br />
<strong>Schweiz</strong>/Italien liegt bei Strecken-Kilometer<br />
156,2 im Tunnel. Die rund 46 Kilometer lange<br />
Zufahrtsstrecke Lausanne – Vallorbe stellt<br />
die Verbindung zum französischen Streckennetz<br />
her. Ihre Anfänge liegen in der Mitte des<br />
19. Jahrhunderts.<br />
Erste Ansätze gab es 1855, als zusammen<br />
mit der Jura-Südfuß-Linie Olten – Lausanne<br />
der Abschnitt Cossonay – Bussigny-prés-Lausanne<br />
der Zufahrtslinie eröffnet wurde. 1870<br />
folgte der Rest bis Vallorbe mit der Anknüpfung<br />
an das französische Netz. Auf der Simplonlinie<br />
eröffnete die Compagnie de l’Ouest-<br />
Suisse am 10. Juni 1857 die Teilstrecke Villeneuve<br />
– Bex, 1878 begann nach dem Lückenschluss<br />
Leuk – Brig der durchgehende Betrieb.<br />
In jenen Jahren wurde das Thema „alpenüber<br />
querende Eisenbahnstrecke“ in der<br />
<strong>Schweiz</strong> aktuell. Mehrere Landesteile kämpften<br />
um den Zuschlag für die neue Alpenbahn, weil<br />
diese Strecke das Verkehrsaufkommen von allen<br />
bisher benutzten Pässen wegziehen würde.<br />
In der Ostschweiz standen fünf seit alters begangene<br />
Pässe zur Auswahl; der direkte Weg<br />
führte über den Gotthard in der Zentralschweiz,<br />
dessen Zufahrtswege zwar in offenen<br />
Tälern verliefen, der aber mit der Schöllenenschlucht<br />
ein schwieriges Hindernis aufwies. Im<br />
Westen konkurrierten Simplon und Großer St.<br />
Bernhard. Durch den Bau des Mont Cenis-<br />
Tunnels als Teil der Strecke Lyon – Turin (1871)<br />
geriet die von den Ingenieuren bevorzugte Variante<br />
über den Simplon-Pass ins Hintertreffen;<br />
die Ostalpenbahn unterlag der Gotthard-Linie,<br />
die als kürzeste Verbindung auch von den Geldgebern<br />
im Ausland favorisiert wurde.<br />
Der Simplontunnel entsteht<br />
Trotz der Eröffnung der Gotthard-Linie im<br />
Jahre 1882 hatte der zweite Anlauf zu einem<br />
Simplon-Tunnel Erfolg. Das war ein Verdienst<br />
der Jura–Simplon-<strong>Bahn</strong> (JS), zu der sich die<br />
Westschweizer <strong>Bahn</strong>en 1890 zusammengeschlossen<br />
hatten. 1895 vereinbarten die<br />
<strong>Schweiz</strong> und Italien in einem Staatsvertrag den<br />
Bau eines Tunnels zwischen Brig und Iselle di<br />
Trasquera sowie der Anschlussstrecke Iselle –<br />
Domodossola. Dass die Staatsgrenze <strong>Schweiz</strong>/<br />
Italien etwa in der Mitte des Tunnels verlaufen<br />
sollte, sahen die <strong>Schweiz</strong>er Militärs als hohes<br />
Sicherheitsrisiko an. Die „militärischen Arbeiten“<br />
im Tunnel regelte man 1908 auf diplomatischem<br />
Wege.<br />
Der Tunnel wurde das Kernstück der gesamten<br />
Simplon-Strecke und setzte Maßstäbe.<br />
70
Simplonbahn<br />
Anfangstage und heute: der feierliche Eröffnungszug 1906 in Brig (l.) und Re 460 der SBB bei der Ausfahrt in Iselle (r.) Slg. H.-B. Schönborn (2)<br />
Bei seiner Eröffnung am 19. Mai 1906 war er<br />
mit 19.803,10 Metern der längste Eisenbahntunnel<br />
der Welt. Zunächst hatte man parallel<br />
einen eingleisigen <strong>Bahn</strong>- und einen<br />
Hilfsstollen im Abstand von 17 Metern ausgebrochen,<br />
die alle 200 Meter durch einen<br />
Querstollen miteinander verbunden wurden –<br />
ein sicherheitstechnisch überzeugendes Konzept.<br />
Der Vollausbruch des Hilfsstollens zur<br />
zweiten Eisenbahnröhre begann sechs Jahre<br />
später. Der Tunnel wurde im Planbetrieb von<br />
Anfang an elektrisch befahren, auch wenn<br />
dem Eröffnungszug mit den Ehrengästen, darunter<br />
dem italienischen König, noch eine<br />
Dampflok vorgespannt wurde.<br />
Trotz der damals modernsten Technik und<br />
aufwendiger Installationen für die Logistik<br />
hatte es beim Bau nicht vorhersehbare Probleme<br />
gegeben. Der große Gebirgsdruck, verschiedene<br />
Bergschläge, Wassereinbrüche aus<br />
kalten und heißen Quellen sowie Gebirgstemperaturen<br />
von mehr als 50 Grad Celsius<br />
machten den Arbeitern und Planern sehr zu<br />
schaffen. Im Wallis beklagte man deshalb den<br />
schleppenden Fortgang der Bauarbeiten. Zusätzlich<br />
ärgerten sich in Brig Leute darüber,<br />
dass der internationale <strong>Bahn</strong>hof auf der anderen<br />
Seite des Tunnels im italienischen Domodossola<br />
angesiedelt wurde. Den jungen, im<br />
Wallis ungeliebten <strong>Schweiz</strong>erischen Bundesbahnen<br />
(SBB), in die 1903 auch die JS eingegliedert<br />
worden war, wurde unterstellt, die<br />
Eröffnung des Tunnels zu verschleppen, um<br />
keine Konkurrenz zur Gotthard-Strecke zu<br />
schaffen. Weil die Arbeiten auf der Nordseite<br />
im Mai 1904 wegen des Einbruchs heißer<br />
Quellen eingestellt worden waren, wurde die<br />
Hauptröhre am 23. Mai 1905 von der Südseite<br />
her durchstochen. In der Mitte des Tunnels,<br />
wo sich auch die Staatsgrenze befindet,<br />
wurde die zweite Röhre auf rund 500 Metern<br />
vollständig ausgebrochen, um eine Kreuzungsstelle<br />
errichten zu können.<br />
Elektrifizierung und zweite Röhre<br />
Da ein Dampfbetrieb in einem so langen Tunnel<br />
wegen der Emissionen sehr problematisch<br />
erschien, wies die Firma BBC aus Baden (bei<br />
Zürich) bereits 1905, während der Bauarbeiten<br />
am Simplontunnel, auf den elektrischen<br />
Betrieb in Norditalien hin. Nach einem Be-<br />
STICHWORT<br />
STAZIONE GALLERIA DE SEMPIONE<br />
Bereits beim Bau der ersten Röhre wurde in<br />
der Mitte des Simplon-Tunnels die zweite<br />
Röhre auf einer Länge von 500 Metern vollständig<br />
ausgebrochen, um die Möglichkeit für<br />
Zugkreuzungen oder -überholungen zu schaffen.<br />
Da die Weichen zunächst vor Ort bedient<br />
wurden, arbeitete jahrzehntelang ein Bediensteter<br />
in der „Stazione Galleria de Sempione“.<br />
Nachdem die zweite Röhre vollständig ausgebrochen<br />
war, bot diese Kreuzungsstelle (samt<br />
der entsprechenden Signalisierung) die Möglichkeit,<br />
Züge bis zur Tunnelmitte parallel fahren<br />
und so einen schnelleren Personen- einen<br />
langsameren Güter- oder Personenzug überholen<br />
zu lassen. In Rahmen der jetzt laufenden<br />
Modernisierung erhielt die Kreuzungsstelle<br />
ein neues elektronisches Stellwerk mit einem<br />
vom Stellwerk Brig abgesetzten Rechner.<br />
In der Mitte des<br />
Simplontunnels hält<br />
sich im Mai 2006<br />
ein Streckenwärter<br />
für Fotozwecke im<br />
Stellwerk an der<br />
Verzweigung auf.<br />
Üblicherweise wird<br />
die Strecke fernbedient,<br />
inzwischen<br />
per Computer<br />
Armin Schmutz<br />
such der Aufsichtsbehörden in Norditalien<br />
schlossen SBB und BBC am 19. Dezember<br />
1905 einen Vertrag über die Elektrifizierung<br />
der Tunnelstrecke; die Kosten und das Risiko<br />
trug BBC.<br />
Drei Lokomotiven für Dreiphasen-Drehstrom<br />
wurden von der italienischen Staatsbahn<br />
FS gemietet (RA 361 – 363, später bezeichnet<br />
als E 360 001 – 003). Zwei weitere,<br />
die eigentlich für die Veltliner <strong>Bahn</strong>en bestimmt<br />
waren, kamen fabrikneu zu den SBB<br />
(Fb 3/5, später Ae 3/5 364 – 365). Im April<br />
1906 begannen die elektrischen Probefahrten<br />
durch den Tunnel, doch am 18. Mai entschieden<br />
die SBB, die Festzüge mit Dampfloks<br />
zu führen. Der Planbetrieb ab 1. Juni 1906 erfolgte<br />
elektrisch: Zunächst waren es alle Güterzüge<br />
und ein Personenzug täglich, ab<br />
14. Juli fünf Reisezüge und ab 1. August dann<br />
alle Züge. Trotzdem verkehrten immer wieder<br />
Dampfloks, weil der Abschnitt Iselle – Domodossola<br />
noch nicht elektrifiziert war und<br />
der Simplon-Orient-Express London – Paris –<br />
Mailand durchgehend mit Dampfloks fuhr.<br />
Auf Anregung von BBC wurde die Tunnelstrecke<br />
elektrifiziert. Die Firma trug auch die Kosten<br />
Als am 27./28. Juni 1913 die Lötschberg-<br />
Bergstrecke Spiez – Brig in Betrieb ging (und<br />
Brig zum Knotenbahnhof wurde), gewann der<br />
Simplon-Tunnel weiter an Bedeutung. Bereits<br />
1912 hatten die SBB beschlossen, den Hilfsstollen<br />
zu einer zweiten Röhre auszubrechen,<br />
doch der Erste Weltkrieg verzögerte die Arbeiten.<br />
Am 16. Oktober 1922 wurde die zwei-<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 71
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
LINKS OBEN Wegen Bauarbeiten<br />
ist im April<br />
1988 nur Dieseltraktion<br />
durch den Simplontunnel<br />
möglich. Also nimmt<br />
Diesellok Am 4/4<br />
18463 (eine ehemalige<br />
V 200 der Bundesbahn)<br />
den „Simplon-Express“<br />
Paris – Belgrad samt<br />
Ellok in Brig an den<br />
Haken Ludwig Rotthowe<br />
BILDER UNTEN Aus dem<br />
Verzweigungsschacht<br />
heraus entstand das Bild<br />
auf einen durchfahrenden<br />
IC (l.). Ellok 362 der<br />
Simplonlinie gehörte zur<br />
„Erstausstattung“ und<br />
fuhr noch mit Drehstrom,<br />
im Bild in Brig (r.)<br />
A. Schmutz (l.), Slg. Wunschel<br />
te Röhre eröffnet, die 19.823,80 Meter misst,<br />
also etwas länger als die erste ist.<br />
Der Betrieb<br />
Der Simplon-Tunnel wurde von mehreren internationalen<br />
Personenzügen benutzt, die sowohl<br />
durch das Rhônetal als auch ab 1913<br />
über die Lötschbergstrecke kamen. Zu Beginn<br />
des Ersten Weltkriegs nahmen die Güterzüge<br />
durch bis zu acht Kohlezüge nach Italien täglich<br />
zu, bis Italien in den Krieg eintrat. Dann<br />
brach der Verkehr fast vollständig zusammen.<br />
Nach dem Krieg erholte sich der Verkehr, und<br />
1924 wurden die ersten Autos auf Flachwagen<br />
durch den Tunnel transportiert. Die Gütertransporte<br />
von Deutschland nach Italien nahmen auch<br />
wieder zu. Im Anschluss an den Simplon-Tunnel<br />
hatten die SBB 1919 den Abschnitt Brig –<br />
Sion mit 3.300 Volt Drehstrom elektrifiziert. Zu<br />
den fünf Elloks aus der Anfangszeit kamen noch<br />
eine Fb 4/6 und zwei Fb 4/4 hinzu. Zwischen<br />
1923 und 1927 wurde die gesamte Strecke bis<br />
Brig elektrifiziert, und zwar nun mit dem bei den<br />
SBB üblichen Einphasen-Wechselstrom von<br />
15 kV 16,7 Hz. Nach der Umstellung des Stromsystems<br />
auch im Simplon-Tunnel konnten ab<br />
Mai 1930 alle SBB- und BLS-Loks freizügig ein-<br />
gesetzt werden, was die Attraktivität des Tunnels<br />
erhöhte, weil das zweimalige Umspannen der Lokomotiven<br />
in Brig und Iselle wegfiel. Vorher waren<br />
von Iselle bis Domodossola noch Dampfloks<br />
gefahren.<br />
Der Zweite Weltkrieg brachte einen erneuten<br />
Einbruch mit sich, und die strategische Bedeutung<br />
wurde so hoch eingeschätzt, dass das Militär<br />
auf beiden Seiten Sprengladungen anbrachte, wobei<br />
diejenigen auf der <strong>Schweiz</strong>er Seite erst 2001<br />
abgebaut wurden. Trotz der Kriegshandlungen<br />
gab es jedoch keine Schäden an den bis Domodossola<br />
fahrenden <strong>Schweiz</strong>er Lokomotiven.<br />
Nach 1945 war das Verkehrsaufkommen wegen<br />
der Kriegsschäden an den <strong>Bahn</strong>anlagen in<br />
Italien und Deutschland zunächst gering, nahm<br />
aber in den 50er-Jahren kontinuierlich zu, zumal<br />
im Dezember 1959 der vertaktete Autotransport<br />
durch den Tunnel begann, nachdem die Verladeanlagen<br />
in Brig ausgebaut worden waren.<br />
Auch die Simplonstrecke wurde ausgebaut; 1979<br />
schlossen die SBB die Erweiterung auf den zweigleisigen<br />
Betrieb ab. Der eigentliche Aufschwung<br />
begann in den 90er-Jahren nach der<br />
Eröffnung der Doppelspur am Lötschberg sowie<br />
dem Ausbau zur Huckepackstrecke; hierfür wurden<br />
die Tunnel zwischen 1996 und 1998 grundlegend<br />
modernisiert sowie mit Funkkabeln ausgerüstet,<br />
um die europäischen Sicherheitsvorschriften<br />
zu erfüllen. Der Simplon wurde von<br />
etwa 100 Zügen pro Tag durchfahren, wobei die<br />
Kapazität bei 300 Zügen liegt.<br />
Heutige Bedeutung<br />
Seit 2007 mündet der Lötschberg-Basistunnel<br />
(LBT) bei Raron mittels großzügiger Brückenbauwerke<br />
in Fahrtrichtung Brig in die Simplonlinie,<br />
und Visp ist neuer Knotenbahnhof.<br />
Nicht zuletzt durch diese zusätzliche Anbindung<br />
hat der Simplon-Tunnel heute eine große<br />
Bedeutung für den alpenquerenden Transitverkehr.<br />
Die Güterzüge, etwa die „Rollende Autobahn“<br />
Novara (I) – Freiburg, benutzen vor allem<br />
die Lötschberg–Simplon-Route, die<br />
Personenzüge teilen sich auf die Lötschberg- und<br />
die Simplonlinie auf. Wenn die Gotthard-Route<br />
gesperrt ist – 2012 wegen Felsstürzen drei Mal<br />
–, werden Güterzüge über den Simplon umgeleitet.<br />
Das größte Manko liegt aber zurzeit auf der<br />
anderen Seite des Bergs; der schlechte Zustand<br />
der Infrastruktur auf dem italienischen Abschnitt<br />
und die begrenzten Möglichkeiten der Rangierbahnhöfe<br />
in Domodossola führten wiederholt zu<br />
Einschränkungen. Dr. H.-B. Schönborn<br />
72
Neue Schmalspur-Züge<br />
Neue Schmalspur-Typen<br />
für die <strong>Schweiz</strong><br />
Allegra,<br />
Komet,<br />
Spatz ...<br />
Mehr als ein halbes Dutzend<br />
neuer Triebzug-Reihen wurde<br />
in den letzten fünf Jahren<br />
von den <strong>Schweiz</strong>er Schmalspurbahnen<br />
beschafft.<br />
Gemeinsam haben sie den<br />
Trend zum Niederflurfahrzeug.<br />
Und manchmal tragen sie<br />
recht ungewöhnliche Namen<br />
In den letzten Jahren hat eine größere Modernisierungswelle<br />
die <strong>Schweiz</strong>er Schmalspurbahnen<br />
erfasst. Dazu trug nicht nur<br />
das hohe Alter manches vorhandenen Fahrzeugs<br />
bei, sondern auch das Gleichstellungsgesetz,<br />
demzufolge die <strong>Bahn</strong>en bis 2014 Niederflurbereiche<br />
für mobilitätsbehinderte<br />
Fahrgäste anbieten müssen. So rollten etliche<br />
neue Züge für <strong>Schweiz</strong>er Kunden an.<br />
„Allegra“ der Rhätischen <strong>Bahn</strong><br />
Als am 14. Oktober 2009 der „Roll in“ des ersten<br />
Zweisystem-Triebzuges ABe 8/12 3501,<br />
„Allegra“, gefeiert wurde, begann für die Rhätische<br />
<strong>Bahn</strong> (RhB) eine neue Ära: Die klimatisierten,<br />
teilniederflurigen „Allegra“ sind auf<br />
dem gesamten Netz verwendbar, einschließlich<br />
der mit 1.000-V-Gleichstrom elektrifizierten<br />
Bernina-Strecke.<br />
Haupteinsatzbereich ist eben jene zum<br />
Welterbe der UNESCO zählende Bernina-<br />
<strong>Bahn</strong> St. Moritz – Tirano, wo die „Allegra“ die<br />
100 Jahre alten, mehrfach umgebauten Triebzüge<br />
ABe 4/4 30 – 35 sowie die ABe 4/4 II 41<br />
– 49 ablösten. Der bisherige Lokwechsel, bedingt<br />
durch den Übergang von Wechsel- auf<br />
Gleichstrom, entfällt. So können die „Allegra“<br />
beispielsweise die Bernina-Express-Züge Chur<br />
– Pontresina – Tirano und Davos – St. Moritz<br />
– Tirano (verkehrt nur im Sommer) durchweg<br />
befördern. Weitere Einsatzgebiete sind die Strecke<br />
Chur – Arosa, die auch durch die Straßen<br />
von Chur führt, die Linie Landquart – Davos<br />
Platz – Filisur oder die RegioExpress-Züge<br />
Landquart – Vereina-Tunnel – St. Moritz. Dabei<br />
nehmen die Triebzüge teils Personen- oder<br />
„Allegra“ heißen die neuen, zweisystemtauglichen Triebwagen der Rhätischen <strong>Bahn</strong>. Ihr<br />
Haupteinsatzgebiet ist die Bernina-Strecke, wo sie auch mit angehängten Personenwagen fahren<br />
(Station Ospizio Bernina, Sommer 2011)<br />
Sven Klein<br />
IN KÜRZE<br />
TECHNISCHE DATEN DES „ALLEGRA“<br />
Dreiteiliger „Allegra“<br />
Vierteiliger „Allegra“<br />
Typ ABe 8/12 (Triebzug) ABe 4/16 (Triebzug)<br />
Nummerierung 3501 – 3515 3101 – 3105<br />
Hersteller Stadler Rail Stadler Rail<br />
Inbetriebsetzung 2009 – 2012 ab 2012<br />
Achsformel Bo’Bo’ + 2’2’ + Bo’Bo’ Bo’Bo’ + 2’2’ + 2’2’ + 2’2’<br />
Spurweite 1.000 mm 1.000 mm<br />
Länge über Puffer 49.500 mm 74.750 mm<br />
Dienstmasse 106 t 113 t<br />
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h 100 km/h<br />
maximale Leistung am Rad 2.600 kW (Wechselstrom) 1.400 kW<br />
2.400 kW (Gleichstrom)<br />
Stromsysteme 11 kV 16,7 Hz Wechselstrom 11 kV 16,7 Hz Wechselstrom<br />
1.000 V Gleichstrom –<br />
Sitzplätze 24 1. Klasse 24 1. Klasse<br />
90 2. Klasse 178 2. Klasse<br />
Der Neue bei den<br />
LEB bietet seinen<br />
Fahrgästen Luftfederung<br />
im S-<strong>Bahn</strong>-<br />
Zugverkehr<br />
Slg. Dr. H.-B. Schönborn<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 73
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
Tests im kommerziellen Betrieb statt; Testfahrten<br />
in Mehrfachtraktion sollen folgen.<br />
Güterwagen mit. Gelegentlich sind noch<br />
Albula-Schnellzüge statt mit einer Ellok<br />
Ge 4/4 III mit einem „Allegra“ bespannt.<br />
Wie fast alle neuen Triebfahrzeuge litten die<br />
„Allegra“ unter „Kinderkrankheiten“. So kritisierten<br />
viele Fahrgäste die starken Schlingerund<br />
Schaukelbewegungen des Zwischenwagens,<br />
ein Problem der Stoßdämpfer, an die<br />
sehr unterschiedliche Anforderungen gestellt<br />
werden. Da die Triebzüge auch für den Unterhalt<br />
oder für Reparaturen nicht getrennt<br />
IN KÜRZE<br />
TECHNISCHE DATEN DES „KOMET“<br />
Dreiteiliger „Komet“<br />
Vierteiliger „Komet“<br />
Typ ABDeh 4/8 (Triebzug) ABDeh 4/10 (Triebzug)<br />
Nummerierung 2021 – 2022 2011 – 2013<br />
Hersteller Stadler Rail Stadler Rail<br />
Baujahre 2007 / 2008 2007/ 2008<br />
Achsformel 2’Bo’Bo’2’ 2’Bo’Bo’2’2’<br />
Spurweite 1.000 mm 1.000 mm<br />
Länge über Kupplung 56.664 mm 74.728 mm<br />
Dienstmasse 77 t 95 t<br />
Höchstgeschwindigkeit 80 km/h 80 km/h<br />
Stundenleistung 1.000 kW 1.000 kW<br />
Anfahrzugkraft 200 kN 200 kN<br />
Stromsystem 11 kV 16,7 Hz Wechselstrom 11 kV 16,7 Hz Wechselstrom<br />
Sitzplätze 30 1. Klasse 47 1. Klasse<br />
114 2. Klasse 141 2. Klasse<br />
OBEN Seit 2012 erhält<br />
die Zentralbahn<br />
die dreiteiligen<br />
„FINK“-Triebzüge<br />
(Probefahrt bei<br />
Brienz, März 2012);<br />
zwei der Dreiteiler<br />
und ein Bistrowagen<br />
ergeben als Kombination<br />
den „Adler“,<br />
der ebenfalls seit<br />
2012 beschafft wird<br />
Armin Schmutz<br />
LINKS Aktueller Komfort<br />
der Zentralbahn:<br />
die 2. Klasse eines<br />
„FINK“-Triebzugs<br />
Armin Schmutz<br />
werden, nahm die RhB 2011 in Landquart<br />
eine neue, zweigleisige Unterhaltshalle in Betrieb.<br />
Anfang 2012 begann die Ablieferung der<br />
fünf vierteiligen „Allegra“ ABe 4/16, die nur<br />
auf dem Stammnetz verkehren können und<br />
auf den S-<strong>Bahn</strong>-Linien Schiers – Chur – Rhäzüns<br />
und Chur – Thusis die in die Jahre gekommenen<br />
Vorortpendelzüge ersetzen sollen.<br />
Nach einigen technischen Anpassungen fanden<br />
ab 8. Januar 2013 mit Zug 3103 erste<br />
„Komet“ der<br />
Matterhorn- Gotthard-<strong>Bahn</strong><br />
In den Jahren 2003 und 2005 beschaffte die<br />
Matterhorn–Gotthard-<strong>Bahn</strong> (MGB) je zwei<br />
Niederflur-Panoramazüge mit Zahnradantrieb<br />
BDSeh 4/8 (Nrn. 2051 – 2054) als „Zermatt-<br />
Shuttle“; diese waren für den Transport von<br />
Personen mit viel Gepäck zwischen Täsch und<br />
Zermatt vorgesehen. Zusammen mit der neuen<br />
Streckenführung zwischen dem <strong>Bahn</strong>hof in<br />
Brig und Bitsch nahm sie dann neue, mit Niederflurbereichen<br />
ausgestattete Zahnrad- und<br />
Adhäsions-Triebzüge in Betrieb; dies sind die<br />
dreiteiligen ABDeh 4/10 2011 – 2013 und die<br />
vierteiligen ABDeh 4/8 2021 – 2022. Die<br />
Fahrzeuge erhielten den Namen „Komet“; das<br />
steht für „Komfortabler Meterspur-Triebzug“.<br />
Die Fahrzeuge fahren hauptsächlich zwischen<br />
Brig, Visp und Zermatt, häufig als „Pärchen“<br />
aus einem Drei- und einem Vierteiler. In den<br />
Randstunden verkehren die Triebzüge einzeln.<br />
2012 hat die MGB für die „Komet“ neue<br />
Unterhaltsanlagen in Brig, Glisergrund in Betrieb<br />
genommen. Weiterhin bestellte sie einen<br />
vierteiligen ABDeh 4/10, sechs dreiteilige<br />
ABDeh 4/8 und vier zweiteilige Gelenksteuerwagen,<br />
die im Erscheinungsbild den „Komet“<br />
angepasst werden und aufgrund ihrer automatischen<br />
Kupplungen nur mit diesen<br />
verkehren können. Damit sollen bis zu neunteilige<br />
Kompositionen gebildet werden.<br />
„FINK“ und „Adler“ der<br />
Zentralbahn<br />
2004/2005 nahm die Zentralbahn (zb), die<br />
durch Fusion aus der Luzern–Stans–Engelberg-<br />
<strong>Bahn</strong> und der Brünigbahn der SBB entstanden<br />
war, zehn Adhäsionstriebzüge ABe 4/8 in Betrieb.<br />
Diese heißen „Spatz“ („Schmalspur Panorama<br />
Triebzug“) und sind für den Regionalverkehr<br />
Meiringen – Interlaken Ost sowie die<br />
S-<strong>Bahn</strong>-Strecken Luzern – Dallenwil und Luzern<br />
– Giswil vorgesehen. Die Züge mit je zwei<br />
niederflurigen Einstiegsbereichen in den Endwagen<br />
und einem Mittelwagen mit Panoramafenstern<br />
bis ins Dach bedeuteten einen Quantensprung.<br />
Einen weiteren Quantensprung –<br />
diesmal auch für die RegioExpress-Verbindungen<br />
Luzern – Interlaken Ost – brachten zwei Typen<br />
von Zahnrad- und Adhäsionstriebzügen: die<br />
dreiteiligen ABeh 160 „FINK“ („Flinke, innovative<br />
Niederflur-Komposition“) und die siebenteiligen<br />
ABeh 150 „Adler“. Die Fahrzeuge<br />
werden seit 2012 schrittweise in Betrieb gesetzt.<br />
Die vollklimatisierten „Adler“ mit Panoramafenstern<br />
und Niederflureinstiegen bestehen aus<br />
zwei dreiteiligen Triebmodulen, die technisch<br />
dem FINK entsprechen, aber nur einen Führerstand<br />
besitzen. Zwischen die Triebmodule wird<br />
ein Bistrowagen eingereiht. Das Einsatzkonzept<br />
sieht vor, dass die FINK morgens und abends im<br />
Regional- und S-<strong>Bahn</strong>-Verkehr fahren und tagsüber<br />
– wenn erforderlich – die „Adler“ zwischen<br />
Luzern und Interlaken Ost verstärken. Wenn ein<br />
Triebmodul eines „Adlers“ ausfällt, wird es durch<br />
einen FINK ersetzt. Allerdings gibt es zwischen<br />
74
Von „Allegra“ bis „STAR“<br />
Regionalverkehr vom anderen Stern? „Komet“ heißt der Neuling der<br />
Matterhorn-Gotthard-<strong>Bahn</strong><br />
Der Nächste, bitte: Ab 2009 reihte sich der NeXT-Triebzug der asm in<br />
die Riege der neuen Triebzüge ein Dr. Hans-Bernhard Schönborn (2)<br />
IN KÜRZE<br />
IN KÜRZE<br />
TECHNISCHE DATEN VON „FINK“ UND „ADLER“<br />
Dreiteiliger „FINK“<br />
TECHNISCHE DATEN VON „NEXT“ UND „STAR“<br />
Dreiteiliger „NExT“<br />
Dreiteiliger „Star“<br />
<strong>Bahn</strong>gesellschaft Regionalverkehr Bern-Solothurn aare–seeland mobil (asm)<br />
Typ RABe 4/12 (Triebzug) Be 4/8 (Triebzug)<br />
Nummerierung 21 – 26 + 27 – 34 110 – 112 + 113 – 115<br />
Hersteller Stadler Rail Stadler Rail<br />
Inbetriebsetzung 2009/2013 2008/2011<br />
Achsformel 2’2’+ Bo’Bo’ + 2’2’ Bo’2’2’Bo’<br />
Spurweite 1.000 mm 1.000 mm<br />
Länge über Kupplung 60.000 mm 39.000 mm<br />
Dienstmasse 77 t 54 t<br />
Siebenteiliger „Adler“<br />
Typ ABeh 160 (Triebzug) ABeh 150 (Triebzug)<br />
Nummerierung 001 – 006 001 – 004<br />
Hersteller Stadler Rail Stadler Rail<br />
Inbetriebsetzung 2012 / 2013 2012/ 2013<br />
Achsformel Bo’1Az’Az1’Bo’ Bo’1Az’Az1’Bo’ + 2’2’ +<br />
Bo’1Az’Az1’Bo’<br />
Spurweite 1.000 mm 1.000 mm<br />
Länge über Kupplung 54.000 mm 126.000 mm<br />
Dienstmasse ca. 92 t ca. 200 t<br />
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h (Adhäsion) 120 km/h (Adhäsion)<br />
Maximale Leistung 1.400 kW (Adhäsion) 2.800 kW (Adhäsion)<br />
1.600 kW (Zahnrad) 3.200 kW (Zahnrad)<br />
Stromsystem 15 kV 16,7 Hz Wechselstrom 15 kV 16,7 Hz Wechselstrom<br />
Sitzplätze 18 1. Klasse 74 1. Klasse<br />
129 2. Klasse 213 2. Klasse<br />
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h 80 km/h<br />
Maximale Leistung am Rad 1.400 kW 1.000 kW<br />
Stromsystem 1.250 V Gleichstrom 1.200 V Gleichstrom<br />
Sitzplätze 18 1. Klasse –<br />
139 2. Klasse 121 2. Klasse<br />
FINK und „Adler“ keine Übergangsmöglichkeit.<br />
Unter anderem durch die neuen Fahrzeuge sinkt<br />
die Fahrzeit zwischen Luzern und Interlaken ab<br />
Dezember 2013 auf unter zwei Stunden.<br />
„NExT“ des Regionalverkehr<br />
Bern – Solothurn<br />
Seit 2009 fahren die sechs Niederflur-Express-<br />
Triebzüge („NExT“) auf der Linie Bern – Solothurn.<br />
Die vollklimatisierten und auf der gesamten<br />
Länge von 60 Metern durchgängigen<br />
Züge weisen pro Wagen zwei niederflurige<br />
Einstiegsbereiche auf, sind also speziell auf einen<br />
schnellen Fahrgastwechsel im S-<strong>Bahn</strong>-<br />
Verkehr zugeschnitten. Weil sich die Fahrzeuge<br />
sehr gut bewährt haben, hat der<br />
Regionalverkehr Bern-Solothurn eine Option<br />
für acht weitere „NExT“ eingelöst, die 2013<br />
in Betrieb gehen und den Takt verdichten.<br />
„STAR“ von aare–seeland mobil<br />
(asm)<br />
Für die Meterspurlinie Solothurn – Langenthal<br />
(samt der Neubaustrecke Niederbipp –<br />
IN KÜRZE<br />
Typ<br />
TRIEBZÜGE FÜR DIE LEB<br />
Nummerierung 41 – 46<br />
Hersteller<br />
Inbetriebsetzung 2010<br />
Achsformel<br />
Spurweite<br />
RBe 4/8 (Triebzug)<br />
Stadler Rail<br />
Bo’2’ + 2’Bo’<br />
1.000 mm<br />
Länge über Kupplung 42.100 mm<br />
Dienstmasse<br />
63 t<br />
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h<br />
Maximale Leistung am Rad 1.400 kW<br />
Stromsystem<br />
1.500 V Gleichstr.<br />
Sitzplätze<br />
118 2. Klasse<br />
Oensingen) und die Strecke Langenthal – St.<br />
Urban ließ die aare–seeland mobil (asm) von<br />
Stadler die Triebzüge Be 4/8 „STAR“ entwickeln.<br />
„STAR“ bedeutet „Schmalspur Triebzug<br />
für Attraktiven Regionalverkehr“. Die<br />
Fahrzeuge sind eine Kombination aus Straßenbahn<br />
für den Streckenabschnitt in der<br />
Stadt Solothurn und Regionalzug für das übrige<br />
Streckennetz. Die Züge erhielten Magnetschienenbremsen<br />
sowie einen großzügigen,<br />
transparenten Fahrgastraum. Sie bewältigen<br />
Steigungen bis zu 70 Promille und Kurvenradien<br />
bis zu 40 Meter. Weil sich die ersten Fahrzeuge<br />
sehr gut bewährten, kamen 2011 drei<br />
weitere hinzu.<br />
Zweiteilige Triebzüge für die LEB<br />
2010 nahm die Chemin de fer Lausanne–<br />
Echallens–Bercher (LEB), die zwischen Lausanne<br />
und Bercher wie eine S-<strong>Bahn</strong> verkehrt,<br />
sechs teilniederflurige Triebzüge RBe 4/8 in<br />
Betrieb. Die Fahrzeuge bieten dank luftgefederten<br />
Drehgestellen einen hohen Fahrkomfort.<br />
Eine nachträgliche Verlängerung der<br />
Züge mit einem Zwischenwagen ist schon vorbereitet.<br />
Weitere Planungen<br />
Das ist aber nicht das Ende der Modernisierungswelle.<br />
Im Jahr 2013 erhält die Frauenfeld–Wil-<strong>Bahn</strong><br />
fünf neue Meter-Niederflur-<br />
Gelenktriebzüge ABe 4/8. Verschiedene<br />
andere <strong>Bahn</strong>en haben neue Fahrzeuge bestellt<br />
oder arbeiten an entsprechenden Plänen.<br />
Dr. Hans-Bernhard Schönborn<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
75
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
OBEN Im August 2011 hat eine Ge 4/4 I den „Glacier“ aus Davos Platz<br />
am Haken. Ab Chur fährt er vereinigt mit einem GEX nach St. Moritz<br />
RECHTS „Roter Wurm“ in der Rheinschlucht: Regionalzug nach Scuol-<br />
Tarasp mit Ellok Ge 4/4 II kurz vor Trin, fotografiert im August 2012<br />
UNTEN Sommer auf der Bernina-<strong>Bahn</strong> mit einem ABe-4/4 III -Doppel zwischen<br />
Ospizio Bernina und Alp Grüm (2010) Bilder d. Beitrags: F. Martinoff<br />
„Wunderwelt“ Rhätische <strong>Bahn</strong><br />
Die „kleine Rote“<br />
Die Rhätische <strong>Bahn</strong>, das sind fast 400 Kilometer Symbiose aus Bergerlebnis und Hochleistungsbahn.<br />
Tagtäglich erobern die imposanten Züge eine gigantisch schöne Landschaft, zu jeder Jahreszeit<br />
und bei jedem Wetter. So empfindet es Florian Martinoff, den bereits seit frü hester Kindheit die<br />
meterspurige <strong>Bahn</strong> in Graubünden in ihren Bann zieht<br />
76
Wunderwelt Rhätische <strong>Bahn</strong><br />
Höchst abwechslungsreich ist die Landschaft<br />
entlang der Strecken: Vom warmen<br />
Churer Rheintal, gespickt mit<br />
Weinreben, reicht sie bis zu hochalpinen<br />
Landschaften ohne jeglichen Bewuchs am<br />
Bernina. Das den Kanton Graubünden umfassende<br />
Netz der Rhätischen <strong>Bahn</strong>, kurz RhB,<br />
bietet viel: zahlreiche verschiedene Fahrzeuge,<br />
mannigfaltige Fotomöglichkeiten. Und<br />
auch für mich als regelmäßigen Besucher immer<br />
wieder Neues.<br />
Lieblingsstrecken, Lieblingsfahrzeuge<br />
Meine bevorzugten Strecken sind die Albulabahn<br />
von Chur nach St. Moritz mit ihren<br />
zahlreichen Kunstbauten, der Bernina von St.<br />
Moritz nach Tirano, welcher die höchste Adhäsionsbahn<br />
der Alpen darstellt, sowie die<br />
<strong>Bahn</strong> durch die Rheinschlucht von Chur nach<br />
Disentis mit den hohen und markanten Kreidefelsen<br />
neben der Strecke. Dort entsteht die<br />
nahezu perfekte Mischung aus herrlicher<br />
Graubündner Bergwelt, den formschönen<br />
Fahrzeugen mit ihrem lieblichen Pfeifen und<br />
Graubündner Berge, formschöne Fahrzeuge und die<br />
Fotostellen: eine Harmonie aus Landschaft und Zug<br />
den wunderschönen Fotostellen – eine Harmonie<br />
aus Landschaft und Zug.<br />
Meine Lieblingsfahrzeuge der RhB sind mit<br />
Sicherheit die „BoBo I“ genannte und offiziell<br />
als Ge 4/4 I bezeichnete Ellok sowie deren größere<br />
Schwester Ge 6/6 II . Mit den neuen „Allegra“-Triebwagen<br />
sind die Ge 4/4 I leider großteils<br />
verschwunden – aktuell gibt es noch drei<br />
von ehemals zehn Loks im Bestand der Rhä-<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 77
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
Klassische RhB-Lok, unterwegs mit einem Alpine-Classic-Pullman-Zug. Ende September 2011 hat Ge 6/6 I Nummer 415, eines der rhätischen<br />
Krokodile, die historische Garnitur übernommen und ist auf dem Weg von St. Moritz nach Zermatt (Bild zwischen Castrisch und Ilanz)<br />
tischen <strong>Bahn</strong>, die aber nur nach Bedarf eingesetzt<br />
werden. Die Ge 6/6 II sind als Nachfolger<br />
der legendären „Krokodile“<br />
heute hauptsächlich<br />
im Güterverkehr<br />
tätig.<br />
Güterverkehr? Ja!<br />
Die RhB ist nicht nur<br />
eine Touristenbahn,<br />
sie dient auch dazu,<br />
bedeutende Orte wie<br />
Begeistert von der <strong>Schweiz</strong> und insbesondere<br />
von der Rhätischen <strong>Bahn</strong>. Florian Martinoff,<br />
Student aus München<br />
St. Moritz, Davos, Disentis, Ilanz, Scuol oder<br />
Tirano vor allem mit Lebensmitteln, Brennstoffen<br />
und Baumaterial zu versorgen. Gerade<br />
diese Züge haben es mir angetan, die – Gott<br />
sei Dank – zumeist noch von einer sonor durch<br />
das Albulatal brummenden Ge 6/6 II angeführt<br />
werden. Das zu erleben, ist jedes Mal wieder<br />
eine beeindruckende Situation.<br />
Bekannt ist die <strong>Bahn</strong> aber vor allem international<br />
durch die mit Reisegruppen besetzten<br />
Renommierzüge Glacier- und Berninaexpress.<br />
In deren, zum Teil vom italienischen<br />
Designer Pininfarina gestylten Panoramawagen<br />
erlebt man Berge, Täler, Kunstbauten und<br />
Denkmäler an großen Fensterfronten, wie in<br />
einem Breitwandfilm. Ich bevorzuge zwar eher<br />
die Regionalexpresszüge, bei denen ich grundsätzlich<br />
noch alle Fenster öffnen kann – gut<br />
zum Fotografieren. Der Bildeindruck eines<br />
modernen Panoramazuges, der sich durch ein<br />
enges Bergtal, umgeben von weißen Gipfeln<br />
nach oben wie ein Lindwurm windet, fasziniert<br />
aber jeden alpinen Eisenbahnfotografen.<br />
Mich eingeschlossen.<br />
Liebe zum Historischen<br />
Besonders erfreulich für Eisenbahnfreunde<br />
und <strong>Bahn</strong>fotografen ist, dass die RhB historische<br />
Fahrzeuge nicht nur pflegt und erhält,<br />
sondern auch zu etlichen Sonderdiensten und<br />
78
Fotomotive bei der RhB<br />
Im nächtlichen <strong>Bahn</strong>hof von Chur steht im Februar 2013 Ellok Ge 4/4 II 612 mit einem Regionalzug<br />
bereit. Der Zug fährt von Scuol nach Disentis<br />
Schnee und herbstliches Lärchengold begleiten Ellok Ge 6/6 II 702 „Curia“, die im November<br />
2012 G 5135 aus Landquart befördert. Das Bild zeigt den Güterzug kurz vor Pontresina<br />
Erlebnisreisen einsetzt. Immer wieder hat man<br />
damit Gelegenheit, ein wummerndes Krokodil<br />
vor Belle-Epoque-Salonwagen oder eine<br />
der beiden Consolidation-Dampflokomotiven<br />
(107 und 108) fauchend vor grünen Oldtimerwagen<br />
in beinahe unberührter Bergromantik<br />
erleben zu können. Und bildlich zu<br />
verewigen natürlich auch.<br />
Meine bevorzugten Reisetermine sind mit<br />
Sicherheit die oftmals sehr wetterstabilen Monate<br />
September und Oktober, außerdem der<br />
November mit den berühmten goldenen Lärchen<br />
entlang der wildromantischen Strecken.<br />
Im Juni ist das Gewitterrisiko noch nicht so<br />
hoch, wodurch die Fototage meist auch voll<br />
ausgeschöpft werden können. Auch der Winter<br />
hat bei der RhB seinen Reiz – meterhoch liegt<br />
der Schnee am Bernina, im Engadin und rund<br />
um Davos. Das Wetter ist im Hochwinter aber<br />
eher schwer einzuschätzen. Innerhalb weniger<br />
Minuten kann nach strahlendem Sonnenschein<br />
plötzlich ergiebiger Schneefall einsetzen…<br />
Die Wahl der Fotostellen bei der Rhätischen<br />
<strong>Bahn</strong> gestaltet sich meist sehr einfach:<br />
Fast jeder Zug ist irgendwo im richtigen Licht<br />
und die Strecken sind fast überall gut zugänglich<br />
und frei von Bewuchs. Jede Linie hat ihren<br />
ganz besonderen Reiz – sei es die Landschaft<br />
oder der abwechslungs- und umfangreiche<br />
Zugverkehr, den man bei einer Schmalspurbahn<br />
so meist nicht erwartet.<br />
So stoße ich bei der Anfahrt durch die<br />
Bündner Herrschaft jedes Mal einen Seufzer<br />
Geheimtipp November: Dann säumen goldene<br />
Lärchen die wildromantischen Strecken<br />
aufkommenden Glücksgefühls aus. Bald weicht<br />
er dann der kribbelnden Spannung, welche Lok<br />
mir die „Bündner Staatsbahn“ wohl zur Begrüßung<br />
durch das Prättigau entgegenschickt.<br />
Bella Grischuna, wie man auf rätoromanisch<br />
sagt. Auf deutsch: schönes Bündner Land ...<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
79
Strecken, Züge, Fahrzeuge<br />
So sah das Nordportal des Gotthard-Basistunnels bei Erstfeld kurz nach dem finalen Durchstich im Sommer 2011 aus. Die meterspurige Stollenbahn<br />
sorgte in der Bauphase für den Personen- und Materialtransport<br />
Dr. Dietmar Beckmann<br />
Der Gotthard-Basistunnel<br />
Im Rohbau fertig<br />
Die Arbeiten für den längsten Tunnel der Welt laufen. Voraussichtlich im Dezember 2016 soll<br />
der 57 Kilometer lange Gotthard-Basistunnel als zweite Querung des Alpenhauptkamms ohne<br />
Steilstrecken, Kehren und Spiraltunnel in Betrieb gehen<br />
Die Mineure haben ihre Arbeit am Gotthard<br />
bereits erledigt. Die beiden 57 Kilometer<br />
langen Tunnelröhren, die jeweils<br />
ein Richtungsgleis aufnehmen sollen, sind vollständig<br />
ausgebrochen. Seit dem Baubeginn an<br />
den Hauptröhren im November 2002 haben<br />
sich die Vortriebsmannschaften nicht nur von<br />
den beiden Portalen bei Erstfeld an der Reuss<br />
und Bodio im Tessin, sondern auch von drei so<br />
genannten Zwischenangriffen aus durch den<br />
Berg gearbeitet. Bei 80 % der Tunnelstrecke kamen<br />
vier gewaltige Tunnelbohrmaschinen der<br />
deutschen Firma Herrenknecht mit den Namen<br />
Heidi, Sissi, Gabi I und Gabi II zum Einsatz; der<br />
Schneidraddurchmesser betrug beachtliche<br />
8,89 Meter bis 9,43 Meter. Auf den restlichen<br />
20 % wurde konventionell mit dem Sprengvortriebsverfahren<br />
gearbeitet. Wegen der zahlreichen<br />
Bauabschnitte konnte man recht häufig einen<br />
Durchschlag auf Teilabschnitten feiern, bis<br />
dann am 15. Oktober 2010 die allerletzte Wand<br />
in der Oströhre fiel, womit diese bereits durchgängig<br />
war. Nach dem finalen Durchstich auch<br />
in der Weströhre am 23. März 2011 war der Basistunnel<br />
im Rohbau fertig. Seitdem wird „nur“<br />
noch am Innenausbau gearbeitet; es werden<br />
Gleise verlegt, der Fahrdraht aufgehängt, Signalund<br />
Kommunikationseinrichtungen installiert.<br />
Zwei einspurige Röhren<br />
Die beiden Einspurröhren führen parallel im Abstand<br />
von ca. 40 Metern durch das Gebirge und<br />
sind alle 325 Meter durch als Fluchtweg dienende<br />
Querschläge miteinander verbunden. Etwa in<br />
den Drittelspunkten des Tunnels befinden sich die<br />
so genannten Multifunktionsstellen Sedrun und<br />
Faido, die jeweils einen doppelten Spurwechsel,<br />
Nothaltestellen sowie Technikräume für die Lüftungs-<br />
und Sicherungstechnik enthalten. Für das<br />
gesamte, 153,5 Kilometer lange Tunnelsystem<br />
mit seinen beiden Hauptröhren, den Schächten,<br />
Zugangs- und Rettungsstollen mussten insgesamt<br />
13,3 Millionen Kubikmeter Gestein (Abraum)<br />
aus dem Tunnel befördert werden, was einer Masse<br />
von 28,2 Millionen Tonnen entspricht. Ein Teil<br />
des Materials (fünf Millionen Tonnen) wurde<br />
noch auf der Baustelle als Baustoff für den Tunnelausbau<br />
(Betonzuschlag) aufbereitet und so<br />
wieder in den Berg eingebaut. Der Rest diente der<br />
Renaturierung der Reussmündung Flüelen oder<br />
Das meiste der 13,3 Millionen Kubikmeter Abraum<br />
wurde abtransportiert – und zwar nur mit der <strong>Bahn</strong><br />
wurde Interessenten zum Verkauf angeboten. Alles<br />
Gestein wurde grundsätzlich per <strong>Bahn</strong> transportiert,<br />
so dass man Abraumzüge zum Beispiel<br />
zwischen Erstfeld und Affoltern a.A. beobachten<br />
80
Gotthard-Basistunnel<br />
IN KÜRZE<br />
DATEN ZUM GOTTHARD-BASISTUNNEL<br />
Länge<br />
57 km (Weltrekord)<br />
Maximale Gebirgsüberlagerung<br />
2.300 m (Weltrekord)<br />
Masse des Abraums<br />
28,2 Mio. Tonnen<br />
Volumen des Abraums 13,3 Mio. m 3<br />
Anzahl Spurwechsel 2<br />
Baubeginn<br />
1993 (erster Sondierstollen)<br />
Zul. Höchstgeschwindigkeit<br />
250 km/h<br />
Plangeschwindigkeit<br />
100 km/h bis 160 km/h<br />
Oberbau<br />
Feste Fahrbahn (schotterlos)<br />
Sicherungssystem ETCS Level 2<br />
Ausbruchdurchmesser<br />
8,89 bis 9,43 m<br />
Nutzquerschnitt im Betrieb 41 m 2<br />
(zum Vergleich: Scheiteltunnel: 36 m2)<br />
Baukosten<br />
11,83 Milliarden CHF<br />
Betriebsführung<br />
SBB<br />
AlpTransit Gotthard AG<br />
konnte, die die ansonsten von Güterzügen selten<br />
befahrene Einspurstrecke entlang des Zugersees<br />
über Walchwil nutzten.<br />
Der höchste Punkt im Tunnel liegt mit<br />
550 Metern über Normalnull 600 Meter tiefer als<br />
der Scheiteltunnel der Bergstrecke. Die maximale<br />
Steigung beträgt nur 13 Promille, so dass in<br />
Verbindung mit der eingleisigen Strecke über Luino<br />
die erste so genannte Flachbahn durch die Alpen<br />
entsteht. Damit reicht für die Querung der<br />
Alpen auch bei Güterzügen die Flachland-Traktionsleistung<br />
aus, man kann auf Vorspann-, Zwischen-<br />
oder Schubloks gänzlich verzichten. Nach<br />
der Eröffnung des Ceneri-Basistunnels 2019 wird<br />
es auch eine zweigleisige Flachbahn geben.<br />
Eine weitere Option zur Erhöhung der Kapazität<br />
ist die Bildung von bis zu 1.400 Meter<br />
langen Güterzügen, die jeweils auch nur eine<br />
Fahrplantrasse belegen. Bei der Inbetriebnahme<br />
des Tunnels in knapp vier Jahren werden die<br />
Güterzüge noch keine Überlänge haben, jedoch<br />
schon ohne Vorspann- oder Drucklok auskommen.<br />
Die <strong>Schweiz</strong>er können dann stolz sein,<br />
wieder den längsten Tunnel der Welt im eigenen<br />
Land zu haben. Durch die Gebirgsüberlagerung<br />
von 2.300 Metern ist er auch der tiefste Tunnel<br />
der Welt. Dr. Dietmar Beckmann<br />
Die Frage der Kapazität<br />
Trotz des von Anfang an zweigleisigen Betriebes<br />
wird die Kapazität des Gotthard-Basistunnels aufgrund<br />
der großen Geschwindigkeitsunterschiede<br />
zwischen Reise- und Güterzügen nicht unbedingt<br />
für die prognostizierten Gütermengen im<br />
Transit durch die <strong>Schweiz</strong> ausreichen. Das Geschwindigkeitsniveau<br />
der einzelnen Zuggattungen<br />
auf den Zulaufstrecken wird sich zumindest<br />
mittelfristig nicht wesentlich verändern, so dass<br />
dort alle Züge relativ homogen mit 80 km/h bis<br />
allenfalls 140 km/h verkehren. Der Basistunnel ist<br />
dagegen für 250 km/h ausgelegt. Bis vor einigen<br />
Monaten waren die SBB davon ausgegangen, die<br />
Fahrpläne der Reisezüge für 220 km/h auszulegen,<br />
diejenigen der Güterzüge für 100 km/h. Unter<br />
diesen Voraussetzungen wäre der Tunnel mit<br />
den zwei Eurocitys bzw. Intercitys und fünf Güterzügen<br />
pro Stunde und Richtung voll ausgelastet.<br />
Damit hätte er die prognostizierten und in der<br />
FinöV (Finanzierung der Infrastruktur des öffentlichen<br />
Verkehrs) geforderten Gütermengen<br />
nicht bewältigen können, so dass mindestens ein<br />
Güterzug über die Bergstrecke geleitet werden<br />
müsste. Gemäß den neuesten Planungen soll die<br />
Geschwindigkeit der Reisezüge aber nun auf<br />
160 km/h beschränkt werden, zumal die optimale<br />
Fahrzeit von knapp drei Stunden zwischen den<br />
Knoten Zürich und Mailand ohnehin nicht realisiert<br />
werden kann. Der Fahrzeitverlust beträgt<br />
gerade einmal zwei Minuten, aber es wird eine zusätzliche<br />
Trasse für den Güterverkehr geschaffen.<br />
Die Multifunktionsstelle Sedrun zeigt sich als <strong>Bahn</strong>hof tief im Berg – heute noch für die Stollenbahn,<br />
später im Betrieb dann als Nothaltestelle und Spurwechsel AlpTransit Gotthard AG<br />
Die Züge mit dem Abraummaterial des Tunnels fuhren zweimal täglich von Erstfeld nach Affoltern<br />
a.A. über die eingleisige Strecke am östlichen Ufer des Zugersees Dr. Dietmar Beckmann<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 81
Momentaufnahmen<br />
Foto-Impressionen von Tibert Keller<br />
<strong>Bahn</strong> mal anders<br />
Tibert Keller, Graubündner des Jahrgangs 1959, war von 1975 bis 1998 bei<br />
der Rhätischen <strong>Bahn</strong> tätig. Heute arbeitet er als freischaffender Fotograf,<br />
Reiseleiter und Journalist. Eines seiner liebsten Motive sind die <strong>Schweiz</strong>er<br />
Eisenbahnen, möglichst vielfältig und in ungewohnten Perspektiven<br />
<strong>Schweiz</strong>, das Land der glücklichen Kühe. Neugierig bestaunen zwei<br />
von ihnen am 2. September 2012 den Fotografen, der sich auf ihre<br />
Weide gewagt hat. Eine dritte schaut lieber dem vorbei fahrenden<br />
Triebwagen BDeh 3/6 25 der Rorschach-Heiden-<strong>Bahn</strong> zu, der an dem<br />
Tag Ungewöhnliches im Schlepptau hat. Wegen einer Gruppenreise<br />
wurden ihm noch sechs Zweiachswagen angehängt ...<br />
82
<strong>Schweiz</strong>er <strong>Bahn</strong>en mal anders<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013 83
Regenwetter ist<br />
schlechtes Wetter?<br />
Gott bewahre: Es<br />
zeichnet nur den<br />
Gegenzug etwas weicher,<br />
als dieser am<br />
12. September 2012<br />
in Ospizio Bernina<br />
eintrifft und durch<br />
die nasse Frontscheibe<br />
des Allegra-<br />
Triebzugs hindurch<br />
fotografiert wird<br />
Der Blickfang vor dem Bergüner <strong>Bahn</strong>museum Albula ist das 1985<br />
ausrangierte RhB-Krokodil Ge 6/6 407. Es bietet dank des eingebauten<br />
Loksimulators Führerstands-Fahrerlebnisse. Im Winter kommt mit<br />
Schnee-Häubchen noch etwas Besonderes von außen dazu<br />
Nahe der Haltestelle Holderbank, zwischen Wildegg und Brugg, haben<br />
offene Güterwagen der <strong>Schweiz</strong>erischen Bundesbahnen einen neuen<br />
Verwendungszweck gefunden. Als mobile Baumkübel geben sie auf<br />
dem Anschlussgleis sprießenden Birken ein Zuhause<br />
Muskelarbeit prägt den Betrieb des Dampfbahn-Vereins Zürcher Oberland<br />
(DVZO). In Bauma mühen sich zwei Museumsbahner mit den betrieblichen<br />
Vorbereitungen. Gilt es doch, die vom offenen Güterwagen auf den<br />
Karren umgeladenen Behälter mit Kohle ins Lokdepot zu verfrachten<br />
Natur und Technik<br />
Wetterstimmung, Pflanzen<br />
und zwischendrin der<br />
Mensch: Schon ist sie<br />
fertig, die Mischung für<br />
interessante Motive<br />
84
Natur und Technik<br />
Den Landwasserviadukt kennt eigentlich jeder Eisenbahnfotograf. Aber haben<br />
Sie schon mal den „Talblick“ probiert? Am 12. Februar 2012 war es ein mutiges<br />
Unterfangen: Um die minus 20 Grad Kälte musste man aushalten, um hier<br />
den Dampfsonderzug der Rhätischen <strong>Bahn</strong> Richtung Filisur abzupassen<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
85
Momentaufnahmen<br />
Allzu viel Schnee darf die Dampfschneeschleuder X rot d 9213 der Rhätischen <strong>Bahn</strong> auf der<br />
Berninalinie gar nicht „bearbeiten“ – sonst bekommen die Teilnehmer der Vorführfahrten ja<br />
nur Schneegestöber zu sehen und keine Schleuder. Ein paar Verwehungen sind aber schon da,<br />
als sie am 19. Januar 2013 zwischen den regulären Räumarbeiten ihr Können zeigt<br />
86
Licht, Schatten, Perspektiven<br />
LINKS Durch diese hohle Gasse<br />
muss er kommen. Kurz<br />
vor Chur verlaufen das Gleis<br />
der Rhätischen <strong>Bahn</strong> links<br />
und die Doppelspur der SBB<br />
nebeneinander. Teleobjektiv,<br />
tief liegende Wintersonne<br />
und die im Schatten stehende<br />
Flanke des Calanda geben<br />
dem von Ziegelbrücke<br />
kommenden Pendelzug am<br />
5. Februar 2011 Dramatik<br />
RECHTS Ein temporäres Anschlussgleis<br />
verbindet die<br />
Matterhorn-Gotthard-<strong>Bahn</strong>-<br />
Strecke mit dem AlpTransit-<br />
Zwischenangriffsschacht<br />
von Sedrun. Zu besonderen<br />
Anlässen befahren statt Güterzügen<br />
auch Personenzüge<br />
den 2,2 Kilometer langen<br />
Abschnitt, wie am 24. September<br />
2011 Ellok HGe 4/4<br />
Nr. 36 mit RhB-Wagen für<br />
den englischen Veranstalter<br />
„Desperate Railtours“.<br />
Gleich ist das Ende des<br />
Zahnstangenstücks erreicht<br />
Licht, Schatten, Perspektiven<br />
Rotierende Räder, dunkle Kanäle oder mal die<br />
gemütliche Pause: Wer sagt, dass die Eisenbahn<br />
von heute nichts mehr zu bieten hat?<br />
Trotz Klimaanlage bieten die Allegra-Triebwagen<br />
Fenster zum Öffnen, und das macht<br />
sich am 12. November 2012 bezahlt. Mit<br />
langer Verschlusszeit entsteht der Ausblick<br />
auf den Castieler Tobel-Viadukt der Arosa -<br />
linie, der wie der Landwasserviadukt an<br />
einer fast senkrechten Felswand in einen<br />
Tunnel übergeht<br />
Ob wirklich alle Eisenbahner auf der HGe 4/4 33 auf die anstehenden Rangierarbeiten warten?<br />
Am 8. August 2011 steht die gut mit Personal besetzte Ellok der Matterhorn-Gotthard-<br />
<strong>Bahn</strong> in Brig für den aus Zermatt eintreffenden abendlichen Regionalzug bereit; sie wird<br />
anschließend dessen Verstärkungswagen ins Depot Glisergrund bringen<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
87
<strong>Bahn</strong>land <strong>Schweiz</strong><br />
Reisetipps<br />
Schnuppertour<br />
<strong>Schweiz</strong><br />
Das Land der Eidgenossen mit der <strong>Bahn</strong> zu entdecken ist leicht – und auch wieder nicht. Überall<br />
gibt es gute Anschlüsse, aber: womit beginnen, was anschauen? <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> hilft bei der Qual<br />
der Wahl und gibt Tipps für Ihre Tour, verteilt auf <strong>Bahn</strong>fahrten kreuz und quer durch die Regionen<br />
Am dichten Streckennetz<br />
liegt es sicher nicht, wenn<br />
man es nicht schafft, alle Sehenswürdigkeiten<br />
der <strong>Schweiz</strong>er<br />
Eisenbahnen aufzusuchen. Es gibt<br />
einfach so viel, was den Besuch<br />
lohnt. Und das sind nicht nur <strong>Bahn</strong>fahrten;<br />
oft bietet die Wanderung<br />
entlang der Gleise weitere reizvolle<br />
Eindrücke. Immerhin: Wer bestimmte<br />
Ausgangspunkte wählt,<br />
kann in kurzer Zeit ganz gut eine<br />
Schnuppertour durchs Alpenland<br />
unternehmen. Wir sagen, wie und<br />
wohin es geht.<br />
Basel, <strong>Bahn</strong>knoten im Norden<br />
Basel, die Stadt am Rhein mit einem<br />
großen Straßenbahnnetz und<br />
einer sehenswerten Altstadt, war<br />
die erste <strong>Schweiz</strong>er Stadt, welche<br />
die Eisenbahn erreichte. Das war<br />
1844 die Chemin de fer Strasbourg–Bâle<br />
(StB), die 1845 nach<br />
heftigen Diskussionen einen <strong>Bahn</strong>hof<br />
innerhalb der Stadtmauern erhielt.<br />
Wenig später erreichte die<br />
deutsche Rheintal-Eisenbahnlinie<br />
Basel, 1854 begannen die Bauarbeiten<br />
an der künftigen Stammlinie<br />
der <strong>Schweiz</strong>erischen Centralbahn<br />
(SCB) durch den Hauenstein nach<br />
Olten und weiter Richtung Süden.<br />
Basel empfiehlt sich als erster<br />
Ausgangspunkt und gleich auch als<br />
erste Sehenswürdigkeit. Interessant<br />
sind zum Beispiel die drei Basler<br />
<strong>Bahn</strong>höfe, von denen Basel SBB<br />
der bedeutendste ist. Den größten<br />
Grenzbahnhof Europas verlassen<br />
täglich rund 1.000 Züge, in etwa<br />
gleich viele kommen dort an. Im<br />
Schnitt gibt es also alle 90 Sekunden<br />
eine Zugbewegung. Hinzu<br />
kommen Güterzüge auf den<br />
Durchfahrgleisen und Postzüge im<br />
88
Reisetipps<br />
Frühlingszeit – Reisezeit! Wie<br />
wäre es da mit einer <strong>Bahn</strong>tour<br />
in (oder besser: durch) die<br />
<strong>Schweiz</strong>? Das reichhaltige Angebot<br />
an <strong>Bahn</strong>en und Zügen<br />
macht vieles möglich. Im Bild:<br />
Ellok Re 4/4 II Nr. 11301 mit EuroCity<br />
auf der Strecke Basel –<br />
Brugg – Zürich im April 2009<br />
Armin Schmutz<br />
Von Basel nach Bern<br />
unterirdischen Postbahnhof. Also<br />
<strong>Bahn</strong>-Attraktion pur.<br />
Im internationalen Verkehr gibt<br />
es etwa stündlich ICE von/nach<br />
Deutschland (unter anderem Hamburg<br />
und Berlin), mehrmals täglich<br />
EC-Züge von/nach Mailand sowie<br />
TGV von/nach Paris. Im nationalen<br />
Fernverkehr fahren mehrmals<br />
stündlich IC-Züge nach Olten, Zürich<br />
und Bern sowie mindestens<br />
stündlich Züge Richtung Zürich –<br />
Chur, Olten – Luzern – Bellinzona –<br />
Locarno, Olten – Bern – Interlaken<br />
Ost / Visp – Brig und Delsberg – Biel<br />
– Neuenburg – Lausanne / Genf.<br />
Außerdem gibt es einen trinationalen<br />
Regionalverkehr, und die Regio-<br />
S-<strong>Bahn</strong> Basel reicht von Frick / Laufenburg<br />
im Osten, Olten im Süden,<br />
Pruntrut im Westen nach Mulhouse<br />
im Nordwesten und Zell im Wiesental<br />
im Nordosten. Mit anderen<br />
Worten: genug zum Schauen und<br />
für die nächsten Etappen.<br />
Der kleinste <strong>Bahn</strong>hof ist der direkt<br />
an Basel SBB angebaute Französische<br />
<strong>Bahn</strong>hof. Gleis 4 von Basel<br />
SBB geht direkt in Gleis 30 von Basel<br />
SNCF über, wobei die Oberleitung<br />
von 15 kV 16,7 Hz auf 25 kV<br />
50 Hz umschaltbar ist.<br />
Eine Doppelspurstrecke stellt<br />
die am 3. November 1873 eröffnete<br />
Verbindung zum zweitgrößten<br />
<strong>Bahn</strong>hof her, dem Badischen <strong>Bahn</strong>hof,<br />
in dem viele Regionalzüge der<br />
Deutschen <strong>Bahn</strong> sowie einige Fernverbindungen<br />
beginnen. Zurzeit<br />
wird eine zweite Doppelspur mit einer<br />
zweiten Rheinbrücke zur Kapazitätserweiterung<br />
fertig gestellt.<br />
Wer rasch nach Bern fahren<br />
möchte, steigt in Basel SBB in einen<br />
IC nach Interlaken Ost oder Brig<br />
und erreicht nach weniger als einer<br />
Stunde die <strong>Schweiz</strong>er Hauptstadt.<br />
In Muttenz kann man die großen<br />
Rangierbahnhöfe sehen und im<br />
fünf Kilometer langen Adlertunnel<br />
umfährt der IC das Nadelöhr Pratteln.<br />
Es folgen das nächste Nadelöhr,<br />
der acht Kilometer lange Hauenstein-Basistunnel,<br />
und dann der<br />
Knotenpunkt Olten, der ursprüngliche<br />
„Kilometer Null“ im <strong>Schweiz</strong>er<br />
Eisenbahnnetz. Danach geht es<br />
richtig schnell, befährt der Zug ab<br />
Rothrist doch die 52 Kilometer lange<br />
Neubaustrecke nach Mattstetten<br />
und ist dort mit bis zu 200 km/h<br />
unterwegs. Bald schon hat man<br />
Bern erreicht.<br />
Es geht aber auch gemütlicher.<br />
Zum Beispiel, indem man von Basel<br />
SBB aus mit der S-<strong>Bahn</strong> bis Liestal<br />
fährt. Dort beginnt die Waldenburgerbahn,<br />
die mit 750-Millimeter-Gleis<br />
schmalste <strong>Bahn</strong> der<br />
<strong>Schweiz</strong>, die jedoch ähnlich einer<br />
S-<strong>Bahn</strong> im 30-, zu Spitzenzeiten im<br />
15-Minuten-Takt verkehrt. An bestimmten<br />
Tagen richtet sie übrigens<br />
auch Dampfsonderfahrten<br />
aus. In Waldenburg kann man<br />
gleich am <strong>Bahn</strong>hof in einen Bus der<br />
PTT, „Postauto“ genannt, nach Balsthal<br />
steigen. In Balsthal wartet die<br />
nächste Besonderheit auf den Eisenbahn-Freund,<br />
die Oensingen –<br />
Der <strong>Bahn</strong>hof Basel SBB ist ein internationales Drehkreuz und das Tor<br />
zum Norden. Er eignet sich gut als Start für <strong>Schweiz</strong>reisen Heiko Focken<br />
<strong>Bahn</strong> fahren im Raum Solothurn lohnt sich. Eine Reihe kleinerer Strecken<br />
lädt dort zu Besuchen ein<br />
Anneli Nau<br />
PREISTIPP<br />
!<br />
SPEZIALTARIFE<br />
Wenn man in der <strong>Schweiz</strong> tageweise viel fahren will, gibt es verschiedene<br />
Angebote. Ein Überblick über kostengünstige Reisemöglichkeiten:<br />
Der „Swiss Pass“ ermöglicht<br />
an vier, acht, 15, 22 aufeinander<br />
folgenden Tagen oder einem ganzen<br />
Monat freie Fahrten auf fast allen<br />
<strong>Bahn</strong>en und Postautolinien, den<br />
Schiffen und etlichen Verkehrsbetrieben.<br />
Bei vielen Bergbahnen wird ein<br />
Rabatt von 25 Prozent gewährt.<br />
!<br />
Der „Swiss Flexi Pass“ bietet<br />
an drei bis sechs frei wählbaren Tagen<br />
innerhalb eines Monats freie Fahrten<br />
auf fast allen <strong>Bahn</strong>en, Postautolinien,<br />
den Schiffen und bei etlichen Ver kehrs -<br />
betrieben.<br />
!<br />
Wenn man Besitzer eines Halbtax-Abonnements<br />
ist, kann man zu<br />
diesem Tageskarten 1. und 2. Klasse<br />
kaufen, die wieder freie Fahrt ge -<br />
währen.<br />
!<br />
In einigen Regionen oder Kan to -<br />
nen, z. B. Graubünden, gibt es auch regi -<br />
o nale Angebote für Freifahrten. HBS<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
89
<strong>Bahn</strong>land <strong>Schweiz</strong><br />
Grün-gelb wie eine frühlingshafte Löwenzahnwiese zeigen sich die Züge der Wengernalpbahn, die von<br />
Wengen zur Kleinen Scheidegg fahren. Mit einem Unterschied: Die Züge haben das ganze Jahr Saison S. Klein<br />
Wanderungen kann man – bei ein<br />
wenig Glück – einen der beiden<br />
ehemaligen RhB-Triebwagen (Chur<br />
– Arosa) mit einem Kehrichttransport<br />
fotografieren. Von La Chauxde-Fonds<br />
fahren RegioExpress-<br />
Züge im Stundentakt nach Biel mit<br />
einem relativ knappen Anschluss<br />
nach Bern. Die Reisezeit (ohne<br />
Wanderung) beträgt etwa vier<br />
Stunden.<br />
AUSFLUGSTIPP:<br />
VERKEHRSHAUS LUZERN<br />
Am 1. Juli 1959 wurde das Verkehrshaus<br />
der <strong>Schweiz</strong> in Luzern<br />
eröffnet. Es bietet umfang reiche Ausstel<br />
lungen mit den Schwerpunkt-Themen<br />
Schienenverkehr, Stra ßen verkehr,<br />
Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt<br />
sowie Kommunikation; daneben gibt<br />
es unter anderem ein Filmtheater. Im<br />
Verkehrshaus sind verschiedene<br />
<strong>Schweiz</strong>er Schienenfahrzeuge zu<br />
sehen, zum Beispiel eine Dampflok<br />
C 5/6 („Elefant“), eine Ellok Be 6/8 II<br />
(„Krokodil“), die „Landi-Lok“<br />
Ae 8/14 Nr. 11852 und die Dampfschneeschleuder<br />
Rotary Xrot 100.<br />
Das Museum hat täglich geöffnet, in<br />
der Sommerzeit von 10 bis 18 Uhr, in<br />
der Winterzeit von 10 bis 17 Uhr. Der<br />
Eintritt kostet 30 CHFr für Erwachsene,<br />
15 CHFr für Jugendliche.B. Uesi<br />
Von Bern zu den nächsten Attraktionen<br />
Sie suchen braune BLS-Loks? Kommen Sie zum Autoverlad am Lötschberg,<br />
dort fahren die Klassiker Re 4/4 (Foto in Goppenstein) Ralf Kutschke<br />
Balsthal-<strong>Bahn</strong> (OeBB), die eine vier<br />
Kilometer lange, normalspurige<br />
Stichstrecke im 30-Minuten-Takt<br />
betreibt. Die <strong>Bahn</strong> besitzt zahlreiche<br />
historische Fahrzeuge (anderer<br />
<strong>Bahn</strong>gesellschaften), die sie vor allem<br />
bei Nostalgiefahrten einsetzt.<br />
In Oensingen halten nicht nur die<br />
Züge der Jura-Südfußlinie Olten –<br />
Solothurn – Biel – Yverdon – Neuchâtel<br />
– Lausanne, sondern seit Dezember<br />
2012 auch die Meterspurzüge<br />
der aare–seeland mobil<br />
(asm). An Werktagen bedienen die<br />
modernen, klimatisierten Niederflurzüge<br />
die Strecke (Langenthal –<br />
Niederbipp –) Oensingen – Niederbipp<br />
– Solothurn im 30-Minuten-<br />
Takt, sonst fahren sie stündlich. Diese<br />
dreiteiligen Triebzüge stellen<br />
eine Mischung aus Straßenbahn<br />
und Regionalzug dar. In Solothurn,<br />
dem Amtssitz des Basler Bischofs,<br />
endet eine weitere Meterspurbahn,<br />
die Strecke Bern – Solothurn des<br />
Regionalverkehr Bern-Solothurn<br />
(RBS). Diese Strecke wird von teilweise<br />
neuen Zügen im 30-Minuten-Takt<br />
befahren. Wenn man nirgends<br />
verweilt, ist man nach knapp<br />
drei Stunden im SBB-Tiefbahnhof<br />
Bern angekommen.<br />
Eine dritte Variante führt über<br />
noch weniger bekannte Gleise: Von<br />
Basel SBB fährt man mit einem InterCity-Neigezug<br />
ICN bis Delémont,<br />
wo man in eine S-<strong>Bahn</strong> nach<br />
Glovelier umsteigt. In Glovelier beginnt<br />
die Meterspurstrecke der<br />
Chemins de Fer du Jura (CJ), die<br />
über Saignelégier und Le Noirmont<br />
nach La Chaux-de-Fonds verläuft.<br />
Die Züge verkehren im Stundentakt.<br />
Da die Strecke durch den Jura,<br />
den jüngsten Kanton der <strong>Schweiz</strong>,<br />
wenig bekannt, aber recht fotogen<br />
ist, bietet sich eine Wanderung (jeweils<br />
ca. zwei Stunden) an. Diese<br />
kann zum Beispiel von Glovelier<br />
nach Combe Tabeillon führen, wo<br />
der <strong>Bahn</strong>hof an einer Spitzkehre<br />
liegt, oder von Le Noirmont nach<br />
Les Bois bzw. von Les Bois nach La<br />
Cibourg. Bei den letzten beiden<br />
Bern, die Bundes- und Kantonshauptstadt<br />
mit einem größeren<br />
Straßenbahnnetz, einer sehenswerten<br />
Altstadt und dem bekannten<br />
Bärengraben, ist ein weiterer<br />
bedeutender Eisenbahnknoten mit<br />
den nach Zürich HB zweitmeisten<br />
<strong>Bahn</strong>reisenden pro Tag. Im Fernverkehr<br />
machen die Züge nach/<br />
von Interlaken Ost und Visp – Brig<br />
hier Kopf, während diejenigen nach<br />
Fribourg – Lausanne weiterfahren.<br />
Daneben gibt es ein umfangreiches<br />
S-<strong>Bahn</strong>-Netz, von dem die BLS den<br />
Normalspur-, der RBS den Schmalspurteil<br />
betreibt.<br />
Von Bern aus bietet sich eine<br />
Fahrt zur höchstgelegenen <strong>Bahn</strong>station<br />
Europas, dem Tunnelbahnhof<br />
Jungfraujoch auf 3.454 Metern<br />
an. Zunächst benutzt man einen<br />
der stündlich verkehrenden IC-<br />
Züge nach Interlaken Ost, der am<br />
Thunersee vorbeifährt. In Interlaken<br />
Ost beginnt (außer der meterspurigen<br />
Zentralbahn nach Meiringen<br />
– Luzern) die Berner<br />
Oberland-<strong>Bahn</strong> (BOB) nach Lauterbrunnen<br />
und Grindelwald. Lauterbrunnen<br />
ist der Umsteigebahnhof<br />
zur Wengernalpbahn (WAB),<br />
die ihre Fahrgäste über den autofreien<br />
Ort Wengen zur Kleinen<br />
Scheidegg bringt. Insgesamt ist die<br />
Strecke der WAB, einer reinen Zahnradbahn,<br />
19,2 Kilometer lang und<br />
hat eine Spurweite von 800 Millimetern.<br />
Dort beginnt die meterspurige,<br />
101 Jahre alte Jungfraubahn,<br />
die auf ihrer 9,3 Kilometer<br />
langen Strecke mittels Zahnstange<br />
fast 1.400 Höhenmeter überwindet.<br />
Bei der Bergfahrt kann man in<br />
der Regel in den Tunnelstationen<br />
Eigerwand und Eismeer durch<br />
Fenster die grandiose Bergwelt bewundern.<br />
Nach einer Pause auf<br />
dem Jungfraujoch bietet sich für<br />
die Rückfahrt ab Kleine Scheidegg<br />
die Strecke über Grindelwald<br />
Grund, wo die WAB-Züge im Depotbereich<br />
Kopf machen, nach<br />
Grindelwald an. Von Grindelwald<br />
geht es mit der BOB nach Interlaken<br />
Ost, wo der Übergang zum IC<br />
nach Bern gleich möglich ist. Eine<br />
solche Rundfahrt würde – mit einer<br />
einstündigen Pause – etwa siebeneinhalb<br />
Stunden in Anspruch nehmen.<br />
Sehenswert ist weiterhin die<br />
Schynige Platte-<strong>Bahn</strong> (SPB), eine<br />
reine Zahnradbahn mit einer Spurweite<br />
von 800 Millimetern, die fast<br />
ausschließlich Altbau-Fahrzeuge<br />
einsetzt. Sie verkehrt von Anfang<br />
Juni bis Ende Oktober ab dem BOB-<br />
<strong>Bahn</strong>hof Wilderswil. Die Fahrzeit<br />
beträgt bergwärts 42, talwärts 52<br />
Minuten. Ein weiteres Highlight ist<br />
die Brienz-Rothorn-<strong>Bahn</strong> (BRB),<br />
die als reine Zahnradbahn auf 7,6<br />
Kilometern eine Höhendifferenz<br />
90
Basel, Bern und Lötschberg<br />
„Aus’m Zug luage isch super!“ Mit der Eisenbahn kann man in der <strong>Schweiz</strong> prima auf Ausflugstour gehen; so gut wie alle Sehenswürdigkeiten<br />
lassen sich per Schiene erreichen. Oft sind die Züge selbst die Attraktion – auch wenn nicht alle Wagen Fenster zum Öffnen haben Eva Schaller<br />
von 1.678 Metern überwindet. Der<br />
Betrieb mit Dampfloks findet von<br />
Anfang Juni bis Ende Oktober statt.<br />
Die Bergfahrt dauert etwa 55, die<br />
Talfahrt etwa 60 Minuten. Zubringer<br />
sind die Zentralbahn ab Interlaken<br />
Ost (Fahrtzeit rund 20 Minuten)<br />
oder das Schiff (75 Minuten).<br />
Bern kann auch der Ausgangspunkt<br />
für Ausflüge zur Lötschberg-Strecke<br />
sein. Für eine Fahrt<br />
über die klassische Bergstrecke<br />
bleibt heute nur der Regionalverkehr;<br />
die BLS betreibt ihn mit modernen<br />
Triebzügen RABe 535<br />
„Lötschberger“, die stündlich als RE<br />
Bern – Kandersteg – Brig verkehren.<br />
Vielleicht noch attraktiver ist die<br />
Wanderung entlang der Lötschberg-Strecke,<br />
bei der man zwischen<br />
zwei Varianten wählen kann.<br />
Die erste setzt die Reise im „Lötschberger“<br />
von Bern bis Kandersteg<br />
voraus (Fahrzeit: gut eine Stunde).<br />
Dort beginnt der Eisenbahn-Erlebnispfad<br />
„Lötschberg Nordrampe“,<br />
der an der BLS-Dienststation Blausee-Mitholz<br />
vorbei zur Kirche im<br />
Kandergrund und von dort nach<br />
Frutigen führt. Unterwegs informieren<br />
47 Tafeln über Eisenbahn,<br />
Gleisanlagen, Bauten und Züge.<br />
Die Wanderzeiten (ohne Pausen<br />
und Fotohalte) betragen ungefähr:<br />
Kandersteg – Blausee zwei Stunden,<br />
Blausee – Kandergrund<br />
eine Stunde, Kandergrund – Frutigen<br />
zwei Stunden. In Blausee und<br />
Kandergrund gibt es Busstationen.<br />
Die Rückfahrt Frutigen – Bern dauert<br />
50 Minuten.<br />
Die Alternative ist der „Klassiker“,<br />
der <strong>Bahn</strong>wanderweg an der<br />
Lötschberg-Südrampe hoch über<br />
dem Rhônetal der <strong>Bahn</strong>strecke<br />
entlang von Hohtenn via Ausserberg<br />
und Eggerberg nach Lalden,<br />
der teilweise die Trasse der früheren<br />
Baubahn benutzt. Die Wanderzeit<br />
ohne Pausen und Fotohalte<br />
beträgt etwa fünfeinhalb<br />
Stunden. Nach Hohtenn fährt man<br />
mit dem RE Bern – Brig (rund 100<br />
Minuten). Für die Rückfahrt empfiehlt<br />
sich ab Lalden der RE nach<br />
Brig und von dort ein IC oder EC<br />
durch den Lötschberg-Basistunnel<br />
nach Bern (Reisezeit:<br />
rund 100 Minuten).<br />
Für die Weiterfahrt<br />
von Bern bietet sich<br />
die Route Bern – Spiez<br />
– Zweisimmen – Montreux<br />
an mit Umsteigen<br />
in Spiez und Zweisimmen;<br />
in Zweisimmen<br />
werden künftig Wagen<br />
der Montreux-Oberland-Bernois-<strong>Bahn</strong><br />
(MOB) auf der durchgehenden<br />
Golden-Pass-<br />
Verbindungen Montreux – Zweisimmen<br />
– Interlaken eingesetzt<br />
Slg. Marco Frühwein<br />
An der Ostseite des Genfer Sees und weiter an der Simplonstrecke<br />
nach Brig gibt es viele reizvolle Nebenbahnen<br />
Anneli Nau<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
91
<strong>Bahn</strong>land <strong>Schweiz</strong><br />
Im Jahr 1981 legte die Furka-Oberalp-<strong>Bahn</strong> die Furka-Bergstrecke still und schickte ihre Züge fortan durch den Basistunnel. Eisenbahnfreunde<br />
erwarben die spektakuläre Zahnradstrecke über den Furkapass und richteten sie für den Museumsbetrieb her. Heute setzt die Trägergesellschaft<br />
Dampfbahn Furka Bergstrecke auf der Meterspurbahn in der Sommersaison Dampfzüge ein; diese fahren von Realp über den Pass bis<br />
Oberwald und überwinden Steigungen bis zu 35 Promille (Adhäsionsbetrieb) bzw. 118 Promille (Zahnradbetrieb)<br />
Dr. Hans-Bernhard Schönborn<br />
Wie wäre es mit einem FLIRT am Genfer See? Das moderne Fahrzeug<br />
fährt zum Beispiel als Regionalzug zwischen Montreux und Sion und<br />
macht dort auch am berühmten Schloss Chillon Station S. Klein, C. Völk (r.)<br />
Naschkatzen kommen beim „Train du Chocolat“ der MOB auf ihre Kosten.<br />
Der Sonderzug Montreux – Broc fährt tageweise von Juni bis Oktober,<br />
das Programm beinhaltet den Besuch einer Schokoladenfabrik<br />
und umgespurt werden. Die Reisezeit<br />
ohne Fotostopps beträgt ca.<br />
dreieinviertel Stunden. Wanderungen<br />
bieten die Möglichkeit, die Panoramazüge,<br />
bei denen die MOB<br />
Vorreiterin war, zu fotografieren;<br />
Wanderrouten sind zum Beispiel<br />
Oeschseite – Schönried (Dauer:<br />
zwei Stunden) oder Rossinière – La<br />
Tine (eine Stunde), wobei die erwähnten<br />
Ausgangs- und Endstationen<br />
nur alle zwei Stunden von<br />
Regionalzügen bedient werden.<br />
Montreux ist ein weiterer Ort,<br />
der sich gut als Ausgangspunkt für<br />
„Eisenbahn-Expeditionen“ eignet.<br />
Wobei Montreux selbst schon etwas<br />
zu bieten hat, ist dies doch der<br />
einzige <strong>Schweiz</strong>er <strong>Bahn</strong>hof mit drei<br />
Montreux und der Genfer See<br />
Spurweiten: Neben der SBB-Normalspur<br />
und der MOB-Meterspur<br />
beginnt im <strong>Bahn</strong>hof – ziemlich versteckt<br />
auf dem hintersten Gleis –<br />
die besuchenswerte Zahnradbahn<br />
nach Glion – Rochers de Naye mit<br />
einer Spurweite von 800 Millimetern<br />
(Berg- bzw. Talfahrt: rund eine<br />
Stunde).<br />
Richtung Westen eröffnet sich<br />
für den Reisenden von Montreux<br />
aus eine malerische Tour an der<br />
Nordseite des Genfer Sees entlang,<br />
92
<strong>Bahn</strong>reise mit Reisetipps<br />
Die <strong>Schweiz</strong> für Zuhause: Diese Re 460 führt eine Kamera mit, die Führerstandsbilder<br />
gibt’s im Internet unter http://www.traincam.ch<br />
Ungewöhnliche Zielstation: Die <strong>Bahn</strong>strecke Aigle – Leysin endet in<br />
einem Tunnel<br />
Dr. Hans-Bernhard Schönborn, Dr. Dietmar Beckmann (Bild l.)<br />
AUSFLUGSTIPP:<br />
BAUMSCHUL<strong>BAHN</strong><br />
Von Basel erreicht man mit <strong>Bahn</strong><br />
und Bus die Schinznacher Baumschulbahn<br />
(SchBB), die einzige mit<br />
Dampf betriebene Schmalspurbahn<br />
der <strong>Schweiz</strong> mit einer Spurweite von<br />
600 Millimetern. Auf dem Gelände<br />
der Baumschule Zulauf in Schinznach-Dorf<br />
führt die Strecke in einem<br />
etwa drei Kilometer langen Rundkurs<br />
durch das parkartige Gelände. Die<br />
Dampfzüge verkehren vom 13. April<br />
bis 13. Oktober 2013 zwischen 13<br />
und 17 Uhr jeweils samstags und<br />
sonntags.<br />
HBS<br />
Mit Zahnstange und Drehstrom arbeitet die nach der Jungfraubahn zweithöchste Bergbahn Europas, die<br />
Gornergratbahn. Unter zweifacher Fahrleitung bringt sie ihre Gäste ins Skiparadies<br />
Sven Klein<br />
einschließlich reizvoller Anschlussbahnen<br />
in die gebirgigen Regionen.<br />
Erster größerer Halt von Montreux<br />
aus ist Vevey, das man mit<br />
den SBB rasch erreicht (sechs Minuten<br />
Fahrzeit). Dort beginnt die<br />
meterspurige Zahnrad- und Adhäsionsbahn<br />
nach Blonay und<br />
Les Pléjades (Bergfahrt: 36 Minuten,<br />
Talfahrt: 50 Minuten). In Blonay<br />
besteht Anschluss an die einzigartige<br />
Museumsbahn Blonay –<br />
Chamby, die von Anfang Mai bis<br />
Ende Oktober – teilweise mit<br />
Dampfzügen – betrieben wird<br />
(Fahrzeit bis zum Museum über<br />
Chamby: 22 Minuten). Von Chamby<br />
aus besteht mit der MOB eine Rückfahrmöglichkeit<br />
nach Montreux<br />
(Fahrzeit: etwa eine Viertelstunde).<br />
Wer weiter auf der Strecke am<br />
Genfer See reist, kommt nach Lausanne<br />
(Montreux – Lausanne mit IR<br />
oder S-<strong>Bahn</strong>: rund 30 Minuten).<br />
Dort treffen sich nicht nur die<br />
Hauptstrecken aus Olten (Jura-Südfußlinie),<br />
Bern – Fribourg, Genf und<br />
Brig, sondern es beginnt auch die<br />
Meterspurbahn nach Echallens –<br />
Bercher, die mit modernem Rollmaterial<br />
wie eine S-<strong>Bahn</strong> betrieben<br />
wird (Fahrzeit pro Richtung: ca. 40<br />
Minuten). Außerdem gibt es die im<br />
Mai 1991 eröffnete Metrolinie m1<br />
nach Renens, technisch gesehen<br />
eher eine Stadtbahn, sowie die im<br />
September 2008 eröffnete m2, deren<br />
gummibereifte Züge führerlos<br />
verkehren und die Zahnradbahn<br />
Lausanne – Ouchy ersetzen.<br />
Und nochmals zur Strecke am<br />
Genfer See: Es lohnt sich auch, die<br />
„ganze halbe Runde“ von Montreux<br />
über Lausanne bis Genf zu<br />
machen. Zum einen, weil schöne<br />
Ausblicke auf Bergketten und Seen<br />
(und in diesem Teil der <strong>Schweiz</strong> sogar<br />
manchmal Palmen!) warten.<br />
Zum anderen, weil es dort noch<br />
weitere interessante <strong>Bahn</strong>en gibt.<br />
Von Nyon beispielsweise klettert<br />
die meterspurige Chemin de Fer<br />
Nyon – St. Cergue – Morez hinauf<br />
in die Berge zum Wintersportort St.<br />
Cergue und fährt dann weiter nach<br />
La Cure an der schweizerisch-französischen<br />
Grenze. Das im Namen<br />
enthaltene Morez auf französischer<br />
Seite erreicht man heute nur noch<br />
per Autobus, doch auch so bietet<br />
die <strong>Bahn</strong> viel. Besonders spektakulär:<br />
An klaren, schönen Tagen blickt<br />
man vom Zugfenster (bergwärts<br />
linke Seite) hinab auf den weiten<br />
Genfer See und im Hintergrund auf<br />
den Mont Blanc.<br />
Ist das schon eine nicht so bekannte<br />
Sehenswürdigkeit, so wartet<br />
Auf der Simplonstrecke nach Osten<br />
östlich von Montreux ein weiterer Geheimtipp.<br />
Dazu muss man mit den<br />
SBB auf der Simplonstrecke nach Aigle<br />
fahren. Dort findet sich neben<br />
dem SBB-<strong>Bahn</strong>hof ein moderner,<br />
fünfgleisiger Meterspur-<strong>Bahn</strong>hof für<br />
drei Linien: Die Zahnrad- und Adhäsionsbahn<br />
nach Leysin fährt zunächst<br />
wie eine Straßenbahn durch<br />
Aigle, am Stadtrand machen alle<br />
Züge im Depot Kopf, so dass die<br />
Triebwagen den Steuerwagen auf<br />
der Zahnstangenstrecke bergwärts<br />
ziehen. Die Endstation Leysin-Grand<br />
Hôtel liegt teilweise im Tunnel (Fahrzeit:<br />
30 Minuten). Die reine Adhäsionsbahn<br />
nach Le Sépey – Les Diablerets<br />
fährt durch eine beeindruckende<br />
Landschaft. Besonders fotogen ist die<br />
Brücke bei Les Planches am Beginn<br />
der langen Spitzkehre zum Kopfbahnhof<br />
Le Sépey. Die Fahrzeit beträgt<br />
rund 50 Minuten pro Richtung.<br />
Der landschaftlich abwechslungsreichen<br />
Strecke nach Ollon, Monthey<br />
und Champéry steht die Anpassung<br />
des Stromsystems und der Zahnstange<br />
an die anderen Linien sowie<br />
die Beschaffung neuer Fahrzeuge bevor.<br />
Die Fahrzeit Aigle – Champéry<br />
beträgt rund eine Stunde. Bei der<br />
Rückfahrt empfiehlt es sich, nur bis<br />
Monthey-Ville zu fahren, zum SBB-<br />
<strong>Bahn</strong>hof zu laufen, von dort nach St-<br />
Maurice zu fahren und in den Zug<br />
nach Bex umzusteigen (Reisezeit: ca.<br />
eine Stunde). Dort beginnt eine meterspurige<br />
Zahnrad- und Adhäsionsbahn<br />
– teilweise als Straßenbahn –<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
93
<strong>Bahn</strong>land <strong>Schweiz</strong><br />
Eine Re 4/4 II in Swiss-Express-Lackierung ist im November 2011 mit einem IR am Gotthard unterwegs. Der<br />
Panoramawagen an dritter Stelle im Zug bietet famose Ausblicke auf die grandiose Landschaft Florian Martinoff<br />
Wandern an der Rhätischen <strong>Bahn</strong>:<br />
Der Fußweg durch die Zügenschlucht<br />
bietet tolle Ausblicke<br />
auf die <strong>Bahn</strong> Dr. Hans-Bernhard Schönborn<br />
Durch Berg und Tal bringt die Matterhorn-Gotthard-<strong>Bahn</strong> ihre Reisenden. Hier mit einem Zug bei Dieni<br />
nach Villars-sur-Ollon (Fahrzeit pro<br />
Richtung: 40 Minuten) und auf den<br />
Col de Bretaye (Fahrzeit: bergwärts<br />
18, talwärts 20 Minuten) – gleichfalls<br />
eine sehr reizvolle Strecke.<br />
Die Hauptstrecke von Montreux –<br />
Aigle Richtung Sion – Brig – Simplon<br />
ist per se sehenswert (SBB-Bedienung<br />
mit Fern- und Regionalzügen).<br />
Doch macht es Sinn, sie nicht „in einem<br />
Rutsch“ zu befahren, sondern<br />
unterwegs immer wieder zu pausieren<br />
und Abstecher zu abzweigenden<br />
<strong>Bahn</strong>en zu unternehmen. Etwa in<br />
Martigny. Dort beginnt die teilweise<br />
mit einer Zahnstange und einer<br />
Stromschiene ausgestattete Meterspurstrecke<br />
über Le Châtelard (Fahrzeit:<br />
50 Minuten) ins französische<br />
Chamonix am Fuß des Mont Blanc<br />
(Fahrzeit: eineinhalb Stunden). Außerdem<br />
ist Martigny Ausgangspunkt<br />
für die Normalspurstrecken nach<br />
Dr. Hans-Bernhard Schönborn<br />
Orsières (Fahrzeit: 25 Minuten mit<br />
Umsteigen in Sembracher) und La<br />
Châble (Fahrzeit: 26 Minuten).<br />
Zur Fortsetzung der <strong>Schweiz</strong>reise<br />
fährt man von Montreux, Aigle,<br />
Bex oder Martigny aus auf der Simplonstrecke<br />
nach Visp (Fahrzeit<br />
Montreux – Visp: ca. eineinviertel<br />
Stunden). Dort bietet die meterspurige<br />
Matterhorn–Gotthard-<br />
<strong>Bahn</strong> (MGB) Anschluss durch das<br />
Mattertal vorbei am Bergsturz von<br />
Randa nach Zermatt (Fahrzeit: ca.<br />
65 Minuten). Wenn man Fotos von<br />
einem anspruchsvollen, viel befahrenen<br />
Streckenabschnitt machen<br />
möchte, ist eine Wanderung von<br />
Zermatt nach Täsch zu empfehlen<br />
(Dauer ohne Fotohalte: ca. eineinhalb<br />
Stunden). Eine weitere interessante<br />
Strecke ab Zermatt ist die<br />
Gornergratbahn auf den gleichnamigen<br />
Berg; die nach der Jungfraubahn<br />
zweithöchste Bergbahn<br />
Europas fährt mit Zahnradbetrieb<br />
und Drehstrom (Fahrzeit bergwärts:<br />
33 Minuten, talwärts 45 Minuten).<br />
An der Station Riffelalp aus<br />
hat man noch Anschluss zu einer<br />
pittoresken „Straßenbahn“ zum<br />
Hotel Riffelalp.<br />
Von Zermatt nach Chur<br />
Von Zermatt aus empfiehlt sich<br />
die Weiterfahrt mit einem der berühmtesten<br />
Schmalspurzüge, dem<br />
„Glacier Express“, obwohl man<br />
von diesem Zug aus den Rhônegletscher,<br />
der dem Zug den Namen<br />
gab, nicht mehr sehen kann. Prinzipiell<br />
kann man mit dem „langsamsten<br />
Schnellzug der Welt“ bis zum<br />
Zielort St. Moritz fahren; für den<br />
Schnupperkurs ist aber die Fahrt<br />
bis Chur passender, weil es dort<br />
vielfältigere Ausflugs- und preiswertere<br />
Übernachtungsmöglichkeiten<br />
gibt. Wer gerne sein Mittagessen<br />
im einem nostalgischen<br />
Speisewagen einnehmen möchte,<br />
sollte den Glacier Express Zermatt<br />
– Davos wählen. Die Fahrt geht<br />
vom Mattertal ins Rhônetal, danach<br />
dem jungen Rotten entlang nach<br />
Oberwald und durch den Furka-Basistunnel<br />
nach Andermatt. Von dort<br />
führt die Reise mittels Zahnradstange<br />
zum Oberalppass, dem<br />
höchsten Punkte der heutigen<br />
Streckenführung, anschließend am<br />
Vorderrhein entlang nach Disentis<br />
und nach einem Lokwechsel durch<br />
die Ruinaulta nach Chur. Wer doch<br />
die Fortsetzung nach St. Moritz<br />
wählt, nimmt die zum UNESCO-<br />
Welterbe zählende Albula-Strecke<br />
mit. Die Fahrzeit bis Chur beträgt<br />
fünfeinhalb Stunden, bis St. Moritz<br />
sieben und drei Viertel Stunden.<br />
Chur ist Bischofssitz, die älteste<br />
Stadt der <strong>Schweiz</strong> und besitzt eine<br />
sehenswerte Altstadt , die von den<br />
Zügen der Rhätischen <strong>Bahn</strong> (RhB)<br />
nach Arosa wie eine Straßenbahn<br />
durchfahren wird. Von hier aus bieten<br />
sich weitere traumhafte Eisenbahn-Exkursionen<br />
an. Lohnend ist<br />
zum Beispiel eine Fahrt Chur – Pontresina<br />
– Tirano mit dem „Bernina<br />
Express“ (Fahrzeit: rund vier Stunden<br />
für eine Richtung), bei welcher<br />
die beiden UNESCO-Welterbe-Strecken<br />
der RhB befahren werden. Die<br />
Unterschiede zwischen dem Albula-<br />
Tal, den Gebirgsmassiven bei Ospizio<br />
Bernina und dem mediterranen<br />
Tirano auf italienischer Seite sind beeindruckend.<br />
In Tirano ist vor der<br />
94
Zermatt, Chur und Bellinzona<br />
Berge, <strong>Bahn</strong> – Bernina-<strong>Bahn</strong>: Die höchstgelegene Adhäsionsbahn Europas beeindruckt mit Streckenführung, Kunstbauten und Ausblicken auf die<br />
Landschaft. Vor dem Morteratsch-Gletscher schraubt sich ein „Allegra“-Triebzug nach oben<br />
Sven Klein<br />
Rückfahrt Zeit, um vor der Wallfahrtskirche<br />
Sta. Maria die RhB-Züge<br />
als Straßenbahn zu fotografieren.<br />
Neben den Zugfahrten bietet gerade<br />
auch das Netz der RhB Möglichkeiten,<br />
entlang der Strecke zu wandern.<br />
An der Albulabahn (Thusis –<br />
Filisur – Samedan – St. Moritz) ist vom<br />
<strong>Bahn</strong>hof Filisur aus ein etwa 20-minütiger<br />
Fußweg zu einem schönen<br />
Aussichtspunkt ausgeschildert; von<br />
dort lässt sich der berühmte Landwasser-Viadukt<br />
aus der Vogelperspektive<br />
faszinierend fotografieren.<br />
Der acht Kilometer lange, bahnhistorische<br />
Lehrpfad am Albula von Preda<br />
nach Bergün ist der Klassiker unter<br />
den <strong>Bahn</strong>wanderwegen schlechthin:<br />
Von Preda aus schlängelt sich der<br />
Weg durch die wildromantische<br />
Landschaft des oberen Albulatals<br />
und führt – einmal hoch über dem<br />
Flüsschen Albula, einmal direkt neben<br />
ihm – an faszinierenden Kunstbauten<br />
der RhB vorbei nach Bergün.<br />
Immer wieder erläutern Schautafeln<br />
den Bau und den Streckenverlauf der<br />
achterbahnartigen <strong>Bahn</strong>linie. Der<br />
Zeitaufwand beträgt etwa zwei Stunden<br />
(ohne Pausen und Fotohalte). In<br />
Bergün wartet noch das neu eröffnete<br />
Albula-Museum.<br />
Auch an der Bernina-Strecke bietet<br />
eine Wanderung interessante<br />
Ausblicke. Zum Beispiel der Fußmarsch<br />
von Bernina Diavolezza nach<br />
Poschiavo, der sich auch noch portionieren<br />
lässt: Diavolezza – Ospizio<br />
Bernina, Ospizio Bernina – Alp Grüm,<br />
Alp Grüm – Cavaglia, Cavaglia – Poschiavo.<br />
Verpflegung erhält man in<br />
Ospizio Bernina und Alp Grüm.<br />
Von Chur aus lässt sich zudem<br />
noch eine interessante Foto-Rundfahrt<br />
unternehmen: Chur – Filisur –<br />
Wiesen – Davos. Es lohnt sich, in<br />
Monstein auszusteigen und nach<br />
Davos Dorf zu laufen, denn man hat<br />
die <strong>Bahn</strong>strecke (fast) immer im<br />
Blickfeld und mit dem Flüsschen sowie<br />
der Stadt ergeben sich interessante<br />
Fotomotive. Von Davos geht es<br />
mit der <strong>Bahn</strong> weiter, wobei in Klosters<br />
ein Abstecher mit dem Postauto<br />
zum Autoverlad Selfranga möglich<br />
ist. Anschließend fährt man von<br />
Klosters über Landquart nach Chur.<br />
Diese Foto-Wander-Fahrt nimmt einen<br />
Tag in Anspruch. Wer noch etwas<br />
mehr Zeit einplanen kann, hat<br />
die Möglichkeit, in Wiesen vom<br />
<strong>Bahn</strong>hof aus über den Wiesener Viadukt<br />
zu gehen und nach der Hippschen<br />
Wendescheibe nach links in<br />
den Wald abzubiegen. Dort gelangt<br />
man zu einem Fotopunkt, von dem<br />
aus der ganze Viadukt zu sehen ist.<br />
Und schließlich kann man neben<br />
planmäßigen Zugfahrten bei der<br />
RhB Dampfsonderzüge erleben. Der<br />
WINTERTIPP: SCHLITTELFAHRTEN PREDA – BERGÜN<br />
Der Winter 2012/2013 ist zwar so<br />
gut wie vorbei, aber wer seine<br />
<strong>Schweiz</strong>reise für die nächsten schneereichen<br />
Monate plant, kann Wintergaudi<br />
und <strong>Bahn</strong>fahren bei der<br />
Rhätischen <strong>Bahn</strong> kombinieren. Im<br />
Winter wird die Albula-Passstraße zwischen<br />
Preda und Bergün für Autos gesperrt<br />
und dient als sechs Kilometer<br />
Verein Dampffreunde RhB ist in<br />
der Hinsicht aktiv und organisiert interessante<br />
Veranstaltungen.<br />
Von Chur nach Bellinzona<br />
lange Rodelbahn. Zurück nach oben<br />
kommen die Schlittenfahrer samt<br />
Schlitten jeweils mit speziellen „Schlittelzügen“<br />
der RhB, die im Halbstundentakt<br />
verkehren. Ein Extrazug der<br />
RhB stellt samstags und sonntags die<br />
Verbindung von Chur nach Preda (hin)<br />
bzw. Bergün (zurück) her. Im Dezember<br />
2013 geht’s wieder los. B. Uesi<br />
Nachdem es bislang fast durchweg<br />
Reisetipps für die Schiene gab,<br />
muss der Schnupperkurs für die<br />
nächste Etappe vorübergehend auf<br />
die Straße ausweichen. Das Postauto<br />
von Chur nach Bellinzona ist<br />
einfach die beste Möglichkeit für<br />
den „Standortwechsel“ (Fahrzeit:<br />
zwei Stunden und 20 Minuten).<br />
Bellinzona steht als weiteres Beispiel<br />
dafür, dass die <strong>Schweiz</strong> „vier<br />
Länder in einem“ vereinigt. Nach<br />
der Deutschschweiz, der Französischen<br />
<strong>Schweiz</strong> und Graubünden<br />
hat der Reisende nun die Italienische<br />
<strong>Schweiz</strong> erreicht, und Bellinzona<br />
mit seinem Kastell gibt davon<br />
einen ersten Eindruck. Eisenbahnmäßig<br />
ist Bellinzona ein guter Ausgangspunkt,<br />
zuallererst für die<br />
weltberühmte Gotthard-<strong>Bahn</strong>.<br />
Die faszinierende Südrampe mit ihren<br />
Schleifen und Rampen bis hinauf<br />
nach Airolo, die Fahrt durch<br />
den Gotthard-Tunnel nach Göschenen<br />
und der Abstieg auf der Nordrampe<br />
mit dem Höhepunkt, der<br />
dreimaligen Begegnung mit der<br />
Kirche von Wassen, gehören zu den<br />
besten Eisenbahnattraktionen der<br />
<strong>Schweiz</strong>. Umso mehr, da sie noch<br />
den vollen <strong>Bahn</strong>betrieb bieten –<br />
der Basistunnel ist ja erst im Bau.<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
95
<strong>Bahn</strong>land <strong>Schweiz</strong><br />
Einige Steigungen müssen die Triebwagen der Rorschach-Heiden-<strong>Bahn</strong> überwinden. Die mit Zahnstange<br />
ausgestattete Verbindung ist die einzige Normalspurstrecke der Appenzeller <strong>Bahn</strong>en<br />
Sven Klein<br />
STICHWORT: SBB HISTORIC<br />
Zur Erhaltung und Dokumen -<br />
tation historischer Eisenbahn<br />
gründeten die SBB im Jahr 2001<br />
die SBB Historic. Neben einer<br />
Bibliothek und Sammlungen von<br />
Eisenbahn-Exponaten betreut SBB<br />
Historic auch Eisenbahn-Fahrzeuge,<br />
von denen sie einige für Sonderfahrten<br />
nutzt.<br />
Mehr unter: www.sbbhistoric.ch<br />
B. Uesi<br />
<strong>Schweiz</strong>erisch-französisches Fernzugtreffen in Zürich HB mit SBB-Ellok<br />
Re 4/4 II (l.) und TGV; der „Silberne“ fährt bis Paris<br />
Sven Klein<br />
Wer sich Zeit nehmen kann, sollte<br />
nicht auf die Wandermöglichkeiten<br />
am Gotthard verzichten. Die gibt es<br />
für die Südrampe wie für die Nordrampe.<br />
Auf der Südseite führen verschiedene<br />
Wanderwege durch die Leventina<br />
von Airolo hinab bis Biasca.<br />
An zwei Stellen – der Piottino-<br />
Schlucht und der Biaschina – wurden<br />
im Jahre 2007 diese Wanderwege mit<br />
Informationstafeln zur Gotthardbahn<br />
ergänzt. Der Weg führt vom Dazio<br />
Grande, einem wuchtigen, alten Zollhaus,<br />
durch die Piottino-Schlucht.<br />
Durch diese enge, eindrucksvolle<br />
Schlucht mit den beidseits hohen<br />
Felswänden zwängen sich der Wanderweg<br />
(ein Jahrhunderte alter<br />
Lugano, Chiasso, Locarno<br />
Saumweg und eine ehemalige Fahrstraße),<br />
die heutige Kantonsstraße,<br />
die Autobahn und die Gotthardbahn.<br />
Um die Höhendifferenz zu überwinden,<br />
mussten hier vor über 125 Jahren<br />
ein Kehrtunnel und an den steilen<br />
Felswänden irgendwie ein Trassee gebaut<br />
werden. Nach der Piottino-<br />
Schlucht überquert der Wanderweg<br />
auf einer Brücke die Gotthardbahn.<br />
Hier war ursprünglich ein <strong>Bahn</strong>übergang<br />
mit Schranke. Der Wanderweg<br />
führt danach auf der linken Talseite<br />
entlang nach Faido. Immer wieder lassen<br />
sich die auf der gegenüberliegenden<br />
Talseite berg- und talwärts<br />
fahrenden Personen- und Güterzüge<br />
beobachten. Die Wanderung dauert<br />
fünfeinhalb Stunden.<br />
An der Gotthard-Nordrampe wurde<br />
der <strong>Bahn</strong>wanderweg im Juni 2007<br />
eröffnet. Er führt von Göschenen via<br />
Wassen, Gurtnellen, Amsteg und Silenen<br />
nach Erstfeld. An verschiedenen<br />
Stellen informieren Tafeln über den<br />
Bau der Gotthardbahn oder über die<br />
alten Verkehrswege in Uri. Die reine<br />
Wanderzeit (ohne Pausen und Fotohalte)<br />
für den ganzen Weg beträgt zirka<br />
siebeneinhalb Stunden. Da zwischen<br />
Göschenen und Erstfeld Busse<br />
verkehren, kann die Wanderung an<br />
mehreren Stellen abgekürzt werden.<br />
Neben dem Ausflug nach Norden<br />
zur Gotthard-<strong>Bahn</strong> bieten sich von<br />
Bellinzona aus noch weitere Touren<br />
an. Da gibt es die Fahrt auf der Hauptstrecke<br />
Richtung Süden nach Lugano<br />
(wo der Zug den Luganer See umrundet<br />
und in der hübschen Stadt<br />
selbst die meterspurige Ferrovia Lugano-Ponte<br />
Tresa verkehrt) bzw.<br />
zum Grenzbahnhof Chiasso. Westwärts<br />
führt die <strong>Bahn</strong> zum Lago Maggiore,<br />
unter anderem nach Locarno.<br />
Dort ist der Ausgangspunkt der Centovalli-<strong>Bahn</strong><br />
(FART), die auf Meterspur<br />
und mit grandiosen Kunstbauten<br />
den Weg in die Berge einschlägt.<br />
Auf 51 Kilometern Strecke verbindet<br />
sie Locarno mit dem italienischen Domodossola<br />
und ist so nebenbei die<br />
kürzeste Schienenverbindung zwischen<br />
der Gotthard-Strecke und der<br />
Simplon-Route. Die Reisezeit Bellin zona<br />
– Locarno – Domodossola beträgt<br />
zwei drei Viertel Stunden in eine Richtung;<br />
sinnvoller (und gemütlicher) ist<br />
es, sich für den Besuch einen ganzen<br />
Tag zu gönnen.<br />
Zurück in den <strong>Schweiz</strong>er Norden<br />
Von Locarno aus fahren direkte IR<br />
über die Gotthard-Strecke nach Norden,<br />
wo weitere Ziele warten. Nach<br />
der grandiosen Gotthard-Passage erreicht<br />
man recht bald Arth-Goldau.<br />
Dort gibt es die Möglichkeit, mit der<br />
Arth-Rigi-<strong>Bahn</strong>, einer normalspurigen<br />
Zahnradbahn, auf die Rigi zu fahren.<br />
Oben auf dem Berg gibt es dann<br />
die Möglichkeit, mit der Vitznau-Rigi-<br />
<strong>Bahn</strong> talwärts zu gelangen – diese<br />
ebenfalls normalspurige Zahnradbahn<br />
war einst die erste Bergbahn<br />
Europas. Von der Talstation Vitznau<br />
kommt man mit dem Bus zum <strong>Bahn</strong>hof<br />
Küssnacht an der Strecke Luzern<br />
– Arth-Goldau. Alternativ besteht die<br />
Option, mit dem Schiff über den Vierwaldstätter<br />
See nach Luzern zu fahren.<br />
Die Stadt und ihr <strong>Bahn</strong>hof lohnen<br />
den Besuch allemal, gibt es doch in<br />
der dortigen Station neben den normalspurigen<br />
SBB-Zügen noch die Meterspurzüge<br />
der Zentralbahn; diese<br />
fahren auf der Brünig-<strong>Bahn</strong> von Luzern<br />
über Meiringen nach Interlaken<br />
Ost. Wer möchte, kann sich also hier<br />
wieder südwärts aufmachen (und von<br />
Interlaken westwärts über Spiez und<br />
Thun Bern er reichen). Luzern hat aber<br />
96
<strong>Bahn</strong>reise mit Reisetipps<br />
<strong>Faszination</strong><br />
Nahverkehr<br />
noch eine weitere Attraktion: das Verkehrshaus<br />
der <strong>Schweiz</strong>. Das Museum<br />
ist eine Fundgrube für Technik-Interessierte<br />
und eine wertvolle Alternative<br />
für Schlechtwettertage.<br />
Von Luzern aus hat man außerdem<br />
die Möglichkeit, über Olten nach<br />
Basel zu fahren – zum Ausgangspunkt<br />
der Schnuppertour – oder noch einen<br />
Ausflug nach Norden und Nordosten<br />
anzuhängen. Über Zug geht die Reise<br />
an den Zürichsee und weiter in die<br />
größte Stadt der <strong>Schweiz</strong>. Der <strong>Bahn</strong>hof<br />
Zürich HB ist ein internationales<br />
Drehkreuz, von dem unter anderem<br />
Züge nach Deutschland und Österreich<br />
fahren. Im <strong>Schweiz</strong>er Eisenbahnverkehr<br />
fahren hier IC-, IR- und<br />
Regionalzüge, außerdem gibt es das<br />
ausgedehnte Netz der Züricher<br />
ostschweiz folgen, die oft ein wenig<br />
im Schatten anderer Regionen steht.<br />
Dabei bietet beispielsweise auch die<br />
Südostbahn interessanten Betrieb.<br />
Reizvoll ist etwa die Fahrt von Arth-<br />
Goldau über Pfäffikon, weiter über<br />
den Seedamm nach Rapperswil und<br />
von dort nach St. Gallen (wer möchte,<br />
kann auch von Zürich nach St. Gallen<br />
fahren und mit der Südostbahn südwärts<br />
nach Arth-Goldau). Von St. Gallen<br />
aus gibt es die Möglichkeit, den<br />
Bodensee zu besuchen – oder mit<br />
den Appenzeller <strong>Bahn</strong>en zu fahren.<br />
Sie betreiben vor allem Meterspurstrecken<br />
(darunter St. Gallen – Gais –<br />
Appenzell, mit Zahnradabschnitt) sowie<br />
eine 1.200-Millimeter-Strecke<br />
(Rheineck – Walzenhausen, mit Zahnradabschnitt)<br />
und eine Normalspur-<br />
Wer von Arth-<br />
Goldau auf die<br />
Rigi möchte,<br />
findet in der<br />
Arth-Rigi-<strong>Bahn</strong><br />
ein geeignetes<br />
Verkehrsmittel.<br />
Im April 2011<br />
verlässt ein<br />
Zug der <strong>Bahn</strong><br />
die Station Rigi<br />
Staffel. Im Hintergrund<br />
sind<br />
der Vierwaldstätter<br />
See und<br />
der Pilatus zu<br />
sehen Sven Klein<br />
Jeden<br />
Monat neu<br />
am Kiosk!<br />
... und ein Abstecher in den Nordosten<br />
S-<strong>Bahn</strong> sowie die Nahverkehrszüge<br />
der Sihltal-Zürich-Uetliberg-<strong>Bahn</strong>.<br />
Auch Sonderfahrten hat Zürich HB zu<br />
bieten: Die Zürcher Museumsbahn<br />
fährt von hier nach Wiedikon und<br />
Sihlbrugg, wobei unter anderem der<br />
„Schnaagi-Schaagi“ zum Einsatz<br />
kommt, eine Dampflok des Typs E 3/3.<br />
Zum Schluss der Schnuppertour<br />
sollen noch zwei <strong>Bahn</strong>en in der Nord-<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 3/2013<br />
strecke (Rorschach – Heiden, mit<br />
Zahnradabschnitt). Es gäbe noch<br />
mehr helvetische Strecken und <strong>Bahn</strong>en,<br />
die den Besuch lohnen. Doch als<br />
Schnupperkurs in Sachen <strong>Bahn</strong>-<strong>Faszination</strong><br />
mag dies ein Anfang sein – von<br />
dem Sie Teile nehmen können, das<br />
ganze Programm oder das Ganze mit<br />
Fortsetzungen dazu. Viel Vergnügen!<br />
DR. HANS-BERNHARD SCHÖNBORN/MHZ<br />
Jeden Monat neu am Kiosk oder unter:<br />
www.strassenbahn-magazin.de<br />
97
<strong>Vorschau</strong> – Leserservice – Impressum<br />
Seien Sie gespannt auf das nächste Heft: <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 4/2013<br />
Impressum<br />
3/2013 l Mai/Juni<br />
24. Jahrgang l Nummer 124<br />
ICE – der moderne DB-Zug<br />
Der Schnellste, das Rückgrat, das Sorgenkind: Im Jahr 1991 läutete die Bundesbahn mit dem InterCityExpress das<br />
Hochgeschwindigkeitszeitalter ein. Heute stehen bei der Deutschen <strong>Bahn</strong> AG mehrere Generationen des Triebzugs in<br />
Dienst, aus dem modernen Fernverkehr ist er nicht mehr wegzudenken. Aber immer wieder offenbarte das Rückgrat des<br />
DB-Reiseangebots unerwartete Schwächen, zuletzt mit dem 407, auf den die DB nach wie vor wartet. <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong><br />
dokumentiert die Entwicklung von ICE-Fahrzeugen und -Liniennetz, beleuchtet die Hintergründe, zeigt die Fortschritte,<br />
Schwierigkeiten und aktuellen Perspektiven. Mit fundierten Berichten, verblüffenden Fakten und brillanten Bildern!<br />
Verpassen Sie keine Ausgabe mehr!<br />
Sichern Sie sich heute schon die nächste Ausgabe mit<br />
bis zu 40 % Preisvorteil und Geschenkprämie –<br />
mehr im Internet unter www.bahnextra.de<br />
Aufnahme: Johnny Loschert<br />
Internet: www.eisenbahnwelt.de<br />
Redaktionsanschrift:<br />
<strong>BAHN</strong>-<strong>EXTRA</strong><br />
Postfach 40 02 09 80702 München<br />
l<br />
Tel. +49 (0) 89.13.06.99.720, Fax - 700<br />
E-Mail: redaktion@geramond.de<br />
Redaktionsleitung: Michael Krische<br />
Verantwortl. Redakteur: Thomas Hanna-Daoud<br />
Redaktion: Martin Weltner, Alexandra Wurl<br />
Redaktionsassistenz: Brigitte Stuiber<br />
Layout: Karin Vierheller, Rico Oehme<br />
Mitarbeit: Dr. Dietmar Beckmann, Michael<br />
Blum/BLS, Tibert Keller, Sven Klein, Florian Martinoff,<br />
Armin Schmutz, Dr. Hans-Bernhard Schönborn,<br />
Doreen Wolff, Thomas Wunschel u.v.m.<br />
Abo-Hotline, Kundenservice,<br />
GeraMond-Programm<br />
Tel. (0180) 5 32 16 17*<br />
Fax (0180) 5 32 16 20*<br />
E-Mail: leserservice@bahnextra.de<br />
(*14 Cent pro Minute)<br />
Gesamtanzeigenleitung:<br />
Helmut Kramer, Tel. +49 (0) 89.13.06.99.270,<br />
helmut.kramer@verlagshaus.de<br />
Anzeigenleitung <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong>:<br />
Helmut Gassner, Tel. +49 (0) 89.13.06.99.520,<br />
Fax - 100; helmut.gassner@verlagshaus.de<br />
www.verlagshaus-media.de<br />
Es gilt Anzeigenpreisliste Nr. 23 vom 1.1.2013<br />
Litho: Cromika, Verona<br />
Druck: Stürtz, Würzburg<br />
Verlag:<br />
GeraMond Verlag GmbH<br />
Infanteriestraße 11a, 80797 München<br />
Geschäftsführung:<br />
Clemens Hahn, Carsten Leininger<br />
Herstellungsleitung: Sandra Kho<br />
Vertrieb Zeitschriften: Dr. Regine Hahn<br />
Vertrieb/Auslieferung Handel:<br />
MZV, Moderner Zeitschriften Vertrieb<br />
GmbH & Co. KG, Unterschleißheim<br />
Zuletzt erschienen:<br />
* z.B. DVD „Die Geschichte der Eisenbahn“<br />
Im selben Verlag erscheinen außerdem:<br />
5|2012 – September/Oktober • € 12,50 CH: sFr 24,80 • A: € 14,20 • B/NL/L: € 14,60<br />
Ostfront<br />
Vormarsch und Katastrophe<br />
Kriegsloks<br />
Mit Dampf, Diesel und Strom<br />
<strong>BAHN</strong>-<strong>EXTRA</strong> 5/2012 Eisenbahn im Zweiten Weltkrieg<br />
Bewa fnung<br />
Geschütze und Panzerzüge<br />
Luftkrieg<br />
Angri fe und Konsequenzen<br />
Eisenbahn im<br />
Zweiten Weltkrieg<br />
Reichsbahn<br />
und Wehrmacht<br />
1939–1945<br />
l<br />
l<br />
Seltene historische<br />
Farbaufnahmen!<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 5/2012 – Eisenbahn im Zweiten Weltkrieg<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 6/2012 – Die letzten Jahre der DR<br />
Lieber Leser,<br />
Sie haben Freunde, die sich ebenso für die Eisenbahn mit all Ihren Facetten begeistern<br />
wie Sie? Dann empfehlen Sie uns doch weiter! Ich freue mich über jeden neuen Leser.<br />
Ihr<br />
Sie haben ein Heft verpasst?<br />
Kein Problem! Bestellen Sie die<br />
nicht mehr am Kiosk erhältlichen<br />
Ausgaben telefonisch über unseren<br />
Kundenservice<br />
Tel. (0180) 5 32 16 17* oder<br />
schnell und bequem im Internet<br />
auf www.eisenbahnwelt.de<br />
l<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 1/2013 – <strong>Bahn</strong>-Jahrbuch 2013<br />
l<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> 2/2013 – Berliner S-<strong>Bahn</strong><br />
Preise: Einzelheft Euro 12,50 (D) (bei Einzelversand<br />
zzgl. Versandkosten); Jahresabopreis<br />
(6 Hefte) Euro 67,50 (inkl. Mehrwert steuer,<br />
im Ausland zzgl. Versandkosten)<br />
ISSN 0937-7174 l ISBN 978-3-86245-190-6<br />
Zeitungskennzahl 12126<br />
Erscheinen und Bezug:<br />
<strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> erscheint alle zwei Monate je weils Mitte/<br />
Ende eines geraden Monats. Sie erhalten <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> in<br />
Deutschland, in Öster reich und in der <strong>Schweiz</strong> im <strong>Bahn</strong> -<br />
hofs buch handel, an gut sortierten Zeitschriften kiosken,<br />
im Fachhandel sowie direkt beim Verlag.<br />
© by GeraMond Verlag München. Die Zeitschrift und alle<br />
in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheber<br />
rechtlich geschützt. Durch Annahme eines Ma nu skripts<br />
erwirbt der Ver lag das aus schließ liche Recht zur Veröffentlichung.<br />
Für unverlangt eingesandte Fotos und Manuskripte<br />
wird keine Haftung übernommen. Gerichtsstand<br />
ist München.<br />
Verantwortlich für den redak tionellen Inhalt: Thomas Hanna-<br />
Daoud; verantwortlich für die Anzeigen: Helmut Kramer;<br />
beide Infanteriestraße 11a, 80797 München.<br />
Verantwortlicher Redakteur <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong><br />
98
Schlachten, Technik,<br />
Feldherren<br />
Das neue Heft ist da.<br />
Jetzt am Kiosk!<br />
Testabo mit Prämie bestellen unter:<br />
www.clausewitz-magazin.de/abo
Vor 100 Jahren, im Juni 1913, wurde die Lötschbergbahn feierlich eröffnet –<br />
die zweite wichtige Alpentransversale der <strong>Schweiz</strong> war vollendet, der Aufstieg<br />
der Bern-Lötschberg-Simplon-<strong>Bahn</strong> begann. Grund genug, der Eisenbahn in der<br />
<strong>Schweiz</strong> ein <strong>BAHN</strong> <strong>EXTRA</strong> zu widmen. Und nicht der einzige: Die Vielfalt der<br />
<strong>Bahn</strong>gesellschaften ist überwältigend, das <strong>Bahn</strong>netz von beeindruckender Dichte,<br />
der Lokomotivbau des Landes voller wegweisender Neuerungen und zuguterletzt<br />
bietet die <strong>Schweiz</strong> eine Fülle von Strecken in grandioser Landschaft.<br />
Dieses Heft lädt Sie ein zu einer Reise quer durch Helvetien. Mit zahlreichen<br />
Fakten, hervorragenden Aufnahmen, Reisetipps von Kennern und mit einer<br />
DVD – 120 Minuten <strong>Schweiz</strong>er Eisenbahnen in bewegten Bildern!<br />
www.eisenbahnwelt.de<br />
ISBN 978-3-86245-190-6