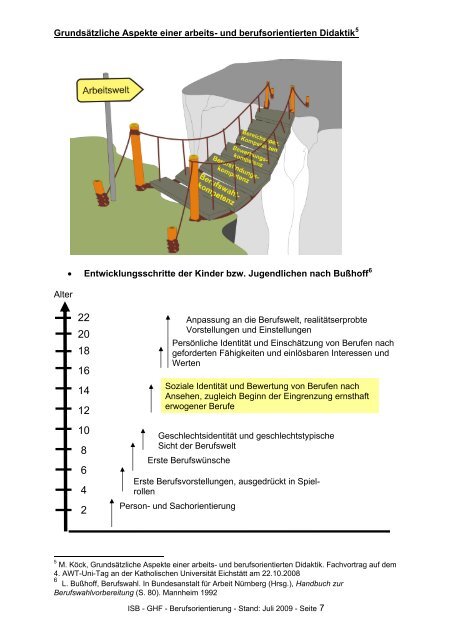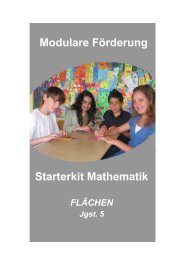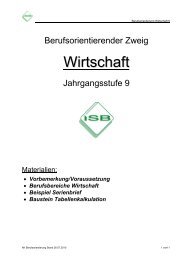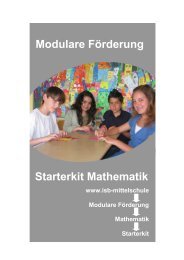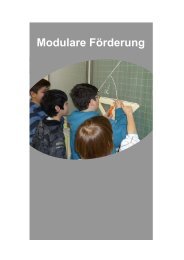Grundsätzliche Aspekte einer arbeits- und berufsorientierten ...
Grundsätzliche Aspekte einer arbeits- und berufsorientierten ...
Grundsätzliche Aspekte einer arbeits- und berufsorientierten ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gr<strong>und</strong>sätzliche <strong>Aspekte</strong> <strong>einer</strong> <strong>arbeits</strong>- <strong>und</strong> <strong>berufsorientierten</strong> Didaktik 5<br />
Alter<br />
• Entwicklungsschritte der Kinder bzw. Jugendlichen nach Bußhoff 6<br />
22<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
Persönliche Identität <strong>und</strong> Einschätzung von Berufen nach<br />
geforderten Fähigkeiten <strong>und</strong> einlösbaren Interessen <strong>und</strong><br />
Werten<br />
Soziale Identität <strong>und</strong> Bewertung von Berufen nach<br />
Ansehen, zugleich Beginn der Eingrenzung ernsthaft<br />
erwogener Berufe<br />
Geschlechtsidentität <strong>und</strong> geschlechtstypische<br />
Sicht der Berufswelt<br />
Erste Berufswünsche<br />
Erste Berufsvorstellungen, ausgedrückt in Spielrollen<br />
Person- <strong>und</strong> Sachorientierung<br />
Anpassung an die Berufswelt, realitätserprobte<br />
Vorstellungen <strong>und</strong> Einstellungen<br />
5 M. Köck, Gr<strong>und</strong>sätzliche <strong>Aspekte</strong> <strong>einer</strong> <strong>arbeits</strong>- <strong>und</strong> <strong>berufsorientierten</strong> Didaktik. Fachvortrag auf dem<br />
4. AWT-Uni-Tag an der Katholischen Universität Eichstätt am 22.10.2008<br />
6 L. Bußhoff, Berufswahl. In B<strong>und</strong>esanstalt für Arbeit Nürnberg (Hrsg.), Handbuch zur<br />
Berufswahlvorbereitung (S. 80). Mannheim 1992<br />
ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 7
Methodisches Repertoire - Auswahl nach dem Profil der Methoden<br />
Inhaltliche <strong>Aspekte</strong><br />
Unterweisung<br />
Fertigungsaufgabe<br />
Konstruktionsaufgabe<br />
Betriebsbesichtigung<br />
Zielgruppenspezifische<br />
<strong>Aspekte</strong><br />
Beratung/Begleitung<br />
Bewerbungstraining<br />
Betriebspraktikum<br />
Kommunikations- <strong>und</strong><br />
Moderationstechniken<br />
Projekt<br />
Betriebserk<strong>und</strong>ung<br />
Fallstudie<br />
Leittextmethode<br />
Planspiel<br />
Zukunftswerkstatt<br />
Rollenspiel<br />
Szenario-Technik<br />
Berufswahlordner<br />
Lernpsychologische<br />
<strong>Aspekte</strong><br />
Individual- <strong>und</strong> sozialpsychologische<br />
<strong>Aspekte</strong><br />
Betriebserk<strong>und</strong>ungen, Fallstudien <strong>und</strong> Leittextmethoden berücksichtigen im unterschiedlichen<br />
Maße inhaltliche, lernpsychologische, individual- <strong>und</strong> sozialpsychologische<br />
<strong>und</strong> zielgruppenspezifische <strong>Aspekte</strong>.<br />
(siehe farbliche Zuordnung in der Grafik)<br />
• Methodisches Repertoire <strong>einer</strong> Arbeits- <strong>und</strong> Berufsorientierten Didaktik<br />
– Arbeitsaufgabe => Vollständige Handlung<br />
6. Was muss<br />
beim nächsten<br />
mal anders gemacht<br />
werden?<br />
Fachgespräch<br />
mit dem Lehrer,<br />
Lernpass<br />
6. Bewerten<br />
1. Was soll getan<br />
werden? Leitfragen,<br />
Leitsätze<br />
1. Informieren<br />
2. Planen<br />
2. Wie geht man<br />
vor? Arbeitsplan,<br />
Kontrollbogen,<br />
Liste der Arbeitsmittel<br />
5. Ist die Arbeit<br />
fach- <strong>und</strong> sachgerecht<br />
durchgeführt?<br />
Kontrollbogen<br />
5. Kontrollieren<br />
4. Ausführen<br />
4. Fertigung des<br />
Werkstücks bzw.<br />
Aufgabenbearbeitung<br />
3. Entscheiden<br />
3. Fertigungsweg<br />
<strong>und</strong> Betriebsmittel<br />
festlegen,<br />
Fachgespräch<br />
mit dem Lehrer<br />
ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 8
Berufsorientierender Unterricht in der Haupt-/Mittelschule<br />
Die Haupt-/Mittelschule begleitet die Schüler bei ihrem Übergang von der Schule ins<br />
Berufsleben. Sie gestaltet diesen Übergang methodisch <strong>und</strong> didaktisch als ganzheitlichen<br />
Prozess, der sich über mehrere Schuljahre erstreckt. Er beginnt am Ende der<br />
6. Klasse, wo die Schüler Überlegungen zu ihrer weiteren Schullaufbahn anstellen. In<br />
der 7. Klasse machen sich die Schüler erste Gedanken über den Zusammenhang<br />
von eigener Lebensgestaltung, Arbeit <strong>und</strong> Beruf. Zentrum des Berufsorientierungsprozesses<br />
ist das Betriebspraktikum in den Klassen 8 <strong>und</strong> 9. Daneben finden in den<br />
Klassen 7 bis 9/10 viele weitere schulische Veranstaltungen statt, z. B. praktisches<br />
Arbeiten, die Erk<strong>und</strong>ung des Berufsinformationszentrums, Gespräche mit dem Berufsberater,<br />
Betriebserk<strong>und</strong>ungen usw.<br />
In diesem Berufsorientierungsprozess hat die Schule folgende Aufgaben: Im Unterricht<br />
in den Fächern Arbeit-Wirtschaft-Technik, Technik, Wirtschaft <strong>und</strong> Soziales<br />
werden die Schüler motiviert, ihren Berufswahlprozess selbstständig, eigeninitiativ<br />
<strong>und</strong> eigenverantwortlich zu gestalten; darüber hinaus erhalten die Schüler Orientierungs-<br />
<strong>und</strong> Entscheidungshilfen; es werden ihnen wichtige Informationen zur Verfügung<br />
gestellt, <strong>und</strong> sie werden angeleitet, sich über die Berufs- <strong>und</strong> Arbeitswelt zu<br />
informieren; die Schüler lernen, wie sie die vielen Informationen, Fakten, Beobachtungen,<br />
Eindrücke <strong>und</strong> Erfahrungen ordnen <strong>und</strong> systematisieren können; sie werden<br />
vor allem in den Fächern Technik, Wirtschaft <strong>und</strong> Soziales <strong>und</strong> in den Betriebspraktika<br />
darin unterstützt, ihre eigenen Vorstellungen <strong>und</strong> Ziele zu klären, ihre Neigungen,<br />
Talente, Fähigkeiten <strong>und</strong> Stärken zu entdecken, aber auch sich selbst reflektiert <strong>und</strong><br />
kritisch einzuschätzen <strong>und</strong> eigene Schwächen <strong>und</strong> Grenzen wahrzunehmen.<br />
Der Unterricht leistet so konkrete Hilfe bei der Entwicklung eines Selbstkonzepts für<br />
die die eigne Persönlichkeit.<br />
Alle unterrichtlichen Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass Schüler den Wert <strong>einer</strong><br />
qualifizierten Berufsausbildung erkennen <strong>und</strong> einsehen, wie sehr es in allen Berufen<br />
neben fachlichen Können auch auf soziale <strong>und</strong> personale Kompetenzen ankommt.<br />
Am Ende dieses Prozesses sollen Schüler vorbereitet sein, selbst Verantwortung zu<br />
übernehmen, indem sie sich für den Erstberuf entscheiden <strong>und</strong> schließlich auch erfolgreich<br />
bewerben.<br />
ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 9
Strukturierte Berufsorientierung an der Haupt-/Mittelschule<br />
[Hajek/Schönstetter]<br />
5./6.Jahrgangsstufe Tastschreiben <strong>und</strong> richtiger Umgang am PC<br />
7. Jahrgangsstufe<br />
Sozialkompetenztraining – Softskills im AWT-Unterricht<br />
• Gr<strong>und</strong>lagenvermittlung in den drei berufsorientierenden<br />
Zweigen Technik, Wirtschaft, Soziales – Interesse<br />
wecken<br />
• Eltern- <strong>und</strong> Schülerinfoabend<br />
• Aufnahmegespräch bei der Agentur für Arbeit<br />
• Besuch des Berufsinformationszentrums, BiZmobil<br />
• Technik-Rallye bbw<br />
• Berufsinformationstag z. B. ZöBuS<br />
• Zugangs- <strong>und</strong> Arbeitsplatzerk<strong>und</strong>ung<br />
• Vertiefte Berufsorientierung: Orientierungspraktikum<br />
in <strong>einer</strong> überbetrieblichen Einrichtung<br />
• Projekt: arbeiten <strong>und</strong> wirtschaften für einen Markt<br />
• Berufspaten <strong>und</strong> ggf. „fit for life“<br />
8. Jahrgangsstufe<br />
• Berufsähnliche Tätigkeiten in den berufsorientierenden<br />
Zweigen erproben (Voraussetzungen – Fähigkeiten)<br />
• Vertiefte Berufsorientierung z. B. AiS<br />
• Eltern- <strong>und</strong> Schülerinfoabend<br />
• Berufsberatung<br />
• mindestens 2-3 Wochen Betriebspraktika<br />
• Berufsinformationstag z. B. ZöBuS<br />
• Besuch <strong>einer</strong> Bildungs- bzw. Ausbildungsmesse<br />
• Projekte<br />
• Betriebserk<strong>und</strong>ungen<br />
• Professionelle Unterstützung bei der Bewerbung<br />
• Einbezug von Paten beim Bewerbungsschreiben<br />
9. Jahrgangsstufe<br />
• Bewerbungsbegleitung durch Klassenleiter, Fachlehrer<br />
<strong>und</strong> ggf. Berufspaten<br />
• Berufsberatung<br />
ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 10
Gr<strong>und</strong>sätzliche Überlegungen für einen berufsorientierenden Unterricht<br />
Berufsorientierung = Interaktiver Prozess<br />
Annäherung <strong>und</strong> Abstimmung von:<br />
Interesse, Wünsche,<br />
Wissen <strong>und</strong> Können<br />
der Schüler<br />
Bedarf <strong>und</strong> Anforderung<br />
der Arbeits- <strong>und</strong><br />
Berufswelt<br />
Berufsorientierter Unterricht:<br />
• Möglichkeiten bieten, Fähigkeiten <strong>und</strong> Fertigkeiten zu entdecken <strong>und</strong> zu<br />
entwickeln …<br />
• Reflexionsphasen (Selbst- <strong>und</strong> Fremdeinschätzung)<br />
• Entwickeln eines persönlichen Selbstkonzepts<br />
• Ein vom St<strong>und</strong>enplan festgelegter Wochentag, an dem die Schüler <strong>einer</strong><br />
Jahrgangsstufe in den<br />
„Berufsorientierenden Zweigen“<br />
Technik<br />
Wirtschaft<br />
Soziales<br />
<strong>und</strong> im Fach AWT unterrichtet werden.<br />
Dieser Tag wird als schulischer Praxistag bezeichnet<br />
<strong>und</strong> kann als betrieblicher Praxistag genutzt werden, d.h. der Schüler verbringt<br />
diesen Tag in einem Praktikumsbetrieb.<br />
Der pädagogische Mehrwert des Praxistags<br />
• ermöglicht die Kooperation der AWT- <strong>und</strong> Fachlehrer<br />
(Projektplanung <strong>und</strong> Schülerbeobachtungen)<br />
• Zeit <strong>und</strong> Raum für berufsorientierende Projekte <strong>und</strong> Aktionen.<br />
z. B. Betriebserk<strong>und</strong>ungen, Berufsinformationstag,...<br />
• ermöglicht Organisationsformen z. B. modularer Unterricht,<br />
Semesterlösungen etc., die eine breites <strong>und</strong> vertieftes Angebot für den<br />
Schüler an Berufsorientierung ermöglichen.<br />
ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 11
St<strong>und</strong>enplan <strong>und</strong> Jahresplanung<br />
Beispiel eines St<strong>und</strong>enplans *<br />
Diese Schule hat drei achte Klassen.<br />
Die Belegung der Zweige ergab in<br />
dieser Jahrgangsstufe zwei Kurse<br />
pro Zweig. In der ersten St<strong>und</strong>e<br />
haben die Schüler im Klassenverband<br />
den AWT-Unterricht. Ab der<br />
zweiten St<strong>und</strong>e löst sich der<br />
Klassenverband auf <strong>und</strong> die Schüler<br />
belegen den Unterricht ggf. das<br />
angebotene Modul in dem gewählten<br />
Zweig bzw. Zweigen. Am Nachmittag werden Arbeitsgemeinschaften angboten, die<br />
ebenfalls zur Berufsorientierung beitragen können, so z. B. AP = Altenpflegeheim-<br />
Patenprojekt.<br />
Die Kombination mit der Ganztagesklasse bietet für alle Klassen einen Mehrwert.<br />
A 10 ist z. B. ein Angebot der Geb<strong>und</strong>enen Ganztagesklasse mit berufsorientierenden<br />
Inhalten.<br />
* Das St<strong>und</strong>enplanprogramm verwendet noch die Abkürzungen der alten Fächerbezeichnungen.<br />
Praxistag: Beispiel für eine Jahresübersicht 2007/08<br />
Beispiel: Hauptschule Kümmersbruck [Gräss]<br />
Aktionen <strong>und</strong> Projekte am schulischen Praxistage <strong>und</strong> Betriebspraktika müssen langfristig<br />
festgelegt <strong>und</strong> geplant werden.<br />
Eine Jahresplanung stellt für alle Beteiligten eines Praxistages eine zuverlässige<br />
Planungsgr<strong>und</strong>lage dar:<br />
►für Schüler<br />
►für Lehrkräfte<br />
►für Schulleitung<br />
►für externe Partner (z. B. Betriebe)<br />
In der Jahresplanung müssen auch Schulwochen ohne Praxistag eingeplant werden.<br />
Wochenende Ferien 154 Schultage Praxistage <strong>und</strong> Praktika<br />
ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 12
Fremd- <strong>und</strong> Selbsteinschätzung – Abgleich durch Schülerbeobachtungen<br />
Beispiel Hauptschule Ampfing<br />
[Hajek]<br />
Ein berufsorientierender Unterricht bietet dem Schüler ein<br />
breites Angebot an Informationen, Fakten, Beobachtungen,<br />
Eindrücke <strong>und</strong> Erfahrungen. Diese müssen geordnet <strong>und</strong><br />
systematisiert werden. Der Schüler muss lernen, sich selbst zu<br />
reflektieren <strong>und</strong> sich selbst kritisch einzuschätzen. Nach<br />
berufsorientierenden Veranstaltungen, Aktionen, Projekten<br />
<strong>und</strong> vor allem Praktika dienen Reflexionsbögen z. B. „Meine<br />
persönliche Auswertung“ dazu, ein „Selbstkonzept“ zu<br />
entwickeln. Diese Auswertung soll der Schüler dann in<br />
seinen Berufswahlpass aufnehmen.<br />
Bescheinigungen <strong>und</strong> Zertifikate geben dem Schüler<br />
Rückmeldung über seine Kompetenzen. Die Kompetenzen<br />
sollen den individuellen Stand des Schülers<br />
aufzeigen. Der Schüler soll dadurch seine eigenen<br />
Stärken <strong>und</strong> Schwächen erkennen.<br />
Die unterschiedlichen Rückmeldungen<br />
<strong>und</strong> Auswertungen<br />
bündelt der Klassenlehrer in<br />
seinen Schülerbeobachtungen/-<br />
beurteilungen, damit er den<br />
Schüler kompetent beraten<br />
bzw. begleiten kann.<br />
ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 13