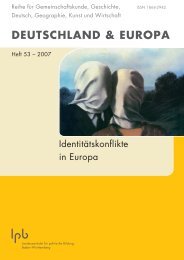deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zeitschrift für Gemeinschaftskunde, Geschichte, ISSN 1864-2942<br />
Deutsch, Geographie, Kunst und Wirtschaft<br />
DEUTSCHLAND & EUROPA<br />
Heft 65 – 2013<br />
Bürgerbeteiligung in<br />
Deutschland und Europa
Zeitschrift für Gemeinschaftskunde, Geschichte, Deutsch,<br />
Geographie, Kunst und Wirtschaft<br />
DEUTSCHLAND & EUROPA<br />
HEFT 65–2013<br />
»Deutschland & Europa« wird von der Landeszentrale<br />
für politische Bildung Baden-Württemberg<br />
herausgegeben.<br />
DIREKTOR DER LANDESZENTRALE<br />
Lothar Frick<br />
REDAKTION<br />
Jürgen Kalb, juergen.kalb@lpb.bwl.de<br />
REDAKTIONSASSISTENZ<br />
Sylvia Rösch, sylvia.roesch@lpb.bwl.de<br />
BEIRAT<br />
Günter Gerstberger, Robert Bosch Stiftung GmbH,<br />
Stuttgart<br />
Renzo Costantino, Ministerialrat, Ministerium für Kultus,<br />
Jugend und Sport<br />
Prof. Dr. emer. Lothar Burchardt, Universität Konstanz<br />
Dietrich Rolbetzki, Oberstudienrat i. R., Filderstadt<br />
Lothar Schaechterle, Professor am Staatlichen Seminar<br />
für Didaktik und Lehrerbildung Esslingen/Neckar<br />
Dr. Beate Rosenzweig, Universität Freiburg und<br />
Studien haus Wiesneck<br />
Dr. Georg Weinmann, Studiendirektor, Dietrich-<br />
Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim<br />
Lothar Frick, Direktor der Landeszentrale für politische<br />
Bildung<br />
Jürgen Kalb, Studiendirektor, Landeszentrale für<br />
politische Bildung<br />
ANSCHRIFT DER REDAKTION<br />
Stafflenbergstraße 38, 70184 Stuttgart<br />
Telefon: 0711.16 40 99-45 oder -43;<br />
Fax: 0711.16 40 99-77<br />
Die Teilnehmer des »Filderdialogs« am Samstag, den 16.06.2012 in Leinfelden-Echterdingen.<br />
Beim Filderdialog berieten Bürgerinnen und Bürger sowie Experten/-innen über mögliche alternative<br />
Stuttgart-21-Trassenvarianten rund um den Landesflughafen in Leinfelden-Echterdingen.<br />
Während die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg diese Form der Bürgerbeteiligung<br />
positiv bewertete, beurteilte z.B. die Bürgerinitiative »Schutzgemeinschaft Filder« oder der<br />
»BUND« diese überwiegend kritisch.<br />
© Franziska Kraufmann dpa/lsw<br />
Kontroverse Diskussion um den »Filderdialog«:<br />
Stellungnahme der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeiteiligung der badenwürttembergischen<br />
Landesregierung, Gisela Erler: www.stm.baden-wuerttemberg.de/de/<br />
Meldungen/ 285478.html?referer=225359&template=min_meldung_html&_min=_stm<br />
Stellungnahme der »Schutzgemeinschaft Filder« und des »BUND«: www.schutzgemeinschaftfilder.de/presse/presse-anzeige/article/schutzgemeinschaft-und-bund-empoert-ueber-umgangmit-filderdialog-votum-beide-erklaeren-austritt-a/<br />
Weiterführende Informationen auf der Website des »Filderdialogs 21«<br />
www.filderdialog-s21.de<br />
SATZ<br />
Schwabenverlag Media der Schwabenverlag AG<br />
Senefelderstraße 12, 73760 Ostfildern-Ruit<br />
Telefon: 0711.44 06-0, Fax: 0711.44 06-179<br />
DRUCK<br />
Süddeutsche Verlagsgesellschaft Ulm mbH<br />
89079 Ulm<br />
Deutschland & Europa erscheint zweimal im Jahr.<br />
Preis der Einzelnummer: 3,– EUR<br />
Jahresbezugspreis: 6,– EUR<br />
Auflage 17.000<br />
Namentlich gezeichnete Beiträge geben nicht die<br />
Meinung des Herausgebers und der Redaktion wieder.<br />
Für unaufgefordert eingesendete Manuskripte<br />
übernimmt die Redaktion keine Haftung.<br />
Nachdruck oder Vervielfältigung auf elektronischen<br />
Datenträgern sowie Einspeisung in Datennetze nur mit<br />
Genehmigung der Redaktion.<br />
Mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für<br />
Kultus, Jugend und Sport sowie der Heidehof Stiftung.<br />
THEMA IM FOLGEHEFT 66 (NOVEMBER 2013)<br />
Erweiterungs- und Austrittsdiskussionen<br />
in der Europäischen Union
Inhalt<br />
Inhalt<br />
Bürgerbeteiligung in Deutschland und<br />
Europa<br />
Vorwort des Herausgebers . ................................................. 2<br />
Geleitwort des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport . ............................ 2<br />
1. Bürgerbeteiligung im europäischen Mehr ebenensystem – Chancen und Grenzen Jürgen Kalb 3<br />
2. Auf dem Weg zur Mitmachdemokratie: Gemeinsam gestalten – Bürgerbeteiligung lebt<br />
vom Mitmachen Gisela Erler. .......................................... 10<br />
3. Entwicklungen der partizipativen Demokratie in Europa Patrizia Nanz | Jan-Hendrik<br />
Kamlage. ........................................................ 12<br />
4. Bürgerbeteiligung und soziale Gleichheit: Zwei Prinzipien im Spannungs feld von Utopie<br />
und Wirklichkeit am Beispiel Deutschland Oscar W. Gabriel. .................... 20<br />
5. Die europäische Bürgerinitiative und die Möglichkeiten und Grenzen der<br />
Bürgerbeteiligung in der EU Franz Thedieck ................................ 26<br />
6. Mehr Demokratie? Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa von<br />
1945–1990 Andreas Grießinger ....................................... 34<br />
7. Soziale Medien und das Partizipationsparadox Jan-Hinrik Schmidt. ............... 46<br />
1<br />
8. Wahlalter 16? »Nichts ist aktivierender als die Aktivität selbst« D&E-Interview mit<br />
Prof. Dr. Klaus Hurrelmann zum »Wahlalter mit 16«. .......................... 54<br />
9. »Wahlalter 16« – eine Chance zur Überwindung der Politikverdrossenheit? D&E-Interview<br />
mit Dr. Jan Kercher, Universität Stuttgart-Hohenheim .......................... 58<br />
10. »Projekt Grenzen-Los!« Trinationale Zusammenarbeit für eine Engagement kultur <br />
Jeannette Behringer. ................................................ 68<br />
Deutschland & Europa intern<br />
D&E – Autorinnen und Autoren – Heft 65 .................................... 72<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Inhalt
Vorwort<br />
des Herausgebers<br />
Geleitwort<br />
des Ministeriums<br />
2<br />
Unser repräsentativ-demokratisches System befindet sich, so<br />
scheint es jedenfalls im Moment, in einem tiefgreifenden Wandel.<br />
Auf der einen Seite verlieren insbesondere die politischen Parteien<br />
zunehmend an Vertrauen und an Mitgliedern, auf der anderen<br />
Seite werden von großen Teilen der Bevölkerung direkte<br />
Formen der Demokratie wie z.B. Bürgerbegehren oder Volksentscheide,<br />
zumindest aber eine stärkere »Bürgerbeteiligung« eingefordert.<br />
Nach einer repräsentativen Umfrage der Bertelsmann Stiftung<br />
aus dem Jahre 2011 wünschen sich 81 Prozent der befragten Bürger<br />
mehr Beteiligungs- und Mitsprachemöglichkeiten im politischen<br />
Prozess. Gefragt nach der grundsätzlichen Bereitschaft,<br />
sich über Wahlen hinaus z.B. an Diskussionsforen, Bürgerbegehren<br />
oder Anhörungen zu beteiligen, zeigten sich 60 Prozent bereit,<br />
sich stärker einzubringen. 85 Prozent der Bürger in Deutschland<br />
stimmten der Aussage zu, dass politische Entscheidungen<br />
durch mehr Bürgerbeteiligung eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung<br />
fänden. Schließlich sagten 76 Prozent der Befragten,<br />
Deutschland würde durch mehr Bürgerbeteiligung gerechter.<br />
Empirische Untersuchungen zeigen allerdings auch, dass sich bildungsferne<br />
Gruppen keineswegs von allen Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten<br />
über demokratische Wahlen hinaus in gleichem<br />
Maße angesprochen fühlen wie etwa die Bürgerinnen und Bürger<br />
mit höherer formaler Bildung. Die Forderung nach »mehr Bürgerbeteiligung«<br />
könnte deshalb sogar zu Verzerrungen bei der Erhebung<br />
des Volkswillens im demokratischen Meinungs- und Willensbildungsprozess<br />
führen.<br />
Gleichzeitig wächst in einer modernen Industriegesellschaft fast<br />
täglich die Notwendigkeit, etwa durch die Erneuerung der Infrastruktur<br />
im Energie-, Verkehrs- oder Schulwesen, in den Alltag der<br />
Menschen einzugreifen.<br />
Deshalb reift auch bei den gewählten Repräsentanten die Einsicht:<br />
Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger merken, dass sie<br />
frühzeitig informiert, offen angehört und ihre Argumente verstanden<br />
werden, lässt sich eine höhere Identifikation, wenn nicht<br />
sogar die Verantwortungsübernahme zumal der jungen Bürgerinnen<br />
und Bürger für das Gemeinwohl erreichen.<br />
Voraussetzung und Grundlage für eine, wenn man so will, »Partizipationskompetenz«<br />
der Bürgerinnen und Bürger ist dabei stets<br />
eine sachliche, die kontroversen Standpunkte der Beteiligten berücksichtigende<br />
politische Bildung.<br />
15. März 2013<br />
Lediglich 42 % der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen<br />
Union sind der Meinung, dass ihre Stimme in der Union zählt. Und<br />
nur die Hälfte aller EU-Bürgerinnen und -Bürger sind mit der Art<br />
und Weise, wie Demokratie auf europäischer Ebene aktuell funktioniert,<br />
zufrieden (Eurobarometer 77.4, 2012). Diese Ergebnisse<br />
sind bedenklich und signalisieren deutlich Handlungsbedarf, um<br />
das Vertrauen der Menschen in die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit<br />
der Europäischen Union zu stärken.<br />
Richtig ist aber auch: Bürgerinnen und Bürger engagieren sich<br />
mehr denn je und suchen nach neuen Wegen der Mitwirkung und<br />
der politischen Partizipation. Die Europäische Union hat das Jahr<br />
2013 zum »Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger« erklärt<br />
und trägt damit der Tatsache Rechnung, dass der wichtigste<br />
Baustein einer modernen Demokratie die Beteiligung von Bürgerinnen<br />
und Bürgern an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen<br />
ist. Die Bürgerbeteiligung gibt Menschen<br />
unterschiedlichster Herkunft und politischer Überzeugung die<br />
Möglichkeit, Politik zu erleben und mitzugestalten. Eine lebendige<br />
Gesellschaft braucht aktive Bürgerinnen und Bürger, die das<br />
Zusammenleben gestalten wollen, das Wort ergreifen, sich verantwortlich<br />
zeigen und sich einbringen. Dies gilt auf Ebene der<br />
Einzelstaaten, und dies hat auch für das Zusammenleben in Europa<br />
Gültigkeit.<br />
Die aktuelle Ausgabe von »Deutschland & Europa« gibt einen gelungenen<br />
Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung<br />
im europäischen System und beleuchtet das Thema<br />
aus vielfältigen Blickwinkeln. Die Bandbreite reicht von einer historischen<br />
Betrachtung der zivilgesellschaftlichen Bewegungen in<br />
Deutschland und Europa bis hin zur aktuellen Diskussion zur Absenkung<br />
des Wahlalters auf 16 Jahre. Damit bietet das Heft eine<br />
ideale Grundlage für eine differenzierte Auseinandersetzung mit<br />
einem für die Zukunft Europas entscheidend wichtigen Themenkomplex.<br />
Lothar Frick<br />
Direktor<br />
der Landeszentrale<br />
für politische Bildung<br />
in Baden-Württemberg<br />
Jürgen Kalb, LpB,<br />
Chefredakteur von<br />
»Deutschland & Europa«<br />
Renzo Costantino<br />
Ministerium für<br />
Kultus, Jugend und Sport<br />
in Baden-Württemberg<br />
Vorwort & Geleitwort<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
BÜRGERBETEILIGUNG IN DEUTSCHLAND UND EUROPA<br />
1. Bürgerbeteiligung im europäischen<br />
Mehr ebenensystem – Chancen und<br />
Grenzen<br />
JÜRGEN KALB<br />
Die Europäische Union hat das Jahr 2013<br />
zum »Europäischen Jahr der Bürgerinnen<br />
und Bürger« erklärt. Verbunden damit<br />
ist die Aufforderung, sich über die Zukunft<br />
der EU, die »EU 2020«, auf allen exekutiven<br />
und legislativen Ebenen, aber auch in der<br />
Zivilgesellschaft und in der Geschäftswelt<br />
öffentlich auszutauschen. Zudem werden,<br />
so heißt es, die Bürgerinnen und Bürger<br />
auf den nationalen, regionalen oder lokalen<br />
Ebenen aufgefordert, sich zu artikulieren<br />
und sich zu beteiligen, sollen neue<br />
Wege der Bürgerbeteiligung gesucht, ausprobiert<br />
und etabliert werden. Dies geht<br />
einher mit Bestrebungen in einzelnen Bundesländern,<br />
wie z. B. Baden-Württemberg,<br />
und Kommunen, mehr »Bürgerbeteiligung<br />
zu wagen«. Doch was ist substantiell an<br />
dieser »Wende hin zu den Bürgerinnen und<br />
Bürgern«? Sind es gar nur Alibianhörungen<br />
in einem zu erstarren drohenden repräsentativ-demokratischen<br />
»europäischen<br />
Mehr ebenensystem«, das nicht selten als<br />
fernes »bürokratisches Monster Brüssel«<br />
karikiert wird? Das Ansehen der demokratisch gewählten Vertreterinnen<br />
und Vertreter ist jedenfalls, das zeigen nahezu<br />
alle nationalen sowie <strong>europa</strong>weiten Befragungen, auf einem<br />
Tiefpunkt angelangt. Ob sich durch mehr Bürgerbeteiligung<br />
eine Trendwende einleiten ließe, bleibt bislang sicher eine offene<br />
Frage. Optimisten sehen in der Etablierung von »formellen<br />
und informellen Formen der direkten Partizipation« bereits<br />
Alternativen bzw. Ergänzungen zum parlamentarischen<br />
System. Skeptiker warnen dagegen vor allzu viel Euphorie, ja<br />
sehen darin sogar die Gefahr, dass formelle und informelle<br />
Anhörungen der Bürgerinnen und Bürger das parlamentarische<br />
System und die Verantwortlichkeit der demokratisch legitimierten<br />
Repräsentanten aushöhlen und letzten Endes,<br />
fänden die Befragungen dann doch wenig Gehör, zu noch<br />
mehr Frustration und Misstrauen führen könnten. Letztlich<br />
sei die Partizipationsbereitschaft auch keineswegs auf alle<br />
Bevölkerungsgruppen gleichmäßig verteilt, was zu extremen<br />
Verzerrungen in der politischen Meinungs- und Willensbildung<br />
führen müsse. Andererseits sind sich alle Beteiligten<br />
schnell darin einig, dass ohne die Zustimmung seiner Bürgerinnen<br />
und Bürger ein so komplexes System wie das transnationale<br />
Mehrebenensystem der Europäischen Union auf Dauer<br />
nicht funktionieren kann. Das Anwachsen von Kräften, die<br />
sich für eine Renationalisierung einsetzen, lässt sich heute<br />
bereits in manchen Mitgliedstaaten beobachten.<br />
Warum ein »Europäisches Jahr<br />
der Bürgerinnen und Bürger«?<br />
Abb. 1 »Ist das nicht das Bürokratie-Monster? …« © Gerhard Mester, 20.1.2013<br />
Europakritische Stimmen melden sich nicht nur in den Medien<br />
und an den Stammtischen in zunehmendem Ausmaße. In zahlreiche<br />
Mitgliedstaaten sitzen heute bereits <strong>europa</strong>kritische Parteien<br />
in den Parlamenten. Dies sollte auch in Deutschland nicht<br />
bagatellisiert werden, auch wenn es hierzulande (noch) keine explizit<br />
populistisch-<strong>europa</strong>kritische Partei in den Parlamenten<br />
gibt. Schon in Großbritannien sieht es anders aus. So kündigte zu<br />
Beginn des Jahres 2013 der britische Premierminister David Cameron<br />
an, im Jahre 2017 ein Referendum über die weitere Mitgliedschaft<br />
des Vereinigten Königreichs in der EU durchführen zu<br />
lassen. Und Meinungsforscher sehen im Moment sogar eine<br />
Mehrheit bei jenen Briten, die einen Austritt aus der EU befürworten.<br />
In den Niederlanden, in Finnland, in Österreich, um nur einige<br />
Länder zu nennen, eroberten <strong>europa</strong>kritische Parteien<br />
längst enorme Prozentpunkte bei Parlamentswahlen.<br />
Insbesondere nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise<br />
sowie in der Folge der Staatsschuldenkrise in den PIIGS-Staaten<br />
(Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien), oft auch abgekürzt<br />
»Euro-Krise« genannt, scheinen jene Recht zu bekommen,<br />
die schon längst behaupten, dass die Problemlösungskapazität<br />
der Europäischen Union nicht ausreiche, die aktuellen<br />
Herausforderungen zu bewältigen. Als Krisenbewältiger erscheinen<br />
in den Medien und damit auch in den Augen der meisten Bürgerinnen<br />
und Bürger dabei auch in erster Linie die Staats- und<br />
Regierungschefs der großen EU-Mitgliedstaaten, die in nächtelangen<br />
Konferenzen um Kompromisse ringen. Als weiterer Agent<br />
neben dem Europäischen Rat erscheinen in den Medien höchstens<br />
noch die Vertreter der Europäischen Kommission. Vom Europaparlament<br />
war dagegen in diesen Krisenmonaten wenig zu lesen,<br />
zu hören oder zu sehen. Schon ist die Rede vom weiteren<br />
»Legitimationsverlust« der EU. Die »Effektivität« der beschlossenen<br />
Kompromisse wird schon länger angezweifelt.<br />
Umstrittene EU-Richtlinien aus den Reihen der EU-Kommission<br />
erzeugen zudem den Eindruck einer Regelungswut aus Brüssel,<br />
die an den Bedürfnissen der einzelnen Bürgerinnen und Bürger<br />
3<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Bürgerbeteiligung im europäischen Mehr ebenensystem – Chancen und Grenzen
4<br />
JÜRGEN KALB<br />
vor Ort vollkommen vorbei gehe. Als Beispiel<br />
sei hier nur die sog. »Wasser-Richtlinie« genannt,<br />
die inzwischen durch öffentlichen<br />
Druck wieder zurück genommen wurde. Unter<br />
der Überschrift des »Europäischen Semesters«<br />
sind es dann wiederum der »Rat«<br />
und die Kommission, die die Mitgliedstaaten<br />
zur Einhaltung der nationalen Haushaltsdisziplin<br />
bzw. des Fiskalpaktes drängen. Vor allem<br />
in den Krisenstaaten entsteht der Eindruck,<br />
aus »Brüssel« oder »Berlin« werde eine<br />
Austeritäts- oder Sparpolitik diktiert, die den<br />
Bedürfnissen dieser Staaten keineswegs gerecht<br />
werde. Und Jugendarbeitslosigkeitsraten<br />
in den Krisenstaaten von nahe an oder<br />
über 50 % lassen in der Tat <strong>europa</strong>weit aufhorchen.<br />
Andererseits wehren sich zunehmend<br />
Menschen in den nördlichen EU-Mitgliedstaaten<br />
dagegen, »Zahlmeister der EU«<br />
zu werden. Bürgernähe erzeugt beides nicht.<br />
Zwar hat der Lissaboner Vertrag, der seit<br />
2009 als Grundlagen vertrag der EU gilt, die<br />
Rechte des Europaparlaments deutlich ausgeweitet,<br />
dessen Medienpräsenz und damit<br />
öffentliche Beachtung erscheint aber nach<br />
wie vor zumindest bei der Krisenbewältigung<br />
peripher. Selbst dem interessierten Beobachter<br />
des Europaparlaments fällt es schwer einzuschätzen,<br />
welches Gewicht das Europaparlament<br />
im Brüsseler Gesetzgebungsprozess<br />
denn nun wirklich spielt.<br />
2014 stehen erneut Europawahlen an. Und<br />
bereits 2009 war die Wahlbeteiligung mit<br />
<strong>europa</strong>weit rund 43 % keineswegs überzeugend.<br />
Abb. 2<br />
Mit dem »Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger« im Jahr<br />
2013 möchten die Europäische Kommission und die Europaparlamentarier<br />
deshalb rechtzeitig damit beginnen, Wählerinnen und<br />
Wähler für die Europawahlen zu mobilisieren.<br />
Die Europäische Kommission hat dazu neben einer Öffentlichkeitskampagne<br />
mit verschiedenen Webportalen (z. B. http://<strong>europa</strong>.<br />
eu/ citizens-2013/de/home) zudem »Eurobarometer« damit beauftragt<br />
herauszufinden, ob die Bürgerinnen und Bürger in der EU denn<br />
genügend über ihre Rechte als Unionsbürger informiert seien<br />
(Flash Eurobarometer 365 vom Februar 2013, Erhebung November 2012).<br />
Das insgesamt positive Ergebnis kann aber sicher nicht darüber<br />
hinweg täuschen, dass die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger<br />
mit ihren Mitwirkungsrechten auf der europäischen Ebene keineswegs<br />
zufrieden sind.<br />
Bundespräsident Joachim Gauck hat in seiner Rede vom 22.2.2013<br />
einige der seit langem zu hörenden Kritikpunkte an der EU aufgelistet:<br />
»den Verdruss über die sogenannten Brüsseler Technokraten und<br />
ihre Regelungswut, die Klage über mangelnde Transparenz der Entscheidungen,<br />
das Misstrauen gegenüber einem unübersichtlichen Netz von Institutionen<br />
und nicht zuletzt den Unwillen über die wachsende Bedeutung<br />
des Europäischen Rates und die dominierende Rolle des deutsch-französischen<br />
Tandems«. (Joachim Gauck, Europa: Vertrauen erneuern – Verbindlichkeit<br />
stärken, S. 2f., www.bundespraesident.de)<br />
Der Bundespräsident kommt zu dem Schluss, »zu viele Bürger lässt<br />
die Europäische Union in einem Gefühl der Macht- und Einflusslosigkeit<br />
zurück« (S. 2) und weiter unten heißt es: »Die Krise hat mehr als nur<br />
eine ökonomische Dimension. Sie ist auch eine Krise des Vertrauens in das<br />
politische Projekt Europas.«<br />
Gleichzeitig betont Gauck aber auch, dass es, anders noch als im<br />
19. Jahrhundert bei der Nationalstaatenbildung, heute »starke Zivilgesellschaften«<br />
gebe. »Ohne die Zustimmung der Bürger könnte<br />
keine europäische Nation, kann kein Europa wachsen. Takt und Tiefe der<br />
europäischen Integration, sie werden letztlich von den europäischen Bürgerinnen<br />
und Bürgern bestimmt« (ebenda, S. 9).<br />
»Wie hoch ist Ihr Vertrauen in folgende Berufsgruppen?«<br />
© Change, Das Magazin der Bertelsmann Stiftung, Sonderheft 2009; S. 19<br />
Sein Wunschbild für Europa heißt für ihn, »mehr europäische Bürgergesellschaft«<br />
(S. 12). Darunter versteht Gauck auch »eine europäische<br />
Agora, ein gemeinsamer Diskussionsraum für das demokratische Miteinander«<br />
(S. 11). Direkt an die anwesenden Schülerinnen und Schüler<br />
gewandt führt er aus:<br />
»Wir brauchen heute ein erweitertes Modell. Vielleicht könnten ja unsere<br />
Medienmenschen, könnte unsere Medienlandschaft so eine Art <strong>europa</strong>fördernde<br />
Innovation hervorbringen, vielleicht so etwas wie »Arte für alle«<br />
(»Arte« ist ein deutsch-französischer TV-Sender mit kulturellem Anspruch:<br />
J. K.), ein Multikanal mit Internetanbindung, für mindestens 27 Staaten,<br />
28 natürlich, für Junge und Erfahrene, Onliner, Offliner, für Pro-Europäer<br />
und Europa-Skeptiker. Dort müsste mehr gesendet werden als der Eurovision<br />
Song Contest oder ein europäischer Tatort. Es müsste zum Beispiel<br />
Reportagen geben über Firmengründer in Polen, junge Arbeitslose in Spanien<br />
oder Familienförderung in Dänemark. Es müsste Diskussionsrunden<br />
geben, die uns die Befindlichkeiten der Nachbarn vor Augen führten und<br />
verständlich machten, warum sie dasselbe Ereignis unter Umständen<br />
ganz anders beurteilen als wir. Und in der großen Politik würden dann<br />
nach einem Krisengipfel die Türen aufgehen und die Kamera würde nicht<br />
nur ein Gesicht suchen, sondern die gesamte Runde am Verhandlungstisch<br />
einblenden. Ja, ob nun mit oder ohne einen solchen TV-Kanal: Wir brauchen<br />
eine Agora. Sie würde Wissen vermitteln, europäischen Bürgersinn<br />
entwickeln helfen und auch Korrektiv sein, wenn nationale Medien in nationalistische<br />
Töne verfallen, ohne Sensibilität oder Sachkenntnis, über<br />
den Nachbarn berichten und Vorurteile fördern. Ich weiß, dass viele Medienkonzerne<br />
die europäische Öffentlichkeit schon zu stimulieren versuchen,<br />
mit Beilagen aus anderen Ländern, mit Schwerpunktthemen zu Europa<br />
und vielen guten Ideen. Ich weiß das. Aber bitte mehr davon – mehr<br />
Berichterstattung über und mehr Kommunikation mit Europa!<br />
Wir sprechen gerade über Kommunikation. Kommunikation ist für mich<br />
kein Nebenthema des Politischen. Eine ausreichende Erläuterung der Themen<br />
und Probleme, sie ist vielmehr selbst Politik. Eine Politik, die mit der<br />
Mündigkeit der Akteure auf der Agora rechnet und sie nicht als untertänig,<br />
desinteressiert und unverständig abtut. Mehr Europa heißt für mich:<br />
Bürgerbeteiligung im europäischen Mehr ebenensystem – Chancen und Grenzen<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
mehr europäische Bürgergesellschaft. Ich<br />
freue mich daher, dass 2013 das Europäische<br />
Jahr der Bürgerinnen und Bürger ist.«<br />
(ebenda, S. 12)<br />
Gauck weist dabei in seiner Rede ausdrücklich<br />
auf das von Ulrich Beck und<br />
Daniel Cohn-Bendit initiierte Manifest<br />
»Wir sind Europa! Manifest zur Neugründung<br />
Europas von unten.« (http://manifest-<strong>europa</strong>.eu/allgemein/<br />
wir-sind-<strong>europa</strong>?lang=de) hin, wenn er<br />
auch nicht allen aufgestellten Forderungen<br />
zustimmen möchte. Im Manifest<br />
heißt es:<br />
»Wir, die Erstunterzeichnenden, möchten<br />
der europäischen Bürgergesellschaft eine<br />
Stimme geben. Wir fordern deshalb die<br />
Europäische Kommission und die nationalen<br />
Regierungen, das Europäische Parlament<br />
und die nationalen Parlamente dazu<br />
auf, ein Europa der tätigen Bürger zu<br />
schaffen und sowohl die finanziellen wie<br />
auch rechtlichen Voraussetzungen für ein<br />
Freiwilliges Europäisches Jahr für alle bereitzustellen<br />
– als Gegenmodell zum Europa<br />
von oben, dem bisher vorherrschenden<br />
Europa der Eliten und Technokraten. Europa droht zu scheitern an der<br />
unausgesprochenen Maxime der Europapolitik, das Glück des europäischen<br />
Bürgers notfalls auch gegen seinen Willen zu schmieden. Es geht<br />
darum, die nationalen Demokratien europäisch zu demokratisieren und<br />
auf diese Weise Europa neu zu begründen. Nach dem Motto: Frage nicht,<br />
was Europa für dich tun kann, frage vielmehr, was du für Europa tun<br />
kannst – Doing Europe!«<br />
Wenn auch der deutsche Bundespräsident sich nicht gleich der<br />
Forderung des Manifests nach einem »von der EU finanzierten europäischen<br />
Freiwilligendienst« anschließen möchte, so hegt er<br />
doch Sympathien für die Forderungen nach einer »EU von unten«,<br />
nach der Unterstützung und Organisation von mehr Bürgerbeteiligung<br />
in Europa, auf allen Ebenen.<br />
Das Instrument der<br />
»Europäischen Bürgerinitiative«<br />
Abb. 3<br />
3. DIE EUROPÄISCHE BÜRGERINITIATIVE (EBI)<br />
Umweltpolik<br />
Verbraucherschutz<br />
Steuerfragen<br />
Grundrechte der EU-Bürger<br />
Altersversorgung<br />
Bildungsfragen<br />
Arbeits- und Beschäigungspolik<br />
Nationaler Bericht - Deutschland<br />
»In welchen Bereichen würden Sie die Europäische Bürgerinitiative am ehesten nutzen?«<br />
© EU-Kommission: Standard Eurobarometer 78/Herbst 2012 – TNS Opinion & Social<br />
19%<br />
Bürgerbeteiligung lässt sich im transnationalen europäischen<br />
Mehrebenensystem sicher nur sehr unterschiedlich für die politische<br />
Willensbildung nutzbar machen. Am häufigsten werden die<br />
unterschiedlichen Modelle der »formellen oder informellen Bürgerbeteiligung«<br />
sicher auf regionaler oder lokaler Ebene organisiert<br />
und praktiziert. Professorin Dr. Patrizia Nanz und Dr. Jan-<br />
Hendrik Kamlage haben dazu in der vorliegenden Ausgabe von<br />
D&E in ihrem Beitrag »Entwicklungen der partizipativen Demokratie in<br />
Europa« einige anschauliche Beispiele vorgestellt. Im sich anschließenden<br />
Materialteil wird zudem mit Zeitungsberichten zu<br />
Praxisbeispielen aus Süd<strong>deutschland</strong> das durchaus unterschiedliche<br />
Presseecho auf solche Bürgerbeteiligungsformen deutlich.<br />
Zuvor beschreibt die »Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung«<br />
der baden-württembergischen Landesregierung,<br />
Gisela Erler, in ihrem Beitrag: »Auf dem Weg zur Mitmachdemokratie:<br />
Gemeinsam gestalten – Bürgerbeteiligung lebt vom Mitmachen« die<br />
diesbezüglichen Vorhaben der grün-roten Landesregierung. Für<br />
die Landesregierung soll die verstärkte Bürgerbeteiligung gar zu<br />
einem zentralen Vorgehen in ihrer Regierungsarbeit werden.<br />
Professor em. Dr. Oscar W. Gabriel von der Universität Stuttgart<br />
sieht die Bürgerbeteiligungsprojekte, wozu er auch z. B. Volksabstimmungen<br />
rechnet, in einem Zielkonflikt: »Bürgerbeteiligung und<br />
soziale Gleichheit: Zwei Prinzipien im Spannungsfeld von Utopie und<br />
Wirklichkeit.« Am Beispiel Deutschlands zeigt er, auf empirische<br />
Daten gestützt, welche Personengruppen sich bislang noch wenig<br />
durch partizipative Bürgerbeteiligungsformen angezogen<br />
fühlen: Es sind dies vor allem die weniger Gebildeten und die<br />
Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch tendenziell die<br />
jungen Menschen.<br />
Auf europäischer Ebene sieht der Lissaboner Vertrag übrigens<br />
auch ein diesbezügliches Instrument vor, das seit April 2012 auch<br />
aktiv gestartet wurde. Es ist die sogenannte »Europäische Bürgerinitiative«,<br />
die durch transnationale Unterschriftensamm lungen<br />
von mehr als einer Million in mindestens sieben EU- Mitgliedstaaten<br />
die EU-Kommission, die bislang allein das Gesetztesinitiativrecht<br />
besitzt, zwingen kann, sich mit der jeweiligen Initiative (erneut)<br />
zu befassen.<br />
Prof. Dr. Franz Thedieck von der Hochschule Kehl stellt in dieser<br />
Ausgabe von D&E dieses transnationale Instrument einer Mitwirkung<br />
von Bürgerinnen und Bürger der EU auf den Gesetzgebungsprozess<br />
anhand der konkreten Bestimmungen, anhand der<br />
Interviews und beispielhafter Initiativen vor: »Die Europäische Bürgerinitiative<br />
und die Möglichkeiten und Grenzen der Bürgerbeteiligung in<br />
der EU.«<br />
Und tatsächlich hat bereits mindestens eine erste Europäische<br />
Bürgerinitiative, so wurde noch im Februar 2013 in der Presse gemeldet,<br />
das notwendige Quorum erreicht. Es handelt sich dabei<br />
um die Initiative »Right2Water«, die sich gegen eine EU-Richtlinie<br />
zur geplanten Pflicht der öffentlichen Ausschreibung der Wasserversorgung<br />
richtet. Zumindest in Deutschland war der Widerstand<br />
dagegen groß, befindet sich hier doch noch immer ein<br />
Großteil der Wasserversorgung in kommunaler Hand. Kritiker sehen<br />
in dieser Initiative der EU-Kommission ein Plädoyer für die<br />
Privatisierung eines öffentlichen Gutes. Wenn auch der – in dieser<br />
Ausgabe von D&E dokumentierte – Weg der Initiative noch nicht<br />
beendet ist, so hat doch der zuständige EU-Kommissar Michel<br />
Barnier bereits angekündigt, die geplante EU-Richtlinie nicht weiter<br />
– zumindest im ursprünglich geplanten Umfang – zu verfolgen.<br />
Dabei ist die EU-Bürgerinitiative gegen die Wasserprivatisierung<br />
nicht die einzige initiierte Unterschriftensammlung. Ein<br />
eigenes Webportal der EU sorgt hier für die nötige Transparenz.<br />
Transparenz und Partizipation –<br />
neue Möglichkeiten mit Hilfe des Internets<br />
Jan-Hinrik Schmidt beschreibt in seinem Beitrag: »Soziale Medien<br />
und das Partizipationsparadox«, welche Möglichkeiten, aber auch<br />
20%<br />
20%<br />
22%<br />
22%<br />
QD8: In welchen Bereichen<br />
würden sie die Europäische<br />
Bürgerinitiative am ehesten<br />
nutzen ? / EU<br />
24%<br />
38%<br />
5<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Bürgerbeteiligung im europäischen Mehr ebenensystem – Chancen und Grenzen
6<br />
JÜRGEN KALB<br />
Gefahren neue Kommunikationstechnologien<br />
für die Bürgerbeteiligung bieten. Nicht<br />
wenige, vor allem junge Menschen, verstehen<br />
sich als sogenannte »Digital Natives«, als<br />
nach Transparenz und Beteiligung gierende<br />
Staatsbürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig<br />
gilt vielen von ihnen das tradierte repräsentative<br />
System als zu starr, wenn nicht als<br />
gänzlich überholt. Unter »politischem Engagement«<br />
und »Bürgerbeteiligung« wird in<br />
dieser Gruppe unter Umständen etwas anderes<br />
verstanden: Diskussionen mit möglichst<br />
allen Beteiligten unter »Twitter«, persönliche<br />
Portale bei z. B. »Facebook« und individualisierte<br />
»Blogs« mit Kommentaren von den jeweiligen<br />
»Followern«. Max Winde hat mit seinem<br />
Blog »Ihr werdet euch noch wünschen,<br />
wir wären politikverdrossen« diesem Milieu<br />
eine sprechende Stimme gegeben. Zeitweise<br />
schien es auch so, als ob dieses Milieu durch<br />
die »Piratenpartei« sich nicht nur politisch<br />
organisieren, sondern auch breitere Kreise<br />
der vor allem jungen Bevölkerung in ihren<br />
Bann ziehen könnte. Bei regionalen Wahlen<br />
erzielten die »Piraten« Achtungserfolge und<br />
zogen gleich in drei Länderparlamente ein.<br />
Die erste Strahlkraft der »Piraten«, so zeigen<br />
es jedenfalls die demoskopischen Umfragen, scheint jedoch<br />
inzwi schen wieder etwas verblasst. An der radikalen Forderung<br />
nach »umfassender Transparenz« scheinen die inhaltlichen Debatten<br />
und programmatischen Findungsprozess ebenso wie<br />
wichtige personelle Entscheidungen derzeit in Mitleidenschaft zu<br />
geraten. Dennoch bleibt spannend zu beobachten, ob die »Digital<br />
Natives« politisch eine »Heimat« finden werden und wie sich<br />
solch eine Organisation zum etablierten repräsentativen politischen<br />
System stellen wird (| Abb. 4 |).<br />
»Mobilisierung der Jugendlichen durch ein<br />
Wahlalter mit 16«?<br />
Abb. 4 »Nirgendwohin! Aber schnell!« (Die »5-Sterne-Bewegung« von Beppo Grillo hatte bei den italienischen<br />
Parlamentswahlen in Italien rund 25 % der Stimmen erzielt. Grillos Partei gilt als »netzaffin« und<br />
kritisch gegenüber dem parlamentarisch-repräsentativen System.) © Gerhard Mester, 27.2.2013<br />
Nicht erst die Untersuchungen der »Bertelsmann Stiftung« (2011)<br />
sowie der »Stiftung für Zukunftsfragen« (2012), auch bereits die<br />
Shellstudien (2002, 2006, 2010) belegen, dass das Vertrauen in<br />
Politiker und insbesondere in die Parteien besorgniserregend<br />
schwindet. Rückläufige Mitgliederzahlen bei den etablierten<br />
Volksparteien sprechen hier eine deutliche Sprache. Aber auch<br />
die anderen Parteien, vielleicht immer noch mit Ausnahme der<br />
»Piraten«, klagen über Nachwuchssorgen.<br />
Insbesondere von Seiten der SPD und den Grünen wird deshalb<br />
versucht, Jugendliche für die Politik dadurch zu interessieren,<br />
dass man ihnen ein aktives Wahlrecht bereits ab 16 zugesteht. Bedenkenträger<br />
dazu äußern sich insbesondere aus den Reihen der<br />
Union.<br />
D&E hat zu dieser Thematik für die vorliegende Ausgabe zwei renommierte<br />
Fachleute befragt: Professor Dr. Klaus Hurrelmann<br />
und Dr. Jan Kercher von der Universität Stuttgart-Hohenheim. In<br />
Baden-Württemberg erhält diese Thematik dadurch Brisanz, da<br />
die grün-rote Landesregierung für die anstehenden Kommunalwahlen<br />
im Mai 2014 ein Wahlrecht ab 16 angekündigt hat. Für die<br />
2016 in Baden-Württemberg wieder anstehenden Landtagswahlen<br />
wäre allerdings eine Verfassungsänderung notwendig, was<br />
ohne die Zustimmung der CDU nicht möglich ist. Die öffentliche<br />
Diskussion über das Thema »Wahlalter 16« steht demnach noch<br />
bevor. In Bremen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist<br />
eine solche Wahlrechtsreform dagegen bereits beschlossen und<br />
umgesetzt worden, ebenso wie z. B. in Österreich. Der Kommunikations-<br />
und Politikwissenschaftler Dr. Jan Kercher geht in seinem<br />
Interview: »Wahlalter 16 – eine Chance zur Überwindung der Politikverdrossenheit?«<br />
ausführlich auf die unterschiedlichen<br />
Argumente pro und contra »Wahlalter 16« ein. Dabei kann er sich<br />
auch auf eigene Untersuchungen und Befragungen Jugendlicher<br />
sowie die Wahlergebnisse mit dem Wahlalter 16 beziehen.<br />
Bereits seit Mitte der neunziger Jahre führte der international renommierte<br />
Bildungsforscher Professor Dr. Klaus Hurrelmann<br />
zahlreiche Jugendstudien, darunter die bekannten Shell-Studien,<br />
durch. In seinem Interview mit dem Redakteur von D&E: »Nichts ist<br />
aktivierender als die Aktivität selbst.« bezieht er sich zunächst auch<br />
auf seine Untersuchungen zum Reifeprozess junger Menschen im<br />
21. Jahrhundert. Hurrelmann plädiert dabei für die Vorverlegung<br />
des Wahlalters, obwohl er in seinen Studien immer wieder feststellen<br />
konnte, dass eine knappe Mehrheit der Jugendlichen<br />
selbst durchaus Skepsis gegenüber dieser Regelung hegt. Hurrelmann<br />
möchte aber nicht nur am Wahlalter ansetzen, sondern die<br />
Bildungspolitik insgesamt zu mehr politischer Bildung, aber auch<br />
zur Erprobung eines demokratischen Miteinanders im Schulalltag<br />
ermutigen. Davon, so Hurrelmann, hänge im Wesentlichen die<br />
Stabilität und Akzeptanz des politischen Systems insgesamt auf<br />
Dauer ab. Mehr Partizipation, d. h. mehr Bürgerbeteiligung,<br />
müsse früh eingeübt und als selbstverständliche Realität erlernt<br />
werden. In Zeiten horrender Jugendarbeitslosigkeitszahlen in den<br />
südlichen Mitgliedstaaten der EU, teilweise nahe an oder bereits<br />
über 50 % einer Generation, seien die politischen Beteiligungschancen<br />
gerade der Jugendlichen essenziell für ein Gemeinwesen.<br />
Ob nun Spanien oder Griechenland, nicht selten wird heute bereits<br />
von einer »verlorenen Generation« (»Lost Generation«) gesprochen<br />
und geschrieben. Landesweite Jugendprotestbewegungen<br />
wie in Spanien, »Echte Demokratie Jetzt!« (»M-15«), oder in<br />
Griechenland, Italien oder Frankreich belegen bereits heute eindrucksvoll,<br />
sowie transnationale NGOs wie die »Occupy-Bewegung«,<br />
dass die Gefahr einer vom herrschenden parlamentarischen<br />
System zutiefst frustrierten »Lost Generation« immer<br />
weniger von der Hand zu weisen ist.<br />
Die historische Perspektive:<br />
Zivilgesellschaftliche Bewegungen nach dem<br />
II. Weltkrieg<br />
Dr. Andreas Grießinger hat in seinem Beitrag: »Mehr Demokratie?<br />
Zivilgesellschaftliche Bewegungen in Deutschland und Europa von 1945–<br />
Bürgerbeteiligung im europäischen Mehr ebenensystem – Chancen und Grenzen<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
1990« eine Bilanz ganz unterschiedlicher<br />
Demokratiebewegungen gezogen.<br />
Dabei gelingt ihm nicht nur eine<br />
eindrucksvolle Analyse ausgewählter<br />
zivilgesellschaftlicher Demokratiebewegungen,<br />
sein ausführlicher Materialteil<br />
dokumentiert auch die jeweils<br />
unterschiedliche Stoß- und<br />
Ausrichtung dieser Strömungen. Ein<br />
moderner Geschichtsunterricht täte<br />
gut daran, diese aktuelle »Geschichte<br />
von unten« in Deutschland und Europa<br />
in Beziehung zu setzen zu den<br />
durch die Regierungen und Parlamente<br />
vereinbarten staatlichen Abkommen<br />
und Verträgen nach 1945 bis<br />
in die Gegenwart. Dabei zeigt sich,<br />
dass die zentrale Frage und Forderungen<br />
nach »Mehr Demokratie« keineswegs<br />
immer so einfach zu beantworten<br />
ist. »Bürgerbeteiligung und<br />
soziale Gleichheit« stehen eben in einem<br />
Spannungsverhältnis, wie Oscar W. Gabriel in seinem Beitrag<br />
für das aktuelle Deutschland ja bereits empirisch untersucht<br />
hat.<br />
Dr. Jeannette Behringer stellt schließlich ein wesentlich von ihr<br />
mit betreutes und von der LpB Baden-Württemberg initiiertes trinationales<br />
Projekt vor. Ihr Beitrag: »Grenzen-Los! Trinationale Zusammenarbeit<br />
für eine Engagementkultur« beschreibt und dokumentiert<br />
die durchaus unterschiedlichen Ansätze von freiwilligem<br />
bzw. bürgerschaftlichem Engagement in Deutschland, Österreich<br />
und der Schweiz. Mehrere Konferenzen zeigten, dass bürgerschaftliches<br />
Engagement in allen drei Ländern eine auch volkswirtschaftlich<br />
beeindruckende Rolle spielt, dass die Rolle staatlicher<br />
Institutionen und Repräsentanten dabei aber durchaus<br />
unterschiedlich gesehen wird. Auffallend ist auch, dass Projekte,<br />
die sich der politischen Beteiligung oder Bildung im engeren<br />
Sinne widmen, in allen untersuchten Ländern eher eine periphere<br />
Rolle spielen. Sollten staatliche Verwaltungen und gewählte Repräsentanten<br />
nicht doch mehr dazu betragen, Bürgerinnen und<br />
Bürger die Möglichkeit zu geben, sich politisch zu beteiligen?<br />
Was bedeutet Bürgerbeteiligung?<br />
Bürgerbeteiligung kann man in Abgrenzung zu Bürgerentscheiden<br />
(z. B. »Wahlen« oder »Volksabstimmungen«, vgl. auch GG<br />
Art 20) als »Mitsprache« oder »Teilhabe« (»Partizipation«) der Bürgerinnen<br />
und Bürger an politischen Planungsprozessen sowie<br />
Entscheidungen definieren.<br />
Die stärksten Formen der Bürgerbeteiligung sind dabei, wenn<br />
man so will, direktdemokratische Verfahren wie z. B. die Bürgerentscheide<br />
oder Volksabstimmungen, die mit zum Teil recht unterschiedlichen<br />
Quoren auf lokaler, regionaler, (in Deutschland<br />
kaum auf) nationaler und bisher gar nicht auf europäischer Ebene<br />
praktiziert werden. Einzelheiten, Vor- und Nachteile der direktdemokratischen<br />
Modelle hat D&E in seiner Ausgabe »Politische<br />
Partizi pation in Europa«, Heft 62, vom November 2011 ausführlich<br />
untersucht. Insbesondere Dr. Otmar Jung hat umfassend die jeweils<br />
unterschiedlichen Regelungen, ihre Vor- und Nachteile in<br />
Deutschland und der Schweiz analysiert und bewertet: »Erfahrungen<br />
mit direkter Demokratie in Deutschland und der Schweiz.« Er plädierte<br />
dabei für die Ergänzung der repräsentativen Demokratie<br />
um direktdemokratische Elemente, wie es die Schweiz seit langem<br />
kennt.<br />
Demgegenüber betonen z. B. Patrizia Nanz und Miriam Fritsche<br />
in ihrem »Handbuch Bürgerbeteiligung. Verfahren und Akteure, Chancen<br />
und Grenzen« (Bonn 2012) ausdrücklich, dass die dort sachlich beschriebenen<br />
Bürgerbeteiligungsformate keineswegs zu einer<br />
Abb. 5 Bürgerbeteiligung und die Dauer von Präsenzverfahren © Nanz/Fritsche, S. 108<br />
»Schwächung der repräsentativen Demokratie« führen sollten.<br />
Sie sind der Überzeugung, dass diese Verfahren den gewählten<br />
Volksvertreterinnen und Volksvertretern allerdings helfen könnten,<br />
eine »verantwortungsbewusste Politik jenseits von Parteidisziplin<br />
und kurzfristigen Wahlkampfinteressen« (S. 133) durchzusetzen.<br />
Ihr Handbuch bietet demgemäß neben einer Darstellung<br />
vielfältiger Bürgerbeteiligungsformate insbesondere auch die<br />
grundsätzliche Reflexion über Chancen und Grenzen von Bürgerbeteiligung.<br />
Bezüglich der Verbindlichkeit der Bürgerbeteiligung werden dabei<br />
zwei unterschiedliche Beteiligungsverfahren unterschieden:<br />
die gesetzlich vorgeschriebenen oder »formellen Beteiligungsverfahren«<br />
sowie die »freiwillige Bürgerbeteiligung«, entweder<br />
organisiert durch die gewählten Repräsentanten (»Top-down-<br />
Verfahren«) oder durch Initiativen der Bürgerinnen und Bürger<br />
selbst (»Bottom-up-Verfahren«). Im Handbuch zur Bürgerbeteiligung<br />
werden die zuerst genannten, also die formellen Beteiligungsverfahren<br />
nicht näher analysiert, also weder Informationsveranstaltungen<br />
mit partizipativem Anstrich noch Verfahren<br />
unter Beteiligung von Interessengruppen, Lobbyistinnen und<br />
Lobbyisten oder professionellen Expertinnen und Experten.<br />
Im Mittelpunkt der analysierten Formate stehen »deliberative<br />
bzw. dialogorientierte Verfahren«, also der Austausch von Argumenten<br />
mit dem Ziel einer gemeinschaftlichen Willensbildung<br />
und idealerweise einer anschließenden konsensualen Entscheidungsfindung.<br />
In organisierten Diskussionen sollen die Beteiligten<br />
alternative Positionen abwägen unter der Prämisse, andere<br />
Standpunkte zu berücksichtigen. Diese zumeist sehr komplexen<br />
Verfahren durchlaufen dabei oft mehrere Runden und sind angewiesen<br />
auf die Unterstützung von Moderatorinnen und Moderatoren<br />
sowie Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis.<br />
Eine erste Unterscheidung könnte dabei die Dauer (| Abb. 5 |),<br />
die Anzahl der Teilnehmenden an den Präsenzverfahren, die Rekrutierung<br />
und Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
(| Abb. 6 |, | Abb. 7 |) sowie die Funktionen der Bürgerbeteiligungsverfahren<br />
(| Abb. 8 |) betreffen.<br />
Häufig komme es jedoch vor, so die Erfahrungen der beiden Autorinnen<br />
Nanz und Fritsche, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
bei Bürgerbeteiligungsformaten mit sehr unterschiedlichen<br />
Erwartungen und Interessen aufeinanderträfen, um sich auch<br />
noch über unklar definierte Themen auszutauschen und zu Ergebnissen<br />
zu gelangen, deren Gültigkeitsbereich und Reichweite<br />
nicht vorab festgelegt wurden.<br />
7<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Bürgerbeteiligung im europäischen Mehr ebenensystem – Chancen und Grenzen
8<br />
JÜRGEN KALB<br />
Abb. 6 Bürgerbeteiligungsformate und die Rekrutierung und Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
© Nanz/Fritsche, S. 115<br />
Abb. 7 Ansätze zur Auswahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Bürgerbeteiligungsverfahren<br />
Selbstselektion: Der Zugang zum Verfahren ist offen für alle. Die Teilnahme ist eine freiwillige Entscheidung.<br />
Selbstselektion führt häufig zur Überrepräsentation »beteiligungsaffiner Milieus«: bildungsnahe Angehörige der<br />
Mittelschicht und Menschen, die über vergleichsweise viel Zeit verfügen wie zum Beispiel Studierende, Seniorinnen<br />
und Senioren. Dieser Ansatz bringt es deshalb häufig mit sich, dass die am stärksten vom Regelungsgegenstand<br />
betroffenen Personen sich auch am stärksten beteiligen. Beispiele: Open-Space, Bürgerhaushalt, Zukunftswerkstatt.<br />
Zufällige Auswahl: Dieser Ansatz kann – theoretisch – die Repräsentativität erhöhen und damit die Dominanz<br />
von Partikularinteressen senken. Doch auch hier besteht die Gefahr überproportionaler Teilnahme beteiligungsaffiner<br />
Gruppen. Durch eine große Stichprobe und gezielte Nachrekrutierung (z. B. anhand demographischer Merkmale)<br />
kann diesem Effekt begegnet werden. Beispiele: Bürgergutachten, Konsensuskonferenzen, Deliberative Poll.<br />
Gezielte Auswahl: Der Verfahrenszugang ist offen, jedoch wird zum Erreichen möglichst hoher Repräsentativität<br />
gezielt versucht, Einzelpersonen oder Vertreterinnen und Vertreter bestimmter Gruppen zu rekrutieren. Dies kann<br />
durch gezielte Ansprache, aber auch durch Anreize (z. B. Aufwandsentschädigung) geschehen. Beispiele: Szenario-<br />
Workshops, Zukunftskonferenzen, Mediationsverfahren.<br />
© Nanz/Kamlage, D&E, Heft 65, 2013 (Vgl. deren Beitrag in dieser Ausgabe von D&E)<br />
Voraussetzungen erfolgreicher<br />
Bürgerbeteiligung<br />
Nach Nanz/Fritsche ließen sich folgende Voraussetzungen für<br />
eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung formulieren:<br />
(1) Beteiligungsverfahren sind angewiesen auf die freiwillige und<br />
in der Regel unentgeltliche Mitwirkung von Bürgerinnen und<br />
Bürgern. Sie engagieren sich in ihrer Freizeit, aus Überzeugung<br />
und mit dem Ziel, einen politischen Entscheidungsprozess<br />
zu beeinflussen. Wenn bei den Teilnehmenden der Eindruck<br />
entsteht, dass ein Verfahren folgenlos bleibt, werden<br />
sie sich rasch enttäuscht abwenden und nicht erneut einbringen.<br />
Um einer solchen Entwicklung vorzubeugen, müssen<br />
Bürgerinnen und Bürger von der Relevanz und Sinnhaftigkeit<br />
der konkreten demokratischen Teilhabe überzeugt<br />
sein.<br />
(2) Echte Bürgerbeteiligung setzt zudem voraus, dass politische<br />
Mandatsträgerinnen und -träger sich von einer reinen Topdown-Politik<br />
verabschieden und die Bereitschaft für einen<br />
souveränen Umgang mit offenen Austausch- und Mitwirkungsprozessen<br />
aufbringen.<br />
(3) Dem Beteiligungsverfahren muss ein klar definiertes Ziel zugrunde<br />
liegen: Soll die demokratische Bildung der Bürgerinnen<br />
und Bürger gestärkt oder die öffentliche Debatte angestoßen<br />
werden? Geht es um eine Beratung von Politik und<br />
Verwaltung oder sollen politische Entscheidungen direkt von<br />
Bürgerinnen und Bürgern beeinflusst werden?<br />
(4) Alle Informationen zum Thema<br />
müssen für die Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer eines Verfahrens<br />
frei und umstandslos zugänglich<br />
sein.<br />
(5) Zugleich müssen sich auch Außenstehende<br />
jederzeit über<br />
Ziele, Auftraggeberinnen und<br />
Auftraggeber, Teilnehmende, deren<br />
Interessen und den Stand des<br />
jeweiligen Verfahrens informieren<br />
können. Eine solche Transparenz<br />
dient einerseits als Möglichkeit<br />
zur Kontrolle, sie schafft<br />
andererseits auch eine breite<br />
Vertrauensbasis.<br />
(6) Die Grenzen der Mitwirkung<br />
und die Frage, in welchen Händen<br />
die Entscheidungshoheit<br />
letztendlich liegt, müssen von<br />
Anfang an feststehen und deutlich<br />
kommuniziert werden.<br />
(7) Initiatorinnen und Initiatoren müssen<br />
dafür Sorge tragen, dass die an<br />
einem Verfahren Teilnehmenden<br />
ein verlässliches Feedback erhalten,<br />
das heißt, es ist öffentlich zu<br />
begründen, welche Ergebnisse des<br />
Beteiligungsverfahrens im weiteren<br />
Entscheidungsprozess berücksichtigt<br />
wur den – und welche nicht<br />
und warum.<br />
(8) Sowohl innerhalb eines Verfahrens<br />
als auch in seiner Außendarstellung<br />
muss Klarheit über die<br />
Rollenaufteilung und die Zuständigkeiten<br />
aller Beteiligten<br />
herrschen (so z. B. Auftraggeber/<br />
innen, Projektleiter/innen, Dienstleister/innen,<br />
wissenschaftliche<br />
Berater/innen, Moderator/innen<br />
und technische Begleiter/innen).<br />
(9) Eine professionelle Durchführung und Moderation des Beteiligungsprozesses<br />
muss gewährleistet sein.<br />
(10) Bürgerinnen und Bürger müssen während des gesamten Prozesses<br />
ernst genommen werden. Die Kommunikation sollte<br />
mit gegenseitiger Wertschätzung und auf Augenhöhe erfolgen.<br />
Es ist sicherzustellen, dass alle vorgetragenen Standpunkte<br />
berücksichtigt und in den weiteren Entscheidungsprozess<br />
einbezogen werden. (nach: Nanz/Fritsche, S. 130f.)<br />
Unter diesen Voraussetzungen geht es bei Bürgerbeteiligung um<br />
»(…) Partizipation durch Artikulation und Einmischung und damit letztlich<br />
um Emanzipation. (…) Sie kann einerseits auf die Erzeugung rationaler<br />
Politikerzeugnisse zielen, sich aber auf der anderen Seite auch der Verringerung<br />
des Abstands zwischen Herrschern und Beherrschten widmen.«<br />
(ebenda, S. 126)<br />
»Fallstricke« und »Stolpersteine«<br />
der Bürgerbeteiligung<br />
Den Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung bestätigte jüngst auch<br />
eine wissenschaftliche Untersuchung der Universität Leipzig (Vgl<br />
Literaturhinweise), die zeigt, dass von den Bürgerinnen und Bürgern<br />
eine stärkere Einbindung insbesondere bei Infrastrukturmaßnahmen<br />
wie dem Bau von Straßen, Behörden, Flugplätzen<br />
oder Stromleitungen gefordert wird. Im Gegensatz zu den ebenfalls<br />
befragten Vertretern von Kommunen bemängelten die Bür-<br />
Bürgerbeteiligung im europäischen Mehr ebenensystem – Chancen und Grenzen<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
gerinnen und Bürger insbesondere,<br />
dass die bislang gesetzlich geregelten<br />
Verfahren der Bürgerbeteiligung<br />
(»Bauleitplanungen«) nicht ausreichten.<br />
Bürgeranliegen würden in der<br />
Regel zu spät erfragt und zu wenig<br />
bis gar nicht berücksichtigt.<br />
Andererseits ergab die Studie auch,<br />
dass die Mehrzahl der Bürgerinnen<br />
und Bürger die bereits bestehenden<br />
Angebote kaum wahrnehme. Ein<br />
Großteil der befragten Haushalte<br />
gab offen an, meist nur bei direkter<br />
persönlicher Betroffenheit aktiv zu<br />
werden. Zudem erwiesen sich solche<br />
Verfahren allzu oft als enorm zeitaufwändig<br />
und kostspielig, klagten insbesondere<br />
die Vertreter der Kommunen<br />
und der Unternehmen.<br />
Bürgerbeteiligungsmodelle drohen<br />
somit vor allem dann zu scheitern,<br />
wenn …<br />
(1) … die Unterstützung seitens der<br />
Abb. 8 Bürgerbeteiligungsformate und ihre Funktionen © Nanz/Fritsche, S. 121<br />
Entscheidungsträgerinnen und -träger fehlt und diese zu<br />
Recht oder Unrecht eine Einschränkung ihrer Ent schei dungsmacht<br />
und Verantwortung fürchten;<br />
(2) … kein tatsächlicher Gestaltungsspielraum zur Verfügung<br />
Bertelsmann Stiftung (2009): Deutschland 2020 – Blick nach vorn! In:<br />
Change. Das Magazin der Bertelsmann Stiftung. Sonderheft.<br />
www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-BB97FD61-E8299D21/bst/<br />
xcms_bst_dms_29851_29852_2.pdf<br />
steht, die wesentlichen Entscheidungen bereits im Vorfeld des<br />
Bertelsmann Stiftung (2012): Politik beleben, Bürger beteiligen, Charakteristika<br />
neuer Beteiligungsmodelle, Gütersloh, www.bertelsmann-stiftung.de/<br />
Verfahrens feststehen oder Bürgerinnen und Bürger schlichtweg<br />
zu spät eingebunden werden;<br />
cps/rde/xbcr/SID-26D3BB55-C9EC3B10/bst/xcms_bst_dms_ 31298_ 31299_<br />
(3) … Bürgerinnen und Bürger das Partizipationsangebot<br />
2.pdf<br />
nicht annehmen wollen – weil sie z. B. in der Vergangenheit<br />
schlechte Erfahrungen gemacht haben oder sich ihnen Möglichkeiten<br />
Deutschand&Europa, Heft 62 (2011): Politische Partizipation in Europa.<br />
eröffnen, ihre Interessen auf anderen Wegen effizi-<br />
Stuttgart. www.<strong>deutschland</strong>und<strong>europa</strong>.de<br />
enter durchzusetzen;<br />
Fritsche, Miriam/Nanz, Patrizia (2012): Handbuch Bürgerbeteiligung: Verfahren<br />
und Akteure, Chancen und Grenzen, Schriftenreihe Band 1200, Bundes-<br />
(4) … soziale Ungleichheiten zwischen den Teilnehmenden eines<br />
Verfahrens weder in der Zusammensetzung noch in der<br />
zentrale für politische Bildung, Bonn. (vergriffen), kostenloser download<br />
konkreten Durchführung ausgeglichen, sondern vielmehr zementiert<br />
werden. (Vgl. Nanz/Fritsche, S. 107ff.)<br />
unter: www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Handbuch_Buerger<br />
beteiligung.pdf<br />
Zusätzlich sollten angekündigte Bürgerbeteiligungsprojekte mit<br />
den notwendigen materiellen und personellen Ressourcen, d. h.<br />
auch mit dem notwendigen Know-how sowie der Expertise unabhängiger<br />
Jung, Otmar (2011): Erfahrungen mit direkter Demokratie in Deutschland<br />
und der Schweiz. in: D&E, Heft 62, S. 18–27<br />
Expertinnen und Experten ausgestattet werden. Das gilt<br />
Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge<br />
der Universität Leipzig, u. a. (2013): »Optionen moderner Bürger-<br />
auch und gerade für Online-Formate, die sogenannten Beteiligungsportale.<br />
Allein schon die notwendigen Feed-Back-Prozesse<br />
beteiligung auf Basis von Erfahrungen und Einstellungen von Bürgern,<br />
dürften dabei sicherlich ressourcenintensiv werden.<br />
Kommu nen und Unternehmern«, www.wifa.uni-leipzig.de/ fileadmin/<br />
»Bürgerbeteiligungs-Politik« braucht besonders die Bereitschaft<br />
user_upload/KOZE/Downloads/Optionen_moderner_<br />
der Verantwortlichen, umfassende Transparenz zu ermöglichen.<br />
Bürgerbeteiligungen_bei_ Infrastrukturprojekten_.pdf<br />
Angesichts der Reaktionen einer kritisch-investigativen Öffentlichkeit<br />
und zahlreicher juristischer Widerspruchsmöglichkeiten<br />
im Rechtsstaat stellt dies sicher eine große Herausforderung dar.<br />
Mit Recht verweisen Nanz/Fritsche zusätzlich noch auf die Notwendigkeit<br />
Internethinweise<br />
einer sachlichen, auf empirischen Untersuchungen<br />
basierenden wissenschaftlichen Begleitung von Bürgerbeteiligung<br />
www.buergerbeteiligung.lpb-bw.de (Portal der LpB Ba-Wü)<br />
am konkreten Beispiel und Format.<br />
Sollte dies gelingen, dürfte sich jedoch so nach und nach verloren<br />
www.b-b-e.de (Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement)<br />
gegangenes Vertrauen in den politischen Prozess wiederherstellen<br />
www.buerger-beteiligung.org (Portal der Bertelsmann Stiftung mit zahl-<br />
lassen. Die Einbeziehung junger Menschen scheint dabei von<br />
reichen Beispielen von Formaten gelungener Bürgerbeteiligung<br />
ganz besonderer Bedeutung, exemplarisch etwa bei der gerade<br />
www.buergergesellschaft.de dort insbesondere: Modelle und Methoden<br />
anstehenden »Bildungsplanreform 2015« in Baden-Württemberg.<br />
der Bürgerbeteiligung: www.buergergesellschaft.de/politischeteilhabe/modelle-und-methoden-der-buergerbeteiligung/modelle-und-<br />
Literaturhinweise<br />
Bertelsmann Stiftung (2011): Bundesbürger möchten sich politisch beteiligen,<br />
methoden-von-a-bis-z/106120/ – eine Infoseite der Stiftung Mitarbeit:<br />
www.mitarbeit.de<br />
www.politische-bildung.de/buergerbeteiligung_demokratie.html<br />
vor allem aber mitentscheiden. www.bertelsmann-stiftung.de/cps/<br />
(Umfangreiches Literaturverzeichnis)<br />
rde/xbcr/SID-CEF28043-B3F7F3BF/bst/xcms_bst_dms_34119_34120_2.pdf<br />
9<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Bürgerbeteiligung im europäischen Mehr ebenensystem – Chancen und Grenzen
BÜRGERBETEILIGUNG IN DEUTSCHLAND UND EUROPA<br />
2. Gemeinsam gestalten –<br />
Bürgerbeteiligung lebt vom Mitmachen<br />
GISELA ERLER<br />
10<br />
Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung sind in aller<br />
Munde: Menschen wollen mitreden. Menschen wollen teilhaben<br />
und beteiligt sein. Alle reden davon, meinen aber oft<br />
nicht dasselbe: Bürger verbinden damit oft paradiesische Zustände.<br />
Politik befürchtet Machtverlust und die Verwaltungen<br />
sagen, dass sie auch ohne die Bürger schon sehr beschäftigt<br />
seien. Der Wunsch nach einem Mehr an gesellschaftlicher Teilhabe<br />
der Menschen liegt im Wesentlichen an den Veränderungen<br />
der gesellschaftlichen Milieus. Mit einer Politik des<br />
»Gehört werdens« will die baden-württembergische Landesregierung<br />
dem wachsenden Mitwirkungsbedürfnis dieser engagierten<br />
Zivilgesellschaft gerecht werden und verloren gegangenes<br />
Vertrauen in die Politik wieder zurückgewinnen.<br />
Unser Ziel ist eine Mitmachdemokratie. Als Landesregierung<br />
haben wir aus diesem Grund Strategien und Formate entwickelt,<br />
die eine Mitwirkung der Bürgergesellschaft auf Augenhöhe<br />
mit der Politik ermöglichen. Wir wollen nicht nur dafür<br />
sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger politische Entscheidungen<br />
besser nachvollziehen können und Transparenz hergestellt<br />
wird, sondern auch, dass das Wissen und die Kompetenz<br />
der Zivilgesellschaft künftig besser genutzt werden. Denn wir<br />
sind davon überzeugt: Wenn sich die Politik dem Einfluss und<br />
den Ideen aus der Bürgergesellschaft öffnet, erhöht das auch<br />
die Chancen auf gute politische Ergebnisse und trägt so nicht<br />
zuletzt zu einer spürbaren Qualitätsverbesserung von Politik<br />
bei. Gerade in Baden-Württemberg sind die Voraussetzungen<br />
besonders gut, das Verhältnis von Staat, Markt und Bürgergesellschaft<br />
auf zukunftsweisende Art neu zu justieren, denn<br />
nirgendwo sonst sind die Menschen stärker bürgerschaftlich<br />
engagiert.<br />
Mitmachen – davon lebt Bürgerbeteiligung<br />
Damit ist eine wichtige Grundvoraussetzung geschaffen, denn<br />
Bürgerbeteiligung lebt vom Mitmachen. Eine moderne, eine lebendige<br />
und starke Demokratie lebt vom Einspruch und von der<br />
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Nicht wo die Menschen<br />
sich einmischen ist die Demokratie bedroht, sondern dort, wo sie<br />
sich abwenden von den öffentlichen Angelegenheiten, von den<br />
res publica. Die Landesregierung möchte deshalb die demokratischen<br />
Spielregeln in Baden-Württemberg ändern: Neben der Reform<br />
von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen werden ein<br />
verbindlicher Planungsleitfaden und neue Fachgesetze mehr Beteiligung<br />
in Planungsprozessen ermöglichen. Mit mehr direkter<br />
Demokratie schaffen wir einen Hebel, mit dem die Bürgerschaft<br />
ihr Veto einlegen kann. Die Politik muss deshalb frühzeitiger beteiligen,<br />
um eben dieses Veto zu verhindern. Ich möchte meine<br />
Arbeit aber nicht auf rechtliche Veränderungen begrenzt sehen.<br />
Es gibt auch »weiche« Strategien, mehr Bürgerbeteiligung zu erreichen,<br />
auf die ich hier eingehender erläutern möchte.<br />
Für eine Pädagogik der Beteiligung<br />
Ich war schon immer der Überzeugung, dass Bürgerbeteiligung<br />
gelernt werden kann. Sie ist viel mehr als Methoden und Formate<br />
und bedarf jenseits von gesetzlicher Verankerung einer persönlichen,<br />
ermöglichenden Haltung. Solche Haltungen ergeben sich<br />
Abb. 1 Staatsrätin Gisela Erler bei der Eröffnung des Workshops »Europäisches<br />
Netzwerk zur Bürgerbeteiligung«, 6.12.2012<br />
© Staatsministerium Baden-Württemberg<br />
nicht von selbst. Sie müssen von Bürgern, Verwaltung und Politik<br />
gleichermaßen erarbeitet und erlernt werden. Die Qualifizierung<br />
zur Beteiligung voranzubringen ist deshalb für mich ein zentraler<br />
Punkt. Was haben wir dafür getan und woran arbeiten wir noch?<br />
Gemeinsam mit der Führungsakademie Baden-Württemberg und<br />
den Hochschulen für öffentliche Verwaltung in Kehl und Ludwigsburg<br />
haben wir ein Curriculum zum Thema Bürgerbeteiligung erarbeitet.<br />
Daraus wurde innerhalb kürzester Zeit ein Kontaktstudiengang<br />
mit 15 Modulen, die sich vor allem an Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter aus Ministerien, Regierungspräsidien und Kommunalverwaltungen<br />
richten. Zentrale Inhalte sind die gesellschaftliche<br />
Entwicklung von Bürgerbeteiligung, Kommunikation<br />
in Beteiligungsprozessen, E-Partizipation, Methoden und Instrumente<br />
und der kontinuierlicher Erfahrungsaustausch.<br />
Beteiligungsportal – das Internet nutzen<br />
Mit dem Beteiligungsportal (www.baden-wuerttemberg.de/de/beteiligungsportal-info),<br />
welches ab dem Frühjahr 2013 online gehen wird,<br />
beschreiten wir neue Wege in Sachen Mitwirkung durch die Bürgerschaft.<br />
Das Beteiligungsportal umfasst drei Säulen. Auf der<br />
Informationssäule werden die Aktivitäten der Landesregierung<br />
im Bereich Bürgerbeteiligung präsentiert. Somit werden die in<br />
den Ressorts durchgeführten Beteiligungsprojekte an einer zentralen<br />
Stelle kommuniziert. In der Kommentierungssäule des Beteiligungsportals<br />
werden Gesetzentwürfe, die sich im Anhörungsverfahren<br />
befinden, online veröffentlicht und können von<br />
Nutzerinnen und Nutzern kommentiert werden. In der Mitmachsäule<br />
wird den Ministerien eine Infrastruktur angeboten, die sie<br />
für die Durchführung umfassender Online-Beteiligungsverfahren<br />
verwenden können. Ich empfehle den Ressorts, wichtige politische<br />
Vorhaben mit Bürgerbeteiligung zu realisieren. Dabei sollte<br />
ein Mix aus Online- und Offline-Beteiligung angewandt werden.<br />
Das Beteiligungsportal ermöglicht es, einen kompletten Beteiligungsprozess<br />
darzustellen, und bietet die technischen Möglichkeiten,<br />
eine Online-Konsultation durchzuführen.<br />
Gemeinsam gestalten – Bürgerbeteiligung lebt vom Mitmachen D&E Heft 65 · 2013
Allianz für Beteiligung –<br />
im Netzwerk handeln<br />
Vor einem Jahr habe ich die Initiative für eine<br />
»Allianz für Beteiligung« angestoßen. Im Mai<br />
2012 fand dazu eine Auftaktkonferenz mit<br />
über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern<br />
mit 90 Initiativen aus ganz Baden-Württemberg<br />
statt. Zentrale Aufgabe der Allianz ist<br />
die Entwicklung einer regionalen Hilfs- und<br />
Unterstützungsstruktur im Sinne einer »Peer<br />
to Peer Beratung«. Darin soll die Nutzung von<br />
Fähigkeiten und Talenten aus der Bürgerschaft<br />
zum Thema Bürgerbeteiligung aktiviert<br />
und vernetzt werden. Grundvoraussetzung,<br />
dass dies gelingt, ist die Entwicklung<br />
der Allianz im bottom-up Verfahren, also<br />
durch die Menschen und Initiativen selber<br />
und nicht von staatlicher Seite. Inzwischen<br />
wurde der Verein »Allianz für Beteiligung«<br />
zum Aufbau und Stärkung einer Beteiligungskultur<br />
in Baden-Württemberg, vor allem<br />
aber zur organisatorischen Abwicklung,<br />
gegründet. Finanziell erfährt die Allianz eine<br />
Förderung durch die Baden-Württemberg<br />
Stiftung, die Robert Bosch Stiftung und die<br />
Breuninger Stiftung. Damit kann eine Grundausstattung<br />
für eine Geschäftsstelle gewährleistet werden und<br />
die Allianz kann starten. Im Laufe dieses Jahres wird die Allianz<br />
mit einem eigenständigen Veranstaltungsformat in allen vier Regierungsbezirken<br />
in unserm Land aktiv und sichtbar.<br />
Demokratietheater, Lernlabor und<br />
Demokratie-Monitoring<br />
Es ist bekannt, dass komplexe Sachverhalte am einfachsten spielerisch<br />
vermittelt werden können. Dieser pädagogischen Erkenntnis<br />
tragen wir durch eine Theaterproduktion mit dem Titel »Bürgerbeteiligung<br />
– ein Lustspiel« Rechnung. Im Rahmen des<br />
Landesjubiläums 2012 habe ich die Produktion in Auftrag gegeben.<br />
Das Stück befasst sich fernab von Runden Tischen, Planungswerkstätten<br />
und Bürgerhaushalten sehr kreativ mit dem<br />
Thema Demokratie und Beteiligung und ist in sich selbst partizipativ<br />
und generationsübergreifend mit 20 ganz normalen Bürgern<br />
zwischen 7 und 70 Jahren angelegt. Gespielt wird es immer<br />
an einschlägigen Demokratieorten in Rathäusern, Landratsämtern<br />
und sogar im Plenarsaal des Landtags in Stuttgart. Das Projekt<br />
wird textlich, fotografisch und filmisch dokumentiert.<br />
Geplant ist eine »Spielkiste« mit methodischen Tipps zu Beteiligungs-Theater-Ideen<br />
für interessierte Kommunen und Theatergruppen.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt, wenn es um eine Pädagogik der Beteiligung<br />
geht, sind die Qualifizierungsangebote für junge Bürgerinnen<br />
und Bürger. Mit ganz spezifischen Formaten wie Onlinespielen,<br />
Planspielen und Programmen wie etwa »Jugend bewegt«, soll<br />
ein demokratisches Lernlabor für die junge Generation eröffnet<br />
werden. Ob und wie all unsere Bestrebungen in Sachen Beteiligung<br />
bei den Bürgerinnen und Bürger unseres Landes ankommen,<br />
wollen wir mit einem regelmäßigen »Demokratie-Monitoring«<br />
herausfinden, das erstmalig im Sommer 2013 Ergebnisse zu<br />
Tage förder<br />
Dass es in Baden-Württemberg schon viele gute Beispiele für die<br />
Beteiligung und Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger gibt zeigen<br />
wir mit einem gemeinsamen Wettbewerb des Staatsanzeigers<br />
und der kommunalen Spitzenverbände. Über 130 Beiträge<br />
sind dazu beim Staatsanzeiger eingegangen und zeigen eindrücklich,<br />
dass in den Gemeinden und Kommunen schon eine ganz<br />
hervorragenden Arbeit geleistet wird. Dachten wir zunächst an<br />
Abb. 2 Werbung des Staatsministeriums für das »Bürgerbeteiligungsportal« der baden-württembergischen<br />
Landesregierung: (www.baden-wuerttemberg.de/de/beteiligungsportal-info)<br />
© Staatsministerium Baden-Württemberg<br />
vierzig oder fünfzig Beiträge, so würden wir und vor allem auch<br />
der Staatsanzeiger völlig überrascht. Die außerordentlich erfreuliche<br />
Konsequenz, dass bis in den Sommer hinein, alle Wettbewerbsbeiträge<br />
veröffentlicht werden. Danach sind die Leserinnen<br />
und Leser des Staatsanzeiger für eine Vorauswahl gefragt um<br />
dann diese schließlich und endlich von einer »Bürgerjury« bewertet<br />
werden.<br />
Europäisches Netzwerk zur Bürgerbeteiligung<br />
Das Thema Bürgerbeteiligung und die verschiedenen Methoden<br />
zur Anwendung beschränken sich aber natürlich nicht nur auf<br />
Deutschland. Die Bürgerbeteiligung lebt vom Mitmachen der verschiedenen<br />
Akteure und vom Wissensaustausch untereinander.<br />
Und da viele Fragen, die die Demokratie bzw. die gelebte politische<br />
Praxis betreffend, heute in vielerlei Form mit Europa und der<br />
EU zusammenhängen, kommt der europäischen Komponente der<br />
Beteiligung eine besondere Bedeutung zu.<br />
Genau aus diesem Grunde habe ich im Dezember letzten Jahres in<br />
Stuttgart einen internationalen Workshop zur Bürgerbeteiligung<br />
organisiert. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen aus den<br />
verschiedensten Ländern Europas und der ganzen Welt. Akademische<br />
Koryphäen führten in Ihren Vorträgen in den aktuellen Forschungsstand<br />
zu Demokratie und Demokratieentwicklung ein.<br />
Neben dieser theoretischen Grundlage kamen aber auch in den<br />
Vorträgen schon Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Ländern,<br />
so zum Beispiel zu den verschiedenen Beteiligungsnetzwerken<br />
in den USA oder einem speziellen, sogenannten Sunset-Law,<br />
Gesetz zur Beteiligung in der Toskana.<br />
Neben den Inputs aus Vorträgen wurde danach in verschiedenen<br />
Arbeitsgruppen von Vertretern aus den jeweiligen Ländern über<br />
Ihre Erfahrungen mit der Beteiligung und den von Ihnen gewählten<br />
Methoden ausgetauscht. Am Ende des zweitätigen Workshops<br />
stand für alle Beteiligten die Notwendigkeit einer engeren<br />
Kooperation zwischen den Ländern und Regionen, vor allem Europas,<br />
zum Thema Bürgerbeteiligung fest. Daher haben wir ein<br />
europäisches Netzwerk gegründet, dessen Ziel es ist, durch regelmäßig<br />
stattfindende Treffen und den Austausch untereinander<br />
weiter voneinander zu lernen und die Bürgerbeteiligung im<br />
europäischen Kontext zu stärken.<br />
11<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Gemeinsam gestalten – Bürgerbeteiligung lebt vom Mitmachen
BÜRGERBETEILIGUNG IN DEUTSCHLAND UND EUROPA<br />
3. Entwicklungen der partizipativen<br />
Demokratie in Europa<br />
PATRIZIA NANZ | JAN-HENDRIK KAMLAGE*<br />
Die Demokratien in Europa unterliegen<br />
einem merklichen Wandel. Zum einen<br />
gibt es in Europa eine immer größer werdende<br />
Zahl an direktdemokratische Verfahren<br />
wie Referenden, Volksbegehren und<br />
Bürgerbegehren (vgl. APuZ 2006). Von den<br />
weltweit seit 1793 gezählten 1.405 nationalen<br />
Referenden entfallen alleine 62 Prozent<br />
auf die europäischen Länder. Ungefähr die<br />
Hälfte davon fanden seit 1989 statt (Pállinger,<br />
Kaufmann, Marxer & Schiller 2007: 9).<br />
Zum anderen finden auch die sogenannten<br />
deliberativen oder dialogorientierten Verfahren<br />
der Bürgerbeteiligung wie Bürgerhaushalte,<br />
Bürgerinnenräte, Zukunftskonferenzen<br />
und Planungszellen in den letzten<br />
zwei Jahrzenten zunehmende Verbreitung<br />
in Europa. Durch wissenschaftliche Forschung<br />
belegte Zahlen liegen hier allerdings<br />
bisher nicht vor, weder zum Umfang<br />
dieses Trends insgesamt noch zur Verteilung<br />
der verschiedenen dialogorientierten<br />
Beteiligungsformate in den europäischen<br />
Ländern.<br />
Die Bereitschaft zu mehr politischer Beteiligung<br />
Angaben in Prozent<br />
Wünschen Sie sich mehr politische<br />
Beteiligungsmöglichkeiten für die<br />
Bürger?<br />
Wären Sie bereit, sich über Wahlen<br />
hinaus an politischen Prozessen zu<br />
beteiligen?<br />
Glauben Sie, dass die Politiker<br />
grundsätzlich mehr Mitbestimmung<br />
durch die Bürger wollen?<br />
Ja Nein Weiß nicht, keine Angabe<br />
Quelle: Bertelsmann Stiftung / Umfrage TNS-Emnid.<br />
Ja<br />
Nein<br />
81 16<br />
60 39<br />
22 76<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Abb. 1 »Die Bereitschaft zu mehr politischer Beteiligung«<br />
© Bertelsmann Stiftung (2011): Bundesbürger möchten sich politisch beteiligen, vor allem aber mitentscheiden,<br />
www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-CEF28043-B3F7F3BF/bst/xcms_bst_dms_34119_34120_2.pdf<br />
12<br />
Die Krise der repräsentativen Demokratie<br />
Die direktdemokratischen wie dialogorientierten Formen der<br />
Bürgerbeteiligung erfreuen sich vor allem deshalb wachsender<br />
Beliebtheit, weil sie im Ruf stehen, die immer größer werdende<br />
Kluft zu den gewählten Politikern, die weniger als Volksvertreter<br />
und -vertreterinnen denn als politische Klasse wahrgenommen<br />
werden, zu verringern. Schwindende Wahlbeteiligung, abnehmende<br />
Mitgliederzahlen der Parteien, sinkendes Vertrauen der<br />
Menschen in die Handlungsfähigkeit der Regierenden – die Diagnose<br />
der Krise der repräsentativen Demokratie ist vielfältig. So<br />
stimmen beispielsweise nur fünf Prozent der Deutschen in einer<br />
repräsentativen Studie der Stiftung für Zukunftsfragen der Aussage<br />
zu: »Die Politiker bereiten mein Heimatland gut auf die Zukunft<br />
vor«. In anderen Ländern sieht es nicht viel besser aus: In<br />
Frankreich stimmen zwölf Prozent und in Spanien sieben Prozent<br />
dieser Aussage zu (Europauntersuchung der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen,<br />
2012). Gleichzeitig ist der Wunsch der Bürgerinnen und<br />
Bürger nach unmittelbarer Mitwirkung und Beteiligung an politischen<br />
Entscheidungen so groß wie nie. Nach Angaben einer repräsentativen<br />
Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2011<br />
wünschen sich 78 Prozent der Deutschen mehr Möglichkeiten<br />
über politische Fragen durch Volksentscheide und Bürgerbegehren<br />
direkt mitentscheiden zu können. 68 Prozent würden gerne<br />
bei großen Infrastrukturprojekten mitentscheiden und 47 Prozent<br />
an Bürgerhaushalten mitwirken. Generell sprechen sich 81<br />
Prozent für mehr politische Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten<br />
aus (Bertelsmann Stiftung, 2011, www.bertelsmann-stiftung.<br />
de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/nachrichten_107591.htm).<br />
* | Hinweis: Der Beitrag ist unter der Zuarbeit von Ivo Gruner entstanden.<br />
Dialogorientierte Formen der Bürgerbeteiligung<br />
in Europa<br />
Im Folgenden wollen wir augenfällige Entwicklungen der partizipativen<br />
Demokratie in Europa in groben Zügen darstellen. Dabei<br />
geht es ausschließlich um dialogorientierte Formen der Bürgerbeteiligung.<br />
Zunächst: Was bedeutet dialogorientierte Bürgerbeteiligung?<br />
In solchen Verfahren werden Bürgerinnen und Bürger,<br />
zivilgesellschaftliche Akteure und Entscheidungsträgerinnen und<br />
-träger frühzeitig im politischen Prozess zusammengebracht. Im<br />
Mittelpunkt der Beratungen steht der Austausch von Argumenten<br />
mit dem Ziel einer gemeinschaftlichen Willensbildung und idealerweise<br />
einer anschließenden konsensualen Entscheidungsfindung.<br />
In Diskussionen wägen die Beteiligten alternative Positionen<br />
ab unter der Prämisse, andere Standpunkte zu berücksichtigen<br />
(Fung, 2003, S. 340). Diese teilweise komplexen Verfahren durchlaufen<br />
oft mehrere Runden und sind angewiesen auf die Unterstützung<br />
von Moderatorinnen und Moderatoren sowie Expertinnen<br />
und Experten aus Wissenschaft und Praxis. Sie werden oft als<br />
»informell« bezeichnet in Abgrenzung zu gesetzlich vorgeschriebenen<br />
»formellen« Beteiligungsmöglichkeiten wie zum Beispiel<br />
den Anhörungen im Rahmen der deutschen Raumordnungs- und<br />
Planfeststellungsverfahren bei öffentlichen Bauvorhaben. Erweiternd<br />
und ergänzend stehen bei dialogorientierten Beteiligungsprozessen<br />
immer öfter auch internetgestützte Werkzeuge und<br />
Technologien zur Verfügung, die einer größeren Menge von Bürgerinnen<br />
und Bürger die Mitwirkung ermöglichen.<br />
Dialogorientierte Bürgerbeteiligung ist eingebettet in spezifische<br />
politische Kulturen und Systeme, die sich je nach Ländern<br />
und Regionen, und manchmal auch nach Städten und Gemeinden<br />
unterscheiden. Vergleicht man Europa mit den USA, so ist auffällig,<br />
dass in den Vereinigten Staaten die Beteiligungsprozesse in<br />
aller Regel auf der lokalen Ebene und kaum auf zentralstaatlicher<br />
Ebene stattfinden. Durchgeführt und getragen werden Beteiligungsprozesse<br />
wie »Citizens Juries« und »National Issue Forums«<br />
Entwicklungen der partizipativen Demokratie in Europa D&E Heft 65 · 2013
Abb. 2 Europaweite Befragung: »Die Politiker bereiten mein Heimatland gut auf die Zukunft vor.«<br />
© Europauntersuchung der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen,<br />
www.stiftungfuerzukunftsfragen.de/uploads/media/Forschung-Aktuell-241-Politikervertrauen-in-Krisenzeiten_01.pdf<br />
sowie vor allem Großformate wie zum<br />
Beispiel »Deliberative Pollings« und<br />
»Town Hall Meetings« (500 bzw. bis zu<br />
5000 Teilnehmende) vornehmlich<br />
durch zivilgesellschaftliche Organisationen<br />
(Bertelsmann Stiftung, im Erscheinen).<br />
In Europa findet Bürgerbeteiligung<br />
vorwiegend sowohl auf lokaler als<br />
auch auf regionaler Ebene statt, und<br />
in manchen Ländern auch auf nationaler<br />
Ebene. Je nach politischer Kultur<br />
lassen sich verschiedene Muster<br />
der Beteiligung in den einzelnen Ländern<br />
und Regionen finden. In Frankreich<br />
zum Beispiel gibt es die »Commission<br />
Nationale du Débat Public«,<br />
eine unabhängige vom Staat finanzierte<br />
Organisation auf der zentralstaatlichen<br />
Ebene, die öffentliche<br />
Debatten und Beteiligung zu großen<br />
Infrastrukturvorhaben wie beispielsweise<br />
U-Bahnen, Autobahnen und<br />
Bahnhöfen organisiert. Diese Be tei ligungs<br />
formen sind eher »spontan«<br />
und auf die Einflussnahme von Öffentlichkeit<br />
und Gesellschaft gerichtet<br />
im Vergleich zu deutschen Verfahren, denen meist ein recht<br />
klares Regelwerk zugrunde liegt und die oft das Ziel verfolgen,<br />
Entscheidungsträgerinnen und – träger zu beraten. In Frankreich<br />
wie auch in Deutschland haben Mandatsträger und -trägerinnen<br />
sowie Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine dominante<br />
Rolle in der Vorbereitung und Durchführung der Verfahren,<br />
während die britische Regierung Bürgerbeteiligung vornehmlich<br />
auf lokaler Ebene einfordert, aber deren Ausführung dem privaten<br />
und Non-Profit-Sektor überlässt. In Großbritannien ist seit<br />
2003 die gemeinnützige Organisation »Involve« aktiv, welche die<br />
Zusammenarbeit vieler an Partizipation beteiligter Akteure optimiert,<br />
sowohl aus dem öffentlichen, als auch aus dem privaten<br />
und dem freiwilligen Sektor. In Italien wiederum gibt es zahlreiche<br />
kleine Initiativen auf lokaler und regionaler Ebene. Die Region<br />
Toskana hat im Jahr 2007 ein in Europa bislang einzigartiges<br />
Gesetz erlassen, das es Bürgerinnen und Bürgern und dort wohnhaften<br />
Personen ermöglicht, Beteiligung einzufordern und selber<br />
zu initiieren, wenn das geplante Großvorhaben einen signifikanten<br />
Einfluss auf die Bevölkerung hat. Mit dem Gesetz wurde darüber<br />
hinaus eine zentrale staatliche Anlauf- und Beratungsstelle<br />
zur Verbreitung, Förderung und Evaluation der Beteiligungspraxis<br />
etabliert, die jährlich Berichte über den Verlauf der Praxis veröffentlicht<br />
(Regione Toscana, 2007).<br />
Länderübergreifende und vergleichende wissenschaftliche Forschung,<br />
die die verschiedenen Partizipationskulturen in Europa<br />
sowie die unterschiedliche Verbreitung bzw. Ausprägung einzelner<br />
Beteiligungsformate erfasst, gibt es allerdings bislang nicht.<br />
Mit einer Ausnahme: die Erforschung der »Bürgerhaushalte« in<br />
verschiedenen europäischen Ländern. Der Bürgerhaushalt ist das<br />
weltweit bekannteste und verbreitetste dialogorientierte Verfahren<br />
(Cabannes, 2006). Entstanden sind Bürgerhaushalte Ende der<br />
1980er Jahre in der brasilianischen Millionenstadt Porto Alegre<br />
und im neuseeländischen Christchurch. Das in Porto Alegre entwickelte<br />
Modell ist als Beispiel einer »Demokratisierung der Demokratie«<br />
bekannt geworden. Die Bürgerinnen und Bürger können<br />
auf kommunaler Ebene an der Gestaltung politischer und<br />
budgetärer Angelegenheiten, deren Konsultation und Prioritätensetzung<br />
mitwirken und sogar mitentscheiden. Die Entstehung<br />
des Beteiligungsverfahrens in Porto Alegre stand unter den Vorzeichen<br />
von sozialer Gerechtigkeit, Bekämpfung von Korruption<br />
und Ausweitung der Basisdemokratie. Erwähnenswert ist, dass<br />
sich hier verstärkt auch ärmere und bildungsferne Bevölkerungsschichten<br />
beteiligen (Baiocchi, 2005). Der Bürgerhaushalt von<br />
Christchurch hingegen gilt als Vorbild für eine erfolgreiche Verwaltungsmodernisierung<br />
durch bürgerschaftliche Konsultationen<br />
(Holtkamp, 2012). Er soll vornehmlich die Akzeptanz erhöhen<br />
und Legitimierung fiskalpolitischer Maßnahmen in der Bevölkerung<br />
steigern. Diese beiden Modelle haben in den europäischen<br />
Ländern und Regionen unterschiedliche Verbreitung gefunden<br />
(Herzberg, Sintomer, et al., 2010).<br />
In Deutschland beispielsweise werden Bürgerhaushalte wie in<br />
Berlin-Lichtenberg, Esslingen, Köln und Freiburg überwiegend als<br />
Mittel zur Verwaltungsmodernisierung angewendet, also nach<br />
dem neuseeländischen Vorbild. Sie zielen ab auf eine Verbesserung<br />
der Informationsgrundlage der Stadt- und Gemeinderäte bei<br />
der Beschlussfassung über den Haushaltsplan. In Spanien und<br />
anderen Ländern Süd<strong>europa</strong>s hingegen stehen bei Bürgerhaushalten<br />
nach dem brasilianischen Modell eher Fragen der sozialen<br />
Gerechtigkeit im Mittelpunkt wie zum Beispiel in Cordoba, Sevilla<br />
und Albacete (Sintomer, Herzberg, et al., 2008). Mit Blick auf die<br />
Bürgerhaushalte lässt sich festhalten: Die Gestaltung und Umsetzung<br />
eines Beteiligungsformats hängt stark von den jeweiligen<br />
Beteiligungskulturen und Traditionen sowie den Strukturen des<br />
politischen Systems der jeweiligen Länder und Regionen ab.<br />
Neben den Bürgerhaushalten gibt es heute rund 16 weitere gängige<br />
Verfahren und Methoden dialogorientierter Bürgerbeteiligung,<br />
die in den europäischen Ländern und Regionen Verbreitung<br />
gefunden haben – ergänzt um eine zunehmende Zahl von<br />
online- und internetgestützten Beteiligungsverfahren (siehe im<br />
Überblick Fritsche & Nanz, 2012). Die verschiedenen Formate unterscheiden<br />
sich hinsichtlich ihrer Dauer (ein Tag bis mehrere Monate),<br />
ihrer Teilnehmerzahl (von zehn bis mehreren Tausenden)<br />
sowie der Rekrutierung und Auswahl der beteiligten Bürgerinnen<br />
und Bürger (Selbstselektion, zufällige oder gezielte Auswahl, vgl.<br />
| Abb. 7 |, S. 8). In Europa dienen Beteiligungsprozesse vornehmlich<br />
der Einflussnahme von Öffentlichkeit und Gesellschaft sowie<br />
der Beratung von Entscheidungsträgerinnen und -trägern. Unmittelbare<br />
Entscheidungen der Bürgerinnen und Bürger sind in<br />
den meisten dialogorientierten Verfahren nicht vorgesehen, sodass<br />
kollektiv bindende Beschlüsse nach wie vor durch Parlamente,<br />
Stadträte und Verwaltungen gefällt werden. Allein im Rahmen<br />
von Bürgerhaushalten sind auch Mit-Entscheidungen von<br />
Bürgerinnen und Bürgern möglich, wobei in Deutschland auch<br />
13<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Entwicklungen der partizipativen Demokratie in Europa
14<br />
PATRIZIA NANZ | JAN-HENDRIK KAMLAGE*<br />
hier das Entscheidungsrecht weiterhin ausschließlich in den Händen<br />
von Politik und Verwaltung liegt.<br />
In den europäischen Ländern haben sich die verschiedenen Beteiligungsformate<br />
nicht nur unterschiedlich ausgeprägt, wie das<br />
Beispiel der Bürgerhaushalte zeigt, sondern sie sind auch unterschiedlich<br />
weit verbreitet. In Deutschland wird schon seit den<br />
1970er Jahren die »Planungszelle« angewendet. Planungszelle ist<br />
ein organisatorisch aufwendiges Kleinformat, das komplexe Fragestellungen<br />
von wenigen, zufällig ausgewählten Bürgerinnen<br />
und Bürgern erarbeiten lässt und auf dieser Basis Empfehlungen<br />
(sogenannte »Bürgergutachten«) erstellt. Diese dienen dann<br />
Stadträten, Verwaltungen und Parlamenten als Entscheidungsgrundlage,<br />
beispielsweise für die Kommunal- und Verwaltungsreform<br />
in Rheinland-Pfalz (vgl. Dienel, 2011) oder für die Entwicklung<br />
der Neusser Innenstadt (vgl. Ortwein, 2001).<br />
Europaweit:<br />
Bürgerbeteiligung im Fokus der Öffentlichkeit<br />
Nicht zuletzt als Antwort auf die neue Protestwelle in den letzten<br />
Jahren (u. a. Stuttgart 21) und auf die Konflikte im Kontext der<br />
Energiewende ist Bürgerbeteiligung in Deutschland (wieder)<br />
stark in den Fokus der politischen Öffentlichkeit gerückt. An vielen<br />
Orten in der Republik, sei es auf kommunaler, regionaler oder<br />
zentralstaatlicher Ebene, werden gegenwärtig verschiedenste<br />
Beteiligungsverfahren erprobt.<br />
In Österreich, und hier vorwiegend im westösterreichischen Bundesland<br />
Vorarlberg, hat das im Vergleich zur Planungszelle einfache<br />
Format der Bürgerinnenräte weite Verbreitung gefunden, das<br />
in den USA entwickelt wurde und dort »Wisdom Council« genannt<br />
wird. Ziel ist es, die Ideen und Vorschläge von rund zehn zufällig<br />
ausgewählten Bürgerinnen und Bürger an wenigen Tagen zu erarbeiten<br />
und auf diesem Weg zu einer kreativen und gemeinschaftlichen<br />
Problemlösung zu gelangen. Die daraus entstehenden<br />
Empfehlungen dienen als Diskussionsgrundlage sowohl für die<br />
lokale Öffentlichkeit als auch für Entscheidungsträgerinnen und<br />
-träger, z. B. im Gemeinderat (Strele, Nanz, et al., 2012). Aufgrund<br />
der positiven Erfahrungen mit den Bürgerinnenräten wird erstmals<br />
in Europa im Jahr 2013 die partizipative Demokratie in der<br />
Landesverfassung von Vorarlberg verankert – ein Trend, dem<br />
höchstwahrscheinlich auch andere Regionen in Bälde folgen werden.<br />
In Großbritannien wird neben vielen anderen häufig das Beteiligungsverfahren<br />
»Planning for Real« angewendet, mit dem Ziel,<br />
die Lebensqualität an konkreten Orten (Stadtplätze, Quartiere,<br />
Stadtparks etc.) zu verbessern. Es ist offen für alle Interessierten.<br />
Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist nicht begrenzt.<br />
In Dänemark wiederum werden seit den frühen 1990er Jahren erfolgreich<br />
»Konsensuskonferenzen« mit Bürgern durchgeführt,<br />
deren Ergebnisse dem Parlament überreicht werden. Die Dänische<br />
Behörde für Technikfolgenabschätzung bringt dazu Expertinnen<br />
und Experten zusammen mit 10–30 zufällig ausgewählten<br />
Laien hinsichtlich eines zu diskutierenden Themas. Das Themenspektrum<br />
der Konferenzen reicht von der Strahlenbelastung von<br />
Lebensmitteln über die Behandlung von Unfruchtbarkeit bis hin<br />
zu Chancen und Schwierigkeiten von Verkehrsmauten.<br />
Wie sieht es nun auf der europäischen Ebene mit der Erprobung<br />
von »dialogorientierten Verfahren der Bürgerbeteiligung« aus?<br />
Die Europäische Kommission hat seit 2001 eine Vielzahl von Projekten<br />
unterstützt, um zu testen, welche Verfahren und Methoden<br />
für transnationale und mehrsprachige Bürgerbeteiligung geeignet<br />
sind (Nanz & Kies, im Erscheinen). Das größte und<br />
vielschichtigste Projekt dieser Art waren bislang die »Europäischen<br />
Bürgerkonferenzen«, die erstmals zwischen Oktober 2006<br />
und Mai 2007 stattfanden. An diesem grenzüberschreitenden<br />
Großverfahren nahmen etwa 1.800 nach demographischen Kriterien<br />
zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus 27 EU-<br />
Mitgliedstaaten teil und berieten über die Zukunft Europas. Die<br />
Europäischen Bürgerkonferenzen waren nach der Auftaktveranstaltung<br />
in Brüssel als ein dreistufiges Verfahren organisiert: Im<br />
ersten Schritt wurden zentrale Bürgerkonferenzen mit Online-<br />
Elementen in den einzelnen Mitgliedstaaten durchgeführt. Im<br />
zweiten Schritt wurden ergänzend in verschiedenen Städten der<br />
Mitgliedstaaten »regionale Bürgerforen« veranstaltet, um in einem<br />
letzten Schritt die Ergebnisse aus den Mitgliedstaaten auf<br />
der europäischen Ebene zusammenzutragen und dort mit Vertretern<br />
der Europäischen Kommission auf einer Abschlussveranstaltung<br />
zu diskutieren (Baumann, Felten, et al., 2009). Im Anschluss<br />
an die ersten Europäischen Bürgerkonferenzen gab es bis heute<br />
verschiedene Folgeprozesse, die die Ergebnisse des Verfahrens in<br />
die Mitgliedstaaten zurück kommuniziert haben. Im Jahr 2009<br />
wurden erneut Europäische Bürgerkonferenzen veranstaltet, um<br />
so eine erste reguläre transnationale Beteiligungspraxis der Bürgerinnen<br />
und Bürger in Europa zu etablieren.<br />
Erste Ergebnisse<br />
Die vielfältigen Entwicklungen im Feld der dialogorientierten Verfahren<br />
in Europa haben dazu geführt, dass sowohl Politik und<br />
Verwaltungen einiger Länder, Regionen und Kommunen als auch<br />
die wachsende Anzahl an Dienstleistern und Anbietern von Bürgerbeteiligungsverfahren<br />
ein gesteigertes Interesse an Qualitätsnormen,<br />
Standards und Leitlinien für die Umsetzung der Beteiligungsverfahren<br />
entwickelt haben. In den letzten Jahren sind<br />
daher in verschiedenen Ländern Europas Qualitätsgrundsätze<br />
und Standards der Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung entstanden.<br />
So hat die »Österreichische Gesellschaft für Umwelt und<br />
Technik« (ÖGUT), die Mitte der 1980er Jahre als überparteiliche<br />
Plattform für Umwelt, Wirtschaft und Verwaltung zur Förderung<br />
von Beteiligungsprozessen vor allem im Bereich der Umweltpolitik<br />
gegründet wurde, »Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung«<br />
veröffentlicht. Die Entwicklung der Standards und Praxisleitfäden<br />
wurde vom österreichischen Ministerrat am 2. Juli 2008 beschlossen<br />
und von einer interministeriellen Arbeitsgruppe unter Federführung<br />
des Kanzleramtes und des Lebensministeriums entwickelt.<br />
Die Arbeitsgruppe konsultierte darüber hinaus verschiedene<br />
Vertreter der Zivilgesellschaft und externe Fachexperten (Lebensministerium<br />
& Bundeskanzleramt, 2008, S. 3). Die Qualitätsstandards<br />
und Leitfäden sind als Service und Unterstützung für Verwaltungen<br />
konzipiert, um eine Orientierung für die gute Praxis<br />
der Öffentlichkeitsbeteiligung bereit zu stellen (www.partizipation.<br />
at/standards_oeb.html).<br />
Neben Österreich hat auch die Landesregierung von Wales begonnen,<br />
nationale Prinzipien für öffentliche Beteiligung zu entwickeln.<br />
Hierzu wurde im Jahr 2009 die beratende Kommission der<br />
Organisation »Participation Cymru« beauftragt. »Participation<br />
Cymru« ist eine Kooperation der öffentlichen Verwaltung und zivilgesellschaftlichen<br />
Organisationen, die darauf abzielt, öffentliche<br />
Dienstleistungen durch die Stärkung und den innovativen<br />
Einsatz von Bürgerbeteiligung zu verbessern. Den Anstoß zur Entwicklung<br />
der Prinzipien gab eine vom walisischen Parlament verabschiedete<br />
»Vision für öffentliche Dienstleistungen«. Jüngst haben<br />
sich auch Städte wie Heidelberg und Leipzig auf den Weg<br />
gemacht, Qualitätsnormen zu kodifizieren (vgl. Stadt Heidelberg,<br />
2012; Stadt Leipzig, 2013). Zu diesem Zweck wurden unter anderem<br />
Grundsätze und Leitfäden für die Umsetzung von dialogorientierten<br />
Verfahren entwickelt.<br />
Trotz der mittlerweile zahlreichen Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung<br />
hat in Europa bisher kein systematischer Lern- und Erfahrungsaustausch<br />
stattgefunden. Im Dezember 2012 hat daher die<br />
Stabsstelle der »Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung<br />
des Staatsministeriums Baden-Württemberg«, Gisela Erler,<br />
und das »European Institute for Public Parcipation« (EIPP)<br />
verschiedene europäische Regionen zu einer Konferenz eingeladen,<br />
u. a. Rhone-Alpes, Vorarlberg, Katalonien, die dänischen Regionen<br />
sowie die Toskana und Emilia-Romagna. Als Ergebnis ist<br />
Entwicklungen der partizipativen Demokratie in Europa<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
das erste »Europäische Netzwerk zur Förderung<br />
der Bürgerbeteiligung« gegründet worden.<br />
Es wurde bei dem Treffen der europäischen<br />
Regionen deutlich, dass Politik und<br />
Verwaltung als Initiatoren und Organisatoren<br />
von partizipativen Prozessen in den kommenden<br />
Jahren dringend Kompetenzen ausbilden<br />
müssen, um entscheiden zu können,<br />
welches Format am besten für ein Thema, ein<br />
Fachgebiet und eine politische Ebene geeignet<br />
ist. Was zudem benötigt wird, ist praktisches<br />
Wissen über die Stärken und Schwächen<br />
der verschiedenen Verfahren und ihre<br />
Nützlichkeit für unterschiedliche Situationen.<br />
Darüber hinaus suchen Regionen und<br />
Kommunen verstärkt nach Wegen, dialogorientierte<br />
Verfahren mit den jeweiligen repräsentativ-demokratischen<br />
Institutionen und<br />
Gremien zu verzahnen, damit das »Voicing«<br />
der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig Einfluss<br />
nehmen kann.<br />
Die wachsende Verbreitung neuer und innovativer<br />
Formen dialogorientierter Bürgerbeteiligung<br />
in Europa macht auch die Notwenigkeit sozialwissenschaftlicher<br />
Forschung deutlich, die diese Entwicklungen<br />
quantitativ sowie qualitativ erfasst und kritisch begleitet. Europa<br />
braucht ein unabhängiges Kompetenzzentrum, das Grundlagenforschung<br />
mit Anwendungsorientierung verbindet und zentraler<br />
Bestandteil eines europäischen Netzwerks für Bürgerbeteiligung<br />
wird. Aufgabe dieses Zentrums wäre es, länderübergreifend die<br />
Erfahrungen aus einzelnen Beteiligungsinitiativen systematisch<br />
zusammenzutragen, die Ursachen für Erfolg und Misserfolg zu<br />
analysieren, unabhängige Handreichungen über intendierte und<br />
nicht-intendierte Wirkungen von Beteiligungsbeispielen zur Verfügung<br />
zu stellen und somit einen Raum zur kritischen Reflexion<br />
partizipativer Prozesse zu schaffen. Auf der Grundlage solchen<br />
Wissens könnte eine derartige Institution auch bei der Konzeption<br />
von Beteiligungsangeboten behilflich sein, Qualitätsnormen<br />
für Verfahren erarbeiten und Evaluationsstandards zur unabhängigen<br />
Bewertung der Praxis entwickeln. Darüber hinaus könnte<br />
sie Akteure aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft ebenso<br />
wie Dienstleisterinnen und Dienstleister, Moderatorinnen und<br />
Moderatoren sowie technische Entwicklerinnen und Entwickler<br />
vernetzen und zum »Capacity Buildings« der Akteursgruppen beitragen.<br />
Ein solches Kompetenzzentrum könnte aber auch die Debatte<br />
um die Zukunft der Demokratie insgesamt bereichern:<br />
– Wie ließen sich dialogorientierte Beteiligungsverfahren mit<br />
direkt-demokratischen Abstimmungen verbinden (wie etwa<br />
im Beispiel der Wahlrechtsreform in British Columbia oder des<br />
isländischen Verfassungsentwurfs durch die Bürger und Bürgerinnen,<br />
für das jüngst eine satte Mehrheit der Wahlbevölkerung<br />
gestimmt hat)?<br />
– Wie könnten Verknüpfungen von einzelnen Beteiligungsverfahren<br />
(oder gar einer ständigen Bürgerkammer zum Beispiel<br />
für langfristige Fragenstellungen) und parlamentarischen<br />
Entscheidungsprozessen aussehen?<br />
Es ginge am Ende darum, systematische Vorschläge für europäische<br />
Demokratiereformen zu machen – Demokratiereformen, die<br />
institutionelle Rahmenbedingungen entwickeln für eine Kombination<br />
aus repräsentativer, direkter und partizipativer Demokratie<br />
– und dabei die unterschiedlichen Beteiligungskulturen und<br />
politischen Systeme in Europa berücksichtigt.<br />
Literaturhinweise<br />
APuZ (2006): Direkte Demokratie, Bundeszentrale für politische Bildung,<br />
Bonn, www.bpb.de/system/files/pdf/YRK9YG.pdf (letzter Zugriff:<br />
25.01.2013).<br />
Abb. 3 Am 5. und 6.12.2012 kamen im Staatsministerium in Stuttgart Expertinnen und Experten aus<br />
aller Welt zusammen, um sich in einem Workshop über Konzepte der Bürgerbeteiligung in Europa auszutauschen.<br />
Dazu eingeladen hatten die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, Gisela<br />
Erler, und Professorin Dr. Patrizia Nanz vom »European Institute for Public Participation« (EIPP).<br />
© Staatsministerium Baden-Württemberg<br />
Baiocchi, Gianpaolo (2005): Militants and Citizens: The Politics of Participatory<br />
Democracy in Porto Alegre, Stanford, Kalifornien.<br />
Baumann, Mechthild, Felten, Sandra & Stratenschulte, Eckart D. (2009):<br />
Empi rische Auswertung der Europäischen Bürgerforen 2008/2009,<br />
www.buergerforen.de/fileadmin/medias-buergerforen/presse/Finale_<br />
Auswertung.pdf (letzter Zugriff: 25.01.2013).<br />
Bertelsmann Stiftung (im Erscheinen): Public Participation in International<br />
Review: A discussion between Archon Fung, Yves Sintomer, Patrizia Nanz<br />
and Anna Wohlfarth, in: Inspiring Democracy: New Forms of Public Participation,<br />
S. 71–75.<br />
Dienel, Hans-Liudger (2011): Die Planungszelle im Einsatz: Bürgervoten für<br />
die Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz, in: Kurt Beck &<br />
Jan Ziekow (Hrsg.), Mehr Bürgerbeteiligung wagen, S. 169–177.<br />
Fritsche, Miriam & Nanz, Patrizia (2012): Handbuch Bürgerbeteiligung: Verfahren<br />
und Akteure, Chancen und Grenzen, Schriftenreihe Band 1200, Bundeszentrale<br />
für politische Bildung, Bonn.<br />
Fung, Archon (2003): Survey Article: Recipes for Public Spheres: Eight Institutional<br />
Design Choices and Their Consequences, Journal of Political Philosophy,<br />
11(3), S. 338–367.<br />
Herzberg, Carsten, Sintomer, Yves, et al. (2010): Vom Süden lernen: Bürgerhaushalte<br />
weltweit-eine Einladung zur globalen Kooperation: Studie,<br />
http://opus.kobv.de/zlb/volltexte/2011/10312/pdf/dg25.pdf (letzter Zugriff:<br />
25.01.2013).<br />
Ley, Astrid & Weitz, Ludwig (Hrsg.) (2009): Praxis Bürgerbeteiligung, Stiftung<br />
Mitarbeit, Bonn.<br />
Nanz, Patrizia & Kies, Raphaël (im Erscheinen): Is Europe Listening to Us?<br />
Successes and Failures of EU Citizen Consultations, Ashgate Publishing.<br />
Stadt Heidelberg (2012): Leitlinien für mitgestaltende Bürgerbeteiligung in<br />
der Stadt Heidelberg, online: http://www.heidelberg.de/servlet/PB/<br />
show/1227274/12_pdf_Buergerbeteiligung_LeitlinienEnd.pdf (letzter<br />
Zugriff: 25.01.2013).<br />
Stiftung für Zukunftsfragen (2012): Forschung aktuell, Hamburg, online:<br />
www.stiftungfuerzukunftsfragen.de/uploads/media/Forschung-Aktuell-<br />
241-Politikervertrauen-in-Krisenzeiten_01.pdf (letzter Zugriff: 25.01.2013).<br />
Strele, Martin, Nanz, Patrizia & Lüdemann, Martin (2012): BürgerInnen-Räte<br />
in Österreich, Gemeinsames Forschungsprojekt des Lebensministeriums<br />
und des Büros für Zukunftsfragen, Bregenz, Wien, online:<br />
http://www.vorarlberg.at/pdf/endberichtforschungsproje.pdf (letzter<br />
Zugriff: 26.01.2013).<br />
15<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Entwicklungen der partizipativen Demokratie in Europa
16<br />
PATRIZIA NANZ | JAN-HENDRIK KAMLAGE*<br />
MATERIALIEN<br />
M 1 Claus Leggewie, Patrizia Nanz: »<br />
Mehr Beteiligung für die Energiewende«,<br />
Süddeutsche Zeitung<br />
Es wird eng: Rund um den Erdball werden<br />
Endlager für hoch radioaktive Abfälle aus der<br />
Nutzung der Kernenergie durch Industrie,<br />
Medizin und Forschung gesucht. Die Europäische<br />
Union hat 14 Mitgliedstaaten eine Lösung<br />
für die Atommüll-Endlagerung bis 2015<br />
auferlegt, andernfalls wird sie gegen säumige<br />
Staaten vorgehen und wegen Vertragsverletzung<br />
vor dem Europäischen Gerichtshof<br />
klagen. Die Lagerstätten müssen so<br />
beschaffen sein, dass die Abfälle von der Biosphäre<br />
abgeschieden bleiben, bis keine Gefahr<br />
mehr von ihnen ausgeht – nach Festlegung<br />
des Bundesamtes für Strahlenschutz<br />
von 2005 heißt das: für eine Million Jahre. Bis<br />
zum Jahr 1 002 005 also. Die Zahl demonstriert<br />
den Hochmut einer hochriskanten Technologiewahl,<br />
die für Menschen kaum nachvollziehbare<br />
Fristen und Risiken einplanen<br />
muss. Aber das zu beklagen, reicht nicht: Das<br />
jahrelange Schwarze-Peter-Spiel zwischen Energiewirtschaft, Politik<br />
und Anti-AKW-Bewegung hat die Übernahme von Verantwortung<br />
für das immer dringender werdende Problem verhindert.<br />
Nach dem Fiasko von Gorleben, dem Skandal um die Asse und der<br />
Untauglichkeit anderer bislang in Aussicht genommener Standorte<br />
ist endlich ein annehmbares Endlager auszuweisen, politisch<br />
zu vereinbaren und mit maximalen Sicherheitsvorkehrungen zu<br />
errichten. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried<br />
Kretschmann (Grüne) hat uns auf den Boden der Tatsachen<br />
geholt, als er sagte, irgendwo müsse das Zeugs ja hin.<br />
Zunächst aber stößt jeder Vorschlag, Bürgerbeteiligung bei der<br />
Endlagersuche auf den Weg zu bringen, auf berechtigte Skepsis.<br />
Warum soll das Volk richten, was eine sich selbst blockierende<br />
und zur Einigung nicht fähige Allparteienkoalition verbockt hat?<br />
Aber wie, wenn nicht unter Einbeziehung der Betroffenen vor Ort<br />
und mit der Legitimierung durch den Souverän soll dies sonst gelingen?<br />
Gemeint ist erst einmal kein Volksentscheid, sondern eine<br />
tiefer gehende Erörterung des bestgeeigneten Endlager-Standortes<br />
durch die Öffentlichkeit, die in den Entwürfen für ein Endlagersuchgesetz<br />
breiten Raum einnimmt (www.endlagerdialog.de).<br />
Die wenigen Erläuterungen und Konkretisierungen des Gesetzesentwurfes<br />
lassen allerdings wenig Gutes hoffen; Bundesumweltminister<br />
Peter Altmaier (CDU) meint wohl, mit ein paar unverbindlichen<br />
Bürgerdialogen und Internetplattformen könne man<br />
sich die nötige Akzeptanz beschaffen.<br />
Das gelingt freilich schon bei weniger dramatischen Anlässen<br />
nicht, erst recht nicht in der Endlagerfrage. Und es geht ja um<br />
mehr als bloße Akzeptanzbeschaffung: nämlich darum, einer wie<br />
auch immer gearteten parlamentarischen Entscheidung durch<br />
eine verbindliche Empfehlung aus der Bürgerschaft zusätzliche<br />
Legitimation und Tragfähigkeit zu verleihen. Alle Vorzeichen für<br />
einen ruhigen und rationalen Meinungsaustausch sind allerdings<br />
negativ: Das Vertrauen in die politischen Eliten ist vollständig erschüttert,<br />
keine wissenschaftliche Autorität wird mehr anerkannt,<br />
Bürgerinitiativen haben sich in einer Wagenburg verschanzt,<br />
die Energiekonzerne stehlen sich aus der Verantwortung.<br />
Wer sich ernsthaft mit der Organisation von Bürgerbeteiligung<br />
befasst hat, möchte vor einer solchen Ausgangsszenerie davonlaufen.<br />
Allein die Dringlichkeit des Problems erfordert, im Zuge<br />
der Energiewende die Jahrhundertchance auf einen haltbaren politischen<br />
Kompromiss für ein durchdachtes Endlagersuchgesetz<br />
zu nutzen. Es gilt dabei, einen lokalen, nationalen und am Ende<br />
M 2 »Einstimmig!« © Gerhard Mester 2013<br />
auch europäischen Bürgerbeteiligungsprozess sorgfältig vorzubereiten<br />
und in Angriff zu nehmen. Bis 2015 muss eine Entscheidung<br />
gefällt sein, welche Endlagerstätten erkundet werden sollen,<br />
in den folgenden Jahren muss eine konsensfähige und<br />
nachhaltige Lösung gefunden werden, die deren schwere Lasten<br />
auch noch möglichst gerecht verteilt und den Betroffenen nicht,<br />
wie man es mit denen in Gorleben halten wollte, zuruft: Pech gehabt!<br />
Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Legitimität – das sind die<br />
normativen Leitlinien des im Gesetzentwurf angedeuteten Bürgerbeteiligungsprozesses.<br />
Der muss zugleich die nationale Aufgabe der Endlagersuche, deren<br />
Organisation einer neuen Behörde übertragen werden soll, an<br />
alle in Erwägung gezogenen Standorte dezentralisieren. Er muss<br />
zudem lokale Belange, die jeweils nach dem NIMBY-Prinzip (»Not<br />
in my Backyard«) wegdelegiert werden können, zum Ausgleich<br />
bringen. Was wir dafür brauchen, ist ein nationaler Ausschuss, der<br />
mehr ist als die Ethik-Kommission, die im Fall des Atomausstiegs<br />
nach Fukushima als Gremium ausgesuchter Persönlichkeiten tätig<br />
geworden ist. Wenig geeignet ist sicherlich auch eine vor laufender<br />
Kamera agierende Schlichtung, wie im Fall Stuttgart 21,<br />
oder die Stakeholder-Mediation am Frankfurter Flughafen, um<br />
nur die bekanntesten Beispiele zu nennen.<br />
Ein Patentrezept für die Zusammensetzung und beste Mischung<br />
gibt es nicht, persönliche Autorität, wissenschaftliche Kompetenz<br />
und gesellschaftliche Repräsentativität müssen fein balanciert<br />
werden.<br />
Denkbar ist ein Zukunftsrat, der sich gar nicht aus Prominenten<br />
rekrutiert, sondern aus einfachen Bürgern, die sich – wie eine<br />
parlamentarische Untersuchung – jeden gewünschten Sachverstand<br />
per Hearing heranziehen kann, und per Zufallsverfahren<br />
und nach soziodemografischen Kriterien wie Alter, Geschlecht<br />
und Bildung so zusammensetzen, dass sie den Querschnitt der<br />
Bevölkerung möglichst gut abbilden. Anders als amerikanische<br />
Geschworenengerichte sollen die »Laienschöffen« kein Urteil fällen,<br />
sondern eine Handlungsempfehlung aussprechen, die vom<br />
Parlament in der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden<br />
muss. Eine große Portion Gemeinsinn scheint bei der Endlagerfrage<br />
in jedem Fall unverzichtbar.<br />
Infrage kommende Standorte könnten in lokalen Gremien diskutiert<br />
werden, während eine Ratsversammlung auf nationaler<br />
Ebene die Ergebnisse aller Gremien bündeln und bewerten sollte.<br />
Besonders in Regionen, die vielleicht zu den Lastenträgern der<br />
Entwicklungen der partizipativen Demokratie in Europa<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
Endlagerfrage werden, könnte Bürgerbeteiligung<br />
eine wichtige Rolle<br />
spielen, um Konflikte gemeinschaftlich<br />
zu beraten, faire Ausgleichsmöglichkeiten<br />
zu entwerfen und die Bildung<br />
von Orten des Widerstands zu<br />
verhindern. Auch in den lokalen Gremien<br />
ist das Prinzip der direkten Betroffenheit<br />
gering zu halten, denn sie<br />
sollen sich schließlich nicht nur um<br />
den Standort, sondern auch um die<br />
langfristige Zukunft einer Region Gedanken<br />
machen.<br />
Denn darum geht es ja: wie die Bevölkerung<br />
sich die Existenzbedingungen<br />
und Lebensqualität ihrer Kinder, Enkel<br />
und Urenkel in einer Gegend vorstellt,<br />
in der – gegebenenfalls – das<br />
Endlager errichtet wird. Viele<br />
Perspek tiven – sozialpolitische, demografische<br />
und energiepolitische –<br />
stehen heute unter diesem futurischen<br />
Vorzeichen 2012, 2050, 2100.<br />
Und ganz offenbar ist unsere Zukunft<br />
keine lineare Fortschreibung des gewohnten<br />
Lebens. Wegen der zeitlich<br />
weitreichenden Folgen ist die atomare<br />
Endlagerung eine besondere<br />
Herausforderung für die Gerechtigkeit<br />
zwischen den Generationen.<br />
Der Teufel liegt bei einer öffentlichen<br />
Erörterung der Standortfrage mit allen<br />
Nebenerwägungen durch einen<br />
Zukunftsrat im prozeduralen Detail:<br />
Wie oft und wie lange tagen die nationale<br />
Ratsversammlung und lokale<br />
Gremien, wie viele Mitglieder sollen<br />
sie haben, sollen Bürger eine Aufwandsentschädigung<br />
erhalten? Wie<br />
können die Interessen künftiger Generationen<br />
systematisch berücksichtigt<br />
werden? Sicher benötigt der<br />
Zukunfts rat einen gewissen professionellen<br />
Apparat und finanzielle Ressourcen:<br />
Informationsmaterial muss<br />
M 3<br />
bereitgestellt, Debatten moderiert, Experten einbestellt, Ergebnisse<br />
gesichert und öffentlich zur Diskussion gestellt werden. Er<br />
arbeitet nicht fürs Fernsehen, aber eine kontinuierliche Dokumentation<br />
online und möglichst auch eine Berichterstattung in<br />
den Medien sind zentral.<br />
Es lohnt sich ein Blick ins Ausland: In Großbritannien fand 1999<br />
eine Konsensuskonferenz statt, in der 15 Bürger in mehreren Wochenendworkshops<br />
Vorschläge für eine effiziente und öffentlich<br />
akzeptierte Langzeitlagerung von radioaktivem Abfall entwickelt<br />
haben.<br />
Die dänische Behörde für Technikfolgenabschätzung führt seit<br />
dem Ende der achtziger Jahre erfolgreich solche Verfahren durch.<br />
Hier wird der Endbericht immerhin nicht nur der Öffentlichkeit,<br />
sondern auch allen Parlamentsmitgliedern übergeben. Der Zukunftsrat<br />
bräuchte allerdings sicherlich mehrere Monate für seine<br />
Arbeit und insgesamt weit mehr als 15 Mitglieder. Wesentlich ist,<br />
dass eine Bürgerbeteiligung über eine so weitreichende Entscheidung<br />
wie das Endlager nach demokratischen Kriterien und auf<br />
mehreren Ebenen konzipiert wird, damit jedes »Hier nicht!« mit<br />
dem »Hier auch nicht!« an anderer Stelle konfrontiert wird und<br />
damit gemeinsame Verantwortung entstehen und ein faire Verteilung<br />
der Lasten erreicht werden kann. Die weitere Voraussetzung<br />
für das Gelingen dieses Experiments ist eine geeignete Anbindung<br />
an den Entscheidungsprozess in den parlamentarischen<br />
Welche Formen von politischer Beteiligung werden von den Bürgern praktiziert<br />
und sind für sie erstrebenswert – Welche kommen nicht in Frage?<br />
Angaben in Prozent<br />
Form der<br />
Beteiligung<br />
Teilnahme an Wahlen<br />
Volksentscheide-Bürgerbegehren<br />
Abstimmung über Infrastrukturprojekte<br />
Teilnahme an einer Bürgerversammlung<br />
Mitgliedschaft in einem Interessenverband<br />
Schreiben eines Leserbriefes<br />
Beschwerde/Eingabe bei Abgeordneten<br />
Online-Umfrage im Internet<br />
Beratungen über kommunalen Bürgerhaushalt<br />
Teilnahme an einer Demonstration<br />
Abstimmung über bestimmte Fragen im Internet<br />
Elektronische Petition<br />
Teilnahme an einem Bürgerforum / Zukunftswerkstatt<br />
Mitgliedschaft in einer Bürgerinitiative<br />
Mitwirken in Partei ohne Mitgliedschaft<br />
Verfassen von Beiträgen in Internet-Foren/Blogs<br />
Mitgliedschaft in einer Partei<br />
Einsatz als Sachkundiger Bürger in Rat<br />
Habe ich schon einmal gemacht oder käme für mich in Frage Kommt für mich nicht in Frage Weiß nicht, keine Angabe<br />
Quelle: Bertelsmann Stiftung / Umfrage TNS-Emnid.<br />
Hab ich schon einmal<br />
gemacht oder käme<br />
für mich in Frage<br />
55<br />
55<br />
54<br />
51<br />
47<br />
47<br />
45<br />
39<br />
39<br />
34<br />
33<br />
32<br />
30<br />
27<br />
68<br />
64<br />
Kommt für mich<br />
nicht in Frage<br />
0 20 40 60 80 100<br />
»Welche Formen von politischer Beteiligung werden von den Bürgern praktiziert und sind für Sie erstrebenswert<br />
– Welche kommen nicht in Frage?« www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-<br />
CE93650F-414B9DD6/bst/xcms_bst_dms_34121_34144_2.pdf<br />
© Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahre 2011<br />
21<br />
29<br />
36<br />
44<br />
Gremien auf Bundes- und Länderebene und in den Gemeinden.<br />
Der Zukunftsrat hat im Sinn der Gewaltenteilung kein imperatives<br />
Mandat, aber er müsste gehört werden, und er sollte, damit politische<br />
Akteure und Konjunkturen ihn nicht ignorieren können,<br />
neben parlamentarischen Debatten über dessen Handlungsempfehlung<br />
auch ein verbindliches Feedback von der Regierung bekommen.<br />
Wenn man Bundespräsident Gauck als Schirmherrn gewinnen<br />
könnte, wäre das Verfahren zudem mit der nötigen personalen<br />
Autorität versehen.<br />
Der Vorschlag eines solchen Zukunftsrats mag vielen utopisch<br />
vorkommen. Das mag er sein, aber man muss ihn abgleichen mit<br />
anderen Entscheidungsmodalitäten, die bisher eben nicht zur<br />
Findung und Realisierung eines geeigneten Endlagers im Konsens<br />
geführt haben. Ein Endlager muss so beschaffen sein, dass<br />
eine Million Jahre keine Gefahr von ihm ausgeht<br />
Claus Leggewie, Patrizia Nanz: » Mehr Beteiligung für die Energiewende. Nach dem Fiasko<br />
um Gorleben braucht die Suche nach einem Atom-Endlager endlich mehr demokratische<br />
Basis: einen Zukunftsrat. «, Süddeutsche Zeitung 22.11.2012, S. 20<br />
78<br />
94<br />
5<br />
45<br />
45<br />
48<br />
52<br />
53<br />
54<br />
58<br />
60<br />
65<br />
67<br />
67<br />
69<br />
72<br />
17<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Entwicklungen der partizipativen Demokratie in Europa
18<br />
PATRIZIA NANZ | JAN-HENDRIK KAMLAGE*<br />
M 4<br />
Der Filder-Dialog in Kürze<br />
»Mit dem Filder-Dialog S 21 wollen die Projektpartner<br />
von Stuttgart 21 Transparenz<br />
über ihr Vorhaben vor Ort schaffen und mit<br />
den Betroffenen und der Bürgerschaft in einen<br />
konstruktiven Dialog treten. Sie nehmen<br />
dabei den Planfeststellungsabschnitt 1.3 auf<br />
den Fildern (beim Stuttgarter Flughafen) unter<br />
die Lupe: Sowohl die für diesen Abschnitt<br />
beantragte Trasse als auch weitere Trassen<br />
und Varianten sollen vorgestellt und diskutiert<br />
werden. Dabei geht es auch um die zugrunde<br />
liegenden Planungsprämissen und<br />
Bewertungskriterien. Zu den Vorgaben des<br />
Dialogs gehört unter anderem, dass der vereinbarte<br />
Kostendeckel nicht angehoben, der<br />
Terminplan eingehalten und über die sogenannte<br />
Null-Variante (die das Projekt Stuttgart<br />
21 grundsätzlich infrage stellt) nicht diskutiert<br />
wird.<br />
Ziel des Dialogverfahrens: Die Teilnehmenden äußern sich zu den<br />
verschiedenen Trassenvarianten und geben Empfehlungen an die<br />
Projektpartner. Dabei können auch andere Lösungen, als die bislang<br />
geplante Trasse herauskommen. Die Projektpartner haben<br />
zugesagt, nach Abschluss der Bürgerbeteiligung die Ergebnisse<br />
gemeinsam zu bewerten und zu beschließen, welche Empfehlungen<br />
bei der weiteren Planung berücksichtigt werden. Sie wollen<br />
die Machbarkeit dieser Empfehlungen anhand der geltenden Planungsprämissen<br />
und Bewertungskriterien ernsthaft prüfen. (…)<br />
Den ersten Schritt zum Filder-Dialog hat im Herbst 2010 die<br />
»Schlichtung« zum Gesamtprojekt Stuttgart 21 gesetzt. Damals<br />
hatte die Deutsche Bahn AG betont, sie wolle Planungen künftig<br />
anders angehen und mehr Bürgermitwirkung sowie eine bessere<br />
Informationspolitik gewährleisten Kurz darauf, im Frühjahr 2011,<br />
wechselte bei einem der Projektpartner die für Stuttgart 21 zuständige<br />
Spitze: Winfried Hermann, Grüne, der neue Minister für<br />
Verkehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg, plädierte<br />
dafür, an der noch nicht abgeschlossenen S21-Planung auf<br />
den Fildern die örtliche Bürgerschaft zu beteiligen. So beschlossen<br />
die Projektpartner am 24. Februar 2012, mit dem Filder-Dialog<br />
S21 eine neue Form der Bürgerbeteiligung anzugehen. Und sie<br />
kamen überein, die Planung und Durchführung des Dialogs in die<br />
Hände einer erfahrenen externen Fachkraft für Moderation zu legen.<br />
Um den Filder-Dialog so optimal wie möglich zu gestalten, wurde<br />
ein auf Großgruppenmoderation spezialisierter und von außerhalb<br />
der Region Stuttgart kommender Experte gesucht. Beste<br />
Sachkenntnis bezüglich des Verfahrens bei möglichst großem Abstand<br />
zu den verhandelten Inhalten, so lautete die Vorgabe. Die<br />
Wahl fiel auf den Moderator Ludwig Weitz aus Bonn.«<br />
© www.filderdialog-s21.de/ueberdenfilderdialog-s21.html<br />
M 5<br />
Markus Heffner, Malte Klein: »Filderdialog zu Stuttgart<br />
21«: Einige Bürger fühlen sich nur als Statisten«<br />
Der Filderdialog, ein demokratisches Verfahren mit ergebnisoffenem<br />
Ausgang, bei dem sich Bürger einbringen und echte Verbesserungen<br />
bewirken konnten? Darüber gibt es auch nach dem<br />
Abschluss der Veranstaltung unterschiedliche Meinungen. Zumindest<br />
die Mehrheit der Teilnehmer selbst, so die Bilanz der<br />
Schlussrunde, ist mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen.<br />
Etliche Bürger klagten in ihrem Abschlusswort aber auch darüber,<br />
dass sie sich von den Projektpartnern nicht ernst genommen gefühlt<br />
hätten, nur Statisten gewesen seien und der Ausgang von<br />
vorneherein festgestanden hätte, so eine der Zufallsbürgerinnen.<br />
Einig waren sich die Teilnehmer dagegen in dem Wunsch, über<br />
M 6 Der Moderator des »Filderdialogs – S 21«: Ludwig Weitz, Bonn © dpa, picture alliance<br />
den weiteren Verlauf und die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien<br />
der Projektpartner informiert zu werden. Eine Art Fortsetzung des<br />
Filderdialogs ist zudem auch im Sinne der Staatsrätin Gisela Erler<br />
und des Moderatos Ludwig Weitz, die das Verfahren erst als beendet<br />
sehen, so Weitz, wenn ein konkretes Ergebnis auf dem Papier<br />
steht, das auch umgesetzt wird. Der Verkehrsminister Winfried<br />
Hermann (Grüne), der im Filderdialog ein gelungenes Experiment<br />
der Bürgerbeteiligung sieht, hat eine solche Fortführung fest zugesagt.<br />
Drei Monate lang wollen die Projektpartner nun in einer<br />
Machbarkeitsstudie prüfen lassen, ob der Vorschlag, den Fernbahnhof<br />
auf den Fildern unter der Flughafenstraße und damit näher<br />
an die S-Bahn-Station zu bauen, tragfähig und finanziell realisierbar<br />
ist. Ein Vorteil dieser Variante wäre, dass zumindest die<br />
S-Bahn-Station frei von Mischverkehr wäre, da die Fern- und Regionalzüge<br />
direkt in den Flughafenbahnhof einschleifen würden.<br />
Auf der S-Bahn-Trasse zwischen Rohrer Kurve und Flughafen<br />
müssten die Kommunen dagegen mit dem ungeliebten Mischverkehr<br />
leben, weshalb nun auch die Möglichkeiten des Lärm- und<br />
Erschütterungsschutzes ausgelotet werden sollen. Im Spätherbst,<br />
so Hermann, könne das Ministerium die ersten Ergebnisse<br />
vorlegen.<br />
Prominente Teilnehmer wie Roland Klenk, der Oberbürgermeister<br />
von Leinfelden-Echterdingen, oder Institutionen wie der Umweltverband<br />
BUND und die Schutzgemeinschaft Filder haben<br />
derweil ihre Meinung zu dem Verfahren schon während des Dialogs<br />
mit ihrem Austritt kundgetan. Die Staatsrätin Gisela Erler<br />
wertet es trotz dieser Probleme als einen richtungsweisenden<br />
Schritt: »Wir haben einen Grundstein gelegt für ein neues Denken<br />
und für ein Verfahren, wie man zukunftsfähige Verkehrslösungen<br />
mit den Bürgern erarbeiten kann.«<br />
Das große Problem des Dialogs sei gewesen, dass er viel zu spät<br />
im Projektverlauf begonnen und unter enormem Zeitdruck gestanden<br />
habe. Gemessen an den schwierigen Bedingungen sei<br />
durchaus etwas Zukunftsweisendes herausgekommen, so Erler.<br />
Dass nun etwa auch die Sicherung der Gäubahn für den Nahverkehr<br />
mit großer Priorität geprüft werde, könnten die Bürger als<br />
Erfolg verbuchen. Sicher sei es für viele Teilnehmer bitter, dass<br />
sich ihre Wunschtrasse nicht durchgesetzt hat. »Damit muss man<br />
bei einem demokratischen Verfahren, das nur empfehlenden<br />
Charakter hat, aber rechnen.« Auch von den »unterlegenen« Befürwortern<br />
der Gäubahnvariante seien jedoch überwiegend positive<br />
Rückmeldungen bezüglich des Verfahrens gekommen.<br />
Die Erfahrungen der vergangenen Wochen sollen nun in geplante<br />
Bürgerverfahren bei vergleichbaren Infrastrukturprojekten in<br />
Schwäbisch Gmünd und Tübingen einfließen, und auch bei der<br />
Planung des Rosensteinquartiers hält die Staatsrätin eine sehr<br />
frühe Beteiligung der Bürger für höchst hilfreich. »Wir alle haben<br />
im Filderdialog viel gelernt«, sagt Erler: »Was man tun sollte – und<br />
was besser nicht.«<br />
Entwicklungen der partizipativen Demokratie in Europa<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
Am Montag sprachen die Mitglieder der<br />
»Arbeits gruppe S 21« derweil über die Stellungnahmen<br />
der Projektpartner zu den Empfehlungen<br />
des Filderdialogs. »Es ist erschreckend,<br />
dass wir in Leinfelden-Echterdingen<br />
mehr Lärmschutz entlang der S-Bahn-Trasse<br />
als gesetzlich nötig selbst zahlen sollen«,<br />
sagte Uwe Janssen (Grüne).<br />
© Markus Heffner, Malte Klein: »Filderdialog« zu Stuttgart 21:<br />
Einige Bürger fühlen sich nur als Statisten, Stuttgarter Zeitung<br />
vom 17.7.2012<br />
M 7<br />
Jan-Hendrik Kamlage: »Tunneldialog<br />
und Bürgerbeteiligung in<br />
Schwäbisch Gmünd«<br />
In Schwäbisch Gmünd soll mit dem Einhorn-<br />
Tunnel die Innenstadt vom Straßenverkehr<br />
entlastet werden. Geplant ist, dass die mit<br />
Staub und Schadgasen belastete Luft des 2,2 Kilometer langen<br />
Tunnels über einen zentralen Kamin ausgeblasen wird. Anwohner<br />
befürchten gesundheitliche und ökologische Folgen steigender<br />
Immissionsbelastungen im Bereich des Kamins und schlugen den<br />
Einbau eines Tunnelfilters vor. Dies wurde von dem Regierungspräsidium<br />
Stuttgart (RP) sowie dem Ministerium für Verkehr und<br />
Infrastruktur Baden-Württemberg (MVI) und dem Bundesministerium<br />
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) jedoch<br />
abgelehnt, da die gesetzlichen Grenzwerte für Luftschadstoffe<br />
nicht überschritten würden. Im September 2007 gründete sich<br />
die Bürgerinitiative »Pro Tunnelfilter«. Kurz danach wurde in<br />
Schwäbisch Gmünd die Umweltzone eingeführt, die in der Bevölkerung<br />
über wenig Akzeptanz verfügt.<br />
Um den Konflikt zu schlichten und die Sachfrage zu klären, wurde<br />
im Februar 2011 durch das Bundesministerium für Bildung und<br />
Forschung (BMBF) eine Machbarkeitsstudie in Aussicht gestellt.<br />
Die Studie sollte klären, ob und unter welchen Bedingungen ein<br />
Tunnelfilter für den Einhorn-Tunnel einsetzbar sei. Daraufhin erarbeiteten<br />
im März 2011 Vertreterinnen und Vertreter aus den<br />
Bürgerinitiativen, der Wirtschaft, der Stadtverwaltung und der<br />
Lokalpolitik gemeinsam einen Fragenkatalog, der innerhalb des<br />
Verfahrens bearbeitet werden sollte. Im Anschluss wählte die<br />
Gruppe das Konsortium zur Umsetzung der Studie aus.<br />
Der Tunneldialog in Schwäbisch Gmünd ist ein Anwendungsfall<br />
für Verfahren der Präsenzbeteiligung. Vertreter aus Zivilgesellschaft,<br />
Unternehmen, Verwaltung und Politik beraten innerhalb<br />
eines speziell für diesen Fall entwickelten Beteiligungsformates<br />
die strittige Frage, ob und inwieweit ein Tunnelfilter für den dortigen<br />
Einhorn-Tunnel von Nutzen sein kann.<br />
© Jan-Hendrik Kamlage: Tunneldialog und Bürgerbeteiligung in Schwäbisch Gmünd. Originalbeitrag.<br />
M 8<br />
Wolfgang Fischer: » Bessere Wege als der Filter zu<br />
sauberer Luft«. Tunneldialog und Bürgerbeteiligung in<br />
Schwäbisch Gmünd<br />
Schwäbisch Gmünd. Die Abluft des Tunnels muss gefiltert werden,<br />
davon waren viele Bürger überzeugt. Doch seit April hat es<br />
vier Dialogrunden von Bürgern und Experten zu diesem Thema<br />
gegeben, und am Ende fasste zum Beispiel Schönblick-Geschäftsführer<br />
Martin Scheuermann, bisher überzeugter Filter- Befürworter,<br />
zusammen: »Wir sind uns einig, dass die gesundheitlichen<br />
Probleme, die wir befürchtet haben, nicht eintreten.« Prof. Dr.<br />
Erich Wichmann, Physiker und Mediziner an der Uni München,<br />
hatte den Zuhörern im Stadtgarten zuvor nochmals dargelegt,<br />
dass der Tunnel die Luftsituation in Gmünd deutlich verbessere.<br />
M 9 Kleingruppenarbeit beim »Filderdialog 21« © dpa, picture alliance<br />
Die zusätzliche Wirkung des Filters wäre dagegen verschwindend<br />
gering. Es gebe bessere Wege, die Luftqualität zu verbessern, folgerte<br />
auch Martin Scheuermann. Welche, das hatten die Dialog-<br />
Teilnehmer zuvor in einer Arbeitsgruppe diskutiert. Grünen-<br />
Stadträtin Brigitte Abele, die die Ergebnisse vortrug, nannte als<br />
ersten Punkt die Umweltzone: Rascher als vorgesehen müsse<br />
auch Fahrzeugen mit gelber Plakette die Zufahrt verboten werden,<br />
zudem solle die Einhaltung schärfer kontrolliert werden. (…)<br />
Auch Oberbürgermeister Richard Arnold räumte im Gespräch mit<br />
der Gmünder Tagespost ein, dass der Tunneldialog anders als erwartet<br />
verlaufen sei. »Die Hoffnung auf Argumente für den Filter<br />
hat sich nicht erfüllt.« Dafür hätten sich andere Perspektiven eröffnet.<br />
Zum Beispiel könnte er sich vorstellen, in Gmünd modellhaft<br />
an einer Stelle Moose oder andere Pflanzen, die Feinstaub<br />
binden, anzubauen – vielleicht schon zur Landesgartenschau. Außerdem<br />
gefällt ihm die Idee eines Clusters »Saubere Luft für den<br />
Raum Gmünd« (…). Diese Idee hatte Dr.-Ing. Hartmut Pflaum vom<br />
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik<br />
eingebracht. Er definierte »Cluster« als Zusammenschluss von<br />
Akteuren mit gleichen Interessen in einer Region. (…)<br />
Ebenfalls Thema war der Verlauf des Dialogs: Martin Scheuermann<br />
anerkannte, dass die Experten auch »sehr, sehr kritische<br />
Fragen« der Bürger beantwortet hätten. Im Gegenzug lobte Moderator<br />
Lars Eggert die außergewöhnliche Offenheit der Bürger in<br />
diesen Dialogrunden.<br />
Auch Claus Leggewie vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen,<br />
der den Dialog begleitet hatte, lobte die Form der Diskussionen.<br />
Allerdings hätte er sich mehr Politiker – auch überregionale<br />
– als Teilnehmer gewünscht. Eine Zuhörerin kritisierte, dass<br />
nur wenige Bürger gekommen waren. Andere hätten sich gewünscht,<br />
dass dieser Dialog früher gekommen wäre. Filter-Ingenieur<br />
Bernd Müller verteidigte in einem persönlichen Fazit die<br />
Forderung nach einem Filter. Doch die Teilnehmer des Dialogs<br />
diskutierten bereits, wie man die neue Erkenntnis, dass der Filter<br />
eben doch nicht das Optimum für Gmünd wäre, den Bürgern mitteilt,<br />
die man zuvor um Unterschriften für den Filter gebeten<br />
hatte. Wie es weitergeht, legte auch Lars Eggert dar: Voraussichtlich<br />
Ende September 2013 wird ein Abschlussbericht des Gmünder<br />
Tunneldialogs vorliegen, der an den Auftraggeber, das Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung, übergeben werden muss.<br />
Diese Aufgabe, schlug er vor, könnte eine Gmünder Delegation<br />
übernehmen.<br />
© Wolfgang Fischer: Bessere Wege als der Filter zu sauberer Luft. Einhelliges Fazit bei der<br />
Abschlusssitzung des Tunneldialogs/Umweltzone ausweiten und »verschärfen«?. Gmünder<br />
Tagespost vom 20.07.2012<br />
19<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Entwicklungen der partizipativen Demokratie in Europa
BÜRGERBETEILIGUNG IN DEUTSCHLAND UND EUROPA<br />
4. Bürgerbeteiligung und soziale<br />
Gleichheit: Zwei Prinzipien im<br />
Spannungs feld von Utopie und Wirklichkeit<br />
am Beispiel Deutschland<br />
OSCAR W. GABRIEL<br />
20<br />
Ein Ausbau der politischen Beteiligung erscheint derzeit<br />
vielen als Königsweg zu einer besseren Demokratie. Eine<br />
breite Bürgerbeteiligung soll dazu dienen, die politische<br />
Agenda zu öffnen und zu erweitern, die Inhalte der politischen<br />
Entscheidungen an den Präferenzen der Bürger auszurichten,<br />
die Distanz zwischen den Regierenden und den Regierten zu<br />
verringern, die Transparenz politischer Prozesse zu verbessern,<br />
die Qualität der politischen Auseinandersetzung zu erhöhen,<br />
die Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen zu fördern<br />
und die demokratische Kompetenz der Bürger zu stärken<br />
(Dahl 1998: 37–41; Parry/Moyser/Day 1993: 6–16). Im Prinzip<br />
sind diese Erwartungen normativ gerechtfertigt, denn nur ein<br />
Staat, in dem alle Bürger über gleiche Beteiligungsrechte verfügen<br />
und von ihnen Gebrauch machen, darf das Attribut »demokratisch«<br />
beanspruchen. In einem politischen System, in<br />
dem das Recht, im Namen der politischen Gemeinschaft allgemein<br />
verbindliche Entscheidungen zu treffen und diese<br />
durchsetzen, sich aus dem Grundsatz der Volkssouveränität<br />
ableitet, bilden Demokratie und Bürgerbeteiligung notwendigerweise<br />
eine Einheit (Dahl 1971; van Deth 2009: 141; Verba/<br />
Schlozman/Brady 1995: 1). Doch im Gegensatz zu dem breiten<br />
Konsens über die Zusammengehörigkeit der Prinzipien »Bürgerbeteiligung«<br />
und »Demokratie« sind einzelne Aspekte dieser<br />
Beziehung umstritten. Es existieren unterschiedliche Auffassungen<br />
darüber, wie viel Beteiligung eine funktionsfähige<br />
Demokratie benötigt, in welchen Formen sie sich vollziehen<br />
sollte, welchen konkreten Zwecken bürgerschaftliche Beteiligung<br />
dient und welche demokratischen Prinzipien sie fördert,<br />
ob sich alle diese Ziele gleichzeitig erreichen lassen und welchen<br />
von ihnen im Konfliktfall der Vorzug zu geben ist.<br />
Abb. 1 »Die Zeit ist reif für Volksabstimmungen …« © Heiko Sakurai, 26.6.2012<br />
Dieser Beitrag untersucht, wie sich die wichtigsten Merkmale der<br />
Sozialstruktur auf die politische Aktivität der Bürger auswirken.<br />
Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die politisch bedeutsamsten<br />
Merkmale der Sozialstruktur, der sozioökonomische Status,<br />
das Geschlecht, das Alter und der Migrationshintergrund der Bürger.<br />
Zunächst gebe ich einen Überblick über das Niveau und die<br />
Entwicklung der politischen Beteiligung im Zeitraum 1998 bis<br />
2008 und stelle dann den sozialen Hintergrund der politischen<br />
Beteiligung dar. Im Schlussteil erfolgt eine Diskussion der Bedeutung<br />
der dargestellten Sachverhalte für die Qualität der Demokratie<br />
in Deutschland.<br />
Bürgerbeteiligung, Demokratie und Gleichheit:<br />
eine problematische Beziehung?<br />
Nicht weniger kompliziert stellt sich die Beziehung zwischen den<br />
Prinzipien »Bürgerbeteiligung« und »Demokratie« bei einem<br />
Blick auf die Ergebnisse der empirischen Forschung dar. Wie zahlreiche<br />
Studien belegen, beteiligt sich jenseits der Stimmabgabe<br />
bei nationalen Parlaments- oder Präsidentschaftswahlen nur eine<br />
Minderheit der Bürger aktiv am politischen Leben, und auch die<br />
Wahlbeteiligung ist in den letzten Jahrzehnten in fast allen Demokratien<br />
zurückgegangen (z. B. Norris 2002; Blais 2010). Darüber<br />
hinaus nehmen nicht alle Mitglieder der politischen Gemeinschaft<br />
ihre Beteiligungsrechte in gleichem Ausmaß wahr (so<br />
schon: Nie/Powell/Prewitt 1969; Verba/Nie/Kim 1978; neuestens:<br />
Hooghe/Quintelier 2013). Nicht nur die Breite der bürgerschaftlichen<br />
Beteiligung, auch die soziale Zusammensetzung der politisch<br />
Aktiven bleibt in den modernen Gesellschaften hinter den<br />
demokratischen Idealen zurück. Es gibt sogar Indizien dafür, dass<br />
sich diese Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit in den letzten<br />
Jahrzehnten nicht verringert hat, sondern gewachsen ist.<br />
Bürgerbeteiligung: Struktur und Entwicklung<br />
Als politische Beteiligung bezeichnet man in Anlehnung an Kaase<br />
(1997: 167) alle freiwillig ausgeübten Aktivitäten, mittels derer Privatpersonen<br />
versuchen, Einfluss auf politische Entscheidungen<br />
zu nehmen oder direkt an diesen mitzuwirken. Seit dem Beginn<br />
der Demokratisierung der modernen Staaten hat die politische<br />
Beteiligung der Bürger zugenommen und an Vielfalt gewonnen.<br />
Zwar ist die Stimmabgabe bei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen<br />
noch immer die am weitesten verbreitete Form aktiver<br />
politischer Teilnahme, daneben existieren jedoch zahlreiche weitere<br />
Beteiligungsmöglichkeiten, die sich in ihren strukturellen<br />
Eigenschaften und ihren Zielen voneinander unterscheiden und<br />
von der Bevölkerung unterschiedlich breit genutzt werden. Hierzu<br />
zählen Aktivitäten im Rahmen der Strukturen und Prozesse der<br />
repräsentativen Demokratie, wie die Mitarbeit in Parteien oder<br />
die Versuche, durch Politiker- oder Verwaltungskontakte politischen<br />
Einfluss auszuüben. Darüber hinausgehend, greift die Bevölkerung<br />
seit der Mitte der 1970er Jahre in allen modernen<br />
Gesell schaften zur Durchsetzung ihrer Ziele vermehrt auf Protestaktionen<br />
wie Unterschriftensammlungen, Demonstrationen, Verkehrsblockaden<br />
und Produktboykotte zurück. Schließlich wurden<br />
Bürgerbeteiligung und soziale Gleichheit D&E Heft 65 · 2013
in den letzten Jahrzehnten wurden in 100<br />
Deutschland und anderen Demokratien vermehrt<br />
Möglichkeiten geschaffen, durch<br />
Volksbegehren und -entscheide politischen<br />
Einfluss auszuüben. Zu guter Letzt nutzt eine<br />
80<br />
wachsende, wenn auch immer noch relativ<br />
kleine, Gruppe von Bürgern das Internet als<br />
Mittel der politischen Beteiligung (vgl. ausführlich<br />
dazu: Gabriel/Völkl 2005; Gabriel/<br />
Völkl 2008; van Deth 2009).<br />
60<br />
Auch wenn die Beteiligung an der Wahl der<br />
politischen Führung für die meisten Bürger<br />
die wichtigste Form politischer Einflussnahme<br />
geblieben ist, zeigt die empirische 40<br />
Forschung mit großer Deutlichkeit, dass die<br />
vielfältigen Möglichkeiten zum politischen<br />
Engagement von einer wachsenden Zahl von<br />
Bürgern genutzt werden. Zwar ist die Wahlbeteiligung<br />
in den letzten zwanzig Jahren in<br />
20<br />
Deutschland stärker gesunken als es die Daten<br />
in Abbildung 2 erkennen lassen, jedoch<br />
handelt es sich dabei eher um eine Ausnahme 0<br />
als um die Regel im politischen Engagement:<br />
Entweder ist das politische Engagement gestiegen<br />
– wie im Fall der legalen Protestaktionen<br />
– oder es ist zumindest stabil geblieben.<br />
Außer der Wahlbeteiligung hat sich in<br />
Deutschland keine andere Form der politischen<br />
Partizipation rückläufig entwickelt.<br />
Insgesamt ist somit die Inklusivität des politischen Systems gewachsen.<br />
Dies bestätigen auch weitere empirische Studien (Hinweise<br />
bei: Gabriel 2011: 24–29).<br />
Welche Gruppen betätigen sich politisch und<br />
welche bleiben inaktiv?<br />
Ungeachtet des relativ breiten bürgerschaftlichen Engagements<br />
beteiligt sich jeder zweite Deutsche nicht aktiv am gesellschaftlichen<br />
bzw. politischen Leben, jedenfalls soweit das Engagement<br />
über die Stimmabgabe bei Wahlen hinausgeht. Solange man<br />
nicht die unrealistische Erwartung hegt, dass alle Bürger jederzeit<br />
ihre Partizipationsrechte wahrnehmen, ist dieser Sachverhalt<br />
für sich genommen nicht problematisch. Er kann aber dann zu<br />
einer Herausforderung für die Demokratie werden, wenn sich die<br />
aktiven und die inaktiven Bevölkerungsgruppen systematisch in<br />
ihrer sozialen Herkunft und in ihren politischen Wünschen und<br />
Ideen voneinander unterscheiden. Wie die empirische Forschung<br />
vielfach belegte, sind ressourcenstarke, sozial gut integrierte<br />
Menschen politisch aktiver als Personen, denen diese Merkmale<br />
fehlen (Burstein 1972; Marsh/Kaase1979; Nie/Powell/Prewitt 1969;<br />
Verba 2003; Verba/Nie/Kim 1978; Verba/Schlozman/Brady 1995).<br />
Dies stellt eine Herausforderung an ein demokratisches Regime<br />
dar, weil die politisch aktiven Teile der Öffentlichkeit die politische<br />
Führung möglicherweise mit Forderungen konfrontieren,<br />
die sich von denen der inaktiven Bevölkerung unterscheiden. Unter<br />
diesen Bedingungen kann die ungleiche Wahrnehmung von<br />
Partizipationsrechten in Konflikt mit den Forderungen nach politischer<br />
Gleichheit und nach einem gegenüber allen Gruppen verantwortlichen<br />
Handeln der politischen Führung geraten.<br />
Bevor man dieser Frage im Einzelnen nachgeht, ist es sinnvoll, die<br />
für das politische Engagement maßgeblichen sozialen Merkmale<br />
zu bestimmen, die dazu führen können, dass die politische Führung<br />
durch die Beschäftigung mit den von den Aktivisten artikulierten<br />
Forderungen einseitige oder verzerrte Informationen über<br />
die in einer Gesellschaft vorherrschenden Bedürfnisse und Probleme<br />
erhält.<br />
1988 1998 2008<br />
Wählen<br />
Petition/<br />
Unterschrift<br />
An Diskussion<br />
teilnehmen<br />
Angemeldete<br />
Demonstration<br />
In Bürgerinitiative<br />
mitarbeiten<br />
In einer Partei<br />
mitarbeiten<br />
Nicht angemeldete<br />
Demonstration<br />
Abb. 2 Die Entwicklung ausgewählter Formen politischer Beteiligung in Deutschland, 1988–2008<br />
(Angaben: Prozentanteile).<br />
© Oscar W. Gabriel, Quelle: Allbus, eigene Auswertung. 1988 wurden nur in<br />
West<strong>deutschland</strong> Daten erhoben, für 1998 und 2008 sind die Daten für Ost- und<br />
West<strong>deutschland</strong> entsprechend Bevölkerungsverteilung repräsentativ gewichtet.<br />
Sozioökonomischer Status und Partizipation<br />
An erster Stelle ist in diesem Zusammenhang die sozioökonomische<br />
Stellung von Individuen zu nennen, die sich aus ihrem Bildungsniveau,<br />
ihrem Einkommen, der Art ihrer Berufstätigkeit und ihrer<br />
subjektiven Schichteinstufung ergibt. Die empirische Politikwissenschaft<br />
interessiert sich seit ihren Anfängen für die politische<br />
Bedeutung der soziökonomischen Schichtung und konnte zeigen,<br />
dass die gesellschaftliche Stellung von Individuen ihr politisches<br />
Verhalten und damit das politische Leben in modernen Gesellschaften<br />
in vielfältiger Weise prägt. In der Sozialstruktur angelegte<br />
Interessen und Wertvorstellungen führten in der Mitte des<br />
19. Jahrhunderts zur Bildung politischer Parteien, die sich der Vertretung<br />
der politischen Interessen bestimmter sozioökonomischer<br />
Gruppen widmeten und bei diesen bis zum heutigen Tage<br />
überdurchschnittlich starke Unterstützung finden (Lipset/Rokkan<br />
1967; neuere empirische Daten hierzu bei Elff/Roßteutscher<br />
2009). Auch das aktive politische Engagement der Menschen<br />
hängt stark von ihrer sozio-ökonomischen Position ab. Wie<br />
Schattschneider schon vor einem halben Jahrhundert anmerkte,<br />
singt der Chor im Himmel der pluralistischen Demokratien mit<br />
einem starken Oberschichtakzent (Schattschneider 1960).<br />
Unter den sozioökonomischen Charakteristika wird dem Bildungsniveau<br />
traditionell eine besonders wichtige Rolle als Antriebskraft<br />
politischen Engagements zugeschrieben. Im Laufe<br />
ihrer Bildungskarriere erwerben die Menschen diejenigen Wissensbestände,<br />
Kompetenzen, Wertorientierungen und Einstellungen,<br />
die sie zu einem sozialen und politischen Engagement<br />
befähigen oder motivieren. Zugleich öffnet eine qualifizierte Bildung<br />
den Zugang zu sozialen Netzwerken, was ebenfalls das politische<br />
Engagement erleichtert. Aus diesen Gründen erwies sich<br />
das Bildungsniveau in zahlreichen Studien als der wichtigste Bestimmungsfaktor<br />
der politischen Beteiligung. Je höher ihr formales<br />
Bildungsniveau ist, desto stärker engagieren sich Bürger in<br />
der Politik.<br />
Diese Annahme bestätigt sich auch für Deutschland. Wie | Abb. 3 |<br />
zeigt, steigt die Beteiligung an sämtlichen hier untersuchten politischen<br />
Aktivitäten mit dem formalen Bildungsabschluss. Allerdings<br />
stellt sich dieser Zusammenhang bei einzelnen Arten der<br />
Beteiligung unterschiedlich dar. Am schwächsten beeinflusst das<br />
21<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Bürgerbeteiligung und soziale Gleichheit
22<br />
OSCAR W. GABRIEL<br />
Bildungsniveau die Stimmabgabe bei Wahlen.<br />
Die Beteiligung an dieser Aktivität fällt<br />
bei Personen ohne abgeschlossene Schulbildung<br />
mit 67 Prozent wesentlich geringer aus<br />
als in den übrigen Bildungsgruppen. Diese<br />
unterscheiden sich im Niveau der Wahlbeteiligung<br />
aber kaum voneinander. Selbst Personen<br />
mit Hochschulreife beteiligen sich nur<br />
geringfügig stärker an Wahlen als die anderen<br />
Gruppen mit einer abgeschlossenen,<br />
aber weniger qualifizierten Schulbildung. In<br />
allen diesen Gruppen liegt die berichtete<br />
Wahlbeteiligung über 80 Prozent.<br />
Einen wesentlich größeren Unterschied<br />
macht das Bildungsniveau für die übrigen Arten<br />
politischer Beteiligung. In den für repräsentative<br />
Demokratien typischen Formen<br />
engagieren sich nur 13 Prozent der Befragten<br />
ohne Schulabschluss, aber fast jeder zweite<br />
Bürger mit Hochschulreife (44 %). Noch stärker<br />
wirkt sich das Bildungsniveau auf die Beteiligung<br />
an Protestaktivitäten aus. Nicht<br />
einmal jeder vierte Befragte ohne Schulabschluss<br />
(23 %) nimmt an Protestaktionen teil,<br />
dies tun aber fast drei Viertel der Bürger mit<br />
Hochschulreife (73 %). Für die meisten Personen<br />
mit mittleren oder höheren Bildungsabschlüssen<br />
sind Protestaktivitäten ein typisches<br />
Mittel zur politischen Einflussnahme. Dagegen setzt nur<br />
eine Minderheit der Befragten mit niedrigem Bildungsniveau auf<br />
diese Aktionen. Online-Proteste konnten sich in keiner Bildungsschicht<br />
als bedeutsame Beteiligungsform etablieren, aber auch<br />
hier gilt: Anders als bei den gut gebildeten gesellschaftlichen<br />
Gruppen spielen sie für Personen mit einem niedrigen formalen<br />
Bildungsniveau praktisch keine Rolle.<br />
Neben dem Bildungsniveau gelten die Merkmale Einkommen,<br />
subjektiv wahrgenommene Schichtzugehörigkeit und berufliche<br />
Stellung als weitere Indikatoren des sozialen Status von Individuen.<br />
Ihre Bedeutung für das politische Engagement wurde in<br />
zahlreichen Studien empirisch belegt und zeigt sich auch in unseren<br />
Daten (Vgl. | Abb. 4 |). Angehörige Akademischer Freier Berufe<br />
und Beamte, Personen die sich selbst der oberen Mittelschicht<br />
oder der Oberschicht zurechnen und die Bezieher hoher Einkommen<br />
weisen das höchste Niveau politischer Beteiligung auf, und<br />
zwar unabhängig von der gewählten Form des Engagements. Dagegen<br />
sind Personen ohne Beruf, Arbeiter, Unterschichtangehörige<br />
und die Bezieher kleiner Einkommen am wenigsten aktiv bei<br />
der Artikulation und Durchsetzung ihrer politischen Forderungen.<br />
Um dies an einigen Beispielen zu illustrieren: Während nur<br />
knapp 80 Prozent der Arbeiter angaben, sich an Bundestagswahlen<br />
zu beteiligen, waren dies bei den Angehörigen der Freien Berufe<br />
über 95 Prozent. Über Aktivitäten im Rahmen der repräsentativ-demokratischen<br />
Strukturen berichtete jeder vierte Befragte,<br />
der keinem Beruf nachgeht, aber fast zwei von drei Angehörigen<br />
der Freien Berufe. Im Vergleich mit Arbeitern haben sich nach eigenen<br />
Angaben doppelt so viele Beamte und Freiberufler an Protestaktivitäten<br />
beteiligt. Bei den Onlineprotesten beträgt die<br />
Relation zwischen der inaktivsten (ohne Beruf) und der aktivsten<br />
Gruppe (Freiberufler) sogar eins zu sechs. Ähnliche Strukturen<br />
zeigen sich beim Vergleich der Einkommensgruppen und der subjektiven<br />
Schichtkategorien. Auch wenn alle diese Faktoren eine<br />
wichtige Rolle für die Entscheidung von Individuen spielen, politisch<br />
aktiv zu werden oder passiv zu bleiben, ist keine dieser Größen<br />
für sich betrachtet für das politische Engagement so bedeutsam<br />
wie der formale Bildungsabschluss. Insofern hat die in<br />
Deutschland häufig kritisierte soziale Schieflage im Bildungssystem<br />
eine unmittelbare Konsequenz für den Zugang bildungsferner<br />
Schichten zum politischen System. Angehörige dieser Gruppen<br />
nutzen weniger als andere ihre Chance, sich im politischen<br />
Anteil Aktiver<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
ohne Abschluss<br />
Volks-/Hauptschule<br />
Mittlere Reife<br />
Bildungsabschluss<br />
Fachhochschulreife<br />
Leben Gehör zu verschaffen. Das Zusammenwirken von Einkommenssituation,<br />
Berufstätigkeit und Bildungsniveau verschärft die<br />
ungleiche Wahrnehmung der Beteiligungschancen durch einzelne<br />
gesellschaftliche Gruppen.<br />
Der Gender-Aspekt<br />
Hochschulreife<br />
Wahlbeteiligung<br />
Traditionell<br />
Protest<br />
Online<br />
Abb. 3 Bildungsabschluss und politische Beteiligung in Deutschland, 2008.<br />
© Oscar W. Gabriel, Daten: Allbus 2008<br />
Neben der sozioökonomischen Stellung von Individuen gehört<br />
die Geschlechtszugehörigkeit zu den besonders häufig untersuchten,<br />
seit einige Jahren politisch am stärksten diskutierten<br />
Bestimmungsfaktoren politischer Beteiligung. Der in den 1960er<br />
Jahren in den modernen Gesellschaften einsetzende Wertewan-<br />
Wahlbeteiligung<br />
Traditionell<br />
Protest<br />
Online<br />
Ohne Beruf 83,8 24,9 45,9 5,0<br />
Arbeiter 78,9 27,5 37,5 5,8<br />
Selbständige/Landwirte 85,9 39,0 57,0 7,9<br />
Angestellte 87,9 40,3 66,9 13,1<br />
Beamte 93,6 59,5 81,7 17,6<br />
Akad. Freie Berufe 95,5 62,2 80,0 31,1<br />
Ungleichheit min–max 1,21 2,50 2,18 6,22<br />
Unterschicht 68,4 22,0 41,4 6,8<br />
Arbeiterschicht 80,1 21,5 38,8 5,1<br />
Mittelschicht 87,5 35,5 57,5 9,0<br />
Obere Mittelschicht/OS 90,5 46,5 73,3 15,1<br />
Ungleichheit min–max 1,32 2,16 1,89 2,96<br />
Erstes Einkommensviertel 79,7 22,6 45,6 6,4<br />
Zweites Einkommensviertel 83,7 24,0 49,2 7,5<br />
Drittes Einkommensviertel 88,9 35,8 54,3 8,2<br />
Viertes Einkommensviertel 88,0 49,8 64,9 13,0<br />
Ungleichheit min–max 1,10 2,20 1,42 2,03<br />
Ungleichheit Bildung min–max 1,32 3,42 3,21 13,07<br />
Abb. 4 Sozioökonomische Merkmale und politische Beteiligung in Deutschland,<br />
2008 (Angaben: Prozentanteile).<br />
Bürgerbeteiligung und soziale Gleichheit<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
del stellte die traditionelle Rollenverteilung<br />
100<br />
zwischen Männern und Frauen in Frage, nach<br />
der das öffentliche Engagement als Aufgabe<br />
83,1<br />
von Männern und die Regelung privater Angelegenheiten,<br />
insbesondere in der Familie<br />
80<br />
und bei der Kindererziehung, als Domäne der<br />
Frauen galt. Der verbesserte Zugang von<br />
60<br />
Mädchen zu Einrichtungen der tertiären Bildung<br />
(Gymnasium und Hochschulen) sowie<br />
die zunehmende Integration von Frauen ins<br />
Berufsleben verstärkten die mit dem Wertewandel<br />
verbundene Angleichung der Ge-<br />
40<br />
schlechterrollen. Daraus ergibt sich die Erwartung,<br />
dass sich insbesondere junge, gut<br />
20<br />
gebildete und berufstätige Frauen in ihrem<br />
politischen Engagement kaum noch von den<br />
Männern unterscheiden.<br />
0<br />
Wie | Abb. 5 | zeigt, hängt der Einfluss der<br />
Geschlechtszugehörigkeit auf das politische<br />
Engagement von der Beteiligungsform ab.<br />
Bei bei der Wahlbeteiligung und der Mitwirkung<br />
an Protestaktionen hat sich das politische<br />
Verhalten der Frauen dem der Männer<br />
angeglichen. Anders verhält es sich bei den<br />
traditionellen, repräsentativ-demokratischen Beteiligungsformen<br />
und der Teilnahme an Online-Protestaktionen. In diesen beiden<br />
Bereichen betätigen sich Männer nach wie vor stärker als Frauen.<br />
Dies ist insofern ein interessantes Ergebnis, als sich Muster von<br />
Geschlechterungleichheit sowohl bei einer traditionellen als auch<br />
bei einer modernen Beteiligungsform erkennen lassen. Moderne<br />
Partizipationsformen führen demnach nicht unbedingt zu mehr<br />
Gendergleichheit. Allerdings unterliegen die traditionellen, repräsentativ-demokratischen<br />
Aktivitäten wesentlich stärker dem<br />
Einfluss von Genderrollen als die Teilnahme an Online Protesten.<br />
Lebensalter<br />
Anteil Aktiver<br />
85,9<br />
37,0<br />
25,7<br />
52,4 51,6<br />
Wahlbeteiligung Traditionell Protest Online<br />
Beteiligungsform und Geschlecht<br />
10,3<br />
Mann<br />
Frau<br />
Abb. 5 Genderrolle und politische Beteiligung in Deutschland © Oscar W. Gabriel, Daten: Allbus 2008<br />
Anteil Aktiver<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Mit dem demografischen Wandel ist ein Sozialstrukturmerkmal<br />
noch stärker als früher in den Fokus der Partizipationsforschung<br />
gerückt, nämlich das Lebensalter. Ein Einfluss des Alters auf die<br />
politische Beteiligung lässt sich aus zwei theoretischen Perspektiven<br />
heraus begründen. Nach dem Generationenansatz erhalten<br />
Menschen durch die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen,<br />
unter denen sich ihre politischen<br />
Wertorientierungen und Einstellungen<br />
herausbilden, Anreize zur politischen Beteiligung<br />
oder diese wird ihnen erschwert. Dem<br />
entsprechend unterstellt der Generationenansatz<br />
bei den ausschließlich in der Bundesrepublik<br />
sozialisierten Altersgruppen ein<br />
stärkeres politisches Engagement als bei<br />
Personen, die ihre politische Sozialisation in<br />
den autoritären Regimen der Vorkriegszeit<br />
durchliefen. Ost<strong>deutschland</strong> nimmt in dieser<br />
Hinsicht eine besondere Position ein. Einerseits<br />
herrschten in diesem Teil des Landes bis<br />
zum Zusammenbruch des SED-Regimes autoritäre<br />
politische Verhältnisse, auf der anderen<br />
Seite enthielt das zu DDR-Zeiten propagierte<br />
Leitbild des sozialistischen Bürgers<br />
eine partizipative Komponente.<br />
Der zweite zur Interpretation der Bedeutung<br />
des Lebensalters für die politische Beteiligung<br />
herangezogene Ansatz, das Lebenszykluskonzept,<br />
bindet die Beteiligungsanreize<br />
an den von den Menschen typischerweise<br />
durchlaufenen Lebenszyklus. Demnach sind<br />
Menschen in der Mitte ihres Lebens besonders<br />
aktiv, weil ihre privaten Lebensumstände dies möglich und<br />
erforderlich machen. Sie haben sich in dieser Lebensphase ihre<br />
berufliche und familiale Existenz geschaffen, sodass Raum für<br />
politisches Engagement bleibt. Auf der anderen Seite sind sie als<br />
Arbeitnehmer und Steuerzahler, Eltern von Kindern in der Ausbildungsphase<br />
und Nutzer der öffentlichen Infrastruktur besonders<br />
stark von politischen Entscheidungen betroffen und beziehen<br />
von daher überdurchschnittlich starke Partizipationsanreize.<br />
Jenseits dieser traditionellen Erklärungsansätze haben altersspezifische<br />
Muster politischer Beteiligung eine zusätzliche Bedeutung<br />
durch die Alterung der deutschen Gesellschaft gewonnen.<br />
Dieser Prozess löste eine Diskussion über die Generationengerechtigkeit<br />
und die Anpassung der Infrastruktur an die Bedingungen<br />
des demographischen Wandels aus. Die sinkenden Geburtenraten<br />
und die steigende Lebenserwartung bewirken eine<br />
Zunahme des Anteils älterer Menschen, die ihre spezifischen Forderungen<br />
an die Politik richten und diese durchzusetzen versuchen.<br />
Die bessere gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung<br />
führt zudem zu einem längeren Erhalt der Gesundheit, was wiederum<br />
soziale Integration und politische Aktivität ermöglicht und<br />
fördert. Ältere Menschen sind heute wesentlich besser als in frü-<br />
6,3<br />
18–29 J. 30–44 J. 45–59 J. 60–74 J. 75 u.ä.<br />
Alter<br />
Wahlbeteiligung<br />
Traditionell<br />
Protest<br />
Online<br />
Abb. 6 Lebensalter und politische Beteiligung in Deutschland, 2008.<br />
© Oscar W. Gabriel, Daten: Allbus 2008<br />
23<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Bürgerbeteiligung und soziale Gleichheit
24<br />
OSCAR W. GABRIEL<br />
heren Phasen der gesellschaftlichen Entwicklung<br />
dazu in der Lage, eine aktive Rolle<br />
im gesellschaftlichen und politischen Leben<br />
zu spielen.<br />
In | Abb. 6 | zeigen sich sowohl generationsspezifische<br />
und lebenszyklische Einflüsse auf<br />
das politische Engagement der Bundesbürger.<br />
Anders als früher steigt die Wahlbeteiligung<br />
mit dem Lebensalter. Möglicherweise<br />
haben ältere Menschen die Vorstellung, die<br />
Stimmabgabe gehöre zu den staatsbürgerlichen<br />
Pflichten, stärker verinnerlicht als jüngere<br />
und neigen deshalb stärker dazu, diese<br />
Pflicht zu erfüllen. Auf der anderen Seite haben<br />
sich in den letzten Jahrzehnten die Beteiligungsmöglichkeiten<br />
stark ausdiffe renziert.<br />
Anders als ältere Menschen, für die aktives<br />
politisches Engagement lange Zeit gleichbedeutend<br />
mit der Stimmabgabe bei Wahlen<br />
war, verfügen jüngere Personen über Erfahrungen<br />
mit dem breiten Beteiligungsangebot<br />
moderner Demokratien. Sie kennen es<br />
besser als ältere und sind eher dazu bereit<br />
und in der Lage, es zu nutzen. Auf Grund der<br />
vorhandenen Alternativen büßen Wahlen für jüngere ihre exponierte<br />
Stellung im Beteiligungssystem ein und werden von jüngeren<br />
weniger genutzt. Das Gegenstück hierzu bildet die Beteiligung<br />
an Onlineprotesten. Diese Verhaltensform ist in der<br />
jüngsten Altersgruppe relativ weit verbreitet, tritt bei den 45- bis<br />
59-Jährigen relativ selten auf und kommt bei den über 60-Jährigen<br />
praktisch nicht mehr vor. Dies reflektiert die unterschiedlichen<br />
Gewohnheiten der verschiedenen Altersgruppen bei der Informationsbeschaffung<br />
und Kommunikation. Je stärker das<br />
Internet generell zu diesen Zwecken genutzt wird, desto wahrscheinlicher<br />
ist sein Einsatz zur Durchsetzung politischer Ziele.<br />
Einem lebenszyklischen Muster folgt dagegen die Beteiligung an<br />
traditionellen, in die Strukturen der repräsentativen Demokratie<br />
eingebetteten Aktivitäten. Aus den genannten Gründen sind<br />
diese Aktivitäten in den mittleren Altersgruppen besonders weit<br />
verbreitet. Im Vergleich damit sind junge Menschen noch nicht so<br />
gut in die politische Gemeinschaft integriert und politisch inaktiver,<br />
während die politische Integration und Aktivität bei Menschen<br />
über 75 Jahren nachlässt. Andererseits verdeutlicht das<br />
politische Verhalten der zweitältesten Gruppe (60 bis 74 Jahre)<br />
den Wandel der Altersrolle in der deutschen Gesellschaft, denn<br />
sie weist das gleiche Aktivitätsniveau auf wie Personen in der<br />
Alters gruppe von 30 bis 44 Jahren. Dies unterstreicht auch die Beteiligung<br />
an Protestaktivitäten. Sie ist in vier der fünf Altersgruppen<br />
annähernd gleich weit verbreitet. Erst mit dem Erreichen<br />
des 75. Lebensjahres geht diese Form des Engagements stark<br />
zurück, liegt aber immer noch leicht über dem Niveau der traditionellen<br />
politischen Aktivitäten. Neben der Genderrolle haben<br />
sich auch die mit dem Lebensalter verbun denen politischen<br />
R ollen stark verändert. Der Rückgang des politischen Engagements<br />
scheint sich in die Phase der Hochaltrigkeit verschoben zu<br />
haben.<br />
Migration<br />
Neben dem demografischen Wandel hat die internationale Migration<br />
die Struktur der deutschen Gesellschaft stark verändert.<br />
Mittlerweile weist nahe jeder fünfte Einwohner Deutschlands einen<br />
Migrationshintergrund auf. Dies wirft die Frage auf, wie gut<br />
diese große Bevölkerungsgruppe ins politische Leben integriert<br />
ist. Da insbesondere eingebürgerte Zuwanderer und EU-Ausländer<br />
über die gleichen oder nahezu die gleichen Beteiligungsrechte<br />
verfügen wie deutsche Staatsangehörige sind einem großen<br />
Teil der Zuwanderer die meisten Beteiligungsmöglichkeiten<br />
Anteil Aktiver<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
87,5<br />
68,5<br />
34,4<br />
16,3<br />
56,6<br />
29,8<br />
Wahlbeteiligung Traditionell Protest Online<br />
Migrationshintergrund und Beteiligung<br />
rechtlich zugänglich. Das bedeutet aber nicht, dass sie von diesen<br />
tatsächlich Gebrauch machen.<br />
Die rechtliche Gleichstellung der Migranten mit den Deutschen<br />
ist für ihr Beteiligungsverhalten weitgehend unerheblich. Bei der<br />
Stimmabgabe bei Wahlen, die als einzige Beteiligungsform mit<br />
dem Staatsbürgerstatus verknüpft ist, besteht zwischen<br />
Migranten und Einheimischen keine größere Lücke als bei anderen<br />
Beteiligungsformen, die allen Einwohnern offen stehen. Unabhängig<br />
von der Partizipationsform liegt das Niveau der politischen<br />
Aktivität bei den Migranten um etwa zwanzig Prozentpunkte<br />
niedriger als bei den Einheimischen. Ob es sich dabei um verfasste<br />
oder nicht verfasste, mit dem Staatsbürgerstatus verknüpfte<br />
oder von ihm unabhängige Beteiligungsformen handelt,<br />
spielt keine Rolle. Nur bei den Onlineprotesten unterscheiden<br />
sich Einheimische und Migranten weniger voneinander. Dies lässt<br />
sich in erster Linie auf die Charakteristika der Onliner zurückführen.<br />
Wenn Personen jung und formal gut gebildet sind, dann nutzen<br />
sie unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit überdurchschnittlich<br />
stark das Internet, offenbar auch zu politischen<br />
Zwecken. Nach dem Bildungsniveau ist der Migrationshintergrund<br />
der wichtigste Faktor für die Entscheidung darüber, eine<br />
aktive politische Rolle zu übernehmen oder passiv zu bleiben.<br />
Zusammenfassung und Folgerungen<br />
Kein Zuwanderer<br />
Zuwanderer<br />
Abb. 7 Migrationshintergrund und politische Beteiligung in Deutschland, 2008<br />
© Oscar W. Gabriel, Daten: Allbus 2008<br />
Wie in anderen Demokratien beeinflusst die soziale Herkunft in<br />
Deutschland die politische Aktivität von Menschen. Nach den Ergebnissen<br />
zahlreicher empirischer Studien beteiligen sich formal<br />
gut gebildete, einkommensstarke, in Berufen mit einer selbstbestimmten<br />
Arbeit tätige Personen sowie im Inland Geborene stärker<br />
am politischen und gesellschaftlichen Leben als Angehörige<br />
der unteren Einkommens- und Bildungsschichten, abhängig Beschäftigte<br />
und Personen mit Migrationshintergrund. Keine große<br />
Rolle für die Wahrnehmung von Beteiligungsrechten spielen dagegen<br />
die Geschlechtszugehörigkeit und die damit verbundenen<br />
Rollenerwartungen. Die meisten Zusammenhänge zwischen der<br />
sozialen Herkunft und dem politischen Verhalten sind nicht sehr<br />
stark ausgeprägt, gleichwohl sind sie erkennbar und konfrontieren<br />
die Wissenschaft und die politische Praxis mit der Frage, ob<br />
sich die sozialen Charakteristika der Aktiven und der Inaktiven in<br />
den öffentlich artikulierten Präferenzen der Bürger und in der<br />
Aufnahme der artikulierten Forderungen durch die politischen<br />
Entscheidungsträger niederschlagen. Da diese Frage bislang empirisch<br />
noch nicht hinlänglich breit und detailliert untersucht ist,<br />
8,8<br />
5,5<br />
Bürgerbeteiligung und soziale Gleichheit<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
sollte man aus den Zusammenhängen zwischen der sozialen Herkunft<br />
von Individuen und ihrer Beteiligung an der Politik keine<br />
voreiligen Folgerungen in Bezug auf die Offenheit des politischen<br />
Systems für gruppenspezifische Interessen und Wertvorstellungen<br />
ableiten. Eines der wichtigsten Argumente für repräsentative<br />
Demokratien besteht ja gerade darin, dass repräsentative Institutionen<br />
nicht als Durchlauferhitzer für Gruppeninteressen funktionieren,<br />
sondern sich um einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen<br />
verschiedener Gruppen bemühen. Auch wenn dieser nicht<br />
immer gelingt, sind die repräsentativen Verfahren auf das Erreichen<br />
dieses Zieles ausgerichtet.<br />
Doch unabhängig vom Problem der Interessenberücksichtigung<br />
und der politischen Responsivität stellt der Einfluss der gesellschaftlichen<br />
Stellung und Rolle von Individuen eine Herausforderung<br />
des Ideals politischer Gleichheit dar. Zudem beeinträchtigen<br />
diese Strukturen möglicherweise die Repräsentationsleistung<br />
politischer Institutionen, um die es am besten bestellt sein dürfte,<br />
wenn alle sozialen Gruppen gleichermaßen versuchen, ihren Forderungen<br />
Gehör zu verschaffen. Insofern stellt eine Ausweitung<br />
der Beteiligungsmöglichkeiten nur eine unbefriedigende Lösung<br />
des Problems dar, wenn sie vornehmlich dazu führt, dass die ohnehin<br />
Aktiven zusätzliche Einflussmöglichkeiten erhalten, sich für<br />
die Inaktiven aber nichts ändert. Partizipative Reformen müssen<br />
der Mobilisierung der politikfernen Gruppen mehr Aufmerksamkeit<br />
widmen und diese über niedrigschwellige Beteiligungsangebote<br />
in lebensnahen Bereichen an den politischen Prozess heranführen.<br />
Nur unter dieser Bedingung bedeutet mehr Partizipation<br />
mehr Gleichheit.<br />
Literaturhinweise<br />
Blais, Andre (2010): Political Participation. In: LeDuc, Lawrence/Niemi,<br />
Richard G./Norris, Pippa, (Hrsg.): Comparing Democracies 3. Elections and<br />
Voting in the 21st Century. Los Angeles u. a.: Sage, 165–183.<br />
Burstein, Paul (1972): Social Structure and Individual Political Participation<br />
in Five Countries. In: American Journal of Sociology 77, 1087–1110.<br />
Dahl, Robert A. (1971): Polyarchy. Participation and Opposition. New Haven:<br />
Yale University Press.<br />
Dahl, Robert A. (1998): On Democracy. New Haven/London: Yale University<br />
Press.<br />
van Deth, Jan W. (2009): Politische Partizipation. In: Kaina, Viktoria/Römmele,<br />
Andrea, (Hrsg.): Politische Soziologie. Ein Studienbuch. Wiesbaden: VS<br />
Verlag für Sozialwissenschaften, 141–161.<br />
Elff, Martin/Roßteutscher, Sigrid, (2009): Die Entwicklung sozialer Konfliktlinien<br />
in den Wahlen von 1994 bis 2005. In: Gabriel, Oscar W./Weßels, Bernhard/Falter,<br />
Jürgen W., (Hrsg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlass der<br />
Bundestagswahl 2005. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 307–<br />
327.<br />
Gabriel, Oscar W. (2011): Bürgerbeteiligung. Stärkung der Demokratie Verbesserung<br />
der Politikergebnisse? Unveröffentlichtes Gutachten für die<br />
Robert Bosch Stiftung. Stuttgart.<br />
Gabriel, Oscar W./Völkl, Kerstin, (2005): Politische und soziale Partizipation.<br />
In: Gabriel, Oscar W./Holtmann, Everhard, (Hrsg.): Handbuch Politisches<br />
System der Bundesrepublik Deutschland. 3. Aufl. München/Wien: Oldenbourg,<br />
523–573.<br />
Gabriel, Oscar W./Völkl, Kerstin, (2008): Politische und soziale Partizipation.<br />
In: Gabriel, Oscar W./Kropp, Sabine, (Hrsg.): Die EU-Staaten im Vergleich.<br />
Strukturen, Prozesse, Politikinhalte. 3. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften,<br />
268–298.<br />
Hooghe, Marc/Quintelier, Ellen, (2013): Political Participation in Europe. In:<br />
Keil, Silke I./Gabriel, Oscar W., (Hrsg.): Society and Democracy in Europe.<br />
London/New York: Routledge, 220–243.<br />
Kaase, Max, (1997): Vergleichende Politische Partizipationsforschung. In:<br />
Berg-Schlosser, Dirk/Müller-Rommel, Ferdinand, (Hrsg.): Vergleichende Politikwissenschaft.<br />
Ein einführendes Handbuch. 3. Aufl. Opladen: Leske + Budrich,<br />
159–174.<br />
Lipset, Seymour M./Rokkan, Stein, (1967): Cleavage Structures, Party Systems,<br />
and Voter Alignments. In: Rokkan, Stein/Lipset, Seymour Martin,<br />
(Hrsg.): Party Systems and Voter Alignments. New York: The Free Press,<br />
1–64.<br />
Marsh, Alan/Kaase, Max, (1979): Background of Political Action. In: Barnes,<br />
Samuel H./Kaase, Max u. a.: Political Action. Mass Participation in Five Western<br />
Democracies. Beverly Hills/London: Sage, 97–136.<br />
Nie, Norman H./Powell, G. Bingham/ Prewitt, Kenneth (1969): Social Structure<br />
and Political Participation. Developmental Relationships. Teil I. In: American<br />
Political Science Review 63, 361–376, Teil II. In: American Political Science<br />
Review 63, 808–832.<br />
Norris, Pippa, (2002): Democratic Phoenix. Reinventing Political Activism.<br />
Cambridge: Cambrigde University Press.<br />
Parry, Gerraint/Moyser, George/Day, Neil, (1992): Political Participation and<br />
Democracy in Britain. Cambridge u. a.: Cambridge University Press.<br />
Schattschneider, Elmer E. (1960): The Semisovereign People: A Realist›s View<br />
of Democracy in America. Holt, Rinehart and Winston.<br />
Verba, Sidney (2003): Would the Dream of Political Equality Turn out to Be a<br />
Nightmare? In: Perspectives on Politics, 1, 663–679.<br />
Verba, Sidney/Nie, Norman H./Kim, Jae-On, (1978): Participation and Political<br />
Equality: A Seven-Nation Comparison. Cambridge u. a.: Cambridge University<br />
Press.<br />
Verba, Sidney/Schlozman, Kay Lehman/Brady, Henry, (1995): Voice and Equality.<br />
Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge, Mass./London: Harvard<br />
University Press.<br />
25<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Bürgerbeteiligung und soziale Gleichheit
BÜRGERBETEILIGUNG IN DEUTSCHLAND UND EUROPA<br />
5. Die europäische Bürgerinitiative und<br />
die Möglichkeiten und Grenzen der<br />
Bürgerbeteiligung in der EU<br />
FRANZ THEDIECK<br />
26<br />
Alle Gewalt geht vom Volke aus.« Das<br />
Grundgesetz formuliert in Art. 20<br />
Abs. 2 das Prinzip der Volkssouveränität<br />
anschaulich, nämlich wie man Demokratie,<br />
das griechische Lehnwort für Volksherrschaft,<br />
begreifen kann. Das Volk ist danach<br />
alleiniger Träger der Staatsgewalt, nur das<br />
Volk kann legitimerweise Macht auf die<br />
Staatsorgane übertragen (BVerfGE 89, 155,<br />
171ff.). Die politische Willensbildung soll<br />
sich von unten nach oben vollziehen (Alfred<br />
KATZ, Staatsrecht, 18. Aufl. Heidelberg 2012, Rdn.<br />
139). Manchem Kommentator der Verfassung<br />
ist dieses Bild zu anschaulich, der daraus<br />
abzuleitende demokratische Anspruch<br />
für die Bürger zu weitgehend,<br />
sodass er die Formulierung in den Bereich<br />
der Fiktion verweist oder doch die Herrschaft<br />
des Volkes als lediglich indirekt oder<br />
mittelbar darstellt. Die damit verbundene<br />
Verkürzung des Prinzips der Volkssouveränität<br />
besitzt im Grundgesetztext selbst<br />
keine Grundlage, sie wird »aus der Natur<br />
der Sache« abgeleitet. Aber das Grundgesetz<br />
wiederholt nur die klassische Formulierung aus der französischen<br />
Erklärung der Bürger- und Menschenrechte von<br />
1789, die indes ernsthaft gemeint war: Das Volk sollte anstelle<br />
des Königs herrschen. Und diesen Prinzipien weiß sich auch<br />
die Europäische Union verpflichtet.<br />
Wer die Frage nach dem Inhalt der Demokratie an einen Mitbürger<br />
stellt, wird regelmäßig eine Antwort erhalten, die uns fast<br />
selbstverständlich vorkommt: Demokratie bedeutet die Abhaltung<br />
von freien Wahlen, so wie es der zweite Satz in Art. 20 Abs. 2<br />
Grundgesetz auszudrücken scheint: »Sie (die Demokratie) wird<br />
vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe<br />
… ausgeübt«. Der Wortlaut lässt keinen Zweifel daran, dass<br />
Instrumente zur Ausübung der Volkssouveränität, Wahlen und<br />
Abstimmungen, gleichgewichtig neben einander gestellt sind.<br />
Dennoch wird aus dem Gesamtzusammenhang des Grundgesetzes<br />
abgeleitet, dass Abstimmungen nur dann zulässig seien, wenn<br />
sie ausdrücklich vom Grundgesetz zugelassen sind (A. KATZ,<br />
Staatsrecht, Rdn. 145). Diese Interpretation ist keineswegs zwingend,<br />
noch viel weniger überzeugt seine Begründung, die<br />
schlechten Erfahrungen während der Weimarer Republik hätten<br />
den Verfassungsgeber zu einer restriktiven Linie in Bezug auf direktdemokratische<br />
Elemente veranlasst. Entgegen dieser gebetsmühlenartig<br />
wiederholten Behauptung und ohne hier eine profunde<br />
historische Untersuchung zu versuchen, beruht die<br />
nationalsozialistische Machtergreifung weder auf einer Wahlentscheidung<br />
der Bürger, noch auf einer Abstimmung zugunsten der<br />
Nazis, sondern auf einer grundlegenden Fehlentscheidung des<br />
greisen Reichspräsidenten Hindenburg, der Adolf Hitler mittels<br />
seiner nichtdemokratischen Sondervollmacht nach Art. 48 der<br />
Weimarer Reichsverfassung mit der Kanzlerschaft betraut hat. Es<br />
kann also keine Rede davon sein, dass die Weimarer Demokratie<br />
durch direktdemokratische Elemente zerstört worden sei, diese<br />
Abb. 1 »Sollten wir vielleicht den da hinten mal befragen? « © Klaus Stuttmann, 26.6.2012<br />
Behauptung fällt in den Bereich der geschichtlichen Legendenbildung.<br />
Die während der Nazidiktatur mehrfach angewendeten<br />
Fälle von Volksbefragungen fanden unter völlig irregulären Bedingungen<br />
statt und können nicht als Gegenargument gegen Formen<br />
unmittelbarer Demokratie gelten. Leider leben wir in<br />
Deutschland mit diesem Mythos, der zu Unrecht die unmittelbare<br />
Demokratie klein macht.<br />
Das Demokratiedefizit der EU<br />
Wenn die regelmäßige Abhaltung von freien Wahlen dem demokratischen<br />
Anspruch der Bürger genügen würde, wäre an der politischen<br />
Organisation der Europäischen Union gar nichts auszusetzen,<br />
demokratischer Anspruch und Wirklichkeit würden<br />
identisch zusammenfallen. Mit einer solchen Meinung stände<br />
man aber allein unter den Fachleuten aus Juristen, Politologen<br />
und Europawissenschaftlern und würde nicht ernst genommen.<br />
Zu tief hat sich die Diagnose des Demokratiedefizits in der EU in<br />
unser Bewusstsein eingeprägt. Das Urteil Gerald HÄFNERs, Abgeordneter<br />
im Europäischen Parlament und »Vater« der EU-Bürgerinitiative,<br />
wird deshalb allgemein geteilt: »Die Aufgabe, die EU zu<br />
einer Union der Bürger zu machen, ist noch unerfüllt. Wir haben<br />
bis heute noch keine ausreichenden demokratischen Organe und<br />
Verfahren entwickelt.« (In einem Vortrag am 21.04. 2010 im Kehler Forum<br />
Zukunftsfragen, bestätigt am 10.01. 2013)<br />
Dieses Urteil wird von Martin SCHULZ, dem Präsidenten des EU<br />
Parlaments geteilt, der die Machtkonzentration beim Ministerrat<br />
und das Fehlen einer parlamentarischen Kontrolle seiner Mitglieder<br />
beklagt (Interview mit Martin SCHULZ, Contre la Dé-Démocratisation<br />
de l’UE, in: Paris, Berlin – Magazin für Europa, November 2012, S. 14f.).<br />
Die Defizite der Europäischen Demokratie beginnen bereits mit<br />
dem geltenden Wahlsystem zum Europäischen Parlament. Jedes<br />
Die europäische Bürgerinitiative D&E Heft 65 · 2013
Mitgliedsland besitzt sein eigenes Wahlgesetz<br />
mit unterschiedlichen Regelungen, wodurch<br />
das Prinzip der Wahlgleichheit verletzt<br />
wird. Aber auch das Gewicht einer Stimme,<br />
die der EU-Bürger in den einzelnen Mitgliedsländern<br />
bei der Europawahl abgibt, ist höchst<br />
ungleichgewichtig. Ursache hierfür ist die<br />
zwischen den Mitgliedstaaten vereinbarte<br />
Sitzverteilung im Europäischen Parlament.<br />
Im Ergebnis wird dadurch in Malta jede einzelne<br />
Stimme zur Europawahl zwölfmal höher<br />
bewertet als es in Deutschland der Fall ist:<br />
Der Repräsentant der maltesischen Bürger<br />
vertritt 67.000 Europäer, sein deutscher Kollege<br />
dagegen 854.000 EU-Bürger. (Melanie<br />
PIEPENSCHNEIDER: Vertragsgrundlagen und Entscheidungsverfahren,<br />
in: Informationen zur politischen<br />
Bildung (Heft 279), bpb, 2005, S. 23.) Beschönigend<br />
spricht man von dem »Prinzip<br />
fallender Proportionalität«, in Wahrheit handelt<br />
es sich um eine eklatante Verletzung des<br />
Gleichheitsprinzips.<br />
Die Tatsache, dass jedem in Deutschland gewählten<br />
EU-Abgeordneten mehr als 800.000 repräsentierte Bürger<br />
gegenüber stehen, impliziert die Frage nach seiner Überforderung.<br />
Zieht man einen Vergleich mit dem Bundestag, dann wird<br />
dem Europäischen Abgeordneten bei der Repräsentation des<br />
Wahlvolks eine um den Faktor 8-mal so intensive Aufgabe abverlangt.<br />
Natürlich verlangt die Arbeitsfähigkeit der Parlamente,<br />
dass die Anzahl der Abgeordneten nicht beliebig ausgeweitet<br />
werden kann. Würde man denselben Maßstab wie beim Deutschen<br />
Bundestag anlegen, dass ein Abgeordneter also etwa<br />
100.000 Bürger repräsentiert, so müsste das EU-Parlament auf<br />
etwa 4.000 Abgeordnete aufgebläht werden, was sicherlich auch<br />
keine gute Lösung wäre. Aber die Idee demokratischer Repräsentation<br />
wird bezüglich der deutschen EU-Abgeordneten ad absurdum<br />
geführt.<br />
Weitere demokratiekritische Argumente richten sich gegen die<br />
etatistische Konstruktion der Unionsorgane, welche die Macht<br />
beim Ministerrat bzw. beim Europäischen Rat und bei der Kommission<br />
konzentriert. Der Ministerrat besteht aus den Mitgliedern<br />
der jeweiligen nationalen Regierungen, der Europäische Rat<br />
aus den Staatschefs der Mitgliedsländer; diese Organe treffen die<br />
politischen Entscheidungen, die Kommission bereitet sie vor und<br />
bringt die Gesetzesinitiativen ein, wodurch sich die Gewaltenbalance<br />
zur Exekutive verschoben hat. Das EU-Parlament, als einziges<br />
Organ durch direkte Wahl legitimiert, besitzt nicht einmal die<br />
Kompetenz, Gesetzesinitiativen einzubringen, es ist im Vergleich<br />
mit den nationalen Parlamenten schwächer entwickelt. Wenn<br />
auch durch den Ausbau des Mitentscheidungsverfahrens und die<br />
Einbeziehung des Agrarhaushalts in das parlamentarische Budgetrecht<br />
eine spürbare Verbesserung eingetreten ist, so ist doch<br />
mit dem Bundesverfassungsgericht weiterhin von einer unzureichenden<br />
Repräsentation des Volkswillens auf europäischer Ebene<br />
auszugehen.<br />
Ein weiterer Kritikpunkt aus unionsfreundlicher Sicht besteht darin,<br />
dass bis auf Ausnahmen, wie in Irland, sich der Einigungsprozess<br />
als bürokratische Initiative ohne bürgerschaftliche Begleitung<br />
vollzieht. War es kein Gebot der Volkssouveränität, die<br />
Bürger zu beteiligen und ihren Willen zu den grundlegenden Veränderungen<br />
ihrer politischen Wirklichkeit zu erfragen? Wenn nur<br />
das Volk öffentlichen Organen demokratisch legitimierte Macht<br />
übertragen kann, wieso wurde es in Deutschland und anderen<br />
Mitgliedsländern systematisch davon abgehalten, über die einzelnen<br />
Etappen der Europäischen Einigung zu entscheiden? Und<br />
wenn die verantwortlichen Politiker so handelten, um Schaden<br />
von Europa abzuwenden, so macht es das nicht besser: Denn welches<br />
Demokratieverständnis spricht aus dieser Haltung, die die<br />
»richtige« Politik am Volk vorbei realisieren möchte? Was sind das<br />
Abb. 2 »Europa gestalten …« © Thomas Plaßmann, 24.8.2012<br />
für Politiker, die sich nicht einmal zutrauen, die Grundsätze ihrer<br />
Politik den Bürgern so verständlich zu erklären, dass diese den<br />
Prinzipien zustimmen und die erforderliche Legitimation vermitteln?<br />
Demokraten sind es sicher nicht, eher Vertreter eines elitären<br />
Politikverständnisses, welches Mahatma Gandhi treffend als<br />
demokratisch unwürdig bewertete: »Was du für mich tust, aber<br />
ohne mich, tust du gegen mich!«.<br />
Lösungsvorschläge<br />
Das in den Lissaboner Vertrag aufgenommene Bekenntnis der EU<br />
zum Subsidiaritätsprinzip sehen die meisten Kritikern als unzureichend<br />
an, um die demokratische Ordnung durch größere Bürgernähe<br />
zu stärken. Zwar können Verstöße gegen das Subsidiaritätsprinzip<br />
von den Mitgliedstaaten und deren Parlamenten<br />
gerügt werden, entscheidend ist jedoch, welche Institution über<br />
die Begründetheit der Rüge entscheidet. Die Forderung nach einem<br />
vom EuGH gesonderten Kompetenzgerichtshof fand keinen<br />
Eingang in den Lissaboner Vertrag; somit bleibt es bei der Zuständigkeit<br />
des Europäischen Gerichtshofs, dem nach den bisherigen<br />
Erfahrungen eine überzeugende Verteidigung der Kompetenzen<br />
der EU-Mitgliedstaaten kaum zugetraut wird.<br />
Mit der Forderung nach einem klaren Katalog der Gesetzgebungskompetenzen,<br />
der ausreichend Entscheidungsmasse bei<br />
den Mitgliedstaaten belässt, haben sich die Kritiker der überbordenden<br />
Europäischen Kompetenzen nur scheinbar durchgesetzt.<br />
Zwar sind in den Art. 3 – 6 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der<br />
Europäischen Union, kurz: Lissaboner Vertrag) nunmehr tatsächlich<br />
die Gesetzgebungskompetenzen der EU geregelt. Jedoch ist<br />
der Katalog der gemeinsamen Zuständigkeiten nach Art. 4 AEUV<br />
wiederum so weit gefasst, dass zwischen den Zuständigkeiten der<br />
EU und denjenigen der Mitgliedstaaten nicht effektiv unterschieden<br />
werden kann. Der Versuch, durch eine Beschneidung der<br />
EU-Kompetenzen die Demokratien auf der Ebene der Mitgliedstaaten<br />
vor Aushöhlung zu schützen, muss als fehlgeschlagen betrachtet<br />
werden.<br />
Was zur Lösung des Demokratiedefizits bleibt, wäre der Ausbau<br />
des EU-Parlaments zu einem vollwertigen Gesetzgebungsorgan.<br />
Die oben dargestellten Verbesserungen ändern aber nichts daran,<br />
dass das strukturelle Demokratiedefizit insoweit fortbesteht,<br />
als das Parlament nicht die Europäischen Völker insgesamt<br />
repräsentiert, sondern immer noch auf die nationalen Teilmengen<br />
bezogen ist.<br />
Der deutsche Bundesfinanzminister Wolfgang SCHÄUBLE fordert<br />
seit langem die Direktwahl des Präsidenten des Europäischen Ra-<br />
27<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Die europäische Bürgerinitiative
28<br />
FRANZ THEDIECK<br />
tes durch die Unionsbürger. Dies wäre eine effektive Kompensation<br />
des bemängelten Demokratiedefizits, weil dadurch die Bürger<br />
direkt an der Machtausübung beteiligt würden. Doch bislang<br />
ist das nur Zukunftsmusik.<br />
Die demokratische Ordnung der EU muss auch weiterhin als deren<br />
wesentlicher Mangel gelten, sodass vor allem der »Europäischen<br />
Bürgerinitiative« (EBI) die Funktion zukommt, das Demokratiedefizit<br />
abzumildern. Könnte der Bürger sich direkt an den<br />
politischen Entscheidungen der EU beteiligen, so würde das die<br />
demokratischen Mängel der EU-Institutionen kompensieren und<br />
das Gefühl des Bürgers mildern, der Europäischen Bürokratie<br />
ohnmächtig ausgeliefert zu sein. (Hans H. von ARNIM, Staat ohne<br />
Diener, München 1993, S. 336 und Das Europa-Komplott: wie EU-<br />
Funktionäre unsere Demokratie verscherbeln, München, Wien<br />
2006)<br />
Die EU-Bürgerinitiative<br />
Nach Art. 11 Abs. 4 EUV können 1 Million EU Bürger aus mindestens<br />
7 Mitgliedstaaten die Möglichkeiten der Europäischen Bürgerinitiative<br />
(EBI) nutzen, um von der EU Kommission ein neues<br />
Gesetz zu verlangen. Im Falle eines Erfolges ist die Kommission<br />
gehalten, darauf angemessen zu reagieren. Seitdem die Regelung<br />
im April 2011 in Kraft getreten ist, sind 23 EBIs gestartet worden,<br />
zu Themen wie Umweltschutz, Gesundheit oder öffentliche Moral<br />
(Stand Februar 2013).<br />
a) Rechtsgrundlage<br />
Auf der Grundlage von Art 11 Abs. 4 EUV hat die EU-Verordnung<br />
Nr. 211/2011 vom 16. Februar 2011 über die Bürgerinitiative den<br />
Bürgern die Möglichkeit gegeben, sich direkt mit der Aufforderung<br />
an die Europäische Kommission zu wenden, einen Vorschlag<br />
für einen Rechtsakt der Union zur Umsetzung der Verträge zu unterbreiten.<br />
Das deutsche Bundesgesetz zur Durchsetzung Europäischer<br />
Bürgerinitiativen hat Zuständigkeiten und Verfahren<br />
festgelegt und ist am 1.4.2012 in Kraft getreten ist.<br />
b) Regelungsinhalt<br />
Eine Bürgerinitiative ist zu jeder Frage zulässig, in dem die Kommission<br />
befugt ist, einen Rechtsakt vorzuschlagen, etwa Umwelt,<br />
Landwirtschaft, Verkehr oder öffentliche Gesundheit (http://<br />
ec.<strong>europa</strong>.eu/citizens-initiative/public/competences, abgerufen<br />
am 10.01.2013).<br />
c) Verfahren<br />
(1.) Um eine EBI zu starten, muss ein »Bürgerausschuss« gebildet<br />
werden. Dieser muss aus mindestens sieben EU-Bürgerinnen<br />
und -Bürgern bestehen, die in mindestens sieben verschiedenen<br />
Mitgliedstaaten ansässig sind. Die Mitglieder müssen das<br />
Wahlrecht zu den Europäischen Parlamentswahlen besitzen.<br />
Eine EBI kann nicht von einer Organisation in Gang gesetzt<br />
werden, Organisationen dürfen die Initiative jedoch unterstützen.<br />
(2.) Der Bürgerausschuss muss seine Initiative auf einem von der<br />
EU hierfür eingerichteten Internetportal registrieren, bevor er<br />
mit der Sammlung von Unterstützungsbekundungen von Bürgerinnen<br />
und Bürgern beginnt. Die Kommission prüft binnen<br />
zwei Monaten, ob die Initiative zulässig ist, insbesondere ob<br />
sich ein Gesetzesvorschlag innerhalb der Gesetzgebungskompetenzen<br />
der EU bewegt.<br />
(3.) Will die Initiative auch online Unterschriften sammeln, so beantragt<br />
sie bei der Kommission die dafür bestimmte Open-<br />
Source-Software. Dafür ist eine Behörde aus dem Land verantwortlich,<br />
in dem der Server steht. Sie antwortet innerhalb<br />
eines Monats.<br />
(4.) Sobald die Registrierung bestätigt wurde, haben die Organisatoren<br />
ein Jahr Zeit für die Sammlung der erforderlichen 1<br />
Million Unterschriften, die aus mindestens 7 Mitgliedstaaten<br />
stammen müssen. Die Sammlung kann schriftlich oder online<br />
erfolgen.<br />
(5.) Sind 1 Million Unterschriften gesammelt worden, so legt die<br />
Initiative diese der Kommission vor.<br />
Nachdem die Unterschriften eingereicht wurden, prüfen die<br />
Mitgliedstaaten die Gültigkeit der Unterstützungsbekundungen<br />
ihrer Staatsbürger, wofür ihnen eine Frist von drei Monaten<br />
zur Verfügung steht. Je nach Mitgliedstaat gelten dabei<br />
andere Anforderungen, welche Informationen für die Gültigkeitsprüfung<br />
notwendig sind. So müssen Österreicher zur Unterzeichnung<br />
einer EBI die Nummer ihres Reisepasses oder<br />
Personalausweises angeben, während in Deutschland nach<br />
anfänglichen Überlegungen darauf verzichtet wurde.<br />
(6.) Binnen drei Monaten entscheidet die Kommission, wie sie mit<br />
der erfolgreichen Initiative verfährt.<br />
(Ronald Pabst, Europäische Bürgerinitiative im Praxistest, in: md-magazin,<br />
Zeitschrift für direkte Demokratie, Heft 2/2012, S. 29ff.)<br />
Konsequenzen einer erfolgreichen EBI<br />
Eine erfolgreiche EBI stellt zunächst lediglich eine Aufforderung<br />
an die Kommission dar, einen Rechtsakt zu einem Thema vorzuschlagen,<br />
zu dem es nach Ansicht der Initiatoren einer Regelung<br />
bedarf. Die Unionsbürger werden damit in Bezug auf das Aufforderungsrecht<br />
auf dieselbe Stufe gestellt wie das Europäische Parlament<br />
und der Rat der Europäischen Union, die dieses Recht<br />
nach Art. 225 bzw. Art. 241 AEUV genießen. Die Kommission prüft<br />
die Initiative innerhalb einer Dreimonatsfrist, während derer die<br />
Initiatoren von Vertretern der Kommission empfangen werden,<br />
um die Initiative zu erläutern. Sie erhalten ferner die Möglichkeit,<br />
das Anliegen der Initiative bei einer öffentlichen Anhörung im Europäischen<br />
Parlament vorzustellen. Die Kommission wiederum<br />
veröffentlich während dieser Frist eine formelle Antwort, in der<br />
sie erläutert, ob und welche Maßnahmen sie als Antwort auf die<br />
EBI vorschlägt und ebenso die Gründe für ihre – möglicherweise<br />
auch negative – Entscheidung.<br />
Die Europäische Kommission behält aber in jedem Fall weiterhin<br />
das alleinige Initiativrecht. Selbst wenn eine Bürgerinitiative alle<br />
Kriterien erfüllt, ist die Kommission nicht verpflichtet, eine Gesetzesinitiative<br />
auf der Grundlage der EBI vorzuschlagen.<br />
Die EBI in der Praxis<br />
Seit April 2012 wurden 23 Initiativen gestartet. Im Januar 2013 laufen<br />
14 Initiativen, 8 Initiativen wurden abgelehnt, eine wurde zurück<br />
gezogen.<br />
Wegen der Anlaufschwierigkeiten bei der praktischen Umsetzeng<br />
der EBI, insbesondere weil die von der Kommission zur Verfügung<br />
gestellte Software für die Online-Registrierung und -Sammlung<br />
nicht termingerecht funktionierte, wurde die Laufzeit der registrierten<br />
EBIs bis November 2013 verlängert.<br />
Die EBI wurde in Deutschland durchweg positiv aufgenommen.<br />
»Mehr Demokratie e. V.« begrüßt »das erste transnationale Instrument<br />
direkter Demokratie«. Die Europa-Union Deutschland bezeichnet<br />
die Europäische Bürgerinitiative als eine große Chance<br />
für das europäische Einigungsprojekt und setzt darauf, »dass das<br />
gemeinsame grenzüberschreitende Agieren der Bürgerinnen und<br />
Bürger längerfristig dazu beitragen wird, die Entwicklung einer<br />
europäischen Öffentlichkeit zu befördern«. Abgeordnete aller<br />
Fraktionen im Europäischen Parlament begrüßten die Einführung<br />
der Bürgerinitiative.<br />
Der Thüringische Justizminister Holger Poppenhäger erhofft sich<br />
durch die EBI eine höhere Wahlbeteiligung bei den Europawahlen.<br />
Mehr direkte Demokratie stärke »auch die Unionsbürgerschaft<br />
und damit die Europäische Identität.«<br />
Die europäische Bürgerinitiative<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
Bewertung und Schluss<br />
Interviews mit MdEP Häfner (| M 4 |) und mit<br />
Tatjana Saranka (| M 2 |) vermitteln eine valide<br />
Einschätzung der EBI. Die Stärke der EBI<br />
liegt zweifelsohne in dem Potential, das sie<br />
für die Bildung einer Europäischen Zivilgesellschaft<br />
besitzt, und der Chance, dass sich<br />
der EU-Bürger aus seiner Zuschauerrolle lösen<br />
kann. Es ist andererseits auch richtig,<br />
dass die Konsequenzen einer erfolgreichen<br />
EBI formal noch deutlich zu gering sind. Das<br />
Bild vom »zahnlosen Tiger« scheint zu stimmen.<br />
Aber leicht wird es den EU-Institutionen nicht<br />
fallen, das Votum von 1 Million Bürgern zu ignorieren.<br />
Das EU-Parlament hört die Vertreter<br />
der erfolgreichen Initiative an und es liegt<br />
in seinem Ermessen und seiner politischen<br />
Klugheit, das Anliegen der EBI zu stärken.<br />
Auch besitzen die EU-Institutionen ein eigenes<br />
Interesse, die wachsende Europäische<br />
Lethargie zu durchbrechen und das bürgerschaftliche<br />
Engagement für Europäische<br />
Themen zu fördern.<br />
Das sieht Elmar BROK, Vorsitzender des Ausschusses<br />
für Auswärtige Angelegenheiten im EU Parlament, ähnlich:<br />
»Gerade in Zeiten der Staatsschuldenkrise, in der die EU –<br />
überwiegend negativ – in aller Munde ist, muss dem drohenden<br />
Vertrauensverlust der Bürger in die EU entgegengewirkt werden.<br />
Dies können wir nur schaffen, indem wir unseren Bürgern mehr<br />
Mitspracherecht geben und damit die Demokratie in Europa stärken<br />
…Die Europäische Bürgerinitiative könnte zu einem echten<br />
Bindeglied zwischen den Bürgern und den EU-Institutionen werden.<br />
Eine Million von 500 Millionen EU-Bürgern zu überzeugen ist<br />
eine Herausforderung, aber machbar – entscheidend ist dabei<br />
das richtige Projekt.«<br />
Die EBI ist damit ein Anfang, der in eine positive Richtung zur Stärkung<br />
der Zivilgesellschaft weist, ein Anfang, der Hoffnung macht.<br />
Literaturhinweise<br />
Arnim, Hans Herbert von (2006): Das Europa-Komplott: Wie EU-Funktionäre<br />
unsere Demokratie verscherbeln, München, Wien.<br />
Efler, Michael/Häfner, Gerald/Huber, Roman/Vogel, Percy (2009): Europa:<br />
Nicht ohne uns! Abwege und Auswege der Demokratie in der Europäischen<br />
Union, Hamburg.<br />
Abb. 3 »Bloß nicht anrufen!« © Horst Haitzinger, 27.7.2012<br />
Heussner, Herrmann K./Jung,Otmar (2009): Mehr direkte Demokratie<br />
wagen – Volksbegehren und Volksentscheid: Geschichte, Praxis, Vorschläge,<br />
München.<br />
Hornung, Ulrike (2011): Die Verordnung über die Europäische Bürgerinitiative<br />
– mit Vollgas und angezogener Handbremse zu mehr Demokratie in<br />
Europa?. In: Recht und Politik. Nr. 2, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011,<br />
S. 94–102.<br />
Pabst,Roland (2012): Europäische Bürgerinitiative im Praxistest, in: mdmagazin<br />
– Zeitschrift für direkte Demokratie, Heft 2/2012, S. 29ff.<br />
Piepenschneider, Melanie (2005): Vertragsgrundlagen und Entscheidungsverfahren,<br />
in: Informationen zur politischen Bildung (Heft 279), bpb, 2005,<br />
S. 23<br />
Schiller, Theo/ Mittendorf, Volker (2002): Direkte Demokratie – Forschung<br />
und Perspektiven, Wiesbaden 2002<br />
Veil, Winfried (2007): Volkssouveränität und Völkersouveränität in der EU –<br />
Mit direkter Demokratie gegen das Demokratiedefizit? Baden-Baden.<br />
Weidenfeld, Werner: Geistige Ordnung auf der Baustelle Europa, Neue<br />
Zürcher Zeitung, 21.2.2013, S. 23<br />
Online-Leitfaden zur Europäischen Bürgerinitiative – Europa: ec.<strong>europa</strong>.<br />
eu/citizens-initiative/files/guide-eci-de.pdf<br />
29<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Die europäische Bürgerinitiative
30<br />
FRANZ THEDIECK<br />
MATERIALIEN<br />
M 1<br />
Das Bundesverfassungsgericht zur Rolle des EU-Parlaments<br />
nach dem Lissabon-Vertrag:<br />
»Gemessen an verfassungsstaatlichen Erfordernissen fehlt es der<br />
Europäischen Union auch nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon<br />
an einem durch gleiche Wahl aller Unionsbürger zustande<br />
gekommenen politischen Entscheidungsorgan mit der Fähigkeit<br />
zur einheitlichen Repräsentation des Volkswillens. Es fehlt, damit<br />
zusammenhängend, zudem an einem System der Herrschaftsorganisation,<br />
in dem ein europäischer Mehrheitswille die Regierungsbildung<br />
so trägt, dass er auf freie und gleiche Wahlentscheidungen<br />
zurückreicht und ein echter und für die Bürger<br />
transparenter Wettstreit zwischen Regierung und Opposition<br />
entstehen kann. Das Europäische Parlament ist auch nach der<br />
Neuformulierung in Art. 14 Abs. 2 EUV-Lissabon und entgegen<br />
dem Anspruch, den Art. 10 Abs. 1 EUV-Lissabon nach seinem<br />
Wortlaut zu erheben scheint, kein Repräsentationsorgan eines<br />
souveränen europäischen Volkes. Dies spiegelt sich darin, dass es<br />
als Vertretung der Völker in den jeweils zugewiesenen nationalen<br />
Kontingenten von Abgeordneten nicht als Vertretung der Unionsbürger<br />
als ununterschiedene Einheit nach dem Prinzip der Wahlgleichheit<br />
angelegt ist.«<br />
BVerfG, Urteil vom 30. Juni 2009, Az: 2 BvE 2/08 u. a., Rn. 284ff.<br />
M 2<br />
Interview mit Tatjana Saranka<br />
Thedieck: Was war Ihre Motivation für die Themenwahl Ihrer Bachelorarbeit?<br />
Saranka: Abgesehen von meinem großen Interesse für europäische<br />
Themen fiel meine Wahl auf die Europäische Bürgerinitiative<br />
(EBI), da die Diskussion über direktdemokratische Beteiligung<br />
der Bürger insbesondere auf europäischer Ebene immer relevanter<br />
wird. Das ist einerseits den immer lauter werdenden Stimmen<br />
über das Demokratiedefizit der EU und – damit zusammenhängend<br />
– der Abkehr der Bürger von der EU und ihrem mangelnden<br />
Vertrauen in die Politik geschuldet. EU Bürger haben das Gefühl,<br />
keine Stimme im europäischen Entscheidungsfindungsprozess zu<br />
haben und empfinden die Geschehnisse »in Brüssel« als bürgerund<br />
realitätsfern. Ein Indiz hierfür sind die sinkende Wahlbeteiligung<br />
bei den EU-Wahlen sowie diverse Eurobarometer-Umfragen.<br />
Thedieck: Wo sehen Sie die größte Schwachstelle bei der EBI?<br />
Saranka: Eine Schwäche der EBI ist ihre geringe verbindliche Wirkung<br />
bei der EU-Kommission. Eine Initiative, welche alle Voraussetzungen<br />
der Zustimmung bei den Bürgern findet, landet noch<br />
lange nicht auf der Agenda der EU-Kommission, auch wenn eine<br />
Ablehnung ausführlich begründet werden muss. Das macht die<br />
EBI zu einem »zahnlosen Tiger«.<br />
Thedieck: Worin besteht ihre Stärke?<br />
Saranka: Eine Stärke des Instruments sehe ich in der verhältnismäßig<br />
liberalen Ausgestaltung der Zugangsvoraussetzungen. Die<br />
Zustimmenden müssen aus 7 Mitgliedstaaten kommen, in denen<br />
sie wiederum eine bestimmte Anzahl an Unterstützern finden<br />
müssen. Angesichts des ursprünglichen Vorschlags der Kommission<br />
(9 Länder) halte ich die beschlossene Zugangsschranke für<br />
einen guten Mittelweg, welcher es den Bürgern einerseits nicht<br />
unmöglich macht, die vorgegebene Mindestanzahl an Stimmen<br />
zu sammeln und andererseits nicht die Gefahr birgt, die Initiative<br />
zu missbrauchen.<br />
Tatjana Saranka schrieb 2011 ihre Bachelorarbeit an der Hochschule Kehl über »Direkte Demokratie<br />
auf Europäischer Ebene« und war dafür mit dem Zukunftspreis der Hochschule<br />
ausgezeichnet worden. Frau Saranka arbeitet derzeit im Europäischen Parlament als Assistentin<br />
des MdEP Elmar Brok. Datum der Befragung: 8. Januar 2013.<br />
M 3<br />
Die Europäische Bürgerinitiative – laufende Initiativen<br />
Bezeichnung<br />
Unconditional Basic<br />
Income (UBI) – Exploring a<br />
pathway towards emancipatory<br />
welfare conditions<br />
in the EU<br />
Single Communication<br />
Tariff Act<br />
Kündigung Personenfreizügigkeit<br />
Schweiz<br />
30 km/h – macht die Straßen<br />
lebenswert!<br />
European Initiative for<br />
Media Pluralism<br />
Stoppen wir den Ökozid in<br />
Europa: Eine Bürgerinitiative,<br />
um der Erde Rechte<br />
zu verleihen<br />
Central public online collection<br />
platform for the<br />
European Citizen Initiative<br />
Aussetzung des Energieund<br />
Klimapakets der EU<br />
Pour une gestion responsable<br />
des déchets, contre<br />
les incinérateurs<br />
Qualitativ hochwertige<br />
europäische Schulbildung<br />
für alle<br />
Stop Vivisection<br />
Let me vote<br />
EINER VON UNS<br />
Wasser und sanitäre<br />
Grundversorgung sind ein<br />
Menschenrecht! Wasser ist<br />
ein öffentliches Gut und<br />
keine Handelsware!<br />
verfügbare<br />
Sprachen<br />
Registrierungsdatum<br />
Frist für die<br />
Sammlung<br />
von Unterstützungsbekundungen<br />
EN* 03/12/2012 03/12/2013<br />
EN* BG CS<br />
DA NL ET FI<br />
FR DE HU GA<br />
IT LV LT PL<br />
RO SK SL ES<br />
SV MT PT EL<br />
03/12/2012 03/12/2013<br />
DE* 19/11/2012 19/11/2013<br />
EN* DE ES FI<br />
FR IT NL SV<br />
SL PL EL CS<br />
HU<br />
EN* FR IT RO<br />
NL HU ES<br />
EN* NL DE<br />
ET<br />
13/11/2012 13/11/2013<br />
05/10/2012 01/11/2013 **<br />
01/10/2012 01/11/2013 **<br />
EN* 16/07/2012 01/11/2013 **<br />
EN* CS PL<br />
HU IT DE DA<br />
LV BG ES FI<br />
FR LT NL PT<br />
SK SL RO<br />
08/08/2012 01/11/2013 **<br />
FR* 16/07/2012 01/11/2013 **<br />
EN* FR IT PL<br />
ES DE HU GA<br />
EL ET SV RO<br />
LT PT NL BG<br />
DA MT FI LV<br />
CS SK<br />
EN* IT FR DE<br />
ES NL DA ET<br />
FI GA SK SL<br />
SV BG RO EL<br />
FR* EN NL<br />
DE ES IT LV<br />
LT SV EL PT<br />
IT* EN FR DE<br />
ES RO PT LT<br />
HU SL PL EL<br />
DA LV SK FI<br />
SV ET NL<br />
EN* NL FR<br />
DE ES IT SV<br />
RO CS BG<br />
DA EL ET FI<br />
GA HU LT LV<br />
MT PL PT SK<br />
SL<br />
16/07/2012 01/11/2013 **<br />
22/06/2012 01/11/2013 **<br />
11/05/2012 01/11/2013 **<br />
11/05/2012 01/11/2013 **<br />
10/05/2012 01/11/2013 **<br />
Die europäische Bürgerinitiative<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
Bezeichnung<br />
Fraternité 2020 – Mobilität.<br />
Fortschritt. Europa.<br />
verfügbare<br />
Sprachen<br />
EN* FR DE<br />
CS IT BG DA<br />
ES LT HU NL<br />
PL PT RO SK<br />
SL FI SV MT<br />
EL GA ET LV<br />
Registrierungsdatum<br />
Frist für die<br />
Sammlung<br />
von Unterstützungsbekundungen<br />
09/05/2012 01/11/2013 **<br />
*Bei der Registrierung verwendete Sprache<br />
**Aufgrund von Problemen während der Anlaufphase der Bürgerinitiative wurde eine neue<br />
Frist festgesetzt.<br />
Weitere Informationen und weiterführende Links zu den EBI unter:<br />
http://ec.<strong>europa</strong>.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing?lg=de<br />
M 4<br />
EU-Kommission: Abgelehnte Registrierungsanträge<br />
Nur die geplanten Initiativen, die den in Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung<br />
über die Bürgerinitiative festgelegten Bedingungen entsprechen,<br />
werden registriert und mithin auf diesem Internetportal<br />
veröffentlicht. Hier (Link vgl unten) finden Sie den Text der<br />
geplanten Initiativen, die diese Bedingungen nicht erfüllen, und<br />
die abschlägigen Bescheide der Kommission an die betreffenden<br />
Bürgerausschüsse.<br />
Die Kommission begründet in ihrer Antwort, warum die Registrierung<br />
aufgrund der in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen<br />
abgelehnt wurde, und weist die Organisatoren auf die ihnen<br />
zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe hin.<br />
– Unconditional Basic Income<br />
– ONE MILLION SIGNATURES FOR<br />
“A EUROPE OF SOLIDARITY”<br />
– Création d›une Banque publique<br />
européenne axée sur le développement<br />
social, écologique et solidaire<br />
– Abolición en Europa de la tauromaquia<br />
y la utilización de toros en<br />
fiestas de crueldad y tortura por<br />
diversión.<br />
– Fortalecimiento de la participación<br />
ciudadana en la toma de decisiones<br />
sobre la soberanía colectiva<br />
– Recommend singing the European<br />
Anthem in Esperanto<br />
– My voice against nuclear power<br />
© Europäische Kommission: http://ec.<strong>europa</strong>.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered<br />
(Stand: 18.1.2013)<br />
Initiative Beiträge zur politischen Entwicklung leisten. Die EBI fördert<br />
das Entstehen einer europäischen Zivilgesellschaft und einer<br />
öffentlichen Debatte über EU-Themen, weil die Bürgerinnen und<br />
Bürger Europas ihre Anliegen benennen und sich für ihr Zustandekommen<br />
miteinander vernetzen. So kommen sie miteinander und<br />
mit den Institutionen ins Gespräch. Letztendlich führt die EBI<br />
auch dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger der EU über ihren<br />
nationalen Tellerrand gucken, aktiv werden und voneinander lernen.<br />
Thedieck: Was sollte an der gegenwärtigen Regelung unbedingt verändert<br />
werden?<br />
Häfner: Die Europäische Bürgerinitiative ist das erste existierende<br />
transnationale Instrument direkter Demokratie in der Praxis.<br />
Damit ist die EBI bereits ein Erfolg. Jedoch muss die EBI dringend<br />
verbessert werden. Sie ist noch zu bürokratisch ausgestaltet<br />
und hinsichtlich der möglichen Themen sowie ihrer voraussehbaren<br />
Wirkung zu begrenzt. Die Tatsache, dass es allein im Ermessen<br />
der Europäischen Kommission liegt, ob sie einen Vorschlag<br />
für eine Gesetzesinitiative annimmt, schränkt die Wirkung dieses<br />
Instruments erheblich ein. Dass eine Million Bürgerinnen und<br />
Bürger aus sieben verschiedenen EU-Ländern den Vorschlag unterschreiben<br />
müssen, ist eine sehr hohe Hürde. Wer sie überwunden<br />
hat, sollte damit mehr bewirken können als nur eine völlig<br />
unverbindliche Anhörung. Wir müssen die EBI bürger- und praxisfreundlicher<br />
machen. Dabei setze ich auf die Lobbyarbeit von<br />
»Democracy International« und »Mehr Demokratie«, die die EBI<br />
maßgeblich mit ins Leben gerufen haben.<br />
Gerald HÄFNER war Vorsitzenden des Vereins »Mehr Demokratie« und den Gründungsvorsitzenden<br />
von »Democracy International«. Gerald Häfner engagiert sich seit über 20 Jahren<br />
für den Ausbau der direkten Demokratie. Er wurde dreimal in den Deutschen Bundestag<br />
gewählt und ist seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments, wo er die Initiative für die<br />
EBI lanciert hat. Datum der Befragung: 10. Januar 2013.<br />
31<br />
M 5<br />
Interview mit Gerald Häfner,<br />
MdEP<br />
Thedieck: Inwieweit erweitert nach Ihrer<br />
Auffassung die EU-Bürgerinitiative<br />
den Spielraum demokratischer Willensbildung?<br />
Häfner: Mit der Europäischen Bürgerinitiative<br />
(EBI) können die Bürgerinnen<br />
und Bürger Europas Themen<br />
auf die europäische Tagesordnung<br />
setzen und damit selbst aus eigener<br />
M 6 Website der europäischen Bürgerinitiative »30 km/h – macht die Straßen lebenswert!«, Stand 29.1.2013<br />
© http://de.30kmh.eu<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Die europäische Bürgerinitiative
32<br />
FRANZ THEDIECK<br />
M 7<br />
EU-Pläne zur Wasserversorgung: Sturm im Wasserglas<br />
oder Privatisierungswelle?<br />
In Deutschland wird derzeit kontrovers darüber diskutiert, ob EU-<br />
Pläne dazu führen, dass Kommunen die Versorgung ihrer Bürger<br />
mit Trinkwasser an private Unternehmen abgeben müssen und<br />
somit die Kontrolle über Preis und Qualität verlieren. Stimmt<br />
nicht, beharrt der zuständige EU-Kommissar Michel Barnier.<br />
Doch Kritiker halten dem entgegen, die Details der Brüsseler<br />
Pläne könnten sehr wohl dazu führen, dass die Wasserversorgung<br />
in bestimmten Fällen öffentlich ausgeschrieben werden muss.<br />
Auslöser der Debatte ist das Vorhaben von Binnenmarktkommissar<br />
Barnier, in der gesamten EU einheitliche Regeln zur Vergabe<br />
von Konzessionen für Dienstleistungen wie die Wasserversorgung<br />
zu schaffen. Ziel sind der Kommission zufolge Wettbewerb<br />
und Chancengleichheit zwischen Unternehmen, aber in Zeiten<br />
leerer öffentlicher Kassen auch eine bessere Kontrolle über die<br />
Verwendung von Steuergeldern, »die in einer beunruhigenden<br />
Reihe von Fällen ohne Transparenz oder Rechenschaftspflicht<br />
ausgegeben werden«, wodurch sich »die Risiken der Günstlingswirtschaft,<br />
des Betrugs und sogar der Korruption erhöhen«.<br />
Inzwischen ist das EU-Gesetzgebungsverfahren der vor mehr als<br />
einem Jahr vorgestellten Pläne auf der Zielgeraden – und Barnier<br />
schlägt immer heftigerer Widerstand aus Deutschland entgegen.<br />
Der Vizechef der Unionsbundestagsfraktion, Johannes Singhammer,<br />
warnt davor, dass durch die neue EU-Regelung die Kommunen<br />
nicht mehr frei entscheiden könnten, wie sie die öffentliche<br />
Wasserversorgung organisieren und letzten Endes die Qualität<br />
leide: »Es besteht zu Recht die Befürchtung, dass nach einer Privatisierung<br />
nur noch die Erzielung von möglichst hohen Renditen<br />
im Vordergrund steht.«<br />
Die EU-Kommission weist Vorwürfe eines Zwangs zur Privatisierung<br />
der Trinkwasserversorgung entschieden zurück und spricht<br />
von »einer bewussten Fehlinterpretation« des Vorschlags. (…) Die<br />
Kritiker der Pläne sehen darin aber aufgrund von Sonderregeln<br />
nur die halbe Wahrheit. Denn etwa bei großen Stadtwerken, die<br />
zum Beispiel auch Strom und Gas anbieten und weniger als 80<br />
Prozent ihres Geschäfts vor Ort machen, müsste nach einer im<br />
Jahr 2020 endenden Übergangsfrist die Vergabe von Dienstleistungen<br />
ausgeschrieben werden. Zwar könnten sich städtische<br />
Unternehmen um den Auftrag bemühen, »bewerben können sich<br />
allerdings auch große, <strong>europa</strong>- und weltweit tätige private Konzerne<br />
mit all ihren Möglichkeiten «, gibt der EU-Abgeordnete Thomas<br />
Händel von der Linken zu Bedenken. Städtetagspräsident<br />
Christian Ude mahnt, dass es für eine qualitativ hochwertige<br />
Wasserversorgung »riesige Investitionen« brauche, die »ein auf<br />
kurzfristigen Gewinn orientiertes Privatunternehmen keineswegs«<br />
schätze. Barnier wolle tief in die kommunalen Strukturen<br />
einer »sehr gut organisierten und funktionierenden Wasserwirtschaft«<br />
eingreifen, warnt der Hauptgeschäftsführer des Verbandes<br />
kommunaler Unternehmen, Hans-Joachim Reck. »Die Bundesregierung<br />
muss jetzt die kommunale Wasserwirtschaft in den<br />
weiteren Beratungen der Richtlinie schützen, ansonsten kommt<br />
sie unter die Räder der Gleichmacher aus Brüssel.«<br />
Auch wenn Barnier sein Vorhaben durchbringt, dürfte die mögliche<br />
Privatisierung von Trinkwasser weiter Thema bleiben. Auf der<br />
Internetseite »www.right2water.eu« werden Unterschriften für<br />
ein EU-Volksbegehren gesammelt mit dem Ziel: »Die Versorgung<br />
mit Trinkwasser und die Bewirtschaftung der Wasserressourcen<br />
darf nicht den Binnenmarktregeln unterworfen werden.« Finden<br />
sich bis September eine Million Unterzeichner, können sie die EU-<br />
Kommission auffordern, sich mit dem Thema zu befassen – mehr<br />
als 600.000 Unterstützer gibt es bereits.<br />
© Jan Dörner, afp, Sturm im Wasserglas oder Privatisierungswelle?, Handelsblatt vom<br />
26.1.2013. Anmerkung: Ende Februar 2013 zog EU-Kommissar Barnier große Teile der bisher<br />
geplanten EU-Wasser-Richtlinie zurück.<br />
M 8 »Der Kommerz im Wasserwerk …« © Luis Murschetz, 2013<br />
M 9<br />
Teresa Fries (jetzt.de – Das Jugendmagazin der Süddeutschen<br />
Zeitung): »Privates Wasser«<br />
Brüssel will die Wasserversorgung künftig ausschreiben lassen.<br />
Seit Tagen werden wir deshalb auf Facebook mit Wasser-Videos<br />
und Einladungen zu einer Bürgerinitiative gegen die Privatisierung<br />
bombardiert. Wir haben die Debatte in sechs Antworten zusammengefasst.<br />
Wasser in privater Hand? Das lässt einen schon<br />
misstrauisch werden. Denn was die private Hand hält, kann sie<br />
auch nach ihrer privaten Laune verschenken oder eben teuer verkaufen.<br />
Wasser braucht jeder, doch was, wenn man es sich nicht<br />
mehr leisten kann? Es geht definitiv um ein wichtiges Thema,<br />
doch keiner versteht so genau, was da in der EU gerade passiert:<br />
Die EU-Kommission hat einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinien<br />
zur Vergabe der Dienstleistungskonzessionen unter anderem<br />
für den Bereich der Trinkwasserversorgung gemacht. Der<br />
Binnenmarktausschuss hat diesem zugestimmt. Demnach wird er<br />
dem Parlament vorgelegt, das im April (2013) endgültig darüber<br />
entscheidet. Doch was heißt das denn nun bitteschön? »jetzt.de«<br />
hat mit ver.di-Mitarbeiter Mathias Ladstätter, dem deutschen<br />
Vertreter der Europäischen Bürgerinitiative »right2water«, gesprochen<br />
und beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema<br />
Wasserprivatisierung.<br />
1. Was würde eine Privatisierung der Wasserversorgung bedeuten?<br />
In Deutschland sind Städte und Kommunen für die Wasserversorgung<br />
und Abwasserentsorgung zuständig. Die Wasserversorgung<br />
liegt deshalb zum größten Teil in öffentlicher Hand. Privatisierung<br />
würde bedeuten, dass Wasserbetriebe von privaten Unternehmen<br />
übernommen werden würden. Bürger müssten dann<br />
diese für die Wasserversorgung bezahlen. Für Mathias Ladstätter<br />
ist die Gefahr ganz offensichtlich: Die Kommunen und Städte bestimmen<br />
den Preis nach dem Kostendeckungsprinzip. Sie verlangen<br />
nur so wiel, wie sie brauchen, um Qualität und Versorgung<br />
auch zukünftig sicher zu stellen. Anders ist das bei privaten Unternehmen,<br />
deren Zweck es ist, Gewinn zu erwirtschaften.<br />
2. Worum genau geht es bei dem Vorschlag der EU Kommission?<br />
Die Möglichkeit der Privatisierung beziehungsweise der Teilprivatisierung<br />
besteht bereits – auch in Deutschland. »Zwischen fünf<br />
und zehn Prozent der Wasserver- und Abwasserentsorgung sind<br />
bei uns privat«, erklärt Mathias Ladstätter. Im Vergleich zu anderen<br />
Ländern sei das allerdings sehr wenig. Auch gebe es Stadtwerke<br />
mit privaten Teilhabern. Solange deren Anteil unter 49 Prozent<br />
liegt, handele es sich immer noch um öffentlich-rechtliche<br />
Institutionen. Es sei also möglich, dass Stadtwerke neben Wasser<br />
auch zum Beispiel Strom anbieten und über die Grenzen des Versorgungsgebiets<br />
verkaufen würden. Damit wären sie zumindest<br />
in diesem Bereich auch gewinnorientierte Unternehmen.<br />
Die europäische Bürgerinitiative<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
M 10 Website der europäischen Bürgerinitiative »www.right2water.eu/de«, Stand 29.1.2013<br />
Mathias Ladstätter erklärt das Prinzip folgendermaßen:<br />
Die Städte und Gemeinden<br />
können mit solchen Stadtwerken Verträge<br />
abschließen. Sie vergeben sogenannte<br />
Dienstleistungskonzessionen. Damit übertragen<br />
sie ihre kommunale Aufgabe der Wasserversorgung<br />
ganz oder nur teilweise zum<br />
Beispiel an ein Stadtwerk. Diese Konzessionen<br />
sind an Bedingungen geknüpft. So kann<br />
die Stadt noch immer bestimmen, wie viel die<br />
Wasserversorgung den Bürger kosten darf,<br />
welche Qualitätsstandards eingehalten werden,<br />
wie viel die Mitarbeiter des Stadtwerks<br />
verdienen, welche Nachhaltigkeitsmaßnahmen<br />
getroffen werden müssen und so weiter.<br />
Im Moment können Städte und Kommunen<br />
entscheiden, an wen sie die Konzessionen<br />
vergeben. Ist ein Vertrag ausgelaufen, können<br />
sie ihn entweder verlängern, anderweitig<br />
vergeben oder kommunalisieren die Wasserversorgung<br />
wieder. Die EU-Kommission will<br />
die Richtlinien zur Vergabe dieser Dienstleistungskonzessionen<br />
ändern. Sie will, dass<br />
nicht mehr die Kommunen selbst einfach<br />
entscheiden können, sondern dass alle Konzessionen<br />
EU-weit für private Unternehmer<br />
ausgeschrieben werden. Das beste Angebot<br />
gewinnt. Das hätte zur Folge: Es könnte nicht<br />
mehr nur teilweise privatisiert werden und<br />
die Vergabe der Konzessionen wären nicht<br />
mehr an besondere Bedingungen – was Preis<br />
oder Qualität betrifft – geknüpft.<br />
3. Wie rechtfertigt die Kommission das?<br />
Laut einem Artikel in »Der Standard« weist<br />
der EU-Kommissar für Binnenmarkt und<br />
Dienstleistungen, Michel Barnier, die Kritik<br />
zurück. Es gehe nur um eine transparente Vergabe der Konzessionen.<br />
Er spricht von einer »bewussten Fehlinterpretation« durch<br />
Privatisierungsgegner. Der Richtlinienvorschlag enthalte keine<br />
Verpflichtung zur Vergabe der Leistungen am Markt. Was bedeuten<br />
würde, eine Privatisierung sei nach wie vor freiwillig. Mathias<br />
Ladstätter nennt die Rechtfertigung des Kommissars »eine falsche<br />
Beruhigungspille. Natürlich könnten die Kommunen sich<br />
auch innerhalb der EU-Ausschreibung bewerben, aber gegen die<br />
großen internationalen Konzerne könnten sie nicht ankommen.<br />
Denen stünde dann nichts mehr im Weg.«<br />
4. Was würde sich durch die neue Richtlinie für uns ändern?<br />
Für uns Verbraucher würde das bedeuten, dass immer mehr Betriebe<br />
der Wasserver- und Abwasserentsorgung in privaten Besitz<br />
übergehen würden. Damit wären die Preise nicht mehr gesichert<br />
und wir müssten mit Erhöhungen rechnen. Zudem könnte die<br />
Wasserqualität abnehmen, da die privaten Unternehmer nicht<br />
mehr allen heutigen Standards entsprechen müssten. Auch dazu,<br />
mit dem Wasser nachhaltig zu wirtschaften, wären die Unternehmer<br />
nicht verpflichtet. Ein Youtube-Video, in dem Nestle Konzernchef<br />
Peter Brabeck-Letmathe seine Ansichten über die Trinkwasserversorgung<br />
darlegt, lässt nichts Gutes ahnen: Wasser als<br />
öffentliches Recht wäre die eine Extremlösung, die andere – für<br />
die er sich natürlich ausspricht – wäre, dass Wasser einen Wert<br />
bekommt. Für den Teil der Bevölkerung, der dadurch keinen Zugang<br />
mehr zu Wasser hätte, für den gäbe es ja spezifische Möglichkeiten.<br />
5. In der Diskussion hört man immer wieder, dass der Zugang<br />
zu Wasser ein Menschenrecht sein soll. Da wir für das Wasser<br />
zahlen, ist das doch im Moment auch nicht der Fall?<br />
»Wir zahlen nicht für das Wasser, sondern nur für die Bereitstellung<br />
«, erklärt Mathias Ladstätter. Damit sind zum Beispiel Pumpen,<br />
Rohre, Qualitätstests und Mitarbeiter gemeint. Das Wasser<br />
an sich zahlen wir nicht. Das sei Allgemeingut. Doch mit den Privatisierungsvorhaben<br />
ginge das Menschenrecht auf Wasser noch<br />
viel weniger einher. Die UNO deklarierte 2012 zwar den Zugang zu<br />
Wasser als Menschenrecht, doch eine solche Deklaration hat<br />
keine rechtlichen Folgen. Die Europäische Bürgerinitiative »right-<br />
2water« fordert schon lange ein entsprechendes Gesetz der EU-<br />
Kommission, allerdings ohne Erfolg. Gäbe es ein Gesetz, das das<br />
Menschenrecht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung gewährleisten<br />
würde, hätte die Privatisierung weit weniger Chancen.<br />
6. Was kann eine Bürgerinitiative ausrichten?<br />
Die Europäische Bürgerinitiative »right2water« wird hauptsächlich<br />
von Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes organisiert.<br />
Alle Bürgerinnen und Bürger, die in einem der 27 EU-Mitgliedstaaten<br />
aktives Wahlrecht haben, können die Initiative mit ihrer<br />
Unterschrift unterstützen. Kommen eine Million Unterschriften<br />
aus mindestens sieben Staaten zusammen, muss das Parlament<br />
sich mit den Vertretern auseinandersetzen und das Anliegen politisch<br />
behandeln. Im Klartext heißt das: Das Parlament muss zwar<br />
darüber reden und die Bürgerstimmen zur Kenntnis nehmen, ihr<br />
Vorhaben zur Privatisierung können sie trotzdem umsetzen.<br />
»Selbst wenn das Parlament dem Vorschlag zustimmt, werden wir<br />
die Bürgerinitiative weiterführen«, sagt Mathias Ladstätter. Er<br />
und seine Mitstreiter würden dann dafür kämpfen, dass die Richtlinien<br />
überdacht und geändert werden. »Es wäre in diesem Fall<br />
noch wichtiger als zuvor.«<br />
© Teresa Fries, Privates Wasser, 24.1.2013, http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/<br />
anzeigen/564942/Privates-Wasser<br />
33<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Die europäische Bürgerinitiative
BÜRGERBETEILIGUNG IN DEUTSCHLAND UND EUROPA<br />
6. Mehr Demokratie? Zivilgesellschaftliche<br />
Bewegungen in Deutschland und<br />
Europa von 1945–1990<br />
ANDREAS GRIESSINGER<br />
34<br />
Bürgerbeteiligung und Bürgerprotest – ein Thema, das<br />
kaum aktueller sein könnte. Wer auf die vergangenen<br />
Jahre zurückblickt, dem fallen spontan vielfältige Bilder von<br />
Menschen ein, die ihren Anspruch auf mehr politische Selbstbestimmung<br />
auf Straßen und Plätzen mutig und kompromisslos<br />
eingeklagt haben. Erst in jüngster Zeit zeigte der<br />
»arabische Frühling« die unbändige Kraft empörter Bürgerbewegungen<br />
gegenüber hochgerüsteten autoritären Regimen<br />
wie beispielsweise dem Gaddafis in Libyen. Aber nicht<br />
nur Diktaturen erfuhren den Zorn ihrer Bürger, die globale<br />
Finanz krise generierte Bürgerproteste auch in den demokratischen<br />
Staaten Nordamerikas und West<strong>europa</strong>s: Die<br />
»Occupy«-Bewegung trug den Ruf nach demokratischer Kontrolle<br />
der Börsen und Finanzmärkte sowie nach mehr Bürgerbeteiligung<br />
bei den finanzpolitischen Entscheidungen der Regierungen<br />
direkt vor unsere Haustür. Sie steht damit in der<br />
Tradition der global agierenden Bürgerproteste von NGOs wie<br />
»Amnesty International«, »Greenpeace«, »Attac« oder »Transparency<br />
International«. Auch im deutschen Südwesten haben<br />
»Wutbürger« im Zusammenhang mit »Stuttgart 21« ihre Kritik<br />
an bürgerfernen verkehrspolitischen Planungs- und Entscheidungsprozessen<br />
lautstark artikuliert, genauso wie regionale<br />
Initiativen wenig später gegen den umstrittenen Fluglärm-<br />
Staatsvertrag zwischen der Bundesregierung und der Schweiz<br />
sowie gegen Pläne der Landesregierung zur Einrichtung eines<br />
»Nationalparks Nordschwarzwald« protestiert haben. Und<br />
schließlich war die Unzufriedenheit überwiegend junger Wählerinnen<br />
und Wähler mit unzureichenden Mitbestimmungsmöglichkeiten<br />
in den etablierten demokratischen Parteien<br />
eine Ursache für das Entstehen der »Piraten«-Partei und ihrer<br />
Forderung nach internetgestützter Direktbeteiligung an parteiinternen<br />
Meinungsbildungsprozessen, z. B. über elektronische<br />
»liquid feedback«-Methoden. »Liquid democracy« wurde<br />
zum provokanten Schlagwort der neuen Partei, die z. B. über<br />
ständige Mitgliederversammlungen unmittelbare Betei ligungs<br />
formen – ohne den Umweg über Delegierten-Parteitage<br />
– zu garantieren verspricht.<br />
All das sind spektakuläre Formen zivilgesellschaftlichen Engagements,<br />
die von den Medien gern aufgegriffen und in der politischen<br />
Öffentlichkeit breit diskutiert werden. Seit vielen Jahren<br />
gibt es aber auch »stillere« Formen von Bürgerbeteiligung, die<br />
Teil der politisch-administrativen Normalität geworden sind: Eltern<br />
engagieren sich in Schulkonferenzen, die mit erweiterten<br />
Kompetenzen ausgestattet werden, Anwohner beteiligen sich an<br />
der Stadtentwicklungsplanung, insgesamt gilt: Bürgerinnen und<br />
Bürger engagieren sich aktiv und selbstbewusst bei der Gestaltung<br />
ihres unmittelbaren Lebensumfeldes in der Nachbarschaft,<br />
dem Stadtviertel, der Kommune oder dem Landkreis. Sie nutzen<br />
Angebote der deliberativen Bürgerbeteiligung, die sich mittlerweile<br />
stark ausgeweitet haben: Bürgerkonferenzen, Zukunftswerkstätten,<br />
Szenario-Workshops usw. In diesem Zusammenhang<br />
hat sich im Verlauf der vergangenen 10 Jahre die Anzahl der<br />
Bürgerentscheide auf der Ebene der kommunalen Gebietskörperschaften<br />
verdreifacht. Weder Gemeinderäte noch Stadtverwaltungen<br />
können sich diesen Ansprüchen ihrer Bürger mehr entziehen,<br />
im Gegenteil: Sie haben die vielfältigen Vorteile einer<br />
Abb. 1. Die Pnyx in Athen war seit den Reformen des Kleisthenes der Tagungsort,<br />
wo bis 330 v. Chr. die Volksversammlungen der Athener abgehalten wurde.<br />
Im Vordergrund die Rednertribühne, die Bema, im Hintergrund die Akropolis.<br />
© John Hios,picture-alliance, akg<br />
kontinuierlichen Kooperation mit der interessierten Öffentlichkeit<br />
mittlerweile erkannt und in ihre Entscheidungsabläufe integriert.<br />
Die historischen Wurzeln des Anspruchs auf<br />
Bürgerbeteiligung<br />
Das Thema »Bürgerbeteiligung und Bürgerprotest« hat aber keineswegs<br />
nur tagesaktuelle Aspekte, von denen einige kurz skizziert<br />
wurden. Wichtiger ist im Folgenden seine historische Tiefendimension,<br />
liegen die Wurzeln des Anspruchs auf politische<br />
Teilhabe doch in der europäischen Geschichte selbst. Mit grundsätzlich<br />
neuem Anspruch – deshalb sprach der Althistoriker Christian<br />
Meier mit Recht von einem »Neubeginn der Weltgeschichte« –<br />
wurde Bürgerpartizipation erstmals im Modell der attischen<br />
Demokratie praktiziert und in ein Verfahren überführt, das Politik<br />
als die »Kunst, Entscheidungen durch öffentliche Diskussion herbeizuführen«<br />
(Moses Finley) verstand, und zwar vor allem über die<br />
direkte Beteiligung der Bürger in der Institution der Volksversammlung.<br />
Aber auch im europäischen Mittelalter galt Herrschaft<br />
nur dann als legitim, wenn sie auf dem Konsens mit den zur politischen<br />
Teilhabe berechtigten Untertanen beruhte. So erkämpfte<br />
sich das mittelalterliche Stadtbürgertum von den vormaligen<br />
adli gen oder geistlichen Stadtherren Formen politischer Selbstverwaltung<br />
und Bürgerfreiheit, die es sich durch verbriefte Privilegien<br />
garantieren ließ. »Stadtluft macht frei« stammt als Schlagwort<br />
zwar aus dem 19. Jahrhundert, trifft aber den Kern des<br />
städtischen Selbstbestimmungsanspruchs. Auch auf dem Land<br />
entstand im Spätmittelalter ein selbstbewusster partizipativer<br />
»Kommunalismus« (Peter Blickle), der immerhin der bäuerlichen<br />
Oberschicht gemeindliche Autonomie und Selbstbestimmung gegenüber<br />
grundherrlicher und obrigkeitlicher Bevormundung garantierte.<br />
Dieser bildete die Basis nicht nur für den Widerstand<br />
Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa D&E Heft 65 · 2013
der Schweizer Eidgenossen seit 1291 gegen die habsburgischen<br />
Territorialisierungsabsichten, sondern auch für die kollektive Widerständigkeit<br />
des »gemeinen Mannes« im Bauernkrieg 1525. Die<br />
Wirkmächtigkeit solch kollektiver Beteiligungstraditionen in Europa<br />
zeigt sich übrigens in dem nur auf den ersten Blick paradoxen<br />
Sachverhalt, dass später selbst absolutistische und totalitäre<br />
Regimes ständische bzw. parlamentarische Mitbestimmungsgremien<br />
bezeichnenderweise auch dann nicht abgeschafft haben,<br />
wenn sie sie faktisch bereits entmachtet hatten.<br />
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, die langen Traditionen<br />
direkter politischer Teilhaberechte in der Geschichte Europas<br />
nachzuzeichnen – gleichwohl sollten sie nicht in Vergessenheit<br />
geraten, weil diese phasenweise auch immer wieder verschütteten<br />
Traditionslinien eine normative Wirkung entfaltet haben, die<br />
bis in die Gegenwart reicht. Europa war und ist ein Raum zwar<br />
stets umkämpfter, aber gerade in diesen Kämpfen sich unaufhaltsam<br />
entfaltender Partizipationsformen. Sie mündeten im<br />
späten 18. Jahrhundert ins Programm einer »bürgerlichen Gesellschaft«:<br />
In ihrem Zentrum stand »das Ziel einer modernen, säkularisierten<br />
Gesellschaft freier, mündiger Bürger (citoyens), die<br />
ihre Verhältnisse friedlich, vernünftig und selbstständig regelten,<br />
ohne allzu viel soziale Ungleichheit, ohne obrigkeitsstaatliche<br />
Gängelung, individuell und gemeinsam zugleich.« (Jürgen Kocka,<br />
vgl. | M 1 |). Dieser epochal neue Lebensentwurf artikulierte sich<br />
in den Revolutionen von 1776 in Amerika, 1789 in Frankreich und<br />
1848 in Deutschland und Europa. Im 20. Jahrhundert entwickelte<br />
sich aus dem sozial begrenzten Programm der »bürgerlichen Gesellschaft«<br />
das universale Konzept einer »Zivilgesellschaft« bzw.<br />
»civil society«, die sich insbesondere nach dem Ende des Zweiten<br />
Weltkriegs in Nordamerika und Europa, schließlich zusehends<br />
auch global entfaltete. Diese zivilgesellschaftliche Ausweitungsbewegung<br />
soll im Folgenden für die Zeit zwischen 1945 und 1990<br />
nachgezeichnet werden.<br />
Bürgerbeteiligung und Bürgerprotest seit 1945<br />
Beginnen wir mit einem Tatbestand, der auf den ersten Blick vielleicht<br />
überraschend erscheinen mag: Der »Zivilisationsbruch«<br />
(Dan Diner) der Jahre 1933–45 und der 1947 einsetzende »Kalte<br />
Krieg« etablierten mit der pluralistisch-repräsentativen Demokratie<br />
im Westen und der »Volksdemokratie« im Osten zwei einander<br />
diametral entgegengesetzte Demokratiemodelle, die direkte<br />
Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger gleichermaßen<br />
bewusst einhegten und in ihrer Entfaltung begrenzten, wenn<br />
auch aus gänzlich unterschiedlichen Begründungszusammenhängen<br />
heraus. Waren die Beweggründe im Westen einerseits die<br />
zuerst in den »Federalist Papers« der us-amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung<br />
systematisch begründeten repräsentativen<br />
Traditionen der US-Verfassung, andererseits die vermeintlich<br />
schlechten Erfahrungen in Deutschland mit den plebiszitären Elementen<br />
der Weimarer Verfassung angesichts ihrer Instrumentalisierbarkeit<br />
für antidemokratische Bewegungen, so wirkten im<br />
Osten die auf Rousseau (»volonté générale«) zurückgehenden<br />
identitätstheoretischen Grundannahmen des sozialistischen Demokratiebegriffs<br />
(z. B. »Einheitslisten«) und Lenins Parteitheorie<br />
(»Avantgarde des Proletariats«) restriktiv auf die ideologisch eigentlich<br />
propagierte »Entfaltung einer breiten Massenbewegung<br />
als der breitesten Zusammenfassung aller fortschrittlichen demokratischen,<br />
antinazistischen Kräfte« (Walter Ulbricht, Wilhelm<br />
Pieck und Anton Ackermann am 17.2.1945).<br />
Beginnen wir mit der jungen Bundesrepublik: Entgegen seiner dezidiert<br />
repräsentativ angelegten Grundtendenz entfaltete das<br />
Grundgesetz in der »Kanzlerdemokratie« Konrad Adenauers<br />
seine partizipationsbegrenzende Wirkung nur teilweise, was<br />
prima facie überraschen mag. Zum Katalysator der eigentlich systemfremden<br />
Selbstorganisation der oppositionellen Staatsbürger<br />
wurde die Verteidigungspolitik: Eine breite pazifistische Bewegung,<br />
die sich bereits in der ersten Hälfte der 50er Jahre unter der<br />
Abb. 2 Tausende von Demonstranten auf dem Trafalgar Square in London.<br />
1958 wurde der erste viertägige Marsch von London nach Aldermaston in Berkshire<br />
von der »Kampagne für nukleare Abrüstung« organisiert. Dieser »Alderston<br />
March« gilt als Beginn der europäischen Ostermärsche gegen atomare Bewaffnung.<br />
© Mary Evans Picture Library, 4.4.1958, picture alliance<br />
Parole »Ohne mich!« gegen Adenauers Wiederbewaffnungspolitik<br />
formiert hatte, schwoll weiter an, als 1956 Pläne zur Ausrüstung<br />
der eben erst gegründeten Bundeswehr mit Atomwaffen<br />
bekannt wurden. Der Protest wurde außer von der SPD auch<br />
von Kirchen, Gewerkschaften, Hochschulen, Studentenvertretungen,<br />
Künstlern und Schriftstellern getragen. Große Resonanz<br />
fand 1957 die »Göttinger Erklärung« (| M 2 |), in der 18 namhafte<br />
deutsche Atomforscher die Nuklearpläne Adenauers scharf kritisierten.<br />
Der 1958 gegründete Arbeitsausschuss »Kampf dem<br />
Atomtod« organisierte zahlreiche Massendemonstrationen in<br />
deutschen Städten, an denen Hunderttausende von Menschen<br />
teilnahmen, die Adenauers Pläne schließlich erfolgreich zu Fall<br />
brachten, nachdem auch bei den Westalliierten, insbesondere<br />
den USA, Bedenken laut geworden waren. Das war der erste spektakuläre<br />
Erfolg einer regierungskritischen Bürgerbewegung, die<br />
ihren Anspruch auf politische Mitbestimmung in autonom organisierten<br />
Formen öffentlichen Protests artikulierte.<br />
Bereits diese erste zivilgesellschaftliche Bewegung der jungen<br />
Bundesrepublik war vernetzt mit pazifistischen Gruppen in Europa,<br />
insbesondere in Großbritannien: mit den »War Resisters›<br />
International«, dem »Direct Action Committee Against Nuclear<br />
War« und der »Campaign for Nuclear Disarmament«. Diese organisierte,<br />
unabhängig von den deutschen Protesten, an Ostern<br />
1958 den »Aldermaston March« von London zum Atomforschungszentrum<br />
Aldermaston mit 10.000 Teilnehmern, aus dem sich in<br />
den Folgejahren in ganz West<strong>europa</strong> die Ostermarsch-Bewegung<br />
entwickelte. Der erste deutsche Ostermarsch fand 1960 statt,<br />
nachdem Gerüchte über eine geplante Erprobung von Atomraketen<br />
in der Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-<br />
Belsen laut geworden waren. Er war als Sternmarsch organisiert<br />
und endete am Ostermontag 1960 beim Truppenübungsplatz<br />
Bergen-Hohne mit mehr als 1000 Teilnehmern. In diesen Aktivitäten<br />
kann man mit guten Gründen die Anfänge der neuen sozialen<br />
Bewegungen der 70er Jahre, insbesondere der <strong>europa</strong>weiten Friedensbewegung<br />
sehen, auf die später noch zurückzukommen ist.<br />
Auf eine weitere transnationale Vernetzung ist hinzuweisen: Träger<br />
des ersten deutschen Ostermarschs war der Hamburger<br />
»Aktions kreis für Gewaltlosigkeit«, dessen Name bereits auf den<br />
35<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa
36<br />
ANDREAS GRIESSINGER<br />
Abb. 3 Nach vorangegangenen Streiks in Ost-Berliner Betrieben versammelten sich am 17. Juni 1953<br />
Demonstranten in den Straßen von Berlin und in der ganzen DDR, um gegen das SED-Regime zu protestieren<br />
– hier wird ein sowjetischer Panzer am Potsdamer Platz mit Steinen beworfen. Sowjetische Truppen<br />
und die Nationale Volksarmee der DDR warfen den Volksaufstand in der DDR mit Waffengewalt nieder.<br />
© zb-archiv, picture alliance, 17.6.1953<br />
gewaltlosen Widerstand Mahatma Gandhis in der indischen Unabhängigkeitsbewegung<br />
der 40er Jahre verweist, der gleichzeitig<br />
weltweit Vorbild und Katalysator für antikoloniale Proteste<br />
wurde. Er beeinflusste auch die Bürgerrechtsbewegung in den<br />
USA gegen Rassentrennung und -diskriminierung, die 1954 mit<br />
dem berühmten Urteil des Supreme Court im Fall »Brown v. Board<br />
of Education of Topeka, Kansas« zur Massenbewegung heranwuchs.<br />
Den Anstoß zu der Bewegung gaben fortbestehende Formen<br />
von Rassentrennung, obwohl der Oberste Gerichtshof der<br />
USA entschieden hatte, dass die Integration von Minderheiten für<br />
die öffentlichen Schulen eine Pflicht darstelle und die Rassentrennung<br />
an Schulen verfassungswidrig sei. Aus der amerikanischen<br />
Bürgerrechtsbewegung gingen nicht nur Martin Luther<br />
King als charismatischer Führer hervor, der 1968 ermordet wurde,<br />
sondern auch Stokely Carmichael und Malcolm X mit ihrer radikalen<br />
»Black Power«-Bewegung, die in die ebenfalls von den USA<br />
ausgehende 68er-Bewegung einmündete. Über sie ist später zu<br />
berichten, bleiben wir zunächst in der Frühphase der zivilgesellschaftlichen<br />
Bewegungen.<br />
Denn bürgerschaftlicher Protest war keineswegs ein Monopol des<br />
Westens: Auch in der DDR meldeten Bürger, ermutigt durch Stalins<br />
Tod, bereits in den 50er Jahren ihre Partizipationsforderungen<br />
unüberhörbar an, wenn auch – hier liegt der Unterschied zur<br />
Bundesrepublik – ohne Erfolg: Nach ersten Arbeiterstreiks am 11.<br />
und 12. Juni 1953 zogen Bauarbeiter der Ostberliner Stalinallee,<br />
des Vorzeigeprojekts sozialistischen Wohnungsbaus, am Morgen<br />
des 16. Juni vor das Haus der Ministerien: Forderungen nach Rücknahme<br />
der kurz zuvor verordneten Normerhöhungen und einem<br />
Generalstreik wurden laut. Wir wissen heute, dass die Wortführer<br />
und Organisatoren der Streikbewegung überwiegend ältere Arbeiter<br />
waren, die bereits in der Zeit der Weimarer Republik gewerkschaftlich<br />
organisiert waren und auf Erfahrungen mit der<br />
Planung und Durchführung von Streiks zurückgreifen konnten –<br />
hier zeigt sich überdeutlich die Bedeutung bürgerschaftlicher<br />
Teilhabetraditionen als Voraussetzung für politische Handlungsfähigkeit.<br />
Am 17. Juni verbreitete sich die Protestbewegung flächenbrandartig<br />
und dehnte sich in den folgenden Tagen auf über<br />
560 Orte der DDR aus, wobei städtische Mittelschichten, Bauern<br />
und Intellektuelle hinzustießen. Allein am 17. Juni beteiligten sich<br />
über 500 000 Menschen an Streiks und über 400.000 an Demonstrationen.<br />
Dabei waren neben wirtschaftlichen und sozialpolitischen<br />
Forderungen auch Rufe nach freien Wahlen, deutscher Einheit<br />
und Rücktritt der Regierung zu hören (| M 5 |). Nachdem<br />
Volkspolizei und Stasi die Kontrolle über die Situation verloren<br />
hatten, wurde der Volksaufstand von sowjetischen Panzern niedergeschlagen,<br />
wobei mehr als 50 Protestierende erschossen und<br />
40 sowjetische Soldaten wegen Befehlsverweigerung hingerichtet<br />
wurden. 3 000 Demonstranten wurden von der Sowjetarmee<br />
festgenommen, es folgten weitere 13 000<br />
Verhaftungen durch die zuständigen Organe<br />
der DDR. Nur das gewaltsame Vorgehen der<br />
»Roten Armee« hatte die SED vor dem Sturz<br />
durch die Volksbewegung gerettet. Die erste<br />
Massenerhebung gegen ein kommunistisches<br />
Regime nach 1945 war von Panzern niedergewalzt<br />
worden, der Westen war den Aufständischen<br />
nicht zu Hilfe gekommen. Drei<br />
Jahre später, im Jahr 1956, erfuhren die Aufständischen<br />
in Budapest dann dasselbe<br />
Schicksal, und auch der zu Unrecht weitgehend<br />
vergessene Posener Aufstand im selben<br />
Jahr wurde von der polnischen Armee blutig<br />
niedergeschlagen, diesmal allerdings ohne<br />
sowjetische Beteiligung – auch das sind<br />
deutliche Hinweise auf transnationale Zusammenhänge<br />
und Wechselwirkungen.<br />
Zurück zum Westen: Nach den ersten Erfolgen<br />
der bundesrepublikanischen Bürgerbewegung<br />
in der Mitte der 50er Jahre musste<br />
Adenauer weitere Niederlagen gegen eine<br />
zusehends kritischer werdende Öffentlichkeit hinnehmen, und<br />
zwar einerseits während der »Präsidentschaftskrise« 1959, in der<br />
er das Amt des Bundespräsidenten anstrebte, um die Politik seines<br />
designierten Nachfolgers Erhard kontrollieren zu können, andererseits<br />
beim »Fernsehstreit« 1960, während dem Adenauer ein<br />
zweites Fernsehprogramm unter Einfluss und Aufsicht der Bundesregierung<br />
schaffen wollte. Die wachsende öffentliche Kritik<br />
an seiner paternal-autoritären »Kanzlerdemokratie« führte bei<br />
der Bundestagswahl 1961 schließlich zum Verlust der absoluten<br />
Mehrheit für CDU und CSU. Das unwiderrufliche Ende der »Ära<br />
Adenauer« wurde dann 1962 durch die »SPIEGEL-Affäre« und die<br />
durch sie ausgelöste Regierungskrise eingeleitet: Ein in dem<br />
Hamburger Nachrichtenmagazin abgedruckter kritischer Artikel<br />
zur Verteidigungspolitik der CDU führte zur Verhaftung des Herausgebers<br />
Rudolf Augstein, mehrerer leitender Redakteure und<br />
des verantwortlichen Journalisten Conrad Ahlers, die Verteidigungsminister<br />
Franz-Josef Strauß persönlich veranlasst hatte. Die<br />
folgende Durchsuchung der »SPIEGEL«-Redaktionsräume begründete<br />
Adenauer angesichts heftiger öffentlicher Proteste mit<br />
einem »Abgrund von Landesverrat«, der sich aufgetan habe. Massenkundgebungen<br />
von Studierenden und Gewerkschaften waren<br />
die Folge, bei denen von massiven Eingriffen in die Presse- und<br />
Meinungsfreiheit gesprochen wurde. Als selbst der Koalitionspartner<br />
FDP den Rücktritt von Franz-Josef Strauß forderte, war<br />
Adenauer am Ende: Er gab nach, bildete ein neues Kabinett, dem<br />
Strauß nicht mehr angehörte, und kündigte seinen Rücktritt für<br />
den Herbst 1963 an. Erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik<br />
war aus einer politischen Krise die kritische Öffentlichkeit als Siegerin<br />
hervorgegangen. Das sollte in den kommenden Jahren<br />
Schule machen.<br />
Wendejahr 1968<br />
Die nächste Etappe in der Verbreiterung politischer Bürgerbeteiliung<br />
bildete das Jahr 1968 in der Bundesrepublik, dessen Wurzeln<br />
wiederum in den USA lagen. Die 68er-Bewegung begann mit Protesten<br />
amerikanischer Studenten gegen den Vietnam-Krieg, die<br />
von dem 1960 gegründeten »Student Nonviolent Coordinating<br />
Committee« und den »Students for a Democratic Society« getragen<br />
wurden. Ihr Wortführer Tom Hayden formulierte schon 1962<br />
die Forderung nach einer »participatory democracy«. Diese Parole<br />
fiel in der Bundesrepublik rasch auf fruchtbaren Boden, wo<br />
die »Außerparlamentarische Opposition« angesichts der Großen<br />
Koalition eine »Transformation der Demokratie« (Johannes<br />
Agnoli) in Richtung eines technokratisch-autoritären Staats diagnostizierte.<br />
Als Indikatoren sah sie die auf die winzige FDP ge-<br />
Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
Abb. 4 Streikende Arbeiter der Renault-Werke in Boulogne-Billancourt schauen vom Dach aus auf die<br />
Studenten, die am 17. Mai 1968 mit einem Marsch zum Werk des Automobilherstellers ihre Solidarität<br />
mit den streikenden Arbeitern bekunden wollen. Die Regierung de Gaulle unterschätzte die soziale<br />
Unzufriedenheit breiter Schichten der französischen Bevölkerung. 1968 führten die Maiunruhen zu<br />
bürgerkriegs ähnlichen Zuständen, in Paris lieferten sich die Studenten Straßenschlachten mit der Polizei.<br />
Die Gewerkschaften riefen am 13. Mai zum Generalstreik auf. Am 30. Mai löste Staatspräsident de Gaulle<br />
die Nationalversammlung auf und rief Neuwahlen aus. Diese wurden von den Gaullisten gewonnen, die<br />
Ära de Gaulle fand trotzdem ihr Ende: Am 28. April 1969 trat Charles de Gaulle nach einem verlorenen<br />
Referendum zurück. © upi, picture alliance, 13.5.1968<br />
schrumpfte und damit zur Bedeutungslosigkeit<br />
verurteilte parlamentarische Opposition<br />
sowie die von der Großen Koalition geplanten<br />
Notstandsgesetze. Ganz im Sinne Haydens<br />
forderte auch der deutsche SDS eine<br />
partizipativ erweiterte »soziale Demokratie«,<br />
so Hans-Jürgen Krahl in seiner Römerbergrede<br />
am 27.5.1968, auf der Grundlage einer<br />
»aufgeklärten Selbsttätigkeit der mündigen<br />
Massen« (| M 9 |).<br />
Auch in anderen westeuropäischen Ländern<br />
begannen zeitgleich Studentenproteste, insbesondere<br />
in Frankreich und Italien, wo der<br />
Studentenbewegung – anders als in der Bundesrepublik<br />
– Aktionsbündnisse mit der organisierten<br />
Industriearbeiterschaft z. B. bei<br />
Renault und Fiat gelangen. In Frankreich<br />
musste Präsident de Gaulle sogar das Land<br />
verlassen, weil im »Mai 1968« die Zeichen auf<br />
Revolution zu stehen schienen. Allerdings<br />
gingen nach seiner Rückkehr die Konservativen<br />
aus den Juni-Wahlen durch einen klaren<br />
Wahlsieg gestärkt hervor, der die revolutionären<br />
Träume der Mai-Bewegung wie Seifenblasen<br />
platzen ließ.<br />
In der Bundesrepublik hingegen folgte auf<br />
das rebellische Jahr 1968 ein Wahlsieg der sozialliberalen<br />
Koalition, die CDU wurde erstmals<br />
seit Bestehen der Bundesrepublik auf die Oppositionsbank<br />
verdrängt. In Reaktion auf die Partizipationsforderungen der 68er<br />
kündigte der neu gewählte Bundeskanzler Willy Brandt in seiner<br />
Regierungserklärung im Oktober 1969 programmatisch an, die<br />
sozialliberale Koalition wolle »mehr Demokratie wagen«: »Die Regierung<br />
kann in der Demo kratie nur erfolgreich wirken, wenn sie<br />
getragen wird vom demokratischen Engagement der Bürger[…]<br />
wir brauchen Menschen, die kritisch mitdenken, mitentscheiden<br />
und mitverantworten.« (| M 11 |)<br />
Es folgte in den Jahren danach ein breit ausgefächertes Reformprogramm<br />
in der Innen-, Außen- und Deutschlandpolitik, das die<br />
Bundesrepublik nicht zuletzt durch eine verstärkte Bürgerbeteiligung<br />
liberalisierte und modernisierte. Bezeichnenderweise erreichte<br />
die Wahlbeteiligung nach Ablauf der ersten sozialliberalen<br />
Legislaturperiode im Jahr 1972 mit 91,1 % den bislang höchsten<br />
Wert in der Geschichte der Bundesrepublik – ein Rekordwert, von<br />
dem wir heute nur noch träumen können. SPD-Wahlkampfparolen<br />
wie »Wir schaffen das moderne Deutschland« und »Modell<br />
Deutschland« brachten den innovativen Zeitgeist einer »partizipativen<br />
Demokratie«, die Tom Hayden 1962 und der SDS 1968 gefordert<br />
hatten, auf den Begriff.<br />
1968 wurde aber nicht nur in West<strong>europa</strong> zum »Wendejahr«, auch<br />
im Ostblock hofften Menschen angesichts des Aufbruchs im Westen<br />
auf die Chance einer Demokratisierung innerhalb der poststalinistischen<br />
Strukturen. Ein »Sozialismus mit menschlichem Antlitz«,<br />
der – wie im Westen – auf einer breiteren Beteiligung der<br />
Menschen beruhen sollte (| M 12 |), wurde im Jahr 1968 in der CSSR<br />
von Alexander Dubcek, dem Ersten Sekretär der KPC, ausgerufen.<br />
Der folgende Reformprozess ist unter dem Namen »Prager Frühling«<br />
in die Geschichte der europäischen Demokratiebewegungen<br />
eingegangen und wurde, wie die Juni-Revolution 1953 in der<br />
DDR und der Budapester Aufstand 1956, von Panzern der Sowjetunion<br />
und anderer Staaten des Warschauer Pakts gewaltsam beendet.<br />
Während mit dem Jahr 1968 in der Bundesrepublik eine<br />
»Fundamentalliberalisierung« (Jürgen Habermas) begonnen<br />
hatte, endete 1968 für die Menschen des Ostblocks mit einer weiteren<br />
bitteren Enttäuschung ihrer Hoffnungen auf Liberalisierung<br />
und Demokratisierung. In der DDR zählten zu den Enttäuschten<br />
so prominente Oppositionelle wie der Physiker Robert Havemann<br />
und der Song-Schreiber Wolf Biermann, über die ein Lehr- bzw.<br />
Auftrittsverbot verhängt wurde. SED-Chef Walter Ulbricht forderte<br />
angesichts der liberalisierten Lebensformen im Westen<br />
eine »saubere Leinwand«, um die DDR als »sauberen Staat« von<br />
der Bundesrepublik abzugrenzen, und in der jugendlichen »Unkultur«<br />
von »Gammlern« und »Langhaarigen« sah er »Erscheinungen<br />
der amerikanischen Unmoral und Dekadenz«. Erweiterte Partizipationsmöglichkeiten<br />
waren in dieser Stimmung von Intoleranz<br />
und Engstirnigkeit auf absehbare Zeit nicht zu erwarten.<br />
Anders in der Bundesrepublik: Die breite Politisierung, die sich<br />
seit 1968 vollzogen hatte, mobilisierte nach den Studenten und<br />
Schülern immer neue Gruppen, die sich innerhalb der politischen<br />
Öffentlichkeit nicht vertreten fühlten und deshalb ihre Teilhaberechte<br />
lautstark einklagten. Schon 1968 artikulierten SDS-Studentinnen<br />
ihren Protest gegen die männliche Hegemonie in den<br />
Führungsgremien der antiautoritären Organisationen und bildeten<br />
zunächst in Berlin einen »Aktionsrat zur Befreiung der Frau«<br />
(| M 15 |), später »Weiberräte« in mehreren Städten. Ihre Isolierung<br />
innerhalb des akademischen Sozialmilieus durchbrach die<br />
»neue Frauenbewegung« allerdings erst mit der 1971 begonnenen<br />
Kampagne gegen den § 218 des Strafgesetzbuchs, der Abtreibung<br />
mit einer Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren bedrohte. Selbstbezichtigungen<br />
(»Ich habe abgetrieben!«) von 374 Frauen, darunter<br />
viele Prominente, in der Illustrierten »Stern« lösten 1971 eine Lawine<br />
von Fraueninitiativen, Unterschriftensammlungen und Demonstrationen<br />
unter der provokativen Parole »Mein Bauch gehört<br />
mir!« aus. Sie führten 1974 zu der von der sozialliberalen<br />
Koalition verabschiedeten »Fristenlösung« für Abtreibungen, die<br />
allerdings ein Jahr später vom Bundesverfassungsgericht für nichtig<br />
erklärt und deshalb 1976 durch eine Indikationslösung mit verpflichtenden<br />
Beratungen vor einem Schwangerschaftsabbruch<br />
ersetzt wurde.<br />
Seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre dominierten weniger spektakuläre,<br />
aber umso wirkungsvollere Frauenförderungs- und<br />
Selbsthilfeprojekte (»Frauen helfen Frauen«, »pro familia« usw.),<br />
die die Einrichtung von Frauenhäusern, die Einführung von Frauenquoten<br />
(z. B. in Parteien) und Gleichstellungsbeauftragten (im<br />
öffentlichen Dienst), die Schaffung von universitären Projekten<br />
und Lehrstühlen zur Frauen- und Geschlechterforschung sowie<br />
eine Teilreform des koedukativen Schulunterrichts zur Folge hatten.<br />
Die »pragmatische Wende« der Frauenpolitik spiegelte einen<br />
allgemeinen Stimmungswandel wider, der schon seit der ersten<br />
Hälfte der 70er Jahre begonnen hatte und sich seit Willy Brandts<br />
37<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa
38<br />
ANDREAS GRIESSINGER<br />
Abb. 5 Frauenbewegung: Demonstration aus Anlass des Internationalen Frauentags am 8. März 1982.<br />
© Klaus Rose, picture alliance<br />
Rücktritt und dem Ende seiner Reformpolitik 1974 verstärkte.<br />
Sein Nachfolger Helmut Schmidt verkörperte auch als Person das<br />
Ende der seit 1968 verbreiteten Aufbruchsstimmung, zumal seine<br />
Amtszeit im Zeichen von Ölkrisen, weltwirtschaftlicher Talfahrt<br />
und einer »neuen Eiszeit« in den internationalen Beziehungen<br />
stand.<br />
Politik des pragmatischen Krisenmanagements<br />
und neues Krisenbewusstsein<br />
An die Stelle kühner Zukunftsentwürfe trat seit Mitte der 70er<br />
Jahre eine Politik des pragmatischen Krisenmanagements, dem<br />
es angesichts der heraufziehenden globalen Gefahren und der<br />
schrumpfenden Verteilungsspielräume schon hinreichend, zunehmend<br />
sogar erstrebenswert erschien, den Status quo zu konsolidieren,<br />
um drohende Katastrophen zu vermeiden. Bücher mit<br />
hohen Verkaufszahlen trugen nun Titel wie »Ende oder Wende?«,<br />
»Ein Planet wird geplündert« oder »Vom Fortschritt in die Unmenschlichkeit«<br />
– unübersehbar spiegelten sie den Übergang wider<br />
von der Reform-Euphorie zu einem umfassenden Krisenbewusstsein,<br />
wenn nicht gar zu kollektiven Ängsten, die sich nach<br />
den apokalyptischen Warnungen des »Club of Rome« vor den<br />
»Grenzen des Wachstums« (1972) vor allem auf die Bedrohung der<br />
natürlichen Lebensgrundlagen durch den industriewirtschaftlichen<br />
Raubbau an der Umwelt und die durch ihn bedingte Verknappung<br />
der natürlichen Ressourcen richteten.<br />
Das sich damit andeutende Ende des »Goldenen Zeitalters« (Eric<br />
Hobsbawm) der Nachkriegszeit entmutigte bürgerschaftliches<br />
Engagement aber keineswegs, im Gegenteil: Mit der Gründung<br />
des »Bundesverbands Bürgerinitiativen Umweltschutz« (BBU)<br />
1972 schufen sich ökologische Bürgerinitiativen, die sich bislang<br />
eher lokaler oder regionaler Umweltprobleme angenommen hatten,<br />
erstmals bundesweit eine Dachorganisation. Hervorgegangen<br />
aus der Idee Willy Brandts, durch eine breitere Partizipation<br />
der Bürger an politischen Entscheidungen »mehr Demokratie zu<br />
wagen«, wuchsen Bürgerinitiativen in den folgenden Jahren kontinuierlich<br />
an und erreichten Ende der 70er Jahre ca. 1,8 Millionen<br />
Mitglieder, was etwa der Mitgliederzahl in politischen Parteien<br />
entsprach.<br />
Ihr durch Demonstrationen und Bauplatzbesetzungen artikulierter<br />
Protest richtete sich zunächst gegen großtechnische Atomenergiekonzepte,<br />
insbesondere gegen die geplanten Kernkraftwerke<br />
in Wyhl 1975, Brokdorf 1976 sowie Gorleben, Grohnde und<br />
Kalkar 1977. Hinzu traten Bürgerinitiativen, die sich anderen Themen<br />
zuwandten: Im Mittelpunkt standen<br />
Probleme des Verkehrs (Lärm und Luftverschmutzung<br />
durch Straßen- und Flughafenausbau,<br />
Fahrpreiserhöhungen bei öffentlichen<br />
Verkehrsmitteln), der Stadtentwicklung<br />
(Hausbesetzungen gegen Sanierung, Bodenund<br />
Wohnraumspekulation), des Lebensraums<br />
von Kindern (Spielplätze, Kinderläden)<br />
und Jugendlichen (selbstverwaltete<br />
Jugendzentren) sowie der Bildung (alternative<br />
Pädagogik, Elternmitbestimmung).<br />
Nach einer Anfangsphase, in der lokale »Ein-<br />
Punkt-Aktionen« dominiert hatten, strebten<br />
in der zweiten Hälfte der 70er Jahre »grüne<br />
Listen« den Einzug in Kommunalvertretungen<br />
und Landtage an: Ihr zunächst nur punktueller<br />
Protest gegen Formen friedlicher und<br />
militärischer Nutzung von Kernenergie erweiterte<br />
sich zusehends zu einem programmatischen<br />
Widerstand gegen industriegesellschaftliche<br />
Wachstumsideologien, gegen<br />
die Bürokratisierung und Bürgerferne der<br />
Parteien und Parlamente sowie – ab 1979 –<br />
gegen den NATO-Nachrüstungsbeschluss,<br />
was angesichts ihrer Unterstützung durch die Friedensbewegung<br />
(| M 16 |) schnell zu ersten Erfolgen bei Kommunal- und Landtagswahlen<br />
seit 1979 führte. Die 1980 als Bundespartei gegründeten<br />
»GRÜNEN« zogen mit ihrer Wahlkampfparole »ökologisch – sozial<br />
– basisdemokratisch – gewaltfrei« dann 1983 in den Bundestag<br />
ein und wurden von da an endgültig zu einem wesentlichen<br />
Faktor innerhalb der bundesrepublikanischen Demokratie<br />
(| M 17 |). Auch in den anderen westeuropäischen Ländern spielten<br />
die neuen sozialen Bewegungen eine wachsende Rolle, wenn<br />
auch der Einzug ökologisch-pazifistischer Protestparteien in die<br />
Parlamente länger dauerte als in der Bundesrepublik.<br />
Neue soziale Bewegungen in Mittel- und<br />
Ost<strong>europa</strong> bis zur Wende 1989<br />
Eine ganz neue Dynamik entstand hingegen in Ost<strong>europa</strong>, wo in<br />
den 70er Jahren die zivilgesellschaftlichen Bürgerbewegungen in<br />
erstaunlichem Tempo erstarkten, allerdings erkannte man im<br />
Westen nur langsam, welch grundlegende Veränderungen sich<br />
damit im Übergang zu den 80er Jahren vollzogen. So bedeuteten<br />
die u. a. von Vaclav Havel verfasste »Charta 77« (| M 18 |) in der<br />
CSSR sowie die Arbeiterunruhen auf polnischen Werften seit dem<br />
Sommer 1980, aus denen die unabhängige Gewerkschaft »Solidarnosc«<br />
hervorging, eine direkte Gefahr für die innere Stabilität<br />
des Ostblocks insgesamt und der DDR im Besonderen. Während<br />
in den folgenden Jahren verschiedene Ostblock-Staaten den Weg<br />
der Reform beschritten, so etwa Ungarn ab 1982 und die Sowjetunion<br />
mit Gorbatschow ab 1985, reagierte die SED mit einer strikten<br />
Abgrenzungspolitik und betrat damit den Weg in die Selbstisolierung,<br />
der sie wenige Jahre später in den Abgrund führen<br />
sollte.<br />
Denn mit der Kombination von wachsenden Wirtschafts- und Versorgungsproblemen<br />
einerseits und Liberalisierungstendenzen im<br />
Umfeld der verbündeten Ostblock-Staaten andererseits nahm der<br />
innenpolitische Druck auf die SED von Jahr zu Jahr weiter zu. Die<br />
Zahl oppositioneller Gruppen, die sich vor allem im Schutz der<br />
Kirchen formierten, wuchs weiter an (| M 19 |). Sie verstanden sich<br />
einerseits als Teil der gesamteuropäischen Friedensbewegung<br />
und protestierten gegen das neue Wettrüsten in Ost und West:<br />
Schon 1981 trugen 100.000 DDR-Jugendliche den von dem Jugendpfarrer<br />
Harald Brettschneider entworfenen Aufnäher »Schwerter<br />
zu Pflugscharen«. Andererseits wuchs – wie im Westen – auch die<br />
Ökologie-Bewegung in der DDR, insbesondere nach der Reaktorkatastrophe<br />
im ukrainischen Tschernobyl 1986 und der auf sie<br />
Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
folgenden Desinformationspolitik der SED.<br />
Die Friedens-, Ökologie- und Menschenrechtsgruppen<br />
agierten allerdings – isoliert<br />
und ständig von Stasi-Schikanen bedroht –<br />
eher an der Peripherie der DDR-Gesellschaft,<br />
zumal sie, abgesehen von einigen westlichen<br />
»GRÜNEN«-Politikern, aus der Bundesrepublik<br />
kaum unterstützt wurden.<br />
Stärker als die Minderheit der oppositionellen<br />
Gruppen trat bereits seit 1975, als die<br />
DDR-Führung die KSZE-Schlussakte unterzeichnet<br />
hatte, die wachsende Zahl von Ausreiseanträgen<br />
ins öffentliche Bewusstsein,<br />
deren Zahl sich trotz Schikanen und Diskriminierungen<br />
von 21.500 im Jahr 1980 auf<br />
125.000 im Jahr 1989 steigerte. Auch das<br />
muss im europäischen Kontext als Teil der<br />
wachsenden Menschenrechtsbewegungen<br />
seit den 70er Jahren gesehen werden. Diese<br />
Massenbewegung führte zu ersten Konzessionen<br />
der SED: 1984 wurde erstmals 30.000<br />
Antragstellern die Übersiedelung genehmigt,<br />
obwohl ihre Anträge als rechtswidrig<br />
eingestuft worden waren. Die Hoffnung des<br />
Regimes auf eine Ventilfunktion trog allerdings:<br />
Das Zurückweichen des Regimes ermutigte im Gegenteil<br />
weitere DDR-Bürger, Ausreiseanträge zu stellen, sodass 1988 erneut<br />
mehr als 25.000 Genehmigungen erteilt werden mussten.<br />
Außerdem bildeten sich unter Berufung auf den KSZE-Prozess zusehends<br />
mehr Selbsthilfegruppen; ab 1983 gab es erste Demonstrationen<br />
Ausreisewilliger sowie Versuche, über Botschaften die<br />
Ausreise zu erwirken. Der Zusammenbruch der DDR wurde<br />
schließlich durch das Zusammenwirken der anschwellenden Ausreisebewegung<br />
einerseits und der in den folgenden Jahren erstarkenden<br />
Oppositionsbewegung andererseits erzwungen. Ihr gemeinsam<br />
erkämpftes Ergebnis war die »friedliche Revolution« des<br />
Jahres 1989, der – abgesehen von Rumänien – weitere gewaltlose<br />
Revolutionen im Ostblock folgen sollten. Pars-pro-toto sei die<br />
»samtene Revolution« in Prag im Dezember 1989 genannt, die von<br />
Vaclav Havel angeführt wurde. Das Jahr 1989 steht somit für den<br />
Erfolg vielfältiger zivilgesellschaftlicher Bürgerbewegungen, die<br />
sich aus sehr unterschiedlichen Quellen speisen und auf eine<br />
lange Tradition in der Geschichte Deutschlands und Europas zurückblicken<br />
können.<br />
Neue Herausforderungen<br />
Im Gegensatz zu dieser Erfolgsgeschichte haben die zivilgesellschaftlichen<br />
Bürgerbewegungen in der »Berliner Republik« seit<br />
1990 und im Europa des 21. Jahrhunderts ihre Bewährungsprobe<br />
noch nicht bestanden. Im Zeichen sich beschleunigender Globalisierungsprozesse<br />
einerseits und sich gegenläufig verengender<br />
Handlungsspielräume auf nationalstaatlicher Ebene andererseits<br />
stehen sie vor besonders großen Herausforderungen. Um nur ein<br />
Beispiel zu nennen: Da die sich unaufhaltsam beschleunigende,<br />
ressourcenintensive Expansion der Weltwirtschaft die Biosphäre<br />
und damit die natürlichen Lebensgrundlagen der kommenden<br />
Generationen offenkundig zusehends weiter gefährdet, könnte<br />
es eine immer wichtigere zivilgesellschaftliche Zukunftsaufgabe<br />
werden, die nicht-intendierten Folgen eines tendenziell unbegrenzten,<br />
von globalen Märkten gesteuerten Wirtschaftswachstums<br />
zu kontrollieren. Ob partizipative Bewegungen in der Lage<br />
sein werden, eine solche am Gemeinwohl orientierte Kontrolle<br />
von global organisierter Marktmacht angesichts oft anonymer,<br />
jedenfalls schwer greifbarer Akteure (»global players«) zu gewährleisten,<br />
kann aus historischer Perspektive nicht beantwortet<br />
werden. Ähnliche Fragen stellen sich bei weiteren globalen Zukunftsthemen,<br />
wie z. B. der Flüchtlings- und Asylproblematik, der<br />
Abb. 6 Nahezu eine Million Bürger versammelten sich am 4.11.1989 auf dem Berliner Alexanderplatz<br />
und demonstrierten friedlich für Veränderungen in der DDR. Die Demonstranten forderten auf einem<br />
Transparent »Die Jugend geht, das Land wird kahl – wir fordern endlich Freie Wahl». Als im Frühjahr 1989<br />
bekannt wurde, dass die SED für die Fälschungen bei der Kommunalwahl verantwortlich war, gingen<br />
immer mehr Menschen auf die Straße. Vom September an bildeten sich immer neue zivilgesellschaftliche<br />
Gruppen, wie z. B. das »Neue Forum«, der »Demokratische Aufbruch«, die »SDP« und andere Oppositionsgruppen.<br />
© Reinhard Kaufhold dpa, picture alliance<br />
Arbeitsmigration und der Menschen- und Bürger rechtsthematik<br />
insgesamt. Auch wenn die Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure in<br />
diesen und anderen Globalisierungsprozessen der Zukunft<br />
schwer einschätzbar ist, so kann eine historisch reflektierte<br />
Rückbesinnung auf die langen Traditionen und wechselnden Konjunkturen<br />
zivilgesellschaftlichen Engagements und Protests in<br />
Deutschland und Europa bei der Suche nach einem demokratischen<br />
Weg ins 21. Jahrhundert doch mit Sicherheit eine wichtige<br />
Orientierung bieten.<br />
Literaturhinweise<br />
Bauerkämper, Arnd (Hrsg.) (2003): Die Praxis der Zivilgesellschaft. Akteure,<br />
Handeln und Strukturen im internationalen Vergleich. Frankfurt/Main, New<br />
York.<br />
Blickle, Peter (2000): Kommunalismus. 2 Bände (Band 1: Ober<strong>deutschland</strong>,<br />
Band 2: Europa). München.<br />
Diner, Dan (Hrsg.) (1988): Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz. Frankfurt/Main.<br />
Finley, Moses (1980): Antike und moderne Demokratie. Stuttgart.<br />
Gilcher-Holtey, Ingrid (2001): Die 68er Bewegung. Deutschland – West<strong>europa</strong><br />
– USA. München.<br />
Gransow, Volker/Jarausch, Konrad H.(Hrsg.) (1991), Die deutsche Vereinigung.<br />
Dokumente zu Bürgerbewegung, Annäherung und Beitritt. Köln.<br />
Henke, Klaus-Dietmar (Hrsg.) (2009): Revolution und Wiedervereinigung<br />
1989/90. München.<br />
Hildermeier, Manfred/Kocka, Jürgen/Conrad, Christoph (Hrsg.) (2000): Europäische<br />
Zivilgesellschaft in Ost und West. Frankfurt/Main, New York.<br />
Meier, Christian (1993): Athen. Ein Neubeginn der Weltgeschichte. Berlin.<br />
Nolte, Paul (2012): Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart. München.<br />
Roth, Roland/Rucht, Dieter (Hrsg.) (2010): Die sozialen Bewegungen in<br />
Deutschland seit 1945. Frankfurt.<br />
39<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa
40<br />
ANDREAS GRIESSINGER<br />
Materialien<br />
M 1<br />
Der Historiker Jürgen Kocka: Das<br />
»Programm der bürgerlichen Gesellschaft«<br />
(2008)<br />
Es wurde in den bürgerlich geprägten Logen<br />
und Lesegesellschaften, den Vereinen und<br />
Zeitschriften des 18. und frühen 19. Jahrhunderts<br />
diskutiert, bald auch auf öffentlichen<br />
Versammlungen und Festen der sich ausbreitenden<br />
liberalen Bewegung. Es war ein zukunftsgerichteter<br />
Entwurf, zu dem sehr verschiedene<br />
Autoren beigetragen hatten – von<br />
John Locke und Adam Smith über Montesquieu<br />
und die Enzyklopädisten bis zu Immanuel<br />
Kant und den liberalen Denkern des<br />
19. Jahrhunderts. Im Zentrum dieses Entwurfs<br />
stand das Ziel einer modernen, säkularisierten<br />
Gesellschaft freier, mündiger Bürger<br />
(»citoyens«), die ihre Verhältnisse friedlich,<br />
vernünftig und selbstständig regelten, ohne allzu viel soziale Ungleichheit,<br />
ohne obrigkeitsstaatliche Gängelung, individuell und<br />
gemeinsam zugleich. Dazu bedurfte es bestimmter Institutionen:<br />
des Marktes, einer kritischen Öffentlichkeit, des Rechtsstaates<br />
mit Verfassung und Parlament. In dieser gesellschaftlich-politischen<br />
Zielsetzung steckte ein neuer Daseinsentwurf, der auf Arbeit,<br />
Leistung und Bildung (nicht auf Geburt), auf Vernunft und<br />
ihrem öffentlichen Gebrauch (statt auf Tradition), auf individueller<br />
Konkurrenz wie auf genossenschaftlicher Gemeinsamkeit<br />
fußte und sich kritisch gegen zentrale Elemente des Alten Regimes<br />
wandte: gegen Absolutismus, gegen Geburtsprivilegien und<br />
gegen ständische Ungleichheit, auch gegen kirchlich-religiöse<br />
Orthodoxie. Dieses Programm hatte, wie gesagt, zwar seine Basis<br />
im sich neu formierenden Bürgertum (und in angrenzenden<br />
Schichten des niederen Adels und des Kleinbürgertums), aber der<br />
Tendenz nach war es ein Programm für alle, ein universales Modell,<br />
das auf Freiheit, Gleichheit und Teilnahme aller Bürger – im<br />
Sinne aller Staatsbürger – hindrängte und zugleich auf die Verallgemeinerung<br />
der bürgerlichen Kultur und Lebensweise über das<br />
Bürgertum hinaus abzielte. Durch Schulbildung, Literatur, Theater,<br />
Erziehung, Disziplin, Umgestaltung des öffentlichen Lebens<br />
sollte es alle prägen: der Bürger auf dem Weg vom bourgeois zum<br />
citoyen. Dies war ein imponierender Entwurf, durchaus utopisch<br />
und besonders zu Beginn des 19. Jahrhunderts weit von der Wirklichkeit<br />
entfernt.<br />
© Jürgen Kocka, Das Programm der bürgerlichen Gesellschaft in: Aus Politik und Zeitgeschichte<br />
9–10/2008, S. 3–9, hier: S. 4f.<br />
M 2<br />
M 3<br />
»Göttinger Erklärung« der 18 Atomwissenschaftler vom<br />
12.4.1957<br />
Eine Gruppe von Demonstranten führt ein Transparent mit der Parole »Kampf dem Atomtod« mit.<br />
Unter diesem Motto stand die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes am 1. Mai 1958<br />
in Frankfurt am Main gegen Wiederaufrüstung und atomare Bewaffnung. © picture alliance, 1958<br />
Die Pläne einer atomaren Bewaffnung der Bundeswehr erfüllen<br />
die unterzeichnenden Atomforscher mit tiefer Sorge. Einige von<br />
ihnen haben den zuständigen Bundesministern ihre Bedenken<br />
schon vor mehreren Monaten mitgeteilt. Heute ist eine Debatte<br />
über diese Frage allgemein geworden. Die Unterzeichnenden fühlen<br />
sich daher verpflichtet, öffentlich auf einige Tatsachen hinzuweisen,<br />
die alle Fachleute wissen, die aber der Öffentlichkeit noch<br />
nicht hinreichend bekannt zu sein scheinen.<br />
1. Taktische Atomwaffen haben die zerstörende Wirkung normaler<br />
Atombomben. Als »taktisch« bezeichnet man sie, um auszudrücken,<br />
dass sie nicht nur gegen menschliche Siedlungen,<br />
sondern auch gegen Truppen im Erdkampf eingesetzt werden<br />
sollen. Jede einzelne taktische Atombombe oder -granate hat<br />
eine ähnliche Wirkung wie die erste Atombombe, die Hiroshima<br />
zerstört hat. Da die taktischen Atomwaffen heute in<br />
großer Zahl vorhanden sind, würde ihre zerstörende Wirkung<br />
im ganzen sehr viel größer sein. Als »klein« bezeichnet man<br />
diese Bomben nur im Vergleich zur Wirkung der inzwischen<br />
entwickelten »strategischen« Bomben, vor allem der Wasserstoffbomben.<br />
2. Für die Entwicklungsmöglichkeit der lebensausrottenden Wirkung<br />
der strategischen Atomwaffen ist keine natürliche<br />
Grenze bekannt. Heute kann eine taktische Atombombe eine<br />
kleinere Stadt zerstören, eine Wasserstoffbombe oder einen<br />
Landstrich von der Größe des Ruhrgebietes zeitweilig unbewohnbar<br />
machen. Durch Verbreitung von Radioaktivität<br />
könnte man mit Wasserstoffbomben die Bevölkerung der<br />
Bundesrepublik wahrscheinlich schon heute ausrotten. Wir<br />
kennen keine technische Möglichkeit, große Bevölkerungsmengen<br />
vor dieser Gefahr sicher zu schützen.<br />
Wir wissen, wie schwer es ist, aus diesen Tatsachen die politischen<br />
Konsequenzen zu ziehen. Uns als Nichtpolitikern wird man die<br />
Berechtigung dazu abstreiten wollen; unsere Tätigkeit, die der<br />
reinen Wissenschaft und ihrer Anwendung gilt und bei der wir<br />
viele junge Menschen unserem Gebiet zuführen, belädt uns aber<br />
mit einer Verantwortung für die möglichen Folgen dieser Tätigkeit.<br />
Deshalb können wir nicht zu allen politischen Fragen schweigen.<br />
Wir bekennen uns zur Freiheit, wie sie heute die westliche<br />
Welt gegen den Kommunismus vertritt. Wir leugnen nicht, dass<br />
die gegenseitige Angst vor den Wasserstoffbomben heute einen<br />
wesentlichen Beitrag zur Erhaltung des Friedens in der ganzen<br />
Welt und der Freiheit in einem Teil der Welt leistet. Wir halten aber<br />
diese Art, den Frieden und die Freiheit zu sichern, auf die Dauer<br />
für unzuverlässig, und wir halten die Gefahr im Falle des Versagens<br />
für tödlich. Wir fühlen keine Kompetenz, konkrete Vorschläge<br />
für die Politik der Großmächte zu machen. Für ein kleines<br />
Land wie die Bundesrepublik glauben wir, dass es sich heute noch<br />
am besten schützt und den Weltfrieden noch am ehesten fördert,<br />
wenn es ausdrücklich und freiwillig auf den Besitz von Atomwaffen<br />
jeder Art verzichtet. Jedenfalls wäre keiner der Unterzeichnenden<br />
bereit, sich an der Herstellung, der Erprobung oder dem<br />
Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen.<br />
Gleichzeitig betonen wir, dass es äußerst wichtig ist, die friedliche<br />
Verwendung der Atomenergie mit allen Mitteln zu fördern,<br />
und wir wollen an dieser Aufgabe wie bisher mitwirken.<br />
Fritz Bopp, Max Born, Rudolf Fleischmann, u. a., www.hdg.de/lemo/html/dokumente/<br />
JahreDesAufbausInOstUndWest_erklaerungGoettingerErklaerung/index.html<br />
Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
M 4<br />
M 5<br />
Telegramm des Streikkomitees Bitterfeld an die DDR-<br />
Regierung vom 16.6.1953<br />
An die sogenannte Deutsche Demokratische Regierung in Berlin-<br />
Pankow:<br />
Wir Werktätigen des Kreises Bitterfeld fordern von Ihnen:<br />
1. Sofortigen Rücktritt der sogenannten Deutschen Demokratischen<br />
Regierung, die sich durch Wahlmanöver an die Macht<br />
gebracht hat.<br />
2. Bildung einer provisorischen Regierung aus den fortschrittlichen<br />
Werktätigen.<br />
3. Zulassung sämtlicher großer demokratischer Parteien West<strong>deutschland</strong>s.<br />
4. Freie und geheime direkte Wahlen spätestens in vier Wochen.<br />
5. Freilassung sämtlicher politischer Gefangener (direkt politischer,<br />
sogenannter »Wirtschaftsverbrecher« und konfessionell<br />
Verfolgter)<br />
6. Sofortige Abschaffung der Zonengrenzen und Zurückziehung<br />
der Volkspolizei.<br />
7. Sofortige Normalisierung des sozialen Lebensstandards.<br />
8. Sofortige Auflösung der sogenannten »National-Armee«.<br />
9. Keine Repressalien gegen auch nur einen Streikenden.<br />
© Der Morgen, Beilage vom 16./17.6.1953; zit. nach T. Diedrich, Der 17. Juni 1953 in der DDR.<br />
Berlin 1991, S. 227f.<br />
M 6<br />
Volksaufstand in Ostberlin am 17. Juni 1953 in Ostberlin. Bauarbeiter riefen<br />
auf ihrem Marsch zum Haus der Ministerien den Generalstreik aus<br />
und forderten den Rücktritt der SED-Regierung. Der Volksaufstand in der<br />
DDR wurde von sowjetischen Panzern und der Nationalen Volksarmee der<br />
DDR niedergeschlagen. © picture alliance, 1953<br />
Lorant Rácz über die Diskussionen im Petöfi-Klub,<br />
Budapest 1956,<br />
M 7<br />
Teilnehmer einer Massendemonstration in Budapest (Ungarn) passieren in<br />
der Innenstadt einen sowjetischen Panzer. Im Hintergrund liegt der Torso<br />
des von der Menge gestürzten Stalindenkmals auf der Straße. Am<br />
23.10.1956 fielen bei einer zunächst friedlichen Kundgebung in Budapest<br />
erste Schüsse. Arbeiter, Studenten und Jugendliche bewaffneten sich in der<br />
Folge und nahmen den Kampf gegen die einrückenden sowjetischen Truppen<br />
auf. Grund für die Unruhen war die wachsende Unzufriedenheit der<br />
Bevölkerung mit dem Dogmatismus der Parteiführung, die in der Hand<br />
von Alt-Stalinisten lag. Mit dem Ausbruch der Revolution schien sich der<br />
Traum von der Unabhängigkeit zu erfüllen, der neu ernannte Regierungschef<br />
Imre Nagy kündigte sogar den Austritt Ungarns aus dem Warschauer<br />
Pakt an. Am 4. November 1956 griffen jedoch rund 1.000 sowjetische<br />
Panzer und Bomber die Stadt von allen Seiten an – der Aufstand wurde<br />
blutig niedergeschlagen.<br />
© picture alliance<br />
Die vom Parteiführer Rákosi gegen die aufmüpfigen Schriftsteller<br />
geführten öffentlichen Angriffe, verbunden mit Drohungen und<br />
Repressalien, wurden von allen als Rückschlag in der politischen<br />
Entwicklung des Landes empfunden. In dieser gespannten Situation<br />
wirkte die aus Moskau eingelangte Nachricht über den im<br />
Februar 1956 abgehaltenen XX. Kongress der Kommunistischen<br />
Partei der Sowjetunion wie ein Paukenschlag. Die gefassten Kongress-Beschlüsse,<br />
so schien es, bestätigten das Juniprogramm<br />
1953 von Imre Nagy und das im Herbst 1955 veröffentlichte Memorandum<br />
der ungarischen Schriftsteller, Wissenschaftler und<br />
Künstler. Aufhorchen ließ der Beschluss des Kongresses, demzufolge<br />
aus dem Kapitalismus nicht nur ein Weg, der sowjetische,<br />
zum Sozialismus führen kann. Da kam auch schon die noch größeres<br />
Aufsehen verursachende Meldung über die am 25. Februar<br />
von Nikita Chruschtschow in einer geheimen Sitzung des Kongresses<br />
gehaltene sog. »Geheimrede«. In dieser Rede gab er unumwunden<br />
Stalin und dem mit seiner Person verbundenen Personenkult<br />
die Schuld für die blutigen Verbrechen der 30er und 40er<br />
Jahre. Trotz Geheimhaltung sickerte diese Rede durch und das<br />
ganze Land sprach nur noch vom XX. Kongress und der Rede<br />
Chruschtschows. Der seit dem Memorandum in der Presse geführte<br />
lockere Ton wurde immer schärfer und die von Imre Nagy<br />
angeführte Opposition fühlte sich bestätigt und bekam immer<br />
mehr Zulauf aus der Bevölkerung. In diesem Stadium rückten die<br />
Probleme aus Politik und Wirtschaft immer stärker in den Mittelpunkt<br />
der Diskussionen. Die Parteijugend erfasste am schnellsten<br />
die Situation und rief Anfang März 1956, unter der Schirmherrschaft<br />
ihrer eigenen Jugendorganisation (DISZ), eine anfangs lose<br />
Runde ins Leben, die sich einerseits aus aktiven Parteimitgliedern<br />
aus Politik, Wissenschaft und Kunst, anderseits aus der seit 1948<br />
verstoßenen Elite und aus Interessenten der Universitäten bildete.<br />
Zweck dieser ins Leben gerufenen Runde war, einem größeren<br />
Publikum die Gelegenheit zu bieten, außerhalb der Parteigremien<br />
die Thesen des XX. Kongresses auf breiterer Basis zu<br />
diskutieren. Der Kreis entwickelte sich unter dem Namen »Petöfi<br />
Kör«, das heißt »Petöfi Kreis«, zu einer Institution der vorrevolutionären<br />
Jugend, so wie seinerzeit anno 1848. Auch seitens der Bevölkerung<br />
fand der Kreis große Zustimmung und wurde von der<br />
Presse kommentiert und begeistert begrüßt. Er wurde zur Plattform<br />
für die sich um Imre Nagy versammelte Opposition aus Wissenschaftlern,<br />
Künstlern und den vom ZK der Partei geächteten<br />
Schriftstellern.<br />
© Lorant Rácz, Ein Requiem auf den Sozialismus. Ungarn 1953 bis 1956, Norderstedt 2003,<br />
S. 32–39, www.ungarn1956.de/site/40208613/default.aspx<br />
41<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa
ANDREAS GRIESSINGER<br />
42<br />
M 8<br />
M 9<br />
In München demonstrierten 1962 Studenten gegen die Polizei-Maßnahmen<br />
in der Hamburger »SPIEGEL«-Redaktion. Etwa 300 Teilnehmer marschierten<br />
mit Spruchtafeln von der Universität zum Königsplatz, wo ein<br />
Sprecher die Forderung der Studenten nach Pressefreiheit unterstrich. Im<br />
Zuge der »SPIEGEL«-Affäre mussten sich Mitarbeiter des Nachrichtenmagazins<br />
»Spiegel« wegen eines kritischen Artikels gegen eine Anklage wegen<br />
Landesverrats zur Wehr setzen, zeitweise waren der Herausgeber Rudolf<br />
Augstein und mehrere Redakteure inhaftiert. Am Ende musste der damalige<br />
Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß, CSU, der die Verhaftungen<br />
veranlasst hatte, zurücktreten. © Klaus-Dieter Heirler, picture alliance<br />
»Römerbergrede« des SDS-Bundesvorstandsmitglieds<br />
Hans-Jürgen Krahl am 27.5.1968 in Frankfurt am Main<br />
vor 12.000 Menschen angesichts der bevorstehenden<br />
Bundestagsdebatte zu den Notstandsgesetzen<br />
Wir haben nur eine einzige Antwort auf die Notstandsgesetze zu<br />
geben: wenn Staat und Bundestag die Demokratie vernichten,<br />
dann hat das Volk das Recht und die Pflicht, auf die Straße zu gehen<br />
und für die Demokratie zu kämpfen. Wenn die Volksvertreter<br />
die Interessen des Volkes nicht mehr vertreten, dann wird das<br />
Volk seine Interessen selbst vertreten. […]<br />
Eine soziale Demokratie lebt nur durch die aufgeklärte Selbsttätigkeit<br />
der mündigen Massen. Daraus haben die Studentenbewegung<br />
und die außerparlamentarische Opposition die politische<br />
Konsequenz gezogen: auf die Bürokratien der Parteien und der<br />
Gewerkschaften können wir uns nicht verlassen, wenn wir nicht<br />
selbst anfangen zu handeln. Erst die oft herausfordernden Demonstrationen<br />
der Studenten haben viele Themen, welche die<br />
Herrschenden lieber verschwiegen hätten, zur öffentlichen Diskussion<br />
gestellt; so den Krieg in Vietnam […]. Unsere Aufklärungs-<br />
und Machtmittel sind geradezu lächerlich gering, gemessen<br />
an den gewaltigen Funk- und Fernseheinrichtungen sowie<br />
den mächtigen Staats- und Parteiverwaltungen. Aber mit den<br />
Mitteln des Flugblatts, der ständigen Diskussion und unseren Demonstrationen<br />
haben wir erreicht, dass immer mehr Menschen<br />
lernten, wie notwendig es ist, für seine Interessen selbst und aktiv<br />
einzutreten. Entgegen der Manipulation von Presse und Regierung,<br />
die uns von der Bevölkerung mit aller Gewalt isolieren wollen,<br />
hat die außerparlamentarische Opposition ihre Basis ständig<br />
erweitert: zunächst waren es die Studenten, dann die Schüler,<br />
jetzt sind es junge Arbeiter und auch immer mehr ältere Kollegen.<br />
Unsere Demokratie ist direkt und unmittelbar. Es gibt keine Sprecher<br />
und keine Gruppen, die sich nicht den Entscheidungen der<br />
Anwesenden unterwerfen müssten; es gibt keine Funktionäre, die<br />
einen Posten auf Lebenszeit einnehmen; alle unmittelbar Beteiligten<br />
entscheiden in direkter Abstimmung über die politischen<br />
Aktionen und Ziele. […]<br />
Mit der Verabschiedung der Notstandsgesetze steht die Uhr auf<br />
fünf Minuten vor 12. […] Die Losung für die nächsten Tage kann<br />
M 10<br />
nur sein: Politischer Streik! Nur eine Welle von Streiks ermöglicht<br />
schließlich den Generalstreik. Politischer Streik am Dienstag, politischer<br />
Streik am Mittwoch, politischer Streik in den Betrieben,<br />
an der Universität und in den Schulen. Es lebe die praktische Solidarität<br />
der Arbeiter, Studenten und Schüler!<br />
© D. Claussen/R. Dermitzel (Hg.), Universität und Widerstand. Frankfurt/Main (Europäische<br />
Verlagsanstalt) 1968, S. 34–41<br />
M 11<br />
Eine der Initialzündungen der 68er-Bewegung in der Bundesrepublik<br />
Deutschland war der »Internationale Vietnamkongress« des SDS 1968 in<br />
Berlin, bei dem u.a. Herbert Marcuse, Peter Weiss und Erich Fried als<br />
Referenten auftraten. Am Rednerpult der SDS-Vorsitzende Rudi<br />
Dutschke. © Klaus Rose, picture alliance, 17.2.1968<br />
Regierungserklärung des Bundeskanzlers Willy Brandt,<br />
SPD, 28.10.1969<br />
I. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise<br />
öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach Information<br />
Genüge tun. Wir werden darauf hinwirken, dass durch Anhörungen<br />
im Bundestag, durch ständige Fühlungnahme mit den<br />
repräsentativen Gruppen unseres Volkes und durch eine umfassende<br />
Unterrichtung über die Regierungspolitik jeder Bürger die<br />
Möglichkeit erhält, an der Reform vom Staat und Gesellschaft<br />
mitzuwirken.<br />
Wir wenden uns an die im Frieden nachgewachsenen Generationen,<br />
die nicht mit den Hypotheken der Älteren belastet sind und<br />
belastet werden dürfen; jene jungen Menschen, die uns beim<br />
Wort nehmen wollen – und sollen. Diese jungen Menschen müssen<br />
aber verstehen, dass auch sie gegenüber Staat und Gesellschaft<br />
Verpflichtungen haben. Wir werden dem Hohen Hause ein<br />
Gesetz unterbreiten, wodurch das aktive Wahlalter von 21 auf 18,<br />
das passive von 25 auf 21 herabgesetzt wird. Wir werden auch die<br />
Volljährigkeitsgrenze überprüfen.<br />
Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen<br />
unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden<br />
Jahre sein. Wir können nicht die perfekte Demokratie<br />
schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet<br />
und mehr Mitverantwortung fordert. Diese Regierung sucht das<br />
Gespräch, sie sucht kritische Partnerschaft mit allen, die Verantwortung<br />
tragen, sei es in den Kirchen, der Kunst, der Wissenschaft<br />
und der Wirtschaft oder in anderen Bereichen der Gesellschaft.<br />
Dies gilt nicht zuletzt für die Gewerkschaften, um deren<br />
vertrauensvolle Zusammenarbeit wir uns bemühen. Wir brauchen<br />
ihnen ihre überragende Bedeutung für diesen Staat, für seinen<br />
weiteren Ausbau zum sozialen Rechtsstaat nicht zu bescheinigen.<br />
Wenn wir leisten wollen, was geleistet werden muss, brauchen wir<br />
Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
alle aktiven Kräfte unserer Gesellschaft.<br />
[…] Wir werden uns ständig<br />
darum bemühen, dass sich die begründeten<br />
Wünsche der gesellschaftlichen<br />
Kräfte und der politische Wille<br />
der Regierung vereinen lassen. […]<br />
XV. Die Regierung kann in der Demokratie<br />
nur erfolgreich wirken, wenn<br />
sie getragen wird vom demokratischen<br />
Engagement der Bürger. Wir<br />
haben so wenig Bedarf an blinder Zustimmung,<br />
wie unser Volk Bedarf hat<br />
an gespreizter Würde und hoheitsvoller<br />
Distanz. Wir suchen keine Bewunderer;<br />
wir brauchen Menschen,<br />
die kritisch mitdenken, mitentscheiden<br />
und mitverantworten.<br />
Das Selbstbewusstsein dieser Regierung<br />
wird sich als Toleranz zu erkennen<br />
geben. Sie wird daher auch jene<br />
Solidarität zu schätzen wissen, die<br />
sich in Kritik äußert. Wir sind keine<br />
Erwählten; wir sind Gewählte. Deshalb<br />
suchen wir das Gespräch mit allen,<br />
die sich um diese Demokratie<br />
mühen. In den letzten Jahren haben manche in diesem Lande befürchtet,<br />
die zweite deutsche Demokratie werden den Weg der<br />
ersten gehen. Ich habe dies nie geglaubt. Ich glaube dies heute<br />
weniger denn je. Nein: Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie,<br />
wir fangen erst richtig an.«<br />
© Rainer A. Müller (Hg.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, Band 11. Stuttgart<br />
(Reclam) 1996, S. 35–37, 41, 43f., 45f., 50f.<br />
M 12<br />
M 13<br />
»Aktionsprogramm der Kommunistischen Partei der<br />
Tschechoslowakei« (KPC), angenommen auf der<br />
Plenar tagung der ZK der KPC am 5.4.1968:<br />
Ihre Fähigkeit, die Gesellschaft zu leiten, hat die [Kommunistische]<br />
Partei besonders in der gegenwärtigen Zeit bewiesen, als<br />
sie aus eigener Initiative den Demokratisierungsprozess ausgelöst<br />
und seinen sozialistischen Charakter gesichert hat. […] Sie<br />
verwirklicht ihre führende Rolle nicht dadurch, dass sie die Gesellschaft<br />
beherrscht, sondern dadurch, dass sie der freien, fortschrittlichen<br />
und sozialistischen Entwicklung am treuesten dient.<br />
Sie kann sich ihre Autorität nicht erzwingen, sondern muss sie<br />
immer aufs Neue durch ihre Taten gewinnen. Ihre Linie kann sich<br />
nicht durch Verordnungen durchsetzen, sondern nur durch die<br />
Arbeit ihrer Mitglieder und die Wahrhaftigkeit ihrer Ideale.<br />
Die führende Rolle der Partei wurde in der Vergangenheit oft als<br />
Monopol, als Konzentration der Macht in der Hand der Parteiorgane<br />
aufgefasst. Das entsprach der falschen These, dass die Partei<br />
das Instrument der Diktatur des Proletariats sei. Diese schädliche<br />
Auffassung schwächte die Initiative und Verantwortung der<br />
staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen<br />
[…]. Die Partei will und wird die gesellschaftlichen Organisationen<br />
nicht ersetzen, sie muss im Gegenteil dafür sorgen, dass sich<br />
deren Initiative und politische Verantwortung für die Einheit unserer<br />
Gesellschaft erneuert und weiter entfaltet. Aufgabe der Partei<br />
ist es, einen solchen Weg der Befriedigung verschiedener Interessen<br />
zu suchen, der die gesamtstaatlichen Interessen nicht<br />
gefährdet, sondern ihnen im Gegenteil nützt und neue progressive<br />
Interessen schafft. Die Politik der Partei darf nicht dazu führen,<br />
dass die nicht-kommunistischen Bürger das Gefühl haben, in<br />
ihren Rechten und Freiheiten durch die Partei eingeschränkt zu<br />
werden, sondern dass sie vielmehr in der Tätigkeit der Partei die<br />
Garantie ihrer Rechte, Freiheiten und Interessen sehen. […]<br />
Demonstranten mit tschechoslowakischen Flaggen versuchen am 21. August 1968, russische Panzer und<br />
Fahrzeugkolonnen an der Weiterfahrt durch Prag zu hindern. Reformpolitiker innerhalb der Kommunistischen<br />
Partei unter der Führung Alexander Dubceks hatten seit dem Frühjahr 1968 versucht, in der Tschechoslowakei<br />
einen »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« zu schaffen. Die Truppen des Warschauer Pakts<br />
marschierten unter Führung der UdSSR in der Tschechoslowakei ein und beendeten den »Prager Frühling«<br />
schließlich mit Waffengewalt. © picture alliance, 21.8.1968<br />
Grundlage der Aktionsfähigkeit der Partei unter den neuen Bedingungen<br />
ist die ideelle und organisatorische Einheit, die auf der<br />
Basis breiter innerparteilicher Demokratie entsteht. Die wirksamste<br />
Waffe gegen das Eindringen von Methoden des bürokratischen<br />
Zentralismus in die Partei ist die Stärkung des Einflusses<br />
der Parteimitglieder auf die politische Linie, die Stärkung der<br />
Rolle aller wirklich demokratischen Organe. Die gewählten Organe<br />
der Partei sind vor allem dafür verantwortlich, dass alle<br />
Rechte der Mitglieder gewährleistet, dass Entscheidungen kollektiv<br />
getroffen werden und die Macht nicht in einer Hand konzentriert<br />
wird. […] Die Partei ist sich dessen bewusst, dass es in<br />
unserer Gesellschaft keine tiefgreifendere Entwicklung der Demokratie<br />
geben kann, wenn nicht demokratische Grundsätze<br />
konsequent im inneren Leben und der Arbeit der Partei selbst unter<br />
Kommunisten zur Anwendung kommen. Die Entscheidungen<br />
über alle wichtigen Fragen und die Kaderbesetzung von Funktionen<br />
muss nach demokratischen Regeln der Behandlung und<br />
durch geheime Abstimmung erfolgen. […] Dennoch aber haben<br />
sich bis zur heutigen Zeit in unserem ganzen politischen System<br />
die schädlichen Einflüsse der zentralistischen Entscheidung und<br />
Leitung erhalten. In den Beziehungen zwischen Partei, Staat und<br />
gesellschaftlichen Organisationen, in den inneren Beziehungen<br />
und Methoden dieser Komponenten, in den Beziehungen staatlicher<br />
und anderer Institutionen zu den Bürgern, in der Auffassung<br />
der Bedeutung der öffentlichen Meinung und der Informiertheit<br />
aller, in der Praxis der Kaderpolitik – überall dort kommen viele<br />
Dinge zum Ausdruck, die den Menschen das Leben vergällen […].<br />
Die Politik der Partei geht von der Forderung aus, dass es im ganzen<br />
Staatsmechanismus zu keiner allzu großen Konzentration der<br />
Macht innerhalb eines Gliedes, eines Apparates oder bei einer<br />
Einzelperson kommen darf. Man muss eine derartige Aufteilung<br />
der Machtbefugnisse und ein System gegenseitiger Kontrolle zwischen<br />
den einzelnen Gliedern festsetzen, dass die Fehler und<br />
Übergriffe des einen Gliedes beizeiten durch die Tätigkeit eines<br />
anderen korrigiert werden können. Dem müssen nicht nur die Beziehungen<br />
zwischen den gewählten und ausführenden Organen<br />
entsprechen, sondern auch die Beziehungen innerhalb des Mechanismus<br />
der staatlichen Exekutivmacht und Verwaltung und<br />
ebenso die Stellung und Funktion der Gerichte.<br />
© Zdenek Mlynar, Nachtfrost. Erfahrungen auf dem Weg vom realen zum menschlichen Sozialismus.<br />
Köln (EVA) 1978, S. 325–327, 329, 340<br />
43<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa
ANDREAS GRIESSINGER<br />
M 14<br />
Menschenkette der »Friedensbewegung« am 22.10.1983 in Neu-Ulm. Über 200.000 Menschen<br />
demonstrierten an diesem Tag mit ihrer Menschenkette von Neu-Ulm bis Stuttgart gegen die Stationierung<br />
von atomaren US-Mittelstreckenraketen in Europa als Antwort der NATO auf die vorhergegangene<br />
Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen des Typs SS 20 durch die Sowjetunion.<br />
Europa und besonders das geteilte Deutschland, so die Kritiker, drohten zum Schauplatz<br />
eines atomaren Schlagabtauschs der Supermächte zu werden.<br />
© Karin Hill, picture alliance<br />
Die Emanzipation der Frau ist ein Gradmesser der gesamtgesellschaftlichen<br />
Emanzipation. Es gibt keine Befreiung der Menschheit<br />
ohne die soziale, emotionale sowie ökonomische Unabhängigkeit<br />
und Gleichstellung von Mann und Frau. […]<br />
Kleine Mädchen werden rosa gekleidet, kleine Jungen hellblau.<br />
Kleine Mädchen werden zu haushaltsorientiertem Spiel angehalten,<br />
kleine Jungen wegen der Puppe ausgelacht. Die Jungen sollen<br />
das Haus verlassen, sollen selbstständig werden und Erfahrungen<br />
machen. Sich ruhig austoben, auch sexuell. Mädchen lernen bald,<br />
die Männer zu erwarten, wenn Vater und Brüder abends heimkommen<br />
und wenn das Essen vorbereitet sein muss. Sie identifizieren<br />
sich bald mit der Mutter, die über Lob des Vaters glücklich,<br />
über seine Unzufriedenheit schuldbewusst ist. […]<br />
In ihrer Vorbereitung auf die nie zu erreichende Illusion wird die<br />
Frau vorwiegend partnerorientiert. Die kapitalistische Gesellschaft<br />
unterstützt sie dabei mit Werbung und Entertainment. Von<br />
einer aufkommenden Bewusstheit ihrer Situation wird die Frau<br />
systematisch abgelenkt. Kleidung, Gehabe, Emotionen der Frau<br />
sind schließlich Ausdruck ihrer hochgradigen Partner-Erwartung.<br />
Für den Mann zeigt sich diese erregte Frau als erregendes Lustobjekt.<br />
In Filmen und Illustrierten wird ihm diese angeboten. Da er<br />
in seiner Erziehung und Beeinflussung zur überwiegenden Sachorientierung<br />
gebracht wurde, entspricht das Auswählen, Begutachten,<br />
Verbrauchen und Ablegen vom Konsumgut Frau durchaus<br />
seiner Art. Unsere Gesellschaft erzieht zwei Geschlechter, die<br />
durch unterschiedliche Lernprozesse voneinander im Sinne einer<br />
Arbeitsteilung materiell abhängig sind: Das Mädchen lernt vieles,<br />
was mit Haushalt zu tun hat. Der Junge wird davon ferngehalten.<br />
Er wird sich später in Haushaltsdingen so dumm anstellen, dass er<br />
eine Frau braucht. Das Mädchen wird umgekehrt in allem dumm<br />
gehalten, was nicht mit Haushalt zu tun hat. Deswegen braucht<br />
sie später einen Mann, der für sie sorgt.<br />
Emotional jedoch sind beide einander entgegengesetzt geworden:<br />
der Mann der kapitalistischen Gesellschaft ist ein emotionsloses<br />
Arbeitstier, die Frau ein gefühlshaftes Objekt. Ihre gegenseitigen<br />
Rollenerwartungen sind kaum vereinbar: […] Die starke<br />
Fixierung der Frau an den Mann bestätigt und befriedigt einerseits<br />
den Machtanspruch des Mannes, andererseits<br />
wird er durch ihre unerschöpflichen<br />
Zärtlichkeits- und Sinnlichkeitsansprüche<br />
stark belastet. […] Er ist außenorientiert, arbeitet<br />
an sachlichen Problemen, kann sich<br />
weiterentwickeln und lernen, während die<br />
Frau noch in eine Empfindungsdifferenzierung<br />
bis zur Schmerzhaftigkeit verstrickt ist.<br />
[…]<br />
Lassen wir uns zudem nicht vormachen,<br />
Emanzipation bedeute: dem Mann entsprechend<br />
zu werden. Würden wir der vermeintlichen<br />
Emanzipation des Mannes in einer autoritären<br />
Gesellschaft nacheifern, so wäre das<br />
Resultat gesteigerter Konkurrenzkampf, Aggressivität,<br />
Brutalität, Selbstunterdrückung.<br />
Denken wir daran, dass sich der Mann ebenso<br />
wie die Frau aus seiner Rollenfixierung emanzipieren<br />
muss.<br />
© Lutz Schulenburg (Hg.), Das Leben ändern, die Welt verändern.<br />
1968 – Dokumente und Berichte. Hamburg (Edition Nautilus)<br />
1998, S. 303 – 307<br />
M 16<br />
Krefelder Appell: »Der Atomtod<br />
bedroht uns alle – Keine Atomraketen<br />
in Europa« (16.11.1980)<br />
44<br />
M 15<br />
Aktionsrat zur Befreiung der Frau (1968): Emotionale<br />
Probleme der Frau – Politische Probleme<br />
Immer offensichtlicher erweist sich der Nachrüstungsbeschluss<br />
der NATO vom 12. Dezember 1979 als verhängnisvolle Fehlentscheidung.<br />
Die Erwartung, wonach Vereinbarungen zwischen den<br />
USA und der Sowjetunion zur Begrenzung der eurostrategischen<br />
Waffensysteme noch vor der Stationierung einer neuen Generation<br />
amerikanischer nuklearer Mittelstreckenwaffen in West<strong>europa</strong><br />
erreicht werden könnten, scheint sich nicht zu erfüllen. Ein<br />
Jahr nach Brüssel ist noch nicht einmal der Beginn solcher Verhandlungen<br />
in Sicht. […]<br />
Die Teilnehmer am Krefelder Gespräch vom 15. und 16. November<br />
1980 appellieren daher gemeinsam an die Bundesregierung,<br />
– die Zustimmung zur Stationierung von Pershing II-Raketen<br />
und Marschflugkörpern in Mittel<strong>europa</strong> zurückzuziehen;<br />
– im Bündnis künftig eine Haltung einzunehmen, die unser Land<br />
nicht länger dem Verdacht aussetzt, Wegbereiter eines neuen,<br />
vor allem die Europäer gefährdenden nuklearen Wettrüstens<br />
sein zu wollen.<br />
© Blätter für deutsche und internationale Politik 12/1980, S. 1513; zit. nach Georg Fülberth,<br />
Geschichte der Bundesrepublik in Quellen und Dokumenten. Köln (Pahl-Rugenstein) 1983,<br />
S. 388f.<br />
M 17<br />
Der Soziologe Jörg Bopp 1983 über die »Grünen«<br />
Ohne Zweifel hat die Bundesrepublik seit dem Ende der 60er Jahre<br />
trotz aller Rückschläge einen kräftigen Demokratisierungsschub<br />
erlebt, der vor allem von Jugendlichen in Gang gesetzt wurde. […]<br />
Im Moment erleben wir einen neuen Versuch vorwiegend engagierter<br />
Jugendlicher, die bundesrepublikanische Gesellschaft zu<br />
demokratisieren. Waren 1968 vor allem die Sozialdemokraten mit<br />
Willy Brandt der politische »Hoffnungsträger«, so sind es heute<br />
die Grünen […].<br />
Um nun der Abschottung von neuen gesellschaftlichen Entwicklungen<br />
vorzubeugen, haben sich die Grünen auf einige Grundsätze<br />
des alltäglichen politischen Handelns festgelegt. Die damit<br />
anvisierten Handlungsstile sind zugleich politisches Programm:<br />
Rotation der Abgeordneten, imperatives Mandat, knappe Diäten,<br />
paritätische Aufteilung der Ämter zwischen den Geschlechtern,<br />
größtmögliche Veröffentlichung der parlamentarischen Arbeit,<br />
Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
Unterstützung außerparlamentarischer Oppositions-<br />
und Protestbewegungen, Relativierung<br />
des Legalitätsprinzips, legere Umgangsformen,<br />
Respektlosigkeit gegenüber<br />
den Ritualen des politischen Betriebs. Gegen<br />
die Versteinerung der politischen Parteien<br />
soll Basisdemokratie gestellt werden.<br />
© Christian Graf von Krockow (Hg.), Brauchen wir ein neues<br />
Parteiensystem? Frankfurt/Main (Fischer) 1983, S. 57f.<br />
M 18<br />
Die »Charta 77«, verfasst von Vaclav<br />
Havel u. a. (1977)<br />
Charta 77 ist eine freie informelle und offene<br />
Gemeinschaft von Menschen verschiedener<br />
Überzeugungen, verschiedener Religionen<br />
und verschiedener Berufe, verbunden durch<br />
den Willen, sich einzeln und gemeinsam für<br />
die Respektierung von Bürger- und Menschenrechten<br />
in unserem Land und in der<br />
Welt einzusetzen – jener Rechte, die den<br />
Menschen von beiden kodifizierten internationalen<br />
Pakten, von der Abschlussakte der<br />
Konferenz in Helsinki, von zahlreichen weiteren<br />
internationalen Dokumenten gegen<br />
Krieg, Gewaltanwendung und soziale und<br />
geistige Unterdrückung zugestanden werden<br />
und die zusammenfassend von der »Allgemeinen Erklärung der<br />
Menschenrechte« der UN zum Ausdruck gebracht werden.<br />
Charta 77 fußt auf dem Boden der Solidarität und Freundschaft<br />
von Menschen, die von der gemeinsamen Sorge um das Geschick<br />
der Ideale bewegt werden, mit denen sie ihr Leben und ihre Arbeit<br />
verbunden haben und verbinden. (…)<br />
Charta 77 ist keine Basis für oppositionelle politische Tätigkeit.<br />
Sie will dem Gemeininteresse dienen wie viele Bürgerinitiativen in<br />
verschiedenen Ländern des Westens und des Ostens. Sie will also<br />
nicht eigene Programme politischer oder gesellschaftlicher Reformen<br />
oder Veränderungen aufstellen, sondern in ihrem Wirkungsbereich<br />
einen konstruktiven Dialog mit der politischen und<br />
staatlichen Macht führen, insbesondere dadurch, dass sie auf verschiedene<br />
konkrete Fälle von Verletzung der Menschen- und Bürgerrechte<br />
hinweist, deren Dokumentation verbreitet, Lösungen<br />
vorschlägt, die auf Vertiefung dieser Rechte und ihrer Garantien<br />
abzielen, und als Vermittler in anfallenden Konfliktsituationen<br />
wirken, die durch Widerrechtlichkeit verursacht werden können.<br />
Durch ihren symbolischen Namen betont Charta 77, dass sie an<br />
der Schwelle eines Jahres entsteht, das zum Jahr der Rechte politisch<br />
Gefangener erklärt wurde und in dessen Verlauf die Belgrader<br />
Konferenz die Erfüllung der Verpflichtungen von Helsinki prüfen<br />
soll. (…) Wir glauben daran, dass Charta 77 dazu beitragen<br />
wird, dass in der Tschechoslowakei alle Bürger als freie Menschen<br />
arbeiten und leben können.<br />
© FAZ vom 7.1.1977, offizielle deutsche Veröffentlichung des Gründungstextes<br />
M 19<br />
M 20<br />
Bericht des Ministeriums für Staatssicherheit vom<br />
1.6.1989 über oppositionelle Gruppen in der DDR in den<br />
80er Jahren<br />
Seit Beginn der 80er Jahre anhaltende Sammlungs- und Formierungsbestrebungen<br />
[…] führten zur Bildung entsprechender<br />
Gruppierungen und Gruppen. Diese sind fast ausschließlich in<br />
Strukturen der evangelischen Kirchen in der DDR eingebunden<br />
bzw. können für ihre Aktivitäten die materiellen und technischen<br />
Möglichkeiten dieser Kirchen umfassend nutzen. […] Gegenwärtig<br />
bestehen in der DDR ca. 160 derartige Zusammenschlüsse. […]<br />
Etwa zehntausend Demonstranten nahmen bereits am 4. November 1989 in Potsdam an einer bis<br />
dahin einmaligen, weil nicht vom Staat und seinen Massenorganisationen angeordneten Großdemonstration<br />
in der Innenstadt Potsdams teil und zeigten Transparente mit weitreichenden demokratischen<br />
Forderungen. Nach den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR-Gründung und dem<br />
Besuch des sowjetischen Parteichefs Michael Gorbatschow entluden sich die Proteste schließlich<br />
am 9. November 1989, an dem Tag, als die Maueröffnung das Ende der DDR einleitete.<br />
© Bernd Blumrich, picture alliance<br />
Sie gliedern sich in knapp 150 sog. Kirchliche Basisgruppen, die<br />
sich selbst […] bezeichnen als »Friedenskreise« (35), »Ökologiegruppen«<br />
(39), gemischte »Friedens- und Umweltgruppen«<br />
(23), »Frauengruppen« (7), »Ärztekreise« (3); »Menschenrechtsgruppen«<br />
(10) bzw. »2/3-Welt-Gruppen« (39) und sogen. Regionalgruppen<br />
von Wehrdienstverweigerern. […]<br />
Ableitend aus sog. Gründungserklärungen und Strategiepapieren<br />
[…] bilden besonders folgende antisozialistische Inhalte/Stoßrichtungen<br />
die Schwerpunkte im Wirksamwerden feindlicher, oppositioneller<br />
Kräfte:<br />
1. Gegen die Grundlagen und Gesetzmäßigkeiten des Sozialismus<br />
gerichtete Angriffe finden ihren konzentrierten Ausdruck<br />
in Forderungen nach Änderung der sozialistischen Staats- und<br />
Gesellschaftsordnung und nach »Erneuerung des Sozialismus«.<br />
Dabei berufen sich diese Kräfte immer stärker auf die<br />
Umgestaltungsprozesse und die damit verbundenen Entwicklungen<br />
in der UdSSR und anderen sozialistischen Ländern. Demagogisch<br />
werden Begriffe wie Glasnost, Demokratisierung,<br />
Dialog, Bürgerrechte, Freiheit für »Andersdenkende« oder<br />
Meinungspluralismus missbraucht […].<br />
2. Gegen die Sicherheits- und Verteidigungspolitik gerichtete<br />
Angriffe konzentrierten sich unter dem Deckmantel der »Entmilitarisierung«<br />
der Gesellschaft auf Forderungen nach Beseitigung<br />
der vormilitärischen Erziehung und Ausbildung der Jugend<br />
(u. a. Unterrichtsfach Wehrerziehung), Abschaffung der<br />
Wehrpflicht, Einrichtung des sozialen bzw. zivilen »Friedensdienstes«<br />
als gleichwertiger Ersatz für den Wehrdienst und auf<br />
Gewährung des Rechtes auf Wehrdiensttotalverweigerung<br />
aus Gewissensgründen.<br />
3. Gegen die kommunistische Erziehung der Jugend gerichtete<br />
Angriffe beinhalten u. a. Forderungen nach Aufgabe des »Totalitätsanspruches«<br />
der marxistisch-leninistischen Weltanschauung<br />
(…).<br />
4. Probleme des Umweltschutzes bilden ein breites Feld zur Diskreditierung<br />
der Politik der Partei in Umweltfragen […].<br />
© Volker Gransow/Konrad H. Jarausch (Hg.), Die deutsche Vereinigung. Dokumente zu Bürgerbewegung,<br />
Annäherung und Beitritt. Köln (Verlag Wissenschaft und Politik) 1991, S. 54<br />
45<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa
BÜRGERBETEILIGUNG IN DEUTSCHLAND UND EUROPA<br />
7. Soziale Medien und das Partizipationsparadox<br />
JAN-HINRIK SCHMIDT<br />
46<br />
In der öffentlichen Wahrnehmung werden mit dem Internet<br />
zahlreiche Hoffnungen und Befürchtungen verbunden.<br />
Ganz wesentlich sind in diesem Zusammenhang Vorstellungen<br />
darüber, welche Auswirkung die wachsende Verbreitung<br />
der digitalen vernetzten Medien auf gesellschaftliche Teilhabe<br />
und politische Partizipation hat. Positive Stimmen prophezeien,<br />
dass sie politische Prozesse transparenter machen,<br />
Macht- und Medienmonopole brechen und marginalisierten<br />
Gruppen Gehör verschaffen können. Kritiker warnen hingegen<br />
vor Vereinzelung und Desinformation, aber auch vor der<br />
bloßen Simulation von Teilhabe und Fehlformen wie dem<br />
»Clicktivism«, bei denen sich Partizipation im Anklicken eines<br />
Buttons erschöpfe, ohne wirkliche gesellschaftliche Veränderungen<br />
zu bewirken. Ein Blick in die Mediengeschichte zeigt,<br />
dass wohl alle neuen Medien jeweils in ihrer Zeit solche widerstreitenden<br />
Diagnosen und Annahmen über ihre Folgen<br />
hervor riefen (vgl. Schrape 2012). Hoffnung und Sorge sind gewissermaßen<br />
Ausdruck der Unsicherheit, auf welchen gesellschaftlichen<br />
Boden die neuen Informations- und Medientechnologien<br />
fallen: Welche Praktiken und Normen werden sich<br />
neu herausbilden, welche etablierten Verhaltensweisen und<br />
Routinen werden bestehen bleiben und welche verschwinden,<br />
wie greifen diese Veränderungen in Machtverhältnisse ein –<br />
wer gewinnt, wer verliert? Das Internet macht in dieser Hinsicht<br />
keine Ausnahme, ist dennoch aber etwas Besonderes: Es<br />
ist ein Universalmedium, das Funktionen der klassischen<br />
Massenmedien wie Rundfunk oder Presse genauso erfüllen<br />
kann wie den direkten oder zeitverzögerten Austausch, den<br />
wir vorher beispielsweise über Telefongespräche und Briefe<br />
geführt haben. Dadurch greift das Internet in nahezu alle Lebensbereiche<br />
ein – und es entwickelt sich zudem in einer bisher<br />
ungekannten Geschwindigkeit weiter, sodass sich beim<br />
Einzelnen wie auch gesellschaftlich das Gefühl verfestigen<br />
kann, mit den technischen Innovationen und Weiterentwicklungen<br />
nicht mehr Schritt halten zu können.<br />
Soziale Medien (»social media«)<br />
Als jüngste (aber sicher nicht letzte) Stufe dieser Entwicklung<br />
lässt sich das Aufkommen der »sozialen Medien« begreifen, also<br />
von Plattformen wie Facebook oder YouTube, von Wikipedia, Twitter<br />
oder Blogs (vgl. zum Folgenden u. a. Münker 2009; Schmidt<br />
2011). Sie sind überwiegend in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre<br />
entstanden und haben sich inzwischen – wenn auch auf unterschiedlichem<br />
Niveau – unter den Internetnutzern etabliert. Ein<br />
verbreiteter Sammelbegriff für die verschiedenen Angebotsgattungen<br />
ist das »Mitmachnetz«, in der sich bereits das Versprechen<br />
von gesteigerter Teilhabe und Partizipation ausdrückt. So böten<br />
Blogs und Twitter den Dissidenten in China oder Kuba die Möglichkeit,<br />
eine Gegenöffentlichkeit zu den staatlich gelenkten Medien<br />
aufzubauen. Über Video- und Fotoplattformen wie YouTube<br />
oder Flickr könnten Demonstrationen oder staatliche Übergriffe<br />
in autoritären Regimen dokumentiert und für ein weltweites Publikum<br />
zugänglich gemacht werden können. Beim arabischen<br />
Frühling 2011 oder den Demonstrationen im Iran 2009 dienten Internetplattformen<br />
sogar als Namensgeber für politische Proteste<br />
und sozialen Wandel, wenn von »Facebookrevolution« oder »Twitterrevolution«<br />
gesprochen wurde.<br />
Abb. 1 Social Media – Apps auf einem Smart-Phone © Jürgen Kalb, 2013<br />
Aber auch innerhalb von Deutschland haben die sozialen Medien<br />
in den letzten Jahren die politische Kommunikation beeinflusst.<br />
Im Jahr 2009 mündete der Protest gegen ein Vorhaben der Bundesministerin<br />
Ursula von der Leyen, kinderpornographische<br />
Inhalte durch ein Stoppschild zu kennzeichnen, in der bis dato<br />
größten Online-Petition, die mehr als 130.000 Personen unterzeichneten.<br />
Getragen und koordiniert wurde dieser Widerstand<br />
maßgeblich über netzpolitische Blogs und Twitter-Accounts, wo<br />
der Ministerin auch der Beiname »Zensursula« verpasst wurde. Jedoch<br />
beschränkte er sich nicht auf die sozialen Medien, sondern<br />
wurde auch in journalistisch-publizistischen Medien debattiert<br />
sowie auf Demonstrationen vertreten. Ähnliche Muster der Verschränkung<br />
unterschiedlicher medialer Öffentlichkeiten mit dem<br />
politischen Handeln »auf der Straße« zeigten sich auch bei den<br />
heftigen Debatten um den Bahnhofsumbau in Stuttgart. Auf Facebook<br />
entstanden zahlreiche Diskussionsgruppen für wie auch<br />
wider »S21«, auf denen über Protestaktionen informiert und –<br />
nicht immer zivilisiert – gestritten wurde. Über Demonstrationen<br />
vor Ort wurde wiederum in den journalistischen Medien berichtet,<br />
während man auf YouTube auch heute noch zahlreiche Amateuraufnahmen<br />
von den Blockaden im Schlossgarten findet, neben<br />
Werbevideos der Deutschen Bahn zum gleichen Projekt.<br />
Soziale Medien und das Partizipationsparadox D&E Heft 65 · 2013
Persönliche Öffentlichkeiten<br />
Diese Ereignisse und Entwicklungen sind Anzeichen<br />
eines grundlegenden Strukturwandels<br />
von Öffentlichkeit. Er wird durch technische<br />
Innovationen angetrieben, wenngleich<br />
nicht vorherbestimmt: Digitale vernetzte<br />
Medien, mit dem Internet als Basistechnologie<br />
für den Datenaustausch zwischen Rechnern,<br />
senken die Hürden, Informationen aller<br />
Art zugänglich zu machen und in Echtzeit zu<br />
verbreiten. Auf Grundlage dieser Infrastruktur<br />
entstehen zahlreiche Plattformen und<br />
Dienste, die spezifische Funktionen bieten<br />
oder sich an bestimmte Zielgruppen wenden.<br />
Für ihre Nutzerinnen und Nutzer dienen<br />
diese Werkzeuge dazu, alltägliche Kommunikations-<br />
und Informationsbedürfnisse zu befriedigen,<br />
wobei eine zentrale neue Entwicklung<br />
darin liegt, dass ein eigener Typ von<br />
Öffentlichkeit entsteht: Die persönliche Öffentlichkeit,<br />
in der Menschen Informationen<br />
von persönlicher Relevanz auswählen und<br />
mitteilen (also sich nicht unbedingt an Objektivität<br />
oder gesellschaftlicher Relevanz<br />
orientieren müssen, wie es der Journalismus tut) und sich damit<br />
an ein Publikum wenden, das aus Freunden, Bekannten, beruflichen<br />
Kontakten o. ä. besteht, also nicht völlig Unbekannte umfasst.<br />
Über Verlinkungen oder das Weiterleiten und Empfehlen<br />
von interessanten Inhalten können sich Informationen schneeballartig<br />
verbreiten und große Aufmerksamkeit bekommen. Doch<br />
in der Regel haben die persönlichen Öffentlichkeiten keine Massenreichweite,<br />
sondern liegen zwischen der Reichweite von Gesprächen<br />
am Stammtisch oder auf dem Schulhof einerseits und<br />
den Massenmedien andererseits. In ihnen herrscht daher ein anderer<br />
Kommunikationsmodus: Nicht das »Publizieren«, das journalistische<br />
Medien auszeichnet, sondern die »Konversation«<br />
steht im Mittelpunkt. Der Austausch und Dialog, möglicherweise<br />
aber auch Kritik und Beleidigungen, werden über Kommentare<br />
oder den »Gefällt mir«-Knopf von Facebook technisch unterstützt.<br />
Kommunikation in den persönlichen Öffentlichkeiten ist<br />
dadurch vor allem eine Form von Selbstpräsentation und Beziehungspflege<br />
– es handelt sich also auch im wörtlichen Sinn um<br />
»soziale Medien«.<br />
Politische Themen – hier breit verstanden als Fragen von gesellschaftlichem<br />
Belang – werden in persönlichen Öffentlichkeiten<br />
durchaus auch angesprochen und diskutiert, insoweit sie von den<br />
Nutzerinnen und Nutzern als persönlich relevant und (mit-)teilenswert<br />
angesehen werden. Aus diesem Grund zeigen in den<br />
letzten Jahren politische Akteure, von den Parteien und Abgeordneten<br />
über staatliche Einrichtungen und Behörden bis hin zu Bürgerinitiativen<br />
oder gemeinnützigen Organisationen, so ein großes<br />
Interesse, sich in den sozialen Medien zu positionieren: Sie<br />
wollen dort präsent sein, für ihre politischen Ansichten und Ziele<br />
werben und Unterstützung gewinnen, wo sich eine wachsende<br />
Zahl der Bürgerinnen und Bürger aufhält – alleine auf Facebook<br />
sind inzwischen wohl mehr als zwanzig Millionen Deutsche aktiv.<br />
Sie sind nicht nur Empfänger, sondern können auch zu Multiplikatoren<br />
für Informationen und politische Botschaften werden, wenn<br />
sie diese in ihrem eigenen Kontaktnetzwerk verbreiten und empfehlen.<br />
Und weil auch publizistische Medienangebote in den sozialen<br />
Medien präsent sind, kann es zu regelrechten Informationskaskaden<br />
kommen – zur positiven Mundpropanda genauso wie<br />
zum negativ-kritischen »Shitstorm«, bei dem sich Kritik oder<br />
Häme über eine Person oder Organisation ergießt.<br />
Abb. 2 »Das alles wird einmal dir gehören …« © Gerhard Mester, 2012<br />
Teilhabe »in«, »mit Hilfe der« und »an«<br />
den sozialen Medien<br />
Dieser Wandel von Öffentlichkeit, den die sozialen Medien mit<br />
sich bringen, ist für politische Partizipation aber auch deswegen<br />
relevant, weil er Bürgerinnen und Bürgern neue Modi der gesellschaftlichen<br />
Teilhabe eröffnet.<br />
Erstens praktizieren Menschen Teilhabe in den sozialen Medien,<br />
wenn sie sich auf den entsprechenden Plattformen aufhalten und<br />
informieren, mit ihrer Hilfe ihre persönlichen Interessen ausdrücken<br />
und Beziehungen pflegen – also Erfahrungen von sozialer<br />
Einbindung und Austausch machen (vgl. Wagner/Brüggen/Gebel<br />
2009). Diese Teilhabe umfasst das »Sich-Positionieren« zu bestimmten<br />
Themen im Sinne eines Signals an die eigene persönliche<br />
Öffentlichkeit, was einem wichtig ist oder worüber man nachdenkt.<br />
Zur Teilhabe in den sozialen Medien gehört aber auch das<br />
»Sich-Einbringen« in Debatten und Gespräche, die die eigene Lebenswelt<br />
berühren, zum Beispiel indem man sich in den Kommentaren<br />
zu einem Weblogeintrag über seine eigenen Erfahrungen<br />
zu einem politischen Thema austauscht.<br />
Die Grenzen zum zweiten Modus von Teilhabe sind dabei fließend:<br />
Teilhabe mit Hilfe der sozialen Medien geschieht dann,<br />
wenn die sozialen Medien als Werkzeug oder Kanal genutzt werden,<br />
um auf politische Entscheidungen und gesellschaftliche<br />
Debat ten außerhalb des Internets Einfluss zu nehmen. Zudem<br />
lassen sich gerade aufgrund der geschilderten einfachen Möglichkeiten,<br />
Information zu verbreiten und zu multiplizieren, auch<br />
vergleichsweise leicht andere Menschen aktivieren, beispielsweise<br />
durch das Verbreiten von Veranstaltungsinformationen,<br />
Demonstrationsaufrufen oder Hinweisen auf Unterschriftensammlungen.<br />
Digitale Medientechnologien spielen daher inzwischen<br />
eine wichtige Rolle für die Mobilisierung, den Wissensaustausch<br />
und die Koordination politischen Handelns, in Deutschland<br />
und weltweit.<br />
Den genannten Erfolgsbeispielen stehen aber auch Beobachtungen<br />
gegenüber, dass der Schritt von der »Teilhabe im Netz« zur<br />
»Teilhabe mit Hilfe des Netzes« nicht immer gelingt. Vielfach<br />
bleibt es bei Ansätzen oder Artikulationen von politischen Interessen<br />
innerhalb onlinebasierter Räume, die aber nicht an Debatten<br />
und Entscheidungen im politischen System angebunden sind.<br />
Unter dem Stichwort des »Slacktivism« (Morozov 2009) wird beispielsweise<br />
kritisch diskutiert, dass sich für viele Nutzer politisches<br />
Engagement bereits im Klicken des »Gefällt mir«-Buttons<br />
auf Facebook oder dem Weiterleiten eines Links zu einer Online-<br />
47<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Soziale Medien und das Partizipationsparadox
48<br />
JAN-HINRIK SCHMIDT<br />
Abb. 3 Gefangen im (Google-)Netz © Gerhard Mester, 2012<br />
Petition erschöpfe, ohne dass es es zu weiterführenden (und<br />
letztlich politisch folgenreichen) Formen von Teilhabe käme.<br />
Der dritte Modus schließlich ist die Teilhabe an den sozialen Medien<br />
im Sinne einer möglichst selbstbestimmten Technikgestaltung.<br />
Sie artikuliert sich unter anderem in der Netzpolitik, einem<br />
Politikfeld, das sich in den vergangenen Jahren auch in Deutschland<br />
konturiert und etabliert hat. Dafür stehen beispielsweise die<br />
Wahlerfolge (und damit einhergehende große mediale Aufmerksamkeit)<br />
für die Piratenpartei oder die Einrichtung der Enquete-<br />
Kommission »Internet und digitale Gesellschaft« des Deutschen<br />
Bundestags. Politische Debatten um Datenschutz, Netzneutralität<br />
oder das Leistungsschutzrecht für Presseverleger drehen sich<br />
zwar auf den ersten Blick um spezifische Details der medien- oder<br />
technologiepolitischen Regulierung des Internets, berühren bei<br />
näherem Hinsehen aber wesentliche Fragen der Gestaltung von<br />
bürgerlichen Freiheiten oder des Mediensystems unter Bedingungen<br />
einer rasanten technischen Konvergenz von Medien- und<br />
Kommunikations-technologien (vgl. Stöcker 2012).<br />
Das Internet und speziell die sozialen Medien stellen also Kommunikationsräume<br />
für gesellschaftliche Öffentlichkeit zur Verfügung<br />
und unterstützen verschiedene Modi von Teilhabe. Allerdings<br />
wirft diese Entwicklung Widersprüche auf, die sich als<br />
»Partizipationsparadox« beschreiben lassen.<br />
Die Infrastruktur und die Regeln dieser neuen Kommunikationsräume<br />
werden derzeit von einigen wenigen global agierenden Unternehmen<br />
bereitgestellt und gestaltet. Diese haben letztlich<br />
kommerzielle Interessen, wodurch der Grad an Teilhabe, den Nutzerinnen<br />
und Nutzer an den Infrastrukturen der sozialen Medien<br />
ausüben können, in aller Regel eingeschränkt ist (vgl. Wagner/<br />
Gerlicher/Brüggen 2011). Die Plattformbetreiber ermutigen zu<br />
»Mitwirkung«, weil erst die Aktivitäten der Nutzerinnen und Nutzer<br />
– das Teilen von persönlichen Informationen und Neuigkeiten,<br />
von Fotos und Videos – den Wert einer Plattform ausmachen. Auf<br />
den ersten Blick nehmen sie dabei eine reine Mittlerrolle zwischen<br />
den Nutzern ein, doch faktisch lassen sie sich meist weit<br />
reichende Rechte an den Daten und Inhalten einräumen und behalten<br />
sich auch vor, bestimmte Inhalte oder Profile zu sperren,<br />
die nicht den Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechen.<br />
Hierbei kommt eine zweite Facette von Partizipation ins Spiel: Die<br />
»Mitbestimmung«, die sich zum einen in den Möglichkeiten äußert,<br />
das eigene Profil anzupassen und zu<br />
personalisieren. Zum anderen werden Nutzerinnen<br />
und Nutzer aber auch zur Mithilfe aufgefordert,<br />
zum Beispiel wenn es um die Moderation<br />
oder Kontrolle von Inhalten geht.<br />
Auf Plattformen wie YouTube oder Facebook<br />
kann aufgrund der schieren Menge der nutzergenerierten<br />
Inhalte keine vollständige redaktionelle<br />
(Vor-)Prüfung stattfinden. Zu den<br />
Moderationsteams sowie den immer wichtiger<br />
werdenden technischen Filtersystemen<br />
tritt daher die »community«, die Betreiber<br />
auf extremistische, gewaltverherrlichende<br />
oder anderweitig problematische Inhalte<br />
hinweisen soll. Die Teilhabe der Nutzerschaft<br />
wird als Form der unentgeltlichen Arbeit im<br />
Geschäftsmodell einkalkuliert und steigert<br />
letztlich den Wert einer Plattform.<br />
Doch echte Selbstbestimmung, also das eigenverantwortliche<br />
Gestalten von Strukturen<br />
und Regeln, ist bei den großen Social-<br />
Media-Plattformen nicht vorgesehen. Mit<br />
dem Registrieren bei einem Angebot akzeptiert<br />
man zugleich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen<br />
und begibt sich dadurch<br />
in ein Vertragsverhältnis zu den Anbietern, wird also zum Kunden.<br />
Für den Einzelnen ist dies möglicherweise auf den ersten Blick gar<br />
nicht ersichtlich: Man kann in der Regel die Plattformen ja kostenlos<br />
nutzen, und die genauen Bedingungen und Pflichten, die<br />
man eingeht, sind für den juristischen Laien aus den umfangreichen<br />
und komplexen Dokumenten kaum zu erschließen. Dennoch<br />
findet ein Tausch von Leistung und Gegenleistung statt,<br />
denn man zahlt mit seinen persönlichen Daten und seiner Aufmerksamkeit,<br />
die wiederum vor allem gegenüber Werbetreibenden<br />
vermarktet werden. Zynisch formuliert ist man also noch<br />
Das Partizipationsparadox<br />
Abb. 4<br />
»Schalt jetzt endlich die verfluchte Spielkonsole aus!«<br />
© Ritsch-Renn.com, 2013<br />
Soziale Medien und das Partizipationsparadox<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
nicht einmal Kunde von Facebook und anderen<br />
Plattformen, sondern selbst das Produkt.<br />
Das Verhältnis zwischen Nutzerschaft und<br />
Betreibern der Plattformen ist in mehrfacher<br />
Hinsicht problematisch. Erstens hat man als<br />
Nutzer kaum Möglichkeiten, etwaigen Änderungen<br />
in der Gestaltung, im Funktionsumfang<br />
oder in den Geschäftsbedingungen einer<br />
Plattform zu widersprechen oder sie im<br />
Vorfeld zu beeinflussen, weil es keine oder<br />
nur rudimentäre Prozeduren der Nutzeranhörung<br />
oder der Abstimmung zwischen unterschiedlichen<br />
Varianten gibt. Und selbst,<br />
wenn man sich zum Verlassen einer Plattform<br />
entscheiden sollte, bauen sich Hürden auf.<br />
Diese können sozialer Art sein, weil zumindest<br />
in bestimmten Altersgruppen oder Szenen<br />
die Präsenz auf einer Netzwerkplattform<br />
wie Facebook derzeit unerlässlich ist, um<br />
sich nicht sozial zu isolieren. Aber auch technische<br />
Hürden bestehen, denn man kann die<br />
aufwändig eingestellten und zusammengetragenen<br />
Informationen zum eigenen Kontaktnetzwerk<br />
nicht einfach zu einem anderen<br />
Konkurrenznetzwerk transferieren. Diese Interoperabilität,<br />
die zum Beispiel auf dem Telefonmarkt<br />
ermöglicht, auch zwischen zwei unterschiedlichen<br />
Betreibern telefonieren oder seine Nummer mitnehmen zu können,<br />
ist im Bereich der sozialen Medien noch nicht etabliert.<br />
Dies wiederum ist eng mit einem zweiten Problem verbundenen:<br />
Die Anbieter von Social-Media-Plattformen sammeln immense<br />
Datenmengen, die von den personenbezogenen Informationen<br />
im engeren Sinne (wie Geschlecht, Geburtsdatum oder Kontaktadresse)<br />
bis zu eher beiläufig bei der Nutzung anfallenden Informationen<br />
über Vorlieben, Interessen, Aktivitäten und räumliche<br />
Bewegung reichen. Zudem erfassen sie die soziale Verortung einer<br />
Person im Geflecht einander überlappender Beziehungs- und<br />
Interaktionsnetzwerke. Aus diesen Informationen lassen sich wiederum,<br />
eine genügend große Datenmenge vorausgesetzt, relativ<br />
treffsichere Vorhersagen über Präferenzen oder Verhalten des<br />
einzelnen Nutzers machen.<br />
Aus der Sicht der Betreiber entstehen hier neue Möglichkeiten für<br />
zielgerichtete, personalisierte Ansprache und Werbung, die für<br />
den Einzelnen relevanter und damit wertvoller sein kann. Aus<br />
Sicht des Datenschutzes hingegen ist dies eher ein Albtraum, weil<br />
sich die sozialen Medien eben auch für überwachende oder kontrollierende<br />
Zwecke nutzen lassen, und weil die auf ihnen basierenden<br />
Öffentlichkeiten gefiltert, zensiert oder automatisch und<br />
verdeckt durchsucht werden können. Vorschläge zu einer stärkeren<br />
Regulierung, zum Beispiel zur Novellierung der EU-Datenschutzrichtlinie,<br />
sind daher auch als Versuch zu sehen, diesen<br />
potenziell freiheitsgefährdenden Datensammlungen Grenzen zu<br />
setzen.<br />
Zusammengefasst besteht das Partizipationsparadox der sozialen<br />
Medien also darin, dass sie einerseits bisher ungekannte Möglichkeiten<br />
eröffnen, sich an gesellschaftlicher Öffentlichkeit zu<br />
beteiligen, was wiederum bestehende Machtstrukturen des professionell-publizistischen<br />
Systems tiefgreifend verändert. Andererseits<br />
verschließen sie sich selbst aber der Teilhabe und etablieren<br />
neue machtvolle Strukturen, in denen in beispiellosem<br />
Abb. 5 Schule der Zukunft: 20 Jahre nach dem Kruzifix-Urteil © Gerhard Mester, 2012<br />
Ausmaß und unter Mitwirken von uns Nutzerinnen und Nutzern –<br />
Informationen über unseren Alltag erhoben und verarbeitet werden.<br />
Teilhabe in, mit Hilfe der und an den sozialen Medien muss<br />
sich diesem Paradox stellen und letztlich darauf hinarbeiten, alternative<br />
Modelle für digitale vernetzte Öffentlichkeiten zu fördern,<br />
die auf dezentralen Infrastrukturen, offenen Standards für<br />
den Datenaustausch und frei verfügbaren Softwaretechnologien<br />
beruhen.<br />
Literaturhinweise<br />
Morozov, Evgeny (2009): From slacktivism to activism. Hg. v. Foreign Policy.<br />
Online verfügbar unter: http://neteffect.foreignpolicy.com/<br />
posts/2009/09/05/from_slacktivism_to_activism.<br />
Münker, Stefan (2009): Emergenz digitaler Öffentlichkeiten: Die sozialen<br />
Medien im Web 2.0. Frankfurt am Main.<br />
Schrape, Jan-Felix (2012): Wiederkehrende Erwartungen: Visionen, Prognosen<br />
und Mythen um neue Medien seit 1970. Hülsbusch.<br />
Schmidt, Jan (2011): Das neue Netz. Merkmale, Praktiken und Folgen des<br />
Web 2.0. 2. überarbeitete Auflage. Konstanz.<br />
Stöcker, Christian (2012): Governance des digitalen Raumes: aktuelle netzpolitische<br />
Brennpunkte. In: APuZ 62 (7), S. 9–14.<br />
Wagner, Ulrike/ Brüggen, Niels/Gebel, Christa (2009): Web 2.0 als Rahmen<br />
für Selbstdarstellung und Vernetzung Jugendlicher. München. Online verfügbar:<br />
http://www.jff.de/dateien/Bericht_Web_2.0_<br />
Selbstdarstellungen_JFF_2009.pdf<br />
Wagner, Ulrike/Gerlicher, Peter /Brüggen, Niels (2011): Partizipation in und<br />
mit dem Social Web – Herausforderungen für die politische Bildung. München.<br />
49<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Soziale Medien und das Partizipationsparadox
50<br />
JAN-HINRIK SCHMIDT<br />
MATERIALIEN<br />
M 1<br />
Bloggerkolumne von Johnny Haeusler: »Die Jugendverdrossenen«<br />
Vor etwa zwei Jahren twitterte Max Winde alias »@343max«: »Ihr<br />
werdet euch noch wünschen, wir wären politikverdrossen.« Er<br />
erntete damit jede Menge Applaus und Weiterverbreitung. Zu<br />
Recht, denn die Aussage kehrt den ewigen Vorwurf des politischen<br />
Desinteresses der Jugend in eine mittlerweile sehr wahr<br />
gewordene Prognose um.<br />
Als jüngste Umfragen der größtenteils von jungen Menschen geprägten<br />
Piratenpartei bessere Ergebnisse vorhersagten als der<br />
FDP, vor allem aber einen möglichen Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus,<br />
da reagierte das politische Establishment mit Warnungen<br />
durch Klaus Wowereit und einem mäßig gelungenen<br />
Witzchen von Renate Künast. Die grüne Spitzenkandidatin sagte,<br />
sie wolle die Piraten »resozialisieren«. Und auch, dass in dieser<br />
Woche ein kleines Wunder in Sachen politischer Bürgerbeteiligung<br />
geschehen ist, als innerhalb weniger Tage die noch fehlenden<br />
25.000 Mitzeichner einer Petition gegen die Vorratsdatenspeicherung<br />
im Internet mobilisiert werden konnten, ruft bei der<br />
Politik keine hörbare Begeisterung hervor, sondern allenfalls betretenes<br />
Schweigen. Da wird der Bürger also aktiv, und dann ist es<br />
anscheinend auch wieder nicht richtig.<br />
Stattdessen: Debatten über Facebook-Buttons und Rufe nach<br />
mehr Kontrolle im Netz. Wenn sich beachtenswerte Teile einer<br />
Generation mithilfe ihres wichtigsten Mediums, dem Internet,<br />
politisch äußern und engagieren, dann sollte das für die Etablierten<br />
jedoch kein Anlass zur Sorge, sondern zur Begeisterung sein.<br />
Es braucht Unterstützung statt Restriktion. Man könnte fast meinen,<br />
die Politik sei jugendverdrossen.<br />
© Johnny Haeusler, 16.9.2011, Die Jugendverdrossenen, www.tagesspiegel.de/medien/<br />
bloggerkolumne-die-jugendverdrossenen/v_print/4617572.html?p=<br />
Der Autor betreibt das Weblog www.spreeblick.com und ist Mitveranstalter der jährlichen<br />
Konferenz re:publica.<br />
M 2<br />
Macmagazin: » Wer ist eigentlich Max Winde?«<br />
Max Winde ist in der Blogszene kein Unbekannter, mischt er doch beim<br />
Spreeblick mit und ist Mitbegründer von AdNation. Im Interview erzählt<br />
er, wie Twitter frischen Wind in die Szene weht und wie die Welt zum<br />
Twitter-Stoff wird.<br />
macmagazin.de: Welches aktuelle Tagesereignis hat Sie in letzter Zeit<br />
besonders bewegt?<br />
Max Winde: Ich glaube und hoffe, dass das Jahr 2009 als die Geburtsstunde<br />
einer neuen Bürgerbewegung gelten wird, die die<br />
Chancen des Übermediums Internet auch nutzt. Die Verabschiedung<br />
des »Zugangserschwerungsgesetzes« im Bundestag, aber<br />
auch Begriffe wie »Killerspiele« und der Kampf gegen die vermeintlichen<br />
»Kostenloskultur des Internet« zeigen, wie wenig die<br />
politische und wirtschaftliche Führungsschicht das Internet und<br />
die digitale Kultur bisher verstanden haben. Und es zeigt, wie<br />
dringend es nötig ist, dass netzaffine Menschen sich stärker in<br />
die aktuellen Diskussionen einmischen, um für Verständnis zu<br />
werben und für die eigenen Ziele zu kämpfen. Wenn ich zum Beispiel<br />
im Wahlprogramm der CDU das Internet nur als Gefahr und<br />
nie als Chance erwähnt finde, dann ist dies ein Zeichen für mich,<br />
dass wir uns dringend einmischen müssen.<br />
macmagazin.de: Gezwitscher auf allen Kanälen – Hand auf’s Herz, wie<br />
viel Zeit verbringen Sie mit Twitter und Blogs?<br />
Max Winde: Twitter ist für mich der Kommunikationskanal Nummer<br />
Eins. Ich habe meinen Job über Twitter gefunden und meine<br />
Freundin über Twitter kennengelernt. Sogar eine von meinen beiden<br />
Katzen habe ich über Twitter adoptiert. Gerade an diesem<br />
Wochende habe ich ein paar Freunde auf eine Geburtstagssause<br />
M 3<br />
Twitter-Profil von Max Winde, Pionier der »Social media«<br />
© Max Winde,@343max, 2013<br />
in Brandenburg eingeladen: Gerade mal 3 von 17 Leuten habe ich<br />
nicht direkt oder indirekt über Blogs und Twitter kennengelernt.<br />
Wenn ich also betrachte, wie mein gesamtes Leben von Blogs und<br />
Twitter zusammengehalten wird, dann muss ich sagen: Ja, ich verbringe<br />
immer noch viel zu wenig Zeit mit Twitter und Blogs.<br />
macmagazin.de: Sie haben die technische Leitung beim Spreeblick, eines<br />
der großen Blogs im deutschen Sprachraum. Vor einigen Jahren konnte<br />
man von Blogprominenz sprechen, der Begriff A-Blogger geisterte umher.<br />
Wie ist die Situation heute, hat sie sich – vielleicht durch Twitter – entspannt?<br />
Max Winde: Und ob sich die Lage entspannt hat! Bis vor wenigen<br />
Jahren gab es eine handvoll A-Blogger, die die gesamte Aufmerksamkeit<br />
absorbierten wie ein schwarzes Loch das Licht. Dank<br />
Rivva und Twitter finden nun auch viele der kleineren Blogs endlich<br />
die Beachtung, die sie verdienen. Endlich können wir sehen,<br />
dass der ganze Himmel voll mit kleinen Sternen ist und nicht nur<br />
von einigen wenigen großen Sonnen dominiert wird. Die deutsche<br />
Blogosphäre hat sich viel zu lange nur als Gegenpol der klassischen<br />
Medien gesehen und konnte ihr wirkliches Potential nicht<br />
entfalten – dies wird jetzt nachgeholt.<br />
macmagazin.de: Verändert das Bloggen und Twittern die Sicht auf die<br />
Welt, wird sie zum Stoff für (Micro-)Blogging?<br />
Max Winde: Oh ja! Es gibt diese Tage, an denen ich alles auf Twitterbarkeit<br />
abscanne. Kleine Banalitäten des Alltags werden zu<br />
kleinen Geschichten im Netz.<br />
macmagazin.de: Mit AdNation habt Ihr die Werbung in Blogs professionalisiert<br />
und bildet auch Rücklagen für Rechtsstreitigkeiten. Davon haben<br />
auch einige Blogger Gebrauch gemacht, wie ist die Tendenz? Wie gefährlich<br />
ist es, derzeit ein Blog zu führen? Und wann können sich Blogs<br />
wieder bei Euch bewerben?<br />
Max Winde: Nach meinem Gefühl hat die Zahl der Abmahnungen<br />
in letzter Zeit etwas abgenommen. Zum einen hat sich vielleicht<br />
bei vielen Unternehmen langsam mal herumgesprochen, dass ein<br />
Soziale Medien und das Partizipationsparadox<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
kritischer Blogbeitrag nicht gleich das Ende<br />
der Welt bedeutet. Vermutlich sind viele<br />
Blogger auch etwas vorsichtiger geworden.<br />
Solange man Augenmaß bewahrt und im<br />
Zweifelsfall noch mal eine Nacht vor dem Veröffentlichen<br />
über einen kritischen oder polemischen<br />
Artikel schläft, ist die Gefahr, vor<br />
Gericht zu landen, sicherlich recht gering.<br />
Dennoch halte ich es für ratsam, eine Rechtsschutzversicherung<br />
abgeschlossen zu haben:<br />
(…)<br />
macmagazin.de: Wann sind Sie glücklich?<br />
Max Winde: Glück ist für mich, mein Leben<br />
selbst gestalten zu können. So ist es für mich<br />
als leidenschaftlicher Langschläfer ein großes<br />
Glück, nicht um 9 Uhr morgens produktiv<br />
sein zu müssen, nur weil mir eine Uhr dies befohlen<br />
hat. Ich liebe es, statt in einem muffigen<br />
Büro in meinem Garten arbeiten zu können.<br />
Diese flexible Arbeitsweise ist durch das<br />
Internet überhaupt erst möglich geworden,<br />
worüber ich mich jeden Tag auf’s Neue freue.<br />
Den Rest überlasse ich gern dem Zufall.<br />
M 5 »Seht Ihr denn auch irgendwelche Gefahren, ….« © Thomas Plaßmann, 17.6.2012<br />
© Macmagazin. de (13.6.2012): Wer ist eigentlich Max Winde?,<br />
www.giga.de/webapps/twitter/tipps/wer-ist-eigentlichmax-winde<br />
M 4<br />
Johannes Weyrosta: »Ihr werdet euch noch wünschen,<br />
wir wären politikverdrossen!«<br />
Im Grunde mangelt es den heutigen Jugendgenerationen nicht an<br />
Feindbildern und Problemstellungen, dennoch haftet an den jungen<br />
Menschen ein apolitisches und unkritisches Image. Nur selten<br />
überraschen wir unsere wutbürgerliche Elterngenerationen<br />
durch politisches Aufbegehren und zivilgesellschaftliche Partizipation.<br />
Während unsere Eltern auf der Straße gegen überdimensionierte<br />
Tiefgaragen der Deutschen Bahn zu demonstrieren versuchen,<br />
einverleiben wir uns Billigflüge, technologische Neuheiten<br />
und kostengünstige Kleidung im Dauerlauf. Vor wenigen Monaten<br />
kollabierte das Atomkraftwerk in Fukushima, dessen Folgen<br />
bis heute nicht geklärt sind, den dramatischen Auswirkungen von<br />
Tschernobyl jedoch in nichts nachstehen werden.<br />
Vor den Küsten Europas sterben zu Tausenden junge Afrikaner,<br />
die den Diktaturen ihrer Heimatländer entfliehen möchten, im<br />
reichen Westen jedoch nicht geduldet werden. In Libyen fliegt die<br />
westliche Staatengemeinschaft Luftangriffe gegen einen Führer,<br />
der lange Zeit als gern gesehener Gast durch Europa reiste, um an<br />
unserem Wohlstand mitzuwirken und selbst daran zu verdienen.<br />
Schon der Irak-Einsatz der US-Regierung stand unter fragwürdigen<br />
Vorzeichen und ist nicht erst heute als völkerrechtswidrig einzustufen.<br />
In vielen Teilen Europas wird der Tonfall gegenüber<br />
Migranten und Andersgläubigen rauer und feindseliger, Dänemark<br />
denkt bereits öffentlich über Grenzschließungen nach.<br />
Doch wo bleibt der Widerstand unserer Generation? Wir schauen<br />
ohnmächtig zu, die Ereignisse schnellen an uns vorbei und ersticken<br />
fundierte Gegenwehr schon im Keim.<br />
taz und der Freitag überschlagen sich in Berichterstattungen und<br />
Reportagen über die Energiewende, nachhaltiges Wirtschaften<br />
und alternative Lebensformen. Wer Peter Unfried, Chefreporter<br />
der taz, auf seinem Streifzug durch das französische Viertel in Tübingen<br />
und den Entdeckungsreisen durch das wohlstandsbesoffene<br />
aber dennoch energiebewusste Hohenlohe folgt, müsste mit<br />
Stolz erfüllt sein. Deutschland reflektiert kritisch und mit offenem<br />
Ausgang seine eigene Haltung zu Paradigmen der zurückliegenden<br />
Dekaden. Sollten wir uns wirklich nur von ökonomischen<br />
Zielen leiten lassen? Wo können wir noch ressourcenschonender<br />
und nachhaltiger agieren?<br />
Endlich kann auch die Jugendgeneration froh sein, in diesen Zeiten<br />
zu leben. Es geschieht etwas – so zumindest der Eindruck. Von<br />
unseren Eltern und Großeltern bekamen wir frühzeitig vermittelt,<br />
dass große Schlachten und Errungenschaften zurückliegen, die<br />
ganze Generationen zu Kämpfern gegen Faschismus, Autoritäten,<br />
Kriegseinsätze und Atomkraft werden ließen. Die Gegenfrage<br />
liegt nicht weit: Und was ist mit euch? Wogegen kämpft ihr?<br />
Meiner Generation mangelte es schlichtweg an Feindbildern. Antiautoritär<br />
und mit liberalen Weltansichten großgezogen sind wir<br />
nun Wohlstandskinder mit klaren Problemen vor Augen:<br />
Klimawandel, Wirtschaftsmigration und die neoliberale Ausrichtung<br />
der Wirtschaft für immer mehr Wachstum. Sie wurden uns<br />
quasi auf dem Silbertablett präsentiert, wir mussten sie nur noch<br />
greifen. Doch noch ist vieles der Gegenwehr nur heiße Luft. Zusammenhänge<br />
zwischen persönlichem Konsumverhalten und<br />
weltpolitischen Auseinandersetzungen werden nicht oder unzureichend<br />
gezogen. Konsumgesellschaften haben keine Zeit und<br />
keinen Platz für Fragen nach Menschenrechten, Produktionsbedingungen<br />
und Umweltauswirkungen, insofern diese nur in anderen<br />
Teilen der Erde spürbar sind. Die heutige Jugend muss asketischer<br />
werden. Verzicht, Reflektion und Kontrolle müssen die<br />
Maxime unseres Konsumverhaltens werden. Kompromisse darf<br />
es nicht geben. Flüge für 19 Euro nach London sind nicht mit Fairtrade-Kaffee<br />
aufzuwiegen, Klamotten aus Biobaumwolle verlieren<br />
ihre Tragkraft wenn der Körper, der darin steckt, sich täglich<br />
von Fleisch ernährt.<br />
Der Netzaktivist Max Winde prägte mit dem Ausruf »Ihr werdet<br />
euch noch wünschen, wir wären politikverdrossen« unser Leitmotiv.<br />
Es bedarf einer Bewusstwerdung von Folgen und Verantwortung<br />
unseres Konsumverhaltens. An Verzicht geht kein Weg vorbei.<br />
(…) Wir müssen aufwachen, schon jetzt schwinden Fukushima<br />
und der Libyen-Einsatz aus unseren Köpfen, wir verdauen politisches<br />
Verbrechen wie Junkfood und verlieren dabei den Bezug zu<br />
ihrer Tragweite. Dabei ist es doch so erstrebenswert, eine Generation<br />
mit Gesicht zu sein. Und dieses Gesicht sollte wahrlich<br />
nicht die Form eines angebissenen Apfels haben.<br />
© Johannes Weyrosta (13.6.2011): www.freitag.de/autoren/weilmeldung/ihrwerdet-euch-noch-wunschen-wir-waren-politikverdrossen<br />
51<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Soziale Medien und das Partizipationsparadox
52<br />
JAN-HINRIK SCHMIDT<br />
M 6<br />
Katja Bauer: »Die digitale Elite will<br />
die Welt retten. Berlin nach der<br />
Wahl«<br />
Sie sind jung, überwiegend männlich, lieben<br />
Nerdbrillen, Ziegenbärtchen und das Netz.<br />
Aber sie wollen nicht auf ein Klischee reduziert<br />
werden, sondern anders Politik machen.<br />
14 Männer und eine Frau sind die ersten Piraten<br />
in einem Landesparlament. (…) Transparenz<br />
– so heißt eines der Zauberwörter der<br />
Piraten. Alle Neuparlamentarier, die man danach<br />
fragt, was ihr wichtigstes politisches<br />
Ziel sei, antworten mit diesem Wort so zuverlässig<br />
wie Mädchen, die bei Misswahlen Weltfrieden<br />
sagen. (…) »Es ist ja alles noch sehr<br />
ungewohnt«, sagt Andreas Baum, der Spitzenkandidat,<br />
den die Partei per Los bestimmt<br />
hat. Schließlich sei die Arbeit im Parlament<br />
für sie alle ein Lernprozess. Wie locker die Piraten<br />
diesen Prozess nehmen, das konnte<br />
man im Wahlkampf beobachten. Es gab<br />
Kernthemen wie die Wirtschaftspolitik, bei<br />
denen der Spitzenkandidat mit den Achseln<br />
zuckte. Man habe sich noch nicht eingelesen<br />
– das hat offenbar nicht geschadet. Jetzt<br />
wollen sie von ihrem Lern- und Einleseprozess<br />
berichten. Denn natürlich macht die<br />
Partei, in der »wir grade unheimlich viel zum ersten Mal machen«,<br />
neue Erfahrungen. Keiner hat bisher jemals eine Kleine Anfrage<br />
gestellt oder einen Antrag zur Geschäftsordnung. Davon wollen<br />
die Piraten künftig berichten.<br />
»Das kann durchaus auch ein bisschen Sendung-mit-der-Mausmäßig<br />
sein«. Denn – Internetweisheit! – wenn man Lernprozesse teilt,<br />
dann wird man zusammen unter Umständen schneller schlauer.<br />
Da ist es wieder, das Internetwissen – und damit auch das Klischee<br />
einer Partei von den Nerds, die Tag und Nacht vor ihrem<br />
Rechner sitzen und eigentlich außer zensurfreiem Surfen und<br />
vielleicht noch straflosem Cannabiskonsum keine echten Ziele<br />
haben. Das nun wieder findet der Haufen junger, internetaffiner<br />
Männer, der da sitzt, nicht so lustig. (…) In der Zwischenzeit jedenfalls<br />
müssen sie sich erst einmal parlamentarischen Grundfragen<br />
zuwenden. »Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es<br />
bei uns einen Fraktionszwang geben wird«, sagt Andreas Baum.<br />
(…) Hier sitzen keine Politikprofis – die meisten haben lang nicht<br />
gedacht, dass Berufspolitiker aus ihnen werden. Und auch wenn<br />
sie es jetzt sind, sie wollen es nicht werden. »Endlich normale<br />
Menschen«, haben sie auf ihren Plakaten versprochen – eine Antiparteienpartei.<br />
© Katja Bauer: »Die digitale Elite will die Welt retten. Berlin nach der Wahl«, Stuttgarter<br />
Zeitung vom 20.11.2011<br />
M 7<br />
Jasper von Altenbockum: »Die Linux-Demokratie.<br />
Nicht nur die Piratenpartei will aus einer Kathedrale<br />
einen Basar machen«<br />
M 8 »Hoffnungsträger Piratenpartei …« © Gerhard Mester, 2012<br />
Der amerikanische Programmierer Eric Steven Raymond schrieb<br />
1997 mit seinem Essay »Die Kathedrale und der Basar« ein Manifest<br />
der »freien Software«. Er entwarf eine Computerwelt, die nicht<br />
von wenigen Konzernen, sondern von allen geschaffen werden<br />
sollte, mit einer für alle Internetnutzer frei zugänglichen Programmiersprache.<br />
Jeder sollte sich daran beteiligen können, niemand<br />
das Monopol für eine Software haben. Doch Raymond ging es um<br />
mehr. Freie Software (»Open Source«) war für ihn eine Weltanschauung.<br />
Seit ein paar Jahren ist sie in der Politik angekommen.<br />
Die alte Welt habe aus Kathedralen bestanden, schrieb Raymond,<br />
der selbst der Hackerszene entstammt. Die neue sei wie ein Basar.<br />
Kathedralen seien sorgsam Stein für Stein gemeißelt worden,<br />
von Druiden ersonnen, von exklusiven Bauhütten ausgeführt, das<br />
Werk kleiner Gruppen disziplinierter Handwerker und Hohepriester,<br />
die in großer Abgeschiedenheit wirkten. Die Kathedrale der<br />
Gegenwart war damals Microsoft, der Basar war das Betriebssystem<br />
Linux. Jedermann konnte an der Weiterentwicklung von Linux<br />
teilnehmen, die Linux-Gemeinde war in den Augen von Raymond<br />
wie »ein großer, wild durcheinander plappernder Basar, geschaffen<br />
von Tausenden über den ganzen Planeten verstreuten Nebenerwerbs-Hackern«.<br />
»Linux ist subversiv«, schrieb Raymond. (…)<br />
Wie aber wird aus solchen politischen Maximen ein Betriebssystem?<br />
Mit dieser Frage beschäftigt sich nicht nur die Piratenpartei,<br />
sondern die Internetgemeinde als ganze, die es damit immerhin<br />
schon bis in den Deutschen Bundestag schaffte. In der Enquetekommission<br />
des Bundestags »Internet und digitale Gesellschaft«<br />
kam es von Anfang an nicht nur über Datenschutz und Urheberrechte<br />
zum Streit, sondern vor allem darüber, wie die Öffentlichkeit<br />
einzubeziehen sei. Der Vorschlag, im Reichstag »liquid democracy«<br />
einkehren zu lassen, stieß an die Grenzen repräsentativer<br />
Demokratie und der Gepflogenheiten des Parlaments. Unter dem<br />
Schlagwort »liquid democracy« ist eine Mischung aus direkter und<br />
indirekter Demokratie zu verstehen: Jeder wählt und delegiert<br />
selbst, was er für richtig hält, beteiligt sich, woran er will und wie<br />
es ihm gefällt. Der Futurologe Alvin Toffler hatte dafür 1970 den<br />
Namen »Adhokratie« (von Lateinisch ad hoc) erfunden – als Gegenwelt<br />
zur statischen Welt der Bürokratie, zur hierarchisch geordneten<br />
Partizipation und zu jeglicher Form zentraler Planung.<br />
(…) Nicht nur die Piratenpartei experimentiert mit solchen neuen<br />
Formen unmittelbarer Beteiligung. Sie hat den Versuch, der seit<br />
langem in den Volksparteien an Zuspruch gewinnt, auch Nichtmitglieder<br />
an den Personal- und Sachentscheidungen der Partei<br />
teilhaben zu lassen, auf die Spitze getrieben. Jeder kann mitmachen,<br />
wann er will und wie er will. Politik soll »freie Software« der<br />
Gesellschaft sein und nach dem Linux-Prinzip funktionieren.<br />
Besonders auf junge Leute hat das eine Anziehungskraft, die sich<br />
aus den Erfahrungen speist, die im Internet als einem »kollaborativen<br />
Projekt« gesammelt werden können. Es wird sich angesichts<br />
der chaotischen Verfassung der Piratenpartei aber noch zeigen<br />
müssen, ob auch das Parteiensystem eine Kathedrale oder ein<br />
Basar ist.<br />
© Jasper von Altenbockum: »Die Linux-Demokratie, FAZ 12.9.2011, S. 10<br />
Soziale Medien und das Partizipationsparadox<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
M 9<br />
Barbara Zehnpfennig: »Strukturlose Öffentlichkeit.<br />
Warum mehr Transparenz per Internet zu<br />
weniger Demokratie führen kann«<br />
Seit sich das Prinzip der Öffentlichkeit als politische Forderung<br />
etablierte – also seit dem Aufkommen der bürgerlichen<br />
Gesellschaft –, war es mit einem Paradox behaftet.<br />
Die Forderung, der politische Prozess solle sich<br />
öffentlich und damit für alle zugänglich vollziehen, war<br />
gegen die Geheimpolitik des Hofes gerichtet; was sich<br />
im Geheimen vollzog, war schon als solches verdächtig.<br />
Doch die Rechte, die das Bürgertum nun in Anspruch<br />
nahm, standen den eigenen Forderungen zum Teil entgegen:<br />
Das Recht auf Eigentum, das Recht auf geheime<br />
Wahl, die Religionsfreiheit und viele andere sind Rechte<br />
des Privatmanns, der über ihre Ausfüllung nicht unbedingt<br />
öffentlich Rechenschaft geben will. Was man der<br />
Politik verwehrte, nahm man für sich selbst also durchaus<br />
in Anspruch. Daran zeigte sich, dass Öffentlichkeit<br />
kein absoluter Wert sein konnte. Heute hingegen wird<br />
oft behauptet, Öffentlichkeit sei bereits ein Wert an sich.<br />
Weil man durch das Internet eine nie gekannte Dimension<br />
des Öffentlichen erreicht hat, wird mit dieser neuen Möglichkeit<br />
bürgerlicher Teilhabe eine Heilserwartung verbunden, die<br />
näherer Überprüfung kaum standhält. Schon auf den ersten Blick<br />
wird erkennbar, dass sich das oben genannte Paradox auf neuer<br />
Ebene wiederholt. Im Medium Internet, das sich ganz und gar der<br />
Publizität verschrieben hat, ist ein erheblicher Teil der Nutzer anonym<br />
unterwegs. Für das, was man öffentlich macht, will man<br />
öffentlich nicht einstehen. Dafür mag es gute Gründe geben,<br />
wenn man in einer Diktatur lebt und die Inanspruchnahme von<br />
Freiheitsrechten Gefahr für Leib und Leben nach sich zieht. In einer<br />
Demokratie hingegen sieht die Sache anders aus. Hier muss<br />
man sich Freiheitsrechte nicht erkämpfen, hier sind sie verfassungsmäßig<br />
garantiert. Sie sind es deshalb, weil man im liberalen<br />
System davon ausgeht, dass die gewährleisteten Individualrechte<br />
auch von Individuen wahrgenommen werden. An anonyme<br />
Schwärme, wie sie sich im Internet bewegen, hatte man nicht unbedingt<br />
gedacht. (…)<br />
Wie demokratieverträglich ist das Internet überhaupt? Nicht nur<br />
die Anhänger der Piratenpartei sind der Ansicht, dass mit dem Internet<br />
eine neue Ära demokratischer Teilhabe eingeleitet wurde.<br />
Informationen in unvorstellbarem Umfang sind allen und jederzeit<br />
zugänglich, unüberschaubar viele Foren bieten die Möglichkeit<br />
zur Meinungsäußerung und Diskussion, organisierte Nutzer<br />
bilden eine Meinungsmacht, die das Handeln von Unternehmen,<br />
einzelnen Politikern und ganzen Regierungen massiv beeinflussen<br />
kann. Ist das nicht der Inbegriff des Demokratischen, die direkte<br />
Mitwirkung der Bürger auf allen denkbaren Ebenen? Und ist<br />
die Transparenz, die mit der Offenlegung selbst bisher völlig unzugänglicher<br />
Daten einhergeht, nicht ein Faktor, der ungemein<br />
demokratisierend wirkt?<br />
Schon der letzt genannte Zusammenhang ist mehr als zweifelhaft.<br />
Öffentlichmachen ist nicht identisch mit Transparenz. Denn<br />
transparent werden Daten nur dem, der sie versteht. Wer kann<br />
kompetent beurteilen, was von Wikileaks veröffentlichtes geheimdienstliches<br />
Material tatsächlich bedeutet – außer den geschulten<br />
Mitarbeitern der Geheimdienste? Wer weiß, was das von<br />
irgendjemandem ins Internet gestellte Bild zeigt, auf dem ein<br />
Kind zu sehen ist, das in Syrien zu Tode kam? Wurde es von der<br />
syrischen Armee als menschlicher Schutzschild missbraucht, ist<br />
es das Opfer eines Angriffs der Aufständischen, starb es durch einen<br />
Unfall? Mit Bildern und Daten kann man manipulieren, mit<br />
einer Überfülle veröffentlichter Bilder und Daten kann man desinformieren.<br />
Öffentlichkeit als solche ist ambivalent. Ihr Wert liegt allein im<br />
vernünftigen Gebrauch. (…) Im Internet findet nur der Orientierung,<br />
der sie in gewissem Umfang bereits mitbringt. Für alle anderen<br />
vergrößert der gigantische Umfang an Information und<br />
M 10 »Vor und nach Wikileaks …« © Klaus Stuttmann, 6.12.2010<br />
Desinformation, welche das Internet bietet, die Schwierigkeit,<br />
Brauchbares von Unbrauchbarem, Nützliches von Schädlichem zu<br />
sondern. (…) In der Politik sind die Entstehung und der Erfolg der<br />
Piratenpartei Zeichen eines Einstellungswandels. Damit ist nicht<br />
gemeint, dass eine Partei unter dem Namen einer Verbrechergruppe<br />
firmiert und damit großen Anklang findet, was als solches<br />
natürlich auch ein interessantes Phänomen ist.<br />
Gemeint ist der neue Politikstil, der mit der Piratenpartei Einzug<br />
in die Demokratie hielt: von der Repräsentation zur Präsenz. Mittels<br />
des Präsenzmediums Internet halten die Politiker der Piratenpartei<br />
einen fortwährenden Kontakt mit ihren Wählern, der die<br />
Grenzen zwischen Wählern und Gewählten verschwimmen lässt.<br />
Das personale Prinzip, das in der repräsentativen Demokratie mit<br />
gutem Grund die Wahl des Abgeordneten bestimmt, wird damit<br />
geradezu ausgehebelt: Der Abgeordnete ist das Sprachrohr seiner<br />
– immer wieder wechselnden – Basis, jedenfalls derjenigen,<br />
die gerade online ist. Wer in dieser Partei als Person besonders in<br />
Erscheinung tritt, bekommt den geballten Unmut der Nutzer zu<br />
spüren. Hier soll es nicht um Personen, sondern um Verfahren gehen,<br />
was dazu führt, dass die Inhalte genauso fluktuieren wie die<br />
Teilnehmer an dem Verfahren. (…)<br />
Zweifellos bietet das Internet große Chancen der Horizonterweiterung,<br />
des Gedankenaustauschs, ja sogar der Mitwirkung an der<br />
Überwindung autoritärer Regime. Doch ein per se demokratisches<br />
Medium ist es nicht – wenn denn die Demokratie als Herrschaft<br />
der Gleichen in besonderem Maße auf Unterscheidung und<br />
Struktur angewiesen ist. Nicht das Internet macht demokratisch,<br />
sondern nur ein Umgang mit ihm, der nach qualitativ gesicherten<br />
Maßstäben verfährt.<br />
Deshalb sollte demokratische Politik schon um der Selbsterhaltung<br />
des Systems willen in der Bildung ihre entscheidende Aufgabe<br />
sehen. In der Demokratie sind die Bürger die maßgebliche<br />
Ressource. Ihnen müssen per Bildung die Mittel an die Hand gegeben<br />
werden, sich auch in einer immer unübersichtlicher werdenden<br />
Welt, wie sie sich exemplarisch im Internet widerspiegelt,<br />
eigenständig Pfade durch das Dickicht zu schlagen.<br />
Das klassische Konzept der Öffentlichkeit setzte auf eine quasiautomatische<br />
Fortschrittsbewegung durch den öffentlichen Vernunftgebrauch.<br />
Doch Vernunft ist nichts Gegebenes, sie ist etwas<br />
immer wieder neu Hervorzubringendes. Und da die Vernunft<br />
nicht in den Institutionen liegt, nicht in der Öffentlichkeit und<br />
auch nicht in einem Medium wie dem Internet, bleibt nur eines:<br />
durch entsprechende Bildungsanstrengungen dafür zu sorgen,<br />
dass es Menschen gibt, die Vernunft in das hineintragen, was in<br />
sich zunächst einmal ohne Vernunft ist.<br />
© Barbara Zehnpfennig: Strukturlose Öffentlichkeit. Warum mehr Transparenz per Internet<br />
zu weniger Demokratie führen kann, FAZ, 21.1.2013, S. 7<br />
53<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Soziale Medien und das Partizipationsparadox
BÜRGERBETEILIGUNG IN DEUTSCHLAND UND EUROPA<br />
8. Wahlalter 16? »Nichts ist aktivierender<br />
als die Aktivität selbst«<br />
D&E-INTERVIEW MIT PROF. DR. KLAUS HURRELMANN ZUM »WAHLALTER MIT 16«<br />
54<br />
Klaus Hurrelmann ist seit 1979 Professor<br />
an der Universität Bielefeld. Seit<br />
seiner Emeritierung arbeitet er als Senior<br />
Professor of Public Health and Education<br />
an der Hertie School of Governance in Berlin.<br />
Er studierte Soziologie, Psychologie<br />
und Pädagogik an den Universitäten Freiburg,<br />
Berkeley (USA) und Münster und promovierte<br />
in der Sozialisationsforschung.<br />
1975 habilitierte er mit der Arbeit »Erziehungssystem<br />
und Gesellschaft«. 2003 erhielt<br />
er von der Schweizer Egnér-Stiftung<br />
einen hoch dotierten Preis für herausragende<br />
wissenschaftliche Forschungsarbeiten.<br />
Seine wichtigsten Arbeitsgebiete sind<br />
die Sozialisations- und Bildungsforschung<br />
mit den Schwerpunkten Familie, Kindheit,<br />
Jugend und Schule sowie die Gesundheitsund<br />
Präventionsforschung. In diesen Gebieten<br />
hat er eine Vielzahl von Aufsätzen<br />
und Büchern publiziert und herausgegeben, zuletzt das<br />
»Handbuch der Sozialisationsforschung« und das »Handbuch<br />
Gesundheitswissenschaften«. Zusammen mit seinen Lehrbüchern<br />
»Einführung in die Sozialisationstheorie«, »Gesundheitssoziologie«,<br />
»Lebensphase Jugend«, »Einführung in die<br />
Kindheitsforschung«, »Kinder stark machen für das Leben«,<br />
»Prävention und Gesundheitsförderung«, »Geschlecht, Gesundheit<br />
und Krankheit« und »Gewalt an Schulen« haben sie<br />
zusammen eine Auflage von 150.000 Exemplaren weit überschritten.<br />
Klaus Hurrelmann leitete zudem die letzten »Shell<br />
Jugendstudien« und »World Vision Kinderstudien«. Das Interview<br />
mit ihm führte Jürgen Kalb, verantwortlicher Redakteur<br />
von »D&E«, am 20.2.2013.<br />
Abb. 1 »Zeitreihe: Politisches Interesse Jugendlicher im Alter von 15 bis 24 Jahren«, Angaben in %<br />
© 16. Shellstudie, 2010, S. 131, TN Infratest Sozialforschung<br />
Das ist für mich das Hauptargument und auch das Hauptmotiv zu<br />
überlegen, ob das Alter »18« heute noch angemessen ist. Außerdem<br />
ist es ein Alter, das im historischen Rückblick schon mehrfach<br />
nach unten korrigiert wurde.<br />
»Man wird heute früher<br />
zu einem jungen Mann und<br />
zu einer jungen Frau.«<br />
D&E: Herr Prof. Hurrelmann, Sie treten seit Jahren für die Herabsetzung<br />
des Wahlalters für Jugendliche auf 16 ein, auch mit dem Argument, die<br />
Lebenssituation der Jugendlichen habe sich verändert. Hat sich in den<br />
letzten Jahrzehnten denn tatsächlich die Lebenssituation der Jugendlichen<br />
gravierend verändert?<br />
Hurrelmann: Das ist so, weil sich nämlich die Entwicklung beschleunigt<br />
hat. Man kann das am anschaulichsten sehen am Datum<br />
der Pubertät, d. h. der Geschlechtsreife. Das wandert im Lebenslauf<br />
immer weiter nach vorne. Bei den Mädchen ist das heute<br />
im Durchschnitt etwa mit 11 ½ Jahren anzusetzen, bei den Jungen<br />
mit 12 ½ Jahren.<br />
Und da merkt man Unterschiede im historischen Vergleich. Das<br />
war um 1900 rund 2 ½, ja manche Untersuchungen sagen sogar<br />
3 Jahre später. Und das war wahrscheinlich um 1800 noch einmal<br />
zwei oder drei Jahre später. Also da ist eine Beschleunigung der<br />
Entwicklung zu verzeichnen, die zunächst körperliche Dimensionen<br />
hat, aber sie bleibt ein komplexes Geschehen. Das bedeutet,<br />
es ist nicht nur eine körperliche Vorverlagerung, nicht nur die Geschlechtsreife,<br />
sondern wie immer schon ist sie verbunden mit<br />
einer Bewusstseinsveränderung, einer sozialen Einschätzungsveränderung,<br />
einer intellektuellen Entwicklung, die insgesamt<br />
bedeutet, man wird heute früher zu einem jungen Mann und zu<br />
einer jungen Frau. Und entsprechend dürfen wir das als das entscheidende<br />
Kriterium heranziehen, wenn wir dann überlegen,<br />
welche Kompetenzen wir Jugendlichen in dieser Altersspanne zusprechen<br />
können und welche Rechte sich daraus ableiten sollten.<br />
D&E: Können Sie mit Ihren Studien belegen, dass sich Jugendliche von<br />
16–17 Jahren ausgegrenzt fühlen, wenn sie noch nicht das aktive Wahlrecht<br />
besitzen?<br />
Hurrelmann: Das ist nach Ansicht der Jugendlichen selbst nicht<br />
der Fall. Wir machen seit 1996 regelmäßig Untersuchungen und<br />
Befragungen von Jugendlichen in dieser Altersgruppe, wie sie<br />
selbst zu dieser Entwicklung stehen. Und da zeigen z. B. die letzten<br />
Shell-Jugendstudien, dass die 12- bis 17-Jährigen selbst zurückhaltend<br />
sind. Da ist eine knappe Mehrheit sogar dagegen,<br />
dass sie so früh, wie sie meinen, in eine sehr anspruchsvolle politische<br />
Verantwortung gezogen werden.<br />
Wir fragen dann nach und dann stellt sich heraus, die haben wirklich<br />
ein unheimlich komplexes Bild davon, was es bedeutet, das<br />
Wahlrecht auszuüben. Sie glauben, sie müssten die Wahlprogramme<br />
der Parteien kennen, sie genau zu unterscheiden vermögen.<br />
Sie haben den Eindruck, sie müssten die Wahlmechanismen<br />
auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene genau kennen, dass<br />
sie wissen müssten, wie komplexe politische Prozesse funktionierten.<br />
Und das sei ihnen doch alles sehr, sehr fremd, ebenso wie<br />
die Parteien selbst, wie die Studien zeigen.<br />
Also ich denke, der Grund für die Zurückhaltung der Jugendlichen<br />
selbst liegt darin, dass sie sich dem politischen System gegenüber<br />
ziemlich entfremdet haben. Und das kann man nicht ihnen<br />
allein zuschreiben, sondern das liegt auch am politischen System.<br />
Sodass ich, obwohl ich ansonsten sehr auf die Stimmen der jungen<br />
Leute selbst höre, sonst bräuchten wir solche Untersuchun-<br />
Wahlalter 16? »Nichts ist aktivierender als die Aktivität selbst« D&E Heft 65 · 2013
gen nicht zu machen, in diesem Fall mit der<br />
Minderheit, also der etwa 30 % der Jugendlichen,<br />
dafür plädiere, dass sie dieses Wahlrecht<br />
ab 16 eingeräumt bekommen.<br />
D&E: Bedeutet das, dass Sie die Herabsetzung des<br />
Wahlalters als stärkere Motivation für die Bereitschaft<br />
der Jugendlichen betrachten, sich an der politischen<br />
Meinungs- und Willensbildung zu beteiligen?<br />
Hurrelmann: Ja, so dürfen wir das einschätzen.<br />
Denn nichts ist natürlich aktivierender<br />
als die Aktivität selbst. Wir haben das zuletzt<br />
sehr anschaulich gesehen bei der Bremer Bürgerschaftswahl. Da<br />
war zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung ein<br />
ganz interessantes Programm angesetzt worden, nämlich dass in<br />
den Schulen über die sogenannte »Juniorwahl«, manchmal auch<br />
»U-18-Wahl« genannt, schon vom Grundschulalter an, in den weiterführenden<br />
Schulen dann ganz systematisch »Wahlkampf« gemacht<br />
wurde. Da kamen die Kandidatinnen und Kandidaten in<br />
die Schulen. Und man durfte wählen, auch wenn man noch nicht<br />
das Wahlrecht hatte. Und für die, die dann das erste Mal mit 16 an<br />
der Wahl teilnehmen durften in Bremen, gab es dann besondere,<br />
systematische, spannend aufgebaute Unterrichtseinheiten. Und<br />
da konnte man jetzt sehen, dass die Bedenken der Jugendlichen<br />
selbst, dass sie überfordert sein könnten durch das früher eingeräumte<br />
Wahlrecht, plötzlich wie zerstoben waren. Da war die<br />
Wahlbeteiligung der jungen Leute auch ungeheuer hoch. Und<br />
auch nach der Wahl, soweit man das aus den Untersuchungen in<br />
Bremen ablesen konnte, blieb das auf einem hohen Beteiligungsund<br />
Interessenniveau. Das ist also eine wirklich wichtige Botschaft,<br />
dass durch das Beteiligen an einem Wahlvorgang und<br />
dann natürlich erst recht, wenn man ein förmliches Wahlrecht<br />
%-Angaben (Erhebungsjahr/<br />
Zeile)<br />
Fehlende zu 100 = Nie<br />
Ich bin aktiv für<br />
Eine sinnvolle Freizeitgestaltung<br />
von Jugendlichen<br />
Die Interessen von Jugendlichen<br />
Hilfebedürftige ältere Menschen<br />
Den Umwelt- oder Tierschutz<br />
Ein besseres Zusammenleben<br />
mit Migranten<br />
Ein besseres Zusammenleben<br />
am Wohnort<br />
Sicherheit und Ordnung am<br />
Wohnort<br />
Oft<br />
Abb. 2 »Aktivitäten nach Bereichen«, Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren, Angaben in %<br />
© 16. Shellstudie, 2010, S. 153, TN Infratest Sozialforschung<br />
Abb. 3 »Wählen mit 16?« Befragt wurden Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren, Angaben in %<br />
© 16. Shellstudie, 2010, S. 146, TN Infratest Sozialforschung<br />
2002 2006 2010<br />
Oft<br />
und einen Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments hat,<br />
dass dadurch auch ein richtiger Aktivitätsschub entsteht.<br />
»Die jungen Leute kritisieren,<br />
dass sich die etablierten<br />
Parteien einigeln.«<br />
Oft<br />
nahme. Aber auch das schwächt sich schon<br />
wieder deutlich ab.<br />
Die jungen Leute kritisieren, dass sich die<br />
etablierten Parteien einigeln, dass sie ihre<br />
Themen nicht transportieren, dass sie Ihnen<br />
so apparathaft erscheinen, als in sich geschlossene,<br />
funktionierende Systeme, die sie<br />
nicht von außen beeinflussen können. Sie<br />
wünschen sich also vielmehr Transparenz<br />
und viel mehr direkte Einflussmöglichkeiten.<br />
Man kann erkennen, dass gegenüber den<br />
etablierten Parteien eine Skepsis besteht.<br />
Aber zugleich kann man erkennen, dass sich<br />
junge Leute spontan politisch so stark betätigen,<br />
wie sie das schon vor 20 Jahren getan<br />
haben. Dies bedeutet z. B. an einer Demonstration<br />
teilnehmen, Unterschriftensammlungen<br />
machen, neuerdings auch immer stärker<br />
über das Internet an Aktivitäten teilnehmen,<br />
sich im sozialen Bereich engagieren. Das ist<br />
auf einem hohen Niveau geblieben. Und<br />
wenn wir das beides zusammenrechnen,<br />
dann ist das abgesunkene Interesse an der,<br />
ich sage mal, »formalen Demokratie«, bei<br />
gleichgebliebenem Interesse an der lebendigen,<br />
alltäglichen Demokratie und Politik,<br />
dann ist der Einbruch nicht so stark. Und es<br />
stimmt insgesamt nicht, dass die jungen<br />
Leute unpolitisch sind. Und es stimmt nicht,<br />
dass sie neben ihrer eindeutig genussvollen<br />
Umgangsform mit Medien und mit Freizeitaktivitäten<br />
– das gehört zu ihrem Lebensstil<br />
– nicht auch noch den Kopf frei haben für<br />
diesen politischen Bereich. Aber wie gesagt,<br />
schmal wird das Interesse im formalen politi-<br />
Gelegentlich<br />
Gelegentlich<br />
Gelegentlich<br />
13 35 13 31 15 33<br />
12 38 10 36 13 38<br />
8 35 8 34 10 37<br />
8 29 7 24 8 28<br />
8 25 6 22 8 25<br />
6 23 6 18 6 22<br />
6 20 6 16 6 20<br />
Behinderte Menschen 6 16 5 13 5 18<br />
Sozial schwache Menschen 5 29 5 29 7 32<br />
Menschen in den armen<br />
Ländern<br />
4 24 4 24 6 27<br />
Die Pflege der deutschen<br />
Kultur und Tradition<br />
4 17 3 15 6 17<br />
Soziale und politische<br />
2 15 2 14 3 17<br />
Veränderungen<br />
Sonstiges 5 25 7 24 7 25<br />
2002 2006 2010<br />
Spalten in % Unter 18 Ab 18 Unter 18 Ab 18 Unter 18 Ab 18<br />
Wählen mit 16<br />
Gute Idee 29 20 33 19 30 17<br />
Keine gute Idee 34 54 37 63 45 65<br />
Ist mir egal 36 25 30 18 24 18<br />
Keine Angabe 1 1 – – 1 –<br />
D&E: Und trotzdem behaupten Kritiker dieser Wahlrechtsreform immer<br />
wieder, dass gerade Jugendliche in der heutigen Zeit ganz besonders durch<br />
Medien und die Konsumgesellschaft geprägt, ja dadurch beeinflussbar,<br />
wenn nicht manipulierbar seien. Zu einer sachlichen politischen Urteilsbildung<br />
seien sie unter 18 Jahren kaum in der Lage.<br />
Hurrelmann: In dieser Form ist das ein Vorurteil. Es ist zwar richtig,<br />
dass die jungen Leute den etablierten Parteien gegenüber<br />
zurückhaltend sind. Einige Zeit sah es dann so aus, als mache die<br />
Partei der »Piraten« hier eine deutliche Aus-<br />
55<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Wahlalter 16? »Nichts ist aktivierender als die Aktivität selbst«
56<br />
D&E-INTERVIEW MIT PROF. DR. KLAUS HURRELMANN ZUM »WAHLALTER MIT 16«<br />
Abb. 4 »Wie und wo man (oft oder gelegentlich) gesellschaftlich aktiv ist, Jugendliche von 12–25 Jahren,<br />
Angaben in %<br />
© 16. Shellstudie, 2010, S. 156, TN Infratest Sozialforschung<br />
schen Sektor. Und wer da immer nur auf die jungen Leute schaut<br />
und sagt, die hätten kein politisches Interesse, der macht den<br />
Fehler zu übersehen, dass das ja beiderseitig ist, dass die Parteien<br />
ihrerseits sehr wenig Themen und Stil finden, um junge Leute anzusprechen.<br />
Und insofern, denke ich, müssen wir hier aufpassen,<br />
das ist ein grundsätzliches politisches Thema.<br />
D&E: Welche jugendaffine Themen ergeben denn Ihre Untersuchungen,<br />
die Jugendliche von sich aus, und nicht nur durch Politiker bedient, bevorzugen?<br />
Hurrelmann: Das ist natürlich sehr interessant. Hier liegen seit<br />
vielen Jahren ganz klare Untersuchungsergebnisse vor. Die jungen<br />
Leute interessieren sich für die großen Fragen. In den letzten<br />
10 Jahren standen deutlich wirtschaftliche Themen und berufliche<br />
Perspektiven im Vordergrund. Es geht ihnen um eine sichere<br />
Zukunft. Wenn sie die freie Wahl hätten, würden sie sich wünschen,<br />
wenigstens die Garantie zu haben, eine abgeschlossene<br />
Ausbildung zu bekommen und vielleicht auch für eine bestimmte<br />
Zeit den ersten Schritt in einem Beruf machen zu können.<br />
Es stehen bei ihnen dann an zweiter Stelle – das war bis vor zehn<br />
Jahren an erster Stelle und es bewegt sich auch wieder in diese<br />
Richtung – Umwelthemen, eine sichere, klimatisch intakte Welt,<br />
saubere Bedingungen für Essen und Trinken. Der Wunsch nach<br />
internationaler Abstimmungen spielt zudem eine große Rolle.<br />
Und das dritte große Thema sind internationale Konflikte, sind<br />
internationale Spannungen, also die Sicherung des Friedens. Das<br />
sind die drei großen Themenkomplexe, die junge Leute beschäftigen<br />
und danach kommen die etwas kleineren, alltäglicheren Probleme,<br />
von denen man denkt, diese würde ganz im Vordergrund<br />
stehen. Also z. B., wie sieht das Bildungssystem<br />
aus, wie gut sind die Schulen, wie sieht<br />
es mit guten Freizeitangeboten aus. Man<br />
kann auch hieraus erkennen, dass wir eine<br />
durchaus nicht unpolitische junge Generation<br />
haben. Aber sie fühlt sich insgesamt<br />
wohl, sie hat sich auch mit den demokratischen<br />
Strukturen eingerichtet. Man kann<br />
zwar kritisieren, dass sie diese nicht aktiv unterstützen<br />
mag, wie soeben besprochen,<br />
aber sie lebt mit ihnen, sie findet sie richtig<br />
und sie sieht keinen Grund zu einer politischen<br />
Auflehnung. Das muss man einfach so<br />
hinnehmen. Dies ist ja auch ein Kompliment<br />
an das politische Leben in der Bundesrepublik.<br />
D&E: Welche Rolle spielen denn die Elternhäuser<br />
bei der Herausbildung des politischen Interesses,<br />
aber auch bei der politischen Urteilsbildung Jugendlicher?<br />
Ist nicht die Gefahr gegeben, dass z. B.<br />
sogenannte bildungsferne Gruppen oder Gruppen<br />
mit Migrationshintergrund bei solchen Partizipationsansätzen<br />
kaum oder nur am Rande angesprochen<br />
werden?<br />
Hurrelmann: Ja, das ist der Fall. Der Bildungsgrad<br />
der Eltern und auch der Bildungsgrad<br />
der Jugendlichen selbst entscheidet<br />
ganz stark darüber, ob man sich und wie<br />
stark man sich für Politik interessiert. Je höher<br />
der Bildungsgrad, desto höher das Interesse,<br />
sich stärker politisch zu beteiligen. Da<br />
ist ein ganz deutlicher Zusammenhang zu<br />
verzeichnen. Und das zeigt uns eben auch,<br />
dass heute die politische Beteiligung an bestimmte<br />
Kompetenzen gebunden ist. Das ist<br />
in einem komplexer gewordenen politischen<br />
System mit komplizierten Themen, internationalen<br />
Verflechtungen, in dem man merkt,<br />
dass auch manche Spitzenpolitiker die Übersicht<br />
nicht behalten können, auch nicht verwunderlich. Und dies<br />
ist natürlich auch bei jungen Leuten der Fall. Das könnte mit ein<br />
Grund dafür sein, dass zurückhaltend gegenüber der organisierten<br />
Politik agiert wird. Wir müssen das, glaube ich, sehr ernst<br />
nehmen.<br />
Das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, je mehr wir in Bildung<br />
investieren, desto höher wird die Chance, dass wir politisch<br />
sensible und engagierte junge Leute haben werden.<br />
»Es wäre ganz wichtig,<br />
dass in der Schule Themen<br />
aufgenommen werden, die<br />
die jungen Leute beschäftigen.«<br />
D&E: Können Sie daraus Forderungen an schulische Bildung ableiten?<br />
Wie müsste Schule aussehen, damit z. B. die oben beschriebenen Differenzen<br />
aus den Elternhäusern ausgeglichen werden?<br />
Hurrelmann: Es wäre ganz wichtig, dass in der Schule die Themen<br />
aufgenommen werden, die die jungen Leute beschäftigen. Ich<br />
halte es nicht für begründbar, dass heute, in Zeiten nicht nur einer<br />
Berufskrise, die, wie es aussieht, ja langsam in Deutschland abklingt,<br />
sondern auch in Zeiten einer weltweiten Wirtschafts- und<br />
Finanzkrise, die immer noch nicht bewältigt ist, dass diese the-<br />
Wahlalter 16? »Nichts ist aktivierender als die Aktivität selbst«<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
matischen Felder in der Schule eine untergeordnete, wenn nicht<br />
manchmal sogar gar keine Rolle spielen. Es ist unverständlich,<br />
dass ein Fach Wirtschaft, wie auch immer zugeschnitten, nur an<br />
wenigen Schulen angeboten wird. Im Fach Politik, im Fach Sozialoder<br />
Gemeinschaftskunde, wird häufig diese Thematik zwar hin<br />
und da, aber selten systematisch bearbeitet.<br />
D&E: Die 16 Bundesländer in der Bundesrepublik setzen mit der politischen<br />
und ökonomischen Bildung oft recht unterschiedlich ein. Was würden<br />
Sie denn den Bildungsplanreformern raten? An wann sollte die politische<br />
Bildung beginnen?<br />
Hurrelmann: Es ist auf alle Fälle nicht klug, spät zu beginnen.<br />
Denn, auch das zeigen Kinder- und Jugendstudien, das politische<br />
Interesse in einer intuitiven und auf das soziale Umfeld bezogenen<br />
Weise – nicht gleich als Parteipolitik – das beginnt sehr früh,<br />
es beginnt bereits im Grundschulalter. Und entsprechend sollte<br />
schon in der Grundschule – und dann aber sofort auf den weiterführenden<br />
Schulen in einer systematischen pädagogischen Art<br />
und Weise politischer Unterricht in den Schulen charakteristisch<br />
sein. Es sollte aber nicht nur der politische Unterricht wichtig<br />
sein, der die Themen aufnimmt, die die jungen Leute interessiert,<br />
wie z. B. das Umweltthema, die internationalen Spannungen, Medien<br />
spielen eine wichtige Rolle. Es ist das gesamte Unterrichtsgeschehen,<br />
es ist das gesamte Schulleben, das von den Schülerinnen<br />
und Schülern als gestaltbar, beeinflussbar, aber auch in ihrer<br />
Verantwortung liegend wahrgenommen werden muss.<br />
Hier haben inzwischen viele Schulen tolle Ansätze gemacht. Das<br />
sollten wir verbreitern, damit die Schule selbst quasi als ein Feld<br />
für die Alltagsgestaltung erlebt wird, um den Schülerinnen und<br />
Schüler die Möglichkeit zu bieten, gezielt mit sozialer Verantwortung,<br />
Teilhabe an den sozialen Regeln, an den Umgangsformen,<br />
an den Stilen, dann aber auch an der Unterrichtsorganisation und<br />
an bestimmten Unterrichtsabfolgen und dergleichen mitzuwirken.<br />
D&E: Wenn wir die Situation der politischen Bildung in Deutschland mit<br />
der Situation in anderen europäischen oder außereuropäischen Ländern<br />
vergleichen, wo steht Deutschland in diesem Bereich?<br />
Hurrelmann: Insgesamt recht gut. Also wir können uns im internationalen<br />
Vergleich sehen lassen. Wenn die oben angesprochen<br />
Punkte systematischer in den politischen, aber, wie gesagt, auch<br />
in den gesamten Unterricht und das Schulleben einbezogen werden,<br />
dann würden wir noch besser dastehen. Es gibt inzwischen,<br />
etwa nach dem Pisa-Modell, auch international vergleichende<br />
Studien, die versuchen herauszuarbeiten, wie in Europa oder den<br />
hoch entwickelten Ländern die politischen Kompetenzen und Fähigkeiten<br />
der jungen Leute beschaffen sind. Und da sieht man,<br />
Deutschland steht nicht schlecht da, wir müssten aber als ein<br />
ökonomisch so hoch entwickeltes Land da noch ein paar Stufen<br />
klettern können.<br />
Abb. 5 »Juniorwahl.de«. Die bundesweite Initiative Juniorwahl ist eine Initiative<br />
des Kumulus e. V. – Der Kumulus e. V. ist ein gemeinnütziger und überparteilicher<br />
eingetragener Verein. Seit 1999 führt er in Zusammenarbeit mit zumeist<br />
Kultusministerien simulative Wahlen parallel zu offiziellen Wahlen an Schulen<br />
für Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren durch. Bei der Bundestagswahl<br />
2009 beteiligten sich insgesamt 1.043 Schulen und 246.616 Schülerinnen und<br />
Schüler, womit die Juniorwahl zu den größten Schulprojekten in Deutschland<br />
zählt. Im Jahr 2013 parallel zur Bundestagswahl sollen es bundesweit 5.000<br />
Schulen und damit 25 Prozent aller weiterführenden Schulen in Deutschland werden.<br />
© www.Juniorwahl.de<br />
D&E: Zurück zu unserer Ausgangsfrage. Welche Impulse erhoffen Sie sich<br />
aus der beabsichtigten Herabsetzung des aktiven Wahlrechts auf 16 Jahre<br />
in diesem Prozess.<br />
Hurrelmann: Abschließend könnte man sagen, eine Herabsetzung<br />
des Wahlalters kann dadurch begründet werden, dass man<br />
sieht, man kann im Alter von 16 Jahren heute einschätzen, was es<br />
bedeutet, eine Stimme abzugeben. Man hat in diesem Alter die<br />
intellektuelle, aber auch die soziale Urteilsfähigkeit. Das halte ich<br />
für das entscheidende Argument. Da bedeutet nicht etwa die allgemeine<br />
Reife, wie oft gesagt wird. Die wird ja auch bei anderen<br />
Menschen, die vielleicht psychische Probleme haben, nicht eingefordert.<br />
In einer Demokratie entscheidet das Volk. Und jede<br />
Gruppe der Bevölkerung, die wir ausgrenzen, gehört dann nicht<br />
dazu. Dies muss sehr sorgfältig begründet und immer wieder neu<br />
überprüft werden. Und das spricht eben dafür, dass wir überprüfen,<br />
wenn sich junge Leute verändern in ihrem Verhalten und in<br />
ihrer ganzen Entwicklung, wie es nun mit dem Mindestwahlalter<br />
ist.<br />
Literaturhinweise<br />
Hurrelmann, Klaus/Quenzel, Gudrun (2012, 11. Auflage): Lebensphase<br />
Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung.<br />
Beltz Juventa. Weinheim, München<br />
Shell Deutschland Holding (Hrsg.)(2010): Jugend 2010. Eine pragmatische<br />
Generation behauptet sich. Konzeption & Koordination: Albert, Mathias/<br />
Hurrelmann, Klaus, u. a. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt/Main.<br />
Für 2016 plant die IEA (International Association for the Assessment of Educational<br />
Achievement) eine internationale Studie zu politischen Einstellungen<br />
und Kompetenzen bei Jugendlichen (ICCS 2016). Erste Informationen<br />
dazu unter: www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Studies/ICCS_2016_<br />
Brochure.pdf<br />
57<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Wahlalter 16? »Nichts ist aktivierender als die Aktivität selbst«
BÜRGERBETEILIGUNG IN DEUTSCHLAND UND EUROPA<br />
9. »Wahlalter 16« – eine Chance zur Überwindung<br />
der Politikverdrossenheit?<br />
D&E-INTERVIEW MIT DR. JAN KERCHER, UNIVERSITÄT STUTTGART-HOHENHEIM<br />
58<br />
Bei den Kommunalwahlen 2014 sollen in Baden-<br />
Württemberg erstmals 16- und 17-Jährige<br />
wählen können. Die grün-rote Landesregierung in<br />
Baden-Württemberg hat nach Auskunft des Ministerpräsidenten<br />
Kretschmann (Grüne) am 6.11.2012<br />
eine Senkung des Mindestwahlalters bei Kommunalwahlen<br />
von 18 auf 16 Jahre beschlossen. Laut Innenminister<br />
Reinhold Gall (SPD) können nach Inkrafttreten<br />
der Gesetzesänderungen in zwei<br />
Jahren 212.000 Jugendliche erstmals über die Besetzung<br />
von Gemeinderäten oder Kreistagen abstimmen.<br />
Kretschmann sagte, durch die Senkung<br />
des Wahlalters bekämen Jugendliche künftig mehr<br />
Einfluss auf die Gestaltung ihres unmittelbaren<br />
Lebensumfeldes. Die Grünen und die SPD setzen<br />
damit eines ihrer Wahlziele um, wie zuvor schon in<br />
sechs anderen Bundesländern. In Bremen konnte<br />
die Ökopartei vor zwei Jahren eine entsprechende<br />
Wahlrechtsreform sogar für die Wahl zur Bürgerschaft<br />
durchsetzen. Am 22. Mai 2011 durften deshalb<br />
in Bremen zum ersten Mal auch 16- und 17-Jährige<br />
an einer Wahl auf Landesebene teilnehmen.<br />
Eine Senkung des Wahlalters auf Bundesebene, die<br />
ebenfalls von den Grünen beantragt worden war,<br />
scheiterte dagegen schon zweimal an der Mehrheit<br />
des Bundestages, zuletzt am 2. Juli 2009. Jürgen<br />
Kalb, Chefredakteur von D&E, befragte dazu<br />
im Januar 2013 den Kommunikationswissenschaftler<br />
Dr. Jan Kercher von der Universität Stuttgart-Hohenheim,<br />
der sich bereits mit dem Thema in verschiedenen wissenschaftlichen<br />
Studien beschäftigt hat.<br />
10<br />
0<br />
5,6<br />
n.s.**<br />
Persönl. Bedeutung<br />
von Politik<br />
Ergebnisse: Politisches Interesse (0–10)<br />
5,9<br />
5,1 5,2<br />
n.s.**<br />
Informationsorientierte<br />
Mediennutzung<br />
Gespräche<br />
über Politik<br />
Unter 18<br />
18 und älter<br />
D&E: In Baden-Württemberg hat die grün-rote Landesregierung die Herabsetzung<br />
des aktiven Wahlalters für die Kommunalwahl 2014 auf 16<br />
Jahren in Gang gebracht. In Österreich gilt diese Regelung auch bei Nationalratswahlen<br />
seit 2008. Andere Bundesländer in Deutschland wie z. B.<br />
Bremen, NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Rheinland- Pfalz<br />
kennen diese Regelung ebenfalls. Sehen Sie persönlich darin eine Möglichkeit,<br />
junge Menschen näher an das parlamentarische System heranzuführen?<br />
Jan Kercher: Potenziell ja. Allerdings<br />
sollte man bei der Einführung solcher<br />
Regelungen sehr bedacht und keinesfalls<br />
überstürzt vorgehen. Sonst fühlen<br />
sich viele Jugendliche überfordert<br />
von der neuen Verantwortung. Das<br />
war zum Beispiel in Österreich so.<br />
In einer Studie, die anlässlich der<br />
Wahlalter senkung dort durchgeführt<br />
wurde, stellte sich heraus, dass die Jugendlichen<br />
von der Schule erwarten, auf ihr Wahlrecht vorbereitet<br />
zu werden. Denn die Schule wurde von den befragten Jugendlichen<br />
als ein Ort für eine sachliche Informationsvermittlung<br />
wahrgenommen. Gleichzeitig stellte sich jedoch heraus, dass die<br />
Jugendlichen nicht zufrieden waren mit der schulischen Vorbereitung<br />
auf ihre erste Wahlteilnahme, weil das Thema zu wenig oder<br />
zu spät im Unterricht behandelt wurde. Es zeigte sich auch, dass<br />
damit eine wichtige Chance vertan wurde, denn Schülerinnen und<br />
Schüler, die im Unterricht über die Wahl diskutiert hatten, gingen<br />
signifikant häufiger zur Wahl als andere Schülerinnen und Schüler.<br />
Für mich ergibt sich als Fazit aus diesen Befunden, dass man<br />
einer Wahlaltersenkung eine entsprechende Änderung der Bildungspläne<br />
voranstellen sollte. Damit diejenigen Jugendlichen,<br />
die es betrifft, dann auch schon in den Genuss einer entsprechenden<br />
schulischen Vorbereitung gekommen sind, wenn sie ihr Wahlrecht<br />
erlangen. Leider habe ich den Eindruck, dass diesem Vorbereitungsaspekt<br />
von der Politik häufig zu wenig Aufmerksamkeit<br />
geschenkt wird, vermutlich auch, weil er mit sehr viel mehr Aufwand<br />
verbunden ist als eine einfache Gesetzesänderung zum<br />
Wahlalter. Das führt dann zu einem Ergebnis wie in Österreich, wo<br />
der SPÖ-Politiker Walter Steidl nach der Wahl zugab, dass man<br />
die Vorbereitung der Jugendlichen verschlafen habe. Wenn man in<br />
Deutschland aus diesen Fehlern lernt<br />
und die Jugendlichen umfassend vorbereitet,<br />
dann sehe ich eine Wahlaltersenkung<br />
allerdings durchaus als<br />
Chance an, jugendliche Menschen an<br />
politische Themen heranzuführen.<br />
Denn wenn einem durch die Schule<br />
vermittelt wird, wie wichtig politische<br />
Teilhabe ist und man dann auch noch<br />
während seiner Schulzeit das Wahlrecht<br />
erlangt, dann ist das bestimmt eine gute Grundlage für eine<br />
positiv geprägte politische Sozialisation.<br />
D&E: Sie haben das Politikverständnis, d. h. das politische Interesse, das<br />
politische Wissen sowie die Fähigkeit junger Menschen, politische Zusammenhänge<br />
in Politikerreden zu erfassen, bei unter 18- sowie über 18-jährigen<br />
empirisch untersucht und analysiert. Was ist denn eine »Experimentalanalyse«<br />
eigentlich genau und warum haben Sie diese durchgeführt?<br />
Jan Kercher: Eine Experimentaluntersuchung ist eine Untersuchung,<br />
bei der die Versuchsbedingungen gezielt manipuliert oder<br />
8,8<br />
n.s.**<br />
N = 134 N = 134 N = 134<br />
Abb. 1 Politikverständnis und Wahlalter, Studie Jan Kercher.<br />
Interesse = Durchschnittliche Selbsteinstufung der Teilnehmer auf einer Skala von 0 bis 10<br />
(Wichtigkeit von Politik für das eigene Leben, Häufigkeit der Mediennutzung als politische<br />
Informationsquelle, Häufigkeit von Gesprächen über Politik).<br />
** sig. = Gruppenunterschiede sind statistisch signifikant, n. s. = nicht signifikant<br />
© Jan Kercher: Politikverständnis und Wahlalter<br />
»Schüler erwarten von der<br />
Schule, auf ihr Wahlrecht<br />
vorbereitet zu werden.«<br />
5,5<br />
»Wahlalter 16« – eine Chance zur Überwindung der Politikverdrossenheit? D&E Heft 65 · 2013
kontrolliert werden, um ihren Einfluss besser<br />
untersuchen zu können als in einer natürlichen<br />
Situation, bei der immer sehr viele Störfaktoren<br />
vorhanden sind. Wenn sich Menschen<br />
z. B. zu Hause eine politische Talk-Show<br />
anschauen, dann sind sie vielleicht abgelenkt,<br />
weil nebenher jemand redet. Wenn<br />
man ihnen dann Verständnisfragen zur Talkshow<br />
stellen würde, dann würden sie vermutlich<br />
ziemlich schlecht abschneiden. Das muss<br />
aber nicht daran gelegen haben, dass sie die<br />
Politiker wirklich nicht verstehen konnten,<br />
sondern vielleicht einfach nur daran, dass sie<br />
abgelenkt wurden. Deshalb kontrolliert man<br />
die Versuchsbedingungen in einem Experiment<br />
und sorgt zum Beispiel dafür, dass solche<br />
Ablenkungsfaktoren nicht vorhanden<br />
sind. Wenn dann immer noch Verständnisprobleme<br />
auftreten, dann ist es sehr wahrscheinlich,<br />
dass diese wirklich dadurch zu<br />
erklären sind, dass sich die Politiker nicht<br />
verständlich genug ausdrücken. Oder dadurch,<br />
dass die Zuschauer zu wenig Vorwissen<br />
haben, das kommt auf den Standpunkt<br />
an. Das ist im Übrigen ein grundlegendes<br />
14,7<br />
67,2<br />
16,9<br />
Problem beim Thema Politik und Verständlichkeit: Wem gibt man<br />
die Schuld, wenn man auf Verständnisprobleme trifft? Den Bürgern,<br />
die zu wenig Vorwissen haben oder den Politikern, die sich<br />
nicht verständlich genug ausdrücken? Die Bürger selbst neigen<br />
natürlich dazu, den Politikern die Schuld zu geben, während diese<br />
häufig das Gefühl haben, sich gar nicht anders ausdrücken zu<br />
können, ohne das Thema zu stark zu vereinfachen. Das nennt<br />
man übrigens den »Fluch des Wissens«. Wenn man sehr viel über<br />
ein Thema gelernt hat und dieses Wissen auch schon eine ganze<br />
Weile besitzt, dann wird es immer schwieriger, sich noch in andere<br />
Leute hinein zu versetzen, die nicht dasselbe Vorwissen haben.<br />
In der Sprache führt das dann dazu, dass schwierige Wörter<br />
nicht mehr als solche wahrgenommen<br />
werden. Das ist aber ein ganz<br />
natürlicher Prozess und passiert<br />
nicht nur Politikern, sondern zum<br />
Beispiel auch Wissenschaftlern<br />
oder sonstigen Experten. Besonders<br />
problematisch ist das dann,<br />
wenn man nicht direkt mit den eigentlichen<br />
Adressaten der eigenen<br />
Botschaften konfrontiert ist, wie<br />
eben in einer Talkshow. Da richten sich die Teilnehmer ja eigentlich<br />
an die Fernsehzuschauer, nicht an die anderen Gäste. Aber<br />
von den Fernsehzuschauern kann ja niemand nachfragen, wenn<br />
er oder sie etwas nicht versteht. Allerdings: Das trauen sich viele<br />
auch dann nicht, wenn der Politiker oder die Politikerin direkt vor<br />
einem steht. Man will dann eben lieber nicht zugeben, dass einem<br />
viele Begriffe nicht geläufig sind und ärgert sich doch gleichzeitig<br />
über den abgehobenen Sprachstil des Politikers.<br />
D&E: Wie sah Ihre Untersuchung denn genau aus und zu welchen Ergebnissen<br />
sind Sie darin gekommen?<br />
Jan Kercher: Wir haben 134 junge Stuttgarterinnen und Stuttgarter<br />
im Alter von 16 bis 21 Jahren befragt und sie mit kurzen Politiker-Reden<br />
konfrontiert. Das waren etwa fünfminütige Video-Podcasts<br />
von Angela Merkel, Kurt Beck, Guido Westerwelle und<br />
Oskar Lafontaine. Vor dem Anschauen der Videos haben wir das<br />
politische Interesse und Wissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
erfasst. Und nach dem Anschauen jedes Videos haben wir sie<br />
dann gefragt, wie verständlich sie die Podcasts subjektiv fanden<br />
und ihnen auch noch Verständnisfragen zu den Inhalten der Videos<br />
gestellt. Dabei haben wir auch erfasst, wie sicher sich die<br />
Befragten bei ihren Antworten waren. Entscheidend war, dass wir<br />
10,7<br />
62,1<br />
26,1<br />
8,4<br />
47,7<br />
42,9<br />
2,7<br />
35,5<br />
61,5<br />
14 Jahre 15 Jahre 16 Jahre 17 Jahre 18 Jahre<br />
bis 25%<br />
25%–50%<br />
50%–75%<br />
über 75%<br />
1.714 Befragte<br />
Abb. 2 Politisches Wissen von Jugendlichen, Rheinland-Pfalz 2005<br />
© Jens Tenscher/Philipp Scherer (2012): Jugend, Politik und Medien.<br />
Politische Orientierungen und Verhaltensweisen von Jugendlichen<br />
in Rheinland-Pfalz. Münster, S. 86<br />
»Einer Wahlaltersenkung<br />
sollte man eine Änderung der<br />
Bildungspläne voranstellen.«<br />
17,7<br />
77,8<br />
bei der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezielt unterschiedliche<br />
Bildungsgrade und Altersstufen abgedeckt haben.<br />
Zum einen haben wir 16- und 17-jährige Neuntklässler auf der<br />
Hauptschule und im Gymnasium befragt. Und zum anderen 18-<br />
bis 21-jährige Berufsschüler und Studienanfänger.<br />
Betrachtet man unsere Ergebnisse, so stellt sich heraus, dass das<br />
Alter tatsächlich einen deutlichen Einfluss auf das Abschneiden<br />
der Befragten bei den Wissens- und Verständnisfragen hatte. Und<br />
zwar unabhängig vom Bildungsgrad. Sowohl die volljährigen Berufsschüler<br />
als auch die Studienanfänger schnitten sehr viel besser<br />
ab als die Neuntklässler in der Hauptschule und auf dem Gymnasium.<br />
Das ist unserer Interpretation nach eine Folge der<br />
bisherigen Bildungspläne in Baden-<br />
Württemberg, die den Großteil der<br />
politischen Bildung erst in den höheren<br />
Schulstufen vorsehen und<br />
nicht schon vor Erreichen des 16.<br />
Lebensjahres. Mit anderen Worten:<br />
Sie sind offensichtlich ausgerichtet<br />
auf ein Wahlrecht ab 18, das ja bislang<br />
in Baden-Württemberg auch<br />
so gilt. Interessant war für uns aber<br />
auch, dass es beim politischen Interesse zwischen den älteren<br />
und den jüngeren Befragten kaum Unterschiede gab. Die Jüngeren<br />
interessierten sich also fast genauso stark für Politik wie die<br />
Älteren. Das bedeutet, dass sich die 16- und 17-Jährigen durchaus<br />
für Politik interessieren, aber bislang offensichtlich deutlich weniger<br />
von Politik verstehen als volljährige Schüler und Studienanfänger.<br />
D&E: Können Sie aus den Ergebnissen Ihrer Studie auch Konsequenzen<br />
für die politische Bildung junger Menschen sowie für die Bildungspläne<br />
der Schulen ableiten?<br />
Jan Kercher: Ja. An unseren Ergebnissen lässt sich ja recht deutlich<br />
der Effekt der bisherigen Bildungspläne in Baden-Württemberg<br />
ablesen. Da liegt die Vermutung sehr nahe, dass ein Vorziehen<br />
der politischen Bildung in den Schulen – und zwar in allen<br />
weiterführenden Schulen – dazu führen würde, dass sich die Altersunterschiede,<br />
die wir in unserer Studie feststellen konnten,<br />
deutlich verringern würden. Auf diese Weise könnte man eine<br />
Überforderung vieler Jugendlicher, wie man sie in Österreich beobachten<br />
konnte, vermutlich vermeiden. Ich finde, dass man das<br />
Ganze recht gut mit der Diskussion über die Einführung des Euro<br />
vergleichen kann. Damals gab es zwei Lager, die Anhänger der so-<br />
2,9<br />
59<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
»Wahlalter 16« – eine Chance zur Überwindung der Politikverdrossenheit?
60<br />
D&E-INTERVIEW MIT DR. JAN KERCHER, UNIVERSITÄT STUTTGART-HOHENHEIM<br />
Abb. 3<br />
24<br />
24<br />
11<br />
21<br />
10<br />
1<br />
24 23 23<br />
16-jährige<br />
Befragte<br />
23<br />
23<br />
15<br />
21<br />
17-jährige<br />
Befragte<br />
genannten »Lokomotiv-Theorie« und die Anhänger der »Kronen-<br />
Theorie«. Die Anhänger der Lokomotiv-Theorie, die sich letztlich<br />
auch durchgesetzt haben, argumentierten, dass der Euro die finanzpolitische<br />
Integration Europas unterstützen und beschleunigen<br />
würde und deshalb ein wichtiger erster Schritt hierfür sei.<br />
Dem hielten die Anhänger der Kronen-Theorie entgegen, dass es<br />
unverantwortlich sei, eine gemeinsame Währung einzuführen,<br />
bevor die Finanzpolitik der Europäischen Union nicht stärker vereinheitlicht<br />
sei. Blickt man heute zurück und betrachtet die<br />
Schulden-Krise, mit der wir es gerade zu tun haben, dann wirkt es,<br />
als hätten die Anhänger der Kronen-Theorie vielleicht doch Recht<br />
gehabt. Und aus meiner Sicht gibt<br />
es viele gute Gründe, auch bei der<br />
Wahlaltersenkung eine Kronen-<br />
Strategie zu wählen. Das heißt: Erst<br />
die Änderung der Bildungspläne,<br />
dann die Wahlaltersenkung. Nicht<br />
andersherum.<br />
3<br />
18-jährige<br />
Befragte<br />
29,3<br />
10,4<br />
17,5<br />
10,7<br />
6,1<br />
Wahlergebnis<br />
D&E: Seit einigen Jahren organisiert der<br />
Berliner Verein »Kumulus e. V.«, zum Teil<br />
mit großer Unterstützung der jeweiligen<br />
Kultusbürokratie vor zentralen Europa-,<br />
Bundestags- oder Landtagswahlen mit der »Juniorwahl« Wahlsimulationen<br />
vor dem tatsächlichen Wahlgang. Reichen solche oder andere<br />
Initiativen nicht völlig aus, muss es gleich die Herabsenkung des Wahlalters<br />
auf 16, oder wie der Bundes- sowie zahlreiche Landesjugendringe fordern,<br />
gar auf 14 Jahre sein?<br />
Jan Kercher: Das ist letztlich eine Frage, die die Politik entscheiden<br />
muss, nicht die Wissenschaft. Wir als Wissenschaftler können<br />
nur darauf hinweisen, dass es aktuell deutliche Wissens- und Verständnisunterschiede<br />
zwischen heutigen Erstwählern und potenziellen<br />
zukünftigen Erstwählern gibt. Gleichzeitig aber kaum Unterschiede<br />
beim politischen Interesse.<br />
Ich persönlich bin der Meinung, dass jedes Wahlalter letztlich<br />
willkürlich ist. Ob nun 18 Jahre, 16 Jahre, 14 Jahre, 12 Jahre oder<br />
vielleicht sogar 0 Jahre, wie es die Grüne Jugend fordert: Niemand<br />
kann sagen, was »objektiv« das richtige Wahlalter ist. Das muss<br />
man gesellschaftlich diskutieren und dann so festlegen, wie es<br />
die Mehrheit nach dem Austausch aller relevanten Argumente für<br />
sinnvoll hält. Früher lag das Wahlalter ja mal bei 21 Jahren. Dann<br />
kam Willy Brandt und überzeugte die Deutschen, dass es sinnvoll<br />
sei, »mehr Demokratie zu wagen«. Daraufhin wurde das Wahlalter<br />
auf 18 Jahre gesenkt, erst das aktive Wahlalter und dann auch das<br />
17<br />
17<br />
17<br />
12<br />
6<br />
5<br />
Nationalratswahl in Österreich: Wahlverhalten nach Alter<br />
© Sora-Studie »Wählen mit 16« – Eine Post Election Study zur Nationalratswahl 2008<br />
26<br />
»Eine Wahlaltersenkung<br />
bietet die Chance, jugendliche<br />
Menschen an politische<br />
Themen heranzuführen.«<br />
passive Wahlalter. Aktuell beobachten wir<br />
eine ähnliche Entwicklung hin zum Wahlalter<br />
ab 16. Allerdings hat sich bislang kein ähnlich<br />
prominenter und einflussreicher Bundespolitiker<br />
wie damals Willy Brandt für solch eine<br />
Wahlaltersenkung ausgesprochen. Und deshalb<br />
dauert das Ganze deutlich länger als da-<br />
SPÖ<br />
ÖVP<br />
mals. Außerdem betrifft die Diskussion bislang<br />
auch kaum die Bundesebene, sondern<br />
Grüne<br />
FPÖ<br />
vor allem die Landes- und Kommunalebene.<br />
Die Grünen haben zwar auch schon entsprechende<br />
Gesetzesentwürfe in den Bundestag<br />
BZÖ<br />
Sonstige<br />
eingebracht, aber die sind bislang sehr klar<br />
keine Angabe<br />
gescheitert, weil sie von fast allen anderen<br />
Parteien abgelehnt wurden. Was mich wundert,<br />
ist, dass bislang – anders als zur Zeit<br />
von Willy Brandt – kaum über eine Senkung<br />
des passiven Wahlalters gesprochen wird.<br />
Das bedeutet, dass jemand mit 16 Jahren<br />
zwar in der Lage sein soll, eine Partei zu wählen,<br />
aber noch nicht in der Lage sein soll, als<br />
Kandidat für eine Partei anzutreten. Das<br />
kann man ja durchaus so richtig finden. Nur<br />
sollte man das dann auch entsprechend diskutieren<br />
und begründen. Und das kommt mir<br />
in der aktuellen Diskussion zu kurz.<br />
Aber um noch einmal auf Ihre Frage zurückzukommen: Juniorwahlen<br />
sind natürlich eine sehr gute Möglichkeit der Vorbereitung<br />
auf das »echte« Wahlrecht. Aber sie werden natürlich immer<br />
eine Simulation sein und haben letztlich keinen Einfluss auf die<br />
Zusammensetzung der Parlamente. Bestimmt kann man auch auf<br />
diese Weise Jugendliche für Politik begeistern. Aber das zentrale<br />
Argument der Befürworter einer Wahlaltersenkung lautet ja gerade,<br />
dass nur ein echtes Wahlrecht eine Verantwortung mit sich<br />
bringt, die dann auch zu einer größeren Relevanz der Politik im<br />
Alltag der Jugendlichen führt. Deshalb würde ich Juniorwahlen<br />
und Wahlaltersenkung nicht als Alternativen<br />
sehen, sondern eher als<br />
zwei Ansätze, die sich gegenseitig<br />
gut ergänzen können: Denn Juniorwahlen<br />
könnten ja gerade für 14-<br />
und 15-Jährige eine gute Vorbereitung<br />
auf ein Wahlrecht ab 16 sein.<br />
D&E: In Rheinland-Pfalz gab es detaillierte<br />
Schülerbefragungen zum Thema<br />
Wahlalter mit 16, die in dem Band »Jugend,<br />
Politik und Medien« von Jens Tenscher<br />
und Philipp Scherer 2012 veröffentlicht wurden. Was sind Ihrer Meinung<br />
nach die zentralen Befunde der Befragung und was ziehen Sie<br />
daraus für Schlüsse?<br />
Jan Kercher: Die Befragungen bestätigten zunächst einmal einen<br />
Befund, den wir schon bei vielen anderen Wahl-Umfragen mit Jugendlichen<br />
oder Juniorwahlen beobachten konnten: Jugendliche<br />
tendieren häufiger zu den Grünen und leider auch häufiger zu<br />
rechtsradikalen Parteien als ältere Wählerinnen und Wähler. So<br />
lag der Anteil derjenigen, die eine Wahlpräferenz für DVU, Republikaner<br />
oder NPD äußerten, bei den 14- bis 18-jährigen Befragten<br />
bei insgesamt 5,3 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2005, die<br />
etwa zeitgleich stattfand, lag der Anteil dieser drei Parteien zusammengenommen<br />
jedoch nur bei 2,4 Prozent. Also weniger als<br />
halb so hoch.<br />
Was sich ebenfalls bestätigte, waren die großen Wissensunterschiede<br />
zwischen den verschiedenen Altersgruppen. So stieg das<br />
politische Wissen in den Befragungen von Jens Tenscher und Philipp<br />
Scherer zwischen 14 und 18 Jahren jedes Jahr deutlich an. Der<br />
größte Sprung beim Wissen lag jedoch zwischen dem 15. und dem<br />
16. Lebensjahr. Das könnte man aus Sicht der Befürworter einer<br />
Wahlaltersenkung als Zeichen dafür interpretieren, dass 16 mög-<br />
»Wahlalter 16« – eine Chance zur Überwindung der Politikverdrossenheit?<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
licherweise wirklich ein sinnvolles Wahlalter darstellt.<br />
Allerdings bräuchte man hierfür möglichst<br />
noch weitere Befunde, die zu ähnlichen Erkenntnissen<br />
kommen. Denn wie ich bereits gesagt habe,<br />
hängt die Entwicklung des politischen Wissens ja vor<br />
allem auch mit den jeweiligen Bildungsplänen zusammen.<br />
Und diese sahen in Rheinland-Pfalz, wo die<br />
Befragung von Tenscher und Scherer durchgeführt<br />
wurde, natürlich etwas anders aus als in Baden-<br />
Württemberg, wo wir unsere Untersuchung durchgeführt<br />
haben. Hätte man vergleichbare Studien aus<br />
mehreren Bundesländern, könnte man auf deren Basis<br />
auch besser beurteilen, welche Form von politischer<br />
Bildung zu welchem Ergebnis führt. Leider ist<br />
dies aber bislang nicht der Fall, was für mich auch<br />
wieder zeigt, dass dem Bildungs- und Vorbereitungsaspekt<br />
bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt<br />
wird.<br />
Die dritte wichtige Erkenntnis aus der »Jugend, Politik<br />
und Medien«-Studie ist, dass es nur bei den 14-jährigen<br />
Befragten eine Mehrheit für ein Wahlrecht ab<br />
16 gab. Und die fiel auch noch sehr knapp aus: 38,2<br />
Prozent waren für ein Wahlrecht ab 16 und 37,6 Prozent<br />
waren für ein Wahlrecht ab 18 – also die Beibehaltung<br />
des jetzigen Zustands. In allen anderen<br />
Altersgruppen, also zwischen 15 und 18 Jahren, gab<br />
es eine Mehrheit für das Wahlrecht ab 18 – erstaunlicherweise<br />
also auch bei den 16- und 17-Jährigen, die ja von der Wahlaltersenkung<br />
direkt betroffen wären. Bei den 16-Jährigen sprachen sich<br />
aber 51,7 Prozent für ein Wahlrecht ab 18 aus, bei den 17-Jährigen<br />
sogar 60,4 Prozent. Für ein Wahlrecht ab 16 plädierten hingegen<br />
nur 38,4 bzw. 32,0 Prozent. Man sieht also, dass die Zustimmung<br />
zu einer Wahlaltersenkung zwar mit sinkendem Alter zunimmt.<br />
Aber trotzdem lehnt eine Mehrheit der 15- bis 18-Jährigen eine<br />
Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre ab. Das fand ich schon sehr<br />
überraschend. Und ich finde, dass man darüber mit den Befürwortern<br />
einer Wahlaltersenkung sprechen muss. Denn diese argumentieren<br />
ja gerade damit, dass sie sich für die Interessen der<br />
Jugendlichen einsetzen, die bislang noch kein Wahlrecht besitzen,<br />
weil sie diese ernst nehmen wollen. Wenn man sich die Umfrage-Ergebnisse<br />
aus Rheinland-Pfalz aber anschaut, dann würde<br />
ein Ernstnehmen der Befragten eher zu dem Ergebnis führen,<br />
dass man das mit der Wahlaltersenkung lieber sein lässt. Denn<br />
möglicherweise würde man da etwas<br />
einführen, was die Mehrheit der Betroffenen<br />
gar nicht will. Zumindest<br />
bislang noch nicht. Um dies zu ändern,<br />
müssen die Befürworter vermutlich<br />
noch deutlich mehr Überzeugungsarbeit<br />
bei den betroffenen<br />
leisten – gerade, um diese ernst zu<br />
nehmen und der Wahlaltersenkung<br />
damit auch eine breitere Legitimationsbasis<br />
zu verschaffen.<br />
100%<br />
D&E: Kritische Stimmen aus dem Unionslager<br />
und aus der FDP in Baden-Württemberg<br />
betonen, die grün-rote Landesregierung möchte das Wahlalter vor<br />
allem deshalb senken, um sich bei zukünftigen Wahlen Vorteile zu verschaffen.<br />
Bei der Landtagswahl werde dies deshalb in Baden-Württemberg<br />
nicht möglich sein, weil dazu die Verfassung mit 2/3 Mehrheit geändert<br />
werden müsste. Teilen Sie diese Bedenken, wenn Sie z. B. einen Blick<br />
auf die bisherigen Wahlergebnisse in Österreich oder auf die betroffenen<br />
Bundesländer in Deutschland werfen?<br />
Jan Kercher: Ich finde es zunächst einmal erfreulich, wenn offen<br />
darüber gesprochen wird, dass die Parteien mit einer Wahlaltersenkung<br />
natürlich nicht nur selbstlose Motive verfolgen, sondern<br />
sehr wohl auch darauf achten, wie sich solch eine Gesetzesänderung<br />
auf ihre Stimmenanteile auswirken würde. In Bezug auf die<br />
0%<br />
Abb. 4<br />
34,9<br />
sig.**<br />
Politikverständnis und Wahlalter, Experimentaluntersuchung<br />
© Jan Kercher, Universität Hohenheim, 2012<br />
»Die Entwicklung des<br />
politischen Wissens hängt<br />
vor allem mit den jeweiligen<br />
Bildungsplänen<br />
zusammen.«<br />
Ergebnisse: Politisches Interesse (in %)<br />
56,4<br />
36,2<br />
sig.**<br />
76,1<br />
30,3<br />
sig.**<br />
N = 134 N = 80 N = 56<br />
Alle Gymn./Studienanf. Haupts./Berufs.<br />
Objektives Wissen = Anteil der im Wissenstest erzielten Punkte an allen Punkten (0–16 mögliche<br />
Punkte), unter Berücksichtigung einer Ratekorrektur.<br />
** sig. = Gruppenunterschiede sind statistische signifikant, n.s. = nicht signifikant<br />
Unter 18<br />
18 und älter<br />
Grünen hätte eine Wahlaltersenkung wohl auch tatsächlich positive<br />
Auswirkungen für die Wahlergebnisse. Denn die Grünen erzielen<br />
bei Umfragen unter 16- bis 17-Jährigen, bei Juniorwahlen<br />
und auch bei tatsächlichen Wählern im Alter von 16 und 17 Jahren<br />
immer deutlich bessere Ergebnisse als beim Rest der Wählerschaft.<br />
Das war übrigens auch in Österreich so. Und in Baden-<br />
Württemberg haben die Grünen bei der Juniorwahl 2011 stolze<br />
34,0 Prozent erzielt, im Vergleich zu 24,2 Prozent bei der eigentlichen<br />
Landtagswahl. Ähnlich sah es in Bremen 2011 aus: Hier lagen<br />
die Grünen insgesamt bei 22,5 Prozent. Laut einer Wahltagsbefragung<br />
der Forschungsgruppe Wahlen lag ihr Stimmenanteil bei<br />
den 16- und 17-Jährigen aber bei 33,0 Prozent. Ich unterstelle den<br />
Grünen zwar keineswegs, dass sie aus rein wahltaktischen Gründen<br />
für eine Wahlaltersenkung sind. Dagegen spricht schon allein<br />
die geringe Zahl der 16- und 17-Jährigen, die nur zu einer relativ<br />
geringen Änderung der Wahlergebnisse führen würde. Aber ich<br />
denke andererseits auch, dass es kein Zufall ist, dass sich mit den<br />
Grünen eine Partei besonders für eine<br />
Wahlaltersenkung einsetzt, die auch<br />
in besonderem Maße davon profitieren<br />
würde. Genauso wie ich denke,<br />
dass es kein Zufall ist, dass sich die<br />
CDU bislang vehement gegen solch<br />
eine Gesetzesänderung sperrt. Denn<br />
sie schneidet bei den 16- und 17-Jährigen<br />
regelmäßig deutlich schlechter<br />
ab als im Rest der Wählerschaft. Genauso<br />
wie CDU und FDP also dem rotgrünen<br />
Lager vorwerfen, sich nur aus<br />
Eigeninteresse für eine Wahlaltersenkung<br />
einzusetzen, könnte man ihnen<br />
vorwerfen, sich nur aus Eigeninteresse gegen eine Wahlaltersenkung<br />
einzusetzen. Letztlich ist es vermutlich bei allen Parteien<br />
eine Mischung aus echtem Interesse oder Des interesse an der<br />
Beteiligung der Jugend und einer gewissen Portion Eigeninteresse,<br />
die die Haltung zur Wahlaltersenkung bestimmt.<br />
Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens v. a. das Verhalten<br />
der SPD. Denn die SPD kann nach den bisherigen Erkenntnissen<br />
keinesfalls mit einer Erhöhung ihrer Stimmenanteile durch<br />
eine Wahlaltersenkung rechnen. Eher im Gegenteil: In Bremen lag<br />
sie bei den 16- und 17-Jährigen bei 28,5 Prozent, insgesamt aber<br />
bei 38,6 Prozent. Anders als bei Grünen und CDU kann man hier<br />
also eigentlich kein Eigeninteresse unterstellen. Trotzdem unter-<br />
41,1<br />
61<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
»Wahlalter 16« – eine Chance zur Überwindung der Politikverdrossenheit?
62<br />
D&E-INTERVIEW MIT DR. JAN KERCHER, UNIVERSITÄT STUTTGART-HOHENHEIM<br />
39,0<br />
17,2<br />
23,1 23,0 24,2 34,0<br />
CDU SPD B’90/Die<br />
Grünen<br />
5,3 4,4<br />
2,8 3,4 2,1<br />
Landtagswahl<br />
FDP Die Linke Piraten NPD Sonstige<br />
U18-Wahl<br />
Abb. 5 Landtagswahl 2011 in Baden- Württemberg und U-18 Wahl des Landesjugendrings<br />
Ba-Wü © Landeswahlleiter Baden-Württemberg, Landesjugendring Baden-Württemberg e. V.<br />
stützt die SPD auf Landes- und Kommunalebene meistens die Initiativen<br />
der Grünen für eine Senkung des Wahlalters. Es handelt<br />
sich dabei also entweder um echte Überzeugung – die sogar so<br />
groß ist, dass dafür mögliche Verluste bei den Stimmanteilen in<br />
Kauf genommen werden – oder um große Solidarität mit dem bevorzugten<br />
Koalitionspartner.<br />
D&E: Kritiker sagen auch, dass insbesondere männliche Jugendliche mit<br />
einer Wahl ab 16 »ihr Mütchen kühlen« wollten und rechtsradikal wählten.<br />
Sind solche Tendenzen zu befürchten?<br />
Jan Kercher: Wenn auf eine angemessene Vorbereitung der Jugendlichen<br />
verzichtet wird, auf jeden Fall. Das zeigen die Wahlergebnisse<br />
aus Österreich und die Juniorwahl-Ergebnisse aus Baden-Württemberg<br />
recht deutlich. Betrachtet man die Ergebnisse<br />
der Befragungen von Jens Tenscher und Philipp Scherer, so zeigt<br />
sich, dass die vergleichsweise hohen Anteile der rechtsradikalen<br />
Parteien bei den Jungwählern fast ausschließlich auf die Präferenzen<br />
der männlichen Jugendlichen zurückzuführen sind. Hier lag<br />
der Anteil von DVU, Republikanern<br />
und NPD bei 8 %., bei den weiblichen<br />
Jugendlichen hingegen nur bei<br />
8,7<br />
1,0<br />
3,9<br />
2,5<br />
5,4<br />
»Es ist kein Zufall, dass sich<br />
mit den Grünen eine Partei<br />
besonders für eine<br />
Wahlaltersenkung einsetzt,<br />
die auch in besonderem Maße<br />
davon profitieren würde.«<br />
2 %. Gerade die männlichen Jugendlichen<br />
müsste man im Vorfeld<br />
einer Wahlaltersenkung also verstärkt<br />
in den Blickpunkt nehmen.<br />
Was ich dabei besorgniserregend<br />
finde, ist, dass selbst in Bremen, wo<br />
zahlreiche Projekte zur Vorbereitung<br />
der Jugendlichen durchgeführt<br />
wurden, der Stimmenanteil der NPD<br />
bei den 16- und 17-Jährigen mit 4,5<br />
Prozent fast exakt dreimal so hoch<br />
war wie bei allen Wählerinnen und<br />
Wählern. Ich habe mir daraufhin die<br />
verschiedenen Projekte noch einmal genauer angeschaut. Und<br />
musste feststellen, dass zwar durchaus der Wille vorhanden war,<br />
die Jugendlichen auf ihr Wahlrecht vorzubereiten. Dass diese Vorbereitungen<br />
aber fast ausnahmslos wenige Wochen oder sogar<br />
Tage vor der Wahl starteten. Auch hier wurde also keine langfristige<br />
Vor bereitung anhand der Bildungspläne vorgenommen, sondern<br />
eine recht kurzfristige Vorbereitung anhand verschiedener,<br />
außerplanmäßiger Schulprojekte. Das ist zwar durchaus löblich<br />
und teilweise durchaus erfolgreich – was v. a. die hohe Wahlbeteiligung<br />
bei den Jungwählern zeigt. Trotzdem sollte man sich angesichts<br />
der Ergebnisse der Wahltagsbefragung Gedanken<br />
darüber machen, ob solche kurzfristigen und<br />
außerplanmäßigen Projekte wirklich eine ausreichende<br />
Begleitung einer so tiefgreifenden Veränderung<br />
des Wahlsystems sind.<br />
D&E: Forschungen im Bereich des Wertewandels in modernen<br />
Gesellschaften betonen häufig den an postmateriellen<br />
Werten ausgerichteten Wunsch insbesondere junger Menschen<br />
nach mehr Möglichkeiten der politischen Partizipation.<br />
Ist diese Tendenz nach wie vor stabil und gibt es Unterschiede,<br />
was die soziale Herkunft, die besuchte Schulform<br />
bzw. den erreichten Bildungsabschluss sowie das Geschlecht<br />
betreffen?<br />
Jan Kercher: Bei den prominenten und teilweise privat<br />
finanzierten Jugendstudien, die immer wieder in<br />
den Medien diskutiert werden, muss man sehr vorsichtig<br />
sein. Teilweise hapert es da ganz erheblich bei<br />
der Erhebungsmethodik und teilweise lösen sich die<br />
angeblichen Besonderheiten bei den politischen Einstellungen<br />
von Jugendlichen bei genauerem Hinsehen<br />
in Luft auf. Nicht umsonst haben Edeltraud Roller,<br />
Frank Brettschneider und Jan W. van Deth ihrem<br />
Sammelband zum Thema »Jugend und Politik«, der<br />
den Beitrag der politischen Soziologie zur Jugendforschung<br />
untersucht, den Titel »Voll normal!« gegeben.<br />
Denn was man bei einer seriösen Auswertung der vorhandenen<br />
Daten immer wieder feststellt, ist, dass sich die Jugendlichen in<br />
ihren Einstellungen gar nicht so sehr von den Älteren unterscheiden.<br />
So handelt es sich bei vielen Veränderungen, die sich bei den<br />
Jugendlichen im Zeitverlauf zeigen um allgemeine Veränderungen,<br />
die auch für die gesamte Bevölkerung nachweisbar sind. Die<br />
drei erwähnten Forscher kommen also zu dem Ergebnis, dass die<br />
jugendspezifischen Muster, wie sie vielfach auf der Basis von Jugendstudien<br />
ermittelt werden, offenbar wegen des fehlenden<br />
Vergleichs über alle Altersgruppen und über die Zeit überschätzt<br />
werden. Zum Thema Wertewandel: Was sich nach Roller und Kollegen<br />
ebenfalls feststellen lässt, ist, dass im Zuge allgemeiner<br />
gesellschaftlicher Wandlungsprozesse in den letzten zehn bis<br />
fünfzehn Jahren in Deutschland eine neue Generation von Jugendlichen<br />
herangewachsen ist, die sich von den Jugendlichen<br />
der 1970er und 1980er Jahre unterscheidet. Nach der Theorie des<br />
postmaterialistischen Wertewandels von Inglehart sind Jugendliche<br />
ja vor allem postmaterialistisch<br />
orientiert, präferieren Themen und<br />
Positionen der Neuen Politik, wählen<br />
grün-alternative Parteien und<br />
sind politisch aktiv. Dieses Bild der<br />
Jugend ist in der Politischen Soziologie<br />
auch heute noch sehr verbreitet.<br />
Es trifft aber offenbar nicht<br />
mehr uneingeschränkt auf die heutige<br />
Jugend zu. Der Trend zeigt sogar<br />
in eine andere Richtung. Die Jugend<br />
von heute unterscheidet sich<br />
von der Jugend der 1970er und<br />
1980er Jahre zum Beispiel dadurch,<br />
dass sie eine höhere politische<br />
Kompetenz besitzt, in geringerem<br />
Ausmaß postmaterialistisch orientiert ist und Gleichheit als<br />
rechtfertigende Gerechtigkeitsideologie befürwortet. Zudem<br />
zeichnet sie sich durch eine geringere Wahlbeteiligung aus, identifiziert<br />
sich weniger häufig mit einer politischen Partei und wählt<br />
auch seltener die Grünen als früher. Zusammenfassend lässt sich<br />
also feststellen: Die heutige Jugend ist im Vergleich zu ihren Vorgängergenerationen<br />
politisch kompetenter, konservativer in ihren<br />
Wertorientierungen und ihrer Wahlentscheidung, weniger<br />
stark an politische Parteien gebunden und geht seltener zur<br />
Wahl.<br />
»Wahlalter 16« – eine Chance zur Überwindung der Politikverdrossenheit?<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
12,2<br />
38,2<br />
37,6<br />
Was die Einflüsse von Geschlecht, sozialer<br />
Herkunft und Bildung angeht: Generell lässt<br />
sich sagen – und das zeigt sich auch in der<br />
bereits erwähnten Untersuchung von Tenscher<br />
und Scherer –, dass männliche und höher<br />
gebildete Jugendliche mehr Interesse an<br />
Politik und politischer Partizipation bekunden<br />
als weibliche und geringer gebildete Jugendliche.<br />
Auch das politische Interesse der<br />
Eltern spielt eine sehr wichtige Rolle: Je stärker<br />
sich die Eltern für Politik interessieren,<br />
desto höher fällt auch das politische Interesse<br />
ihrer Kinder aus. Die politische Sozialisation<br />
ist also sehr stark von Geschlecht, sozialer<br />
Herkunft und dem Bildungsweg<br />
abhängig. Zum Beispiel zeigen sich auch<br />
deutliche Bildungseinflüsse bei der Frage,<br />
welche Ebenen von Politik für die Jugendlichen<br />
interessant sind. Gymnasiasten bekunden<br />
hier deutlich häufiger ein Interesse an<br />
internationaler Politik als Hauptschüler, die<br />
sich dafür mehr für kommunale Politik interessieren<br />
als Gymnasiasten. Auch die subjektive<br />
politische Kompetenz, die sich die Jugendlichen<br />
selbst zumessen, nimmt mit dem Bildungsgrad<br />
eindeutig zu. Zudem schätzen sich Jungen hier meistens deutlich<br />
höher ein als Mädchen. Bezüglich der Wertorientierungen lässt<br />
sich sagen, dass männliche Jugendliche häufig etwas materialistischer<br />
orientiert sind als weibliche Jugendliche und dass die materialistischen<br />
Orientierungen mit zunehmendem Bildungsgrad<br />
eher abnehmen. Aber auch hier gilt: Das kann man ebenso im<br />
Rest der Gesellschaft beobachten. Die Jugendlichen sind letztlich<br />
also wirklich »voll normal«.<br />
10,4 9,1 5,3 7,1 5,8<br />
14 Jahre 15 Jahre 16 Jahre 17 Jahre 18 Jahre<br />
Abb. 6 Einstellungen zum Wahlalter, Rheinland-Pfalz 2005<br />
© Jens Tenscher/Philipp Scherer (2012): Jugend, Politik und Medien.<br />
Politische Orientierungen und Verhaltensweisen von Jugendlichen in Rheinland-Pfalz. Münster, S. 177<br />
»Die heutigen Jugendlichen<br />
weisen eine deutlich geringere<br />
Bereitschaft auf, sich langfristig<br />
an institutionalisierte Formen<br />
der politischen Partizipation<br />
zu binden.«<br />
7,1<br />
37,2<br />
45<br />
2,5*<br />
38,4<br />
51,7<br />
5<br />
32<br />
60,4<br />
23,3<br />
69,4<br />
ab 14 Jahren<br />
ab 16 Jahren<br />
ab 18 Jahren<br />
ist mir egal<br />
1.714 Befragte<br />
D&E: Welche weiteren Par ti zi pations<br />
formen als das aktive Wahlrecht<br />
bevorzugen denn Jugendliche und<br />
junge Erwachsene? Wächst gerade<br />
eine aktive Generation, die eine moderne<br />
Zivilgesellschaft erst möglich<br />
macht, heran?<br />
Jan Kercher: Die heutigen Jugendlichen<br />
weisen eine deutlich<br />
geringere Bereitschaft auf, sich<br />
langfristig an institutionalisierte<br />
Formen der politischen Partizipation<br />
zu binden. Das betrifft zum<br />
Beispiel Partei-Mitgliedschaften<br />
oder auch die Wahlbeteiligung.<br />
Das bedeutet aber nicht zwangsläufig,<br />
dass weniger politisch partizipiert wird. Sondern eben vor<br />
allem weniger institutionell, sondern eher spontan, kurzfristig<br />
und anlassbezogen. Zum Beispiel durch die Teilnahme an Online-<br />
Petitionen, durch Flashmobs oder Shitstorms. Auch die Occupy-<br />
Bewegung ist für mich ein Beispiel dafür, dass institutionelle Formen<br />
der politischen Partizipation für viele jüngere Menschen<br />
keine attraktive Option mehr sind. Denn die Idee der Occupy-Bewegung<br />
war ja gerade, dass sie keine festen Strukturen und vor<br />
allem auch kein Führungspersonal hat. Für die Parteien bedeutet<br />
das natürlich, dass es immer schwieriger wird, neue Mitglieder zu<br />
gewinnen, die auch langfristig aktiv bleiben. Das sieht man ja an<br />
den sinkenden Mitgliederzahlen fast aller Parteien: Die ausscheidenden<br />
Mitglieder können schon lange nicht mehr durch neue<br />
Mitglieder kompensiert werden – wie das früher immer der Fall<br />
war. Das führt dazu, dass die Parteien hier umdenken müssen –<br />
auch, um ihre Finanzierungsbasis zu sichern, die ja zu einem großen<br />
Teil auf den Mitgliedsbeiträgen aufgebaut ist.<br />
Das Aufkommen der Piratenpartei hat die etablierten Parteien<br />
hier zusätzlich aufgescheucht: Im gerade beginnenden Bundestagswahlkampf<br />
kann man das ganz deutlich sehen. Nun versuchen<br />
sich alle Parteien als Mitmach-Parteien darzustellen, um<br />
neue Anhänger und Mitglieder zu gewinnen. Dieser Prozess wurde<br />
durch die Piratenpartei sicherlich stark beschleunigt. Denn bei<br />
der Piratenpartei kann – oder konnte man zumindest bis vor Kurzem<br />
– auch als Neumitglied relativ schnell wichtige Funktionen<br />
übernehmen. Das sieht bei den etablierten Parteien anders aus,<br />
schon allein aufgrund der größeren Mitgliederzahl. Da muss man<br />
sich im Normalfall erstmal einige Jahre beweisen und hocharbeiten,<br />
bevor man eine hervorgehobene Position einnehmen kann.<br />
Und das schreckt viele Jugendliche<br />
ab. Bei der Piratenpartei<br />
funktionierte das hingegen bis<br />
vor Kurzem eher wie bei einer<br />
Bürgerinitiative: Wer genügend<br />
Engagement mitbrachte, der<br />
konnte ganz schnell Sprecher<br />
oder Vorsitzender sein. Mittlerweile<br />
stößt die Partei hier aber<br />
auch an gewisse Grenzen, was<br />
man gerade beim letzten Parteitag<br />
in Bochum miterleben konnte.<br />
Denn wenn alle immer überall<br />
mitmachen und mitreden dürfen,<br />
dann führt das zwangsläufig zu<br />
Problemen bei der Effizienz. Und<br />
die ist bei einer so schnell wachsenden Organisation auch nicht<br />
ganz unwichtig.<br />
Andererseits zeigt die Piratenpartei ja gerade, dass institutionalisierte<br />
Formen der politischen Partizipation auch heute noch junge<br />
Menschen ansprechen können – wenn sie zeitgemäß organisiert<br />
sind, eine hohe Offenheit ausstrahlen und auch unverbindlichere<br />
Partizipationsmöglichkeiten – quasi als »Schnupperkurs« – anbieten.<br />
Mein Gefühl ist, dass die Attraktivität der Piraten für Jugendliche<br />
vor allem durch ihr offenes und unarrogantes Auftreten zu<br />
erklären ist. Damit meine ich vor allem die Ehrlichkeit, auch zuzugeben,<br />
wenn man zu einem Thema einmal nichts oder noch nichts<br />
zu sagen hat. Natürlich kann man das gerade bei zentralen politischen<br />
Themen nicht ewig so machen. Aber gerade bei Problemen,<br />
die neu auftreten und vielleicht auch noch sehr komplex sind, ist<br />
es ja häufig ehrlicher, als Politiker auch einmal zuzugeben, dass<br />
man dazu noch keine fundierte Meinung hat. Das erlebt man bei<br />
den etablierten Parteien aber sehr selten. Stattdessen flüchten<br />
sich deren Politiker dann häufig in Wortwolken, abgedroschene<br />
Phrasen oder Politiker-Chinesisch, häufig gepaart mit einem sehr<br />
63<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
»Wahlalter 16« – eine Chance zur Überwindung der Politikverdrossenheit?
64<br />
D&E-INTERVIEW MIT DR. JAN KERCHER, UNIVERSITÄT STUTTGART-HOHENHEIM<br />
arroganten und selbstgewissen Auftreten. Und genau das wirkt<br />
meiner Einschätzung nach auf viele Jugendliche sehr abschreckend.<br />
Insofern hat die Piratenpartei hier sicherlich schon einen<br />
positiven Beitrag zur Veränderung der politischen Kultur geleistet<br />
– auch bei den etablierten Parteien.<br />
D&E: Was könnte und sollte die politische Bildung innerhalb und außerhalb<br />
des Schulunterrichts für Angebote zur Stärkung der Partizipationsbereitschaft<br />
Jugendlicher machen und wie kann sie am besten Jugendliche<br />
erreichen?<br />
Jan Kercher: Ein guter und vor allem ansprechender Politik-Unterricht<br />
in der Schule ist für mich nach wie vor das beste Mittel,<br />
um Jugendlichen die Bedeutung von politischer Partizipation näherzubringen.<br />
Denn die Schule ist der einzige Ort, an dem man<br />
alle Jugendlichen erreichen kann. Und sie genießt bei den Jugendlichen<br />
nachweislich einen Ruf als Ort für eine objektive Informationsvermittlung.<br />
Weshalb die Jugendlichen von der Schule auch<br />
erwarten, dass sie ihnen die Informationen und Fähigkeiten vermittelt,<br />
die für ein Verständnis der politischen Prozesse und<br />
Beteiligungsformen nötig sind. Darüber hinaus halte ich Projekte,<br />
wie sie zum Beispiel zur Vorbereitung der Wahlaltersenkung in<br />
Bremen durchgeführt wurden, für<br />
sehr begrüßenswert. Also etwa<br />
Juniorwahlen, Workshops, Projekttage,<br />
Planspiele oder auch<br />
Podiumsdiskussionen, die sich<br />
speziell an Jugendliche richten.<br />
Gerade die Methode des Planspiels<br />
halte ich für sehr gut geeignet,<br />
um Jugendlichen die komplexen<br />
Prozesse zu vermitteln, die im<br />
politischen Alltag relevant sind.<br />
Ich war selbst früher als Teamer<br />
im »Juniorteam Europa« aktiv, einem<br />
Peer-Group-Education-Projekt,<br />
das von der LMU München ins Leben gerufen wurde. Die Idee<br />
ist hier, dass junge Menschen anderen jungen Menschen die Bedeutung<br />
der europäischen Institutionen vermitteln. Und zwar vor<br />
allem durch die Teilnahme an Planspielen, in denen unterschiedliche<br />
europäische Szenarien durchgespielt werden. Meine Erfahrungen<br />
mit dieser Methode waren immer sehr positiv. Nach der<br />
Teilnahme an den Planspielen konnten die Jugendlichen sehr viel<br />
besser verstehen, was Politik im Alltag häufig so mühsam macht<br />
und warum am Ende eben oft »nur« Kompromisse herauskommen,<br />
die auf den ersten Blick vielleicht unbefriedigend erscheinen.<br />
Durch die Teilnahme an einem Planspiel lernt man nämlich<br />
relativ schnell, dass solche Kompromisse ein Wesensmerkmal von<br />
demokratischen oder partizipativen Abstimmungsprozessen sind<br />
und beurteilt sie deshalb dann nicht mehr so negativ wie davor.<br />
Und: Man kann danach auch sehr viel besser einschätzen, was Politiker<br />
täglich leisten. Auch die Politik- oder Politikerverdrossenheit<br />
kann also auf diese Weise – zumindest bei einigen Jugendlichen<br />
– gesenkt werden.<br />
D&E: Die Universität Stuttgart-Hohenheim, an der Sie bisher gearbeitet<br />
haben, hat verschiedene Untersuchungen zu Verständlichkeit von Politikersprache<br />
und Wahlprogrammen gemacht. Neigen nicht gerade junge<br />
Menschen dazu, für personalisierte und emotionalisierte Wahlkämpfe,<br />
vielleicht nach us-amerikanischem Vorbild, besonders empfänglich zu sein?<br />
Anders ausgedrückt: Droht nicht das Niveau der Wahlkampfauseinandersetzung<br />
durch die Senkung des Wahlalters noch weiter herabzusinken?<br />
Jan Kercher: Zunächst einmal: Die Jugendlichen im Alter von 16<br />
und 17 Jahren würden bei einer Wahlaltersenkung nur einen sehr<br />
kleinen Teil der Wählerschaft ausmachen. Es ist also kaum zu erwarten,<br />
dass die Entwicklung der Wahlkampfführung durch solch<br />
eine Änderung entscheidend beeinflusst würde. Auch die Themen<br />
der Wahlkämpfe werden sich deshalb meiner Einschätzung nach<br />
nicht grundlegend ändern. Denn die Masse der Wähler befände<br />
sich auch nach einer Wahlaltersenkung noch immer im älteren<br />
»Die Methode des Planspiels<br />
halte ich für sehr gut geeignet,<br />
um Jugendlichen die komplexen<br />
Prozesse zu vermitteln, die im<br />
politischen Alltag relevant sind.«<br />
Teil der Bevölkerung. Und diese Masse beeinflusst – zumindest<br />
bei den beiden Volksparteien – natürlich in erster Linie die Themensetzung.<br />
Kleinere Parteien wie die Grünen oder die Piraten<br />
wenden sich hingegen mit ihrer Themensetzung heute schon<br />
häufiger auch an jüngere Wählergruppen – auch da würde sich<br />
also nur bedingt etwas ändern. Am ehesten wären aus meiner<br />
Sicht also Änderungen bei den Themensetzungen der FDP und der<br />
Linken zu erwarten. Denn beides sind Parteien, die sich bislang<br />
nicht durch eine gezielte Ansprache von Jungwählern hervorgetan<br />
haben, bei denen aber gleichzeitig auch kleinere Wählergruppen<br />
wie die 16- und 17-Jährigen durchaus wahlentscheidende Bedeutung<br />
haben können.<br />
Selbiges gilt leider auch für die rechtsradikalen Parteien. Was<br />
mich hier besonders nachdenklich stimmt, sind die Befunde aus<br />
der bereits erwähnten Sora-Studie zur österreichischen Nationalratswahl<br />
2008, die u. a. vom Bundeskanzleramt und vom<br />
österreichischen Parlament in Auftrag gegeben wurde. Nach den<br />
Befunden dieser Studie bewerteten die befragten Jugendlichen<br />
schon allein das Herausstellen eines klaren, von der Mehrheitsmeinung<br />
abweichenden Standpunktes durch eine Partei positiv.<br />
Selbst dann, wenn dieser Standpunkt von der eigenen Meinung<br />
abweicht. So lehnte zum Beispiel<br />
eine Mehrheit der befragten Jugendlichen<br />
den Standpunkt der<br />
FPÖ zur Einwanderungspolitik<br />
ab – bewertete aber gleichzeitig<br />
die klare Selbst-Positionierung<br />
der Partei in dieser Frage positiv.<br />
Eventuell sind es also gar nicht<br />
unbedingt immer die Themen<br />
selbst, die entscheidend sind für<br />
die Ansprache jüngerer Wähler –<br />
sondern v. a. auch die Art und<br />
Weise, wie diese Standpunkte<br />
kommuniziert und vertreten werden.<br />
Die österreichischen Forscher stellten nämlich auch fest,<br />
dass die Themen, die von den beiden Rechtsparteien FPÖ und<br />
BZÖ propagiert wurden, auf der Prioritätenliste der Jugendlichen<br />
eigentlich ganz unten standen. Trotzdem wurden sie gerade von<br />
den 16-Jährigen überproportional gewählt.<br />
Das ist aus meiner Sicht auch nicht ganz überraschend: Für jemanden,<br />
der gerade erst beginnt, sich mit dem Thema Politik auseinanderzusetzen,<br />
kann das typische Auftreten von Parteien und<br />
Politikern sehr leicht abschreckend wirken. Teilweise, weil man<br />
die Sprache einfach nicht versteht und teilweise vielleicht auch,<br />
weil man das Gefühl hat, dass die Politiker vieles unnötig verkomplizieren.<br />
Denn auf den ersten Blick wirkt die Lösung vieler Probleme<br />
ja sehr einfach – erst auf den zweiten Blick merkt man dann<br />
häufig, dass es nicht ganz so einfach ist. Leider gibt es aber Parteien,<br />
die den Wählerinnen und Wählern vorgaukeln wollen, dass<br />
es sehr wohl so einfach ist. Und diese bewegen sich eben meistens<br />
an den politischen Rändern. Gerade hier sehe ich also eine<br />
Hauptaufgabe der politischen Bildung. Also darin, den Jugendlichen<br />
zu vermitteln, dass das Auftreten einer Partei nie wichtiger<br />
sein sollte als deren politische Ziele. Und dass man immer misstrauisch<br />
sein sollte, wenn eine Partei allzu einfache Lösungen verspricht.<br />
Denn in unserer heutigen, hoch entwickelten und pluralistischen<br />
Gesellschaft gibt es nur noch für wenige politische<br />
Probleme wirklich einfache Lösungen.<br />
Eine klare und einfache Politikersprache ist deshalb natürlich<br />
nicht falsch – ganz im Gegenteil. Ich halte es gerade für die Ansprache<br />
von Jugendlichen für sehr wichtig, sich nicht in unnötigem<br />
Politiker-Chinesisch zu ergehen. Aber die klare Sprache<br />
sollte eben nicht einhergehen mit einer unzulässigen Simplifizierung<br />
politischer Zusammenhänge. Denn auch komplexe Zusammenhänge<br />
lassen sich meistens mit recht einfacher Sprache beschreiben,<br />
wenn man sich entsprechend bemüht. Bei links- und<br />
rechtsradikalen Parteien geht die einfache Sprache aber häufig<br />
mit einer unzulässigen Vereinfachung der politischen Probleme<br />
»Wahlalter 16« – eine Chance zur Überwindung der Politikverdrossenheit?<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
einher. Und das muss man Jugendlichen innerhalb<br />
und außerhalb der Schule vermitteln.<br />
38,6<br />
D&E: Häufig heißt es, dass sich Jugendliche von elektronischen<br />
Medien, wozu neben den privaten TV-Stationen insbesondere<br />
auch die digitalen Angebote des Internets zählen,<br />
sehr stark manipulativ bestimmen ließen. Denken Sie, dass<br />
über die Herabsenkung des Wahlalters sowie eine verstärkte<br />
verpflichtende politische Bildung in den Schulen<br />
dieser Tendenz Einhalt geboten werden kann und Jugendliche<br />
in ihrem Alter bereits erkennen können, wann eine politische<br />
Frage Zukunftsthemen aufwirft, um die im GG (Art.<br />
20 a) als Staatsziel geforderte Generationengerechtigkeit<br />
umzusetzen?<br />
Jan Kercher: Meiner Einschätzung nach sollte man<br />
von mit einer Absenkung des Wahlalters keine unrealistischen<br />
Erwartungen verbinden. Häufig wird zum<br />
Beispiel behauptet, eine Wahlaltersenkung würde zu<br />
einem Anstieg der Wahlbeteiligung führen – was<br />
nicht stimmt. Natürlich wird durch eine Wahlaltersenkung<br />
die absolute Zahl der abgegebenen Stimmen<br />
steigen – woraus man möglicherweise eine stärkere<br />
Legitimationsfunktion der Wahl ableiten kann,<br />
weil ein größerer Teil der Bevölkerung durch die Wahl<br />
repräsentiert wird. Aber relativ betrachtet wird sich<br />
kaum etwas an der Wahlbeteiligung ändern, weil auch bei den<br />
neuen Erstwählern keine höheren Beteiligungsraten zu erwarten<br />
sind als bei den heutigen Erstwählern. Das sieht man ganz deutlich,<br />
wenn man sich einmal Wahlen anschaut, bei denen das<br />
Wahlalter bereits gesenkt wurde.<br />
Was die Beeinflussbarkeit von Jugendlichen betrifft: Auch mit einem<br />
niedrigeren Wahlalter und verstärkter politischer Bildung<br />
werden Jugendliche immer etwas leichter zu beeinflussen sein als<br />
ältere Menschen. Das ist auch vollkommen natürlich: Als junger<br />
Mensch verfügt man einfach über einen sehr viel geringeren Erfahrungsschatz<br />
– sowohl im politischen Bereich als auch im unpolitischen<br />
Bereich – als ältere Menschen<br />
und auch über weniger<br />
gefestigte Einstellungen. Das macht<br />
zwangsläufig anfälliger für Beeinflussung<br />
durch persuasive Kommunikation<br />
– sei es nun durch Parteien oder<br />
die kommerzielle Werbeindustrie.<br />
Natürlich kann man Jugendliche<br />
durch entsprechende politische Bildung<br />
auf solche Beeinflussungs- oder<br />
Manipulationstechniken vorbereiten<br />
und sie damit auch etwas besser<br />
schützen als dies bislang der Fall ist.<br />
Aber den Effekt der Lebenserfahrung wird man damit natürlich<br />
nicht komplett kompensieren können. Das wäre zu viel erwartet.<br />
Ebenfalls zu viel erwartet wäre aus meiner Sicht deshalb übrigens<br />
auch die Wunschvorstellung, dass sich Jugendliche durch eine<br />
Wahlaltersenkung von heute auf morgen brennend für Rentenpolitik<br />
interessieren werden. Denn es ist schlicht und einfach<br />
menschlich, dass man sich – angesichts eines begrenzten Zeitbudgets<br />
– zunächst einmal mit den Dingen beschäftigt, die einen<br />
aktuell betreffen – und nicht erst in 40 oder 50 Jahren. Daran wird<br />
man auch durch noch so frühe politische Bildung nur bedingt etwas<br />
ändern können. Natürlich kann und sollte man in der politischen<br />
Bildung von jungen Menschen trotzdem versuchen, die<br />
»versteckte« Bedeutung bestimmter Themen zu vermitteln, deren<br />
konkrete Auswirkungen sich für die heutigen Jugendliche vielleicht<br />
erst in vielen Jahren oder Jahrzehnten bemerkbar machen.<br />
Das ist aus meiner Sicht aber eine generelle Aufgabe von politischer<br />
Bildung und nicht etwas, das ich in erster Linie von einer<br />
Wahlaltersenkung erwarte.<br />
Wenn man sie richtig und mit dem nötigen Vorlauf umsetzt, dann<br />
denke ich, dass eine Wahlaltersenkung ein wichtiger Beitrag sein<br />
28,5<br />
»Man sollte mit einer<br />
Absenkung des Wahlalters<br />
keine unrealistischen<br />
Erwartungen verbinden«<br />
Landtagswahl 2011 in Bremen: Wahlverhalten nach Alter<br />
20,3<br />
11,2<br />
22,5<br />
33,0<br />
CDU SPD B’90/Die<br />
Grünen<br />
kann, um Jugendliche bereits vor dem Verlassen der Schule an politische<br />
Themen heranzuführen und ihnen die Relevanz politischer<br />
Prozesse und politischer Diskussionen – auch für ihr eigenes<br />
Leben – zu verdeutlichen. Wenn das gelingen würde, dann<br />
wäre das schon einmal sehr erfreulich. Denn solche frühen, positiven<br />
Erfahrungen prägen die politische Sozialisation auf entscheidende<br />
Weise und haben auch eine sehr langfristige Wirkung<br />
auf das generelle politische Interesse. Sie werden sich also auch<br />
dann noch bemerkbar machen, wenn die heutigen Jugendlichen<br />
einmal nicht mehr ganz so jung sind. Auf diese Weise könnte<br />
sich – ebenfalls langfristig betrachtet – auch die gesellschaftliche<br />
Wahrnehmung von Politik insgesamt<br />
verbessern. Mit anderen Worten: Die<br />
»Politikverdrossenheit«, von der<br />
heute so oft zu lesen ist, könnte möglicherweise<br />
gesenkt werden. Das bedeutet<br />
im Umkehrschluss übrigens<br />
auch, dass sich die Politik dann auf<br />
eine anspruchsvollere und beteiligungsstärkere<br />
Bürgerschaft einstellen<br />
sollte. Man kann ja nicht erwarten,<br />
dass die Leute sich mehr für<br />
Politik interessieren, aber trotzdem<br />
immer alles brav abnicken, was die<br />
Regierenden beschließen.<br />
Diese indirekten und langfristigen Wirkungen einer Wahlaltersenkung<br />
sollte man meiner Meinung nach aber mit gewisser Vorsicht<br />
behandeln. Denn ob und wann sie wirklich eintreffen, lässt<br />
sich heute noch nicht sagen.<br />
Literaturhinweise<br />
5,6 7,3 2,4 4,2 3,7<br />
2,0 1,9<br />
6,0<br />
Alle<br />
FDP Die Linke Piraten NPD Sonstige<br />
16- bis 17-Jährige<br />
4,5 3,4 3,3<br />
1,6<br />
Abb. 7 Landtagswahlen 2011 in Bremen, nach Wahlalter © Jan Kercher, Daten: Landeswahlleiter<br />
Kercher, Jan: Fit fürs Wählen. Ergebnisse einer experimentellen Studie zum<br />
Wahlrecht ab 16. www.politische-bildung-rlp.de/fileadmin/download/<br />
Schupp-Kuehl/Vortrag_LpB_RLP_mit_Zusatzauswertungen.pdf<br />
Kozeluh, Ulrike, u. a. (2009): »Wählen mit 16« – Eine Post Election Study zur<br />
Nationalratswahl 2008. Befragung – Fokusgruppen – Tiefeninterviews.<br />
http://images.derstandard.at/2009/05/15/studie.pdf<br />
Tenscher, Jens/Philipp Scherer, Philipp (2012): Jugend, Politik und Medien.<br />
Politische Orientierungen und Verhaltensweisen von Jugendlichen in Rheinland-Pfalz.<br />
LIT Verlag, Münster u. a.<br />
65<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
»Wahlalter 16« – eine Chance zur Überwindung der Politikverdrossenheit?
66<br />
D&E-INTERVIEW MIT DR. JAN KERCHER, UNIVERSITÄT STUTTGART-HOHENHEIM<br />
MATERIALIEN<br />
M 1<br />
Christoph Faisst: »Konsequenter Schritt«<br />
Wählen mit 16? Aber selbstverständlich. Denn was<br />
die grün-rote Landesregierung zunächst für das<br />
Kommunalwahlrecht und später auch für die Landtagswahl<br />
plant, ist angesichts der gesellschaftlichen<br />
Veränderung nur konsequent: Jugendliche werden<br />
schneller durch die Schule getrieben, um so früh wie<br />
ihre Konkurrenten aus anderen europäischen Ländern<br />
auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt anzukommen.<br />
Sie dürfen mit 17 ans Steuer eines Kraftfahrzeugs.<br />
Sie werden, ob sie es wollen oder nicht, fit<br />
gemacht für eine Leistungsgesellschaft, die sich ihrer<br />
künftigen Mitglieder immer früher bemächtigt. Sie<br />
müssen überall mithalten – doch die entsprechende<br />
politische Teilhabe bleibt ihnen verwehrt.<br />
Die Debatte wird nicht lange auf sich warten lassen:<br />
Wie steht es um die politische Reife dieser jungen<br />
Wähler? Kann es sein, dass Menschen, die noch nicht<br />
unbeschränkt geschäftsfähig sind, mitentscheiden,<br />
wenn es um die Zusammensetzung gesetzgebender Organe geht?<br />
Solche Fragen sind verständlich, doch ein wenig Gelassenheit ist<br />
angebracht. Schließlich werden wir heute auch ganz selbstverständlich<br />
mit 18 Jahren volljährig, bis immerhin 1975 waren es<br />
noch 21 Jahre.<br />
Umstellen müssen sich dagegen die Parteien, die sich verstärkt<br />
mit der Lebenswelt junger Menschen beschäftigen müssen – wollen<br />
sie nicht riskieren, per Wahlrechtsänderung mit leichter Hand<br />
den Piraten 20 Prozent zuzuschanzen.<br />
© Christoph Faisst, Südwestpresse Ulm, Online-Dienst, 1.11.2012<br />
M 2<br />
Beschluss der Vollversammlung des Landesjugendrings<br />
Baden-Württemberg am 25. März 2006<br />
Der Landesjugendring Baden-Württemberg fordert eine Absenkung<br />
des aktiven Wahlalters für Kommunal- und Landtagswahlen<br />
auf 14 Jahre. Diese Absenkung des Wahlalters muss von einer Verstärkung<br />
der schulischen und außerschulischen politischen Bildung<br />
flankiert und durch eine Verbesserung der gesellschaftlichen<br />
Partizipation junger Menschen ergänzt werden. (…)<br />
Eine Absenkung des Wahlalters ist aus mehreren Gründen<br />
dringend geboten. Als Interessensvertretung von Kindern und<br />
Jugend lichen trägt der Landesjugendring mit einer solchen Forderung<br />
dazu bei, mehr Gerechtigkeit zu Gunsten der jungen Generation<br />
herzustellen und gleichzeitig zu einem größeren Gleichgewicht<br />
zwischen den Generationen beizutragen.<br />
Darüber hinaus bewirkt eine Absenkung des Wahlalters auch,<br />
dass junge Menschen die Möglichkeit haben, sich am politischen<br />
Willensbildungsprozess zu beteiligen. Diese Beteiligung halten<br />
wir für wichtig – nicht nur, aber auch bei Wahlen. Nicht zuletzt<br />
können junge Menschen dadurch besser in demokratische Strukturen<br />
hineinwachsen. (…)<br />
• Durch die demographische Entwicklung werden junge Menschen<br />
immer mehr zur Minderheit. Für Baden-Württemberg<br />
prognostiziert das Statistische Landesamt, dass der Anteil der<br />
unter 20-Jährigen bis 2050 von 22 % auf 16 % fallen wird, während<br />
gleichzeitig der Anteil der über 60-Jährigen von heute<br />
23 % auf gut 36 % steigen wird. Dadurch werden Wahlen in<br />
Zukunft noch stärker als bisher von älteren Menschen entschieden.<br />
Es besteht die Gefahr, dass sich Politik deshalb zunehmend<br />
an den Interessen der älteren Generation orientiert.<br />
(…)<br />
• Eine Absenkung des Wahlalters ist mit einer Steigerung der<br />
Relevanz von politischer Bildung verbunden. Damit bekommt<br />
M 3 »Total unpolitisch …« © Gerhard Mester 10.3.2013 (gezeichnet für D&E)<br />
z. B. der Gemeinschaftskundeunterricht eine andere Dimension,<br />
weil er mit stattfindenden Wahlen verbunden werden<br />
kann, an denen sich die Jugendlichen beteiligen können. Auch<br />
in der außerschulischen Jugendbildung gäbe es einen direkteren<br />
Anlass, mit Jugendlichen über das Wahlsystem und die<br />
Auswirkungen einer Wahlentscheidung zu kommunizieren.<br />
Dadurch würden Jugendliche besser in unser demokratisches<br />
System hinein wachsen. Die Auswertung der Beteiligung bei<br />
der Bundestagswahl zeigt, dass dies dringend nötig ist. (…)<br />
• Das Argument, dass viele junge Menschen zu wenig Ahnung<br />
von politischen Themen haben, spricht für die Notwendigkeit<br />
einer besseren politischen Bildung. Es spricht aber nicht gegen<br />
eine Absenkung des Wahlalters. In jeder Altersstufe gibt<br />
es Menschen, die an Politik interessiert sind und solche, die<br />
sich nicht für Politik interessieren. Auch die Möglichkeit der<br />
Beeinflussung der Wahlberechtigten durch die Parteien ist in<br />
allen Generationen gegeben. Die wahlkämpfenden Parteien<br />
geben ja nicht umsonst viel Geld dafür aus, Menschen zu beeinflussen.<br />
(…) Dass viele Jugendliche sich selber als noch<br />
nicht reif zum Wählen einschätzen, bringt deren Respekt vor<br />
der Wichtigkeit und Ernsthaftigkeit von Wahlen zum Ausdruck<br />
und kann nicht gegen eine Absenkung des Wahlalters vorgebracht<br />
werden. Es geht darum, dass junge Menschen überhaupt<br />
die Möglichkeit haben, sich an Wahlen zu beteiligen.<br />
(…)<br />
• Jede Altersgrenze ist beliebig und bringt neue Ungerechtigkeiten<br />
mit sich. Für die Altersgrenze bei 14 Jahren spricht, dass<br />
sich bereits jetzt an dieser Altersschwelle einige gesetzlichen<br />
Rechte und Pflichten ändern. Mit diesem Alter beginnt die Religions-<br />
und Strafmündigkeit. Das bedeutet, dass der Staat<br />
Menschen in diesem Alter schon viel zutraut. Mit anderen<br />
Worten: Wem zugetraut wird, dass er/sie die Religionszugehörigkeit<br />
frei wählen kann und Verantwortung für das eigene<br />
Handeln übernehmen muss, ist auch in der Lage, eine politische<br />
Wahlentscheidung zu treffen.<br />
• Dies wird unterstützt durch entwicklungspsychologische Erkenntnisse<br />
in den Sozialwissenschaften. Ab dem Alter von 12<br />
Jahren geht der Blick über das eigene enge Lebensumfeld hinaus,<br />
die Urteilsfähigkeit auch über Vorgänge, die einen nicht<br />
selbst direkt betreffen, wächst. In den letzten Jahren wird beobachtet,<br />
dass Jugendliche über diese Fähigkeiten immer früher<br />
verfügen. Nicht umsonst nehmen Kinder und Jugendliche<br />
in vielen Jugendverbänden schon viel früher an den innerverbandlichen<br />
Entscheidungsprozessen teil.<br />
© Beschlossen von der Vollversammlung des Landesjugendrings Baden-Württemberg e. V.<br />
am 25. März 2006<br />
»Wahlalter 16« – eine Chance zur Überwindung der Politikverdrossenheit?<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
M 4<br />
Stephan Eisel: Wahlrecht, Volljährigkeit<br />
und Politikinteresse?<br />
Immer wieder wird in Deutschland über eine<br />
Absenkung des Wahlalters als Mittel gegen<br />
eine angenommene »Politikverdrossenheit«<br />
bei Jugendlichen diskutiert. Zuletzt hat der<br />
Landtag in Brandenburg im Dezember 2011<br />
mit den Stimmen von SPD, LINKEN, Grünen<br />
und FDP gegen die Stimmen der CDU das<br />
Wahlalter auf 16 Jahre festgelegt. Der oft<br />
emotional geführten Debatte mangelt es allerdings<br />
meist an einer nüchternen Bewertung<br />
der Fakten. Insbesondere sind bei der<br />
Entscheidung über das Wahlalter folgende<br />
Gesichtspunkte zu beachten (…):<br />
Artikel 38 des Grundgesetzes legt in Absatz 2<br />
zur Wahlberechtigung für die Wahlen zum<br />
Deutschen Bundestag fest: »Wahlberechtigt<br />
ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet<br />
hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat,<br />
mit dem die Volljährigkeit eintritt.« Für eine<br />
Änderung dieser Regelung wäre ein 2/3-Mehrheit<br />
im Deutschen Bundestag erforderlich.<br />
Zwar können die Bundesländer das jeweiligen<br />
Landtags- und Kommunalwahlrecht<br />
grundsätzlich autonom regeln, aber sie orientieren sich meist am<br />
Bundestagswahlrecht. Zwölf von 16 Bundesländern regeln das<br />
Wahlalter für Landtagswahlen und landesweite Volksabstimmungen<br />
in ihren Landesverfassungen. Da diese nur mit einer 2/3-Mehrheit<br />
bzw. teilweise nur durch Volksabstimmungen geändert<br />
werden können, ist eine Änderung des Wahlrechtes vor parteitaktischen<br />
Überlegungen geschützt. In den Landesverfassungen von<br />
Bayern (Art 14), Baden-Württemberg (Art. 73), Berlin (Art. 39),<br />
Hessen (Art. 73), Niedersachsen (Art. 8), Nordrhein-Westfalen<br />
(Art. 30), Rheinland-Pfalz (Art. 76), dem Saarland (Art. 64), Sachsen<br />
(Art. 4) Sachsen-Anhalt (Art. 42) und Thüringen (Art. 46), ist<br />
das Wahlalter ausdrücklich auf die Vollendung des 18. Lebensjahres<br />
festgelegt. (…)<br />
Auch im europäischen Ausland gilt generell die Wahlberechtigung<br />
ab 18 Jahren – mit Ausnahme von Österreich, wo 2007 das<br />
Wahlalter bei nationalen Wahlen auf 16 Jahre gesenkt wurde. International<br />
lassen bisher außerdem lediglich Brasilien, Nicaragua<br />
und Kuba (wo man von Wahlen gar nicht sprechen kann) ein<br />
Wahlrecht ab 16 Jahren zu. (…)<br />
Die Forderung nach einer Senkung des Wahlalters wirft die Frage<br />
auf, nach welchen Kriterien das Wahlalter festgelegt werden soll.<br />
Bisher galt das Erreichen der Volljährigkeit dafür als entscheidender<br />
Maßstab. So kündigte Bundeskanzler Willy Brandt in seiner<br />
Regierungserklärung »Mehr Demokratie wagen« vom 28. Oktober<br />
1969 miteinander verbunden Gesetzesinitiativen zur Absenkung<br />
des Wahlalters und der Volljährigkeit an. Die Umsetzung<br />
erfolgte zur Bundestagswahl 1972 mit der Absenkung des aktiven<br />
Wahlalters und (wegen der Vielzahl rechtlicher Folgeregelungen<br />
zeitlich verzögert) 1975 mit der Herabsetzung der Volljährigkeit<br />
(und damit der passiven Wahlberechtigung) auf 18 Jahre.<br />
Der Vorschlag nach einer weiteren Senkung des Wahlalters wird<br />
allerdings nicht mit der Forderung nach einer weiteren Absenkung<br />
der Volljährigkeitsgrenze verbunden. Die sich daraus ergebende<br />
Entkoppelung von Wahlberechtigung und Volljährigkeit<br />
führt zur grundsätzlichen Problematik, ob Bürgerrechte wie das<br />
Wahlrecht nicht an die Bürgerpflichten gebunden sein sollten, die<br />
zur Volljährigkeit gehören.<br />
Der innere Zusammenhang zwischen Wahlalter und Volljährigkeit<br />
konkretisiert sich in der Frage, warum jemand über die Geschicke<br />
der Gesellschaft mitentscheiden soll, den diese Gesellschaft noch<br />
nicht für reif genug hält, seine eigenen Lebensverhältnisse zu regeln:<br />
M 5 »… Jugendliche reifen heute wesentlich früher …« © Gerhard Mester, 2012<br />
16-Jährige dürfen in Deutschland Mofa fahren, aber nicht ohne<br />
Begleitung eines Erwachsenen ein Auto lenken. Sie dürfen in der<br />
Öffentlichkeit Bier trinken, aber keine hochprozentigen Alkoholika.<br />
Ohne Erlaubnis der Eltern dürfen sie eine Diskothek nur bis<br />
Mitternacht besuchen. Bei Gesetzesverstößen fallen 16-Jährige<br />
unter das Jugendstrafrecht. Heiraten darf man zwar ab 16, aber<br />
nur wenn ein Familiengericht dazu die Genehmigung erteilt und<br />
der Ehepartner bereits volljährig ist. Kaufverträge, die von Jugendlichen<br />
unter 18 Jahren ohne Zustimmung des gesetzlichen<br />
Vertreters geschlossen werden – zum Beispiel der Kauf eines<br />
Computers – sind nur wirksam, wenn sie aus Mitteln bezahlt werden,<br />
die ihnen vom gesetzlichen Vertreter oder mit dessen Zustimmung<br />
von einem Dritten überlassen worden sind.<br />
Dieser sog. »Taschengeldparagraph« (§ 110 des Bürgerlichen Gesetzbuches)<br />
gilt bis zur vollen Geschäftsfähigkeit mit Erreichen<br />
des 18. Lebensjahres.<br />
Es ist auffällig, dass auch die Befürworter einer Absenkung des<br />
Wahlalters nicht vorschlagen, dass an diesen Alterseinschränkungen<br />
etwas geändert wird. Sie plädieren nicht für eine Absenkung<br />
der Volljährigkeit. So gesehen ist die Wahlberechtigung für Minderjährige<br />
ein Widerspruch in sich, weil es das Wahlrecht von der<br />
Lebens- und Rechtswirklichkeit abkoppelt.<br />
Wenn das Wahlrecht von der Volljährigkeit entkoppelt wird, sind<br />
andere Altersgrenzen willkürlich, weil sie an kein objektives Kriterium<br />
geknüpft sind. Nach der Volljährigkeit ist im deutschen<br />
Rechtssystem allenfalls die Strafmündigkeit ab dem 14. Lebensjahr<br />
(§ 19 Strafgesetzbuch) ein wesentlicher Einschnitt. Mit dem<br />
Erreichen des 16. Lebensjahres werden hingegen nur einige Einschränkungen<br />
des Jugendschutzes gelockert (z. B. Ausgang ohne<br />
Erwachsenenbegleitung bis 24 Uhr). (…)<br />
Oft wird als Begründung für eine Senkung des Wahlalters das vermeintlich<br />
hohe Politikinteresse von minderjährigen Jugendlichen<br />
angeführt. Dafür gibt es keine empirischen Belege. Im Gegenteil<br />
stimmen die vorliegenden Studien darin überein, dass das Politikinteresse<br />
von 16/17-Jährigen deutlich geringer ausgeprägt ist als<br />
das von älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen.<br />
© Stephan Eisel: Wahlrecht, Volljährigkeit und Politikinteresse?, (Konrad-Adenauer-Stiftung),<br />
www.kas.de/wf/de/33.29980/, Stand: 18.10.2012, vgl. auch Blog:<br />
buergerbeteiligung.wordpress.com<br />
67<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
»Wahlalter 16« – eine Chance zur Überwindung der Politikverdrossenheit?
BÜRGERBETEILIGUNG IN DEUTSCHLAND UND EUROPA<br />
10. »Projekt Grenzen-Los!«<br />
Trinationale Zusammenarbeit für eine<br />
Engagementkultur<br />
JEANNETTE BEHRINGER<br />
68<br />
Das Projekt »Grenzen-Los! Freiwilliges Engagement<br />
in Deutschland, Österreich und der<br />
Schweiz« wurde im Jahr 2007 durch die Landeszentrale<br />
für politische Bildung Baden-Württemberg<br />
ins Leben gerufen. »Grenzen-Los« ist eine trinationale<br />
und trisektorale Kooperation, die Organisationen<br />
aus Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft<br />
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst.<br />
In ihr arbeiten acht Organisationen aus<br />
Deutschland, Österreich und der Schweiz zum<br />
Thema des zivilgesellschaftlichen, freiwilligen Engagements<br />
grenzüberschreitend zusammen. Seit<br />
Beginn der Kooperation haben sich umfassende<br />
Möglichkeiten des Austauschs zu länderspezifischen<br />
Lösungsansätzen und Akteuren entwickelt.<br />
Die Kooperation möchte sich zu einem Netzwerk<br />
weiterentwickeln, das neue Formen des grenzüberschreitenden,<br />
spezifischen Austauschs zur<br />
Thematik der weiteren Entwicklung einer demokratischen<br />
Zivilgesellschaft, des freiwilligen Engagements<br />
und partizipativer Strukuren sowie deren<br />
gesellschaftlichen Auswirkungen erarbeiten wird. Dabei sollen<br />
zunehmend die Rolle des Staates und der Unternehmen<br />
sowie die Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Strukturen<br />
grenzüberschreitend diskutiert werden.<br />
Abb. 1 Kongress »Grenzen-Los!«, 2009 in Konstanz © Andreas Kaier, Esslingen<br />
(SGG) sowie »MIGROS Kulturprozent«. Sind in Deutschland und<br />
Österreich Organisationen der öffentlichen Hand Trägerinnen<br />
von »Grenzen-Los!«, bearbeiten in der Schweiz vor allem zivilgesellschaftliche<br />
und wirtschaftliche Träger diese Aufgabe auf nationaler<br />
Ebene.<br />
Warum ein grenzüberschreitendes Projekt zum<br />
freiwilligen Engagement?<br />
Freiwilliges Engagement spielt in vielfältiger Form eine zentrale<br />
Rolle in unserer Gesellschaft: Als Träger von Lebensqualität, als<br />
Ausgangspunkt für ein gutes Zusammenleben, als Feld, in dem<br />
wichtige kommunale Aufgaben übernommen werden oder wenn<br />
es darum geht zu diskutieren, wie wir uns als Gesellschaft organisieren<br />
und weiterentwickeln. Das Netzwerk »Grenzen-Los!«, das<br />
Organisationen aus Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft aus<br />
Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst, widmete sich<br />
deshalb in einer Tagungsreihe der Frage »Wie gelingt es, dieses<br />
wichtige Engagement in unserer Gesellschaft bestmöglich zu unterstützen<br />
und zu fördern?«. Ziel der Kooperation ist der länderübergreifende<br />
Wissenstransfer sowie die Identifizierung gemeinsamer<br />
Fragestellungen und die Entwicklung von Lösungsansätzen.<br />
Nach einer Tagung in Konstanz (2009) und in Zürich (2010) beschäftigte<br />
sich die dritte Tagung des Netzwerks in Dornbirn, Österreich<br />
(2011), mit der Wechselwirkung von Beteiligung und Selbstorganisation<br />
als wesentlicher Aspekte bürgerschaftlichen<br />
Engagements.<br />
Die »Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg«<br />
lud für diese Konferenzen Vertreter des »Bundesministeriums für<br />
Familie, Senioren, Frauen und Jugend« (BMFSFJ), des »Bundesnetzwerks<br />
Bürgerschaftliches Engagement« (BBE) sowie des damaligen<br />
»Ministeriums für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg«<br />
ein. Aus Österreich sind das »Lebensministerium« sowie<br />
das »Büro für Zukunftsfragen des Landes Vorarlberg« beteiligt,<br />
aus der Schweiz die »Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft«<br />
Was kann Beteiligung und Selbstorganisation<br />
für die Förderung von Engagement leisten?<br />
Leitend für die Zusammenarbeit war der Gedanke, die Bedeutung<br />
des freiwilligen Engagements im deutschsprachigen Raum in seinen<br />
unterschiedlichen gesellschaftlichen Wirkungen als zentrales<br />
Element einer lebendigen Zivilgesellschaft und Demokratie, für<br />
sozialen Zusammenhalt und Stabilität sowie als Voraussetzung<br />
für eine Nachhaltige Entwicklung deutlich zu machen.<br />
Dazu trat der transdisziplinäre Wissensaustausch: Wissenschaft<br />
soll von Erfahrungen und drängenden offenen Fragen aus der<br />
Praxis Kenntnis erhalten, erfahrene Personen aus dem Feld erhalten<br />
eine »komprimierte Gelegenheit«, sich mit wissenschaftlichen<br />
Befunden zu Entwicklungen des freiwilligen Engagements<br />
auf gesellschaftlicher Ebene auseinanderzusetzen. Des Weiteren<br />
steht der Gedanke der grenzüberschreitenden Vernetzung im<br />
Zentrum: Menschen sollen sich begegnen, austauschen, vernetzen.<br />
Die erste Tagung (2009) hatte, ausgehend von der bundesdeutschen<br />
Diskussion, das Ziel, grundlegende und aktuelle Fragestellungen<br />
des Diskurses zum freiwilligen Engagement wie Ausmaß,<br />
aktuelle Erscheinungsformen, Akteure und Motivationen des freiwilligen<br />
Engagements, oder auch Voraussetzungen und Zugänge,<br />
Wirkungen von Engagement am Beispiel der interkulturellen Integration<br />
aufzugreifen. Die zweite Tagung hatte die in der schweizerischen<br />
Diskussion wichtige Frage nach der Rolle des freiwilligen<br />
Engagements als einen Beitrag für lokale Demokratie und<br />
sozialen Zusammenhalt in den Mittelpunkt gerückt. Diese wurden<br />
anhand spezifischer Fragestellungen weiter vertieft, zum Bei-<br />
»Projekt Grenzen-Los!« Trinationale Zusammenarbeit für eine Engagement kultur D&E Heft 65 · 2013
spiel in der Frage nach den Potenzialen des Engagements in der<br />
Integrations- und Inklusionsförderung oder im Rahmen von Generationenbeziehungen.<br />
Die dritte Tagung in Dornbirn tagte im<br />
Format einer Open Space Anordnung zum Thema »Engagement,<br />
politische Partizipation und Nachhaltige Entwicklung«.<br />
Gemeinsame Motivationen, unterschiedliche<br />
Kulturen<br />
In einer Zeit, in der das europäische Zusammenwachsen groß geschrieben<br />
wird, wird eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />
gern eingefordert. Dennoch: Was ist der »Mehrwert« eines solchen<br />
Projekts? Welche Erfahrungen und Erkenntnisse wurden bisher<br />
gesammelt? Und was können Entwicklungsperspektiven sein?<br />
Eine der wichtigsten Erkenntnisse war bisher: Je länger die Zusammenarbeit<br />
andauerte, je mehr voneinander gelernt und erfahren<br />
wurde, desto deutlicher traten auch die länderspezifische<br />
Unterschiede zutage. Da sich die Kooperation bislang im deutschsprachigen<br />
Raum bewegt, haben sich die Partnerorganisationen<br />
häufig in der unbewussten Annahme »ertappt«, dass sich freiwilliges<br />
Engagement in den drei Ländern mehr oder weniger ähnlich<br />
darstellt. Die Unterschiede sind jedoch größer als angenommen.<br />
Bereits bei der Suche nach einer gemeinsamen Begrifflichkeit hat<br />
die Diskussion zwischen den in der Schweiz eher gebräuchlichen<br />
Begriffen »Freiwilligkeit«, »Freiwilligenarbeit« und dem vor allem<br />
in Deutschland durch die Enquete-Kommission des Bundestags<br />
»Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements« geprägten Begriffs<br />
»Bürgerschaftliches Engagement« höchst unterschiedliche<br />
Auffassungen und Entwicklungen der politischen Kultur und deren<br />
Bedeutung für Zivilgesellschaft und Demokratie zutage gefördert.<br />
In der Schweiz sind die Gesellschaft und der Staat auf die freiwillige<br />
Tätigkeit seiner Bürgerinnen und Bürger wesentlich stärker<br />
angewiesen als in Österreich oder Deutschland. Insbesondere die<br />
staatliche Unterstützung auf der Ebene des Bundes ist strukturell<br />
weit weniger ausgeprägt. Aufgrund des stärkeren Föderalismus<br />
ist sie regional und lokal sehr unterschiedlich und wird stärker<br />
durch Kantone und Gemeinden wahrgenommen.<br />
Hingegen wird in den stärker repräsentativ-demokratischen Kulturen<br />
in Österreich und Deutschland die Rolle und der Charakter<br />
des freiwilligen Engagements nicht in erster Linie für den sozialen<br />
Zusammenhalt diskutiert, sondern wesentlich stärker in seiner<br />
Funktion als zusätzliches politisches Engagement wahrgenommen.<br />
Diese Diskussion wird durch die aktuelle Krise der Legitimation<br />
politischer Parteien und durch die Krise der Repräsentation<br />
verstärkt. So sind in Deutschland und in Österreich vermehrt<br />
staatliche Strukturen für die Förderung des freiwilligen Engagements<br />
vorhanden – gleichzeitig ist damit eine höhere Steuerung<br />
durch staatliche Instanzen vorgezeichnet.<br />
Länderstudien erfassen deshalb das, was als »freiwilliges Engagement«<br />
gilt, zum Teil unterschiedlich. Dennoch zeichnen sich auch<br />
gemeinsame Trends und Entwicklungen ab, wie zum Beispiel die<br />
zunehmende »Monetarisierung« im freiwilligen Engagement, ihre<br />
Multi-Funktionalisierung oder auch die immer größere Inanspruchnahme<br />
der Individuen durch den Arbeitsmarkt, die Zeitressourcen<br />
für freiwilliges Engagement geringer werden lassen.<br />
Gleichzeitig sind Seniorinnen und Senioren in allen Ländern eine<br />
Zielgruppe, deren Kompetenz, Gestaltungswille und auch deren<br />
Zeitressourcen in den kommenden Jahren erheblich mehr Gewicht<br />
gewinnen werden.<br />
Ausblick<br />
Geprägt durch diese Erfahrung von Gemeinsamkeit, aber auch<br />
Unterschieden im freiwilligen Engagement, ist es das Ziel des<br />
Netzwerks, nicht nur in einer Art »Länder-Benchmarking« die sich<br />
verändernden Nuancen eines »Wo engagieren sich die meisten in<br />
Abb. 2 Flipchart aus der Open-Space Konferenz »Grenzen-Los!« vom<br />
21./22. November 2011 in Dornbirn, Österreich © Jeannette Behringer<br />
welchen Themenfeldern?« zu betrachten. Vielmehr liegt das Interesse<br />
darin, in einer nächsten Phase spezifische Fragestellungen,<br />
die länderspezifisch einzigartig oder auch länderübergreifend<br />
beobachtet werden, vertieft zu diskutieren. Dies soll die Möglichkeit<br />
und die Chance bieten, sich gegenseitig zu unterstützen, länderübergreifende<br />
Lösungswege zu entwickeln, d. h. kollegiale<br />
Beratung zu leisten.<br />
Die Erweiterung um Organisationen aus anderen Ländern wäre<br />
deshalb nicht nur denkbar, sondern auch wünschenswert. Die Herausforderung<br />
in dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit<br />
besteht aktuell vor allem darin, einerseits einer naiven Ȇbertragungs-<br />
und Transferlogik« eines länderspezifisch gewachsenen<br />
Projektes zu entgehen, andererseits, trotz bestehender Unterschiede,<br />
Potenziale für die je eigene Kultur zu erkennen. Als wichtige<br />
Voraussetzung für dieses Ziel wird deshalb aktuell der qualitative<br />
Ansatz eines »Verstehen statt Vergleichen« (Rita Trattnigg)<br />
diskutiert.<br />
Literaturhinweise<br />
Europäisches Netzwerk Freiwilliges Engagement (Hrsg.) (2009): Grenzen-<br />
Los!. Freiwilliges Engagement in Deutschland, Österreich und der Schweiz.<br />
Dokumentation zur Internationalen Vernetzungskonferenz Konstanz,<br />
16./17. Februar 2009<br />
Der Bürger im Staat (BIS), Bürgerschaftliches Engagement, Nr. 4–2007.<br />
Gensicke, Thomas/Picot, Sybille/Geiss, Sabine: Freiwilliges Engagement in<br />
Deutschland 1999–2004, Wiesbaden, 2006.<br />
69<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
»Projekt Grenzen-Los!« Trinationale Zusammenarbeit für eine Engagement kultur
70<br />
JEANNETTE BEHRINGER<br />
MATERIALIEN<br />
M 1<br />
Thomas Olk: »Topographie des freiwilligen Engagements<br />
in Deutschland«<br />
Freiwilliges beziehungsweise bürgerschaftliches Engagement hat<br />
in Deutschland eine lange Tradition. So haben etwa im Verlaufe<br />
des 19. Jahrhunderts unterschiedliche Formen des bürgerschaftlichen<br />
Engagements (bürgerliche Sozialreform, Frauenbewegung,<br />
christliche Bewegungen sowie die Stein-Hardenberg’sche Kommunalreform)<br />
zur Entstehung des deutschen Sozialstaates beigetragen.<br />
Dennoch führten Formen des freiwilligen beziehungsweise<br />
bürgerschaftlichen Engagements in der Folgezeit ein<br />
Schattendasein, was nicht zuletzt mit der Expansion des deutschen<br />
Sozialstaates zusammenhängt. Erst in der zweiten Hälfte<br />
der 1970er Jahre stieg angesichts der Grenzen des Wachstums des<br />
Wohlfahrtsstaates die Aufmerksamkeit für die unterschiedlichen<br />
Formen des freiwilligen Engagements wieder an. Mit dem Internationalen<br />
Jahr der Freiwilligen (IJF) im Jahre 2001 und der Enquete-Kommission<br />
des Deutschen Bundestages »Zukunft des<br />
bürgerschaftlichen Engagements« (1999 bis 2002) erhielt das freiwillige<br />
Engagement sogar eine prominente öffentliche Sichtbarkeit,<br />
die mit der Initiative Zivil-Engagement (IZE) des Bundesministeriums<br />
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und<br />
dem Nationalen Forum für Engagement und Demokratie einen<br />
vorläufigen Höhepunkt erreicht hat.<br />
In Deutschland gibt es bis heute keinen Konsens hinsichtlich der<br />
Begrifflichkeit. Traditionell werden unentgeltliche und freiwillige<br />
Tätigkeiten im öffentlichen Raum mit dem Begriff des »Ehrenamtes«<br />
belegt. Inzwischen werden neben dem klassischen Begriff<br />
des Ehrenamtes insbesondere die Termini »freiwilliges Engagement«<br />
und »bürgerschaftliches Engagement« gebraucht. So verständigte<br />
sich die Enquete-Kommission im Jahr 1999 auf den Begriff<br />
des »bürgerschaftlichen Engagements«, um im Anschluss an<br />
republikanische Denktraditionen die gesellschaftspolitische Dimension<br />
freiwilligen Handelns zu betonen. Der erstmalig im Jahre<br />
1999 in Auftrag gegebene Freiwilligensurvey spricht relativ neutral<br />
von »freiwilligem Engagement«. Hinsichtlich der operativen<br />
Dimension gibt es allerdings Konsens dahingehend, dass es sich<br />
bei (freiwilligem beziehungsweise bürgerschaftlichem) Engagement<br />
um freiwillige, nicht auf materiellen Gewinn gerichtete, gemeinwohlorientierte<br />
und im öffentlichen Raum statt findende<br />
Tätigkeiten handelt, die in der Regel gemeinschaftlich beziehungsweise<br />
kooperativ ausgeübt werden. (…) International vergleichende<br />
Angaben lassen sich (…) aus dem ESS (»European Social<br />
Survey«) ableiten. Danach liegt der prozentuale Anteil<br />
ehrenamtlich Aktiver mit 24,6 Prozent in Deutschland deutlich<br />
über dem internationalen Durchschnitt (der bei 17,6 Prozent<br />
liegt). Die höchsten Beteiligungsquoten weisen Norwegen (36,6<br />
Prozent), Schweden (34,7 Prozent) und die Niederlande (30,6 Prozent)<br />
auf, die niedrigsten dagegen Italien (4,6 Prozent), Polen (5,6<br />
Prozent) und Portugal (6,1 Prozent). (…) Was die Tätigkeitsbereiche<br />
anbelangt, so bleibt der Bereich »Sport und Bewegung« nach<br />
wie vor der mit Abstand größte Bereich, gefolgt von »Schule/ Kindergarten«,<br />
»Kirche und Religion« sowie »Kultur und Musik« sowie<br />
dem »sozialen Bereich«. In dem Zeitraum zwischen 1999 und<br />
2004 sind insbesondere die Bereiche »Kindergarten/Schule«, »außerschulische<br />
Jugendarbeit und Erwachsenenbildung« sowie<br />
der »soziale Bereich« gewachsen. Dabei geht diese Zunahme in<br />
den beiden erstgenannten Bereichen auf das Konto der jungen<br />
Leute (14 bis 30 Jahre), während das Wachstum des »sozialen Bereichs«<br />
vor allem durch Menschen ab 40 Jahre getragen wird. (…)<br />
Das quantitative Ausmaß des freiwilligen Engagements ist in<br />
Deutschland mit 36 Prozent durchaus (für manche überraschend)<br />
hoch; mit dieser Engagementquote befindet sich Deutschland im<br />
internationalen Vergleich im oberen Mittelfeld. Allerdings gibt es<br />
eine hohe soziale Selektivität nach Bildungsstand, sozialer Vernetzung,<br />
ethnischer Zugehörigkeit, beruflicher Tätigkeit, etc.;<br />
M 2<br />
(…) Viele Organisationen klagen dennoch über einen Rückgang<br />
ehrenamtlicher Beteiligung und schwindender Bereitschaft zur<br />
Ausübung langfristig bindender Engagements etwa im Führungsund<br />
Leitungsbereich; hier erweist sich ein weiteres Mal, dass freiwilliges<br />
Engagement eine schwer zu bindende Ressource ist, die<br />
entsprechender Rahmenbedingungen bedarf<br />
© Thomas Olk: »Topographie des freiwilligen Engagements in Deutschland«, in: Grenzen-<br />
Los!, a. a. O., S. 22ff., www.lpb-bw.de/6014.html<br />
M 3<br />
Organisatorinnen, Organisatoren, Referentinnen und Referenten des Kongresses<br />
»Grenzen-Los!« in Konstanz 2009: (von links): Dr. Jeannette<br />
Behringer, Dr. Isabelle Stadelmann-Steffen, Professor Dr. Thomas Olk, Eva<br />
More-Hollerweger, Lothar Frick, Direktor der LpB Baden-Württemberg<br />
© Andreas Kaier, Esslingen<br />
Isabelle Stadelmann-Steffen: »Topographie des<br />
freiwilligen Engagements in der Schweiz«<br />
Rund ein Viertel der Schweizer Wohnbevölkerung ist innerhalb<br />
von Vereinsstrukturen freiwillig engagiert. Hierbei können die bereits<br />
in früheren Untersuchungen festgestellten Unterschiede<br />
zwischen der Romandie beziehungsweise dem Tessin und der<br />
Deutschschweiz bestätigt werden. In der Deutschschweiz sind<br />
substantiell mehr Personen freiwillig tätig, als dies in der lateinischen<br />
Schweiz der Fall ist. Dies gilt nicht nur für freiwillige Tätigkeiten<br />
im Allgemeinen, sondern ebenso für die Übernahme von<br />
Ehrenämtern im Besonderen. Mit einem Bevölkerungsanteil von<br />
gut zehn Prozent sind die meisten der formell Freiwilligen in<br />
Sport- und Freizeitvereinen tätig. Umgekehrt engagieren sich weniger<br />
als zwei Prozent in politischen Parteien oder in Menschenrechts-<br />
und Umweltverbänden.<br />
Darüber hinaus ist ein hoher sozialer Status, das heißt eine hohe<br />
Bildung, ein hohes Haushaltseinkommen und eine gute beru iche<br />
Stellung dem freiwilligen Engagement grundsätzlich förderlich.<br />
Demgegenüber ist die verfügbare Zeit nicht das wesentliche<br />
Merkmal formell Freiwilliger (…). Gerade Bevölkerungsgruppen,<br />
die im Prinzip über zeitliche Ressourcen verfügen, um sich in Vereinen<br />
und Organisationen freiwillig zu betätigen, wie etwa Rentner,<br />
Arbeitslose oder Teilzeiterwerbstätige, engagieren sich nicht<br />
so stark wie erwartet. Vielmehr ist die soziale Integration – sei es<br />
über den Beruf oder über familiäre Beziehungen und Freunde –<br />
von zentraler Bedeutung für ein freiwilliges oder ehrenamtliches<br />
Engagement. (…)<br />
In der Schweiz sind insgesamt über 37 Prozent der Bevölkerung<br />
informell, also außerhalb von Vereinen und Organisationen, freiwillig<br />
tätig. Ähnlich wie beim formell freiwilligen Engagement ergeben<br />
sich dabei erhebliche regionale Unterschiede. Vor allem in<br />
den Kantonen der Ost- und Zentralschweiz ist das informelle En-<br />
»Projekt Grenzen-Los!« Trinationale Zusammenarbeit für eine Engagement kultur<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013
gagement ausgeprägt, während in der Romandie und im Tessin<br />
ein deutlich geringerer Anteil von Personen informelle Freiwilligentätigkeit<br />
ausübt. Die informelle Freiwilligkeit kann dabei<br />
überwiegend mit persönlichen Hilfeleistungen für Freunde und<br />
Bekannte beschrieben werden: Rund zwei Drittel der informell<br />
Freiwilligen gehen im Rahmen ihres Engagements anderen Menschen<br />
zu Hilfe. (…) Das freiwillige Engagement der Schweizerinnen<br />
und Schweizer ist mehr als altruistisches Verhalten. Dies spiegelt<br />
sich auch in den wichtigsten Motiven der Ausübung formell<br />
freiwilliger Tätigkeiten wider. Während uneigennützige, wohltätige<br />
Aspekte zwar eine wichtige Rolle für die Übernahme von freiwilligen<br />
und ehrenamtlichen Aufgaben spielen, sind stärker<br />
selbstbezogene Argumente wie das Zusammensein mit Freunden<br />
oder der Spaß an der Tätigkeit für viele der Hauptgrund ihres freiwilligen<br />
Engagements. Obwohl der Ausübung freiwilliger Tätigkeiten<br />
damit in erster Linie persönliche Motive zu Grunde liegen,<br />
kommt der Anstoß für die Übernahme freiwilliger Arbeiten dennoch<br />
häufig von außen. Hier bilden persönliche Kontakte und<br />
Netzwerke den hauptsächlichen Beweggrund für freiwillige Tätigkeiten<br />
in Vereinen und Organisationen. Allgemeine Hinweise<br />
aus den Medien oder durch Informations- und Kontaktstellen<br />
geben nur in Einzelfällen den Anstoß für ein freiwilliges Engagement.<br />
© Isabelle Stadelmann-Steffen: »Topographie des freiwilligen Engagements in der<br />
Schweiz«, a. a. O.,S. 26ff., www.lpb-bw.de/6014.html<br />
M 4<br />
Eva More-Hollerweger: »Topographie des freiwilligen<br />
Engagements in Österreich«<br />
Freiwilligenarbeit findet in Österreich – wie in vielen Ländern – in<br />
unterschiedlichsten Bereichen und Formen statt. Ebenso vielfältig<br />
und facettenreich wie die Tätigkeiten sind die Personen, die<br />
sich ehrenamtlich engagieren und ihre Motive. Freiwilligenarbeit<br />
wird gerne als niederschwellige Möglichkeit gesehen, sich am gesellschaftlichen<br />
Leben zu beteiligen, die grundsätzlich allen Menschen<br />
offen steht. Empirische Ergebnisse zeigen jedoch, dass<br />
diese Möglichkeit nicht von allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen<br />
genutzt wird. Beispielsweise weisen erwerbstätige, besser<br />
gebildete Personen auch einen höheren Beteiligungsgrad bezüglich<br />
Freiwilligenarbeit auf. Die Entscheidung, sich freiwillig zu engagieren,<br />
ist nicht nur auf individuelle Präferenzen zurückzuführen,<br />
sondern wird durch verschiedenste Faktoren beeinflusst. Der<br />
Überblick über das freiwillige Engagement in Österreich beleuchtet<br />
die gesellschaftlichen, politischen und institutionellen Rahmenbedingungen.<br />
Dabei wird auf Daten zurückgegriffen, die im<br />
Rahmen einer Zusatzerhebung zum Mikrozensus Ende 2006 erhoben<br />
wurden und Aufschluss über das Ausmaß des freiwilligen Engagements<br />
und die Beteiligungsstruktur in Österreich geben. (…)<br />
Für die Erhebung wurde folgende Definition gewählt: Freiwilligenarbeit<br />
ist »eine Arbeitsleistung, die freiwillig (das heißt ohne<br />
gesetzliche Verpflichtung) geleistet wird, der kein monetärer Gegenfluss<br />
gegenübersteht (die also unbezahlt geleistet wird) und<br />
deren Ergebnis Konsumentinnen und Konsumenten außerhalb<br />
des eigenen Haushalts zufließt«. (…). Im Gegensatz zu anderen<br />
Studien wurde in dieser Erhebung auch informelle Freiwilligenarbeit<br />
in Betracht gezogen, also auch jene Form von Freiwilligenarbeit,<br />
die in keinem organisationellen Kontext stattfindet. Dabei<br />
handelt es sich vor allem um die Nachbarschaftshilfe.<br />
Durch die Art der Befragung ist es jedoch möglich, zwischen informeller<br />
und formeller Freiwilligenarbeit zu unterscheiden.<br />
Bereich<br />
Stunden pro Woche<br />
Katastrophenhilfsdienste 1.575.932<br />
Kultur, Kunst, Freizeit und Unterhaltung 1.761.588<br />
Umwelt-, Natur- und Tierschutz 349.906<br />
Kirchliche und religiöse Dienste 1.026.121<br />
Soziales und Gesundheit 564.689<br />
Politische Arbeit und Interessensvertretung 640.905<br />
Gemeinwesen 278.223<br />
Bildung 302.910<br />
Sport und Bewegung 1.418.408<br />
Summe formelle FWA 7.918.683<br />
Informelle FWA/Nachbarschaftshilfe 6.773.996<br />
Gesamt 14.692.679<br />
M 5<br />
Wöchentliches Arbeitsvolumen der Freiwilligenarbeit nach Tätigkeitsbereichen<br />
in Österreich © Eva More-Hollerweger, Topographie des freiwilligen<br />
Engagements in Österreich, in: Grenzen-Los! (2009); S. 32<br />
Demnach beteiligen sich 44 Prozent der österreichischen Bevölkerung<br />
über 15 Jahren in irgendeiner Weise an Freiwilligenarbeit,<br />
28 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher beteiligen<br />
sich an formeller Freiwilligenarbeit, 27 Prozent der Österreicherinnen<br />
und Österreicher leisten informelle Freiwilligenarbeit (…).<br />
Ehrenamtliche Arbeit ist per Definition eine Leistung für andere.<br />
Diese wird zwar nicht am Markt verkauft und hat daher keinen<br />
Preis, wohl aber einen ökonomischen Wert. Wie andere Aktivitäten<br />
jenseits des Marktes wurde ehrenamtliche Arbeit lange Zeit<br />
kaum als Beitrag zur Wohlfahrt wahrgenommen. Sie geht beispielsweise<br />
nicht in die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts<br />
ein, das als wesentlicher Wohlfahrtsindikator gilt und gemeinhin<br />
zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation eines Landes herangezogen<br />
wird. Zwar existieren mittlerweile alternative Systeme<br />
an Kennzahlen, deren Ziel es ist, ein stärker ganzheitliches Bild<br />
der ökonomi schen Lage von Ländern zu zeichnen beziehungsweise<br />
gibt es Bestrebungen, Nicht-Marktleistungen in das »system<br />
of national accounts« zu integrieren. Derlei Ansätze sind jedoch<br />
im Alltagsgebrauch wirtschaftlicher Kennzahlen noch wenig<br />
verbreitet. (…)<br />
Dies ist insofern problematisch, als unbezahlte Arbeit einen wesentlichen<br />
Beitrag für das Funktionieren einer Gesellschaft und<br />
damit auch für die ökonomische Leistungsfähigkeit eines Landes<br />
leistet.<br />
Insgesamt werden von Freiwilligen in Österreich<br />
– hochgerechnet aus den Daten der Mikrozensuszusatzerhebung<br />
– wöchentlich knapp 14,7 Millionen Arbeitsstunden geleistet,<br />
knapp 8 Millionen unter Einbindung in eine Organisation, also<br />
in Form von formeller Freiwilligenarbeit, 6,7 Millionen Arbeitsstunden<br />
werden in Form von informeller Freiwilligenarbeit geleistet<br />
(| M 4 |). In Summe entspricht dies der Arbeit von rund<br />
425.000 Vollzeitäquivalenten (40 Stunden). In Österreich<br />
kommt dies dem Arbeitsvolumen von 10,7 Prozent der unselbstständigen<br />
Erwerbstätigen gleich.<br />
© Eva More-Hollerweger: »Topographie des freiwilligen Engagements in Österreich«, in:<br />
Grenzen-Los!, a. a. O. S. 30ff., www.lpb-bw.de/6014.html<br />
71<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
»Projekt Grenzen-Los!« Trinationale Zusammenarbeit für eine Engagement kultur
DEUTSCHLAND & EUROPA INTERN<br />
D&E – Autorinnen und Autoren – Heft 65<br />
»Bürgerbeteiligung in Deutschland und Europa«<br />
Abb. 1 Gisela Erler, Staatsrätin für<br />
Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung<br />
im Staatsministerium der<br />
baden-württembergischen Landesregierung<br />
Abb. 2 Professorin Dr. Patrizia<br />
Nanz, Professorin für Politische<br />
Theorie an der Universität Bremen<br />
und Vorsitzende des 2009 gegründeten<br />
»European Institute for Public<br />
Participation« (EIPP)<br />
Abb. 3 Dr. Jan-Hendrik Kamlage,<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am<br />
Kulturwissenschaftlichen Institut<br />
Essen im Bereich Verantwortungskultur<br />
Abb. 4 Professor em. Dr. Oscar W.<br />
Gabriel, bis 2012 Leiter der Abteilung<br />
»Politische Systeme und Politische<br />
Soziologie« an der Universität Stuttgart<br />
72<br />
Abb. 5 Professor Dr. Franz Thedieck,<br />
Hochschule für öffentliche<br />
Verwaltung Kehl<br />
Abb. 6 Studiendirektor Dr. Andreas<br />
Grießinger, Fachreferent für<br />
Geschichte am Regierungspräsidium<br />
Freiburg (Gymnasien)<br />
Abb. 7 Dr. Jan-Hinrik Schmidt,<br />
Wissenschaftlicher Referent für<br />
Digitale Interaktive Medien und<br />
Politische Kommunikation, Hans-<br />
Bredow-Institut für Medienforschung,<br />
Hamburg<br />
Abb. 8 Professor em. Dr. Klaus Hurrelmann,<br />
Jugendforscher, 1979–2009<br />
Professor an der Universität Bielefeld.<br />
Seit seiner Emeritierung arbeitet er als<br />
Senior Professor of Public Health and<br />
Education an der Hertie School of<br />
Governance in Berlin.<br />
Abb. 9 Dr. Jan Kercher, Kommunikationswissenschaftler,<br />
Universität<br />
Stuttgart-Hohenheim, seit 2013<br />
Referent beim Deutschen Akademischen<br />
Austausch Dienst (DAAD)<br />
Abb. 10 Dr. Jeannette Behringer,<br />
bis 2009 Fachreferentin für Bürgerschaftliches<br />
und ehrenamtliches<br />
Engagement der LpB Ba-Wü; seither<br />
Studienleiterin für Gesellschaftsethik<br />
am ev. Studienzentrum Boldern in<br />
Männedorf/Zürich (CH)<br />
Abb. 11 Studiendirektor Jürgen<br />
Kalb, Fachreferent LpB, Fachberater<br />
für Geschichte, Gemeinschaftskunde<br />
und Wirtschaft am RP Stuttgart,<br />
Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium<br />
Stuttgart – Bad Cannstatt<br />
D&E – Autorinnen und Autoren D&E Heft 65 · 2013
Stafflenbergstraße 38, 70184 Stuttgart<br />
Telefon 0711/164099-0, Service -66, Fax -77<br />
lpb@lpb-bw.de, www.lpb-bw.de<br />
Direktor: Lothar Frick -60<br />
Büro des Direktors:<br />
Sabina Wilhelm -62<br />
Stellvertretender Direktor: Karl-Ulrich Templ -40<br />
Stabsstelle Kommunikation und Marketing<br />
Leiter: Werner Fichter -63<br />
Felix Steinbrenner -64<br />
Abteilung Zentraler Service<br />
Abteilungsleiter: Kai-Uwe Hecht -10<br />
Haushalt und Organisation: Gudrun Gebauer -12<br />
Personal: N. N. -13<br />
Information und Kommunikation: Wolfgang Herterich -14<br />
Klaudia Saupe -49<br />
Siegfried Kloske, Haus auf der Alb Tel.: 07125/152-137<br />
Abteilung Demokratisches Engagement<br />
Abteilungsleiterin/Gedenkstättenarbeit: Sibylle Thelen* -30<br />
Politische Landeskunde: Dr. Iris Häuser* -20<br />
Schülerwettbewerb des Landtags: Monika Greiner* -25<br />
Robby Geyer -26<br />
Frauen und Politik: Beate Dörr/Sabine Keitel -29/-32<br />
Jugend und Politik: Angelika Barth* -22<br />
Freiwilliges Ökologisches Jahr: Steffen Vogel* -35<br />
Alexander Werwein-Bagemühl* -36<br />
Charlotte Becher*, Stefan Paller* -34, -37<br />
Abteilung Medien und Methoden<br />
Abteilungsleiter/Neue Medien: Karl-Ulrich Templ -40<br />
Politik & Unterricht/Schriften zur politischen Landeskunde<br />
Baden-Württembergs: Dr. Reinhold Weber -42<br />
Deutschland & Europa: Jürgen Kalb -43<br />
Der Bürger im Staat/Didaktische Reihe:<br />
Siegfried Frech -44<br />
Unterrichtsmedien: Michael Lebisch -47<br />
E-Learning: Susanne Meir -46<br />
Politische Bildung Online: Jeanette Reusch-Mlynárik,<br />
Haus auf der Alb Tel.: 07125/152-136<br />
Internet-Redaktion: Klaudia Saupe, Julia Maier -49/-46<br />
Abteilung Haus auf der Alb<br />
Tagungszentrum Haus auf der Alb,<br />
Hanner Steige 1, 72574 Bad Urach<br />
Telefon 07125/152-0, Fax -100<br />
www.hausaufderalb.de<br />
Abteilungsleiter/Gesellschaft und Politik:<br />
Dr. Markus Hug -146<br />
Schule und Bildung/Integration und Migration:<br />
Robert Feil -139<br />
Internationale Politik und Friedenssicherung/<br />
Integration und Migration: Wolfgang Hesse -140<br />
Europa – Einheit und Vielfalt: Thomas Schinkel -147<br />
Bibliothek/Mediothek: Gordana Schumann -121<br />
Hausmanagement: Nina Deiß -109<br />
Außenstellen<br />
Regionale Arbeit<br />
Politische Tage für Schülerinnen und Schüler<br />
Veranstaltungen für den Schulbereich<br />
Außenstelle Freiburg<br />
Bertoldstraße 55, 79098 Freiburg<br />
Telefon: 0761/20773-0, Fax -99<br />
Leiter: Dr. Michael Wehner -77<br />
N. N. -33<br />
Außenstelle Heidelberg<br />
Plöck 22, 69117 Heidelberg<br />
Telefon: 06221/6078-0, Fax -22<br />
Leiter: Wolfgang Berger -14<br />
N. N. -13<br />
Außenstelle Tübingen<br />
Die Außenstelle Tübingen wurde zum 1.5.2012 aufgelöst.<br />
Projekt Extremismusprävention<br />
Stuttgart: Stafflenbergstraße 38<br />
Leiterin: Regina Bossert -81<br />
Assistentin: Friederike Hartl -82<br />
* Paulinenstraße 44–46, 70178 Stuttgart<br />
Telefon: 0711/164099-0, Fax -55<br />
LpB-Shops/Publikationsausgaben<br />
Bad Urach Hanner Steige 1, Telefon 07125/152-0<br />
Montag bis Freitag<br />
8.00–12.00 Uhr und 13.00–16.30 Uhr<br />
Freiburg Bertoldstraße 55, Telefon 0761/20773-10<br />
Dienstag und Donnerstag 9.00–17.00 Uhr<br />
Heidelberg Plöck 22, Telefon 06221/6078-11<br />
Dienstag, 9.00–15.00 Uhr<br />
Mittwoch und Donnerstag 13.00–17.00 Uhr<br />
Stuttgart Stafflenbergstraße 38,<br />
Telefon 0711/164099-66<br />
Mittwoch 14.00–17.00 Uhr<br />
Newsletter »einblick«<br />
anfordern unter www.lpb-bw.de/newsletter.html
DEUTSCHLAND & EUROPA IM INTERNET<br />
Aktuelle, ältere und vergriffene Hefte zum kostenlosen Herunterladen:<br />
www.<strong>deutschland</strong>und<strong>europa</strong>.de<br />
BESTELLUNGEN<br />
Alle Veröffentlichungen der Landeszentrale (Zeitschriften auch in Klassensätzen) können<br />
schriftlich bestellt werden bei:<br />
Landeszentrale für politische Bildung, Stabsstelle Kommunikation und Marketing<br />
Stafflenbergstraße 38, 70184 Stuttgart, Telefax 07 11/164 099-77<br />
marketing@lpb.bwl.de oder im Webshop: www.lpb-bw.de/shop<br />
Wenn Sie nur kostenlose Titel mit einem Gewicht unter 0,5 kg bestellen, fallen für Sie keine<br />
Versandkosten an. Für Sendungen über 0,5 kg sowie bei Lieferungen kostenpflichtiger<br />
Produkte werden Versandkosten berechnet.<br />
KOSTENPFLICHTIGE EINZELHEFTE UND ABONNEMENTS<br />
FÜR INTERESSENTEN AUSSERHALB BADEN-WÜRTTEMBERGS<br />
Abonnements für 6,– Euro pro Jahr (2 Hefte) über:<br />
LpB, Redaktion »Deutschland & Europa«, sylvia.roesch@lpb.bwl.de,<br />
Stafflenbergstraße 38, 70184 Stuttgart.<br />
www.lpb-bw.de