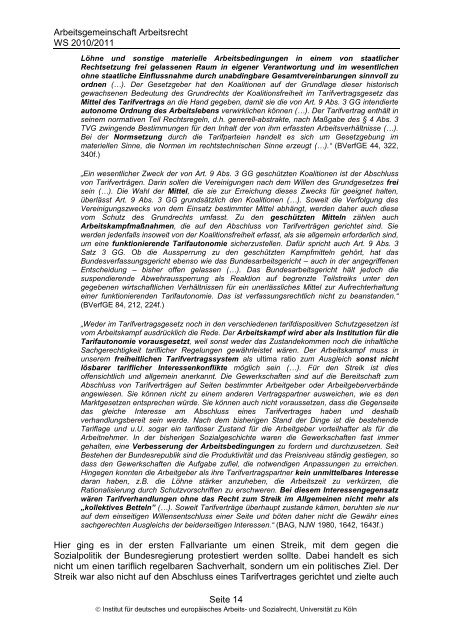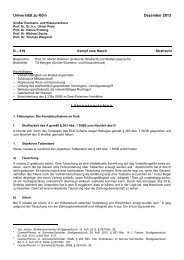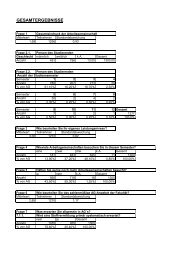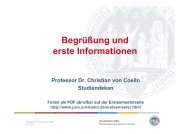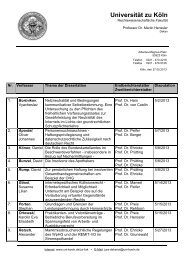Fall 3 - Lösung - Universität zu Köln
Fall 3 - Lösung - Universität zu Köln
Fall 3 - Lösung - Universität zu Köln
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht<br />
WS 2010/2011<br />
Löhne und sonstige materielle Arbeitsbedingungen in einem von staatlicher<br />
Rechtset<strong>zu</strong>ng frei gelassenen Raum in eigener Verantwortung und im wesentlichen<br />
ohne staatliche Einflussnahme durch unabdingbare Gesamtvereinbarungen sinnvoll <strong>zu</strong><br />
ordnen (…). Der Gesetzgeber hat den Koalitionen auf der Grundlage dieser historisch<br />
gewachsenen Bedeutung des Grundrechts der Koalitionsfreiheit im Tarifvertragsgesetz das<br />
Mittel des Tarifvertrags an die Hand gegeben, damit sie die von Art. 9 Abs. 3 GG intendierte<br />
autonome Ordnung des Arbeitslebens verwirklichen können (…). Der Tarifvertrag enthält in<br />
seinem normativen Teil Rechtsregeln, d.h. generell-abstrakte, nach Maßgabe des § 4 Abs. 3<br />
TVG zwingende Bestimmungen für den Inhalt der von ihm erfassten Arbeitsverhältnisse (…).<br />
Bei der Normset<strong>zu</strong>ng durch die Tarifparteien handelt es sich um Gesetzgebung im<br />
materiellen Sinne, die Normen im rechtstechnischen Sinne erzeugt (…).“ (BVerfGE 44, 322,<br />
340f.)<br />
„Ein wesentlicher Zweck der von Art. 9 Abs. 3 GG geschützten Koalitionen ist der Abschluss<br />
von Tarifverträgen. Darin sollen die Vereinigungen nach dem Willen des Grundgesetzes frei<br />
sein (…). Die Wahl der Mittel, die sie <strong>zu</strong>r Erreichung dieses Zwecks für geeignet halten,<br />
überlässt Art. 9 Abs. 3 GG grundsätzlich den Koalitionen (…). Soweit die Verfolgung des<br />
Vereinigungszwecks von dem Einsatz bestimmter Mittel abhängt, werden daher auch diese<br />
vom Schutz des Grundrechts umfasst. Zu den geschützten Mitteln zählen auch<br />
Arbeitskampfmaßnahmen, die auf den Abschluss von Tarifverträgen gerichtet sind. Sie<br />
werden jedenfalls insoweit von der Koalitionsfreiheit erfasst, als sie allgemein erforderlich sind,<br />
um eine funktionierende Tarifautonomie sicher<strong>zu</strong>stellen. Dafür spricht auch Art. 9 Abs. 3<br />
Satz 3 GG. Ob die Aussperrung <strong>zu</strong> den geschützten Kampfmitteln gehört, hat das<br />
Bundesverfassungsgericht ebenso wie das Bundesarbeitsgericht – auch in der angegriffenen<br />
Entscheidung – bisher offen gelassen (…). Das Bundesarbeitsgericht hält jedoch die<br />
suspendierende Abwehraussperrung als Reaktion auf begrenzte Teilstreiks unter den<br />
gegebenen wirtschaftlichen Verhältnissen für ein unerlässliches Mittel <strong>zu</strong>r Aufrechterhaltung<br />
einer funktionierenden Tarifautonomie. Das ist verfassungsrechtlich nicht <strong>zu</strong> beanstanden.“<br />
(BVerfGE 84, 212, 224f.)<br />
„Weder im Tarifvertragsgesetz noch in den verschiedenen tarifdispositiven Schutzgesetzen ist<br />
vom Arbeitskampf ausdrücklich die Rede. Der Arbeitskampf wird aber als Institution für die<br />
Tarifautonomie vorausgesetzt, weil sonst weder das Zustandekommen noch die inhaltliche<br />
Sachgerechtigkeit tariflicher Regelungen gewährleistet wären. Der Arbeitskampf muss in<br />
unserem freiheitlichen Tarifvertragssystem als ultima ratio <strong>zu</strong>m Ausgleich sonst nicht<br />
lösbarer tariflicher Interessenkonflikte möglich sein (…). Für den Streik ist dies<br />
offensichtlich und allgemein anerkannt. Die Gewerkschaften sind auf die Bereitschaft <strong>zu</strong>m<br />
Abschluss von Tarifverträgen auf Seiten bestimmter Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände<br />
angewiesen. Sie können nicht <strong>zu</strong> einem anderen Vertragspartner ausweichen, wie es den<br />
Marktgesetzen entsprechen würde. Sie können auch nicht voraussetzen, dass die Gegenseite<br />
das gleiche Interesse am Abschluss eines Tarifvertrages haben und deshalb<br />
verhandlungsbereit sein werde. Nach dem bisherigen Stand der Dinge ist die bestehende<br />
Tariflage und u.U. sogar ein tarifloser Zustand für die Arbeitgeber vorteilhafter als für die<br />
Arbeitnehmer. In der bisherigen Sozialgeschichte waren die Gewerkschaften fast immer<br />
gehalten, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen <strong>zu</strong> fordern und durch<strong>zu</strong>setzen. Seit<br />
Bestehen der Bundesrepublik sind die Produktivität und das Preisniveau ständig gestiegen, so<br />
dass den Gewerkschaften die Aufgabe <strong>zu</strong>fiel, die notwendigen Anpassungen <strong>zu</strong> erreichen.<br />
Hingegen konnten die Arbeitgeber als ihre Tarifvertragspartner kein unmittelbares Interesse<br />
daran haben, z.B. die Löhne stärker an<strong>zu</strong>heben, die Arbeitszeit <strong>zu</strong> verkürzen, die<br />
Rationalisierung durch Schutzvorschriften <strong>zu</strong> erschweren. Bei diesem Interessengegensatz<br />
wären Tarifverhandlungen ohne das Recht <strong>zu</strong>m Streik im Allgemeinen nicht mehr als<br />
„kollektives Betteln” (…). Soweit Tarifverträge überhaupt <strong>zu</strong>stande kämen, beruhten sie nur<br />
auf dem einseitigen Willensentschluss einer Seite und böten daher nicht die Gewähr eines<br />
sachgerechten Ausgleichs der beiderseitigen Interessen.“ (BAG, NJW 1980, 1642, 1643f.)<br />
Hier ging es in der ersten <strong>Fall</strong>variante um einen Streik, mit dem gegen die<br />
Sozialpolitik der Bundesregierung protestiert werden sollte. Dabei handelt es sich<br />
nicht um einen tariflich regelbaren Sachverhalt, sondern um ein politisches Ziel. Der<br />
Streik war also nicht auf den Abschluss eines Tarifvertrages gerichtet und zielte auch<br />
Seite 14<br />
© Institut für deutsches und europäisches Arbeits- und Sozialrecht, Universität <strong>zu</strong> Köln