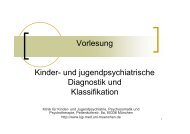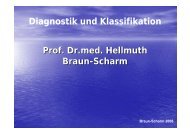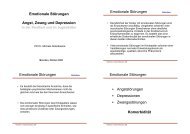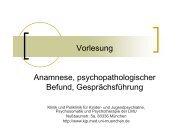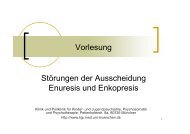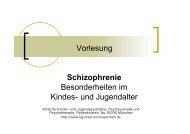Prognostische Validität des ELFRA-1 bei der Früherkennung von ...
Prognostische Validität des ELFRA-1 bei der Früherkennung von ...
Prognostische Validität des ELFRA-1 bei der Früherkennung von ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Originalar<strong>bei</strong>t<br />
18<br />
Hintergrund und Fragestellung<br />
Die gegenwärtige Betreuungssituation <strong>von</strong> Kin<strong>der</strong>n mit Sprachentwicklungsstörungen<br />
ist unbefriedigend. Im Rahmen <strong>der</strong><br />
<strong>Früherkennung</strong>suntersuchung im Alter <strong>von</strong> 12 Monaten (U6)<br />
wird die Sprachentwicklung durch ein einziges Item beurteilt<br />
(Silbenverdoppelungen wie „da-da“). Bei <strong>der</strong> U7 mit 24 Monaten<br />
wird etwas genauer nach dem Sprachentwicklungsstand gefragt.<br />
Trotzdem wird zu diesem Zeitpunkt nur je<strong>des</strong> vierte Kind mit einer<br />
Sprachentwicklungsverzögerung erkannt [16].<br />
Wenn eine Sprachretardierung auffällt, dann wird häufig anstelle<br />
<strong>der</strong> Verordnung einer Sprachtherapie zum Abwarten geraten.<br />
Im Durchschnitt vergehen bis zum Einsetzen einer logopädischen<br />
Behandlung ein bis zwei Jahre. Bei den meisten Kin<strong>der</strong>n<br />
beginnt eine Sprachtherapie erst im Alter <strong>von</strong> vier bis fünf Jahren,<br />
selbst wenn erhebliche Sprachdefizite bestehen [6]. Die sensible<br />
Phase <strong>der</strong> Sprachentwicklung bleibt somit ungenutzt, obwohl<br />
einige Untersuchungen darauf hinweisen, dass durch eine<br />
gezielte För<strong>der</strong>ung im Säuglings- bzw. Kleinkindalter die Manifestation<br />
einer Sprachentwicklungsstörung vermieden werden<br />
kann [18]. Zur Verbesserung <strong>der</strong> Entwicklungsprognose sprachentwicklungsgestörter<br />
Kin<strong>der</strong> sollte eine frühzeitige Intervention<br />
– z.B. in Form einer Anleitung <strong>der</strong> Eltern zu sprachför<strong>der</strong>ndem<br />
Verhalten – erfolgen [11]. Eine Frühför<strong>der</strong>ung setzt allerdings<br />
eine ausreichend zuverlässige <strong>Früherkennung</strong> voraus.<br />
Zunehmend wurden in den letzten Jahren Anstrengungen unternommen,<br />
Risikokin<strong>der</strong> für Sprachentwicklungsstörungen bereits<br />
in den ersten <strong>bei</strong>den Lebensjahren zu erkennen. Mehrere Ar<strong>bei</strong>tsgruppen<br />
versuchen <strong>der</strong>zeit zu klären, ob aus Lautäußerungen<br />
<strong>von</strong> Säuglingen Rückschlüsse auf den Spracherwerb und<br />
<strong>des</strong>sen Störung möglich sind. Erste Ergebnisse sprechen dafür,<br />
dass prosodische Merkmale eine Vorhersage erlauben [13].<br />
Ward [17] erfasste Wahrnehmung und Reaktion auf Sprache<br />
und Geräusche <strong>bei</strong> durchschnittlich zehn Monate alten Säuglingen.<br />
Nach Angaben <strong>der</strong> Autorin konnten so Probleme <strong>bei</strong>m<br />
Spracherwerb relativ sicher vorhergesagt werden. Bislang fehlen<br />
aber Replikationsstudien, so dass <strong>der</strong> prädiktive Wert <strong>des</strong> Screenings<br />
<strong>der</strong>zeitig nicht als gesichert gelten kann.<br />
Da Sprache ein wesentlicher Bereich <strong>der</strong> kognitiven Entwicklung<br />
ist, enthalten allgemeine Entwicklungstests in <strong>der</strong> Regel auch<br />
Skalen zur Sprachentwicklung. So verfügt z.B. die Münchener<br />
Funktionelle Entwicklungsdiagnostik – MFED [9] und <strong>der</strong> Entwicklungstest<br />
für Kin<strong>der</strong> <strong>von</strong> sechs Monaten bis sechs Jahre –<br />
ET 6/6 [14] über Skalen für Sprachproduktion und Sprachverständnis.<br />
Auch <strong>der</strong> Elternfragebogen zur kindlichen Entwicklung<br />
– EFkE [2] enthält 50 Fragen zur Sprachentwicklung. Entwicklungstests<br />
sind aber vorrangig zur Beurteilung <strong>der</strong> allgemeinen<br />
kognitiven Entwicklung konzipiert. Sie <strong>bei</strong>nhalten für jede Altersstufe<br />
nur wenige sprachliche Items, so dass sie keine differenzierte<br />
Aussage über den Sprachentwicklungsstand o<strong>der</strong> eine<br />
ausreichend zuverlässige <strong>Früherkennung</strong> <strong>von</strong> Störungen <strong>des</strong><br />
Spracherwerbs ermöglichen.<br />
Das erste, speziell für die <strong>Früherkennung</strong> <strong>von</strong> Sprachentwicklungsstörungen<br />
erar<strong>bei</strong>tete Verfahren im deutschsprachigen<br />
Raum ist <strong>der</strong> „Elternfragebogen zur Erfassung <strong>von</strong> Risikokin<strong>der</strong>n<br />
– <strong>ELFRA</strong>-1“ <strong>von</strong> Grimm u. Doil [7]. Dieses Sprach-Screening beruht<br />
auf zwei Elternfragebögen, die im angloamerikanischen Sprachraum<br />
weite Verbreitung gefunden haben, den MacArthur Communicative<br />
Development Inventories – CDI [4] und dem Language<br />
Development Survey – LDS [15]. Der <strong>ELFRA</strong>-1 ist für zwölf Monate<br />
alte Kin<strong>der</strong> normiert und für die Erfassung <strong>von</strong> sprachlichen Risikokin<strong>der</strong>n<br />
im Rahmen <strong>der</strong> U6 gedacht. Das Screening ist schnell<br />
durchführbar und einfach auszuwerten. Über die Zuverlässigkeit<br />
<strong>der</strong> Vorhersage einer Sprachentwicklungsstörung liegen bislang<br />
aber kaum Erfahrungen vor. Nach Angaben <strong>der</strong> Testautorinnen bestehen<br />
signifikante Korrelationen zwischen den Ergebnissen im<br />
<strong>ELFRA</strong>-1 und dem produktiven Wortschatz ein Jahr später. Über<br />
Spezifität und Sensitivität für die <strong>Früherkennung</strong> <strong>von</strong> Sprachentwicklungsstörungen<br />
fehlen Daten.<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Studie wird <strong>der</strong> Frage nachgegangen, ob <strong>der</strong><br />
<strong>ELFRA</strong>-1 Sprachauffälligkeiten <strong>bei</strong> zweijährigen Kin<strong>der</strong>n ausreichend<br />
sicher vorhersagt und ob ein routinemäßiger Einsatz <strong>bei</strong><br />
<strong>der</strong> U6 empfohlen werden kann. Des Weiteren wird versucht,<br />
Prädiktoren für die Sprachentwicklung <strong>von</strong> Risikokin<strong>der</strong>n zu<br />
identifizieren.<br />
An<strong>der</strong>e Ar<strong>bei</strong>tsgruppen überprüften die prognostische <strong>Validität</strong><br />
neurophysiologischer und neuropsychologischer Untersuchungen.<br />
Nach einer finnischen Risikokin<strong>der</strong>-Studie erlaubt die Ableitung<br />
<strong>der</strong> Mismatch Negativity (MMN) <strong>bei</strong> Neugeborenen eine<br />
Vorhersage <strong>der</strong> sprachlichen Fähigkeiten im Alter <strong>von</strong> zweieinhalb<br />
Jahren [8]. Die Mismatch Negativity ist eine Komponente<br />
<strong>der</strong> späten akustisch evozierten Potenziale und spiegelt die automatische<br />
Diskriminierung <strong>von</strong> Tönen und Lauten wi<strong>der</strong>. Mit einem<br />
an<strong>der</strong>en Ansatz wird untersucht, ob sich <strong>bei</strong> Säuglingen die<br />
zeitliche Auflösung akustischer Signale zur Vorhersage <strong>der</strong> späteren<br />
Sprachfähigkeit eignet. Benasich u. Mitarb. [1] berichteten<br />
über eine Korrelation zwischen <strong>der</strong> Diskriminationsfähigkeit<br />
schnell aufeinan<strong>der</strong> folgen<strong>der</strong> verbaler bzw. non-verbaler Reize<br />
im Säuglingsalter und <strong>der</strong> Sprachfähigkeit im Alter <strong>von</strong> drei Jahren.<br />
Die genannten Methoden zur <strong>Früherkennung</strong> im Säuglingsalter<br />
befinden sich gegenwärtig aber noch im experimentellen<br />
Stadium. Es gibt bislang we<strong>der</strong> ein standardisiertes Untersuchungs<strong>des</strong>ign<br />
noch Normwerte.<br />
Studien<strong>des</strong>ign und Untersuchungsmethoden<br />
Der <strong>ELFRA</strong>-1 wurde zusammen mit einem soziodemographischen<br />
Fragebogen an Eltern (n = 239) eine Woche vor dem ersten<br />
Geburtstag ihres Kin<strong>des</strong> geschickt. Die Adressen wurden dem<br />
Geburtsanzeiger einer Zeitung entnommen. Zur Beurteilung <strong>der</strong><br />
weiteren Sprachentwicklung wurden diejenigen Eltern, die den<br />
<strong>ELFRA</strong>-1 beantwortet hatten, ein Jahr später gebeten, den EL-<br />
FRA-2 [7] auszufüllen. In die Auswertung gingen Daten <strong>von</strong><br />
121 einsprachig deutsch aufwachsenden Kin<strong>der</strong>n, <strong>von</strong> denen<br />
<strong>der</strong> <strong>ELFRA</strong>-1 und <strong>der</strong> <strong>ELFRA</strong>-2 vorlagen, ein (Tab.1).<br />
Der <strong>ELFRA</strong>-1 besteht aus einer Wortliste mit 164 Wörtern. Die Eltern<br />
haben zu entscheiden, ob ihr Kind das jeweilige Wort „versteht“<br />
o<strong>der</strong> „versteht und spricht“. Weitere 67 Fragen zur Entwicklung<br />
sind mit „ja“ o<strong>der</strong> „nein“ zu beantworten. Die Wortliste<br />
und die Fragen werden vier Entwicklungsskalen (Sprachproduktion,<br />
Sprachverständnis, Gesten, Feinmotorik) zugeordnet. Der<br />
Wert für Sprachproduktion ergibt sich aus den als „versteht und<br />
Sachse S et al. <strong>Prognostische</strong> <strong>Validität</strong> <strong>des</strong> … Klin Pädiatr 2007; 219: 17–22