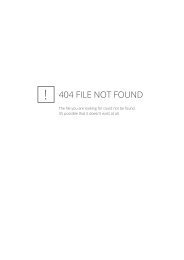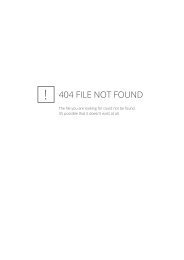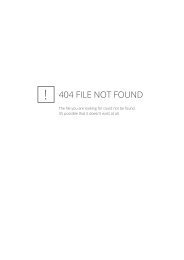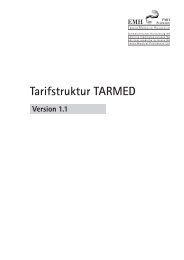Bulletin des médecins suisses 13-14/2013 - Schweizerische ...
Bulletin des médecins suisses 13-14/2013 - Schweizerische ...
Bulletin des médecins suisses 13-14/2013 - Schweizerische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Notes de lecture<br />
HORIZONS<br />
Leitfaden<br />
Susanne Wortmann-Fleischer,<br />
Regina von Einsiedel, George Downing<br />
Stationäre Eltern-Kind-Behandlung<br />
Ein interdisziplinärer Leitfaden<br />
Stuttgart: Kohlhammer; 2012<br />
284 Seiten. 39 Abb., 3 Tab. 78.90 CHF<br />
ISBN 978-3-17-021607-5<br />
Der interdisziplinäre Leitfaden für stationäre<br />
Eltern-Kind-Behandlungen versteht sich als<br />
Leitfaden im modernen Sinn: Es werden keine<br />
Leitlinien, in sich abgeschlossene Theorien<br />
oder übergeordnete Konzepte vorgestellt, sondern<br />
verschiedene interdisziplinäre Projekte<br />
beschrieben, die theoretisch breit und fundiert<br />
abgestützt sind, und so eine wichtige und anregende<br />
Orientierung für den klinisch tätigen<br />
Psychotherapeuten oder andere Fachleute bieten.<br />
Der Leitfaden ist auch eine wertvolle Unterstützung<br />
bei der Entwicklung und Implementierung<br />
von neuen Projekten in schon bestehenden<br />
Angeboten.<br />
Die Inhalte <strong>des</strong> Buches können sinnvoll in die<br />
therapeutische Arbeit übertragen werden.<br />
Intere ssierte Fachleute, die im ambulanten<br />
oder teilstationären Bereich tätig sind, finden<br />
Ideen und Referenzen, um ihre klinisch-therapeutischen<br />
Kompetenzen im Umgang mit<br />
Kleinkindern und ihren Eltern zu entwickeln.<br />
Zahlreiche Beispiele verdeutlichen, welche Auswirkungen<br />
die psychische Gesundheit der Eltern,<br />
insbesondere der Mütter, für die Entwicklung<br />
<strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> hat Es werden wertvolle Anhaltspunkte<br />
gegeben, die den Fachleuten die<br />
Beurteilung und das interdisziplinäre Management<br />
einer möglichen Kindsgefährdungs-<br />
Situa tion erlauben. In den verschiedenen Fallvignetten<br />
werden die Weichen für eine therapeutische<br />
Haltung im alltäglichen Umgang mit<br />
schwierigen Situationen gestellt.<br />
Die Wurzeln der Eltern-Kind Behandlung sind<br />
eindrücklich beschrieben, und es wird deutlich,<br />
dass die Vorgänger dieser Arbeiten einerseits<br />
aus der Sozialpsychiatrie, anderseits aus<br />
der Sozialpädiatrie und Säuglingsforschung<br />
(unter anderen mit der Arbeit von T. Berry Brazelton)<br />
stammen. Die verschiedenen, im Leitfaden<br />
beschriebenen theoretischen Ansätze<br />
lassen sich gut in die klinische Arbeit integrieren<br />
und ergänzen sich.<br />
Eine Frage stellt sich dem Leser, wird aber in<br />
diesem Leitfaden nicht beantwortet. Warum<br />
sprechen die Autoren von «Eltern-Kind-Behandlung»<br />
wenn es in den im Buch beschriebenen<br />
Beispielen meistens um «Mutter-Kind-<br />
Behandlungen» geht? Das Konzept bzw. der<br />
Titel <strong>des</strong> Leitfadens ist in diesem Sinn etwas<br />
irreführend. Eine Erwähnung zum Beispiel der<br />
Arbeiten von Fivaz und Depreusinges (The Primary<br />
Triangle, 1999) und Bürgin (Triangulierung,<br />
1998) hätte der Bedeutung der Triangulierungsphänomene<br />
– mit dem Vater als Bindungs-Figur<br />
– für die Entstehung von frühen,<br />
tragfähigen Bindungen und Mentalisierungsprozessen<br />
beim Kind Rechnung getragen.<br />
Wenn es sich hier um einen Mangel handeln<br />
soll, bestätigt es aber gleichzeitig die Vorzüge<br />
dieses Leitfadens: eine sehr lebendige Anregung<br />
für den klinischen Alltag, die Entwicklung<br />
innovativer Projekte und die Weiterführung<br />
der praktischen und theoretischen Diskussionen<br />
um die Eltern-Kind-Behandlung.<br />
Psychoanalyse<br />
Michael Schröter (Hrsg.)<br />
Sigmund Freud – Eugen Bleuler<br />
Hélène Beutler<br />
«Ich bin zuversichtlich, wir erobern bald die<br />
Psychiatrie»<br />
Briefwechsel 1904–1937<br />
Basel: EMH <strong>Schweizerische</strong>r Ärzteverlag; 2012<br />
287 Seiten, 2 Abb., 27 Faksimiles. 48 CHF<br />
ISBN 978-3-7965-2857-6<br />
Die Geschichte der Psychoanalyse ist ein Musterbeispiel<br />
für die Entwicklung einer Bewegung,<br />
einer Fachrichtung. Zuerst ist man für jeden Interessierten,<br />
jeden Anhänger offen, froh und<br />
dankbar, später baut man Barrieren in verschiedenen<br />
Formen: offizielle Mitgliedschaft,<br />
Mitgliederbeiträge, Prüfungen, Einhalten gewisser<br />
Regeln, und nicht zuletzt Loyalität. Mit<br />
der Zeit spalten sich aber neue Strömungen ab,<br />
entstehen neue Methoden, neue Fächer. Die<br />
Geschichte der Psychoanalyse ist ausserdem von<br />
breitem Interesse, weil diese nicht nur Psychiatrie<br />
und Psychologie beeinflusste, sondern<br />
auch Pädagogik, Kultur, besonders Literatur.<br />
Und so dürfte sich der Sohn von Eugen Bleuler,<br />
Manfred, ziemlich irren, als er meinte, die Korrespondenz<br />
zwischen Sigmund Freud und seinem<br />
Vater würde nicht viele Menschen interessieren,<br />
und auch aus anderen Gründen ihre<br />
Veröffentlichung verweigerte. Erst seine Tochter,<br />
Frau Jost-Bleuler, willigte ein, wofür ihr ein<br />
grosser Dank allseits gebührt. Diese Korrespondenz<br />
ist ein wichtiger Strahl, der uns die Entwicklung<br />
der Psychiatrie und der Psychoanalyse<br />
erleuchtet und näherbringt. Sie ist quasi<br />
eine lebendige Illustration von Freuds «Zur Geschichte<br />
der psychoanalytischen Bewegung».<br />
Ihre fachliche Bedeutung wird ausgezeichnet<br />
fachkundig gewürdigt im Vorwort und den<br />
zahlreichen detaillierten Fussnoten <strong>des</strong> Herausgebers<br />
Michael Schröter, beschlagener Historiker<br />
der Psychoanalyse, dem Frau Jost-Bleuler<br />
diese Aufgabe anvertraut hat, und im Nachwort<br />
von Bernhard Küchenhoff, Stellvertretender<br />
Direktor der Psychiatrischen Klinik Burghölzli.<br />
Bleuler und der ein Jahr ältere Freud weilten,<br />
zwar nicht gleichzeitig, zur «Weiterbildung» bei<br />
Charcot in Paris. In Folge übten beide Hypnose<br />
aus. Bleuler schätzte Freuds vorpsychoanalytische<br />
Arbeit «Zur Auffassung der Aphasien» aus<br />
dem Jahre 1891 sehr, wie auch später die<br />
«Traumdeutung». Fast wie ein Gesellschaftsspiel<br />
wurden im Burghölzli auch von Laien die<br />
Träume analysiert. In einem Brief schreibt<br />
Bleuler, dass seine Frau Hedwig, eine Germanistin,<br />
in der Traumdeutung besser, beschlagener<br />
sei als er. Bei all seiner Strenge, Genauigkeit<br />
und Vorsicht interessierte sich Bleuler für neue<br />
Methoden und Entwicklungen, die den Patienten<br />
dienen konnten. Eines der Motive, nicht<br />
nur dafür, aber schon für seine Berufswahl,<br />
könnte sein, dass seine Schwester, die mit ihm<br />
in einem Haushalt lebte, unter Schizophrenie<br />
litt. Er war der einzige Ordinarius im deutschsprachigen<br />
Raum, der sich der Psychoanalyse<br />
zuwandte. Freud war sehr erfreut, dass seine<br />
Methode Interesse und Zuflucht in Zürich<br />
fand. Trotz gegenseitiger Hochachtung nervten<br />
sich gelegentlich beide gegenseitig. Freud<br />
erhoffte sich und verlangte auch nach mehr<br />
Unterstützung für seine Methode und die psychoanalytischen<br />
Organisationen, was Bleuler<br />
mit der Zeit verweigerte, auch weil er nach<br />
mehr Beweisen für die Behauptungen Freuds<br />
und seiner Schüler verlangte. Aber erst die gegenwärtige<br />
Neurowissenschaft vermag sie zu<br />
liefern. Beide wollten den brillanten Jung in ihren<br />
Kreisen nicht unter-, sondern einordnen<br />
und behalten, der aber unbedingt ein eigenes<br />
Haus bestellen und in ihm eigener Herr bleiben<br />
wollte. Die Auseinandersetzungen zwischen<br />
Bleuler und Freud wurden freundlich, souverän,<br />
sachlich und würdig ausgetragen, ein Beispiel<br />
für alle, die in solche Konflikte geraten.<br />
Sie schätzten sich, und auch wenn die Häufigkeit<br />
der Korrespondenz nachliess, sie blieben<br />
auch im persönlichen Kontakt. In späteren<br />
Jahren wandten sich beide unabhängig<br />
vonein ander dem Okkultismus zu, Freud vor<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
<strong>Bulletin</strong> <strong>des</strong> médecins <strong>suisses</strong> | <strong>Schweizerische</strong> Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 20<strong>13</strong>;94: <strong>13</strong>/<strong>14</strong><br />
536