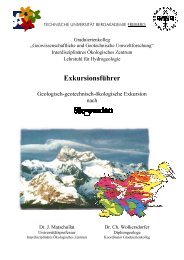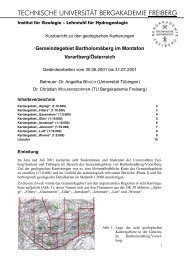PDF Download 1,4 MB - Christian Wolkersdorfer
PDF Download 1,4 MB - Christian Wolkersdorfer
PDF Download 1,4 MB - Christian Wolkersdorfer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DEPARTMENT FÜR GEO- UND<br />
UMWELTWISSENSCHAFTEN<br />
AG HYDROGEOLOGIE UND UMWELTGEOLOGIE<br />
Zwischenbericht<br />
Vorhabenbezeichnung:<br />
„MonKü – Monitoring von Kühlwasserversickerung bei<br />
tiefen Geothermieanlagen am Beispiel Unterhaching“<br />
Zuwendungsempfänger: Ludwig-Maximilians-Universität München<br />
Förderkennzeichen: 0325039<br />
Laufzeit des Vorhabens: 1. März 2008 bis 31. Mai 2009<br />
Berichtszeitraum: 1. August 2008 bis 31. März 2009<br />
Berichterstatter:<br />
Dipl.-Geol. Markus KANTIOLER, Prof. Dr. <strong>Christian</strong><br />
WOLKERSDORFER<br />
Ziel des Vorhabens ist es, am Beispiel der Geothermieanlage Unterhaching eine<br />
ökologisch akzeptable und ökonomisch realisierbare Methode zu entwickeln, um<br />
konditioniertes und eingedicktes Kühlwasser geothermischer Energiegewinnung so<br />
aufzubereiten, dass es bedenkenlos zurück in den Aquifer injiziert werden kann.<br />
Zugleich soll der reaktive Stofftransport in der ungesättigten Zone und im Aquifer<br />
unterhalb des Versickerungsbereichs untersucht werden.<br />
Dazu soll das in der Geothermieanlage anfallende Kühlwasser untersucht und über<br />
eine passive Reinigungsanlage gereinigt werden. Zur Untersuchung des reaktiven<br />
Stofftransports in der ungesättigten Zone soll das bestehende Monitoring ergänzt<br />
werden. Weiterhin wird ein bestehendes numerisches Modell an die aktuellen<br />
Verhältnisse in Unterhaching angepasst und mittels einer neu zu errichtenden<br />
Grundwassermessstation kalibriert.<br />
Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich für dezentrale geothermische<br />
Kraftwerke nutzen, bei denen das Kühlwasser zurück in einen Aquifer gepumpt oder<br />
versickert werden muss und bei denen alternative Kühlwasserreinigungsanlagen<br />
(z.B. Umkehrosmose, Nanofiltration oder Ionenaustausch) nicht in Frage kommen.<br />
Prof. Dr. <strong>Christian</strong> <strong>Wolkersdorfer</strong><br />
Cape Breton University<br />
Sydney, Nova Scotia, Canada<br />
Dipl. Geol. Markus Kantioler<br />
Luisenstr. 37/I, Zimmer 119<br />
80333 München
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 2 VON 12<br />
1 Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen<br />
Ergebnisse und anderer wesentlicher Ereignisse<br />
1.1 Laborversuche zur Reduzierung der Sulfatfracht des zu versickernden<br />
Kühlwassers<br />
Als Basis der Laborversuche zur Reduzierung der Sulfatfracht des Kühlwassers<br />
diente eine während eines Probelaufes gewonnene Wasserprobe aus dem Ablauf der<br />
Geothermieanlage. Anhand der Analysedaten dieser Probe wurde das synthetische<br />
Abschlämmwasser hergestellt und in den Laborversuchen als vorübergehendes<br />
Medium verwendet. Während die überwiegende Anzahl der gemessenen Parameter<br />
im Originalwasser die erwarteten Werte zeigten, konnten im Abschlämmwasser<br />
gegenüber dem Grundwasser deutlich erhöhte Gehalte von Kupfer (6,4 μg/L) und<br />
Chrom (64,5 μg/L) nachgewiesen werden, die nicht bereits im Kühlwasser enthalten<br />
waren. Dadurch erweiterte sich die Aufgabenstellung der Experimente um die<br />
Entfernung dieser beiden Metalle aus dem Abschlämmwasser. Insgesamt wurden vier<br />
verschiedene Versuchsaufbauten entwickelt:<br />
Zunächst wurde in einem Kolonnenversuch die Versickerung des Kühlwassers ohne<br />
vorherige Behandlung simuliert, um die Reinigungswirkung des Bodens bzw. des<br />
Grundwasserleiters zu untersuchen. Zur Befüllung der Säule wurde Kies verwendet,<br />
der aus dem Bohrkern der neu errichteten neuen Grundwassermessstation GWM15<br />
gewonnen wurde (siehe Kapitel 1.2). Um die Versickerung realitätsnah<br />
nachzustellen, wurden jeweils vier Liter des Kühlwassers in 22 Umläufen durch die<br />
Säule versickert. Die sich ergebende Sickerstrecke von 22 m entspricht dem vor Ort<br />
gegeben Grundwasserflurabstand.<br />
Trotz der relativ langen Sickerstrecke konnte keine Reduktion der Sulfatfracht des<br />
Kühlwassers festgestellt werden, jedoch reduzierte sich der Kupfergehalt um<br />
durchschnittlich etwa 50 %, das Chrom konnte fast vollständig aus dem Wasser<br />
entfernt werden.<br />
Ein weiterer Versuchsaufbau bildet das in Unterhaching zur Versickerung des<br />
Kühlwassers konstruierte Feuchtgebiet nach. Wie im zuvor beschriebenen Versuch<br />
konnte auch dabei eine deutliche Reduzierung der Chrom- und Kupfergehalte<br />
erreicht werden, während die Sulfatwerte annähernd unverändert blieben.<br />
Um die erhöhten Kupfer- und Chromgehalte gezielt zu entfernen, wurde die Sorbtion<br />
dieser Metalle an Eisenoxihydratoberflächen (Produkt E33 der Bayer AG) untersucht.<br />
Dabei wurde eine mit Eisenoxihydrat gefüllte Säule mit dem hergestellten<br />
Kühlwasser durchströmt. Wiederum konnten die Kupfer- und Chromgehalte des<br />
Kühlwassers nahezu komplett entfernt werden.<br />
In einem vierten Experiment flossen die bisher erlangten Erkenntnisse in die<br />
Entwicklung eines Versuchsaufbaus aus drei hintereinandergeschalteten Säulen ein.<br />
Um reduzierende Bedingungen und damit eine mögliche eine Reduktion des Sulfates<br />
zu Sulfid zu erreichen, wurde die erste Säule mit organischem Material – in diesem<br />
Falle Kompost – befüllt. Eine zweite mit gebranntem Tongranulat befüllte Säule<br />
sollte als Substrat für Sulfat reduzierende Bakterien dienen. Diese Bakterien<br />
siedelten jedoch bevorzugt in der ersten Säule. Um die Entfernung der Chrom- und
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 3 VON 12<br />
Kupfergehalte des Wassers sicherzustellen, wurde wiederum eine mit Eisenoxihydrat<br />
befüllte Säule angeschlossen.<br />
In Abhängigkeit der erreichten Redoxpotentiale konnte in diesem Experiment ein<br />
leichter Rückgang der Sulfatfracht festgestellt werden. Es besteht jedoch vor allem<br />
in der Stabilisierung des Redoxpotentials noch einiger Forschungsbedarf.
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 4 VON 12<br />
1.2 Verdichtung des Grundwassermessnetzes im Bereich der<br />
Geothermieanlage in Unterhaching<br />
Um zuverlässige Aussagen über die Beschaffenheit der Grundwasser- und<br />
Tertiäroberfläche treffen zu können, sind Informationen – in der Regel in Form von<br />
Bohrprofilen und Grundwassermessstellen – in ausreichender Zahl, sowie in einer<br />
homogenen Verteilung erforderlich. Im Untersuchungsgebiet dieses Projektes treffen<br />
diese Bedingungen jedoch nur teilweise zu. Während im Norden, Osten und Westen<br />
Grundwassermessstellen in ausreichender Zahl vorhanden sind, liegen im Süden und<br />
vor allem im Zentrum des Gebietes kaum Informationen zum Flurabstand vor. Daraus<br />
ergeben sich große Unsicherheiten bei der Interpolation innerhalb dieser nicht<br />
erschlossenen Bereiche. Um einen möglichst hohen Nutzen der neu zu errichtenden<br />
Grundwassermessstelle zu erreichen, wurde diese im Zentrum des am wenigsten<br />
erschlossenen Bereiches angelegt (siehe Anhang 1)<br />
Während der Einrichtung der Grundwassermessstelle wurde der gesamte<br />
Bauvorgang überwacht und in Form eines Bohrprofils dokumentiert (siehe<br />
Anhang 2). Die Schichtenfolge zeigt die für die Münchener Schotterebene typischen<br />
sandigen, leicht schluffigen Kiese mit vereinzelten konglomeratischen Lagen.<br />
Entgegen der erwarteten Tiefe von etwa 30 m unter Geländeoberkante wurde die<br />
Tertiäroberfläche bereits bei 26,2 m erbohrt, was die bisherige Vorstellung in Bezug<br />
auf die Topografie der Tertiäroberfläche an dieser Stelle vollständig verändert.<br />
Während in der bereits exisitierenden numerischen Strömungsmodellierung eine im<br />
Bereich des Perlacher Forstes annähernd ebene, nur leicht nach Norden geneigte<br />
Tertiäroberfläche angenommen wurde, zeigt sich dort bei der Regionalisierung der<br />
aktualisierten Daten ein ausgeprägter, nach Nordnordost ziehender Höhenrücken<br />
innerhalb dieser Fläche (siehe Anhang 3 und 4). Dieser Höhenzug stellt regional eine<br />
unterirdische Wasserscheide dar, die als neue Randbedingung in der nun<br />
durchzuführenden numerischen Strömungsmodellierung Verwendung findet. Analog<br />
der Tertiäroberfläche liegt auch die Grundwasseroberfläche in diesem Bereich etwa<br />
vier Meter höher als bisher angenommen. Die Anhänge 5 und 6 zeigen die<br />
Grundwassergleichenkarte, je einmal mit und einmal ohne die neue Grundwassermessstelle<br />
GWM15<br />
Diese beiden Erkenntnisse erfordern eine Neuinterpretation der hydrogeologischen<br />
Verhältnisse im Bereich der Geothermieanlage in Unterhaching.
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 5 VON 12<br />
1.3 Modellierung der hydrogeologischen Situation im Bereich der Geothermieanlage<br />
in Unterhaching<br />
Die numerische Modellierung der hydrogeologischen Verhältnisse im Projektgebiet<br />
hat zum einen das Ziel, die Ausbreitung und Vermischung des versickerten<br />
Kühlwassers mit dem Grundwasser vorhersagen zu können. Zum anderen soll eine<br />
eventuelle Beeinflussung der auf dem nördlich gelegenen Infiniongelände<br />
installierten Kühlanlagen prognostiziert und quantifiziert werden.<br />
Zunächst wurden die durch die zusätzliche Grundwassermessstelle GWM 15<br />
aktualisierten Datensätze der Tertiär- und Grundwasseroberfläche erneut<br />
regionalisiert und die Ergebnisse auf ihre Plausibilität hin untersucht. Anhand dieser<br />
neuen Flächendaten wurde der Bilanzraum der numerischen Modellierung<br />
festgelegt. Im Osten und Westen wird das Modell von Randbedingungen 2. Art<br />
begrenzt. Diese werden durch eine konstante Zu- bzw. Abflussmenge in eine<br />
bestimmte Richtung definiert. Im Fall dieser Modellierung wurde die Zu- bzw.<br />
Abflussmenge gleich null gesetzt, da die Modellgrenzen rechtwinkelig zu den<br />
Grundwassergleichen verlaufen und in dieser Richtung kein Transport stattfindet.<br />
Als nördliche und südliche Grenzen wurden Randbedingungen 1. Art gesetzt. Bei<br />
dieser Art der Modellgrenzen wird eine feste Piezometerhöhe definiert, wobei der<br />
Zu- bzw. Abstrom variabel bleibt. Als Grundlage dieser Begrenzungen wurden<br />
wiederum Grundwassergleichen herangezogen; diesmal ist der Verlauf der Grenzen<br />
jedoch parallel dazu.<br />
Um die hydrogeologischen Verhältnisse des Untersuchungsgebietes realistisch zu<br />
modellieren, muss das numerische Modell kalibriert werden. Da die hydraulische<br />
Durchlässigkeit des Grundwasserleiters die unsicherste veränderbare Größe im<br />
Modell darstellt, wurde die Kalibrierung anhand dieser Variablen durchgeführt.<br />
Zunächst wurden die Bereiche, in denen die hydraulische Durchlässigkeit bekannt<br />
ist, mit den vorhandenen Werten belegt. Alle restlichen Zellen erhielten einen<br />
Mittelwert. Anhand der als Ergebnis der Simulation erstellten Grundwassergleichen<br />
wurden die Unterschiede zur tatsächlichen Grundwasseroberfläche ermittelt und die<br />
hydraulischen Durchlässigkeiten der betroffenen Bereiche verändert. Dieser Vorgang<br />
hat allerdings der Grundannahme zu folgen, dass sich die Münchener Schotterebene<br />
zunächst entlang des Reliefs der Tertiäroberfläche abgelagert haben muss. In Folge<br />
dessen muss eine Abhängigkeit der hydraulischen Durchlässigkeiten von den<br />
Strukturen der Tertiäroberfläche berücksichtigt werden.<br />
Obwohl die Kalibrierung des numerischen Modells zum Zeitpunkt dieses Berichts<br />
noch nicht abgeschlossen ist, kann generell eine Steigerung der hydraulischen<br />
Durchlässigkeit von Süden nach Norden beobachtet werden. Zusätzlich zu diesem<br />
Trend sind Bereiche mit erhöhter Durchlässigkeit vor allem entlang von Vertiefungen<br />
in der Tertiäroberfläche festzustellen.<br />
Insgesamt sind durch diese numerische Modellierung, die das bisherige numerische<br />
Modell (Diplomarbeit MÜLLER 2006) ersetzen wird, gute und belastbare Ergebnisse<br />
zu erwarten.
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 6 VON 12<br />
2 Vergleich des Standes des Vorhabens mit der ursprünglichen<br />
Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplanung<br />
Nach erheblichen Schwierigkeiten mit der Kalina-Technik ist nun in Unterhaching<br />
die Stromerzeugung der Geothermieanlage in Betrieb gegangen. Während die<br />
Experimente zur passiven Entfernung bzw. Reduzierung der Sulfatfracht des zu<br />
versickernden Kühlwassers bisher nur anhand synthetisch hergestellten Wassers<br />
durchgeführt werden konnten, ergibt sich nun die Möglichkeit die Experimente<br />
erstmals mit dem tatsächlich anfallenden Kühlwasser durchzuführen. Zusätzlich kann<br />
nun auch die Sulfataufnahme der im Sickerbecken wachsenden Pflanzen, sowie eine<br />
eventuelle Akkumulation von Sulfatverbindungen in deren Substrat untersucht<br />
werden.<br />
Auf Grund der jetzt entstandenen neuen Situation erscheint eine kostenneutrale<br />
Verlängerung dieses Forschungsvorhabens sinnvoll, da sich der Versuchsteil im<br />
Labor und Gelände aufgrund der oben dargestellten Situation um ca. ein dreiviertel<br />
Jahr verzögert hat.<br />
3 Aussichten für die Erreichung der Ziele des Vorhabens<br />
Nach den in Punkt 2 genannten technischen Schwierigkeiten und den damit<br />
verbundenen Problemen zu Begin dieses Forschungsvorhabens stehen die<br />
Aussichten nun sehr gut, die festgelegten Ziele zu erreichen.<br />
Mit der fast vollständigen Entfernung der Chrom- und Kupfergehalte aus dem<br />
Abschlämwasser konnte ein weiteres, erst im Verlauf des Projektes entstandenes Ziel<br />
erreicht werden.<br />
4 Für die Durchführung des Vorhabens relevante Ergebnisse Dritter<br />
Bisher sind keine ähnlichen Projekte bekannt.<br />
5 Notwendige Änderungen in der Zielsetzung des Vorhabens<br />
Es sind keine Änderungen in der Zielsetzung des Vorhabens notwendig.<br />
6 Verwertungsplan<br />
Es ist keine Verwertung der Ergebnisse zum Erzielen von Gewinnen vorgesehen.
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 7 VON 12<br />
7 Anhang<br />
Anhang 1<br />
GWM 15<br />
GWM 15<br />
Anhang 1: Übersichtskarte über das Projektgebiet
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 8 VON 12<br />
Anhang 2<br />
Anhang 2: Bohrprofil und Ausbauplan der neu errichteten Grundwassermessstelle<br />
GWM15
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 9 VON 12<br />
Anhang 3<br />
GWM 15<br />
Anhang 3: Isohypsenkarte der Tertiäroberfläche mit der neu errichteten Grundwassermessstelle<br />
GWM15
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 10 VON 12<br />
Anhang 4<br />
Anhang 4: Isohypsenkarte der Tertiäroberfläche ohne die neu errichtete Grundwassermessstelle<br />
GWM15
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 11 VON 12<br />
Anhang 5<br />
GWM 15<br />
Anhang 5: Isohypsenkarte der Grundwasseroberfläche mit der neu errichteten<br />
Grundwassermessstelle GWM15
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 12 VON 12<br />
Anhang 6<br />
Anhang 6: Isohypsenkarte der Grundwasseroberfläche ohne die neu errichtete<br />
Grundwassermessstelle GWM15