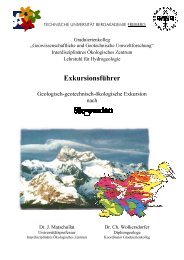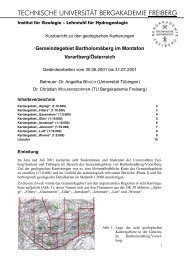Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bericht zur Exkursion nach Slowenien<br />
vom 18.09. bis 03.10.2000<br />
Technische Universität Bergakademie Freiberg<br />
Graduiertenkolleg<br />
"Geowissenschaftliche und Geotechnische Umweltforschung"<br />
Inerdisziplinäres Ökologisches Zentrum<br />
Lehrstuhl für Hydrogeologie<br />
Leitung:<br />
Prof. Dr. J. Matschullat<br />
Dr. Ch. Wolkersdorfer<br />
Bearbeiter: <strong>Claudia</strong> <strong>Blume</strong><br />
1
Bericht zum 29.09.2000<br />
Thema 1: Grundwasserprobleme und Bergbau im Šalek-Tal<br />
EINFÜHRUNG<br />
Das erste Ziel dieses Exkursionstages, Rudnik Lignita Velenje, ein Kohlebergwerk nahe der<br />
Stadt Velenje, liegt im Zentrum Nord-Sloweniens im Šalek-Tal, in der Velenje-Senke.<br />
(Abb.1)<br />
HISTORISCHE ENTWICKLUNG<br />
Erste schriftliche Aufzeichnungen über oberflächliche Kohlefunde im Šalek-Tal stammen aus<br />
dem Jahre 1767. Damals sammelten die Bewohner des Gebietes die Kohle z. B. in Flußbetten<br />
auf. 1860 äußerte der Geologe Friedrich Rolle in einem Bericht mit dem Titel „Die Lignitablagerungen<br />
des Beckens von Schönstein und ihre Fossilien“ die Vermutung, daß in der Tiefe<br />
ein mächtigeres Flöz zu erwarten sei. Da die seit 1875 durchgeführten Untersuchungsbohrungen<br />
diese Annahme bestätigten, wurde im Jahre 1882 mit dem untertägigen Abbau der<br />
Kohle begonnen.<br />
Heute wird die gesamte Kohleproduktion im betriebseigenen Kraftwerk verbraucht und damit<br />
ca.1/3 der Energieversorgung Sloweniens gedeckt. Die erste Heizkraftanlage wurde 1927 errichtet,<br />
die jetzige stammt aus dem Jahre 1965.<br />
EIGENSCHAFTEN DER KOHLE<br />
Die geförderte Kohle, der „Velenje-Lignit“ (Hamrla,1952), ist eine Weichbraunkohle, die aus<br />
etwa 60 % Detrit (zersetztes organisches Material), 40 % Textit (Material, in dem die Pflanzenstrukturen<br />
noch erkennbar sind) und 2-3 % Fusit („fossile Holzkohle“) zusammengesetzt<br />
ist. Die Kohle weist Aschegehalte zwischen 5 % und 40 % auf, Wassergehalte von 30 % bis<br />
40 % und Schwefelgehalte von ca. 1,2 %. Der Heizwert schwankt zwischen 7,5 und 13<br />
MJ/kg. An der Basis des Flözes ist der Brennwert der Kohle mit 7,5 % am niedrigsten, der<br />
Aschegehalt erreicht mit 40 % seine höchsten Werte, zum Hangenden sinkt der Aschegehalt<br />
auf 5 %, der Brennwert steigt auf 13 MJ/kg.<br />
REGIONALE GEOLOGIE<br />
Die Velenje-Senke, in der sich die Kohlelagerstätte befindet, erstreckt sich in Richtung NW-<br />
SE über eine Länge von 11 km und eine Breite von maximal 4 km. Im Norden wird sie von<br />
der Smrekovec-Störung, im Süden von der Šoštanj-Störung begrenzt. Zwischen diesen verläuft<br />
die Velenje-Störung, welche triassische Gesteine im Norden von oligozänen Sedimenten<br />
im Süden trennt.<br />
Bei den triassischen Gesteinen handelt es sich um Dolomite und Kalksteine, bei den tertiären<br />
Ablagerungen um andesitische Tuffe und Lithotamnienkalke. Sie bilden gemeinsam den Untergrund<br />
der Velenje-Senke und werden überlagert von oligozänen sandigen Schluffsteinen<br />
und Tonsteinen.<br />
Die sich im Hangenden anschließenden Brandschiefer bilden dann den Übergang zur Kohle.<br />
Das bis 8 km lange und 1,5-2,5 km breite Flöz erreicht Mächtigkeiten zwischen 80 m und 170<br />
m. Abgelagert wurde die Kohle vor ca. 2,5-3 Mio. Jahren, d.h. etwa an der Grenze vom Mittleren<br />
zum Oberen Pliozän. Im Hangenden des Flözes lagern etwa 300 m mächtige pliozäne<br />
Schichten aus Tonmergeln mit wasserführenden Sandschichten, aus Tonsteinen und aus<br />
2
Schluffsteinen. Quartäre Aufschüttungen mit einer Mächtigkeit von 100 m schließen das Profil<br />
ab.<br />
In dieser über 1 km mächtigen Sedimentfolge läßt sich die Veränderung terrestrischer Ablagerungsbedingungen<br />
von einer Moorfazies zu einem See nachvollziehen. Dieser See versumpfte<br />
allmählich wieder und verlandete schließlich. In einem solchen festländischen<br />
Bec??ken entstandene Kohle heißt limnisch.<br />
KOHLEFÖRDERUNG<br />
Zum Abbau des Lignits wird seit 1960 die Velenje-Strebbaumethode verwendet. Die Gewinnung<br />
erfolgt vollmechanisiert in horizontaler und vertikaler Richtung in allen 3 Bereichen des<br />
Bergwerks (Preloge, Pesje, Sredina). Jährlich werden etwa 3800000 t Lignit gefördert.<br />
Die größten Probleme beim Abbau entstehen durch die Gefahr von Schlagwettern (Methanausbrüche)<br />
und Wassereinbrüche in die Grube. Wasserführend sind sowohl die triassischen<br />
Dolomite, als auch die Sandlinsen, die im Liegenden, im Hangenden und auch im Flöz selbst<br />
vorkommen und oft nur durch eine dünne (
Thema 2: Paläoumwelt und Paläoklima im Ostalpenraum<br />
EINFÜHRUNG<br />
Fr. Dr. Bruch vermittelte einen Einblick in Methoden der Klimarekonstruktion und in die paläoklimatischen<br />
und geologischen Verhältnisse im Ostalpenraum, speziell im Sava-Becken.<br />
GEOGRAPHIE<br />
Das Sava-Becken im NE Sloweniens, nördlich des Flusses Sava, erstreckt sich in Ost-West-<br />
Richtung über mehr als 50 km von Laško im Osten bis nach Moravče im Westen, seine maximale<br />
Breite beträgt 3 km (Abb. 1).<br />
AUFSCHLUßBESCHREIBUNG<br />
Im ersten der beiden Aufschlüsse stehen steilstehende, gut geschichtete, graue Tonsteine, Tonmergel<br />
und Feinsandsteine an. Es treten fossil erhaltene Blattreste von Lauraceen und Taxodiaceen<br />
und Schalen von Süßwassermuscheln (z.B. Cardium) auf. An der Südseite dieses<br />
Aufschlusses werden die Sedimente feinklastischer, fossilreicher und ihr Karbonatgehalt<br />
nimmt zu, so daß sie z.T. bereits als Kalksteine angesprochen werden können.<br />
Etwa 200 m weiter südlich sind graue Tone und Mergeltone aufgeschlossen, in denen fossile<br />
Korallen und Bryozoen vorkommen.<br />
GEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE<br />
Aus dem Fossilgehalt der Sedimente im ersten Aufschluß läßt sich ableiten, daß es sich um<br />
limnische Ablagerungen handelt, wobei der See zur Zeit der Karbonatbildung tiefer war als<br />
während der Ablagerung der Tonsteine und Sandsteine. Die Fossilfunde im zweiten Aufschluß<br />
weisen dagegen daraufhin, daß die Tone im marinen Bereich gebildet wurden.<br />
Die stratigraphisch ältesten Sedimente sind die terrestrischen Sandsteine und Tonsteine, es<br />
folgen die Kalksteine und am jüngsten sind die marinen Tone. Im Aufschluß stehen die Kalke<br />
im Liegenden der terrigenen Tone an, weil die ursprünglich horizontal lagernden Schichten<br />
durch starke tektonische Beanspruchung überkippt wurden.<br />
Untersuchungen haben ergeben, daß die limnischen Sedimente, die als Pseudo-Socka-<br />
Schichten bezeichnet werden, wahrscheinlich aus dem Ober-Oligozän stammen. Sie lagern<br />
diskordant auf triassischem Untergrund und werden durch ein Kohleflöz in die Unteren und<br />
die Oberen Pseudo-Socka-Schichten gegliedert. Im Aufschluß anstehend sind die Oberen<br />
Pseudo-Socka-Schichten, aus denen andernorts Fischfossilien beschrieben wurden.<br />
Die Sedimente des 2. Aufschlusses werden als „oligozäne marine Tone“ angesprochen. Sie<br />
enthalten fossile Foraminiferen, Dinoflagellaten und Nanoplanktonarten, die typisch für einen<br />
vollmarinen Lebensraum sind.<br />
Zum Hangenden hin gehen diese Tone in die stärker sandigen, miozänen Govce-Schichten<br />
über, die wieder unter terrestrischen Bedingungen entstanden sind. Den Abschluß der tertiären<br />
Abfolge im Sava-Becken bilden die Laško-Schichten, marine Kalke aus dem Mittel-Miozän.<br />
In den beschriebenen Aufschlüssen sind die Govce-Schichten und die Laško-Schichten nicht<br />
anstehend.<br />
Die tertiäre Sedimentation begann mit der Öffnung des Sava-Beckens im Oligozän (vor etwa<br />
25 bis 30 Mio. Jahren) mit der terrigenen Schüttung von Konglomeraten, Sanden und Tonen<br />
4
(d.h. den Pseudo-Socka-Schichten) und der zwischenzeitlichen Kohlebildung. Mit der Ingression<br />
der Parathetys setzte die marine Sedimentation ein. Im untersten Unter-Miozän fiel der<br />
Meeresspiegel wieder, im Mittel-Miozän folgte die zweite Transgression, es bildeten sich die<br />
Laško-Schichten.<br />
Während der Spätphase der alpidischen Orogenese (Ober-Miozän) wurde die gesamte Sedimentfolge<br />
verfaltet und überschoben.<br />
REKONSTRUKTION DES TERTIÄREN KLIMAS IM OSTALPENRAUM<br />
Die Klimarekonstruktion erfolgte mittels palynologischer Methoden, d.h. durch Analyse fossiler<br />
Pollen, die aus Sedimentproben gewonnen werden. Die dabei verwendete Arbeitsweise,<br />
der Koexistenz-Ansatz, beruht auf der Annahme, daß sich die Klimaansprüche heute lebender<br />
Pflanzen und ausgestorbener verwandter Arten ähneln. Zunächst müssen somit rezente Vertreter<br />
der fossilen Arten gefunden werden. Dann werden die Intervalle gesucht, in denen sich<br />
die Klimaansprüche der rezenten Arten überschneiden. Es ist also z.B. der Temperaturbereich<br />
gesucht, in dem alle Arten gemeinsam existieren können. Andere Klimafaktoren, die berücksichtigt<br />
werden, sind beispielsweise der Jahresniederschlag, die Temperaturen des wärmsten<br />
und des kältesten Monats und die relative Luftfeuchte.<br />
Die Auswertung der Pollenfunde ergab, daß zur Zeit des Tertiärs im Sava-Becken ein warmhumides<br />
Klima herrschte, mit mittleren Jahrestemperaturen von 16 °C-19 °C und jährlichen<br />
Niederschlägen von 1100-1300 mm.<br />
Die Vegetation bestand zu Beginn der Beckenentwicklung aus Taxodiaceen und Farnen. Mit<br />
der Entwicklung des limnischen Milieus (Ablagerung der Pseudo-Socka-Schichten) traten<br />
Auenwälder in den Vordergrund, die dann von mesophilem Mischwald abgelöst wurden, der<br />
bis zum Einsetzen der marinen Ingression die Landschaft prägte. Die von Fr. Dr. Bruch<br />
durchgeführten Untersuchungen zeigen, daß es während der terrestrischen Phase keine bedeutenden<br />
klimatischen Veränderungen gab, die Veränderungen in der Vegetation demnach<br />
paläogeographische Ursachen haben.<br />
5
Literatur:<br />
MALI, N. & VESELIČ, M. (1989): Dolocanjeizvora rudniskih vvod v Rudniku lihnita Velenje<br />
na osnovi nijhove kemicne sestave (Determination of the origin of mine waters from Velenje<br />
mine on the basis of their chemical composition); Rudarsko-Metalurski Zbornik; Ljubljana<br />
BREZIGAR,A., OGORELEC,B., RIJAVEC,L., MIOC,P. (1987): Geologic setting of the Pre-<br />
Pliocene basis of the Velenje depression and its surroundings; Geologija<br />
RUDNIK LIGNITA VELENJE-HYDROGEOLOŠKA SLUZBA (1993): Kohlenbergwerk im Šalek-Tal;<br />
Velenje (Eigenverlag)<br />
BRUCH,A.A. (1998): Palynologische Untersuchungen im Oligozän Sloweniens - Paläo-Umwelt<br />
und Paläoklima im Ostalpenraum; Tübinger Mikropaläontologische Mitteilungen; Tübingen<br />
6