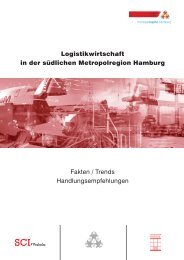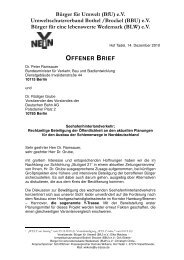Hochleistungsnetz statt Y-Trasse - VCD
Hochleistungsnetz statt Y-Trasse - VCD
Hochleistungsnetz statt Y-Trasse - VCD
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hochleistungsschienennetz<br />
für Niedersachsen, Bremen und Hamburg<br />
<strong>statt</strong><br />
Y<br />
–<br />
<strong>Trasse</strong><br />
Eine systemische Betrachtung<br />
"Y-<strong>Trasse</strong>"<br />
Prinzip <strong>Hochleistungsnetz</strong><br />
Verbindung von Strecken<br />
Verbindung von Knoten<br />
Roland Sellien, Dipl.-Ing.<br />
<strong>VCD</strong> Landesverband Niedersachsen e. V.<br />
Postfach 6124<br />
30061 Hannover<br />
Tel.: 0511 / 7000 522<br />
Fax: 0511 / 7000 520<br />
eMail: nds@vcd.org<br />
Internet: www.vcd.org/nds
„Das niedersächsische Verkehrsministerium ist<br />
der Auffassung, daß es nur im Interesse des<br />
Landes Niedersachsen gelegen sein kann, wenn<br />
das Band des Nord-Süd-Verkehrs in seinem<br />
Bereich möglichst breit ist, d. h. nicht nur auf<br />
die eigentliche Strecke Hamburg - Hannover -<br />
Göttingen beschränkt bleibt.“<br />
Ministerialdirigent Dr. Bierwirth, 13. Juni 1960<br />
Vorwort und Danksagung<br />
Alle reden von Verkehr, alle wollen mobil sein, aber keiner will ihn haben. Trotz der Privatisierung<br />
der Deutschen Bundesbahn und der regelmäßigen Beteuerungen „Güter auf die Schiene“ ist die<br />
Eisenbahn - auf den Gesamtverkehrsmarkt bezogen - ein Nischenanbieter geblieben. Das<br />
Wachstum des Verkehrs ist praktisch nur über die Straße abgewickelt worden. Dennoch sind<br />
einige Eisenbahnstrecken trotz modernster Leit- und Sicherungstechnik an der Grenze ihrer<br />
Leistungsfähigkeit.<br />
Mit der Wiedervereinigung ist Niedersachsen nicht nur in Nord-Süd-Richtung ein Transitland,<br />
sondern auch in Ost-West-Richtung. Mit der Erweiterung der EU nach Osten werden sich die<br />
Probleme aus der Verkehrsbelastung wahrscheinlich noch verstärken. Bereits heute klagen die<br />
Bürgerinnen und Bürger über die Verkehrsbelastungen, so dass gehandelt werden sollte.<br />
Vorrangiges Ziel einer weitsichtigen Verkehrspolitik muss es allerdings bleiben, unnötigen<br />
Verkehr gänzlich zu vermeiden. Instrumente hierzu sind angemessen hohe Transportkosten (z.B.<br />
Lkw-Maut), moderne Logistikkonzepte zur Vermeidung von Leerfahrten, aber auch eine<br />
weitsichtige Raum-/ Regionalplanung. Die „verbleibenden“ vorhandenen Verkehre sollten<br />
umweltfreundlich über bestehende Verkehrswege (vorrangig Schienenverkehr, ggf.<br />
Binnenschifffahrt) abgewickelt werden.<br />
Um die Kapazitäten der Schiene insbesondere für den Güterverkehr zu erhöhen, soll zur<br />
Entlastung der Strecke Hamburg - Lüneburg - Celle - Hannover die so genannte Y-<strong>Trasse</strong> gebaut<br />
werden. Eine dem Personenfernverkehr dienende Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen<br />
Hannover und Hamburg / Bremen.<br />
Dabei sind die Probleme, die heute in dieser Relation vorliegen, nicht neu. Bereits 1960 sind in<br />
einem sehr interessanten und zukunftsweisenden Artikel der Industrie- und Handelskammer<br />
Braunschweig zur Eröffnung des neuen Braunschweiger Hauptbahnhofs im Jahre 1960 diese<br />
erkannt worden (siehe Anhang). Leider hat sich seitdem diesbezüglich nichts getan.<br />
Ist die Y-<strong>Trasse</strong> die Problemlösung oder doch eher eine Scheinlösung? Bestehen Alternativen,<br />
die schneller, günstiger und effektiver durchgeführt werden können, gleichzeitig raumplanerisch<br />
vorteilhafter sind und auch den Wirtschaftsstandort Niedersachsen nachhaltig stärken? Können<br />
die negativen Auswirkungen durch den Transitverkehr positiv genutzt werden? Dieses soll in<br />
dieser Ausarbeitung untersucht und vorgestellt werden.<br />
An dieser Stelle will ich mich ganz besonders bei Herrn Dipl.-Ing. Reinhard Wetterau bedanken,<br />
der mich mit seinem Wissen und seiner Erfahrung fachlich unterstützt hat und mir wertvolle<br />
Hinweise gegeben hat.<br />
Braunschweig, im April 2003<br />
Roland Sellien<br />
Diese systemische Betrachtung ist auf der Jahreshauptversammlung des Verkehrsclubs Deutschland (<strong>VCD</strong>)<br />
Landesverband Niedersachsen e. V. am 7./8. März 2003 in Hannover als Ergänzung zur <strong>VCD</strong> - Resolution<br />
2003 beschlossen worden.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong><br />
Seite I
Inhaltsverzeichnis<br />
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS.............................................................IV<br />
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ..........................................................................................V<br />
„GESETZLICHES VORWORT“ ODER LEITBILD ...........................................................VI<br />
1 EINLEITUNG................................................................................................................... 1<br />
1.1 Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen ................................................................... 1<br />
1.2 Aufbau dieser Arbeit........................................................................................................... 1<br />
1.3 Getroffene Annahmen und Festlegungen ......................................................................... 2<br />
2 BESTANDSAUFNAHME UND -ANALYSE ..................................................................... 3<br />
2.1 Vorhandene Eisenbahninfrastruktur im Bereich Hannover / Bremen / Hamburg .......... 3<br />
2.2 Wann ist eine Strecke ein „Engpass“? ............................................................................. 5<br />
2.2.1 Allgemeines .................................................................................................................... 5<br />
2.2.2 Die Strecke Hamburg - Stelle - Celle - Hannover............................................................ 6<br />
2.3 Gibt es weitere „Engpässe“ und Konfliktpunkte?............................................................ 9<br />
2.3.1 Allgemein........................................................................................................................ 9<br />
2.3.2 Buchholz (Nordheide) und Buchholz (Nordheide) - Hamburg-Harburg ......................... 10<br />
2.4 Wettbewerb auf der Schiene - Die <strong>Trasse</strong>npreise .......................................................... 13<br />
2.5 Erfahrungen mit einer vorhandenen Aus- / Neubaustrecke........................................... 15<br />
2.6 Zwischenfazit .................................................................................................................... 17<br />
3 WELCHE BAHN WILL DER KUNDE?.......................................................................... 18<br />
4 VERKEHRSENTWICKLUNG UND -PROGNOSEN...................................................... 20<br />
4.1 Allgemein........................................................................................................................... 20<br />
4.2 Prognosen und Realität.................................................................................................... 21<br />
4.3 Zwischenfazit .................................................................................................................... 23<br />
5 DIE WIRKUNG VON SCHNELLFAHRSTRECKEN - EIN VERGLEICH ....................... 24<br />
5.1 Schnellfahrstrecken allgemein ........................................................................................ 24<br />
5.2 Die SFS Hannover - Wolfsburg - Stendal - Berlin ........................................................... 27<br />
5.2.1 Allgemein...................................................................................................................... 27<br />
5.2.2 Landeshauptstädte Magdeburg und Potsdam - Vom Fernverkehr abgekoppelt?.......... 28<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong><br />
Seite II
5.3 Zwischenfazit.....................................................................................................................29<br />
6 DIE Y-TRASSE - PROBLEM- ODER SCHEINLÖSUNG?............................................ 30<br />
6.1 Lösungsvarianten (betriebliche und wirtschaftliche Betrachtung) ...............................30<br />
6.2 Lösungsvarianten (politische und finanzielle Betrachtung / Raumordnung) ...............45<br />
6.3 Lösungsvarianten (systemische Betrachtung) ...............................................................47<br />
6.4 Regional- und Güterverkehr auf Schnellfahrstrecken / Y-<strong>Trasse</strong> ..................................49<br />
6.5 Studien, Gutachten und Positionen .................................................................................51<br />
6.5.1 Vorstudie der Vieregg & Rössler GmbH, München, 1993..............................................51<br />
6.5.2 „Das intelligente Netz“, 1996 .........................................................................................53<br />
6.5.3 Position des Vereins Pro Bahn, LV Niedersachsen e.V.................................................54<br />
6.5.4 Gutachten von IBS / ConTrack zum Nahverkehr auf der Y-<strong>Trasse</strong>, 2001 .....................58<br />
6.5.5 Position des <strong>VCD</strong> LV Niedersachsen e.V. .....................................................................63<br />
6.6 Alternativen für die Relation Hamburg / Bremen - Hannover.........................................68<br />
6.7 Fragen und Antworten zur Y-<strong>Trasse</strong> (Zusammenfassung).............................................72<br />
7 WIE SIEHT DIE OPTIMALE LÖSUNG AUS?............................................................... 74<br />
7.1 Allgemein ...........................................................................................................................74<br />
7.2 Beispiele für mögliche Verbesserungen..........................................................................76<br />
8 AUF DEM WEG ZUM LEISEN HOCHLEISTUNGSNETZ............................................. 78<br />
8.1 Was ist ein <strong>Hochleistungsnetz</strong>?.......................................................................................78<br />
8.2 Planungsablauf..................................................................................................................78<br />
8.3 Finanzierung......................................................................................................................80<br />
8.4 Lärmschutz und -vermeidung ..........................................................................................81<br />
9 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT............................................................................. 82<br />
LITERATUR ..................................................................................................................... 84<br />
Verwendete Literatur...............................................................................................................84<br />
Empfohlene Literatur ..............................................................................................................85<br />
GLOSSAR........................................................................................................................ 86<br />
ANHANG..........................................................................................................................87<br />
- Abb. A-1 bis A-3<br />
- Kontrollrechnung zu [Breimeier, 2/2001]<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong><br />
Seite III
- Quelle [Andersen, 2000]: „Betriebliche Betrachtungen...“<br />
- Quelle [Breimeier, 2/2001]: „Eine Neubaustrecke oder...“<br />
- Leserbrief Andersen: „Kein Zwischenhalt sinnvoll“<br />
- Artikel aus Frankfurter Rundschau: „Strecke mit Geisterbahnhöfen“<br />
- Artikel aus DB-mobil: „Die Bahn rückt dem Lärm zu Leibe“<br />
- Quelle [IHK BS, 1960]: Auszug: „Die Nord - Süd - Eisenbahn muss kommen!“<br />
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 2-1: Eisenbahninfrastruktur Untersuchungsraum heute........................................................................... 4<br />
Abb. 2-2: schematisierte Streckenführung im Bahnhof Buchholz (Nordheide) .............................................. 10<br />
Abb. 5-1: Abnehmender Grenznutzen der Geschwindigkeit...........................................................................26<br />
Abb. 6-1: Nutzbare zusätzliche Fahrplantrassen durch Y-<strong>Trasse</strong> .................................................................. 35<br />
Abb. 6-2: Vergleich Y-<strong>Trasse</strong> mit SFS Hannover - Würzburg ........................................................................45<br />
Abb. 7-1: Eisenbahninfrastruktur Untersuchungsraum optimal? Ohne Y-<strong>Trasse</strong>........................................... 75<br />
Abb. 8-1: Der Planungsablauf......................................................................................................................... 80<br />
Abb. A-1: Eisenbahninfrastruktur Untersuchungsraum heute, mit Engpässen,... .......................................... 87<br />
Abb. A-2: konfliktfreie Streckenführung im Bahnhof Buchholz (Nordheide) und Celle................................... 88<br />
Abb. A-3: Abfahrtszeiten ICE und IC Hamburg Hbf Æ Bremen und Hannover .............................................. 88<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tab. 2-1: werktägl. Streckenbelastungen ......................................................................................................... 5<br />
Tab. 2-2: Zählung der Züge in Uelzen .............................................................................................................. 8<br />
Tab. 2-3: Zählung der Züge in Buchholz (Nordheide)..................................................................................... 12<br />
Tab. 2-4: <strong>Trasse</strong>npreise DB Netz AG ............................................................................................................. 13<br />
Tab. 3-1: Einflussfaktoren für Verkehrsmittelwahl .......................................................................................... 18<br />
Tab. 4-1: Prognosen zur Auslastung deutscher Hochgeschwindigkeitsstrecken ........................................... 22<br />
Tab. 4-2: Prognose und tatsächliche Belegung NBS Hannover - Würzburg.................................................. 22<br />
Tab. 4-3: Fahrgastprognose und Realität beim „Wiesele“ und der Schönbuchbahn...................................... 23<br />
Tab. 5-1: Fahrzeitgewinne durch Neu- und Ausbaustrecken (direkt) ............................................................. 24<br />
Tab. 5-2: Fahrzeitenvergleich netzbezogen.................................................................................................... 25<br />
Tab. 5-3: Die schnellsten Züge der Welt ........................................................................................................ 27<br />
Tab. 5-4: Zugzahl- und Fahrzeitvergleich Hannover - BS / WOB - Berlin 1996/2003 .................................... 28<br />
Tab. 5-5: Zugzahl- und Fahrzeitvergleich Magdeburg - Berlin 1996/2003...................................................... 29<br />
Tab. 6-1: Lösungsvarianten für Relation Hamburg - Hannover (-Süddeutschland)........................................ 31<br />
Tab. 6-2: Merkmale zu Varianten zum Ausbau Hamburg / Bremen - Hannover ............................................ 32<br />
Tab. 6-3: Ausbauzustand Variante „Güterbahn“ ............................................................................................. 33<br />
Tab. 6-4: Entwicklung der Verkehrsleistung 1994 - 1999 ............................................................................... 39<br />
Tab. 6-5: Betriebsleistung in <strong>Trasse</strong>nkilometern ............................................................................................ 39<br />
Tab. 6-6: Verbesserungen und Nachteile der Y-<strong>Trasse</strong> ................................................................................. 68<br />
Tab. 6-7: Verbesserungen und Nachteile der Variante „Güterbahn 1” ........................................................... 69<br />
Tab. 6-8: Verbesserungen und Nachteile der Variante „Güterbahn 2“ ........................................................... 70<br />
Tab. 6-9: Verbesserungen und Nachteile der Variante „Ausbau Celle - Lüneburg 4-gleisig“......................... 71<br />
Tab. 7-1: Nah- und Regionalverkehr in der Lüneburger Heide durch „Güterbahn“ ........................................ 76<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong><br />
Seite IV
Abkürzungsverzeichnis<br />
BTE<br />
BSchwAG<br />
BVWP<br />
CNL<br />
D (-Zug)<br />
DB AG<br />
EVB<br />
GVFG<br />
HH<br />
IC / ICE<br />
IC(IR)<br />
IR<br />
KBS<br />
Lr<br />
Lz<br />
MET<br />
NE<br />
NBS<br />
OHE<br />
Pkm<br />
RB<br />
RE<br />
RegG<br />
Rkm<br />
SFS<br />
SGV<br />
SPFV<br />
SPNV<br />
t<br />
TGV<br />
Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH<br />
Bundesschienenwegeausbaugesetz<br />
Bundesverkehrswegeplan<br />
CityNightLine<br />
D(urchgangs)-Zug<br />
Deutsche Bahn AG<br />
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH<br />
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz<br />
Hansestadt Hamburg<br />
InterCity / InterCityExpress<br />
IC, der von seinen Systemhalten dem IR entspricht bzw. vor der Umstellung als IR fuhr.<br />
InterRegio<br />
Kursbuchstrecke<br />
Leer(reise)zug, hier einschließlich Lt-Fahrten (Leertriebwagen)<br />
Triebfahrzeugleerfahrt<br />
Metropolitan, Zugangebot der Deutschen Bahn Gruppe zwischen Hamburg und Köln<br />
Nichtbundeseigene Eisenbahn(en)<br />
Neubaustrecke (nicht zwangsläufig eine Hochgeschwindigkeits- oder Schnellfahrstrecke)<br />
Osthannoversche Eisenbahn AG<br />
Personenkilometer = Reisendenkilometer<br />
RegionalBahn<br />
RegionalExpress<br />
Regionalisierungsgesetz<br />
Reisendenkilometer = Personenkilometer<br />
Schnellfahrstrecke (nicht zwangsläufig eine NBS, Betonung auf „schnell fahren“, ab ca. 200 km/h)<br />
Schienengüterverkehr<br />
Schienenpersonenfernverkehr<br />
Schienenpersonennahverkehr<br />
Tonne(n)<br />
Train à grande vitesse: Französischer Hochgeschwindigkeitszug<br />
V / Vmax Geschwindigkeit / Höchstgeschwindigkeit<br />
<strong>VCD</strong> Verkehrsclub Deutschland e. V.<br />
VGH Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH<br />
VPS Verkehrsbetriebe Peine Salzgitter GmbH<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong><br />
Seite V
„Gesetzliches Vorwort“ oder Leitbild<br />
Nieders. GVBl. Nr. 5/1994, ausgegeben am 9.3.1994<br />
Gesetz über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen<br />
- Teil 1 -<br />
Vom 2. März 1994<br />
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen<br />
- Teil 1 -<br />
A 3.6 Verkehr und Kommunikation<br />
Die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur soll in bedarfsgerechter und umweltschonender Weise alle<br />
Teilräume des Landes erschließen, miteinander verbinden und mit der angestrebten Raumstruktur in<br />
Einklang stehen. Die Einbindung des Landes in das deutsche und internationale Verkehrs- und<br />
Kommunikationsnetz soll gesichert und verbessert werden. Auf eine Verkehrsvermeidung sowie die<br />
Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger [...] soll im Interesse einer umweltfreundlichen<br />
und zugleich wirtschaftlichen Verkehrsabwicklung hingewirkt werden.<br />
Der schienengebundene Personen- und Güterverkehr soll gegenüber dem Straßenverkehr, der Ausbau<br />
vorhandener Verkehrswege soll gegenüber dem Neubau Vorrang erhalten. [...]<br />
Als Grundnetz für eine leistungsfähige und bedarfsgerechte verkehrliche Erschließung des Landes soll das<br />
Eisenbahnnetz erhalten und ausgebaut werden. [...]<br />
B1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes<br />
01 Die räumliche Struktur des Landes soll [...] unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung, der<br />
natürlichen Gegebenheiten, der Erfordernisse des Umweltschutzes sowie der wirtschaftlichen,<br />
infrastrukturellen, sozialen und kulturellen Zusammenhänge und Erfordernisse mit dem Ziel<br />
entwickelt werden, in allen Teilen des Landes gleichwertige Lebensbedingungen herzustellen.<br />
Verordnung<br />
über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen<br />
- Teil II -<br />
Vom 18. Juli 1994<br />
C 3.6.2 Schienenverkehr<br />
01 [...] Das Eisenbahnnetz ist in allen Teilen des Landes zu erhalten und auf ein sicheres,<br />
leistungsfähiges, dem Stand der Technik entsprechendes und den Dienstleistungsanforderungen<br />
gerecht werdendes Niveau zu bringen. [...] Durch den Bau zusätzlicher Gleise sind der schnelle und<br />
langsame Verkehr nach Möglichkeit zu entmischen. [...]<br />
04 Die Bedienungsqualität und Kapazität im Güterverkehr sind weiter zu erhöhen. [...]<br />
06 Folgende Eisenbahnstrecken - neben den „Schienenprojekten der Deutschen Einheit“ - sind neu- bzw.<br />
auszubauen und - soweit noch nicht geschehen - zu elektrifizieren:<br />
- Hildesheim - Braunschweig - Weddeler Schleife - Wolfsburg<br />
- Bremen - Soltau - Uelzen - Stendal - Berlin<br />
- Hannover - Flughafen Hannover - Hamburg/Bremen<br />
- Lehrte - Hamburg<br />
- Wunstorf - Minden<br />
- Uelzen - Dömitz - Ludwigslust<br />
- Lüneburg - Lübeck<br />
- Bad Harzburg - Stapelburg - Wernigerode - Halberstadt<br />
- Holzminden - Scherfede - (-Ruhrgebiet)<br />
- Eichenberger Nordkurve<br />
- Löhne - Hameln - Elze - Hildesheim<br />
- Altenbeken - Northeim - Nordhausen<br />
- Wilhelmshaven - Oldenburg - Osnabrück<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong><br />
Seite VI
Zur besseren Anbindung des Hafens Emden an den Ost-West-Verkehr ist eine Verbindung der<br />
Bahnlinien Norddeich - Rheine und Leer - Oldenburg über eine Schleife anzustreben.<br />
Als Lückenschlüsse sind wieder herzustellen:<br />
- Dannenberg - Salzwedel<br />
- Wittingen - Oebisfelde<br />
- Jerxheim - Dedeleben bzw. Gunsleben<br />
- Duderstadt - Teistungen<br />
Der Oberbau ist auf folgenden Strecken zu verbessern:<br />
- Bremerhaven - Bremervörde - Buxtehude<br />
- Osterholz-Scharmbeck - Worpswede<br />
- Osnabrück – Bielefeld<br />
07 Im weiteren Netz ist die Elektrifizierung vordringlich. Dieses gilt insbesondere für die folgenden<br />
Strecken:<br />
- Cuxhaven - Bremerhaven<br />
- Cuxhaven - Stade<br />
- Braunschweig - Broistedt - Salzgitter/Lebenstedt - Salzgitter/Ringelheim - Seesen - Holzminden -<br />
Altenbeken<br />
- Braunschweig - Bad Harzburg<br />
- Hildesheim - Goslar - Halberstadt<br />
- Seesen - Goslar<br />
- Ihrhove - Landesgrenze (-Groningen)<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong><br />
Seite VII
1 Einleitung<br />
1 Einleitung<br />
1.1 Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen<br />
Die Eisenbahnstrecke Hamburg - Lüneburg - Celle - Hannover ist insbesondere auf dem<br />
Abschnitt Stelle - Lüneburg überlastet, so dass eine befriedigende Betriebsqualität nicht erreicht<br />
werden kann. Auch sind die deutschen Seehäfen in der Reihe Emden - Lübeck auf gute und<br />
kostengünstige Hinterlandverbindungen, die durch Niedersachsen führen, angewiesen. In<br />
Wilhelmshaven ist der Bau eines neuen Tiefwasserhafens beschlossen worden. Dieser wird für<br />
eine zusätzliche Verkehrsbelastung sorgen.<br />
Um vor allem für den Güterverkehr zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, ist geplant, eine neue<br />
Schnellfahrstrecke, die so genannte Y-<strong>Trasse</strong>, von Langenhagen bei Hannover durch die<br />
Lüneburger Heide nach Scheeßel / Lauenbrück zur Fahrt nach Hamburg und einem Abzweig bei<br />
Visselhövede nach Bremen zu bauen. Diese soll etwa 1,5 Milliarden Euro kosten.<br />
Auf der anderen Seite ist noch umfangreiche Eisenbahninfrastruktur vorhanden. Diese entspricht<br />
allerdings sowohl in der Lüneburger Heide als auch in anderen Teilen Niedersachsens zum Teil<br />
eher dem technischen Stand der Jahrhundertwende um 1900 als der um 2000, so dass eine hohe<br />
Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Entsprechend dem Landesraumordnungsprogramm<br />
Niedersachsen sollen viele dieser vorhandenen Strecken auch ausgebaut werden. Der<br />
Realisierungszeitraum ist allerdings ungewiss, so dass „gleichwertige Lebensbedingungen“ in<br />
allen Teilen Niedersachsens weiterhin nicht gegeben sein werden. Ein Grund dafür ist auch in den<br />
„chronisch“ knappen öffentlichen Kassen und der Vernachlässigung der Bahn bei der<br />
tatsächlichen Mittelvergabe, auch gegenüber anderen Verkehrsträgern, zu finden.<br />
In dieser Ausarbeitung soll aufgezeigt werden, dass es eine Lösung gibt, die nicht nur<br />
„haushaltsfreundlicher“ realisiert werden kann, sondern auch verkehrs- und<br />
raumordnungspolitisch wesentlich günstiger abschneidet.<br />
Dieses soll in Form einer systemischen Betrachtung erfolgen, die die Wirkungen und<br />
Wechselwirkungen der verschiedenen Systeme (Politik, Finanzen, Verkehr, Eisenbahn,<br />
Raumplanung, usw.) berücksichtigt.<br />
Weiterhin soll auf grundsätzliche Unterschiede der Systeme „Eisenbahn“ und „Straße“<br />
hingewiesen werden.<br />
1.2 Aufbau dieser Arbeit<br />
Im Kapitel 2 erfolgt zunächst eine Bestandsaufnahme der Eisenbahninfrastruktur im Bereich<br />
Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Dieses unter dem Gesichtspunkt der geplanten Y-<strong>Trasse</strong>.<br />
Für die Planung ist es wichtig zu wissen, welches Produkt der Kunde eigentlich wünscht und<br />
welcher Bedarf in Zukunft zu erwarten ist. Dieses wird in den Kapiteln 3 und 4 untersucht.<br />
Im fünften Kapitel wird auf die Wirkung von Schnellfahrstrecken eingegangen, so dass für die Y-<br />
<strong>Trasse</strong> ein Vergleich vorliegt. Diese wird dann im sechsten Kapitel ausführlich untersucht. Dabei<br />
wird auch ein kurzer kommentierter Überblick über verschiedene Studien und Positionen zur Y-<br />
<strong>Trasse</strong> gegeben. Die „optimale“ Lösung wird im Kapitel 7 vorgestellt. Der Weg zu dieser<br />
optimalen Lösung oder zum Hochleistungsschienennetz wird im Kapitel 8 beschrieben.<br />
Am Schluß befindet sich eine kurze Vorstellung empfohlener Literatur, ein Glossar, in dem einige<br />
Fachbegriffe erklärt werden und ein umfangreicher Anhang.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 1
1 Einleitung<br />
1.3 Getroffene Annahmen und Festlegungen<br />
Sichtweise „Bundesrepublik Deutschland AG“<br />
Diese Ausarbeitung wird aus Sicht einer fiktiven „Bundesrepublik Deutschland AG“ geschrieben, die sowohl<br />
raumordnungspolitische und volkswirtschaftliche Aspekte zu beachten hat, als auch die<br />
betriebswirtschaftliche Seite nicht vernachlässigen darf. So kann ein Projekt volkswirtschaftlich durchaus<br />
„sinnvoll“ sein, betriebswirtschaftlich aber nicht durchgeführt werden, da ein realer Haushaltstitel vorhanden<br />
sein muss und der mögliche volkswirtschaftliche „Nutzen“ - sofern überhaupt genau berechenbar - nicht als<br />
Einnahme im Haushalt gegenübergestellt werden kann.<br />
Eigentümerstruktur DB Netz AG / <strong>Trasse</strong>npreise / <strong>Trasse</strong>npreissystem<br />
Die in dieser Arbeit getroffenen Aussagen sind vom Prinzip von der Eigentümerstruktur der DB Netz AG<br />
bzw. vom aktuellen <strong>Trasse</strong>npreissystem unabhängig. Eine Bewertung des aktuellen <strong>Trasse</strong>npreissystems<br />
der DB Netz AG ist mit dieser Ausarbeitung nicht verbunden.<br />
Zuggattung InterCity (IC) / InterRegio (IR)<br />
Zum Fahrplanwechsel hat die DB AG den IR in einen IC umgewandelt. Bezogen auf die Bedienung von<br />
Orten als Systemhalt ist damit keine eindeutige Aussage mehr verbunden. Auf Strecken, die nicht vom ICE<br />
bedient werden bzw. auf denen im alten Fahrplan keine IR-Linie fuhr, wie z. B. Hamburg - Bremen -<br />
Dortmund, entspricht der IC von den Haltestellenabständen eher dem ICE, auf den anderen Strecken<br />
entspricht der heutige IC teils dem ICE, teils dem IR. Auf der Strecke Magdeburg - Hannover hat<br />
beispielsweise Peine den Systemhalt verloren, Helmstedt wird nicht von jedem IC bedient, sondern nur von<br />
den IC-Zügen, die im alten Fahrplan als IR verkehrten.<br />
Zur eindeutigen Zuordnung wird daher weiterhin die Bezeichnung IR bzw. IC(IR) verwendet.<br />
Baukosten der Y-<strong>Trasse</strong> / Währungsangabe<br />
Die Baukosten der ABS/NBS Hamburg/Bremen - Hannover sind im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 1992<br />
mit 2.5 Mrd. DM (= 1.28 Mrd. EUR) (Preisstand 01.01.1991) angegeben. Bei einer unterstellten<br />
Preissteigerung von durchschnittlich 1,43 % pro Jahr ergeben sich die Baukosten aktuell zu etwa 1,5 Mrd.<br />
EUR. Bei höheren Baukosten sind damit die Berechnungen auf der sicheren Seite.<br />
Alle Preisangaben in DM sind mit dem Wechselkurs von 1 EUR = 1,95583 DM umgerechnet worden.<br />
Widerstand in der Bevölkerung<br />
Mit Widerstand in der Bevölkerung ist heute praktisch bei jedem Ausbauvorhaben zu rechnen, insbesondere<br />
bei Schienenprojekten.<br />
Die Sorgen der Bevölkerung müssen ernst genommen werden. Daher ist es sehr wichtig, dass die vom<br />
Ausbau betroffene Bevölkerung auch davon profitiert, so dass zumindest nach Realisierung der Nutzen<br />
erkannt wird (siehe z. B. S-Bahn von Hannover nach Bennemühlen).<br />
Hochgeschwindigkeit / Faszination Geschwindigkeit<br />
Die im Rahmen dieser Arbeit erfolgten Angaben und Beispiele mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu<br />
300 km/h erfolgen aus betrieblicher oder wissenschaftlicher Sicht zur Verdeutlichung eines Sachverhaltes.<br />
Eine Aussage zur Meinung des <strong>VCD</strong> dazu bzw. ob bestimmte Geschwindigkeiten „sinnvoll“ oder „unsinnig“<br />
sind ist damit nicht verbunden.<br />
Höchste Geschwindigkeiten besitzen oft eine große Faszination. Dieses zeigt sich auch auf der<br />
Schnellfahrstrecke (SFS) Köln - Frankfurt (Main), auf der dem Triebfahrzeugführer bei 300 km/h sehr oft<br />
„begeistert und fasziniert über die Schulter geschaut wird“. Eine Planungskriterium ist „Faszination“<br />
allerdings nicht, so dass zwischen der subjektiven Faszination und dem objektivem Nutzen unterschieden<br />
werden muss.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 2
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
In diesem Kapitel erfolgt unter dem Gesichtspunkt der geplanten Y-<strong>Trasse</strong> eine<br />
Bestandsaufnahme der heute vorhandenen Situation bei der Eisenbahninfrastruktur.<br />
2.1 Vorhandene Eisenbahninfrastruktur im Bereich Hannover / Bremen / Hamburg<br />
In der Abb. 2-1 ist ein Teil der vorhandenen Eisenbahninfrastruktur im Bereich Hannover /<br />
Bremen / Hamburg, ergänzt um den Bereich Braunschweig dargestellt. Die schematisierte<br />
Darstellung soll gleichzeitig zeigen, wie leistungsfähig die betreffenden Strecken sind. Eine<br />
Aussage über die Wirtschaftlichkeit der Strecke ist damit nicht verbunden. Sehr deutlich wird hier,<br />
dass nur „wenige“ Strecken sehr leistungsfähig sind, die entsprechend den Verkehr auf sich<br />
ziehen. Viele Strecken liegen praktisch brach, obwohl sie wesentlich mehr Verkehr aufnehmen<br />
könnten. Insbesondere in der Nord-Süd-Relation, in der mit der Y-<strong>Trasse</strong> zusätzliche (Güterzug-)<br />
Kapazitäten geschaffen werden sollen, ist bereits heute schwach genutzte Eisenbahninfrastruktur<br />
vorhanden.<br />
Weiterhin fällt auf, dass praktisch jeder Verkehr durch die Knoten Hamburg, Hannover und<br />
Bremen geführt werden muss.<br />
Im Gegensatz zur Übersichtskarte für den Personenverkehr im Kursbuch der DB AG ist hier<br />
ersichtlich, dass in Niedersachsen noch umfangreiche Eisenbahninfrastruktur vorhanden ist.<br />
Dieses liegt daran, dass neben der DB Netz AG noch weitere Eisenbahninfrastrukturunternehmen<br />
tätig sind. Diese wird aber derzeit weder im Güterfern- noch im Personenverkehr<br />
nicht oder nur gering genutzt.<br />
Von einem EisenbahnNETZ kann bei genauerer Betrachtung nicht gesprochen werden. Eher<br />
ähnelt es einer punktförmigen Erschließung des Landes von den drei Knoten Hannover, Bremen<br />
und Hamburg.<br />
An Hand der eingezeichneten Lage der Y-<strong>Trasse</strong> wird deutlich, dass diese für den Bereich<br />
Bremen und westlich (also auch für den geplanten Jade-Port in Wilhelmshaven) keine<br />
zusätzlichen Kapazitäten schafft. Auch das Industriegebiet Braunschweig / Wolfsburg / Salzgitter<br />
profitiert nicht von der Y-<strong>Trasse</strong>. Insofern kann dann von der „betrieblichen Wirkungsgrenze“<br />
gesprochen werden. Unterstützt wird dieses dadurch, dass auf der Strecke Bremen - Wunstorf<br />
der Abschnitt Bremen - Langwedel der vom Personenverkehr am stärksten belastete Abschnitt ist<br />
(siehe Tab. 2-1) und nicht durch die Y-<strong>Trasse</strong> entlastet wird.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 3
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
Eisenbahninfrastruktur Bereich Hannover / Bremen / Hamburg (Ausschnitt) (ohne Maßstab)<br />
(einschließlich drittes Gleis Stelle - Lüneburg und zweigleisiger Ausbau Hildesheim - Braunschweig)<br />
Kiel<br />
Skandinavien<br />
Westerland / Kiel / Flensburg /<br />
Dänemark<br />
Lübeck<br />
Cuxhaven<br />
Bremerhaven<br />
Wilhelmshaven<br />
Nordenham<br />
Bremervörde<br />
EVB<br />
Buxtehude<br />
Buchholz(Nordheide)<br />
Hamburg<br />
Maschen<br />
Stelle<br />
Büchen<br />
OLDB<br />
Delmenhorst<br />
Bremen<br />
Osterholz-Scharmbeck<br />
Rotenburg(Wümme)<br />
Winsen(Luhe)<br />
OHE<br />
Lüneburg<br />
Wittenberge /<br />
Stendal / Berlin<br />
Norddeich /<br />
Emden /<br />
Niederlande<br />
Osnabrück<br />
BTE<br />
Kirchweyhe<br />
Syke<br />
Langwedel<br />
Thedinghausen<br />
"Y-<strong>Trasse</strong>"<br />
Soltau(Han)<br />
Uelzen<br />
Verden(Aller)<br />
Osnabrück /<br />
Ruhrgebiet<br />
VGH<br />
Eystrup<br />
Nienburg(Weser)<br />
OHE<br />
Celle<br />
OHE<br />
Wittingen<br />
Stendal /<br />
Magdeburg / Berlin<br />
Betriebliche "Wirkungsgrenze"<br />
der Y-<strong>Trasse</strong><br />
Wunstorf<br />
Hannover<br />
Lehrte<br />
Peine<br />
Gifhorn<br />
Wolfsburg<br />
Stendal / Berlin<br />
Minden(Westf)<br />
VPS<br />
Braunschweig<br />
Magdeburg /<br />
Berlin /<br />
Halle(Saale)<br />
Niederlande / Osnabrück<br />
Elze(Han)<br />
Hildesheim<br />
Löhne<br />
Hameln<br />
SFS<br />
Salzgitter<br />
Ruhrgebiet / Bielefeld<br />
Paderborn / Dortmund<br />
Kreiensen<br />
Seesen<br />
Goslar /<br />
Bad Harzburg<br />
Halberstadt /<br />
Halle (Saale)<br />
Nordhausen / Erfurt<br />
Strecken der DB Netz AG:<br />
Göttingen /<br />
Süddeutschland<br />
zweigleisig: elektrifiziert / nicht elektrifiziert<br />
eingleisig: elektrifiziert / nicht elektrifiziert<br />
Strecken der BTE, EVB, VGH, OHE und VPS :<br />
eingleisig: nicht elektrifiziert<br />
BTE: Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH (ab Bremen-Huchting)<br />
EVB: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH<br />
OHE: Osthannoversche Eisenbahn AG<br />
VGH: Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH<br />
VPS: Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH<br />
Abb. 2-1: Eisenbahninfrastruktur Untersuchungsraum heute<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 4
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
2.2 Wann ist eine Strecke ein „Engpass“?<br />
2.2.1 Allgemeines<br />
Es ist oft die Rede vom „Engpass“ oder einer „Engpassstrecke“. Ab wann ist aber eine Strecke<br />
ein „Engpass“? In der Tab. 2-1 sind die werktäglichen Streckenbelastungen einiger ausgewählter<br />
Strecken aufgeführt. Dabei fällt die im Vergleich zu den anderen Strecken sehr hohe Zuganzahl<br />
der Strecke (Hamburg / Maschen-) Stelle - Winsen (-Celle) auf. Ebenso die deutlich geringere<br />
Belastung im Abschnitt Uelzen - Celle.<br />
tägl. Streckenbelastungen Fahrplan 2001/2002, Montag - Donnerstag, 0:00Uhr - 24:00Uhr<br />
(ohne Lz/Lr-Fahrten, Autoreisezüge, Saisonverkehr, Sonderfahrten...)<br />
Strecke / Relation (Richtung) Belastung mit Zügen des Summe Bemerkung<br />
SPFV SPNV SGV<br />
(Lübeck -) Ahrensburg - Hamburg Hbf 6 78<br />
keine Quelle<br />
84+ x nicht elektrifiziert<br />
(HH / Maschen-) Buchholz - Tostedt (-Bremen) 27 42 52 1) 121 dreigleisiger Abschnitt<br />
(Bremen -) Tostedt - Buchholz - Maschen 0 0 65 1) Gegenrichtung -13<br />
(HH / Maschen -) Stelle - Winsen (- Celle) 30+17 (IC/IR) 46 76 1) 169 ab 2007 dreigleisig<br />
(Celle -) Winsen - Stelle - Maschen 0 0 62 1) Gegenrichtung +14<br />
(Hamburg -) Uelzen - Celle (- Hannover) 30+16 (IC/IR) 19 55 3) 120<br />
Bremen - Langwedel (- Hannover) 11+9 (IR) 56<br />
keine Quelle<br />
76+x<br />
(Bremen-) Nienburg - Wunstorf (-Hannover) 11+10 (IR,EN) 42<br />
keine Quelle<br />
62+x<br />
Celle - Aligse -(Lehrte) 0 37<br />
keine Quelle<br />
37+x<br />
(Dortmund-) Minden - Wunstorf (-Hannover) 36 42 44 3) 122<br />
NBS (Hannover-) Kassel - Fulda 48 2) 0 37 3) 85 2)<br />
SFS (Köln -) Siegburg - Limburg Süd (-Ffm) 59 0 0 59 Fahrplan 2003<br />
Berlin Zoolg. Garten - Berlin Ostbahnhof 94 117 0 211 „Fernbahngleise“<br />
Berlin Zoolg. Garten - Berlin Ostbahnhof 0 357 0 357 S-Bahn-Gleise<br />
SPFV / SPNV = Schienenpersonenfernverkehr / -nahverkehr<br />
1) aus [Andersen, 2000, S.515],<br />
3) aus [Jänsch, 2001, S.100], einschl. Nachtzüge Lz/Lr = Leerfahrten<br />
2) im Abschnitt Göttingen - Kassel +8 IR-Züge SGV = Schienengüterverkehr<br />
Tab. 2-1: werktägl. Streckenbelastungen<br />
(Quelle: DB-Kursbuch)<br />
Diese Streckenbelastungen geben allerdings keine Aussage, ob die betreffende Strecke<br />
„überlastet“ - also eine Engpassstrecke - ist oder ob noch Reserven vorhanden sind. Denn ein<br />
Blick auf die Belastung z. B. der S-Bahn Berlin zeigt, dass diese mit 357 Zügen doppelt so stark<br />
belastet ist wie die ebenfalls zweigleisige Strecke Stelle - Winsen, ohne das hier jemand von<br />
einem durch das Betriebskonzept bedingten Engpass spricht. Bei der S-Bahn ist eher die<br />
physikalische Leistungsgrenze der Strecke erreicht. Ebenso geben diese Streckenbelastungen<br />
keine Aussage über die Tagesganglinie des Bedarfs, d.h., wann sich verschiedene Verkehre<br />
überlagern und zu welchen Zeiten die Zahl der angebotenen Fahrplantrassen kleiner als der<br />
Bedarf ist. Während im Personenverkehr die Nachfrage in Form der Zugdichte durch die<br />
Taktverkehre weitgehend gleichmäßig über die Betriebszeit verteilt ist, kann beim Güterverkehr<br />
die Nachfrage sehr stark schwanken (siehe Tab. 2-2). Es kann auch kein genereller<br />
„Engpasswert“ angegeben werden, eine Strecke ist mit 120 Zügen überlastet, die andere erst mit<br />
180 Zügen. „Die Fahrplan-Leistungsfähigkeit hängt neben den Parametern der Infrastruktur in<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 5
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
entscheidender Weise von der Fahrplan-Struktur ab. Je stärker die Zugfolge harmonisiert ist,<br />
desto geringer sind die durch die Geschwindigkeitsschere bedingten nicht nutzbaren Zeitlücken.“<br />
[Pachl, 1999, S. 203] Auf reinen Personen- oder Güterzugbahnen mit gleichartigen Zuggattungen<br />
können bis zu 20 Züge pro Richtung und Stunde verkehren, auf reinen S-Bahn-Strecken auch<br />
mehr, auf so genannten Mischbetriebsstrecken unter Umständen auch nur 8 Züge pro Richtung<br />
und Stunde. Die teure Infrastruktur ist dann nur gering genutzt, aber dennoch ausgelastet, und<br />
kann nur wenig Einnahmen erzielen.<br />
Daher wird angestrebt, den schnellen und langsamen Verkehr zu trennen, die Zugfolge zu<br />
harmonisieren. Dieses verfolgt die DB mit ihrem Projekt „Netz 21“. Dieses kann räumlich, durch<br />
getrennte Infrastruktur wie bei der neuen Schnellfahrstrecke (SFS) Köln - Frankfurt (Main)<br />
erfolgen, oder zeitlich, wie es auf der Neubaustrecke (NBS) Hannover - Würzburg praktiziert wird.<br />
Diese Harmonisierung der Zugfolgezeiten durch Entmischung der schnellen und langsamen<br />
Verkehre zu erreichen, ist „ein Prinzip, das von Verkehrswissenschaftlern schon seit langem<br />
empfohlen wird.“ [Pachl, 1998, S. 27] „Für Schnellstrecken des Personen-Fernverkehrs ist<br />
außerdem anzumerken, dass dessen Potenzial in den meisten Relationen Deutschlands zu gering<br />
ist, eine arteigene Infrastruktur vollständig auszulasten.“ [Breimeier, 12/2001, S. 536]<br />
(Hinweis: Die sehr starke Nachfrage (auch Bedarf) an Güterzugfahrplantrassen und die Trennung von ICEund<br />
Güterverkehr bewirkt beispielsweise, dass der (letzte) ICE 870 von Göttingen (ab 23:06 Uhr) nach<br />
Hannover (an 0:03 Uhr) über die alte Strecke über Kreiensen geführt wird.)<br />
Im Folgenden soll kurz die Strecke Hamburg - Hannover näher betrachtet werden.<br />
2.2.2 Die Strecke Hamburg - Stelle - Celle - Hannover<br />
Auf der Mischbetriebsstrecke (Hamburg / Maschen -) Stelle - Lüneburg - Celle (- Hannover) reicht<br />
die Geschwindigkeitsschere von 200 km/h der ICE- und IC(IR)-Züge bis zu 80 km/h der Erzzüge.<br />
In Verbindung mit der hohen Zuganzahl (siehe Tab.2-1), bei der die regelmäßige<br />
Spitzennachfrage am Freitag Nachmittag nicht enthalten ist, ist sie damit insbesondere im<br />
Abschnitt Stelle - Winsen (Luhe) - Lüneburg eine Engpassstrecke. Auch scheint ein Teil des Süd-<br />
Nord-Verkehrs über Verden (Aller) - Rotenburg (Wümme) umgeleitet werden zu müssen (Tab. 2-<br />
1). Die Qualität ist für keinen Nutzer befriedigend: Die ICE-Züge der DB Reise&Touristik müssen<br />
Fahrzeitzuschläge (Reserven) hinnehmen (siehe Tab. 5-1 75 <strong>statt</strong> 70 Minuten) und je nach<br />
Fahrplanabschnitt „gebündelt“ werden, so dass z. B. auf der Strecke Hamburg - Hannover -<br />
Kassel - Fulda kein kundenfreundlicher 30 Minuten-Takt angeboten werden kann, die von den<br />
jeweiligen Aufgabenträgern bestellten RE- und RB-Züge werden von IC(IR)-Zügen überholt, so<br />
dass RE- und IC(IR)-Züge gegenseitig in Konkurrenz stehen und im Güterverkehr können<br />
tagsüber nur wenige „langsame“ Fahrplantrassen angeboten werden, mit<br />
Überholungsaufenthalten von bis zu 40 Minuten. Auch die Infrastrukturbetreiberin - hier die DB<br />
Netz AG - kann durch diese vielen unterschiedlichen Kundenbedürfnisse ihre <strong>Trasse</strong><br />
betriebswirtschaftlich nicht optimal verkaufen.<br />
Daraus folgt, dass die Kapazität erhöht werden muss. Dieses kann auf prinzipiell zwei Wegen<br />
erreicht werden:<br />
1. Durch verschiedene Maßnahmen wird versucht, die Kapazität der einzelnen Strecke ohne<br />
zusätzliche Gleise zu erhöhen und / oder<br />
2. die Kapazität der nachgefragten Relation, hier z. B. Hamburg Richtung Süden wird durch<br />
zusätzliche Gleise erhöht.<br />
Eine Kapazitätssteigerung der Strecke kann prinzipiell durch eine Harmonisierung der<br />
Geschwindigkeiten, z.B. Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit der ICE-Züge, oder durch ein<br />
Ausbau der Leit- und Sicherungstechnik, z.B. Einführung des Hochleistungsblocks, erreicht<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 6
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
werden. Im ersten Fall würde dieses mit einer Qualitätseinbuße beim Produkt „ICE“ (teuer) erkauft<br />
werden. Auch ein Ausbau der Leit- und Sicherungstechnik wird praktisch keine<br />
Kapazitätssteigerung ergeben, da bereits heute die leistungsbeeinflussenden so genannten<br />
Blockabschnitte (Abstand zwischen zwei Hauptsignalen) sehr kurz sind.<br />
Daher muss die Kapazität durch zusätzliche Gleise erhöht werden. Dazu soll im Folgenden kurz<br />
mit Hilfe der Tab. 2-2 die Situation analysiert werden.<br />
Welche Besonderheiten für die Planung sind festzustellen?<br />
1. Erst ab ca. 19:00 Uhr ist der Bedarf an Fahrplantrassen für den Güterverkehr in der Nord-Süd-<br />
Richtung im Bereich Uelzen besonders groß, in der Gegenrichtung erst in den frühen<br />
Morgenstunden, die Hauptbelastung tritt praktisch außerhalb der ICE-Fahrzeiten auf.<br />
2. In Süd-Nord-Richtung sind ab etwa 22:00 Uhr noch Kapazitäten vorhanden.<br />
3. Die extreme Belastung mit Güterzügen ist versetzt, abends Nord-Süd, morgens Süd-Nord.<br />
4. Die Hauptnachfrage nach Fahrplantrassen für den Güterverkehr besteht dann, wenn der<br />
schnelle ICE-Verkehr nicht mehr fährt.<br />
Es muss folgende Frage folgen:<br />
Ist die Konzentration der Güterzüge abends eine Folge der fehlenden ICE-Züge, d. h. würde sich<br />
mit dem Bau z. B. der Y-<strong>Trasse</strong> diese Konzentration verschieben oder abbauen, da einige<br />
Güterzüge dann eher fahren könnten?<br />
Antwort:<br />
Von der Tendenz her: Nein. Die Güterzüge bzw. die Spitzennachfrage nach entsprechender<br />
Kapazität wird auch weiterhin in Nord-Süd-Richtung tendenziell abends bzw. spät nachmittags<br />
bestehen.<br />
Grund:<br />
Die Wirtschaft produziert und verlädt tagsüber. Waren werden bevorzugt kurz vor Feierabend<br />
versendet und bei Arbeitsbeginn am Morgen empfangen („Nachtsprung“). Auch werden z. B. im<br />
Hamburger Hafen die Schiffe nur tagsüber zu den „normalen“ Tagesschichten gelöscht, da<br />
niemand die teuren Nachtschichten bezahlen will. Zusätzlich erfolgt kein Direktumschlag, d. h. bei<br />
den Containern wird nicht direkt vom Schiff auf den Zug umgeschlagen. Auf die Gründe soll hier<br />
nicht näher eingegangen werden.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 7
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
Zählung der Züge in Uelzen (km 96,4) am Donnerstag, 19.9.02 von 17:58 Uhr - 22:25 Uhr<br />
Std:Min aus Richtung Hamburg Std:Min in Richtung Hamburg<br />
(17:58 Ankunft des Zählers mit RE mind. ab Lüneburg , ab 17:29 Uhr keine Vorbeifahrt eines<br />
Güterzuges)<br />
18:03 ICE 18:12 ICE<br />
18:15 IR 18:30 Güterzug<br />
18:32 Erzzug (5400 t) (16:55 Uhr Harburg durch) 18:39 IR<br />
18:38 Güterzug 18:50 Güterzug<br />
18:40 ICE 18:55 ICE<br />
18:59 RE 18:58 RE<br />
19:01 Güterzug 19:11 ICE<br />
19:08 Güterzug 19:13 (Lr-ICE)<br />
19:18 IR 19:23 Neigetechnik-ICE auf Gleis 301 aus Stendal<br />
19:49 ICE 19:29 Erzzug (leer)<br />
19:57 RE 19:34 Güterzug<br />
19:59 Güterzug 19:48 IC<br />
19:54 ICE<br />
19:57 RE<br />
20:04 Güterzug 20:16 Güterzug<br />
20:15 IR 20:33 ICE<br />
20:23 Güterzug 20:36 Güterzug<br />
20:28 Güterzug 20:56 ICE<br />
20:33 Güterzug Gleis 302 Æ Stendal 20:58 RE<br />
20:42 ICE<br />
20:51 Güterzug<br />
20:56 Güterzug<br />
21:20 RE (+21 Min. !, gezogen von BR 141) 21:09 ICE<br />
21:23 Güterzug 21:12 IC (aus Stendal)<br />
21:26 Güterzug 21:22 Güterzug<br />
21:31 Güterzug 21:27 Neigetechnik-ICE auf Gleis 301 aus Stendal<br />
21:34 Güterzug 21:42 IR<br />
21:42 Güterzug 21:56 ICE<br />
21:50 Güterzug 21:58 RE<br />
21:55 RE<br />
22:00 DB-Auto-/Nachtzug 22:07 ICE<br />
22:06 Güterzug 22:23 Güterzug<br />
22:12 Güterzug<br />
22:19 IR<br />
22:23 Güterzug Gleis 302 Æ Stendal<br />
(22:25 Abfahrt mit RE nach Hannover bis Celle an 23:03 kein Güterzug Richtung Uelzen !)<br />
Auf Y-<strong>Trasse</strong> verlagerbar, verbleibender Personenverkehr auf „Altstrecke“ , Relation Hamburg - Stendal<br />
Bemerkungen:<br />
- Die Neigetechnik-ICE von Berlin nach Hamburg sind temporär über Uelzen umgeleitet worden. Die Gleise 301 und 302 sind auf der<br />
Westseite des Bahnhofs Uelzen<br />
- Lr = Leerreisezug<br />
- Eine Zählung am Dienstag, 27.08.02 ab 19:46 Uhr führte auf die Zuganzahl bezogen zum gleichen Ergebnis.<br />
- Die Verteilung in den Stunden 10 - 17 entspricht der der Stunde 18, die Verteilung in den frühen Morgenstunden entspricht den<br />
Stunden 21 und 22 mit entgegengesetzter Belastung.<br />
Tab. 2-2: Zählung der Züge in Uelzen<br />
(Quelle: Zählung Sellien)<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 8
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
2.3 Gibt es weitere „Engpässe“ und Konfliktpunkte?<br />
2.3.1 Allgemein<br />
Bei der zur Zeit geführten Diskussion scheint der Eindruck zu bestehen, dass die Strecke Stelle -<br />
Lüneburg - Celle der einzige Engpass ist und mit dem Bau der Y-<strong>Trasse</strong> endlich der „Durchbruch“<br />
erreicht wird. Die Abb. 2-1 (Eisenbahninfrastruktur heute) scheint dieses zu bestätigen, die Y-<br />
<strong>Trasse</strong> liegt auf den ersten Blick „optimal“. Leider ist diesem nicht so. Denn im niedersächsischen<br />
und angrenzenden Eisenbahnnetz bestehen weitere gravierende Engpässe bzw. Konfliktpunkte,<br />
die sich mit steigendem Verkehrsaufkommen auf der Schiene weiter verschärfen werden. Dabei<br />
wird oft übersehen oder ausgeklammert, dass nicht in jedem Fall die Strecken die<br />
leistungsbegrenzenden Elemente darstellen, sondern auch und oft die Knoten (Bahnhöfe,<br />
Abzweige, Einfädelungen).<br />
Engpässe und Konfliktpunkte im relevanten Bereich sind insbesondere (keine Rangfolge):<br />
• Der Knoten Hannover<br />
• hier für die Nord - Süd - Relation: Hannover Hbf - Hannover Bismarckstraße (unbefriedigende<br />
Betriebsqualität)<br />
• Der Knoten Lehrte<br />
• Die Strecke Hude - Delmenhorst - (Bremen-Huchting) - Bremen Neustadt - Bremen Hbf, auf<br />
der der Verkehr von den Strecken aus Oldenburg (Oldb), Nordenham, Vechta und Bremen-<br />
Grolland sich Richtung Bremen summiert.<br />
• Die allgemein höhengleiche Einführung und Kreuzung bestehender Strecken. Dieses<br />
insbesondere in den Bahnhöfen Buchholz (Nordheide), Celle, Langwedel bzw. Verden (Aller),<br />
Lehrte und der Abzweig Groß Gleidingen (Braunschweig - Hannover/Hildesheim)<br />
• Die Kreuzung der RB-Züge Bremen-Vegesack - Verden (Aller) des Streckengleises Hannover -<br />
Bremen im Bahnhof Verden (Aller), heute zweimal pro Stunde.<br />
• Die Strecke Wunstorf - Nienburg (Weser)<br />
• Die Strecke Buchholz (Nordheide) - Hamburg-Harburg, wenn weitere ICE-Linien dazukommen.<br />
• Der Knoten Hamburg<br />
• Die Eingleisigkeit der Strecke Oldenburg (Oldb) - Leer (Ostfriesland)<br />
• Seelze - Minden (Westf)<br />
• Weddel - Lehre - Fallersleben<br />
Die Y-<strong>Trasse</strong> wird - bei unterstelltem Mehrverkehr - keinen dieser Konfliktpunkte entschärfen oder<br />
beseitigen. Im Gegenteil, die Probleme in den Knoten Hannover und Lehrte und im Bahnhof<br />
Buchholz (Nordheide) werden noch verschärft. Dazu reicht ein Blick auf die Streckenübersicht<br />
(Abb. 2-1): Sie „konzentriert“ den Personenverkehr auf Hannover und den Güterverkehr auf<br />
Lehrte. In Buchholz (Nordheide) wird durch die zusätzlichen ICE-Züge die Ein- bzw. Ausfädelung<br />
der Güterzuge der Relation Maschen - Rotenburg (Wümme) (-Bremen) behindert.<br />
Auch die Betriebsqualität auf der Strecke von Hannover Hbf bis Hannover Bismarckstraße wird<br />
nicht gesteigert. Oder anders formuliert. Dieser kurze Streckenabschnitt begrenzt im Süden die<br />
Leistungsfähigkeit der Y-<strong>Trasse</strong>.<br />
Westlich der Achse Rotenburg (Wümme) - Verden (Aller), also auch im Bereich Bremen, hat die<br />
Y-<strong>Trasse</strong> keine Auswirkung, wenn davon ausgegangen wird, dass weiterhin die ICE-Linie nach<br />
Bremen im 2-h-Takt verkehrt.<br />
Wird nun die Abb. A-1 betrachtet, in der die Engpässe, Konfliktpunkte usw. mit eingezeichnet<br />
sind, besteht eher der Eindruck, dass die Y-<strong>Trasse</strong> „irgendwie“ ungünstig zu liegen scheint. Im<br />
Norden könnte sie zwar Richtung Maschen „verschoben“ werden, so dass die vorhandenen<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 9
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
Konfliktpunkte - von Hamburg selbst abgesehen - umgangen werden, aber an welche Stelle<br />
müsste das südliche Ende verschoben werden? Es bietet sich für die Nord - Süd - Relation im<br />
Endeffekt nur der Bereich Peine / Braunschweig an. Eine NBS Maschen - Braunschweig (-<br />
Süden) wird allerdings unrealistisch sein.<br />
Darüberhinaus stellt sich die Frage, ob nicht auch die Strecke (oder Abschnitte) von Hannover -<br />
Osnabrück einen Engpass darstellt. Dieses aus dem Grund, dass die DB Netz AG dem<br />
Eisenbahnverkehrsunternehmen Connex keine geeignete Fahrplantrasse für deren geplanten<br />
InterConnex zur Verfügung stellen konnte.<br />
2.3.2 Buchholz (Nordheide) und Buchholz (Nordheide) - Hamburg-Harburg<br />
Im Folgenden soll kurz der Knoten Buchholz (Nordheide) und die Strecke Buchholz (Nordheide) -<br />
Hamburg-Harburg betrachtet werden. Beim Bau der Y-<strong>Trasse</strong> und unterstelltem<br />
Verkehrswachstum auf der Schiene werden sich die Probleme hier verschärfen.<br />
Im Bahnhof Buchholz (Nordheide) liegt die in Abb. 2-2 schematisiert dargestellte Infrastruktur vor.<br />
Vereinfacht ausgedrückt, werden hier zwei zweigleisige Strecken zu einer dreigleisigen Strecke<br />
zusammengefasst. Damit ist prinzipiell die Leistungsfähigkeit der zweigleisigen Strecken bereits<br />
heute begrenzt. Zusätzlich sind alle Kreuzungen höhengleich, auch die mit einer weiteren<br />
eingleisigen Strecke aus Soltau (Han).<br />
schematisierte Streckenführung im Bahnhof / Knoten Buchholz (Nordheide)<br />
(Auszug)<br />
a le Kreuzungen höhengleich!<br />
von / nach Hamburg<br />
von / nach B r emen<br />
= Konfliktpunkt<br />
von / nach S oltau (Han)<br />
von / nach M as chen<br />
Abb. 2-2: schematisierte Streckenführung im Bahnhof Buchholz (Nordheide)<br />
Grundsätzliche Betrachtung<br />
Ein Güterzug, der von Maschen nach Bremen durch den Bahnhof ohne Halt durchfährt, blockiert<br />
die Gleise der Richtung Bremen / Soltau (Han) - Hamburg etwa zwei Minuten. Das bedeutet, bei<br />
nur fünf Güterzügen pro Stunde kann etwa zehn Minuten kein Zug nach Hamburg fahren bzw. in<br />
den Bahnhof aus Richtung Bremen und Soltau einfahren. Wird das heutige Zugangebot (bis zu 1<br />
IC-, 1 MET-, 1 RE- und 2 RB-Züge = 5 Züge) pro Stunde und die durch die Y-<strong>Trasse</strong> zusätzlichen<br />
(mindestens) zwei ICE-Züge zugrundegelegt, so sind Probleme bei der zuverlässigen<br />
Betriebsführung zu erwarten.<br />
Eine Zählung an einem zufällig ausgewählten Werktag (Tab. 2-3) zeigt, dass bereits heute fast<br />
jeder Zug mehr oder weniger verspätet ist. Dabei ist für eine zuverlässige Betriebsdurchführung<br />
nicht entscheidend, ab wieviel Minuten eine Verspätung als Verspätung gezählt wird, da bereits<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 10
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
kleine Abweichungen vom Fahrplan bei sehr dichter Belegung zu weiteren Störungen bzw. zu<br />
Folgestörungen führen können.<br />
„Es kann bei größeren Betriebsschwierigkeiten durchaus sinnvoll sein, den Vorrang hochwertiger<br />
Züge vorübergehend einzuschränken, um den Betriebsablauf in einem überlasteten Netzelement<br />
flüssig zu halten.“ [Pachl, 1999, S. 163]<br />
Die zusätzliche Belastung mit weiteren Fernverkehrstaktlinien oder auch weiteren<br />
Nahverkehrszügen wird sich auf die Betriebsqualität (Pünktlichkeit) und die Höhe der<br />
Verspätungen nicht förderlich auswirken. Eine Untersuchung und ein entsprechender Ausbau des<br />
Knotens Buchholz (Nordheide) ist daher unabdingbar.<br />
Weiterhin fällt auf, dass die durchschnittliche Verspätung der Personenzüge aus dem<br />
(überlasteten) Knoten Hamburg mit durchschnittlich 4,6 Minuten größer als die 3,0 Minuten aus<br />
Richtung Bremen ist. Etwas „verfälscht“ wird die Verspätung aus Richtung Bremen durch die<br />
extreme Verspätung des RE um 20:44 Uhr von 25 Minuten. Wird für diesen RE eine „normale“<br />
Verspätung von 3 Minuten angesetzt, würde sich die durchschnittliche Verspätung von 3 auf 1,5<br />
Minuten reduzieren. Dieses zeigt, dass die Gestaltung und der Ausbau der Infrastruktur einen<br />
entscheidenden Einfluss auf die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des Eisenbahnbetriebes hat.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 11
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
Zählung der Züge in Buchholz(Nordheide) am Mittwoch, 23.10.02 von 16:44 Uhr - 20:44 Uhr<br />
Std:Min in Richtung Rotenburg(W) - Bremen Std:Min in Richtung Hamburg / Maschen<br />
(16:44 Ankunft des Zählers mit RE)<br />
16:45 RE +7 16:46 IC -1<br />
16:45 Güterzug<br />
16:55 RB +2<br />
17:13 IC +4 17:03 Güterzug (an 16:58)<br />
17:30 RB +1 17:14 Güterzug<br />
17:34 Güterzug 17:22 RE +3<br />
17:51 RB +2 17:28 RB<br />
17:57 RE +18 (RB Æ Soltau 17:45 ab17:54!) 17:28 Güterzug (an vor 16:44)<br />
17:32 Güterzug (an 17:17)<br />
17:46 IC -1<br />
17:50 RB<br />
17:59 Güterzug<br />
18:10 IC +1 18:02 Güterzug<br />
18:19 Güterzug 18:08 Güterzug<br />
18:30 RB +1 18:19 RE<br />
18:41 RE +3 18:29 MET +4<br />
18:52 Güterzug 18:30 RB +2<br />
18:41 Güterzug<br />
18:45 Güterzug<br />
18:47 IC<br />
18:51 RB +1<br />
19:01 RB 19:08 Güterzug<br />
19:23 Güterzug 19:22 RE +3<br />
19:25 IC +16 19:28 RB<br />
19:33 Güterzug 19:49 Güterzug<br />
19:37 RB +7 19:54 IC +7<br />
19:38 MET +1<br />
19:43 RE +3<br />
19:47 Güterzug<br />
19:55 RB<br />
19:56 Güterzug<br />
20:00 Güterzug 20:19 Güterzug<br />
20:04 Güterzug 20:25 Güterzug<br />
20:07 CNL +10 20:30 RB +2<br />
20:09 Güterzug 20:32 Güterzug<br />
20:17 IC +8 20:35 Güterzug<br />
20:32 RB +3 20:44 RE +25<br />
20:38 Güterzug<br />
20:39 RE +1<br />
(20:44 Abfahrt des Zählers mit RE)<br />
19 Züge Σ +88 Minuten = 4,6 Min./Zug 15 Züge Σ +45 Minuten = 3 Minuten / Zug<br />
Fernverkehr , Nahverkehr , Güterzug aus / nach Maschen, +/-Zahl = Verspätung / Verfrühung in Minuten<br />
Bemerkungen:<br />
- angesetzte Fahrzeiten: Hamburg Hbf - HH-Harburg / Buchholz(Nordheide): 11 / 22 Minuten<br />
- keine Verlagerung auf Y-<strong>Trasse</strong> möglich<br />
- pro Stunde und Richtung zwei ICE-Züge zusätzlich durch Y-<strong>Trasse</strong> (Verlagerung von Hamburg - Lüneburg - Hannover)<br />
Tab. 2-3: Zählung der Züge in Buchholz (Nordheide)<br />
(Quelle: Zählung Sellien)<br />
Anmerkung zum Unterkapitel: Hier wird ein weiterer grundsätzlicher Unterschied zwischen den Systemen<br />
„Straße“ und „Eisenbahn“ deutlich. Durch die besonderen Eigenschaften der Eisenbahn und des Stahlrad-<br />
Stahlschiene-Systems (wie lange Fahrzeugeinheiten oder lange Bremswege) wird u. a. ein Fahren im festen<br />
Raumabstand bei der Eisenbahn notwendig, der einen festen Fahrplan erfordert. Damit muss das Netz<br />
(Fahrdienstleiter) über die Betriebsführung entscheiden. Im Straßenverkehr entscheidet der Fahrzeugführer,<br />
wie schnell er fährt, wo er fährt und wann er den Fahrweg eines anderen Fahrzeugs kreuzt, alles ohne<br />
Sicherheitseinrichtung und nur auf Sicht. (vgl. auch [Breimeier, 12/2001]). „Eben mal kurz über das<br />
Streckengleis Bremen - Hamburg fahren“ - wie aus Autofahrersicht betrachtet - ist nicht möglich.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 12
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
2.4 Wettbewerb auf der Schiene - Die <strong>Trasse</strong>npreise<br />
Der Wettbewerb auf der Schiene und die damit einhergehende Öffnung der<br />
Eisenbahninfrastruktur für jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen bedingt ein<br />
<strong>Trasse</strong>npreissystem. In der Tab. 2-4 ist ein Auszug aus dem aktuellen <strong>Trasse</strong>npreissystem der<br />
DB Netz AG dargestellt. Der Grundpreis ist unabhängig von der Zuggattung, d. h., dass z. B.<br />
auch für einen Güterzug, der nur mit 100 km/h auf der SFS Hannover - Würzburg fährt, der<br />
Grundpreis von 3,38 EUR/km zu entrichten ist.<br />
<strong>Trasse</strong>npreissystem 2001 der DB Netz AG: <strong>Trasse</strong>npreise ab 01.01.2003<br />
(Auszug)<br />
Kategorie<br />
Fernstrecken<br />
Geschwindigkeitsbereich<br />
Grundpreis Grundpreis Beispielstrecke<br />
plus<br />
Auslastungsfaktor<br />
Fplus > 280 km/h 8,30 EUR/km 9,96 EUR/km SFS Köln - Frankfurt (M)<br />
F1 201 - 280 km/h 3,38 EUR/km 4,06 EUR/km SFS Hannover - Würzburg<br />
F2 161 - 200 km/h 2,24 EUR/km 2,69 EUR/km Hannover - Hamburg<br />
F3 101 - 160 km/h 2,12 EUR/km 2,54 EUR/km Wunstorf - Bremen<br />
F4 101 - 160 km/h 2,07 EUR/km 2,48 EUR/km<br />
F5 101 - 120 km/h 2,02 EUR/km 2,42 EUR/km<br />
S-Bahnstrecken<br />
S1<br />
Vmax S-Bahn<br />
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
wird, müssen die höheren <strong>Trasse</strong>nkosten durch eine drastische Angebotsreduzierung<br />
aufgefangen werden.<br />
Aus Sicht der DB AG / DB Netz AG mag diese Verteuerung der Regionalnetze<br />
betriebswirtschaftlich sinnvoll sein, aus volkswirtschaftlicher und raumordnungspolitischer Sicht ist<br />
dieses kontraproduktiv. ZIMMER stellt weiter fest, dass „bis heute faktisch keine<br />
Wettbewerbsmechanismen zur Erreichung effizienter Strukturen bei Bau, Betrieb und<br />
Unterhaltung der Schienenwege etabliert [sind]“ [ebd., S. 82].<br />
Inwieweit außerhalb dieser Regionalnetze z. B. bei der geringen Auslastung der Y-<strong>Trasse</strong> oder für<br />
die SFS Hannover - Wolfsburg - Berlin mit einer abschnittsweisen Belastung von nur 88 Zügen in<br />
beiden Richtungen [Andersen, 2000, S. 515] ebenfalls eine Art „Regionalfaktor“ zu erheben wäre,<br />
kann und soll hier ebenfalls nicht beurteilt werden, da die zugrundegelegte Berechnungsmethode<br />
nicht bekannt ist. Wie Tab. 2-4 zeigt, kann der <strong>Trasse</strong>npreis durchaus relativ niedrig sein<br />
(Kategorie S1 mit 1,45 EUR/km). Hier spielt sicherlich die hohe Auslastung eine wichtige Rolle.<br />
Dieses soll an Hand einer Beispielrechnung verdeutlicht werden. Oder anders gefragt: Wie viele<br />
Züge braucht das Eisenbahninfrastrukturunternehmen, damit die Strecke sich trägt?<br />
Beispielrechnung 1<br />
In einem sehr interessanten Referat auf einer Tagung des Niels-Stensen-Hauses (Worphausen) und des<br />
Verkehrsclubs Deutschland (<strong>VCD</strong>) am 6. März 2002 [Moorexpress, 2002, S.29 - 36] ging Carsten HEIN u. a.<br />
auf die Instandhaltungskosten der Infrastruktur ein. Als ein Beispiel nannte er die Strecke Bremervörde -<br />
Rotenburg (Wümme) der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe Weser GmbH (EVB). Für Instandhaltung<br />
muss die EVB jährlich etwa 6.700 EUR/km ausgeben. Bei einer Zuganzahl von 1.144 Zügen ergibt dieses<br />
einen rechnerischen „<strong>Trasse</strong>npreis“ von 5,86 EUR/km. Damit wäre diese Strecke teurer als die SFS<br />
Hannover - Würzburg, so dass dieser <strong>Trasse</strong>npreis nicht am Markt durchgesetzt werden kann. Wenn man<br />
berücksichtigt, dass die Unterhaltungskosten nicht oder nur sehr gering bei steigenden Zugzahlen steigen<br />
(hoher Fixkostenanteil, geringer Verschleiß), kann folgende Modellrechnung aufgestellt werden.<br />
Würde erreicht werden, dass pro Tag im Schnitt ein Zugpaar zusätzlich fährt (730 Züge), so sinkt der<br />
„<strong>Trasse</strong>npreis“ bereits auf 3,58 EUR/km. Oder anders ausgedrückt, bei konstantem <strong>Trasse</strong>npreis, sinkt die<br />
Kostenunterdeckung der Strecke.<br />
Dieses ist eine Modellrechnung, die für die Strecken der DB Netz AG genauso zutreffen.<br />
Beispielrechnung 2<br />
Werden für die Y-<strong>Trasse</strong> Baukosten von etwa 1,5 Mrd. EUR angesetzt, 35 Jahre Abschreibungszeitraum<br />
und eine Länge von 84 km, so ergibt sich bei 365 Tagen pro Jahr und (60 + 22 + 8 zusätzliche =) 90 Zügen<br />
pro Tag (siehe Tab. 2-1) ein „<strong>Trasse</strong>npreis“ nur durch die Baukosten (ohne Zinsen und Unterhaltung) von<br />
15,53 EUR/km. Zusätzlich ist vorausgesetzt, dass DB Netz auch die 60 wegfallenden ICE-Züge bzw. deren<br />
Einnahmen über Uelzen durch anderen Verkehr dort ersetzen kann. Dabei dürfen diese zusätzlichen Züge<br />
außerhalb der Strecke Hamburg - Uelzen - Celle - Hannover nur freie Kapazitäten belegen. Zusätzliche Züge<br />
durch allgemein gestiegenes Verkehrsaufkommen haben dort („rechnerischen“) Vorrang.<br />
Die derzeit teuerste Strecke in Deutschland liegt bei einem <strong>Trasse</strong>npreis von gut der Hälfte bei 8,30 EUR/km<br />
(Tab- 2-4). Die Differenz zu dem real erhobenen <strong>Trasse</strong>npreis muss irgendeiner Kostenstelle auch<br />
zugerechnet werden.<br />
Folgen für Y-<strong>Trasse</strong>n-Planung<br />
Die Regionalfaktoren zeigen, dass viele Strecken ihre Kosten heute nicht erwirtschaften können.<br />
Aus raumordnungspolitischen Gründen können (und werden) diese Strecken allerdings nicht<br />
stillgelegt werden. Da das Netz sich vom Prinzip selbst tragen muss (Vollkostendeckung),<br />
müssen diese Kosten an anderer Stelle aufgeschlagen werden. Nach [Zimmer, 2003, S. 83] wird<br />
nur in Deutschland auf diese Vollkostendeckung hingearbeitet, was für „Nebennetze“ allerdings<br />
als unrealistisch gelten muss. Wird nun durch eine entsprechende Planung erreicht, dass der<br />
Verkehr und der zusätzliche Verkehr durch einen entsprechenden Ausbau mit dem vorhandenen<br />
Netz bewältigt werden kann, hier insbesondere unter Einbeziehung der „Nebennetze“ (effektivere<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 14
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
Nutzung = Verbesserung der Wirtschaftlichkeit), <strong>statt</strong> eine neue, relativ gering ausgelastete<br />
Strecke neu zu bauen, führt dieses tendenziell zu sinkenden <strong>Trasse</strong>nkosten pro Zugkilometer.<br />
Es ist zu bezweifeln, ob die Y-<strong>Trasse</strong> aus Sicht des Infrastrukturbetreibers ohne Subventionen<br />
wirtschaftlich zu betreiben ist. (Die Gewinne oder Verluste des Eisenbahnverkehrsunternehmens,<br />
das auf der Y-<strong>Trasse</strong> seine Züge fahren lässt, bleiben davon unberührt!).<br />
Dieses bedeutet: Erst Ausbau, dann Neubau!<br />
2.5 Erfahrungen mit einer vorhandenen Aus- / Neubaustrecke<br />
An einer Fahrt des Verfassers von Braunschweig Hbf über Berlin-Spandau nach Hennigsdorf<br />
lassen sich grundsätzliche Fehler der aktuelleren Neubau- bzw. Schnellfahrstreckenplanung bzw.<br />
deren Ausführung in Deutschland verdeutlichen. Diese sind auch für die Y-<strong>Trasse</strong>n-Planung von<br />
Bedeutung, da hier ebenfalls Nah- und Güterverkehr abgewickelt werden sollen und die Hauptlast<br />
des Güterverkehrs durch Entlastung der bestehenden Strecke auf dieser verkehren soll. Auch<br />
können die systemtechnischen Vorgänge im Eisenbahnnetz verdeutlicht werden.<br />
Ein Erlebnisbericht (aus betrieblicher Sicht)<br />
Auf Grund einer Betriebsstörung im süddeutschen Raum fuhr der ICE mit etwa 40 Minuten Verspätung in<br />
Braunschweig ab. Auf dem eingleisigen Neubau „Weddeler Schleife“ bremste der ICE und fuhr längere<br />
Zeit im Schritttempo. Nach einiger Zeit war auf dem Kreuzungsgleis der stehende ICE der Gegenrichtung<br />
zu sehen. Nachdem der ICE wieder beschleunigt hatte und in Wolfsburg auch die 200 km/h erreicht hatte,<br />
kam der ICE vor Oebisfelde dann mehrere Minuten zum Stehen. Als dann endlich eine Diesellok mit ihrem<br />
Nahverkehrszug auf dem Gegengleis der Schnellfahrstrecke vorbeifuhr, erhielt der ICE wieder<br />
Fahrtberechtigung und beschleunigte auf 250 km/h. Aber nicht lange, denn im Bereich Stendal ging es<br />
wieder längere Zeit nur im Schritttempo voran. Wenige Minuten später, als der ICE wieder etwas schneller<br />
fuhr, war auch diese Ursache ersichtlich. Ein von einer E-Lok gezogener Güterzug Richtung Berlin<br />
„blockierte“ das Gleis des ICE’s und musste erst auf das Gegengleis geführt werden, damit er überholt<br />
werden konnte. Danach war aber immer noch nicht an eine durchgehende Fahrt mit der streckentechnischen<br />
Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h zu denken, da in dem vor Berlin gelegenen Trappenschutzgebiet nur<br />
mit 200 km/h gefahren werden darf, weil entsprechende Schutzmaßnahmen unterblieben sind.<br />
Schließlich ist dann doch noch Berlin erreicht worden, aber die Verspätung wurde nicht abgebaut,<br />
sondern aufgebaut. Immerhin - ab Rathenow „störte“ kein mit 160 km/h zwar schneller, im Vergleich zu<br />
den 250 km/h allerdings langsamer Nahverkehrszug die Fahrt. Der Anschlusszug nach Hennigsdorf war<br />
„natürlich“ abgefahren.<br />
Dieses Erlebnis ist sicher nicht „alltäglich“, es ist allerdings auch kein Einzelfall und enthält nicht<br />
alle Problem- und Konfliktbereiche. Für den „normalen“ Reisenden ist mit der SFS Hannover /<br />
Braunschweig - Berlin scheinbar eine sehr gute Maßnahme umgesetzt worden: Die Fahrzeit ist<br />
sehr deutlich verkürzt worden und im Stundentakt sind die letzten Lücken geschlossen worden.<br />
Angesichts der vorhandenen Probleme sind doch einige Fragen zu stellen. Ist nur eine<br />
suboptimale Lösung realisiert worden? Was ist das ursprüngliche Ziel dieser Maßnahme<br />
gewesen? Welche Fehler sind vollzogen worden bzw. welche Zwänge lagen hier bei der Planung<br />
des Ausbaus der Strecke Hannover / Braunschweig - Wolfsburg - Stendal - Berlin vor, die sich bei<br />
der Y-<strong>Trasse</strong> zu wiederholen scheinen?<br />
Bezogen auf u. a. die Betriebsführungsprobleme im Streckenabschnitt Rathenow - Berlin-<br />
Spandau spricht [Anderson, 2000, S. 519] von Problembereichen, „die ihre Ursachen in einer<br />
mangelnden vorausschauenden betriebssystematischen Durchleuchtung von Betriebsabläufen<br />
haben.“ Diese ist allerdings nur ein Baustein im Planungsprozess. Bevor eine<br />
betriebssystematische Untersuchung durchgeführt werden kann, muss eine Zielbeschreibung<br />
erfolgen bzw. ein Anforderungsprofil erstellt werden. Hier können bereits entscheidende Fehler<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 15
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
gemacht werden. Wenn hier z. B. angenommen wird, dass tagsüber kein Güterzug auf der SFS<br />
fährt, weil für den Güterverkehr auf der bestehenden dann entlasteten Strecke durch den<br />
weitgehenden Wegfall der ICE-Züge ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stehen, später dann<br />
doch Güterzüge über die SFS geführt werden (müssen), weil der Bedarf bzw. die Nachfrage<br />
falsch eingeschätzt worden ist, wird die betriebssystematische Durchleuchtung mit „falschen“<br />
Ausgangsdaten durchgeführt. Auch für den Fall, dass die betriebssystematische Durchleuchtung<br />
mit „richtigen“ Zahlen durchgeführt worden ist, muss die Planung im letzten Schritt schließlich<br />
ausgeführt werden. Hier kann dann der Zwang entstehen, die „optimale“ Planung fallen lassen zu<br />
müssen, weil nicht genügend Geld zur Verfügung gestellt wird.<br />
Der Verfasser erinnert sich an eine Exkursion zur Baustelle der Weddeler Schleife. Der Vertreter<br />
der DB AG sagte sinngemäß (nach Erinnerung des Verfassers): „Wir hätten gerne zweigleisig<br />
ausgebaut, aber seitens der Politik sind die wenigen Millionen Euro (damals noch DM) nicht<br />
bewilligt worden. Wir bauen aber bereits so, dass das zweite Gleis später nur noch verlegt<br />
werden muss.“<br />
Die heute bestehende Lösung ist zweifelsfrei eine Verbesserung gegenüber dem vorhergehenden<br />
Zustand. Sie kann allerdings den Eindruck entstehen lassen, dass „eigentlich“ – bis auf die<br />
fehlende Zweigleisigkeit Weddel - Fallersleben (Weddeler Schleife) – eine sehr gute Lösung<br />
realisiert worden ist. Um dieses beurteilen zu können, müssen zwei Fragen beantwortet werden.<br />
Welches Planungsziel ist aus der realisierten Lösung „rückwärts“ ermittelbar? Wie könnte<br />
eine andere Lösung aussehen?<br />
Die Antwort auf die erste Frage kann wie folgt aussehen: Hauptziel ist die Verkürzung der<br />
Reisezeit, betriebliche Probleme werden akzeptiert. Dieses ist sicher nicht das geplante Ziel<br />
gewesen. Es ist das, was sich aus heutigen Situation ergibt. Es liegt also eine Diskrepanz<br />
zwischen Wunsch (Planungsziel) und Wirklichkeit (tatsächliche Realisierung) vor. Deutlich wird<br />
dieses auch, wenn die „optimalere“ Lösung betrachtet wird:<br />
• konsequente Trennung des langsamen Verkehrs vom schnellen Verkehr. Im Abschnitt<br />
Fallersleben - Wolfsburg - Berlin-Spandau problemlos durchzuführen, da praktisch über die<br />
gesamte Strecke weitgehend ein drittes Gleis vorhanden ist (bzw. problemlos hätte verlegt<br />
werden können), welches nicht elektrifiziert ist, so dass es heute für Duchgangsgüterzüge und<br />
den elektrisch betriebenen Nahverkehr im Berliner Bereich nicht nutzbar ist.<br />
• zweigleisiger Ausbau (Braunschweig -) Weddel - Fallersleben („Weddeler Schleife“) und<br />
(Braunschweig-) Groß Gleidingen - Hildesheim.<br />
• entsprechender Ausbau des Knotens Lehrte einschließlich der Strecke bis Fallersleben, so<br />
dass auch hier eine weitgehende Trennung zwischen den Verkehren möglich ist.<br />
• ab Lehrte bis Berlin-Spandau eine durchgehende Höchstgeschwindigkeit von 250 - 300 km/h,<br />
wobei in einem etwa 150 km langen Abschnitt zwischen Wolfsburg und Berlin-Spandau eine<br />
durchgehende Beharrungsgeschwindigkeit von 300 km/h erreicht werden könnte (Ob dieser<br />
Geschwindigkeitsbereich „sinnvoll“ oder „unsinnig“ ist, ist eine andere Diskussion. Es geht hier<br />
nur um das Aufzeigen der Alternative!)<br />
• Im Trappenschutzgebiet wären bauliche Gegenmaßnahmen realisiert worden, die einen<br />
Geschwindigkeitseinbruch vermieden hätten bzw. das Gebiet wäre umfahren worden.<br />
Mit diesen Maßnahmen, die relativ wenig kosten (im Vergleich zu den Gesamtkosten) bzw.<br />
gekostet hätten, wäre Folgendes erreicht worden:<br />
• Die Fahrzeit Hannover Hbf - Berlin Zoolg. Garten hätte von heute 1 h 31 Min. um etwa 20<br />
Minuten auf 71 Minuten zuverlässig verkürzt werden können, so dass mit einer<br />
Reisegeschwindigkeit von (254 km / 71 Min. =) 214,6 km/h von einer tatsächlichen<br />
Hochgeschwindigkeitsstrecke gesprochen werden könnte.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 16
2 Bestandsaufnahme und -analyse<br />
• Gleichzeitig wird Kapazität bereitgestellt, für die Nachfrage in der Güterzugrelation<br />
(Ruhrgebiet-) Hannover - Berlin (- Polen), auf der heute Bedarf vorhanden ist und der nicht<br />
über Braunschweig - Magdeburg geführt werden kann (wichtig für EU-Osterweiterung).<br />
• Der Nahverkehr hätte sehr flexibel geplant werden können, so dass nicht nur die<br />
Zuverlässigkeit im Knoten Berlin oder Braunschweig erheblich steigen könnte. Er hätte<br />
zusätzlich beschleunigt und im Berufsverkehr dem erhöhten Bedarf angepasst werden können,<br />
d. h. es wären die Anforderungen aller Kunden (Fern-, Nah- und Güterverkehr) berücksichtigt<br />
worden.<br />
• Die Zuverlässigkeit des gesamten Netzes wäre erhöht worden, da u. a. die weitgehend<br />
eingleisige „Konfliktstrecke“ Fallersleben - Braunschweig - Hildesheim entfallen wäre.<br />
Bei der Y-<strong>Trasse</strong> ist eine Wiederholung der Fehler erkennbar: Diskrepanz zwischen Wunsch und<br />
erkennbarer Wirklichkeit, Bevorzugung des Personenfernverkehrs (Güterverkehr verbleibt auf<br />
entlasteter Strecke, Nahverkehr wird auf der Strecke Bremen - Hamburg behindert bzw. behindert<br />
dort den Fernverkehr).<br />
Anmerkung zum Systemunterschied Schiene - Straße: Eine grundsätzlich andere Systemeigenschaft des<br />
Eisenbahnnetzes bzw. des Eisenbahnverkehrs im Vergleich zum Straßenverkehr wird deutlich. Eine<br />
Betriebsstörung im süddeutschen Raum wird „weitergereicht“ und wirkt sich auch im norddeutschen Raum<br />
aus. Ein Stau auf einer Autobahn in Süddeutschland dagegen wird im norddeutschen Autobahnnetz zu<br />
keinen Störungen führen. Mit diesem Problem hat insbesondere DB Reise&Touristik zu kämpfen, da eine<br />
singuläre Störung verhindern kann, praktisch die gesamte Dienstleitung „pünktlicher Transport“ des<br />
einzelnen Zuges in mindestens befriedigender Qualität zu erbringen. Dieses soll kein „Blanko-Scheck“ sein,<br />
muss aber bei Störungen, die außerhalb des Verantwortungsbereiches von DB Reise&Touristik liegen,<br />
berücksichtigt werden.<br />
Auch die Überholung von langsamer fahrenden Zügen (im Regelfall bei Verspätung) ist im Gegensatz zur<br />
Straße nur an bestimmten Stellen möglich (Gegenverkehr darf wie auf einer Bundesstraße ebenfalls nicht<br />
vorhanden sein) und zwar dort, wo eine Weichenverbindung besteht. Dadurch muss der schneller fahrende<br />
Zug u. U. sehr lange hinter dem langsamen Zug herfahren. Für die Netzplanung bedeutet dieses, dass die<br />
Zuverlässigkeit des Netzes erhöht werden muss.<br />
2.6 Zwischenfazit<br />
Die Strecke Stelle - Lüneburg ist zweifelsfrei ein Engpass, der beseitigt werden muss und durch<br />
ein drittes Gleis in Zukunft auch zumindest entlastet wird. Durch die Y-<strong>Trasse</strong> würde zwar eine<br />
weitere Entlastung <strong>statt</strong>finden. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass im<br />
niedersächsischen Eisenbahnnetz noch weitere Engpässe und Konfliktpunkte bestehen, so z. B.<br />
der Bahnhof Buchholz (Nordheide) und nach Realisierung der Y-<strong>Trasse</strong> auch die Strecke<br />
Scheeßel - Buchholz (Nordheide) - Hamburg-Harburg. Zusätzlich sind auch Knoten bzw.<br />
Bahnhöfe leistungsbegrenzende Elemente. Dieses wird in der gesamten Y-<strong>Trasse</strong>n-Diskussion<br />
leider immer übergangen. Gleichzeitig ist umfangreiche, wenig genutzte Eisenbahninfrastruktur<br />
vorhanden.<br />
Angesichts der Fehler, die bei der Aus-/Neubaustrecke Hannover / Braunschweig - Wolfsburg -<br />
Berlin gemacht worden sind - u. a. mangelhafte und ungenaue Zielsetzung, fehlende<br />
betriebssystematische Untersuchung(en) und mangelnde Finanzierungszusagen seitens der<br />
Politik - ist zu fordern, das für den norddeutschen Raum eine eisenbahnbetriebswissenschaftliche<br />
Untersuchung durchgeführt wird (siehe dazu auch Kap. 8), damit nicht scheinbar gute bzw.<br />
suboptimale Lösungen - wie die Y-<strong>Trasse</strong> - mit hohen Investitionsmitteln umgesetzt werden.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 17
3 Welche Bahn will der Kunde<br />
3 Welche Bahn will der Kunde?<br />
Eine wichtiger Einflussfaktor der Ausbauplanung der Schieneninfrastruktur sollten die Wünsche<br />
und Anforderungen aller Kunden sein. Wie im vorhergehenden Kapitel gezeigt, sind bei der SFS<br />
Hannover / Braunschweig - Berlin nicht alle Kunden gleichermaßen berücksichtigt worden, so<br />
dass es hier sogar zu betrieblichen Problemen kommt. Bei der Planung zur Y-<strong>Trasse</strong> scheint der<br />
Eindruck zu bestehen, als ob nur die Interessen des Personenfernverkehrs im Vordergrund<br />
stehen. Der Güterverkehr, für den die eigentliche Kapazitätserweiterung geplant werden soll, wird<br />
selten erwähnt. In der Tab. 3-1 sind die wichtigsten Einflussfaktoren für die Verkehrsmittelwahl<br />
aufgeführt. Eine Gewichtung ist bei dieser allgemeinen Zusammenstellung nicht möglich, da<br />
dieses immer von der Zielgruppe abhängt. Für den Geschäftsreisenden sind eher (früh)morgens<br />
und abends sehr schnelle, auch preislich teurere Verbindungen wichtig, während der<br />
Berufspendler werktags einen dichten Takt zu einem sehr günstigen Preis verlangt mit einer<br />
zuverlässigen Verknüpfung mit den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln und für Familien mit<br />
Kleinkindern sind Fahrpreis und Umsteigevorgänge von Bedeutung.<br />
Einflussfaktoren für Verkehrsmittelwahl, (ohne Gewichtung)<br />
Personenverkehr<br />
Reisezeit Haus - Haus (nicht Höchstgeschwindigkeit)<br />
Fahrpreis<br />
Komfort<br />
Service<br />
Verbindungsangebot (zeitlich, Taktdichte)<br />
Zuverlässigkeit<br />
Bequemlichkeit / Umsteigevorgänge<br />
Tab. 3-1: Einflussfaktoren für Verkehrsmittelwahl<br />
Güterverkehr<br />
Beförderungspreis / Preisgestaltung<br />
Beförderungszeit<br />
Lieferqualität<br />
Kundennähe<br />
Termintreue / Zuverlässigkeit<br />
Wie das Angebot „Schönes-Wochenende-Ticket“ zeigt, kann das Merkmal „Preis“ das einzig<br />
relevante sein. Denn auf längeren Strecken nehmen praktisch alle anderen Merkmale in ihrer<br />
Qualität stark ab. Oder systemisch betrachtet: Ab einem bestimmten Grenzwert versagt die<br />
„lineare Betrachtung“ „Wenn die Reisezeit, der Preis,... um den Betrag X sinkt / steigt, dann<br />
fahren Y Reisende mehr / weniger mit der Bahn“. Auch der neue InterConnex von Gera - Leipzig -<br />
Berlin - Rostock zeigt, dass Schnelligkeit nicht das wesentliche Merkmal sein muss. Wobei der<br />
InterConnex mit Vmax=120 km/h nicht schnell ist, aber im Vergleich zu bestehenden<br />
Zugverbindungen schneller und im Vergleich zum Auto möglicherweise auch schneller und<br />
bequemer bzw. entspannter.<br />
Ein anderer (möglicher) großer Kunde der Schiene ist die verladende Wirtschaft, so dass die<br />
Belange des Güterverkehrs nicht vergessen oder übergangen werden dürfen. So war der<br />
Güterverkehr die „Brot- und Buttersparte“ auch der „späten“ Deutschen Bundesbahn.<br />
Im Güterverkehr sind nach [Breimeier, 1999, S. 80] vor allem Beförderungspreis, danach erst<br />
Beförderungszeit und sonstige Aspekte von Bedeutung.<br />
„Die Bedeutung guter Hinterlandverbindungen für einen Seehafen wird durch Angaben<br />
unterstrichen, nach denen die Seestrecke heute nur noch etwa 20 bis 25 Prozent der<br />
Gesamtkosten weltweiter Transporte ausmacht. Der überwiegende Teil entfällt auf die Kosten des<br />
Landverkehrs, bei denen daher auch die größeren Potenziale für Kostensenkungen durch<br />
Verbesserungen der Infrastruktur vermutet werden können.“<br />
[Sichelschmidt, 2003, S. 18], im Original nicht fett markiert.<br />
Der Güterverkehr verlangt also nach preiswerten, „zügigen“ Strecken. Wie das<br />
<strong>Trasse</strong>npreissystem der DB Netz AG zeigt (Tab. 2-4), ist der Grundpreis der Strecke(nkategorie)<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 18
3 Welche Bahn will der Kunde<br />
tendenziell höher, je schneller gefahren werden darf. Eine Schnellfahrstrecke, die vom<br />
Güterverkehr mitbenutzt wird (bzw. werden muss) widerspricht damit vom Prinzip dem Kriterium<br />
„günstiger Beförderungspreis“. Da die bestehende Strecke über Uelzen nach Realisierung der Y-<br />
<strong>Trasse</strong> im <strong>Trasse</strong>npreissystem nicht zurückgestuft werden wird - der IC(IR)-Verkehr wird<br />
weiterhin auf der Strecke über Uelzen verbleiben (siehe z. B. [Andersen, 2000, S. 522]), werden<br />
die <strong>Trasse</strong>nkosten nicht gesenkt werden können. Auch durch ihre Funktion als Ausweichstrecke<br />
(bei Betriebsstörung auf der Y-<strong>Trasse</strong>) wird die heute vorhandene Infrastruktur nicht<br />
zurückgebaut werden.<br />
SICHELSCHMIDT erwähnt für Deutschland durchschnittliche Entgelte für die <strong>Trasse</strong>nnutzung von<br />
2,60 Euro je Zugkilometer, im Gegensatz zu den Niederlanden, wo subventionsbedingt zur Zeit<br />
0,21 Euro (bis 2006 soll auf 0,95 Euro angehoben werden) zu entrichten sind. Diese 2,60 Euro<br />
entsprechen etwa der DB - Streckenkategorie F2 (z. B. Hamburg - Hannover, siehe Tab. 2-4). Mit<br />
der Y-<strong>Trasse</strong> werden für die Nord - Süd - Relation keine günstigeren <strong>Trasse</strong>npreise angeboten<br />
werden können. Für die Y-<strong>Trasse</strong> selbst werden die <strong>Trasse</strong>npreise - ohne Subventionen - höher<br />
liegen. Bei einem Ausbau, der den Interessen des Güterverkehrs entspricht und z. B. im Ausbau<br />
vorhandener Strecken besteht (siehe Kapitel 6), könnte der <strong>Trasse</strong>npreis auf mindestens 2,12 -<br />
2,02 Euro (oder um etwa 20 Prozent) pro Zugkilometer gesenkt werden. Dieses entspräche<br />
einem Ausbau der Strecken nach Kategorie F3 bis F5. Da die Strecken dann nicht überlastet<br />
sind, entfällt der Auslastungsfaktor.<br />
(Anmerkung: Die vom Güterverkehr intensiv genutzte SFS Hannover - Würzburg ermöglicht eine sehr große<br />
Verkürzung der Transportzeit bzw. ermöglicht den Nachtsprung. Die Y-<strong>Trasse</strong> verkürzt die Transportzeit nur<br />
unwesentlich.)<br />
Andere „Aspekte von Bedeutung“ können sein: Preisgestaltung, Lieferqualität, Kundennähe und<br />
Termintreue. Die hier gesammelten positiven Erfahrungen haben z. B. den BASF-Konzern<br />
bewogen, ihren seit Liberalisierung des Schienenverkehrs selbst durchgeführten Güterverkehr<br />
auszudehen (Frankfurter Rundschau vom 24.11.1998).<br />
(Anmerkung des Verfassers: Diese „privaten“ Güterzüge sind z .B. an den Lokomotiven mit Aufschriften wie<br />
„Rail4Chem“, „TX Logistik“ oder an dem „bunteren“ Anstrich zu erkennen.)<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 19
4 Verkehrsentwicklung und -prognosen<br />
4 Verkehrsentwicklung und -prognosen<br />
4.1 Allgemein<br />
Alle Verkehrsprognosen kommen zu dem Ergebnis, dass sowohl im Personen- als auch im<br />
Güterverkehr die Verkehrsleistung sehr stark zunehmen wird. Ob diese Prognosen zutreffen oder<br />
sich als falsch erweisen, kann hier nicht untersucht werden. Es lassen sich allerdings in jedem<br />
Fall zwei Schlussfolgerungen ziehen, die tendenziell das gleiche Ergebnis liefern:<br />
1. Die Prognosen bewahrheiten sich, dann muss die Kapazität der Schieneninfrastruktur<br />
erweitert werden, wenn nicht die gesamte Steigerung überwiegend auf der Straße<br />
abgewickelt werden soll.<br />
2. Die Prognosen treten nicht ein, es kommt sogar zu einem mehr oder weniger starken<br />
Rückgang der gesamten Verkehrsleistung. Mögliche Ursachen können sein: Höhere<br />
Energiepreise, Trend zum Einkaufen vor Ort und von regionalen Produkten, das gesamte<br />
Verkehrssystem lässt keine Steigerung mehr zu oder auch eine nachhaltige Raumplanung,<br />
die verkehrsreduzierende Strukturen umsetzt.<br />
Statistik: 1999 betrug die Jahresfahrleistung im gesamten deutschen Straßennetz 639,3 Mrd. Kfzkm,<br />
2000 ging sie um 2,5 % auf 623,3 Mrd. Kfzkm zurück. [Drucksache 14/8754]<br />
Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen sank die Zahl der<br />
Flugreisenden auf Deutschlands Flughäfen 2001 und 2002 um 2,5 bzw. 2,2 Prozent.<br />
(Braunschweiger Zeitung, 1. 3. 2003)<br />
Gleichzeitig soll auch die politische Vorgabe umgesetzt werden, den Verkehr<br />
umweltfreundlicher zu bewältigen bzw. die Straßen zu entlasten, d.h. mehr „Güter auf die<br />
Schiene“. Auch in diesem Fall, muss die Kapazität der Schieneninfrastruktur prinzipiell<br />
erhöht werden. Wenn dieses Ziel auch wirklich umgesetzt werden soll, dann ist der<br />
folgenden Aussage von [Breimeier, 2/2001, S. 92] zuzustimmen:<br />
„Soll die Schiene entsprechend den Vorgaben der Verkehrspolitik die Straße tatsächlich<br />
spürbar entlasten, darf eine Steigerungsrate von 100 % - ausgehend von der<br />
gegenwärtigen Belastung - bei langfristiger Betrachtung keine Utopie bleiben.“ Dieses<br />
entspricht im Güterverkehr einer Steigerung der Zugzahlen um 70 % (ein Teil der Zunahme<br />
führt zur stärkeren Auslastung der Züge).<br />
Die Frage, wie, wann und in welchem Umfang diese Kapazitätserhöhung erreicht wird, Neubau<br />
oder Ausbau, ist erst die anschließende Frage.<br />
Weitere Einzelbeispiele, die für mehr Güterverkehr auf der Schiene sorgen (können).<br />
Ostseehafen Lübeck<br />
Der Hafen Lübeck ist mit fast 26 Mio. t im Jahre 2000 und einem Marktanteil von 40 Prozent am<br />
Umschlag der größte deutsche Ostseehafen. „In der nächsten Zeit werden hier ein Landterminal<br />
des Kombinierten Verkehrs gebaut, neue Hafenflächen und 35 ha Gewerbegebiete geschaffen.<br />
[...] Fünf Betriebsbahnhöfe und etwa 85 km Gleise verknüpfen das Infrastrukturnetz mit dem<br />
Hafen. Der Hafenausbauplan sieht hier noch großes Verbesserungspotenzial für<br />
Hafenhinterlandverkehre auf der Schiene“. Zur Zeit beträgt der Modal-Split-Anteil der Schiene 16<br />
Prozent, der nach den Planungen der Bahn auf 30 Prozent gesteigert werden soll. Verschiedene<br />
Maßnahmen wie die Elektrifizierung der Strecke Hamburg - Lübeck Hafenhöfe und die<br />
Modernisierung der Hafenbahn sollen eine Erhöhung der bisherigen 35 Ganzzugabfahrten pro<br />
Woche ermöglichen. [Schwarz, 2002, S. 172]<br />
Die heute eingleisige, nicht elektrifizierte Strecke Lübeck - Büchen - Lüneburg ist im Endzustand<br />
von „Netz 21“ eine „Strecke im Leistungsnetz“. [Jänsch, 2001, S. 109].<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 20
4 Verkehrsentwicklung und -prognosen<br />
Industriegebiet Braunschweig / Wolfsburg / Salzgitter<br />
Dieses große Industriegebiet ist Richtung Norden im Personen- und Güterverkehr nur über den<br />
Umweg Hannover / Lehrte angeschlossen, so dass die Schiene im Vergleich zur Straße im<br />
Nachteil ist. Besonders ungünstig ist dieses für den viermal täglich verkehrenden 5400 t schweren<br />
Erzzug Hamburg-Hansaport - Salzgitter-Beddingen, der von seiner Fahrdynamik nur sehr schwer<br />
in den Fahrplan eingebunden werden kann und heute den Umweg über den überlasteten Knoten<br />
Lehrte nehmen muss.<br />
Richtung Süden besteht praktisch nur der Umweg über Hildesheim und nicht der direkte Weg<br />
über Salzgitter-Ringelheim. Die Schiene kann ihr Potenzial hier nicht voll ausschöpfen.<br />
Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG (NVAG) / Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH<br />
(BTE)<br />
Der ländliche Raum gilt als unwirtschaftlich für DB Cargo. Innovative Bahnunternehmen ändern<br />
das. Die Nordfriesischen Verkehrsbetriebe (NVAG) erschließen das nördliche Schleswig-Holstein<br />
mit Güterverkehrsleistungen. Fünfmal pro Woche holt die NVAG vom Rangierbahnhof Maschen<br />
die georderten Güterwagen ab und verteilt sie auf 18 Güterverkehrsstellen im nördlichen<br />
Schleswig-Holstein.<br />
Vergleichbar versorgt die BTE Güterverkehrsstellen im Raum Delmenhorst und Kirchweye.<br />
Dieses mit so großem Erfolg, dass die Lok ihre Runde zwei- bis dreimal täglich fahren muss.<br />
[der schienenbus, 6/2001 S. 79, 1/2002 S.32]<br />
Abbau von Wettbewerbsverzerrungen, Verteuerung der Energiepreise<br />
Der Abbau und die Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen im Verkehrsbereich wird<br />
tendenziell zu einer Erhöhung des Verkehrs auf der Schiene führen. Eine Ungleichbehandlung<br />
der Eisenbahn ist insbesondere in folgenden Punkten für eine so genannte freie Marktwirtschaft<br />
aus Wettbewerbsgründen nicht hinnehmbar:<br />
• Mehrwertssteuerpflicht bei internationalen Bahnfahrscheinen, im Gegensatz zum Flugverkehr<br />
• Mineralölsteuerpflicht nicht für alle Verkehrsmittel<br />
• erhöhter Ökosteuersatz bei den öffentlichen, umweltfreundlichen Verkehrsmitteln<br />
Weiterhin wird eine Verteuerung der Energiepreise - durch politische Maßnahmen oder durch<br />
Verknappung der Rohstoffe bedingt - zum einen zur Verkehrsvermeidung führen zum anderen<br />
aber die energiesparende Schiene bevorzugen.<br />
4.2 Prognosen und Realität<br />
[Andersen, 2002, S. 532] stellt zwei sehr interessante Vergleiche zwischen verschiedenen<br />
Prognosen zu geplanten Hochgeschwindigkeitsstrecken (Tab. 4-1) und zwischen Prognosen und<br />
Realität bei der in Betrieb gegangenen NBS Hannover - Würzburg auf.<br />
Insbesondere die unterschiedlichen Ergebnisse der Prognosen in Tab. 4-1 sind „erschreckend“<br />
und absolut keine Planungsgrundlage. Während für Fulda - Erfurt nach der Prognose 1992 eher<br />
eine „Güterschnellstrecke“ gebaut hätte werden müssen, stellt sich nach der Prognose 1995 fast<br />
schon die Frage, ob eine reine Hochgeschwindigkeitsstrecke rentabel betrieben werden kann.<br />
Auch die prognostizierten 3 Güterzüge – wenn „klassische“ Güterzüge mit hoher Achslast hier<br />
unterstellt werden – 1992 für Köln - Frankfurt haben einen gravierenden Einfluss auf die<br />
Baukosten. Werden keine Güterzüge zugelassen, dann kann eine reine Personenzugstrecke<br />
gebaut werden, die auf Grund der Trassierungsparameter wesentlich günstiger gebaut werden<br />
kann als eine Mischbetriebsstrecke. Auch die Zahlen für Stuttgart - Ulm sprechen für sich.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 21
4 Verkehrsentwicklung und -prognosen<br />
Prognosen zur Auslastung deutscher Hochgeschwindigkeitsstrecken für das Jahr 2010<br />
Züge pro Tag und Richtung<br />
Prognose 1992 für 2010 Prognose etwa Mitte 1995 für 2010<br />
P-Züge G-Züge Summe 1992 P-Züge G-Züge Summe 1995<br />
(München-) Ingolstadt - Nürnberg 44 38 82 42 20 62<br />
(Nürnberg-) Ebensfeld - Erfurt 24 90 114 24 55 79<br />
Erfurt - Halle / Leipzig 56 95 151 48 60 108<br />
(Hanau -) Fulda - Erfurt 36 104 140 38 25 63<br />
Köln - Frankfurt(Main) 88 3 91 79 0 79<br />
Köln - Frankfurt(Main) Fahrplan 2003 59 0 59<br />
Stuttgart - Ulm 70 80 150 50 20 70<br />
Tab. 4-1: Prognosen zur Auslastung deutscher Hochgeschwindigkeitsstrecken<br />
(Quelle : [Andersen, 2002, S. 532], ergänzt um Fahrplan 2003)<br />
Bei der NBS Hannover - Würzburg besteht die Möglichkeit, Prognosen mit der tatsächlichen<br />
Belegung zu vergleichen. Auf zwei Kleine Anfragen der Gruppe Bündnis ‘90 / Die Grünen<br />
(Drucksache 12/8476 vom 12.9. 1994) und des Abgeordneten Albert Schmidt (Hitzhofen) und der<br />
Fraktion Bündnis ‘90 / Die Grünen (Drucksache 13/2130 vom 10.8.1995) hat die Bundesregierung<br />
die in der Tab. 4-2 zusammengefassten Angaben zur Belegung der NBS Hannover - Würzburg<br />
gegeben.<br />
Prognose und tatsächliche Belegung der NBS Hannover - Würzburg<br />
Angabe Richtung und Gegenrichtung<br />
Personenzüge Güterzüge Summe<br />
Prognose (keine Jahresangabe) 120 120 240<br />
Tatsächliche Belegung August 1994 100 70 170<br />
Prognose BVWP ’80 für Zielhorizont 1990 88 152 240<br />
Tatsächliche Belegung Mitte 1995 100 65 165<br />
Tab. 4-2: Prognose und tatsächliche Belegung NBS Hannover - Würzburg<br />
(Quelle: [Andersen, 2002, S. 532])<br />
Auf den ersten Blick scheint hier eine „bessere“ Trefferquote gelungen zu sein. Doch wird die<br />
Summe betrachtet, so ist der Unterschied zwischen prognostizierten 240 Zügen und erreichten<br />
165 Zügen ebenfalls sehr groß. Auch ist das Verhältnis Personenzüge zu Güterzügen umgedreht.<br />
Es sei an dieser Stelle der wichtige Hinweis gegeben, dass es hier um die Prognosen bzw.<br />
deren Zuverlässigkeit geht und nicht um die Frage, ob die jeweilige Strecke sinnvoll oder<br />
„unsinnig“ ist. So wird heute keiner die damals umstrittene NBS Hannover - Würzburg mit einer<br />
abschnittsweisen Belastung von 186 Zügen in beiden Richtungen an sich in Frage stellen.<br />
Diskutiert werden kann bzw. wird z. B. in [Andersen, 2002] die Wahl der optimalen<br />
<strong>Trasse</strong>nführung.<br />
Nicht nur die Prognosen bei den großen Hauptabfuhrstrecken sind bezogen auf die Qualität oder<br />
Zuverlässigkeit sehr interessant, auch die von kleinen, so genannten Nebenstrecken.<br />
„Von der Öffentlichkeit unbemerkt findet im Südwesten seit Jahren eine kleine Revolution <strong>statt</strong>.<br />
Auf der Wieslauftal- und Schönbuchbahn steigen die Fahrgastzahlen ständig. Immer mehr der<br />
autoverliebten Schwaben lassen ihr „Heilig’s Blechle“ in der Garage und benutzen <strong>statt</strong> dessen<br />
die Bahn vor der Haustür. „Ein Phänomen“, rätselt Manfred Aschpalt von der Württembergischen<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 22
4 Verkehrsentwicklung und -prognosen<br />
Eisenbahngesellschaft mbH (WEG), die beide Nebenstrecken betreut.“ (Frankfurter Rundschau,<br />
19.12.1998) In der Tab. 4-3 sind die Zahlenangaben dieses Artikels zusammengefasst.<br />
Das „Wiesele“ fährt die 11 km von Schorndorf nach Rudersberg (DB-Kursbuchstrecke 787,<br />
Abzweig von der Strecke Stuttgart - Aalen), die 17 km lange Schönbuchbahn von Böblingen nach<br />
Dettenhausen (DB-Kursbuchstrecke 790.9, Abzweig von der Strecke Stuttgart - Konstanz) wurde<br />
1996 nach 30jähriger Stilllegung für den Personenverkehr reaktiviert.<br />
Angesichts dieser Zahlen fragt sich Aschpalt:<br />
„Warum haben wir uns alle so geirrt?“ [ebd.]<br />
Und genau das ist die interessante Frage: Warum haben wir uns hier, wie bei den Prognosen zu<br />
den Hochgeschwindigkeitsstrecken so geirrt, aber mit anderem Vorzeichen?<br />
Fahrgastprognose und Realität beim „Wiesele“ und der Schönbuchbahn<br />
„Wiesele“<br />
Schönbuchbahn<br />
Prognose 1994 2.200 / Tag ähnlich wie „Wiesele“<br />
Fahrgastzahlen 1998 bis zu 4.500 / Tag ähnlich wie „Wiesele“<br />
ursprüngliche Prognose 500.000 / Jahr ähnlich wie „Wiesele“<br />
Fahrgastzahlen 1998 892.000 / Jahr 1.000.000 / Jahr<br />
„Wiesele“ : Schorndorf - Rudersberg (11 km), DB-Kursbuchstrecke 787<br />
„Schönbuchbahn“: Böblingen - Dettenhausen (17 km), DB-Kursbuchstrecke 790.9<br />
Tab. 4-3: Fahrgastprognose und Realität beim „Wiesele“ und der Schönbuchbahn<br />
(Quelle: Frankfurter Rundschau, 19.12.1998)<br />
4.3 Zwischenfazit<br />
Zusätzliche Kapazitäten auf der Schiene sind für die Zukunft notwendig. Auch wenn entgegen<br />
den Prognosen die Gesamtverkehrsleistung sinken sollte, wird durch die Forderung „Güter auf die<br />
Schiene“ zusätzliche Kapazität auf der Schiene notwendig sein.<br />
Für eine Ausbauplanung der Schieneninfrastruktur sind Prognosen allerdings ungeeignet bzw.<br />
nur bedingt geeignet , da sie in den seltensten Fällen zutreffen. Hier muss eine andere<br />
Vorgehensweise gewählt werden (siehe dazu Kapitel 8).<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 23
5 Die Wirkung von Schnellfahrstrecken - Ein Vergleich<br />
5 Die Wirkung von Schnellfahrstrecken - Ein Vergleich<br />
5.1 Schnellfahrstrecken allgemein<br />
Neubaustrecken sind nicht grundsätzlich abzulehnen und können zu einer Erhöhung des<br />
Verkehrsanteils, des so genannten Modal-Split-Anteils, der Eisenbahn führen. Durch die<br />
Neubaustrecke (NBS) Hannover - Fulda - Würzburg erhöhte sich der Anteil der Schiene im<br />
Personenverkehr in der Relation Hamburg - Frankfurt (M) von 28 auf 39 %, während der des<br />
Flugzeugs von 34 auf 27 % und des Autoverkehrs von 38 auf 34 % zurückging [Breimeier, 1999,<br />
S. 87]. Dieses ist sicher zum einen darauf zurückzuführen, dass die Fahrzeit um etwa eine<br />
Stunde auf etwa 3,5 Stunden gesenkt werden konnte, wodurch sich die Aufenthaltszeit bei einer<br />
Tagesfahrt um etwa zwei Stunden verlängert. Allerdings fällt auf, dass der Anteil des<br />
Autoverkehrs mit 4 Prozentpunkten nur relativ gering zurückging. Dieser ist für die Y-<br />
<strong>Trasse</strong>nplanung primär von Bedeutung. Denn der Flugverkehr bedient die kurzen Relationen im<br />
norddeutschen Bereich nicht. Eine mögliche Ursache könnte sein, dass der Grundpreis (ohne<br />
Ermäßigungen und Sonderpreise), der pro Kilometer zu zahlen ist, von 1990 (umgerechnet auf<br />
die Strecke Hamburg - Frankfurt (M) im IC) von 0,113 EUR über 0,145 EUR im Jahre 1999 bis<br />
0,183 EUR im ICE im Jahr 2002 oder um durchschnittlich 5,16 % pro Jahr gestiegen ist und damit<br />
die Verkehrsmittelwahl nennenswert beeinflusst hat. Daher sollte die Reisezeit nicht das alleinige<br />
Kriterium sein (siehe auch Abb. 3-1 und die Formel von Vrtic im Kap- 6.1).<br />
Auch die anderen bisher realisierten Schnellfahrstrecken (SFS) verkürzten die Reisezeit<br />
prozentual und absolut sehr deutlich (siehe Tab. 5-1).<br />
Fahrzeitgewinne durch Neu- und Ausbaustrecken<br />
(schnellste gefundene Verbindung)<br />
Hannover Hbf - Fulda<br />
Hannover Hbf - Würzburg Hbf<br />
auf „alter“ Strecke<br />
2:20 Std. (245 km)<br />
3:33 Std. (358 km)<br />
auf Neu- / Ausbaustrecke<br />
1:22 Std. (-0:58 Std. / - 41%) (233 km)<br />
1:54 Std. (-1:39 Std. / - 46%) (325 km)<br />
Hannover Hbf - Berlin Zoolg. Garten 2:44 Std. (284 km) 1:31 Std. (-1:09 Std. / - 42%) (254 km)<br />
Köln Hbf - Frankfurt(M) Hbf 2:14 Std. (222 km) 1:12 Std. 1) (-1:12 Std. / - 50%) (177 km)<br />
Mannheim Hbf - Stuttgart Hbf 1:24 Std. (129 km) 0:36 Std. (-0:48 Std. / - 57%) (107 km)<br />
Bremen Hbf - Hannover Hbf<br />
0:55 Std. 2) (122 km) 0:50 Std.? (ca. -0:05 Std. / - 10%) (? km)<br />
Hamburg Hbf - Hannover Hbf<br />
1:10 Std. 2) (178 km) 0:56 Std.? (ca.- 0:14 Std. / - 20%) (? km)<br />
(Y-<strong>Trasse</strong>, geplant)<br />
1) Anmerkung des Verfassers: Bei Fahrt ohne Halt von Köln Hbf bis Frankfurt (Main) Hbf wäre eine fahrplanmäßige Fahrzeit von 59 -<br />
61 Minuten erreichbar. Das „Verfehlen“ der ursprünglichen Prognose von 60 Minuten ist also alleine durch die Zwischenhalte<br />
begründet und keine „Falschaussage“ der Planer / DB.<br />
2) Fahrzeit z. Zt. streckentechnisch möglich, aktuell 1:00 Std. bzw. 1:15 Std., Fahrplan 2002.<br />
Tab. 5-1: Fahrzeitgewinne durch Neu- und Ausbaustrecken (direkt)<br />
(Quelle: verschiedene DB-Kursbücher und „Ihr Fahrplan/Reiseplan“)<br />
Unabhängig von sonstigen Kriterien fällt auf, dass die geplante Y-<strong>Trasse</strong> im Vergleich zu den<br />
anderen Schnellfahrstrecken nur unwesentliche Fahrzeitgewinne ermöglicht. Dabei ist ein<br />
möglicher Ausbau der Altstrecke (z.B. Erhöhung der Durchfahrtgeschwindigkeit in den Bahnhöfen<br />
Celle, Uelzen, Lüneburg, Hamburg-Harburg) nicht berücksichtigt. Diese relativieren sich zudem<br />
auf längeren Reisen wie Hamburg - Frankfurt(M). Nach [Breimeier, 1999, S. 87] „hat die<br />
Eisenbahn nur noch eine Daseinsberechtigung, wenn sie sich hinsichtlich der Schnelligkeit<br />
und/oder der Preiswürdigkeit den Konkurrenzverkehrsmitteln als überlegen erweist.“<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 24
5 Die Wirkung von Schnellfahrstrecken - Ein Vergleich<br />
Das Kriterium „Schnelligkeit“ entfällt praktisch bei der Y-<strong>Trasse</strong>. Sie muss daher ihre<br />
Berechtigung zwingend durch eine überproportionale Wirtschaftlichkeit nachweisen, so dass der<br />
Netzbetreiber z. B. sehr günstige <strong>Trasse</strong>ngebühren anbieten kann, die tendenziell zu<br />
preiswerteren Fahrausweisen führen. Auch bedeutet „Schnelligkeit“ nicht „Hochgeschwindigkeit“.<br />
Die „Schnelligkeit“ kann (und muss) vor allem durch eine netzweite Reduzierung von<br />
„Verlustzeiten“ wie z. B. Umsteige- und Wartezeiten erhöht werden (Stichwort innovatives<br />
Betriebskonzept) (siehe Tab. 5-2).<br />
Warum aber fällt der Zeitgewinn bei der Y-<strong>Trasse</strong> „relativ“ gering aus? Dieses liegt darin<br />
begründet, dass fast alle Strecken im (norddeutschen) Flachland bereits damals gerade und<br />
„schnell“ trassiert wurden, während in den Mittelgebirgen sehr kurvenreich und „auf Umwegen“<br />
gebaut werden musste. Die Schnellfahrstrecke Hannover - Berlin weicht davon nicht ab, denn sie<br />
ist „nur“ ein Ausbau einer vorhandenen schnurgeraden Eisenbahnstrecke gewesen, kein<br />
eigentlicher Neubau.<br />
Die in Tab. 5-1 aufgeführten Reisezeitgewinne beziehen sich direkt auf die Neubaustrecke selbst.<br />
Anders sieht es aus, wenn eine Netzbetrachtung durchgeführt wird. Bezogen auf das Kriterium<br />
„Geschwindigkeit“ / Reisezeit zeigt es sich, dass die „direkten“ Fahrzeitgewinne der<br />
Schnellfahrstrecken an anderer Stelle sogar zu Fahrzeitverlusten führen können (siehe Tab. 5-2).<br />
Eine Neubaustrecke führt also nicht automatisch in allen Relationen zu Fahrzeitgewinnen. Dieses<br />
ist vom Betriebskonzept abhängig. Analog dem „Flottenverbrauch“ in der Automobilindustrie<br />
müsste eine „Netzgeschwindigkeit“ des jeweiligen Fahrplans erstellt werden. Diese<br />
Netzgeschwindigkeit ist wesentlich aussagefähiger als einzelne Verbindungsbeispiele, da in ihr<br />
sich auch das Betriebskonzept bzw. der Fahrplan auswirkt, welcher für die Kunden letztendlich<br />
von Bedeutung ist.<br />
Fahrzeitenvergleich netzbezogen<br />
Bremen - Göttingen 1977 1 Std. 55 Min. TEE „Roland“ Vmax.: 160 km/h<br />
Bremen - Göttingen 2002 1 Std. 50 Min ICE (Takt) Vmax.: 250 km/h<br />
Braunschweig - Köln 1981 3 Std. 37 Min. IC „Heinrich der Löwe“ Vmax.: 200 km/h<br />
Braunschweig - Köln 2002 3 Std. 58 Min. IC (Takt) Vmax.: 200 km/h<br />
Braunschweig - Bielefeld<br />
Bielefeld - Köln<br />
2002 (umsteigen!)<br />
3 Std. 47 Min.<br />
IC (Takt)<br />
ICE (Takt)<br />
Vmax.: 200 km/h<br />
Vmax.: 200 km/h<br />
Braunschweig - Frankfurt(M) 1991 2 Std. 50 Min. IC (Takt) Vmax.: 200 km/h<br />
Braunschweig - Frankfurt(M) 2002 2 Std. 44 Min ICE (Takt) Vmax.: 250 km/h<br />
Lübeck - Lüneburg - Hannover 1996 2 Std. 09 Min. RE + IR direkter Anschluß RE - IR<br />
Lübeck - Hamburg - Hannover 1996 2 Std. 03 Min. IR + ICE<br />
Lübeck - Lüneburg - Hannover 2003 2 Std. 44 Min. RB + IC kein Anschluß RB - IC<br />
Lübeck - Hamburg - Hannover 2003 2 Std. 15 Min. RE + ICE Wegfall IC(IR)<br />
Tab. 5-2: Fahrzeitenvergleich netzbezogen<br />
Die ICE-Züge aus Bremen müssen in Hannover auf den ICE der „Hauptlinie“ 12 Minuten warten.<br />
Wäre die Reisezeit wirklich das entscheidende Modal-Split-Kriterium für die Schiene, so müsste<br />
der Bremer-ICE eigentlich bis Würzburg dem Hamburger-Zugteil vorausfahren, so dass zum<br />
einen die Relation Bremen - Göttingen - Würzburg sehr attraktiv wird und zum anderen auf der<br />
Strecke Hannover - Würzburg ein kundenfreundlicherer 15 / 45 Minuten-Takt besteht, der in<br />
Umsteigerelationen (z.B. Peine - Hannover - Kassel) die Reisezeit erheblich verkürzen kann. Für<br />
die Relation Bremen - Nürnberg / München würde sich keine Änderung ergeben. Für die freien<br />
Fahrplantrassen auf der Schnellfahrstrecke sind allerdings nicht unerhebliche <strong>Trasse</strong>ngebühren<br />
zu zahlen. Diese scheinen sich für DB Reise&Touristik nicht zu rechnen. Die netzbezogenen<br />
Fahrzeitenbeispiele lassen sich fast beliebig fortführen (Braunschweig - Kiel: Standardverbindung<br />
knappe vier Stunden (Entfernung etwa 300 km), Hannover - Schwerin, usw.) und zeigen,<br />
dass in vielen anderen Verbindungen „Nachholbedarf“ vorhanden ist.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 25
5 Die Wirkung von Schnellfahrstrecken - Ein Vergleich<br />
Auch verdeutlicht die Tab. 5-2 in der Relation Braunschweig - Frankfurt (Main) den<br />
„abnehmenden Grenznutzen“ der Geschwindigkeit. Die Höchstgeschwindigkeit des ICE auf der<br />
Strecke Braunschweig - Frankfurt (Main) wurde im Vergleich zum IC weitgehend um 25 % erhöht,<br />
die Reisezeit sank dagegen nur um 3,53%.<br />
Dieser abnehmende Grenznutzen der Geschwindigkeit soll in der folgenden Abb. 5-1 einmal<br />
genauer dargestellt werden, da auch bei der Y-<strong>Trasse</strong>n-Planung eine eher einseitige Fixierung<br />
auf das Kriterium „Höchstgeschwindigkeit“ besteht. Sie zeigt, dass Geschwindigkeitserhöhungen<br />
im unteren Bereich wesentlich effektiver als im oberen Bereich sind (z. B. Beseitigung von<br />
Langsamfahrstellen). Unabhängig von der Diskussion, ob Höchstgeschwindigkeiten z. B. über<br />
200 km/h sinnvoll sind, ist festzuhalten: Je höher die gefahrene Höchstgeschwindigkeit, desto<br />
länger muss sie als Beharrungsgeschwindigkeit gefahren werden und desto zuverlässiger<br />
muss das Gesamtsystem sein.<br />
Abnehmender Grenznutzen der Geschwindigkeit<br />
Für eine Strecke s = 100 km gilt:<br />
Formel: t = (60 * s) / v<br />
mit s in [km], V in [km/h] ergibt t in [Min.]<br />
Zeit t [Min.]<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
150<br />
100<br />
75<br />
+ 20 km/h von 60 auf 80 km/h:<br />
Zeitgewinn: 25 Minuten!<br />
60<br />
50<br />
42,8<br />
37,5<br />
33,3<br />
30<br />
27,3<br />
25<br />
+ 20 km/h von 280 auf 300 km/h:<br />
Zeitgewinn: 1,4 Minuten!<br />
0 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360<br />
Geschwindigkeit v [km/h]<br />
23,1<br />
21,4<br />
20<br />
18,8<br />
17,6<br />
16,7<br />
Abb. 5-1: Abnehmender Grenznutzen der Geschwindigkeit<br />
Auch wenn die auf den bisherigen deutschen Neubau- und Ausbaustrecken erzielten<br />
Reisezeitgewinne erheblich sind, zeigt ein internationaler Vergleich, dass der ICE bzw. das<br />
deutsche Hochgeschwindigkeitsnetz trotz einer Höchstgeschwindigkeit von 250 - 300 km/h das<br />
„langsamste Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt“ ist (siehe Tab. 5-3).<br />
Selbst die Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h auf der SFS Köln - Frankfurt(M)-Flughafen<br />
Fernbahnhof führt nur zu einer Reisegeschwindigkeit von 181,1 km/h. Auf die Gründe soll hier<br />
nicht eingegangen werden, einige werden in Kapitel 2.5 erwähnt, weitere werden von [Andersen,<br />
2002] diskutiert. Eine Reisegeschwindigkeit von 181 km/h ist zwar sehr gut, ungünstig ist die<br />
große Differenz zwischen der Höchst- und der Reisegeschwindigkeit.<br />
Die Y-<strong>Trasse</strong> soll für eine Streckenhöchstgeschwindigkeit von 300 km/h ausgelegt werden. Damit<br />
von einer „echten“ Hochgeschwindigkeitsstrecke gesprochen werden kann, sollte sich auch die<br />
Reisezeit entsprechend verkürzen. Um einmal die Größenordnung zu verdeutlichen, was eine<br />
Hochgeschwindigkeitsstrecke bringen muss, ist in Tab. 5-3 eine Beispielrechnung mit aufgeführt.<br />
Diese zeigt, dass die Fahrzeit Hannover - Hamburg bei etwa 41 Minuten liegen müsste, eine<br />
heute angepeilte Fahrzeit von etwa 60 Minuten zwar eine Verbesserung darstellt, aber keine neue<br />
Hochgeschwindigkeitsstrecke rechtfertigt. Dieses würde bedeuten, dass beim Festhalten an der<br />
Y-<strong>Trasse</strong> auch der Abschnitt Scheeßel - Hamburg Hbf für 300 km/h ausgebaut werden muss, die<br />
300 km/h also als Beharrungsgeschwindigkeit über die gesamte Strecke gefahren werden kann.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 26
5 Die Wirkung von Schnellfahrstrecken - Ein Vergleich<br />
Die schnellsten Züge der Welt ohne Zwischenhalt im Fahrplan 2001/02<br />
Land Zug von nach Entfernung Fahrzeit Reisegeschwindigkeit<br />
Japan Nozomi Kokura Hiroshima 192,0 km 44 Min. 261,8 km/h<br />
Nozomi Okamaya Shin Osaka 160,9 km 40 Min. 241,3 km/h<br />
Frankreich TGV Massy TGV St-Pierre de Corps 207,3 km 49 Min. 253,8 km/h<br />
TGV Paris Gare de Marseille 750,0 km 180 Min. 250,0 km/h<br />
Lyon<br />
Spanien AVE Madrid Ciudad Real 170,7 km 49 Min. 209,0 km/h<br />
Deutschland ICE Würzburg Fulda 93,2 km 30 Min. 186,4 km/h<br />
Fahrplan 2003 ICE Braunschweig Berlin-Spandau 200 km 64 Min. 187,5 km/h<br />
Fahrplan 2003 ICE Hannover Berlin-Spandau 243 km 80 Min. 182,2 km/h<br />
Fahrplan 2003 ICE Köln Hbf Frankfurt-Flugh. 166 km 55 Min. 181,1 km/h<br />
Rechnung ICE Hannover Hamburg (170 km) 41 Min. 250,0 km/h<br />
ICE Hannover Bremen (120 km) 31 Min. 230,0 km/h<br />
Tab. 5-3: Die schnellsten Züge der Welt<br />
(Quelle: Auszug aus [Andersen, 2002, S. 526], ergänzt um Fahrplan 2003 und Rechnung)<br />
5.2 Die SFS Hannover - Wolfsburg - Stendal - Berlin<br />
5.2.1 Allgemein<br />
Die SFS Hannover - Wolfsburg - Stendal - Berlin bietet die Möglichkeit, einige Argumente für die<br />
Y-<strong>Trasse</strong> an einer in Betrieb befindlichen Strecke zu überprüfen. Dieses sind insbesondere:<br />
• Durch die Reisezeitverkürzung werden mehr Reisende die Eisenbahn nutzen<br />
(Personenverkehrs-Effekte bzw. Wirtschaftlichkeit).<br />
• Die positive Wirkung für das Gesamtnetz.<br />
Diese SFS ist mit der Y-<strong>Trasse</strong>, bezogen auf diese Punkte, sehr gut vergleichbar, denn:<br />
• beide Strecken beginnen im Knoten Hannover und enden in einer Metropolstadt / -region.<br />
• beide Strecken sind Endabschnitte von ICE- / IC-Linien.<br />
• beide Strecken besitzen vergleichbare betriebliche Probleme an ihren Endpunkten.<br />
Betrachtet wird in der Tab. 5-4 dazu nur die Relation (Ruhrgebiet- / Niederlande-) Hannover -<br />
Berlin. Die Relation (Frankfurt (M) -) Braunschweig - Berlin wird nicht betrachtet. Hier gestaltet<br />
sich ein Vorher / Nachher -Vergleich etwas schwieriger, da parallel zur ICE-Verbindung eine<br />
preislich günstigere und zumindest für den Ostteil Berlins zeitlich konkurrierende IR-Linie<br />
Frankfurt (M) - Halle (Saale) - Berlin-Lichtenberg bestand.<br />
Wird der Zuwachs an Reisenden betrachtet, der für die Y-<strong>Trasse</strong> prognostiziert wird (z. B. von<br />
[Breimeier, 2/2001]) und der die Y-<strong>Trasse</strong> zu einem großen Teil wirtschaftlich rechtfertigen soll,<br />
müsste die Sitzplatzkapazität auf der SFS Hannover - Berlin deutlich erkennbar erhöht worden<br />
sein. Denn im Vergleich zur Y-<strong>Trasse</strong>, die nur eine relativ geringe Reisezeitverkürzung von etwa<br />
10 bis 20 % ermöglicht, ist die Reisezeit nach Berlin um über 40 % verkürzt worden (siehe Tab. 5-<br />
1). Wird die Tagesganglinie in Tab. 5-4 betrachtet, so hat sich die Anzahl der Verbindungen<br />
praktisch nicht erhöht, wenn berücksichtigt wird, dass der IC(IR) in Stendal vom ICE überholt wird<br />
und damit zeitgleich liegt. Auch ist die Sitzplatzkapazität tendenziell verringert worden. Das heißt,<br />
die Personenverkehrseffekte sind anhand der tatsächlichen Sitzplatzkapazität nicht nachweisbar.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 27
5 Die Wirkung von Schnellfahrstrecken - Ein Vergleich<br />
Dieses möglicherweise auch aus dem Grund, dass es sich um eine ICE- End- / Anfangsstrecke<br />
handelt, bei der Kapazitäten noch vorhanden gewesen sind. Aus Sicht des Netzbetreibers hat hier<br />
nur eine Zugverlegung von der Strecke über Magdeburg auf die SFS <strong>statt</strong>gefunden, während auf<br />
der Strecke über Magdeburg nach Beobachtungen des Verfassers die Güterzüge im Abschnitt<br />
Braunschweig - Lehrte weiterhin relativ oft auf dem Überholungsgleis warten müssen.<br />
Züge und Fahrzeit vor und nach Inbetriebnahme Schnellfahrstrecke Hannover - Berlin<br />
durchgehende Züge (ICE, IC, IR, D, NZ), Verkehrstage mindestens Montag – Donnerstag<br />
Tagesganglinie der Zugverbindungen von Hannover nach Berlin 1996 / 2003<br />
3<br />
2<br />
1<br />
Anzahl<br />
Verbindungen<br />
ICE<br />
IC<br />
2003: ICE, IC(IR) Überholung durch ICE, ohne "langsame" Verbindung über Braunschweig<br />
1996: (ICE), IC, IR, D: keine Überholung<br />
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23<br />
Stunde<br />
Sitzplatzkapazität (2. + 1. Klasse)<br />
IC (Lok mit bis zu 13 Wagen + Restaurant), 2 ICE2<br />
1996 2003<br />
IC<br />
688 + 200 = 888<br />
2 ICE2<br />
526 + 210 = 736<br />
Fahrzeit<br />
Hannover - Berlin Zoologischer Garten 2:44 Std. 1:31 Std. (-1:13 Std.)<br />
letzte Zugabfahrt SPFV Berlin Zoo Mo-Fr/Sa/So<br />
nach Hannover<br />
nach Braunschweig<br />
23:55/23:55/23:55<br />
23:55/23:55/23:55<br />
2002<br />
21:10/20:06/22:11<br />
19:34/18:24/20:23<br />
2003<br />
21:54/20:56/21:54<br />
21:54/18:41/21:54<br />
Tab. 5-4: Zugzahl- und Fahrzeitvergleich Hannover - BS / WOB - Berlin 1996/2003<br />
(Quelle: DB-Kursbuch 1996, 2001/2002 und 2003)<br />
Eine mögliche Ursache für die wenig gestiegene Zuganzahl bzw. die fehlenden Kapazitäten<br />
(Fahrplantrassen) für den Güterverkehr ist der „Doppelknoten“ Hannover - Lehrte, über den<br />
weiterhin der gesamte Verkehr geführt werden muss.<br />
Durch die SFS ist zwar die Qualität der Verbindungen wesentlich gesteigert worden, die letzte<br />
Zugabfahrt von Berlin nach Hannover und Braunschweig zeigt aber, dass das Betriebskonzept in<br />
bestimmten Bereichen unabhängig von der Strecke ist.<br />
5.2.2 Landeshauptstädte Magdeburg und Potsdam - Vom Fernverkehr abgekoppelt?<br />
Die SFS Hannover - Berlin hat für die im Mittelpunkt stehenden Relationen (Ruhrgebiet /<br />
Frankfurt (Main) / Niederlande-) Berlin eine deutliche Verbesserung der Verbindungsqualität<br />
gebracht. Eine Netzbetrachtung bzw. Netzwirkung darf die Orte an der bestehenden Strecke nicht<br />
vernachlässigen. Für die SFS Hannover - Berlin ist das insbesondere der Raum der<br />
Landeshauptstadt Magdeburg, für die Y-<strong>Trasse</strong> sind das die Orte Lüneburg, Uelzen und Celle<br />
bzw. Nienburg (Weser) und Verden (Aller).<br />
Für Magdeburg sind in der Tab. 5-5 einige Daten zur Relation Berlin - Magdeburg - Hannover /<br />
Frankfurt (M) aufgeführt.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 28
5 Die Wirkung von Schnellfahrstrecken - Ein Vergleich<br />
Züge und Fahrzeit vor und nach Inbetriebnahme Schnellfahrstrecke Hannover - Berlin<br />
durchgehende Züge (ICE, IC, IR, D), Verkehrstage mindestens Montag - Donnerstag<br />
1996 2003<br />
Strecke (Richtung)<br />
Hannover - Braunschweig - Magdeburg 28 17<br />
Dortmund - Hannover - Magdeburg<br />
Frankfurt(M)- Braunschweig - Magdeburg (-Berlin)<br />
19<br />
9<br />
8<br />
0<br />
Magdeburg - Potsdam - Berlin<br />
Fahrzeit Magdeburg Hbf - Berlin Zoolg. Garten<br />
letzte Zugabfahrten SPFV Magdeburg<br />
nach Braunschweig - Hannover<br />
27<br />
78 Min.<br />
tägl.<br />
22:25, 0:45 und 1:18<br />
Tab. 5-5: Zugzahl- und Fahrzeitvergleich Magdeburg - Berlin 1996/2003<br />
(Quelle: DB-Kursbuch 1996 und 2003)<br />
3<br />
91 / 94 Min. ICE / RE<br />
Mo-Fr / Sa / So<br />
21:00 / 20:01 / 22:01<br />
Ein Kommentar erübrigt sich bei diesen Zahlen. Bezogen auf die Y-<strong>Trasse</strong> muss allerdings<br />
gefragt werden: Was droht Lüneburg, Uelzen, Celle, Nienburg (Weser) und Verden (Aller) nach<br />
Eröffnung der Y-<strong>Trasse</strong>? Wie sieht das Betriebskonzept für das Fernverkehrsnetz mit Y-<strong>Trasse</strong><br />
aus? Könnte ein anderes Eisenbahnverkehrsunternehmen Fernverkehr anbieten, wenn sich die<br />
IC(IR) - Züge aus Sicht von DB Reise&Touristik nicht mehr rentieren, oder sind in den Knoten<br />
Hannover und Hamburg keine Kapazitäten mehr vorhanden? Ist die Eisenbahn dann eine<br />
Alternative zum Auto?<br />
Vergleichbar ist auch die Landeshauptstadt Potsdam weitgehend vom Fernverkehr abgehängt<br />
worden. Auch die zweitgrößte Stadt in Niedersachsen, Braunschweig mit etwa 240.000<br />
Einwohnern, hat komplett die stündliche durchgehende und schnelle Verbindung durch die SFS<br />
ins Ruhrgebiet, nach Düsseldorf und Köln verloren.<br />
5.3 Zwischenfazit<br />
Die Y-<strong>Trasse</strong> verkürzt die Reisezeit zwischen Hannover und Hamburg bzw. Bremen im Vergleich<br />
zu den anderen deutschen Schnellfahrstrecken nur sehr gering. Die Beurteilung der (Aus-)<br />
Wirkung von Schnellfahrstrecken darf allerdings nicht allein auf die Reisezeitverkürzung zwischen<br />
den beiden Endpunkten der Strecke reduziert werden.<br />
Den direkten positiven Effekten auf der Schnellfahrstrecke stehen im Regelfall größere negative<br />
Auswirkungen „in der Fläche“ entgegen. So sind durch die SFS Hannover - Berlin die<br />
Landeshauptstädte Magdeburg und Potsdam, aber auch die zweitgrößte Stadt in Niedersachsen,<br />
Braunschweig, weitgehend vom Fernverkehr abgekoppelt worden bzw. haben deutliche<br />
Verschlechterungen hinnehmen müssen. Daher ist zu fragen, wie die Städte Lüneburg, Uelzen,<br />
Celle, Verden (Aller) und Nienburg (Weser) nach Realisierung der Y-<strong>Trasse</strong> an das<br />
Fernverkehrsnetz eingebunden werden (können).<br />
Auch zeigt die SFS Hannover - Berlin, bei der die Reisezeit um etwa 40 Prozent verkürzt wurde,<br />
dass eine Steigerung der Reisenden sich in engen Grenzen hält bzw. anhand der Zugzahlen nicht<br />
nachweisbar ist. Die Y-<strong>Trasse</strong> soll die Fahrzeit dagegen nur um etwa 20 Prozent verkürzen, so<br />
dass hier nur von unwesentlichen Reisendenzuwächsen ausgegangen werden kann.<br />
Eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, die von den Reisegeschwindigkeiten „internationalem<br />
Standard“ entspricht, müsste die Fahrzeit von Hannover nach Hamburg auf etwa 41 Minuten<br />
verkürzen. Dann müsste die Y-<strong>Trasse</strong> allerdings bis zum Hamburger Hbf durchgebaut werden.<br />
Dieses ist auf Grund der Kosten nicht realisierbar.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 29
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Die Kapazitäten in der Nord-Süd-Relation (Hamburg - Hannover) müssen aus Sicht fast aller<br />
Beteiligter erhöht werden. Während die bis Februar 2003 amtierende niedersächsische<br />
Landesregierung, die Deutsche Bahn AG und [Breimeier, 2/2001] die Leistungssteigerung durch<br />
den Neubau einer neuen Schnellfahrstrecke beheben wollen (Y-<strong>Trasse</strong>), vertritt [Andersen, 2000]<br />
die Meinung, der langsame Güterverkehr muss eine eigene Vorrangstrecke erhalten, die durch<br />
den Ausbau vorhandener Strecken möglich ist.<br />
Zur schnellen Linderung des größten Engpasses - die Strecke Lüneburg - Stelle (-Maschen /<br />
Hamburg) - wird dieser dreigleisig ausgebaut. Da dieser Ausbau ab etwa 2007 auch real zur<br />
Verfügung steht, wird er beim Vergleich der Varianten als vorhanden angenommen.<br />
In diesem Kapitel wird anhand von veröffentlichten Diskussionen, Studien, Positionen und<br />
Gutachten die Y-<strong>Trasse</strong> diskutiert. Gleichzeitig wird so ein Überblick über Meinungen gegeben.<br />
Zu berücksichtigen ist dabei immer, dass es die optimale bzw. die wünschenswerteste Lösung<br />
nicht geben wird, da spätestens die Finanzierung Grenzen setzt. Kurze Spitzenzeiten der<br />
Belastung bzw. Nachfrage wie Freitags im Personenverkehr von etwa 17:00 bis 20:00 Uhr werden<br />
nicht berücksichtigt, da diese wenig zum Gesamtertrag einer so genannten Hauptabfuhrstrecke<br />
beitragen (bei „Nebenstrecken“ liegt eine andere Situation vor, da diese Spitzenbelastung<br />
prozentual zur Gesamtbelastung relativ hoch ausfallen kann).<br />
6.1 Lösungsvarianten (betriebliche und wirtschaftliche Betrachtung)<br />
Eine aktuelle betriebliche Diskussion zur Lösung der Kapazitätsprobleme im norddeutschen<br />
Raum fand in der Zeitschrift „Eisenbahn-Revue-International“ <strong>statt</strong>. In der Ausgabe 11/2000<br />
diskutiert ANDERSEN „Betriebliche Betrachtungen zu einem Netzausbau im norddeutschen<br />
Raum“ ([Andersen, 2000]) auf die BREIMEIER in der Ausgabe 2/2001 eine Entgegnung mit dem<br />
Titel „Eine Neubaustrecke oder eine Ausbaustrecke in Norddeutschland“ ([Breimeier, 2/2001])<br />
schreibt, die sich u. a. intensiv mit der Relation Hamburg - Hannover - (Süddeutschland) auseinandersetzt.<br />
(Hinweis: siehe dazu auch die Artikel im Anhang)<br />
ANDERSEN kommt bezüglich der Relation Hamburg - Hannover - Süddeutschland zu folgendem<br />
Ergebnis:<br />
• Die Verlegung der ICE-Linien durch die Y-<strong>Trasse</strong> auf die Strecke Bremen - Hamburg führt dort<br />
zu <strong>Trasse</strong>nkonflikten, die nur für eine Richtung gelöst werden können. Zusatzzüge in der<br />
Hauptverkehrszeit zwischen Tostedt und Hamburg sind betrieblich nicht mehr durchführbar<br />
und müssen ersatzlos gestrichen werden.<br />
• Die Fahrzeitverkürzung der Relation Hamburg - Frankfurt (Main) muss vor allem südlich von<br />
Hannover erreicht werden, so dass wesentlich mehr Reisende davon profitieren.<br />
• Die höhengleiche Einmündung der Güterzüge in Buchholz (Nordheide) stellt einen<br />
betriebssystematischen Nachteil dar.<br />
• Der Engpass Knoten Hamburg müsste zumindest teilweise mit ausgebaut werden.<br />
• Eine eigenständige Strecke mit Vorrang für den langsamen Verkehr im Raum Maschen - Celle<br />
besitzt hohe Priorität.<br />
Auf die Entgegnung von BREIMEIER soll im Folgenden ausführlicher eingegangen werden, da in<br />
ihr konkrete - wenn auch grobe - Zahlen zur Erlös- und Kostenseite verschiedener Alternativen<br />
genannt werden.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 30
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Tab. 6-1 gibt einen Gesamtüberblick der möglichen Varianten. Alle Varianten, die in der<br />
Entgegnung erwähnt werden, sind hier aufgeführt, ergänzt um eine weitere noch zu<br />
diskutierende.<br />
Varianten der Kapazitätserhöhung auf der Relation Hamburg - Hannover (-Süddeutschland)<br />
Variante Bezeichnung Beschreibung<br />
1) Ausbau mehrgleisiger Ausbau vorhandener Strecken<br />
2) „Güterbahn“<br />
(„Güterbahn1“)<br />
Ausbau der eingleisigen Strecken Buchholz(Nordh) - Soltau (Eigentümer DB Netz)<br />
und Soltau - Celle (Eigentümer Osthannoversche Eisenbahnen, OHE) zu einer<br />
zweigleisigen „Güterbahn“, teilweise Neubau (Länge 97 km)<br />
3) „Direttissima“ Neubau einer Schnellfahrstrecke Ashausen (nördl. Winsen/Luhe) - Celle, vor allem zur<br />
Aufnahme des SPFV, freie Trassierung zwischen Ashausen bis Unterlüß, von dort bis<br />
Celle westliche Parallelführung zur bestehenden Strecke<br />
4) „Autobahn“ Neubau einer Schnellfahrstrecke Ashausen - Langenhagen, weitgehend parallel zur<br />
Autobahn Hamburg – Hannover<br />
5) „Y-<strong>Trasse</strong>“ Neubau einer Schnellfahrstrecke Scheeßel - Langenhagen zur Aufnahme vor allem<br />
der Züge des SPFV in der Relation Hamburg/Bremen – Hannover<br />
6) „Güterbahn 2“ 1.) Elektrifizierung der eingleisigen Strecke Buchholz(Nordheide) - Soltau - Celle als<br />
Vorrangstrecke für Güterverkehr Richtung Nord - Süd<br />
2.) Drittes „Einrichtungs-“Gleis von Celle - Lüneburg (Brutto-Länge 87 km) als<br />
Vorrangstrecke für Güter- und Regionalverkehr Richtung Süd - Nord<br />
-> Prinzip: Zweigleisigkeit, mit räumlich getrennter Lage<br />
Tab. 6-1: Lösungsvarianten für Relation Hamburg - Hannover (-Süddeutschland)<br />
(nach [Breimeier, 2/2001, S. 91], erweitert um Variante 6)<br />
Die Variante 1 (Ausbau) ist einschließlich einer Untervariante nach [Breimeier, 2/2001, S 91]<br />
bereits zu Beginn der Überlegungen zum BVWP ‘92 wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit<br />
ausgeschieden.<br />
(Anmerkung: Wie diese Variante im einzelnen aussah ist nicht erwähnt. Wahrscheinlich handelte es sich<br />
vom Prinzip um einen viergleisigen Ausbau Stelle - Celle und den Ausbau der Strecke Rotenburg (Wümme)<br />
- Verden (Aller) - Nienburg (Weser) - Minden (Westf).)<br />
Auch die Variante 4 (Autobahn) war nach BREIMEIER wirtschaftlich nicht überzeugend, da sie im<br />
Vergleich zur Variante 3 (Direttissima) eine um 28 % größere Neubaulänge mit entsprechenden<br />
Investitionen, aber nur wenig mehr Fahrzeitgewinn (ca. 18 zu 14 Min.) aufweist (siehe Tab 6-2).<br />
Auf die übrigen Varianten 2, 3 und 5 geht BREIMEIER dann näher ein. Er kommt zu dem<br />
Ergebnis, dass von diesen drei Varianten die Y-<strong>Trasse</strong> die Beste ist. Auf seine Argumentation soll<br />
im Folgenden zuerst eingegangen werden. Die von ihm angegebenen Streckenbelastungen als<br />
Summe beider Richtungen werden dabei in Belastung pro Streckenrichtung umgerechnet, die<br />
DM-Beträge werden in Euro umgerechnet.<br />
Die Merkmale dieser drei Varianten sind in der folgenden Tabelle 6-2 zusammengefasst.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 31
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Merkmale von drei Varianten zum Ausbau Hamburg / Bremen - Hannover<br />
(nach [Breimeier, 2/2001, S.91])<br />
Strecke Länge Streckengeschwindigkeit<br />
Investition Fahrzeitverminderung 3)<br />
A) „Güterbahn“ 97 km 120 km/h 844 Mio. EUR 1) 5 min / -<br />
B) „Direttissima“ 92 km 300 km/h 1176 Mio. EUR 18 min / -<br />
C) Y-<strong>Trasse</strong> 84 km 300 km/h 1125 Mio EUR 2) 14 min / 9 min<br />
Hamburg / Bremen - Hannover<br />
1) Die Summe schliesst 51 Mio. EUR für die Anhebung der Streckengeschwindigkeit in den Bahnhofsdurchfahrten Lüneburg, Uelzen<br />
und Celle ein, Fahrzeitverminderung 5 Minuten [Andersen, 2000]<br />
2) Die Summe schliesst 51 Mio. EUR für eine Verbindungskurve in Richtung Bremen ein, entweder bei Visselhövede (westlich Soltau)<br />
oder bei Rotenburg (Wümme)<br />
3) Anmerkung: Es wird - auch im Text - keine neue Fahrzeit angegeben, so dass nicht ersichtlich ist, auf welche Fahrzeit sich die<br />
Verminderung bezieht: Auf die aktuelle (75 min / 60 min) oder die zur Zeit streckenmögliche (70 min / 55 min)<br />
A) Ausbaustrecke Buchholz - Soltau - Celle vor allem für den Güterverkehr, zweigleisiger Ausbau vorhandener eingleisiger<br />
Nebenbahnen mit Neubauabschnitten<br />
B) Neubaustrecke Ashausen (nördlich Winsen/Luhe) - Unterlüß - Celle vor allem für den Hochgeschwindigkeitsverkehr<br />
C) Neubaustrecke Scheeßel - Langenhagen vor allem für den Hochgeschwindigkeitsverkehr<br />
Tab. 6-2: Merkmale zu Varianten zum Ausbau Hamburg / Bremen - Hannover<br />
(nach [Breimeier, 2/2001, S.91])<br />
Der durchschnittliche Investitionsaufwand für die Neubaustrecken wurde mit 12,78 Mio. EUR je<br />
Streckenkilometer, für die Güterbahn mit 8,18 Mio. EUR angesetzt. Diese Zahlen können hier<br />
nicht näher geprüft werden, allerdings soll auf folgende zwei Punkte hingewiesen werden:<br />
1. Die Länge der „Güterbahn“ wird sich im wesentlichen nicht ändern, da vorhandene Strecken<br />
ausgebaut werden. Mit einer „wesentlichen“ Änderung einer ermittelten Investitionssumme ist<br />
nicht zu rechnen. Die endgültige Lage und Länge der Y-<strong>Trasse</strong> ist noch nicht festgelegt, so<br />
dass sich hier nicht unerhebliche Veränderungen ergeben können. Da Neubauprojekte im<br />
Regelfall sich teurer als geplant erweisen, ist hier eher mit einer Erhöhung der Kosten zu<br />
rechnen.<br />
2. Die Kosten für einen Ausbau oder eine Sanierung von Strecken unterliegen möglicherweise<br />
ebenfalls großen Streuungen. So hätte nach einem Bericht der Allgemeinen Zeitung in Uelzen<br />
vom 20.10.1998 die DB AG für die Sanierung der Strecke (Uelzen-) Wieren - Gifhorn -<br />
Braunschweig umgerechnet ca. 50 Mio. EUR benötigt, die OHE dagegen nur ca. 25 Mio. EUR.<br />
Die Sanierungskosten der Strecken Oldenburg (Oldb) - Osnabrück und Delmenhorst - Hesepe<br />
betrugen 17,74 Mio. EUR (umgerechnet 0,15 Mio. EUR/km) bzw. 35,84 Mio. EUR<br />
(umgerechnet 0,40 Mio. EUR/km). Auf die 85 km lange Strecke Braunschweig - Wieren<br />
angewendet ergäbe dieses einen Wert von 12,75 bzw. 34 Mio. EUR. Nach einer<br />
Ausschreibung und Angebotsabgabe der Firmen zum Ausbau dürften sich die Kosten dagegen<br />
nicht oder nur sehr gering erhöhen.<br />
Nach [LNVG, 2001, S. 7] betrugen die Gesamtkosten für den zweigleisigen Ausbau der Strecke<br />
Weetzen - Egestorf umgerechnet 29,76 Mio. EUR. Die Strecke ist ca. 9 km lang und elektrifiziert,<br />
so dass sich ein Preis von 3,31 Mio. EUR/km eingleisiger elektrifizierter Ausbau ergibt. Die<br />
Variante „Güterbahn“ käme bei diesem Preis auf 372 Mio. EUR (ohne Beseitigung der<br />
Bahnübergänge). Inwieweit die Beseitigung der Bahnübergänge und eventuell andere<br />
Kostenfaktoren (843,63 - 372,00 =) 471,63 Mio. EUR kosten, darf zumindest stark bezweifelt<br />
werden.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 32
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Güterverkehrs-Effekte<br />
„Steigerungsraten des Schienen-Güterverkehrs bis zu 50 % können in der Regel - abgesehen von<br />
wenigen Engpassabschnitten - mit der gegenwärtigen Infrastruktur bewältigt werden. Einer dieser<br />
Engpässe ist der bereits angesprochene Streckenabschnitt Lüneburg - Stelle (bei Harburg),<br />
dessen dreigleisiger Ausbau in absehbarer Zeit vorgesehen ist.“ [Breimeier, 2/2001, S. 92].<br />
Nach der im Kapitel „Verkehrsprognosen und -entwicklung“ getroffenen Aussage, dass der<br />
Schienengüterverkehr um 100 % steigen muss, wenn die Straße wirklich entlastet werden soll,<br />
müssen daher weitere Überlegungen folgen.<br />
Aussage 1 [Breimeier 2/2001, S. 92] „notwendige zusätzliche Güterzugtrassen“<br />
Ausgehend von den aktuellen Güterzugbelastungen (siehe [Andersen, 2000] bzw. Tab. 2-1) geht<br />
BREIMEIER davon aus, das die Kapazität in der Nord - Süd - Relation um 63 zusätzliche<br />
Güterzüge je Richtung und Werktag erhöht werden muss.<br />
Mit Realisierung der Y-<strong>Trasse</strong> und des dritten Gleises zwischen Stelle und Lüneburg werden<br />
während der 16 Tagesstunden mit überwiegendem Personenverkehr 77 zusätzliche<br />
Fahrplantrassen pro Richtung auf der alten Strecke geschaffen (29 für wegfallende ICE, mind. 1<br />
pro Stunde und Richtung während der 16 Tagesstunden wg. günstigerem Mischungsverhältnis<br />
der Geschwindigkeiten und 2 pro Stunde und Richtung durch dreigleisigen Ausbau), so dass<br />
sogar noch Güterzüge, die heute den Umweg über Rotenburg - Verden fahren, auf die direkte<br />
Strecke zurückverlagert werden können. Ebenfalls kann in den Nachtstunden auch die Y-<strong>Trasse</strong><br />
Güterverkehr aufnehmen.<br />
Wertung 1<br />
Dieses ist in sich richtig und insofern nicht zu beanstanden. Es werden allerdings keine Aussagen<br />
zu folgenden Punkten getroffen:<br />
1.) Zur Variante Güterbahn<br />
2.) Zur Tagesganglinie der Nachfrage<br />
Wird der in Tab. 6-3 angenommene Ausbauzustand für die Güterbahn angesetzt, so ergeben sich<br />
während der 16 Tagesstunden ab Buchholz (Nordheide) insgesamt 208 (320) theoretische<br />
Fahrplantrassen (ohne Puffertrassen). Werden für den Personenverkehr 25 plus 25 zusätzliche<br />
Puffertrassen vorgesehen, so verbleiben immer noch 158 (270) theoretische Fahrplantrassen für<br />
den Güterverkehr (<strong>statt</strong> 77 bei der Y-<strong>Trasse</strong>).<br />
Angenommener Ausbauzustand Variante „Güterbahn 1“<br />
Anzahl Gleise<br />
Länge Blockabschnitt<br />
V Güterzug<br />
Länge Güterzug + Durchrutschweg<br />
Sperrzeit Blockabschnitt<br />
[Pachl, 1999, S. 50]<br />
durchgehend zwei, elektrifiziert<br />
4 km (zum Vergleich: Hamburg - Uelzen - Hannover heute ca. 2 km)<br />
95 km/h (100 km/h - Reserve) = 26,389 m/s<br />
700 m (max. zulässig) + 50 m<br />
= Fahrstraßenbildezeit+Signalsichtzeit+Annäherungsfahrzeit+Fahrzeit im<br />
Blockabschnitt + Räumfahrzeit+ Fahrstraßenauflösezeit<br />
= 10 sec + 12 sec + (1000 m + 4000 m +700 m + 50 m) / 26,389 m/s + 6 sec<br />
= 246 sec (bei 2 km Blockabschnittslänge: 170 sec)<br />
Fahrplantrassen (maximal) 14 pro Stunde (21 pro Stunde), abzüglich einer Puffertrasse: 13 (20)<br />
Tab. 6-3: Ausbauzustand Variante „Güterbahn“<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 33
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Unberücksichtigt bleibt dabei, das auf der vom schnellen ICE-Verkehr genutzten Strecke über<br />
Lüneburg auch weiterhin Güterverkehr <strong>statt</strong>finden kann, denn gegenüber heute ist mit<br />
zusätzlichen ICE-Zugfahrten nur „in engen Grenzen“ zu rechnen, wie BREIMEIER feststellt.<br />
Vorsichtig angenommen, dürfte im Schnitt tagsüber pro Stunde und Richtung eine<br />
Güterzugfahrplantrasse frei sein.<br />
Ebenso „stören“ auf der „Güterbahn“ tagsüber keine zwei „minutengenauen“<br />
Personenverkehrslinien. In der Praxis wird der Zulauf zur Güterbahn durch die Strecken bzw.<br />
Relationen Maschen - Buchholz (Nordheide) - Rotenburg (Wümme) - Ruhrgebiet begrenzt. Zur<br />
Zeit bestehen auf dieser Strecke allerdings noch erhebliche Kapazitätsreserven (siehe Tab. 2-3).<br />
Die Güterzüge Maschen - Buchholz (Nordheide) - Soltau (Han) - Süddeutschland würden nicht<br />
die Strecke Hamburg - Buchholz (Nordheide) - Bremen kreuzen (siehe Abb. 2-2 und A-2).<br />
Unberücksichtigt bleibt hierbei auch, inwieweit die Engpässe Hamburg und Hannover / Lehrte<br />
diese zusätzlichen Züge aufnehmen können, wenn zusätzlich eine allgemeine Steigerung der<br />
Schienenverkehrsleistung unterstellt wird.<br />
Ob in den Nachtstunden (23:00 - 5:00 Uhr) zusätzliche Güterzugtrassen auf der Y-<strong>Trasse</strong><br />
überhaupt benötigt werden, darf zumindest bezweifelt werden. Zu dieser Zeit könnten auf der<br />
Altstrecke bis zu 20 (Güter-) Züge pro Richtung gefahren werden (siehe Tab. 6-3). Im Zeitraum<br />
23:00 Uhr bis 5:00 Uhr könnten damit über 100 Güterzüge fahren. Die heutige Tagesbelastung<br />
beträgt ca. 80 Güterzüge (siehe Tab. 2-1), d. h., bereits heute bestehen noch Reserven, die<br />
allerdings nicht genutzt werden (können). Dieses liegt darin begründet, dass zu dieser Zeit der<br />
Bedarf nicht vorhanden ist. Denn für einen „Nachtsprung“ vom Norden zum Süden dürfen je nach<br />
Zielort bestimmte Abfahrtszeiten im Norden nicht überschritten werden.<br />
Interessante Nebenrechnug 1 (Y-<strong>Trasse</strong> ohne drittes Gleis):<br />
Wäre das dritte Gleis zwischen Lüneburg und Stelle nicht vorhanden, so würde die Y-<strong>Trasse</strong> nur ca. (29 +<br />
16*1 =) 45 <strong>statt</strong> 77 zusätzliche Güterzugfahrplantrassen schaffen, d.h. ohne das dritte Gleis würden die<br />
zusätzlichen benötigten bzw. geforderten 63 Fahrplantrassen für Güterzüge nicht erreicht werden. Es ist also<br />
unter diesen Annahmen eine zwingende Voraussetzung, um mit der Y-<strong>Trasse</strong> die erforderlichen Kapazitäten<br />
erreichen zu können!<br />
Interessante Nebenrechnung 2 (Betrachtung des Gesamtsystems):<br />
Zur Zeit können auf dem Abschnitt Celle - Lüneburg - Stelle 3 Güterzüge pro Richtung und Stunde<br />
verkehren (siehe Bildfahrplan [Breimeier, 2/2001, S. 90], z. B. Zählpunkt Winsen) und 2 ICE-Züge,<br />
zusammen 5 verkaufte Fahrplantrassen pro Stunde und Richtung heute (Annahme: Das Angebot an<br />
IC(IR)-, RE- und RB-Zügen bleibt mit Einführung der Y-<strong>Trasse</strong> unverändert, bzw. geht zu Lasten der<br />
Güterzugfahrplantrassen). Auf der Y-<strong>Trasse</strong> ist auch tagsüber im Regelfall nur mit einem Stundentakt jeder<br />
ICE-Linie zu rechnen (vgl. z. B. IC / ICE-Linie Berlin - Hannover - Ruhrgebiet vorher / nachher).<br />
Nach [Breimeier, 2/2001, S. 92] wird mit Realisierung der Y-<strong>Trasse</strong> die Strecke über Uelzen um (58/2=) 29<br />
ICE-Züge pro Tag und Richtung entlastet, bei 16 Tagesstunden entspricht dieses im Schnitt 1,81<br />
Fahrplantrassen pro Stunde und Richtung. Das günstigere Mischungsverhältnis der Züge ergibt eine<br />
weitere Steigerung, die BREIMEIER auf mindestens einen Zug je Stunde und Richtung schätzt. Die<br />
Steigerung der Leistungsfähigkeit des dritten Gleises von zwei Zügen je Stunde und Richtung steht prinzipiell<br />
auch ohne Y-<strong>Trasse</strong> zur Verfügung, auf Grund des ungünstigeren Mischungsverhältnisses schätzungsweise<br />
aber nur um einen Zug je Stunde und Richtung. Damit können auf der Y-<strong>Trasse</strong> und der Altstrecke (2 ICE +<br />
3 Güterzüge heute + zusätzlich 1,81 + mind. 1 + 1=) aufgerundet etwa 9 - 10 Fahrplantrassen pro Stunde<br />
und Richtung verkauft werden. Daraus folgt:<br />
Werden von diesen 9 - 10 zukünftigen Fahrplantrassen die 5 heutigen abgezogen, so werden durch die Y-<br />
<strong>Trasse</strong> real nur 4 - 5 Fahrplantrassen pro Stunde und Richtung zusätzlich geschaffen, obwohl es sich<br />
um eine durchgehend zweigleisig elektrifizierte „Hochleistungsstrecke“ handelt. D. h., DB Netz hat in der<br />
Summe 4 - 5 Fahrplantrassen pro Stunde und Richtung zur Verfügung, um die Kosten der Y-<strong>Trasse</strong> zu<br />
erwirtschaften. Werden diese nicht verkauft (z. B. Annahme tritt nicht ein), verringert sich diese Zahl<br />
nochmals.<br />
(Beim Bremer-Ast ist der wahrscheinlichere Abzweig bei Visselhövede angenommen, der die Strecke<br />
Bremen - Hannover um keinen ICE entlastet. Siehe auch weiter unten.)<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 34
An dieser Stelle sei dazu noch einmal BREIMEIER zitiert:<br />
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
„Kapitalintensive Neubaustrecken erfordern eine hohe Auslastung - [...] - und damit eine hohe<br />
Streckenleistungsfähigkeit, um sie wirtschaftlich betreiben zu können. Die Französischen<br />
Eisenbahnen werden dieser Voraussetzung auf der neuen TGV-Nordstrecke mit einer<br />
Leitungsfähigkeit von 17 Zügen je Stunde und Richtung gerecht. Eine Leistungsfähigkeit der<br />
deutschen Neubaustrecke Köln - Rhein/Main von nur 8 Zügen je Stunde und Richtung erscheint<br />
in diesem Zusammenhang bedenklich [24].“ [Breimeier, 1999, S. 86]:<br />
(Anmerkung des Verfassers [24] = Andersen, S.: Betriebliche und verkehrliche Anforderungen an<br />
spurgeführte Hochgeschwindigkeitssysteme. Eisenbahn-Revue International 11 (1998) S. 466 - 482)<br />
D. h., eine kapitalintensive Neubaustrecke sollte mindestens 8 Züge je Stunde und Richtung<br />
ermöglichen bzw. auch real vorweisen können, so dass die Einnahmen nicht nur theoretisch auf<br />
dem Papier existieren. Dieses bedeutet, dass die bestehende Strecke als auch die Y-<strong>Trasse</strong> in<br />
der Relation Hamburg - Hannover zusammen eine Leistungsfähigkeit von mindestens plus 8<br />
Zügen pro Stunde und Richtung gegenüber heute aufweisen müssten. Nach Tab. 2-2 würde<br />
dieses zum Teil mehr als eine Verdoppelung der heutigen Zugzahlen bedeuten. Es stellt sich die<br />
Frage, ob und - wenn ja - wann dieses erreicht werden kann. Nach Tab. 6-4 und Tab. 6-5 darf<br />
zumindest bezweifelt werden, dass auch nur annähernd eine Verdoppelung der Verkehrsleistung<br />
und damit indirekt der Zugzahlen in überschaubarer Zeit erreicht wird.<br />
(Anmerkung: Dieses ist unabhängig vom Ziel, mehr Verkehr auf die Schiene zu lenken, so dass eine<br />
Verdoppelung der Zugzahlen notwendig wird. Die Frage ist hier, wie und wann das Ziel erreicht wird bzw. die<br />
Kapazitäten benötigt werden.)<br />
Ein anderer Aspekt betrifft die Frage, wann die unterstellten 63 Güterzugfahrplantrassen von DB<br />
Cargo und anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen benötigt werden. Wenn es um die absolute<br />
Tagesanzahl geht, bestehen z. B. auf der Güterbahn Maschen - Buchholz (Nordheide) oder auch<br />
auf der Strecke über Uelzen und damit tendenziell auf den Vor- und Nachlaufstrecken ebenso -<br />
über den Tag verteilt noch erhebliche Kapazitätsreserven (siehe Tab. 2-2 und 2-3). Diese könnten<br />
bereits heute genutzt werden. Wenn diese heute nicht genutzt werden können, weil die Zu- und<br />
Ablaufstrecken überlastet sind, dann sind auch die durch die Y-<strong>Trasse</strong> (und Güterbahn,...)<br />
zusätzlichen Güterzugfahrplantrassen ebenfalls nicht nutzbar. Die Diskussion muss dann zuerst<br />
über den Ausbau der Zu- und Ablaufkapazitäten geführt werden.<br />
Wie bereits erläutert und in Abb. 6-1 grafisch dargestellt, besteht in Nord - Süd - Relation die<br />
Hauptnachfrage erst nachmittags bzw. abends. Damit sind viele der durch die fehlenden ICE-<br />
Züge frei gewordenen Fahrplantrassen nicht nutzbar.<br />
Real nutzbare zusätzliche Fahrplantrassen pro Fahrtrichtung durch Y-<strong>Trasse</strong><br />
qualitativ für z. B. Nord-Süd-Relation ab Norddeutschland<br />
Fahrplantrassen<br />
Nachfrage / Bedarf<br />
zusätzliche Fahrplantrassen<br />
durch Y-<strong>Trasse</strong><br />
nicht nutzbar<br />
real nutzbar<br />
heute vorhandene<br />
Fahrplantrassen<br />
5 Uhr 13 Uhr 21 Uhr<br />
Betriebszeit<br />
Abb. 6-1: Nutzbare zusätzliche Fahrplantrassen durch Y-<strong>Trasse</strong><br />
Während durch die Y-<strong>Trasse</strong> in dieser nachfragestarken Zeit nur etwa fünf Fahrplantrassen pro<br />
Stunde geschaffen werden, wird die Kapazität durch die Güterbahn je nach Ausbaustandard um<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 35
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
bis zu 18 (20 minus vorhandene Zugfahrten) Fahrplantrassen erhöht. Dadurch ist eine flexiblere<br />
und zuverlässigere Betriebsführung möglich, insbesondere zu Spitzenzeiten, da bei Verspätung<br />
freie Fahrplantrassen zur Verfügung stehen.<br />
Personenverkehrs-Effekte<br />
Aussage 2 [ebd, S. 92] „zusätzliche Reisendenkilometer“<br />
Mit Hilfe eines Überschlagverfahrens, das die auf den deutschen Neubaustrecken erzielten<br />
Verkehrsgewinne realitätsnah widerspiegelt, errechnet BREIMEIER folgende zusätzliche<br />
Personen-Verkehrsleistungen, gemessen in Reisenden-Kilometer je Jahr(Rkm/a):<br />
Güterbahn 57,77 Mio. Rkm/a<br />
Direttissima 247,81 Mio. Rkm/a<br />
Y-<strong>Trasse</strong><br />
250,79 Mio. Rkm/a<br />
Die Formel für das Überschlagsverfahren im SPFV [Breimeier, 1999, S. 79] berechnet mit Hilfe<br />
der Einwohnerzahl der Städte / Verkehrszellen, der Eisenbahnentfernung, dem<br />
Dienstleistungsanteil des Brutto-Inlands-Produkts und der durchschnittlichen<br />
Zugreisegeschwindigkeit die Reisenden einer Relation je Tag (siehe Anhang).<br />
Dieses ist ein einfaches Gravitationsmodell. Insgesamt ist, so BREIMEIER, die starke<br />
Entfernungsdegression des Verkehrsvolumens auffallend.<br />
Die Verkehrsmittelwahl - der sogenannte Modal-Split - unterliegt vielfältigen Einflüssen. Die<br />
bedeutendsten Einflussfaktoren sind, gereiht nach Bedeutung:<br />
- Im Personenverkehr: Reisezeit (Haustür - Haustür), Fahrpreis, Komfort, Service.<br />
- Im Güterverkehr: Beförderungspreis, Beförderungszeit, sonstige Aspekte<br />
Infrastrukturmaßnahmen des Eisenbahnnetzes beeinflussen lediglich die Beförderungszeit,<br />
Modal-Split-Gesetze für die Verkehrswegeplanung beschränken sich daher auf Zusammenhänge<br />
zwischen der Verkehrsmenge und der Beförderungszeit oder der Beförderungsgeschwindigkeit.<br />
[Breimeier, 1999, S. 80]<br />
Kontrollrechnung<br />
Eine Kontrollrechnung (siehe Anhang) für die Relationen Hamburg / Bremen - Hannover und<br />
Hamburg - Frankfurt(M) ergibt „nur“ 27,53 Mio. zusätzliche Rkm. Dabei wurde für Frankfurt(M) ein<br />
Wert von 2 Mio. Einwohnern angesetzt, so dass der gesamte Großraum damit abgedeckt ist.<br />
Wertung 2<br />
Es ist unwahrscheinlich, dass eine Aufsummierung der weiteren Relationen eine Summe von<br />
250,79 Mio. Rkm ergibt.<br />
Auch wäre - bezogen auf den Personenverkehr - die Direttissima der Y-<strong>Trasse</strong> überlegen, im<br />
Gegensatz zu den Berechnungen von BREIMEIER.<br />
Davon abgesehen, ist die Verwendung dieser Formel sehr zweifelhaft, da zumindest der<br />
zweitwichtigste Faktor für Nutzung der Eisenbahn - der Fahrpreis - keine Berücksichtigung findet.<br />
Die Verwendung der Eisenbahnentfernung kann den Fahrpreis nicht widerspiegeln, da ICE-<br />
Fahrpreise Relationsfahrpreise sind und mit der realen Entfernung keine (lineare)<br />
Übereinstimmung besteht.<br />
Auch die Aussage, dass Infrastrukturmaßnahmen lediglich die Beförderungszeit beeinflussen, ist<br />
grundlegend falsch. Die Kosten des Bahnnetzes werden als <strong>Trasse</strong>npreis auf die Betreiber der<br />
Züge und letztlich auf die Reisenden bzw. Verlader umgelegt. Damit entstehen für die<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 36
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Eisenbahnverkehrsunternehmen höhere Fixkosten. Dass diese Erhöhung der Fixkosten im<br />
Vergleich zu den Mehreinnahmen möglicherweise unerheblich ist, ist eine andere Frage.<br />
Zur Zeit und während der „Entwicklung“ der Überschlagsformel nach BREIMEIER sind die<br />
Reisenden gezwungen, den ICE zu nutzen, da praktisch kein Alternativangebot zur Verfügung<br />
steht, dass entsprechend preisgünstiger ist. Wie das Angebot „Schönes-Wochenende-Ticket“<br />
zeigt, hat der Preis einen erheblichen Einfluss auf die Nachfrage. Es stellt sich in diesem Fall die<br />
Frage, wie die Nachfrage sich entwickeln würde, wenn ein Unternehmen X, das im Personen- und<br />
Güterverkehr tätig ist, ein Fernzugnetz aufbaut, und dieses z. B. mit lokbespannten<br />
Doppelstockzügen betreibt. Da die teure Antriebseinheit „rund um die Uhr“ fahren kann und auch<br />
insgesamt die Fix- und Betriebskosten im Vergleich zum ICE-System sehr niedrig sind, kann eine<br />
Art „Guten-Abend-Ticket“ den gesamten Tag angeboten werden.<br />
Die Formel von VRTIC,<br />
Nachfrage(neu) = Nachfrage(alt) x (neues Zugangebot / altes Zugangebot) 0,35<br />
x (neue Preise / alte Preise) -0,3<br />
x (neues Einkommen / altes Einkommen) 0,5<br />
x (neue Reisezeit / alte Reisezeit) -0,8<br />
die [Siegmann, 2001, S. 88] vorstellt und auf Analysen im Schweizer Netz basiert, enthält u. a.<br />
das Element „Preis“. Wird der Preis um 50 % gesenkt, so erhöht sich die Nachfrage um (0,5/1,0) -<br />
0,3<br />
= 23 %, bei 70 % Preissenkung wären es „nur“ 43,5 %. Insofern hat auch der Preis - entgegen<br />
der Aussage von BREIMEIER - einen entscheidenden Einfluss auf den Modal-Split.<br />
Interessant ist der systemische Ansatz dieser Formel, bei der durch die Elemente<br />
„Einkommen“ und „Zugangebot“ zum einen das „übergeordnete“ System der allgemeinen<br />
Volkswirtschaft als auch das „System“ Fahrplanangebot wirkungsmäßig berücksichtigt werden.<br />
Aussage 3 [ebd., S. 92] „Wirtschaftlichkeit und Amortisation“<br />
BREIMEIER errechnet folgende zusätzliche Erlöse bzw. geht von folgenden Kosten aus (jeweils<br />
umgerechnet in Euro).<br />
zusätzlicher Erlös<br />
zusätzlicher Brutto-Erlös Investition<br />
SPFV<br />
SPFV und SGV<br />
Güterbahn 6,56 Mio. EUR/Jahr 48,84 Mio. EUR/Jahr 843,63 Mio. EUR<br />
Direttissima 28,18 Mio. EUR/Jahr 70,46 Mio. EUR/Jahr 1175,97 Mio. EUR<br />
Y-<strong>Trasse</strong> 28,52 Mio. EUR/Jahr 82,88 Mio. EUR/Jahr 1124,84 Mio. EUR<br />
Im SPFV ist dabei ein durchschnittlicher Erlös von 0,0875 EUR/Rkm angesetzt, für den<br />
<strong>Trasse</strong>npreis im SGV 3,835 EUR/km (ursprüngliches Verfahren von 1994).<br />
„Kosten für Verwaltung Instandhaltung der Strecken, Verkauf von Fahrkarten und zusätzliche<br />
Zugfahrten im Personenfernverkehr sind von den Brutto-Erlösen noch abzusetzen, wobei sich<br />
letztere in engen Grenzen halten, weil die betrachteten Relationen Endstrecken der ICE-Läufe<br />
darstellen, auf denen die Züge in der Regel zusätzliche Verkehre ohne eine Aufstockung<br />
des Angebots aufnehmen können.“ (im Original nicht fett markiert)<br />
Für einen groben wirtschaftlichen Vergleich reicht die Gegenüberstellung von Kennzahlen<br />
„zusätzliche Brutto-Erlöse aus Güter- und Personenverkehr dividiert durch die Fahrweg-<br />
Investitionen“ für die betrachteten Varianten aus.<br />
„Mögliche zusätzliche Erlöse aus dem SPNV auf der Güterbahn zwischen Soltau und Celle und<br />
aus einer InterRegio-Linie auf der Y-<strong>Trasse</strong> wurden vernachlässigt, da sie das Ergebnis nur<br />
unwesentlich beeinflussen.“<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 37
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Wertung 3<br />
1.)<br />
Im Falle einer Realisierung der Y-<strong>Trasse</strong> geht BREIMEIER davon aus, dass die Strecke Bremen -<br />
Hannover weitgehend von Zügen des Personenfernverkehrs entlastet wird, so dass entsprechend<br />
den wegfallenden Zügen des Fernverkehrs mit 18 zusätzlichen Güterzügen pro Tag und Richtung<br />
gerechnet werden kann.<br />
Diese Annahme ist vom Ansatz falsch (sofern nicht die unrealistische Verbindungskurve bei<br />
Rotenburg (Wümme) genommen wird). Wie die Karte in [Breimeier, 2/2001, S. 91] oder Abb. 2-1<br />
zeigen, verläuft der gesamte Fernverkehr weiterhin auf dem Abschnitt Bremen - Langwedel, der<br />
zudem der am stärksten belastete Abschnitt im Personenverkehr der Strecke Bremen - Wunstorf<br />
(- Hannover) ist (siehe Tab. 2-1). Da die Städte Nienburg (Weser) und Verden (Aller) und aller<br />
Wahrscheinlichkeit auch eine Landesregierung den Verlust der Fernverkehrsanbindung nicht<br />
hinnehmen werden, werden die heute neun IC(IR)-Verbindungen in irgendeiner Form erhalten<br />
bleiben oder ersetzt werden. Damit steigt die Belastung des Abschnittes Bremen - Langwedel<br />
sogar noch um neun weitere Züge, wenn unterstellt wird, dass über die Y-<strong>Trasse</strong> Bremen eine<br />
stündliche ICE-Anbindung Richtung Süden erhält (18 Züge pro Richtung). Dieses würde<br />
gegenüber heute eine Steigerung der ICE-Züge um 64 % bedeuten.<br />
Die angenommenen zusätzlichen 18 Güterzugtrassen existieren nicht, so dass die Brutto-Erlöse<br />
der Y-<strong>Trasse</strong> um 12,08 Mio. EUR (nach [Breimeier, 2/2001, S. 92]) reduziert werden müssen.<br />
Ein technisch möglicher dreigleisiger Ausbau der Strecke Bremen - Langwedel als notwendige<br />
„Verlängerung“ der Y-<strong>Trasse</strong> ermöglicht diese zusätzlichen Güterzugtrassen, erhöht aber die<br />
Investitionen der Y-<strong>Trasse</strong> nicht unerheblich, da die Kosten für diesen Ausbau der Y-<strong>Trasse</strong><br />
zugerechnet werden müssen.<br />
2.)<br />
Die Kosten für Instandhaltung der Strecken sind sehr unterschiedlich. Die Y-<strong>Trasse</strong> ist eine<br />
komplette, sehr unterhaltungsaufwändige Schnellfahrstrecke, die im Vergleich zur Güterbahn u.a.<br />
wesentlich umfangreichere Sicherungseinrichtungen erfordert (z.B. Linienzugbeeinflussung). Die<br />
Güterbahn stellt demgegenüber zwar auch praktisch einen Neubau dar, der aber zum einen<br />
wesentlich geringere Anforderungen benötigt und zum anderen eine bisherige Strecke ersetzt, bei<br />
der auch heute bereits Unterhaltungskosten anfallen.<br />
Aus diesem Grund verzerrt - auch für eine grobe Gegenüberstellung - die Verwendung der Brutto-<br />
Erlöse das Ergebnis sehr stark.<br />
3.)<br />
Die gesamten Brutto-Erlöse basieren auf der Annahme, dass die für die Planung unterstellte<br />
Steigerung der Güterverkehrsleistung von 100 % (+ 70 % mehr Züge) auch real existiert. Es muss<br />
hier betont werden:<br />
Der Bau von Strecken oder zusätzlichen Gleisen ergibt keine zusätzlichen Zugzahlen,<br />
sondern ermöglicht sie.<br />
Im Vergleich zu den Räumen einer Immobilie sind diese aber nicht vor dem Bau bereits vermietet<br />
oder verkauft. Wie Tab. 6-4 oder 6-5 zeigt, hat die DB bzw. ihre Tochter DB-Cargo zwischen 1994<br />
und 1999 die Verkehrsleistung praktisch nicht gesteigert (+ 2,46 %) oder steigern könnnen, ihren<br />
Umsatz dagegen um fast 10 % reduziert bzw. aufgrund der ungleichen Wettbewerbsbedingungen<br />
reduzieren müssen.<br />
Ergänzender Hinweis: Die von der DB AG publizierten Zahlen der „Personenkilometer“ (Pkm) sind mit denen<br />
der Deutschen Bundesbahn nicht vergleichbar, da die Erfassungsmodalitäten so geändert wurden, dass bei<br />
gleichen Leistungen höhere Werte erscheinen. [Bodack, 2002, S. 200])<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 38
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Eine Steigerung der Verkehrsleistung der Schiene um 100 % sollte zwar weiterhin das Ziel<br />
bleiben. Es müssen aber zwei Grenzfälle betrachtet werden - die Steigerung tritt ein bzw. die<br />
Steigerung erreicht nur z. B. 10 % - so dass beim Ausbau entsprechend vorgegangen werden<br />
muss (u.a. keine Schaffung von ungenutzten und damit teuren Strecken).<br />
Entwicklung der Verkehrsleistung 1994 - 1999 (der DB AG)<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999<br />
Fernverkehr<br />
Umsatz (Mio. DM) 4.860 5.171 5.350 5.493 5.304 5.533<br />
Differenz 1994 zu 1999 (%) + 13,85 %<br />
Verkehrsleistung (Mio. Pkm) 34.845 36.277 35.620 35.155 34.562 34.897<br />
Differenz 1994 zu 1999 (%) + 0,15 %<br />
Nahverkehr<br />
Umsatz (Mio. DM) 10.791 11.351 11.918 12.167 12.088 12.342<br />
Differenz 1994 zu 1999 (%) + 12,57 %<br />
Verkehrsleistung (Mio. Pkm) 29.694 34.057 35.408 36.475 37.291 37.949<br />
Differenz 1994 zu 1999 (%) + 27,80 %<br />
Güterverkehr<br />
Umsatz (Mio. DM) 6.969 6.799 6.468 6.694 6.600 6.306<br />
Differenz 1994 zu 1999 (%) - 9,51%<br />
Verkehrsleistung (Mio. tkm) 69.775 68.744 67.369 72.389 73.273 71.494<br />
Differenz 1994 zu 1999 (%) + 2,46 %<br />
Tab. 6-4: Entwicklung der Verkehrsleistung 1994 - 1999<br />
(Quelle: [Eisenbahn Revue, 1/2001, S. 44])<br />
Aus Sicht des Netzbetreibers, der seine Kosten durch den Verkauf von <strong>Trasse</strong>nkilometern decken<br />
muss, ist folgende Tabelle interessant.<br />
Betriebsleistung in Mio. <strong>Trasse</strong>nkilometern<br />
1998 1999 2000 2001 Differenz 1998 - 2001<br />
DB Regio 536,6 552,4 563,9 560,2 + 4,4 %<br />
DB Cargo 223,5 220,3 225,5 226,9 + 1,5 %<br />
DB Reise&Touristik 181,5 177,5 175,9 161,5 - 11,0 %<br />
Gesamt bei DB Netz 946,5 976,7 984,2 977,3 + 3,3 %<br />
-> „Dritte“ 4,9 26,5 18,9 28,7 (+ 485,7 %)<br />
Tab. 6-5: Betriebsleistung in <strong>Trasse</strong>nkilometern<br />
(Quelle: DB AG Geschäftsbericht 1999 und „Die Bahn in Europa“, Broschüre der DB AG Kommunikation,<br />
2002)<br />
Die beiden größten Kunden der Infrastrukturbetreiberin DB Netz sind DB Regio und DB Cargo.<br />
Eine neue „Personenverkehrsstrecke“, die die Altstrecke nur um wenige Züge entlastet, wird nicht<br />
automatisch zu einer Erhöhung der <strong>Trasse</strong>nkilometer durch DB Reise&Touristik führen, da Züge<br />
nur verlegt werden. Eine „Güterbahn“, die real nutzbare neue Kapazitäten im hohen Umfang<br />
bereitstellt, kann zu neuem Verkehr auf der Schiene beitragen, da dann auch tagsüber mehr<br />
gefahren werden kann.<br />
4.)<br />
Wird - unabhängig von den bisher aufgeführten Wertungen - angenommen, dass die Zahlen von<br />
BREIMEIER richtig und realistisch sind, so ergibt sich folgender Fall:<br />
Die Kosten für den Bau der Y-<strong>Trasse</strong> müssen komplett vorfinanziert werden. Die Strecke ist erst<br />
nach gesamter Fertigstellung für den öffentlichen Verkehr nutzbar, kann also dann erst<br />
Einnahmen erzielen (Die „Güterbahn“ z. B. wäre dagegen bereits beim Ausbau der Teilstrecke<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 39
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Buchholz(Nordheide) - Soltau für den SPNV nutzbar, oder auch beim teilweise / überwiegend<br />
eingleisigen Ausbau!).<br />
Der Abschreibungszeitraum für eine (Neubau-)Strecke beträgt 35 Jahre (= maximal zulässige<br />
Amortisationszeit).<br />
Der Zinssatz wird zu 5 % angenommen.<br />
Die Bauzeit wird mit 6 Jahren angenommen, der Testbetrieb und die Inbetriebnahme mit einem<br />
Jahr.<br />
Für die Investitionssumme müssen erst mit Ablauf der Bauzeit Zinsen gezahlt werden<br />
(unrealistisch, liegt aber so auf alle Fälle auf der sicheren Seite).<br />
(Auch wenn dem Netzbetreiber die Investitionssumme als zinsloses Darlehen zur Verfügung<br />
gestellt wird oder vom Bund / Land Kosten übernommen / vorfinanziert werden, so fallen die<br />
Zinsen an, die dann vom Staat über Steuererhöhungen oder Kreditaufnahme bezahlt werden<br />
müssen oder an anderer Stelle fehlen.)<br />
Mittels der dynamischen Amortisationsrechnung soll ermittelt werden, wann die Y-<strong>Trasse</strong> sich mit<br />
diesen Annahmen amortisiert hat (Kapitalrückflussdauer). Es wird derjenige Zeitraum ermittelt,<br />
der zur vollständigen Wiedergewinnung der Investitionssumme durch die Barwerte der<br />
zukünftigen Überschüsse vergeht. Bei der Amortisationsrechnung - der statischen wie der<br />
dynamischen - steht nicht die Rentabilität bzw. interne Verzinsung im Vordergrund, sondern das<br />
Sicherheitsdenken (vgl. z. B. [IBB, 2000, S. 4-19]).<br />
(Anmerkung: Die dynamischen Verfahren basieren auf der Annahme des „vollkommenen Kapitalmarktes“,<br />
der sich durch folgende Annahmen auszeichnet:<br />
• Kapital steht dem Investor unabhängig von seiner Bonität zur Verfügung.<br />
• Es erfolgt keine Differenzierung zwischen Eigen- und Fremdkapital.<br />
• Es herrscht vollständige Markttransparenz. Die Konsequenz daraus ist ein einziger, einheitlicher<br />
Marktzins als Kalkulationszinssatz. [ebd., S. 4-14]<br />
Da in diesem Fall der Staat - und kein privater Investor - als Investor auftritt und der Abschreibungszeitraum<br />
sehr lange ist, können praktisch alle Annahmen als gegeben angesehen werden.)<br />
Formel: I o ≤ Σ (E t - A t ) / (1 + p) t von t = 1 bis n = dynamische Amortisationszeit<br />
mit E = Einnahmen<br />
A = Ausgaben<br />
p = Zinssatz<br />
Rechnung mit<br />
Io = 1124,84 Mill. Euro<br />
E = 82,88 Mill. Euro (Brutto-Erlöse aus Personen- und Güterverkehr)<br />
A = hier nur Zinszahlungen (Kosten für Instandhaltung, Verwaltung, usw. nicht berücksichtigt)<br />
Jahr t (E t - A t ) (Ausgaben =Zinsen) (1 + p) (-t) (Et-At) • (1 + p) (-t) kumulierte Summe<br />
0 (Bauende) -1124,84 (Investitionen) 1,0 -1124,84 -1124,84<br />
1 0 - 56,24 0,9524 -53,56 -1178,40<br />
2 82,88 - 58,92 0,9070 21,73 -1156,67<br />
3 82,88 - 57,83 0,8638 21,64 -1146,34<br />
4 82,88 - 57,32 0,8227 21,03 -1125,31<br />
5 82,88 - 56,27 0,7835 20,85 -1104,46<br />
6 82,88 - 55,22 0,7462 20,64 -1083,82<br />
7 82,88 - 54,19 0,7107 20,39 -1063,43<br />
8 82,88 - 53,17 0,6768 20,11 -1043,32<br />
9 82,88 - 52,17 0,6446 19,80 -1023,52<br />
10 82,88 - 51,18 0,6139 19,46 -1004,06<br />
Überschlagsrechnung<br />
1004,06 / 19,46 = 51,60 Jahre<br />
Die Y-<strong>Trasse</strong> würde sich unter diesen auf der sicheren Seite befindenden Annahmen nach etwa<br />
10 + 51 = 61 Jahren amortisiert haben. Liegen die Einnahmen unter den Zinszahlungen, wird sie<br />
sich nie rentieren. Die dynamische Amortisationsrechnung ist bei diesen langen Zeiträumen zwar<br />
nicht mehr jahresgenau, doch zeigt sie die Dimension auf alle Fälle an.<br />
Das Entscheidungskriterium im Falle einer Auswahlentscheidung lautet:<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 40
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
„Realisiere das Vorhaben mit der kürzesten Amortisationszeit, sofern es die maximal<br />
zulässige nicht übersteigt!“ [IBB, 2000, S. 4-19]<br />
„Eines der globalen Ziele von „Netz 21 plus“ ist es, die Fahrwegkosten zu verringern. Die<br />
Forderung nach einem „bezahlbaren Fahrweg“ ist auch ein Kernziel der Bahnreform.“<br />
[Jänsch, 2001, S. 109]<br />
Dieses Ziel kann mit einer Strecke, die sich nicht amortisiert, nicht erreicht werden.<br />
Aussage 4 [ebd., S. 93] „Kapazität und <strong>Trasse</strong>nkonflikte“<br />
Durch die Y-<strong>Trasse</strong> steigt die Belastung des dreigleisigen Abschnitts Scheeßel -<br />
Buchholz (Nordheide) auf 354 Züge pro Tag für beide Richtungen. (Eine Steigerung des<br />
Güterverkehrs um 70 % ist darin enthalten.) Die Leistungsfähigkeit dieser dreigleisigen Strecke<br />
dürfte dennoch noch nicht ausgeschöpft sein.<br />
„Die Konflikte um Fahrplantrassen die [Andersen, 2000, S. 517] nachweist, sind im übrigen zu<br />
einem erheblichen Teil vermeidbar, wenn die schnellen Züge gebündelt verkehren. [...] Sollten die<br />
von Andersen beschriebenen betrieblichen Probleme zwischen Scheeßel und Buchholz durch<br />
eine Bündelung der schnellen Züge nicht zu beheben sein, ist der viergleisige Ausbau dieses<br />
Abschnitts zu prüfen. Für diese betrieblich optimale Lösung erhöhen sich die Investitionen der Y-<br />
<strong>Trasse</strong> um schätzungsweise 230 Mio. EUR.“<br />
Wertung 4<br />
1.)<br />
„Dass Einzelvorhaben hinsichtlich ihrer Wirkung im gesamten Eisenbahnnetz zu beurteilen sind,<br />
ist - [...] - eine Selbstverständlichkeit.“ [Breimeier, 2/2001, S. 90] Werden zur Lösung der<br />
Betriebsprobleme Zugbündelungen zwingend vorausgesetzt, so bedeutet dieses für das gesamte<br />
Eisenbahnnetz, dass die ICE-Züge die Hamburg verlassen bzw. erreichen, dort ihren Fix- oder<br />
Zwangspunkt besitzen. Die Fahrplanplanung ist festgelegt: Anschlüsse in Dortmund, Köln,<br />
Frankfurt(M), Mannheim, München, usw. müssen entsprechend liegen. Auch dürfen sich die vier<br />
SPFV-Linien nicht gegenseitig behindern, um Fahrzeitverlängerungen zu vermeiden. Wird dieses<br />
Ziel zufällig erreicht, so muss der Nahverkehr erhebliche Qualitätseinbußen erleiden, die sowohl<br />
aus Kundensicht nicht akzeptabel sind, als auch aus Sicht des Netzbetreibers. Denn im<br />
ungünstigen Fall müssten (bisher vorhandene) Nahverkehrsleistungen ersatzlos gestrichen<br />
werden (vgl. z. B. [Andersen 2000, S. 517])<br />
2.)<br />
Für diese Strecke zitiert die Rotenburger Kreiszeitung am 19. 7. 1985 den Betriebsingenieuer<br />
Gerald Lilie des Bundesbahnbetriebsamtes Hamburg-Harburg. Dieser sagt aus, dass durch das<br />
dritte Gleis die Kapazität auf 320 Züge gesteigert wird. Beinhaltet diese Zahl keine Reserven<br />
(befriedigende Betriebsqualität), so dürften die 354 Züge pro Tag eher Richtung<br />
(betriebswirtschaftlicher) Leistungsgrenze gehen, als „noch nicht ausgeschöpft“ zu sein.<br />
Davon abgesehen, widerspricht BREIMEIER der Aussage ANDERSENs nicht, denn die Konflikte<br />
sind zu einem erheblichen Teil vermeidbar, aber eben nicht ganz.<br />
Oder anders formuliert:<br />
Wenn bei 354 Zügen in beiden Richtungen pro Tag die Leistungsfähigkeit des dreigleisigen<br />
Abschnitts Buchholz (Nordheide) - Rotenburg (Wümme) mit einem sehr unharmonischen<br />
Betriebsprogramm (ICE, IC, RE, Güterzüge) noch nicht ausgeschöpft ist, dann ist es der<br />
zukünftig dreigleisige Abschnitt Stelle - Lüneburg mit gleichem Betriebsprogramm mit heute ca.<br />
340 Zügen ebenfalls nicht, auch wenn noch eine etwas „langsame“ RB-Linie auf ihr geführt wird.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 41
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Es ist allerdings abzusehen, dass in einigen Jahren beschleunigungsstärkere Fahrzeuge<br />
eingesetzt werden. Daher sind für den Güterverkehr nach dieser Argumentation auch auf dieser<br />
Strecke noch Reserven vorhanden.<br />
Sind 354 Züge für eine dreigleisige Strecke noch nicht die Leistungsgrenze, stellen bei einer<br />
angenommenen Kapazitätserhöhung des dritten Gleises von ca. 25 % [Pachl, 1998, S. 27] für<br />
eine zweigleisige Strecke - mit auf der sicheren Seite gerechneten 35 % - (354/1,35=) 262 Züge<br />
pro Tag für beide Richtungen noch keine Leistungsgrenze dar. Damit hätte die heute mit 240<br />
Zügen in beiden Richtungen belegte Strecke Lüneburg - Celle noch Leistungsreserven.<br />
3.)<br />
Sollte die Strecke auf Grund der Y-<strong>Trasse</strong> viergleisig ausgebaut werden müssen, so müssten<br />
diese Kosten der Y-<strong>Trasse</strong> zugerechnet werden, die sich dann um 20 % erhöhen würden und die<br />
Wirtschaftlichkeit erheblich herabsetzen würde.<br />
4.)<br />
Auf den von [Andersen, 2000, S. 517] betonten betriebssystematischen Nachteil für die<br />
Durchführung des Güterzugverkehrs in Buchholz (Nordheide) - Konflikt Güterzüge Maschen Æ<br />
Buchholz (Nordheide) Æ Rotenburg (Wümme) mit SPFV Rotenburg (Wümme) Æ Buchholz<br />
(Nordheide) Æ Hamburg-Harburg - geht BREIMEIER nicht ein. Theoretisch wäre dieses durch ein<br />
Überwerfungsbauwerk zu lösen. Falls dieses in Buchholz (Nordheide) zu realisieren möglich ist,<br />
würden die Kosten der Y-<strong>Trasse</strong> nochmals steigen.<br />
Aussage 5,6 [ebd., S. 91] Fahrzeitverminderung, „Kostenansatz“ und „fehlende Kosten“<br />
Nach Tab. 6-2 verkürzt die Y-<strong>Trasse</strong> die Fahrzeit um 14 bzw. 9 Minuten (Hamburg bzw. Bremen).<br />
Für die Y-<strong>Trasse</strong> sind 1125 Mio. EUR einschließlich 51 Mio. EUR für eine Verbindungskurve bei<br />
Visselhövede oder bei Rotenburg (Wümme) an Investitionskosten notwendig.<br />
Wertung 5<br />
Leider ist zwar eine Fahrzeitverminderung angegeben, aber keine Aussage auf die<br />
zugrundeliegende Fahrzeit. Beziehen sich die 9 Minuten Fahrzeitgewinn auf die aktuelle Fahrzeit<br />
von 60 Minuten, so würden 51 Minuten mit der Y-<strong>Trasse</strong> erreicht werden, auch wenn zwischen<br />
Langwedel und Visselhövede nur 120 km/h gefahren werden (Bremen - Langwedel ca. 16 Min.,<br />
Langwedel - Visselhövede 13 Min., Visselhövede - Langenhagen Mitte 70km / 280 km/h = 15 Min.<br />
und Langenhagen Mitte - Hannover Hbf 7 Min. = 51 Min.).<br />
Sind auf der Altstrecke alle Langsamfahrstellen beseitigt - wie z. B. Allerbrücke bei Verden - dann<br />
sind hier 55 Minuten möglich (siehe Tab. 5-1) und der Fahrzeitgewinn beträgt nur 4 Minuten.<br />
Beziehen sich die 9 Minuten auf diese 55 Minuten, so müsste der Abschnitt Langwedel -<br />
Visselhövede mindestens für eine Reisegeschwindigkeit von 195 km/h ausgebaut werden.<br />
Sollte dieses der Fall sein, ist die fehlende Aussage zum Ausbau des ca. 26 km langen Abschnitts<br />
Visselhövede - Langwedel nicht hinnehmbar. Nach [LNVG, 2001, S. 8] ist nur ein Ausbau auf 120<br />
km/h bis 2003 realisiert, die Installation neuer Signal- und Sicherungstechniken sowie die<br />
Elektrifizierung zeitlich noch nicht definiert. Werden die von BREIMEIER für eine Neubaustrecke<br />
im norddeutschen Flachland angesetzten 12,78 Mio. EUR, abzüglich 3,31 Mio. EUR/km, die beim<br />
Ausbau der Strecke Weetzen - Egestorf angefallen sind und die unabhängig vom Bau der Y-<br />
<strong>Trasse</strong> anfallen, so ergibt sich für die Ertüchtigung der Strecke Visselhövede - Langwedel ein<br />
zusätzlicher Betrag von (12,78 - 3,31=) 9,47 EUR/km, entsprechend 246,22 Mio. EUR für die 26<br />
km lange Gesamtstrecke. Dieser Betrag ist bei BREIMEIER nicht zu finden. Er ist auch nicht in<br />
den 1125 Mio. EUR enthalten, da ansonsten die Strecke Scheeßel - Langenhagen (84 - 26=) 58<br />
km lang wäre (Langenhagen - Fallingbostel etwa 60 km).<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 42
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Die Kosten für die Y-<strong>Trasse</strong> lägen demzufolge nach BREIMEIER bei (1.125 + 246,22 =) 1.371,22<br />
Mio. EUR.<br />
Würde wegen der Kosten auf den Bremer Ast verzichtet, so fallen die von BREIMEIER<br />
errechneten Einnahmen wesentlich geringer aus.<br />
Auch wenn der Artikel von BREIMEIER etwa 10 Jahre aktueller als der Preisstand des BVWP<br />
1992 ist, stellt sich die Frage, warum die Y-<strong>Trasse</strong> bei BREIMEIER mit 1125 Mio. EUR etwa 153<br />
Mio. EUR „billiger“ als im BVWP 1992 ist.<br />
Weiterhin ist zu fragen, wenn [Breimeier, 2/2001, S. 90] betont: „Die Ausgestaltung der<br />
Infrastruktur der Eisenbahn hat sich stets an den Erfordernissen des Eisenbahn-Betriebes<br />
auszurichten. Hinsichtlich dieser Forderung ist dem Autor ANDERSEN [1] (Anmerkung des<br />
Verfassers [1] = [Andersen, 2000]) uneingeschränkt zuzustimmen.“ (Im Original nicht fett<br />
markiert), warum kein Hinweis auf eine kreuzungsfreie Ein- und Ausfädelung der (ICE-)Strecke<br />
Langwedel - Verbindungskurve Y-<strong>Trasse</strong> von der Strecke Bremen - Verden (Aller) - Hannover<br />
erfolgt, die zusätzliche Kosten bedeutet. Diese ist notwendig, um die Leistungsfähigkeit der<br />
bestehenden Strecke nicht herabzusetzen.<br />
„Ergebnis“ von [Breimeier, 2/2001]<br />
„Im Gegensatz zu Japan lässt sich in Deutschland die Leistungsfähigkeit neuer Strecken<br />
für den Hochgeschwindigkeitsverkehr (mit Ausnahme der Relation Köln - Frankfurt am<br />
Main - Mannheim) allein mit Zügen des Personenfernverkehrs vielfach nicht ausnutzen,<br />
weil entsprechend den verkehrsgeographischen und sozioökonomischen<br />
Voraussetzungen das Verkehrspotenzial fehlt, um eine dichte Zugfolge anbieten zu<br />
können.“ [Breimeier, 2/2001, S. 93]<br />
Diese Aussage ist eindeutig. Mit der unmittelbar folgenden Einschränkung, „Trotz dieser<br />
Einschränkung können Schnellfahrstrecken, die als Ergänzung des Netzes in Deutschland nur in<br />
Relationen mit Kapazitätsengpässen vorgesehen werden, eine größere Wirtschaftlichkeit als<br />
vergleichbare Parallelstrecken konventioneller Bauart erreichen“, wird die oben hervorgehobene<br />
Aussage wieder aufgehoben, da mit ihr jede Schnellfahrstrecke zu rechtfertigen ist. Wenn<br />
weiterhin „Kapazitätsengpässe des Eisenbahnnetzes [...] in der Regel nicht durch „Basteln“ am<br />
bestehenden Netz behoben werden [sollten] [ebd. S. 93], dann müsste die Y-<strong>Trasse</strong> von<br />
Hannover Hbf bis Hamburg Hbf - Dammtor - Altona gebaut werden, da ein „Basteln“ von<br />
Scheeßel bis Hamburg nicht ausbleiben wird.<br />
Auch kurze Aus- bzw. Neubauabschnitte wie Wunstorf - Minden (Westf) stellen im Endeffekt nur<br />
ein „Basteln“ am bestehenden Netz dar und sind demzufolge nach BREIMEIER abzulehnen.<br />
„Da ein grosser Teil der deutschen Bevölkerung außerhalb der Großstädte lebt, die durch<br />
IC/ICE-Züge untereinander verbunden sind, stellt sich ein voller Erfolg im Schienen-<br />
Personenverkehr erst ein, wenn die zum Teil hervorragenden Verbindungen des<br />
Fernverkehrs durch gute Anschlüsse bis in die Fläche hineingetragen werden.<br />
Voraussetzung eines derartigen Angebots ist daher eine Kombination aus Fern- und<br />
Nahverkehr „aus einem Guss“.“ [Breimeier, 1999, S. 85]<br />
Dieser Aussage ist uneingeschränkt zuzustimmen. Die Y-<strong>Trasse</strong> trägt dazu allerdings nicht bei,<br />
da z. B. die gesamte Lüneburger Heide weder an das Fernverkehrsnetz angeschlossen noch<br />
durch Nahverkehr flächenmäßig erschlossen wird. Danach ist vordringlich zu fordern, z. B. den<br />
Nahverkehr in den Bereichen Lüneburger Heide, Hannover, Harz als Zubringer zum Fernverkehr<br />
zu stärken, so dass zusätzliche Fernzüge - IC(IR) auf dem Abschnitt Hannover /<br />
Braunschweig/Hildesheim - Würzburg wirtschaftlich angeboten werden könnten. Abgesehen vom<br />
Engpass Hannover Hbf - Hannover-Bismarckstraße sind hier Kapazitäten ungenutzt.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 43
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Dabei könnte eine mögliche Fernverkehrslinie über Würzburg hinaus nach Stuttgart über Lauda<br />
und Heilbronn geführt werden. Damit würde zum einen die Relation Würzburg - Stuttgart<br />
fernverkehrsmäßig aufgewertet werden und andererseits der Engpass Hanau - Frankfurt (Main) -<br />
Mannheim teilweise entlastet werden.<br />
(Anmerkung: Vgl. dazu z. B. das Konzept der Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger des SPNV zur<br />
Entwicklung eines interregionalen Expressnetzes, nach dem die RE X Linie 18 Stuttgart - Würzburg im Ein-<br />
Stunden-Takt befahren werden soll. www.bag-spnv.de)<br />
Wertung insgesamt:<br />
Die Artikel von BREIMEIER zeichnen sich durch Fachwissen, Sachlichkeit, fundierte<br />
Informationen und leichte Lesbarkeit auch schwieriger Sachverhalte aus (vgl. z.B. [Breimeier,<br />
1999], [Breimeier, 12/2001] oder auch Eisenbahn-Revue International 12/2000 S. 554 ff). Das bei<br />
einigen Punkten die Meinung bzw. Einschätzung anders sein kann, ist normal und spricht nicht<br />
gegen die oben genannten Eigenschaften. Den Aussagen BREIMEIERs zur Y-<strong>Trasse</strong> kann nicht<br />
zugestimmt werden und muss widersprochen werden.<br />
Zwischenfazit betriebliche und wirtschaftliche Betrachtung<br />
Die Y-<strong>Trasse</strong> ist betrieblich und wirtschaftlich den Alternativen unterlegen. Die Variante<br />
„Güterbahn“ 1 bzw. 2 schafft wesentlich mehr zusätzliche Güterzugtrassen, erschließt gleichzeitig<br />
die Fläche und „erspart“ den vom Land geplanten Ausbau der Strecke Buchholz(Nordheide) -<br />
Soltau. Die Entlastung durch Züge des Güterverkehrs und das in Planung / Bau befindliche dritte<br />
Gleis zwischen Lüneburg und Stelle sollte es ermöglichen, die streckenmögliche Zeit von 70<br />
Minuten zwischen Hamburg Hbf und Hannover wieder zuverlässig zu erreichen. Sollte die<br />
technisch mögliche Erhöhung der Durchfahrgeschwindigkeit der Bahnhöfe Celle, Uelzen und<br />
Lüneburg realisiert werden, könnte die Fahrzeit um weitere 4 bis 5 Minuten gesenkt werden. Die<br />
mögliche Erhöhung der Beharrungsgeschwindigkeit von 200 auf 220 (230 / 290) km/h auf 75 km<br />
Streckenlänge ergäbe weitere 2 (3 / 7) Minuten, so dass der Zeitvorteil der Y-<strong>Trasse</strong> weiter<br />
schrumpft (bei singulärer Betrachtung des Zeitaspektes). Inwieweit diese Maßnahmen sinnvoll<br />
und bezahlbar sind, ist eine andere Frage.<br />
Weder betrieblich noch wirtschaftlich ist bei Baukosten von etwa 1,5 Mrd. EUR die Y-<strong>Trasse</strong> zu<br />
rechtfertigen. Zusammengefasst ergeben sich die Probleme der Y-<strong>Trasse</strong> durch ihre Struktur. Sie<br />
verbindet vorhandene (überlastete) Strecken, keine Knoten, wie z. B. die SFS Hannover -<br />
Würzburg (Abb. 6-2).<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 44
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Vergleich: Prinzip der Y-<strong>Trasse</strong> und der SFS Hannover - Würzburg<br />
"Y-<strong>Trasse</strong>"<br />
SFS Hannover - Würzburg<br />
Verbindung von Strecken<br />
tendenziell keine neuen Kapazitäten<br />
nur abschnittsweise Trennung der<br />
langsamen und schnellen Verkehre<br />
Verbindung von Knoten<br />
real neue Kapazitäten<br />
komplette Trennung der langsamen<br />
und schnellen Verkehre<br />
Abb. 6-2: Vergleich Y-<strong>Trasse</strong> mit SFS Hannover - Würzburg<br />
6.2 Lösungsvarianten (politische und finanzielle Betrachtung / Raumordnung)<br />
Großprojekte dieser Art besitzen immer einen gewissen „Charme“, da die sehr hohen<br />
Investitionen mit Arbeitsplatzsicherung und -schaffung verbunden werden. Außerdem spielt bei<br />
einer Hochgeschwindigkeitsstrecke auch der Faktor „Prestige“ eine bestimmte Rolle, genannt<br />
wird dann, dass die „Wettbewerbsfähigkeit“ gestärkt bzw. auf dem Spiel steht. Daher besteht die<br />
Gefahr, dass der „Charme“ und das „Prestige“ zur Treibkraft für das Projekt werden und die<br />
betrieblichen und finanziellen (fachlichen) Aspekte (etwas) verdrängt werden. Dass dieses nicht<br />
unrealistisch ist, zeigt die Braunschweiger Zeitung am 15. Mai 2002 auf ihrer zweiten Seite:<br />
„Im bundesdeutschen Verkehrsnetz klafft auch weiterhin eine riesige Investitionslücke: Die<br />
Bundesländer und die Deutsche Bahn haben [...] Vorhaben mit Kosten bis zu 150 Milliarden Euro<br />
bis zum Jahr 2015 angemeldet. Doch für den Neu- und Ausbau von Straße und Schiene stehen<br />
nach den Planungen der Bundesregierung bis dahin voraussichtlich nur rund 60 Milliarden zur<br />
Verfügung, [...]. Zwar seien die Gesamt-Investitionsmittel im Vergleich zu früheren Jahren<br />
angehoben worden [...], doch werde die Hälfte der Gelder für Instandsetzungen benötigt.“<br />
Es sind hier zwei Fälle zu betrachten.<br />
1. die Gelder für die Y-<strong>Trasse</strong> werden genehmigt und<br />
2. andere „Großprojekte“ und Engpässe besitzen eine höhere Priorität (z. B. Großraum<br />
Frankfurt(M), Metrorapid-Projekte werden durchgezogen und erhalten hohe Summen,<br />
Großflughafen Berlin-Schönefeld wird mit Steuergeldern realisiert, ...) und es werden keine<br />
Mittel bzw. nur geringe Mittel genehmigt. Oder die allgemeine Finanznot lässt keine<br />
Finanzierung in dieser Größenordnung mehr zu.<br />
Im ersten Fall wird aller Wahrscheinlichkeit für andere Schieneninfrastruktur-Projekte in<br />
Niedersachsen kein Geld mehr vorhanden sein. Bereits im aktuellen Programm der<br />
Landesregierung bzw. [LNVG, 2001] sind einige Projekte nur mit offenem Realisierungszeitraum<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 45
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
angegeben. Die ICE-Strecke (Frankfurt (Main) -) Hildesheim - Braunschweig - „Weddeler<br />
Schleife“ - Fallersleben (-Berlin) ist wahrscheinlich 15 Jahre nach der deutschen<br />
Wiedervereinigung immer noch weitgehend eingleisig. Die Weddeler Schleife ist zwar für zwei<br />
Gleise vorbereitet, aber nur eingleisig gebaut worden, weil wenige Millionen Euro fehlten. Erst<br />
nach 2008 soll hier nach [LNVG, 2001, S. 9] das zweite Gleis verlegt werden.<br />
(Anmerkung: Die Strecke (Wolfsburg-) Fallersleben - Weddel (- Braunschweig -) Groß Gleidingen -<br />
Hildesheim ist die einzige eingleisige ICE-Systemstrecke in Deutschland.)<br />
Im zweiten Fall kann die Y-<strong>Trasse</strong> nicht gebaut werden, da aber entsprechende „Alternativ-<br />
Projekte“ nicht angemeldet wurden – um die Y-<strong>Trasse</strong>n-Planung nicht zu gefährden – stehen<br />
keine Bundesmittel zur Verfügung. Es kann nicht investiert werden, bzw. die Engpässe bleiben<br />
bestehen.<br />
Frage: Ist dieses verantwortungsvolle und zukunftsweisende Infrastruktur- und<br />
Raumordnungspolitik?<br />
Bei der Y-<strong>Trasse</strong> kommt hinzu, dass sie sich nicht amortisieren wird, so dass kein Geld<br />
zurückfließt, welches dann wieder in andere Projekte investiert werden kann.<br />
Die anderen Neu- und Ausbaustrecken, die Niedersachsen betreffen (Hannover - Göttingen -<br />
Würzburg und Hannover - Wolfsburg - Berlin) haben sowohl einen „Qualitätssprung“ der<br />
Verbindung innerhalb Niedersachsens bewirkt (Fahrzeitverkürzung), als auch die<br />
Landeshauptstadt als Wirtschafts- und Tagungsort attraktiver werden lassen, da sie aus fast allen<br />
Teilen Deutschlands wesentlich schneller zu erreichen ist. Die Y-<strong>Trasse</strong> verkürzt dagegen die<br />
Fahrzeit nur minimal und erschließt Niedersachsen nicht. So ist von den Großstädten<br />
Braunschweig, Wolfsburg und Göttingen geografisch Braunschweig am nächsten an Hannover<br />
gelegen, gemessen an der Fahrzeit aber am weitesten entfernt. Von Osnabrück ist die<br />
Landeshauptstadt Hannover nur über sehr „unattraktive“ 71 Minuten zu erreichen, bezogen auf<br />
die 133 km Entfernung. Würde die Reisegeschwindigkeit hier der von Hannover - Hamburg<br />
entsprechen, so läge die Zeit bei 56 Minuten. Bezogen auf die Reisezeit besteht in Niedersachsen<br />
auf anderen Strecken eher ein Nachholbedarf.<br />
Raumordnung / Wettbewerbsfähigkeit<br />
Es kann hier keine erschöpfende Untersuchung zum Thema Wettbewerbsfähigkeit oder zur<br />
raumordnerischen Wirkung der Y-<strong>Trasse</strong> erfolgen. Es seien aber zwei Beispiele genannt, die<br />
diesen Bereich betreffen.<br />
In der Broschüre des Lenkungsausschusses der Gemeinsamen Landesplanung in der<br />
Metropolregion Hamburg „metropolinformation. Ziele, Strategien, Handlungsfelder, Projekte“ heißt<br />
es auf Seite 21 zum Ausbau der Strecke Hamburg - Berlin und zur Y-<strong>Trasse</strong>:<br />
Behauptung:<br />
„Mit beiden Vorhaben wird die Metropolregion Hamburg besser erreichbar und in ihrer<br />
Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Zugleich werden die Zentren enger zusammenrücken und<br />
neue Synergien nutzen.“<br />
Es sollte folgende Frage gestellt werden: Ist dieses wirklich der Fall und was ist mit den<br />
Landkreisen und Kommunen zwischen den Zentren (Stichwort: Raumordnung und gleichwertige<br />
Lebensbedingungen)?<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 46
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Antwort: Angesichts der minimalen Fahrzeitreduzierung und eines gleichbleibenden<br />
Zugangebotes kann von einer besseren Erreichbarkeit nicht gesprochen werden. Die benötigten<br />
Kapazitäten für den Güterverkehr werden kaum und preislich nicht günstig geschaffen.<br />
Für die Hansestadt Bremen wird sich - bis auf die geringfügige Fahrzeitreduzierung - sogar keine<br />
Veränderung gegenüber heute ergeben.<br />
Die Landkreise und Kommunen zwischen den Zentren werden weiter an Bedeutung verlieren.<br />
Dieses liegt darin begründet, dass deren Infrastruktur nicht ausgebaut wird und sie damit einen<br />
gravierenden Standortnachteil und Attraktivitätsverlust hinnehmen müssen (reine Wohn- und<br />
Schlafstädte, da in die Metropolen gependelt werden muss). Zusätzlich wird ihr Gebiet von einer<br />
weiteren Verkehrsachse durchschnitten, die allein dem Transit dient und damit ihr Gebiet z. B. für<br />
den Tourismus unattraktiver werden lässt.<br />
Sehr konkret und unmißverständlich schreibt dieses die Stadt Braunschweig - in der Region<br />
Braunschweig wohnen immerhin 1,1 Millionen Einwohner - in ihrer Stellungnahme zum Entwurf<br />
des Nahverkehrsplans 2003 - 2007, die hier wegen ihrer Deutlichkeit zitiert werden soll:<br />
„Im Kapitel D 3.1 Streckennetz (S. 145) ist zu ergänzen, dass zusätzlich zu den aufgeführten<br />
Maßnahmen eine leistungsfähige Direktfernverbindung aus der Region Braunschweig (ca. 1,1<br />
Mio. Einwohner) nach Norden (Hamburg, Ostsee) erforderlich ist, um attraktive Verbindungen für<br />
die Wirtschaft und die Bevölkerung anzubieten und Verkehre teilweise von der Straße auf die<br />
Schiene verlagern zu können. Die derzeit verfolgte so genannte Y-<strong>Trasse</strong> lässt keinerlei Vorteile<br />
für den gesamten Großraum Braunschweig erkennen. Entgegen allen Zusagen scheinen<br />
weiterhin die Schienenverbindungen in, von und nach Hannover vorrangig ausgebaut zu werden,<br />
an<strong>statt</strong> nunmehr vor allem Maßnahmen in den übrigen Teilen des Landes bevorzugt umzusetzen.<br />
Der ZGB (Zweckverband Großraum Braunschweig, Anm. des Verfassers) wird daher außerdem<br />
darum gebeten, sich bezüglich des Schienenwegeausbaus dafür einzusetzen, dass vorrangig<br />
Maßnahmen außerhalb des Großknotens Hannover, d.h. auch im östlichen Teil Niedersachsens,<br />
durchgeführt werden. [NVPZGB, 2003, (S)]<br />
Das dieses Problem nach Antwort des Zweckverbands Großraum Braunschweig im Regionalen<br />
Raumordnungsprogamm abzuhandeln ist, ist sicher auch der Stadt Braunschweig bewußt und<br />
hier auch nicht das Problem. Die Bedeutung der Raumordnung wird erkennbar: Es ist ein<br />
Hinweis, dass die „gleichwertigen Lebensbedingungen“ keine leere Floskel sind, die von den<br />
jeweiligen Bundes- und Landesregierungen auch zu berücksichtigen sind.<br />
6.3 Lösungsvarianten (systemische Betrachtung)<br />
„Das systemrelevante Hauptziel muss immer die Erhöhung und Sicherung der Lebensfähigkeit<br />
eines Systems sein.“ [Vester, 2000, S. 49]<br />
Dabei ist es unerheblich, ob es sich dabei um ein „Eisenbahnsystem“ oder um das System der<br />
Umwelt, in der wir leben, handelt.<br />
„Allzu gerne lässt man sich dazu verführen, zurückliegende Entwicklungen in die Zukunft zu<br />
extrapolieren und das Ergebnis als Entscheidungshilfe zu nutzen. Der Grund dafür ist nicht nur,<br />
dass Hochrechnungen für statistische Phänomene durchaus tauglich sind, sondern dass sie auch<br />
für komplexe Systeme unter bestimmten Umständen und für bestimmte Zeiträume aussagekräftig<br />
sein können. Warum? Weil sich komplexe Systeme in zwei Fällen wie eine Maschine verhalten.<br />
Erstens in Wachstumsphasen und zweitens auch innerhalb eines kurzen Zeithorizonts. In beiden<br />
Fällen ist ihre Entwicklung in der Tat durch Extrapolation determinierbar.“ [ebd, S. 86]<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 47
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Als Beispiel kann hier der „Neue Markt“ bzw. die T-Aktie herhalten, die selbst bei 95 Euro von so<br />
genannten „Experten“ noch zum Kauf empfohlen wurde, die sich heute den Kurs von unter 14<br />
Euro nicht erklären können. Aus diesem Grund sind auch die Verkehrsprognosen kritisch zu<br />
betrachten. Das Wachstum kann auch hier plötzlich vorbei sein. Dieses kann schon heute, aber<br />
auch erst in 5 oder 10 Jahren sein. Aber auch der Mensch, der mit einer erhöhten<br />
Körpertemperatur von 3 Grad krank, mit erhöhten 6 Grad extrapoliert „doppelt so krank“, real<br />
dagegen längst tot ist, kann als Beispiel herhalten.<br />
(Frage: Wo liegt dieser (tödliche) Grenzwert des Verkehrswachstums bzw. der Verkehrsmenge?)<br />
Biokybernetische Grundregeln<br />
Dem Kriterium der Lebensfähigkeit liegen acht biokybernetische Grundregeln zugrunde, deren<br />
Befolgung, verbunden mit einem vernetzten Denken, bereits die gröbsten Planungsfehler<br />
vermeiden hilft. Damit kann dann systemverträglich und der Vernunft des Menschen angemessen<br />
gehandelt werden. Regel 2, 3 und 5 lauten beispielsweise [Vester, 2000, S. 130ff]:<br />
Regel 2: Die Systemfunktion muss vom quantitativen Wachstum unabhängig sein.<br />
(Diese Regel spricht nicht gegen Wachstum als solches, sondern warnt vor der Abhängigkeit davon!)<br />
Regel 3: Das System muss funktionsorientiert und nicht produktorientiert arbeiten.<br />
(Das System muss auch bei veränderter Nachfrage überleben.)<br />
Regel 4: Nutzung vorhandener Kräfte nach dem Jiu-Jitsu-Prinzip <strong>statt</strong> Bekämpfung nach<br />
der Boxer-Methode.<br />
Regel 5: Mehrfachnutzung von Produkten, Funktionen und Organisationsstrukturen.<br />
Nach diesen biokybernetischen Grundregeln, die für alle Systeme - biologische, wirtschaftliche ,<br />
ökologische, usw. - gelten, „verstößt“ die Y-<strong>Trasse</strong> gegen diese Grundregeln. Denn sie ist<br />
abhängig vom Wachstum, da sie nur so ihre Kosten - wenn überhaupt - wieder erwirtschaften<br />
kann (siehe Annahme BREIMEIER +70 % mehr Güterzüge). Sie ist produktorientiert (ICE) und<br />
lässt keine Mehrfachnutzung zu. Dieses zum einen durch die nicht mögliche Nutzung durch<br />
Güterzüge, wenn diese Nachfrage dringend benötigt wird (ab Nachmittags für Nord-Süd-<br />
Richtung) und zum anderen durch die fehlende Erschließung der Region, die dagegen mit der<br />
„Güterbahn“ erreicht wird. Die „Kraft“ „Transit- und Güterverkehr“ wird positiv genutzt,<br />
Niedersachsen mit hochwertiger Infrastruktur zu erschließen, <strong>statt</strong> mit der „Boxer-Methode“ eine<br />
neue Strecke zu bauen.<br />
Zusätzlich durchschneidet die Y-<strong>Trasse</strong> bisher zusammenhängende Systeme (Naturräume), die<br />
von uns Menschen als besonders wertvoll eingestuft werden (Naturschutzgebiete).<br />
Aus diesen Gründen ist die Y-<strong>Trasse</strong> „systemfeindlich“ und daher strikt abzulehnen. Eine Variante<br />
der Güterbahn ermöglicht dagegen systemkonformes Vorgehen: Entsprechend dem Wachstum<br />
kann ausgebaut werden, z. B. zuerst nur die vorhandenen eingleisigen Strecken elektrifizieren.<br />
Bleibt dann das Wachstum aus, muss zum einen nicht weiter ausgebaut werden und zum<br />
anderen war der bisherige Ausbau keine Fehlinvestition, da die Region auf einem qualitativ<br />
höheren Niveau erschlossen ist. Steigt der Verkehr dann doch stark an, kann in „kleinen“<br />
Schritten weiter ausgebaut werden.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 48
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Fehler im Umgang mit komplexen Systemen<br />
Der Systempsychologe Dietrich DÖRNER hat eines der interessantesten Experimente bezüglich<br />
unserer Unfähigkeit, Probleme in komplexen Systemen zu lösen, 1975 an Hand der fiktiven<br />
afrikanischen Region Tanaland durchgeführt und in seinem Buch Problemlösen als<br />
Informationsverarbeitung erstmals beschrieben. (nach [Vester, 2000, S. 35])<br />
Einige der sechs Fehler im Umgang mit komplexen Systemen nach Dörner sind (aus [Vester<br />
2000, S.36, 37]):<br />
„Erster Fehler: Falsche Zielbeschreibung<br />
Statt die Erhöhung der Lebensfähigkeit des Systems anzugehen, wurden Einzelprobleme zu lösen versucht.<br />
Das System wurde abgetastet, bis ein Mißstand gefunden war. Dieser wurde beseitigt. Danach wurde der<br />
nächste Mißstand gesucht und unter Umständen bereits eine Folge des ersten Eingriffs korrigiert. Man nennt<br />
so etwas Reparaturdienstverhalten. Die Planung geschieht ohne große Linie, einem Anfänger beim<br />
Schachspiel vergleichbar.<br />
Zweiter Fehler: Unvernetzte Situationsanalyse<br />
Einige Versuchspersonen waren immer damit beschäftigt, große Datenmengen zu sammeln, die zwar<br />
enorme Listen ergaben, jedoch zu keinem Gefüge führten. Aufgrund fehlender Ordnungsprinzipien - etwa<br />
Rückkopplungskreisen, Grenzwerten usw. - gelang dabei natürlich keine sinnvolle Auswertung der<br />
Datenmassen. Auf die Erfassung des kybernetischen Charakters des Systems - beispielsweise seiner<br />
historischen Genese - wurde verzichtet. Die Dynamik des Systems blieb auf diese Weise unerkannt.<br />
Dritter Fehler: Irreversible Schwerpunktbildung<br />
Man versteift sich einseitig auf einen Schwerpunkt, der zunächst richtig erkannt wurde. Er wurde jedoch zum<br />
Favoriten. Aufgrund der ersten Erfolge biß man sich an ihm fest und lehnte andere Aufgaben ab. Dadurch<br />
blieben schwerwiegende Konsequenzen des Handelns in anderen Bereichen oder gar vorhandene Probleme<br />
und Mißstände unbeachtet.“<br />
Auf die Y-<strong>Trasse</strong>n-Planung angewendet: Das Einzelproblem „Engpass Stelle - Lüneburg“ wurde<br />
erkannt und der Favorit zur Lösung ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke für 300 km/h. Obwohl<br />
Kapazitäten für den Güterverkehr benötigt werden, versteift man sich einseitig auf diese „300<br />
km/h - Strecke“. Eine vernetzte Analyse findet nicht <strong>statt</strong>, da immer nur der Abschnitt Stelle -<br />
Celle betrachtet wird, ohne die Engpässe oder angrenzenden Systeme wie den „Knoten<br />
Hamburg“ oder den „Doppelknoten Hannover - Lehrte“ zu betrachten. Für den Fall der<br />
Realisierung der Y-<strong>Trasse</strong>, wird ein irreversibler Schwerpunkt gebildet. Für Bereiche „außerhalb“<br />
der Y-<strong>Trasse</strong> wird kein Geld mehr vorhanden sein. Die Y-<strong>Trasse</strong> wird bei Misserfolg nicht einfach<br />
verlegt werden können, z. B. wie ein Fahrzeug.<br />
6.4 Regional- und Güterverkehr auf Schnellfahrstrecken / Y-<strong>Trasse</strong><br />
Regional- und Güterverkehr auf SFS ist sicherheitstechnisch und betrieblich möglich, wie die<br />
Beispiele Hannover - Würzburg oder Hannover - Berlin zeigen. Auch ist nach der<br />
biokybernetischen Grundregel 5 „Mehrfachnutzung von Produkten, ...“ eine Mischnutzung<br />
durchaus „anzustreben“.<br />
Aber, nur weil es möglich ist, muss es nicht „sinnvoll“ oder wirtschaftlich sein. Aus Sicht der<br />
Grundregel 5 folgt die Frage: Wenn eine „Spezialstrecke“, ist sie dann systemverträglich, d. h. ist<br />
sie wirtschaftlich?<br />
Insgesamt sind hier unterschiedliche Fälle zu betrachten.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 49
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
(Personen-) Regionalverkehr<br />
Der Regionalverkehr findet zeitgleich mit dem Hochgeschwindigkeitsverkehr <strong>statt</strong>, so dass er<br />
gegenüber diesem auch mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ein Hindernis darstellt.<br />
Regionalverkehr auf SFS muss nicht grundsätzlich abgelehnt werden, wie auch z. B. [Andersen,<br />
2000, S. 520] ein Bedienungskonzept für den Abschnitt Stendal - Gifhorn - (ohne Halt) - Hannover<br />
vorstellt. Allerdings ist dieses kein „klassischer“ Regionalverkehr mehr, es ähnelt mehr einem<br />
IC(IR), der zum Teil öfters Hält und nur auf einem eher kurzen Abschnitt der SFS fährt. Damit<br />
wird weiterhin eine RB notwendig sein, die die kleineren Orte erschließt.<br />
Zusätzlich muss die Frage geklärt werden, wer die Kosten dieser möglicherweise zusätzlichen<br />
Regionalzüge trägt. Fallen diese unter den „Nahverkehr“, dann müssen die Aufgabenträger (oder<br />
andere „Sponsoren“, wie anliegende Kommunen) die Kosten übernehmen. Kann er<br />
eigenwirtschaftlich betrieben werden? Wer übernimmt dann das unternehmerische Risiko? Würde<br />
ein schneller „subventionierter“ Regionalverkehr auf der SFS nicht dem IC(IR) die Kunden<br />
entziehen?<br />
Die Möglichkeit, Regionalverkehr auf der Y-<strong>Trasse</strong> zu fahren, haben [IBS/ConTrack, 2001]<br />
untersucht. Danach ist Regionalverkehr möglich, allerdings mit starken Einschränkungen. Es fehlt<br />
hier leider eine Angabe zu den Kosten. Wie in Kap. 2.4 gezeigt, ist im Wettbewerb ein<br />
<strong>Trasse</strong>npreissystem notwendig. Nach Tab. 2-4 sind zum Teil nicht unerhebliche <strong>Trasse</strong>npreise zu<br />
zahlen. Nach Schätzung des Verfassers würde der <strong>Trasse</strong>npreis der Y-<strong>Trasse</strong> im derzeitigen<br />
<strong>Trasse</strong>npreissystem zwischen Fplus und F1 bei etwa 5,00 EUR/km liegen, sofern kein<br />
„politischer“ Preis „erzwungen“ wird. Da der Regionalverkehr auf der Y-<strong>Trasse</strong> keinen<br />
vorhandenen Nahverkehr ersetzt, müssten die Aufgabenträger diese Kosten zusätzlich<br />
übernehmen. Angesichts der Diskussion, dass die so genannten Regionalisierungsmittel eher<br />
gekürzt als erhöht werden, müsste hier aus dem Landeshaushalt bzw. den kommunalen<br />
Haushalten bezahlt werden.<br />
Güterverkehr<br />
Güterverkehr und Hochgeschwindigkeitsverkehr zeitgleich auf SFS führt neben<br />
Sicherheitsaspekten (Begegnungsproblematik) zu betrieblichen Problemen (siehe Kap. 2.5).<br />
Daher wird Güterverkehr nur außerhalb der Betriebszeit des Personenfernverkehrs durchgeführt<br />
werden können. Für die Y-<strong>Trasse</strong> ergibt sich nach [IBS/ConTrack, 2001] das Zeitfenster zwischen<br />
0 und 5 Uhr. In dieser Zeit ist der Bedarf an zusätzlichen Güterzugfahrplantrassen allerdings eher<br />
gering, bzw. kann auf der bestehenden Strecke abgewickelt werden.<br />
Anders sieht es beispielsweise auf der SFS Hannover - Würzburg aus. Auf Grund ihrer<br />
geografischen und „zeitlichen“ Lage kommen hier mehrere Relationen zusammen. Wenn bereits<br />
aus Hamburg nach Süden die Güterzüge die Strecke über Uelzen auslasten, wird auch die<br />
Strecke Hannover - Kreiensen - Göttingen durch diese Züge belegt sein, so dass die Güterzüge<br />
aus Richtung Bremen, Braunschweig oder aus Hannover warten müssten. Die Kapazitäten der<br />
SFS Hannover - Würzburg werden also real auch benötigt und auch belegt.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 50
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
6.5 Studien, Gutachten und Positionen<br />
6.5.1 Vorstudie der Vieregg & Rössler GmbH, München, 1993<br />
Das Planungsbüro VIEREGG & RÖSSLER GmbH aus München führte 1993 eine „Vorstudie über<br />
die Ausbaumöglichkeiten im Schienenverkehr zwischen Hamburg und Hannover“<br />
([Vieregg&Rössler, 1993]) durch. Auftraggeber waren der <strong>VCD</strong> Fachausschuss Bahn, <strong>VCD</strong> LV<br />
Hamburg und Pro Bahn LV Hamburg.<br />
Nach der Beschreibung der aktuellen Situation auf der Strecke Hamburg - Hannover werden u.a.<br />
folgende Argumente gegen die geplante Neubaustrecke aufgeführt:<br />
• Das sehr gute Angebotsniveau zwischen den norddeutschen Ballungszentren wird weiter<br />
„drastisch“ verbessert, während das Angebot im Nah- und Regionalverkehr weiterhin<br />
vernachlässigt wird.<br />
• Die neue Bahntrasse stellt eine völlige Neuzerschneidung der ökologisch sehr empfindlichen<br />
und topografisch bewegten Landschaft dar.<br />
• Mit der Heidebahn über Soltau und der Nebenstrecke Soltau - Celle liegen vorhandene<br />
Schieneninfrastrukturen weitgehend brach.<br />
• Die angeblich durchgeführten Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die Neubaustrecke im<br />
Vergleich zum Ausbau der Linie über Celle werden von der DB und vom Bundesministerium für<br />
Verkehr zur Geheimsache erklärt und können somit nicht nachvollzogen werden.<br />
Eine betriebliche Untersuchung der Y-<strong>Trasse</strong> erfolgt nicht.<br />
Sie legen folgendes Bedienungskonzept für den Abschnitt Hamburg-Harburg - Uelzen -<br />
Langenhagen zugrunde [ebd. S. 10,11] (Zuggattungen entsprechend der heutigen geändert):<br />
• alle 30 Minuten ein ICE der Relation Hamburg - Hannover - Süddeutschland mit Vmax = 230<br />
km/h,<br />
• jede Stunde ein ICE, gegenüber einem der beiden oben genannten ICE-Züge um 3 Minuten<br />
versetzt ist und die Relation Hamburg - Uelzen - Stendal - Berlin bedient,<br />
• jede Stunde ein IR mit Vmax = 200 km/h und Halt in Hamburg-Harburg, Winsen (Luhe),<br />
Lüneburg, Uelzen und Celle<br />
• jede Stunde ein RE mit Vmax = 160 km/h, der in Hamburg-Harburg, Winsen(Luhe), Lüneburg,<br />
Bad Bevensen, Uelzen, Suderburg, Unterlüß, Eschede, Celle und Langenhagen hält,<br />
• ab Hamburg-Harburg im Laufe einer Stunde 3 RB-Linien mit Vmax = 140 km/h, von denen<br />
eine bis Winsen (Luhe), eine bis Lüneburg und die eine bis Uelzen führt, wobei auch die<br />
Bahnhöfe Deutsch Evern und Bienenbüttel bedient werden.<br />
In den verbleibenden Fahrplantrassen verkehren möglichst viele Güterzüge, wobei als<br />
Mindestzahl pro Richtung gelten sollen:<br />
• zwischen (Maschen-) Stelle - Uelzen weiter Richtung Stendal 2 Güterzüge mit 1800 t, Vmax =<br />
90 km/h,<br />
• ab Lüneburg bis Celle 5 Güterzüge mit 1400 t und Vmax = 120 km/h.<br />
Für die auszubauenden Bahnstrecken Buchholz (Nordheide) - Soltau und Soltau - Celle wird für<br />
den Güterverkehr angesetzt:<br />
• jede Stunde zwei Güterzüge mit 1800 t, Vmax = 90 km/h und<br />
• einmal pro Tag ein Güterzug mit 5000 t (Erzzug) und Vmax = 90 km/h<br />
Die Infrastruktur sollte nach dieser Studie wie folgt ausgebaut werden:<br />
• Die Strecke Hamburg-Harburg - Uelzen - Celle wird für eine Streckenhöchstgeschwindigkeit<br />
von 230 km/h ertüchtigt, die Bahnhofsdurchfahrten Lüneburg, Uelzen und Celle werden so<br />
umgebaut, dass dort Durchfahrtgeschwindigkeiten von 200 km/h (Celle = 230 km/h) gefahren<br />
werden können. Damit kann die Fahrzeit Hamburg - Hannover um gute 10 Minuten reduziert<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 51
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
werden. In den Bahnhöfen Lüneburg und Uelzen müssen dazu sowohl die Kurvenradien<br />
vergrößert werden als auch der nach Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) zulässige<br />
Ausnahmewert der Überhöhung von ü ges = 310 mm eingebaut werden.<br />
(Anmerkung des Verfassers: Gemeint ist nach aktuellen Vorschriften der DB AG der Wert der<br />
ausgleichenden Überhöhung u 0 . Dieser setzt sich aus der Summe der eingebauten Überhöhung u und dem<br />
so genannten Überhöhungsfehlbetrag u f zusammen. Der Grenzwert von u o ergibt sich danach zu max u 0 =<br />
zul u + zul u f . Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden: Der so genannte Ermessensgrenzwert (bestimmt nach<br />
Grenzwerten der EBO) und der Genehmigungsbereich (nur durch Zustimmung der Zentrale bzw. durch<br />
Zulassung einer Ausnahme durch EBO). Der Genehmigungsbereich darf nur angewandt werden, wenn<br />
Sprungkosten oder Geschwindigkeitseinbrüche vermieden werden. Die derzeit gültigen Werte für Züge ohne<br />
Neigetechnik und Schotteroberbau sind: u 0, Ermessensgrenzwert = 290 mm und u 0, Zustimmungswert = 310 mm.<br />
Eine Genehmigung des Zustimmungswertes wird ausgeschlossen sein, so dass eine Erhöhung der<br />
Durchfahrgeschwindigkeit in Lüneburg und Uelzen auf 200 km/h nicht möglich ist bzw. durch eine weitere<br />
Vergrößerung der Kurvenradien erfolgen muss. Dieses dürfte auf Grund des fehlenden Platzes eher<br />
schwierig zu realisieren sein. Der Einbau des Ermessensgrenzwertes, wie auch des Zustimmungswertes,<br />
führt auf Grund des Mischbetriebs zu erhöhten Unterhaltungskosten des Netzes.)<br />
• Fahrstraßenkreuzungen werden durch Überwerfungsbauwerke beseitigt.<br />
• Bei einer Streckengeschwindigkeit von 200 km/h und einer Erhöhung der<br />
Durchfahrtsgeschwindigkeiten in den Bahnhöfen von Lüneburg, Uelzen und Celle von heute<br />
120 km/h auf 160 km/h (200 km/h) ergeben sich auf Grund der reduzierten / wegfallenden<br />
Beschleunigung geringere Energieverbrauchswerte von (beide Richtungen) -8 % (-19 %).<br />
• Für den Güterverkehr wird die Strecke Marxen - Lüneburg reaktiviert, zweigleisig ausgebaut,<br />
elektrifiziert und mit einer Verbindungskurve an die Güterbahn Maschen - Marxen - Buchholz<br />
(Nordheide) angeschlossen (Länge 32 km). Die Alternative, der viergleisige Ausbau Stelle -<br />
Lüneburg ist weniger vorteilhaft, da z. B. die Besiedlung entlang der Strecke wesentlich dichter<br />
ist. Der Ausbau Stelle - Lüneburg sollte daher unterbleiben.<br />
• Ebenfalls für den Güterverkehr wird die Strecke Buchholz (Nordheide) - Soltau - Celle<br />
ausgebaut (zu 40 % zweigleisig) und elektrifiziert<br />
• Zur Erreichung der hohen Streckenleistungsfähigkeit muss ungefähr sieben Kilometer nördlich<br />
von Celle ein viergleisiger Abschnitt bestehen. Dieses entspricht praktisch der Zweigleisigkeit<br />
der Strecke Soltau - Celle in diesem Bereich.<br />
• Ein optionales, zusätzliches Gleis von Suderburg bis sieben Kilometer vor Celle würde sechs<br />
Güterzug-Überholungshalte pro Stunde (beide Richtungen) überflüssig machen, aber keine<br />
zusätzlichen Güterzug-Fahrplantrassen schaffen.<br />
Die Kapazität im Güterverkehr zwischen Maschen - Marxen - Lüneburg und Celle wird mit dann<br />
130 Zügen pro Tag und Richtung angegeben, eine Steigerung gegenüber dem Status-Quo von<br />
(130 - 100 =) 30 Güterzügen. Die Kapazität auf der Strecke (Maschen-) Buchholz(Nordheide) -<br />
Soltau - Celle beträgt bei dem vorgestellten Ausbaukonzept umgerechnet 48 Züge pro Tag und<br />
Richtung, so dass sich insgesamt eine Kapazitätssteigerung im Güterverkehr von 100 auf 178<br />
ergibt.<br />
Die Gesamtkosten für die rund 87 km lange Y-<strong>Trasse</strong> im Abschnitt Scheeßel - Langenhagen<br />
werden mit (umgerechnet) 797,62 Mio. EUR angegeben (bei 9,20 Mio. EUR pro Kilometer<br />
Neubaustrecke im Flachland).<br />
Die Gesamtkosten für die vorgestellte Alternative liegen bei 634,00 Mio. EUR.<br />
Der im Anhang der Vorstudie befindliche Bildfahrplan für die Strecke Hamburg-Harburg -<br />
Hannover-Langenhagen weist folgende „Besonderheiten“ auf:<br />
• Die RB-Linie Hamburg-Harburg - Winsen (Luhe) wird unterwegs vom RE überholt, die anderen<br />
beiden RB-Linien jeweils von den ICE-Linien, so dass sich Aufenthaltszeiten von bis zu 8<br />
Minuten ergeben.<br />
• Der IR und der RE werden in Uelzen zur gleichen Zeit vom ICE überholt, so dass sich für den<br />
IR eine Aufenthaltszeit von ca. fünf Minuten, für den RE von ca. 13 Minuten ergibt. In Uelzen<br />
sind damit mindestens drei Gleise vom Nord-Süd-Verkehr belegt.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 52
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
• Der IR und der RE fahren im Abschnitt Hamburg-Harburg - Uelzen im Abstand von ca. 10<br />
Minuten, der RE und die RB im Abschnitt Lüneburg - Uelzen im Abstand von ca. 6 Minuten.<br />
Wertung<br />
Eine in sich schlüssige und relativ gute Vorstudie, die aufzeigt, dass auch ohne Y-<strong>Trasse</strong> eine<br />
deutliche Kapazitätssteigerung zwischen Hamburg und Hannover erreicht werden kann. Die<br />
optische Gestaltung und Lesbarkeit ist dagegen (leider) nicht überzeugend. Interessant ist die<br />
„Forderung“ nach Überwerfungsbauwerken, die in Deutschland bisher nicht üblich sind und durch<br />
die Vermeidung von höhengleichen Kreuzungen zusätzliche Kapazitäten schaffen.<br />
Zu berücksichtigen ist insgesamt, dass für diese Vorstudie seitens der Auftraggeber nur ein enger<br />
Finanzrahmen zur Verfügung gestellt werden konnte.<br />
6.5.2 „Das intelligente Netz“, 1996<br />
Das Konzept „Das intelligente Netz“ - Ein integriertes Konzept für Regional-, Fern- und<br />
Güterverkehr auf der Schiene in Nordniedersachsen ohne „Y“ und Transrapid“ - wurde 1996 von<br />
folgenden Verbänden / Gruppierungen ausgearbeitet:<br />
- PRO BAHN LV Hamburg-Schleswig-Holstein<br />
- BUND LV Niedersachsen e.V.<br />
- BUND KV Soltau-Fallingbostel<br />
- <strong>VCD</strong> KV Soltau-Fallingbostel<br />
- <strong>VCD</strong> LV Hamburg<br />
Es übernimmt die Vorschläge der Vorstudie von [Vieregg&Rössler, 1993] und ergänzt diese um<br />
eine so genannte versetzte Dreigleisigkeit im Abschnitt Hamburg-Harburg - Lüneburg, damit dort<br />
die Probleme behoben werden, d. h. zweigleisiger Ausbau Stelle - Marxen - Lüneburg (für den<br />
Güterverkehr) und versetzte Dreigleisigkeit Stelle - Winsen (Luhe) - Lüneburg (für den<br />
Nahverkehr). Zusätzlich sind u.a. Kapitel mit folgenden Überschriften eingefügt:<br />
- Einleitung - Welchen Verkehr wollen wir?<br />
- Straßenbau im südlichen Bereich von Hamburg<br />
- Fahrzeuge und Transportsysteme für den Bahnverkehr<br />
- Gestaltung der Bahnhöfe für einen attraktiven Bahnverkehr<br />
Angesprochen werden auch die sehr wichtigen Aspekte der Verkehrsvermeidung<br />
(Siedlungsstrukturen, die Wohnen und Arbeiten trennen, Kartoffeln, die zum Waschen hin- und<br />
zurücktransportiert werden) oder auch die Forderung nach Schaffung von gleichen Spielregeln für<br />
alle Verkehrssysteme.<br />
Aussagen zu Kapazitätssteigerungen werden nicht gegeben.<br />
Eine nähere Inhaltsbeschreibung soll hier entfallen. Auf einzelne Sätze bzw. Aussagen soll<br />
allerdings eingegangen werden, da sie zum Teil grundsätzlich falsch sind bzw. die Qualität der<br />
Arbeit in Frage stellen.<br />
Aussage S. 3 und 22:<br />
„Wir sind der Auffassung, dass die rund 2,3 Milliarden DM, die für das „Y“ veranschlagt werden,...“<br />
„Mit etwa 600 Millionen DM hätte man mehr für Nah-, Fern- und Güterverkehr erreicht, als mit 3<br />
Mrd. DM für die Y-<strong>Trasse</strong>.“<br />
Aussage [Vieregg&Rössler, 1993, S. 24]: „[...] für die rund 87 km lange Y-<strong>Trasse</strong> [...] mit Kosten<br />
von 1560 Mio. DM gerechnet werden muss.“<br />
Im „intelligenten Netz“ werden die Vorschläge von [Vieregg&Rössler, 1993] übernommen und um<br />
die versetzte Dreigleisigkeit erweitert. Nach der Aussage von S. 22 werden dafür 600 Millionen<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 53
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
DM benötigt. [Vieregg&Rössler, 1993, S. 24] setzen ohne die Dreigleisigkeit 1240 Millionen DM<br />
an.<br />
Aussage S. 5:<br />
„Dies kann zusammen mit dem Einsatz der Neigetechnik sowie Verbesserungen bei der<br />
Zugführung (CIRELKE) (Computer Integrated Railroading - Erhöhung der Leistungsfähigkeit im<br />
Kernnetz, Anm. des Verfassers) zu einer erheblichen Reduzierung der Reisezeiten im Nah- und<br />
Fernverkehr beitragen. [...] Zur Minimierung des Flächenverbrauchs setzen wir auf den Einsatz<br />
der Neigetechnik und Ausbau bestehender Strecken <strong>statt</strong> Neubau von reinen<br />
Hochgeschwindigkeitstrassen mit großen Radien und Tunneln.“<br />
In einem sehr interessanten Artikel im Eisenbahn-Kurier kommen Lanz und Hardebber bereits<br />
1992 zu dem Ergebnis:<br />
„Die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der großen Verkehrskorridore ist nicht mit einem<br />
Simsalabim namens CIR zu erreichen, sondern allein durch die Trennung des schnellen<br />
Reiseverkehrs vom langsamen Güterverkehr. Dabei sind offensichtlich die Möglichkeiten,<br />
bestehende Nebenfernstrecken, die früher oftmals einen beträchtlichen Teil des Fernverkehrs<br />
bewältigt haben, oder Nebenbahnen durch einen vielleicht nur vergleichsweise bescheidenen<br />
Ausbau in ihrer Leistungsfähigkeit deutlich zu steigern und dem überregionalen Güterverkehr<br />
nutzbar zu machen, noch längst nicht ausgeschöpft.“ [Lanz, Hardebber, 1992, S. 45]<br />
Ihr Artikel baut auf Untersuchungen der Strecke Hamburg - Hannover auf. Davon abgesehen,<br />
erhöht CIR nicht automatisch die Streckenhöchstgeschwindigkeit.<br />
Zur Neigetechnik sei [Kügler, Lorenzen, 2002, S. 127] zitiert: „In der Literatur zur Neigetechnik ist<br />
immer wieder zu lesen, dass mit Neigetechnik Fahrzeitverkürzungen bis zu 30 % erzielt werden<br />
können. Diese Aussage ist grundlegend falsch. Maßgebend für die möglichen<br />
Fahrzeitverkürzungen sind in erster Linie der im Gleis vorhandene Bogenhalbmesser sowie die<br />
vorhandene Überhöhung. [...] Die Bandbreite der Geschwindigkeitserhöhungen NeiTech z.B. auf<br />
der Linie 8 Berlin - München betragen im zügig trassierten Flachland-Abschnitt Erlangen -<br />
Lichtenfels ∆v = 0 km/h [...] und im engbogigen Abschnitt Hochstadt-Markzeuln - Saalfeld bis zu<br />
∆v = 40 km/h.“<br />
Zu diesen Flachland-Abschnitten können auch die Strecken im „intelligenten Netz“ gezählt<br />
werden, die hier auch keine Tunnel erfordern.<br />
Die favorisierten Neigetechnikzüge sind systembedingt relativ eng im Fahrgastraum. Für den<br />
Fahrgast zählen aber auch Komfort. Beim ICE1 „gelang es, [...], die Fahrzeuge um 18 cm breiter<br />
und damit wesentlich komfortabler zu bauen als die klassischen Wagen gleicher Länge (Leider<br />
wurde dies bei der neuesten, dritten Generation der ICE-Fahrzeuge aufgegeben!)“ [Bodack, 2002,<br />
S. 199]<br />
Wertung<br />
Das Konzept „Das intelligente Netz“ ist in der Ausführung leider mangelhaft, wodurch die gute<br />
Absicht und die prinzipiell richtigen Ziele dieser Arbeit etwas zunichte gemacht werden. Außerdem<br />
sind keine weiteren zusätzlich verwertbaren Informationen vorhanden, so dass bei Bedarf nur auf<br />
das „Original“ - [Vieregg&Rössler, 1993] - zurückgegriffen werden sollte.<br />
6.5.3 Position des Vereins Pro Bahn, LV Niedersachsen e.V.<br />
Der Landesverband Niedersachsen des Vereins Pro Bahn hat auf seiner Internetseite www.pro-<br />
Bahn.de/niedersachen (Stand Ende 2002) ein Themenpapier zur „Verbesserung des<br />
Schienenverkehrs zwischen Hannover und Hamburg/Bremen“ veröffentlicht.<br />
Im Kapitel A werden die Problemlagen dargestellt. Die Kapazität des Fernstreckennetzes hat<br />
erhebliche Engpässe vor allem auf den Strecken Hamburg - Hannover, Hannover - Wunstorf und<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 54
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Verden - Bremen. „Zusätzliche Züge lassen sich, obwohl erforderlich, nicht oder nicht in der<br />
erforderlichen Qualität unterbringen“, obwohl sie dringend benötigt werden, zumindest in der<br />
Hauptverkehrszeit. Andererseits würden zusätzliche Fernzüge die Qualität des bestehenden<br />
Nahverkehrs beeinträchtigen. Dieses wird durch die Einführung eines Integralen Taktfahrplans<br />
(ITF) noch verschärft werden, da die „Nahverkehrszüge nicht mehr einfach in die Taktlücken des<br />
Fernverkehrs geschoben werden können.“<br />
Die nächste Problemlage ist „die Qualität der Anbindung der Heideregion im Schienenverkehr, die<br />
mehr als bescheiden ist“, wobei ein unmittelbarer Zugang zum Fernverkehr nicht besteht. Die<br />
Ost-West-Strecke von Uelzen - Soltau - Bremen wird zwar durch vorgesehene Elektrifizierung<br />
verbessert, die Eingleisigkeit beschränkt allerdings die Kapazität. „Vor allem aber verlaufen die<br />
wesentlich bedeuteren Verkehrsströme in Nord-Süd-Richtung, nämlich auf Hamburg und<br />
Hannover zu.“ Die Einführung eines ITF für die Heideregion reicht bei weitem nicht aus, da nach<br />
Untersuchungen des Landes gezeigt haben, „dass trotz der damit verbundenen Verbesserungen<br />
in Reisezeit und Anschlussbindungen (gemeint wahrscheinlich Anschlussverbindungen, Anm. des<br />
Verfassers) einschließlich eines „Vollknotens“ Soltau die Zahl der Reisenden [...] allein bis zum<br />
Jahr 2005 nur wenig zunimmt. [...] Hier müssen andere Maßnahmen wie z.B. eine<br />
Fernverkehrsanbindung oder sprunghaft verkürzte Reisezeiten dazukommen, die geeignet sind,<br />
den erforderlichen Quantensprung für die Heideregion zu erreichen.“<br />
Als letzte Problemlage wird die „erzielbare Reisegeschwindigkeit“ behandelt. Durch die<br />
Beschleunigung des Fernverkehrs sollen Verlagerungseffekte hin zur Bahn erfolgen. Verwiesen<br />
wird hier auf die Autobahn A7, auf der sich der Verkehr nach Eröffnung der parallelen<br />
Schienenschnellfahrstrecke Hannover - Würzburg rückläufig entwickelt hat, während er sich<br />
landesweit erhöht hat. Auch auf neuere Untersuchungen wird hingewiesen, nach denen der<br />
innerdeutsche Kurzstrecken-Flugverkehr insbesondere in Relationen des Bahn-<br />
Hochgeschwindigkeitsverkehrs „deutlich wegbricht“. Daher muss die künftige Struktur des<br />
Eisenbahnnetzes in der Region auch übergeordnete Gesichtspunkte mit berücksichtigen.<br />
Im Kapitel B werden bisherige Ansätze zur Lösung der Probleme vorgestellt. Eine Ausbauvariante<br />
unter Nutzung der Heidebahn von Hannover bis Walsrode scheiterte am Protest der betroffenen<br />
Orte gegen befürchteten Lärm, Eingriffe in die Bausubstanz und Zerschneidungswirkungen in den<br />
Orten. Diesem Protest fiel auch das zweite Gleis des letzten Abschnitts der S-Bahn Hannover -<br />
Bennemühlen zum Opfer. Daher wurde eine ortsferne <strong>Trasse</strong>, möglichst entlang der Autobahn<br />
gefordert, die wiederum auch wieder abgelehnt wurde, u.a. von den Grünen und<br />
Umweltverbänden, da sie in die Natur und Landschaft eingreift und die Region nicht erschließt.<br />
Seit 1997 wird von der Landesregierung ein Raumordnungsverfahren für eine Form der Y-Strecke<br />
durchgeführt. Als Alternative von Verkehrs- und Umweltverbänden wird die Ausarbeitung „Das<br />
intelligente Netz“ vorgestellt, an der auch Pro Bahn mitgearbeitet hat.<br />
Im letzten Kapitel führt der Pro Bahn-Landesverband Niedersachsen eine Bewertung durch.<br />
Pro Bahn sieht unter „1.“ die Notwendigkeit einer Erhöhung der Kapazität der Strecken im<br />
Städtedreieck Hannover / Hamburg / Bremen. Dabei werden unter „2.“ auch die nutzbaren<br />
Vorteile durch eine Reduzierung der Reisezeiten gesehen, „die soweit vertretbar genutzt werden<br />
sollten, um zu Verlagerungen auf die Schiene zu kommen, wie sie nach Inbetriebnahme der<br />
Neubaustrecke Hannover - Würzburg eingetreten sind.<br />
3. PRO BAHN steht zum Prinzip des Integralen Taktfahrplans, [...]. Dabei entsteht aufgrund der<br />
jeweils unterschiedlichen Anforderungen eine Konkurrenz in der <strong>Trasse</strong>nnutzung und damit eine<br />
Verstärkung von Kapazitätsproblemen, die beseitigt werden müssen.<br />
4. PRO BAHN fordert eine attraktive Einbindung des bisher bahnseitig schlecht erschlossenen<br />
Heidebereiches [...], um so deutliche Anreize zum Umsteigen [...] auf die Schiene in einer bislang<br />
extrem autoorientierten Region zu schaffen. Hierzu reicht ein ITF allein nicht aus.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 55
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
5. Das zum Erreichen des Zieles ausgearbeitete Alternativkonzept „Das intelligente Netz“<br />
erscheint dabei angesichts der gegenwärtigen Sachlage in der vorliegenden Form nicht<br />
durchsetzungsfähig“, da die selbstgesetzten Ziele einer Entmischung der Verkehre nicht erreicht<br />
wird, da von Hamburg bis Uelzen weiterhin alle Zuggattungen verkehren. „Die gewonnenen<br />
Kapazitäten werden höchstens eine kurzfristige Entspannung bringen, nicht jedoch den<br />
erforderlichen Durchbruch für eine schienenorientierte Vorwärtsstrategie.“<br />
„Der geforderte 2-gleisige Ausbau der Heidebahn bringt mindestens ebenso viele innerörtliche<br />
Konflikte, wie die einstmals in der Diskussion befindliche nahverkehrsverträgliche <strong>Trasse</strong>nvariante<br />
für das Y. Die Verschiebung gerade des sehr lauten Güterverkehrs, der sich zudem überwiegend<br />
nachts abspielt, auf eine neue, bislang lärmarme <strong>Trasse</strong> durch das Erholungsgebiet der Heide<br />
wird für eine konfliktreiche und nicht wünschenswerte Strategie gehalten.“<br />
„6. PRO BAHN setzt sich daher für eine offene Diskussion über den Bau und die Streckenführung<br />
auch einer schwerpunktmäßig für den schnellen Fernverkehr gebauten Neubaustrecke ein, unter<br />
Berücksichtigung aller Verkehrs- und Umweltbelange.“<br />
Dabei sollten nach „7.“ auch die Vorteile einer solchen Bahnbaumaßnahme , wie die Anbindung<br />
der Heideregion an den Interregioverkehr und die übergeordneten Netzfunktionen bewertet<br />
werden.<br />
8. Wichtige Ansätze und Impulse des Konzeptes „Das intelligente Netz“ sollen einbezogen<br />
werden, wie etwa Streckenverbesserungen auf bestehenden Strecken, der Bau eines dritten<br />
Gleises zwischen Hamburg und Lüneburg oder eine verbesserte Signaltechnik. „Diese<br />
Maßnahmen werden jedoch von PRO BAHN zusätzlich für erforderlich gehalten und ersetzen<br />
nicht die Diskussion um die Y-Strecke, deren Finanzierung gegenwärtig völlig offen ist.“<br />
9. „Im Sinne einer Eingriffsminimierung ist bei einem Streckenneubau eine Bündelung von<br />
Verkehrswegen, etwa mit der Autobahn A 7 wünschenswert. [...].<br />
10. PRO BAHN Niedersachsen wird sich daher an einer Diskussion über den künftigen<br />
Ausbaubedarf des Bahnnetzes einschließlich einer Neubaustrecke und deren Streckenverlauf<br />
konstruktiv beteiligen.“<br />
Wertung<br />
Auf Kritikpunkte, die sich aus den vorherigen Kapiteln ergeben, wird hier nicht mehr eingegangen.<br />
Eine „brauchbare“ Lösung bzw. einen eindeutigen Standpunkt vertritt Pro Bahn nicht, es gibt<br />
immer ein „sowohl als auch“, auf der Suche nach der „eierlegenden Wollmilchsau“.<br />
Insgesamt fällt die „Fixierung“ auf das Kriterium „Geschwindigkeit“ bzw. „Reisezeitverkürzung“<br />
auf. Was fehlt, ist ein Gesamtkonzept, in dem die „Geschwindigkeit“ nur ein Aspekt von vielen ist.<br />
So basiert das Konzept der LNVG, das in den beiden Broschüren [LNVG, 5/2001] - Zeit für<br />
Bahnhöfe - und [LNVG, 11/2001] - Niedersachsen ist am Zug! - dokumentiert ist auf mehreren<br />
Säulen: Ausbau der bestehenden Infrastruktur, vertaktetes Angebot, zum Teil erweitert, moderne<br />
Bahnhöfe und Haltestellen und moderne Fahrzeuge. Der Erfolg zeigt sich beispielsweise im<br />
Teilnetz Weser-Ems mit der NordWestBahn oder bei der von DB Regio betriebenen S-Bahn<br />
Hannover.<br />
Kapitel A:<br />
Hat der Ausbau der Strecke Uelzen - Soltau - Bremen zu unterbleiben, weil die wesentlich<br />
bedeutenderen Verkehrsströme anders verlaufen? Davon abgesehen, ist für diese Strecke bis<br />
2003 nur die Ertüchtigung für Vmax = 120 km/h geplant. Die dritte Baustufe - die Elektrifizierung -<br />
ist wie die zweite Baustufe - Installation neuer Signal- und Sicherungstechniken - zeitlich noch<br />
nicht definiert. [LNVG, 2001, S. 8]<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 56
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Die „kapazitätsbeschränkende Eingleisigkeit“ ist auch auf den NordWestBahn-Strecken<br />
vorhanden. Trotzdem hat sie Erfolg. Bezogen auf die Kapazität ist anzumerken, dass in diesem<br />
Fall nicht die Eingleisigkeit das (primäre) Problem darstellt, sondern die Anzahl und Lage der<br />
Kreuzungsstellen in Verbindung mit dem Betriebskonzept.<br />
Die Verweise bzw. Argumentation auf den „Wegbrechenden innerdeutschen Kurzstrecken-<br />
Flugverkehr / Verlagerung von der A7 auf die Eisenbahn durch SFS Hannover - Würzburg“ und<br />
die „übergeordneten Gesichtspunkte des regionalen Eisenbahnnetzes“ sind etwas problematisch<br />
und zu pauschal. Zum einen wird die Y-<strong>Trasse</strong> in flugzeugrelevanten Relationen (z. B. Hamburg /<br />
Hannover - Frankfurt / Stuttgart / München) nur unwesentliche bzw. keine Reisezeitverkürzung<br />
ergeben (im Gegensatz zur SFS Hannover - Würzburg) und zum anderen ist damit die Forderung<br />
verbunden, „aus übergeordneten Gesichtspunkten“ Göttingen, Kassel und Fulda konsequent als<br />
ICE-Systemhalt zu streichen, um Potenziale vom Flugverkehr abschöpfen zu können. Damit wäre<br />
allerdings eine deutliche Schwächung dieser Regionen verbunden. Die Y-<strong>Trasse</strong> ist eine reine<br />
Transittrasse innerhalb der Region Lüneburger Heide. Insofern kann sie nicht als Teil des<br />
regionalen Eisenbahnnetzes gelten.<br />
Kapitel B:<br />
Als Lösung des Problems wird praktisch nur die Y-<strong>Trasse</strong> und als Alternative „Das intelligente<br />
Netz“ erwähnt. Dieses wiederum wird in Kapitel C Punkt 5 „abgeschrieben“ und nach Punkt 8<br />
sollen wenigstens wichtige Ansätze und Impulse übernommen werden.<br />
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass eigentlich jede Ausbauvariante abgelehnt wird,<br />
auch der Ausbau der bestehenden Strecken.<br />
Kapitel C:<br />
zu 3.: Ein ITF ergibt Kapazitätsprobleme allenfalls an den Knotenpunkten, nicht auf der Strecke.<br />
zu 4.: Der ITF reicht allein zur Erschließung des Heidebereichs nicht aus. Der Ausbau der<br />
Heidebahn wird unter 5. indirekt aber abgelehnt. Frage: Was muss dann erfolgen? Wie ist der<br />
Erfolg der NordWestBahn dann zu erklären? Ebenfalls ländlicher Bereich, „nur“ Vmax von 120<br />
km/h und „nur“ Stundentakt mit Verdichtung.<br />
zu 5.: „Das intelligente Netz“ bzw. [Vieregg&Rössler, 1993] errechnen eine Kapazitätssteigerung<br />
für den Güterverkehr von 78 %. Dieses als „kurzfristige Entspannung“ zu bezeichnen entbehrt<br />
jeder Grundlage. Frage: Was wäre für den „erforderlichen Durchbruch“ notwendig?<br />
Konflikte beim Ausbau von Bahnstrecken wird es immer geben, ob es sich um den Ausbau einer<br />
reinen SPNV-Strecke handelt oder um eine reine SPFV-Strecke. Beim Ausbau, der die Region<br />
erschließt, können auch die Gegner von heute, morgen die Vorteile der Schiene für sich<br />
entdecken (siehe z.B. S-Bahn Hannover - Bennemühlen).<br />
Der Lärm ist ein Problem, der allerdings auch bei einer Neubaustrecke besteht. Hier muss<br />
selbstverständlich vorgesorgt werden.<br />
zu 7.: Soll eine Neubaustrecke mit einem Interregio-Halt die Region erschließen, so ist dieser nur<br />
sinnvoll, wenn er an einem vorhandenen „Innenstadtbahnhof“ hält. Damit muss die<br />
Neubaustrecke auch entlang von dichtbesiedeltem Gebiet geführt werden oder verlangt lange neu<br />
zu bauende Verbindungsstrecken.<br />
zu 8.: In 1. wird die Notwendigkeit gesehen, die Kapazität zu erhöhen, in 5. wird das „intelligente<br />
Netz“, das die Vorschläge von [Vieregg&Rössler, 1993] übernimmt und eine Alternative zur Y-<br />
<strong>Trasse</strong> ist, als nicht durchsetzungsfähig bzw. ungeeignet (...werden die selbstgesetzten Ziele ...<br />
nicht erreicht,...) bezeichnet und unter 8. wird festgestellt, dass die Finanzierung der Y-Strecke<br />
gegenwärtig völlig offen ist. Schlussfolgerung, siehe Punkt 6 bzw. 10: PRO BAHN kann zur Zeit<br />
nur eine offene Diskussion anbieten, aber (leider) kein diskussionswürdiges und auch praktisch<br />
umsetzbares Gesamtkonzept.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 57
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
6.5.4 Gutachten von IBS / ConTrack zum Nahverkehr auf der Y-<strong>Trasse</strong>, 2001<br />
Der Landkreis Soltau-Fallingbostel hat bei der Arbeitsgemeinschaft IBS / ConTrack<br />
(Ingenieurbüro für Bahnbetriebssysteme GmbH / Consulting - Gesellschaft für Schienenbahnen<br />
mbH) in Hannover ein Gutachten zu „Möglichkeiten der Nutzung der Aus-/Neubaustrecke<br />
Hamburg/Bremen - Hannover (Y-<strong>Trasse</strong>) für den Nah- und Regionalschienenverkehr“ in Auftrag<br />
gegeben. Dieser wurde im Dezember 2001 fertiggestellt und veröffentlicht [IBS/ConTrack, 2001].<br />
(siehe www.heidekreis.de/behoerden/straßenverkehrsamt/forum/y-trasse.html, Stand Ende 2002)<br />
Aufgabenstellung<br />
Nachdem im Frühjahr 2001 die Bezirksregierung Lüneburg das Raumordnungsverfahren für die<br />
Y-<strong>Trasse</strong> mit der landesplanerischen Feststellung zugunsten der Variante 1 (von Hannover<br />
entlang der Autobahn A7 bis in den Raum Walsrode, von dort weiter nordwärts nach Lauenbrück<br />
zur bestehenden Strecke Bremen - Hamburg, Verbindungskurve an die Strecke Uelzen - Soltau<br />
(Han) - Langwedel - Bremen) abgeschlossen worden sind, „sollen für diese Variante<br />
Möglichkeiten für die regionale Verkehrserschließung und -anbindung im Schienenpersonen- und<br />
-güterverkehr untersucht werden, um die Grundlagen für eine Berücksichtigung der regionalen<br />
Mobilitätsbedürfnisse des Landkreises Soltau-Fallingbostel im weiteren Genehmigungsverfahren<br />
der Y-<strong>Trasse</strong> zu schaffen.“<br />
Bericht<br />
Der Bericht gliedert sich in die Kapitel,<br />
1 Einleitung<br />
2 Möglichkeiten für eine regionale Anbindung an die Y-<strong>Trasse</strong> (5 Seiten),<br />
3 Machbarkeit von Verbindungsstrecken zur Bestandsstrecke (3 Seiten),<br />
4 Möglichkeiten für einen Regionalbahnhof (15 Seiten),<br />
5 Betriebliche Betrachtungen (15 Seiten),<br />
6 Auswirkungen auf die KBS 123 (4 Seiten) und<br />
7 Empfehlungen (2 Seiten).<br />
Der grobe Inhalt ist damit bereits sehr gut beschrieben, so dass nur noch auf einige wesentliche<br />
Punkte im Folgenden eingegangen werden soll.<br />
Ergebnisse und Wertung<br />
Im Kapitel 2 wird u. a. festgestellt, dass nach Angaben der DB AG innerhalb des<br />
Raumordnungsverfahrens wegen „fehlenden Bedarfs“ Regionalverkehrshalte bisher nicht<br />
vorgesehen sind, es aber in anderen Regionen bereits derartige Bahnhöfe gibt. Dieses sind z. B.<br />
Vaihingen (Enz) an der SFS Mannheim - Stuttgart und Montabaur und Limburg (Lahn) an der<br />
SFS Köln - Frankfurt (Main).<br />
Im weiteren wird darauf leider nicht näher eingegangen. Dieses ist in dieser Form insbesondere<br />
deswegen nicht akzeptabel, als dass hier der Eindruck entsteht, dass die DB AG hier anders<br />
rechnet, als z. B. bei Montabaur. Auch wird hier nicht auf die Gründe eingegangen, die zur<br />
Errichtung dieser Bahnhöfe geführt haben.<br />
Wenn die DB AG als eigenwirtschaftliches Unternehmen keinen Bedarf sieht, sollte dieses<br />
entweder akzeptiert, oder - falls man der Ansicht ist, dass falsch gerechnet worden ist - eine<br />
Gegenrechnung erstellt werden, mit der die DB AG widerlegt werden kann. Beides erfolgt nicht.<br />
Auch rechnet die DB AG hier nicht anders als bei Montabaur oder Limburg (Lahn). Denn beide<br />
Halte sind politisch „erzwungen“ worden und nicht auf Grund fachlicher oder<br />
betriebswirtschaftlicher Argumente eingerichtet worden (siehe dazu z. B. [Andersen, 2002. S.<br />
534]).<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 58
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Hier umgeht IBS / ConTrack sehr geschickt die entscheidende Frage bzw. beantwortet sie nicht:<br />
Rechnet sich ein Regionalhalt überhaupt (Wirtschaftlichkeit) und wer bezahlt die laufenden<br />
Kosten?<br />
(Anmerkung des Verfassers: Durch die Inbetriebnahme der SFS Köln - Frankfurt (M) kann mittlerweile die<br />
Wirtschaftlichkeit und die „Annahme“ durch die Reisenden der Bahnhöfe Limburg-Süd, Montabaur und<br />
Siegburg an Hand realer Zahlen überprüft werden. Ebenso kann ein Vergleich mit vorher durchgeführten<br />
Progosen und Gutachten durchgeführt werden. Bevor weitere Planungen für einen Regionalbahnhof auf der<br />
Y-<strong>Trasse</strong> durchgeführt werden oder Hoffnungen und Erwartungen an einen Regionalbahnhof bestehen,<br />
sollten diesbezügliche Untersuchungen bzw. Besichtigungen <strong>statt</strong>finden. Siehe auch FR-Artikel im Anhang)<br />
So wohnen zwar nach Angaben der Internetseite des Landkreises Soltau-Fallingbostel etwa<br />
139.00 Einwohner im Landkreis, durch die Größe des Landkreises ergibt sich allerdings nur eine<br />
Einwohnerdichte von 88,7 Einwohnern / km 2 (ohne ständig genutzte militärische Flächen).<br />
Verkehrsgeografisch ist ein „teurer“ Halt damit kaum zu finanzieren. Zusätzlich liegen alle<br />
vorgeschlagenen Regionalbahnhofsstandorte weit entfernt der Aufkommensschwerpunkte<br />
Walsrode, Fallingbostel oder Bomlitz, sofern hier überhaupt von „Schwerpunkten“ gesprochen<br />
werden kann. Damit entfällt die Erreichbarkeit des Regionalbahnhofs zu Fuß oder per Fahrrad,<br />
wie es bei den heutigen Halten gegeben ist. Die Nutzer werden auf das Auto angewiesen sein.<br />
(Rechnung: Für die Baukosten einer Verbindungskurve, für Bahnsteige, Außenanlagen und Straßenbau<br />
werden Kosten von etwa 13 Mio. EUR geschätzt. (Die Bahnanlagen mit 5,5 Mio. EUR werden als<br />
Betriebsbahnhofskosten angenommen.) Wird ein Abschreibungszeitraum von 35 Jahren angesetzt, so<br />
ergeben sich nur durch die reinen Baukosten Kosten in Höhe von 1017 EUR / Tag, die nur von den hier<br />
zusteigenden Reisenden erwirtschaftet werden müssen.)<br />
Im Kapitel 3 wird auf die Ein- und Ausfädelung von der Y-<strong>Trasse</strong> auf das Bestandsnetz<br />
eingegangen. Dabei wird eine eingleisige und niveaugleiche Ein- und Ausfädelung als<br />
ausreichend betrachtet, da maximal mit einem Stundentakt der Regionalzüge gerechnet wird und<br />
dadurch notwendigen Investitionen vermindert werden können. Es wird jedoch darauf<br />
hingewiesen, dass es bei dieser Lösung zu Einschränkungen in der Fahrplangestaltung der<br />
Regionalzüge kommen kann. Wie diese Einschränkungen aussehen, wird nicht erläutert.<br />
Als zusätzliche Argumentation wird aufgeführt, dass niveaugleiche Streckenabzweige mit<br />
Kreuzung des Gegengleises auf Schnellfahrstrecken zwar nicht generell üblich sind, aber z. B.<br />
am Abzweig Sorsum nach Hildesheim von der SFS Hannover - Göttingen oder der Abzweig<br />
Möringen nach Stendal an der SFS Hannover - Berlin vorhanden sind.<br />
Hierzu ist anzumerken, dass es zwar technisch möglich ist, eingleisige und niveaugleiche<br />
Verbindungskurven zu bauen, eine Aussage, ob dieses auch betriebssystematisch sinnvoll ist, ist<br />
damit leider nicht verbunden. Auch der Verweis auf z. B. den Abzweig Sorsum assoziiert den<br />
Gedanken, dass es sogar „sinnvoll“ sein kann. Hier wird außer Acht gelassen, dass der Abzweig<br />
Sorsum vor der deutschen Wiedervereinigung geplant worden ist. Damit wären über diesen<br />
Abzweig tagsüber allenfalls vereinzelt Züge geführt worden. Betriebssystematisch ist dieser<br />
Abzweig heute nachteilig und wirkt sich nicht förderlich auf die Zuverlässigkeit des Fahrplans aus.<br />
Für die Regionalzüge wird im Kapitel 5 eine fahrdynamischer Standard wie bei den IC(IR)-Zügen<br />
unterstellt (Höchstgeschwindigkeit 160 bis 200 km/h). Es wird darauf verwiesen, dass bereits<br />
heute auf der SFS Hannover - Berlin 160 km/h schnelle Regionalzüge verkehren, ohne allerdings<br />
auf den Zwang zur Führung über die SFS hinzuweisen.<br />
Für einen ICE-Halt ergeben sich Fahrzeitverlängerungen von 6 Minuten, so dass mit einem ICE-<br />
Halt sich Fahrzeiten von 62 Minuten für Hamburg - Hannover bzw. 51 Minuten für Hamburg -<br />
Bremen ergeben würden. Damit sind allenfalls einzelne ICE-Halte erreichbar. Mit einem 200 km/h<br />
schnellen Regionalzug könnten folgende Fahrzeiten erreicht werden:<br />
- Walsrode-Süd - Hannover: 28 Minuten (1 Zwischenhalt)<br />
- Walsrode-Süd - Hamburg: 58 Minuten (4 Zwischenhalte)<br />
- Walsrode-Süd - Bremen: 36 Minuten (2 Zwischenhalte)<br />
- Soltau - Walsrode-Süd- Hannover: 57 Minuten (5 Zwischenhalte)<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 59
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Bei einem RE 160 verlängern sich die Fahrzeiten nach Hamburg und Hannover um jeweils 3<br />
Minuten. Eine RE - Linie Soltau - Walsrode - Y-<strong>Trasse</strong> - Hannover mit Vmax = 200 km/h benötigt<br />
57 Minuten.<br />
Für die Leistungsfähigkeitsbetrachtungen wird von Walsrode-Süd nach Hannover ein Stundentakt<br />
angesetzt, nach Bremen Einzelhalte des Fernverkehrs, ergänzt durch einzelne Verstärkerzüge<br />
des Regionalverkehrs in der Hauptverkehrszeit und nach Hamburg ein 2-Stunden-Takt.<br />
Bei den Annahmen zu bestehenden betrieblichen Problemen wird auf die Kapazitätsprobleme in<br />
Hamburg Hbf sowie auf die Strecken Lauenbrück - Hamburg Hbf und Isernhagen - Hannover<br />
hingewiesen. Für die in dieser Untersuchung durchgeführte Fahrlagenplanung wird unterstellt,<br />
dass die bisher bekannten Engpässe durch entsprechende Ausbaumaßnahmen beseitigt sind<br />
und dass mindestens eine Regionalfahrplantrasse pro Stunde und Richtung insbesondere nach<br />
Hamburg Hbf und Hannover Hbf gelegt werden kann.<br />
Hierzu ist anzumerken.<br />
1. Ausbaumaßnahmen im Hamburger Hbf sind leicht vorauszusetzen. Dieses gestaltet sich aber<br />
zum einen sehr schwierig und zum anderen werden auch andere Linien zusätzliche<br />
Kapazitäten beanspruchen, insbesondere die ausgebaute Strecke von Lüneburg - Stelle.<br />
Werden die angenommenen Kapazitäten nicht geschaffen, so ist diese Untersuchung hinfällig.<br />
Es hätten also mindestens zwei Planfälle betrachtet werden müssen: Kein Ausbau des<br />
Hamburger Hbf’s (Planfall 0) und Schaffung der Kapazitäten (Planfall 1), so dass z. B. exakt<br />
deutlich wird (Zwangsfolge): Wenn Hamburg nicht ausgebaut wird, dann ist keine Regionallinie<br />
bis Hamburg Hbf realisierbar. (Zum Engpass Hamburg siehe auch [Andersen 2000, S. 516])<br />
(Auf Grund der getroffenen Annahme, dass Hamburg Hbf ausgebaut werden muss, muss der<br />
Umkehrschluss gezogen werden, dass ohne Ausbau eine Regionallinie nicht möglich ist. Wenn Kapazität<br />
heute vorhanden, bräuchte keine Annahme getroffen zu werden.)<br />
2. Wird nach Hamburg eine Regionallinie im 2-Stunden-Takt angenommen, so müssen von<br />
Tostedt bis Hamburg-Harburg zu Spitzenzeiten / im ungünstigen Fall 8 unterschiedliche<br />
Personenzuglinien (4 ICE/IC/MET, 2 RE und 2 RB) koordiniert werden. Mit einer RB-Linie aus<br />
Soltau auf der Heidebahn „blockieren“ dann insgesamt 9 Züge die Leistungsfähigkeit der<br />
Güterzugrelation Maschen - Buchholz (Nordheide) -> Bremen (sieh Abb. 2-2). Für die 8 Linien<br />
wird sich mit Sicherheit ein oder zwei konfliktfreie Betriebsfälle realisieren lassen. Da aber<br />
insbesondere die Fernverkehrslinien weitere Zwangspunkte besitzen, die sich je nach<br />
Fahrplanabschnitt ändern können und werden, wird es eher zu dem Fall kommen, dass der<br />
Nahverkehr sich dem Fernverkehr und ggf. dem Güterverkehr anpassen muss. Dieses wird<br />
dann zu Wartezeiten, unregelmäßigen Abfahrtszeiten und auch zu einzelnen Zugstreichungen<br />
führen.<br />
3. Werden die Fahrzeiten der Regionallinie Hamburg / Bremen - Walsrode-Süd - Hannover mit<br />
etwa 90 bzw. 70 Minuten betrachtet, so entsprechen diese denen der heutigen IC(IR)-Züge.<br />
Damit ist ein „Kannibalisierungseffekt“ nicht auszuschließen.<br />
4. Wahrscheinlich durch die getroffenen Annahmen bedingt, werden die Bildfahrplanstudien nur<br />
singulär für die Züge der Relation Hamburg - Y-<strong>Trasse</strong> - Hannover durchgeführt. Dieses zeigt<br />
zwar, wie eine Regionalverkehrslinie gelegt werden muss, Konfliktpunkte mit den Zügen der<br />
Relation Hamburg - Tostedt - Bremen werden allerdings nicht sichtbar. Damit entsteht<br />
möglicherweise der Eindruck, als ob diese nicht vorhanden wären. [Andersen 2000, S. 517]<br />
stellt eine korrekte Bildfahrplanstudie auf und kommt zu einem gegenteiligen Ergebnis.<br />
(Anmerkung: Gerade weil es sich um Bildfahrplanstudien handelt, ist es wichtig, mögliche Konfliktpunkte<br />
bzw. Ausschlußfälle aufzuzeigen. Wie Abb. A-3 zeigt, liegen die Abfahrtszeiten der IC-Linie Hamburg -<br />
Bremen - Ruhrgebiet in Hamburg Hbf zwar relativ konstant um die Minute 50. Die Abfahrtszeiten der ICE-<br />
Linien Richtung Hannover - Süden liegen dagegen weit gestreut. Damit ist nicht auszuschließen, dass in<br />
Zukunft Konfliktfälle (auch zwischen den Fernverkehrslinien untereinander) auftreten können, obwohl eine<br />
Bildfahrplanstudie einen konfliktfreien Fall zeigt.)<br />
Interessant ist ebenfalls die Fahrlagenplanung, hier verdeutlicht an der Variante 1 der Linie<br />
Hamburg - Hannover. Es wird festgestellt: „Insgesamt zeigen sich in der Variante 1 nur sehr<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 60
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
begrenzte Möglichkeiten für eine Integration einer stündlichen Regionalverkehrslinie, [...]<br />
Insgesamt zeigt sich also, dass gravierende Fahrplanausschlüsse auftreten. Dies unterstreicht,<br />
dass - [...] - ein viergleisiger Ausbau insbesondere des Abschnitts Lauenbrück - Buchholz zu<br />
fordern wäre.“<br />
Hierzu ist anzumerken:<br />
1. Bereits diese Variante 1 zeigt, dass ein Regionalverkehr nur unter bestimmten<br />
Fernverkehrsfahrplanlagen durchführbar ist. Die Untersuchung einer weiteren Variante erübrigt<br />
sich. Denn es kann hier nicht wie bei einem Haus oder Auto gewählt werden, da keine<br />
„Entweder / Oder“ - Situation vorliegt. Es kann passieren, dass in einem Fahrplanabschnitt ein<br />
„guter“ Nahverkehr angeboten werden kann und im nächsten Abschnitt kein Nahverkehr.<br />
2. Eine viergleisige Strecke ist zwar in jedem Fall betrieblich vorteilhafter als eine dreigleisige, sie<br />
ist aber auch von den Unterhaltungskosten höher. Die Rechtfertigung für einen viergleisigen<br />
Ausbau kann nicht durch eine Regionalverkehrslinie erfolgen, die relativ selten fährt.<br />
Im Kapitel 6 werden die Auswirkungen auf die vorhandene Strecke Soltau - Hannover (KBS 123)<br />
und die Möglichkeiten für den Güterverkehr beschrieben.<br />
Personenverkehr<br />
„Es ist nicht zu erwarten, dass die Besteller LNVG und Region Hannover neben einer stündlichen<br />
Durchbindung Walsrode-Süd - Hannover Hbf weiterhin durchlaufende Züge über die KBS 123<br />
bestellen werden, da dies zu einer deutlichen Zugkilometerausweitung mit entsprechenden<br />
Mehrkosten führen würde. Daneben hätte eine Zugzahlmehrung möglicherweise betriebliche<br />
Engpässe im Abschnitt Hannover - Langenhagen zur Folge. Eine Reduzierung oder sogar<br />
Einstellung der Durchbindungen über die KBS 123 ist je nach Anzahl der über die Y-<strong>Trasse</strong><br />
verkehrenden Regionalzüge daher nicht auszuschließen.“ [...] [E]rgeben sich durch das<br />
Umsteigen [...] vor allem für Schwarmstedt Verschlechterungen. (S. 47, im Original nicht fett<br />
markiert)<br />
Anmerkungen und Fragen:<br />
1. Während für die bestehende Strecke Buchholz (Nordheide) Soltau - Bennemühlen (KBS 123)<br />
nicht erwartet wird, dass die Mehrkosten übernommen werden, scheinen die Mehrkosten durch<br />
die neue Regionalverkehrslinie - durch die langen Zugläufe nicht unerheblich - von den<br />
Aufgabenträgern übernommen zu werden. Denn eine Einschränkung diesbezüglich erfolgt<br />
nicht, d. h. das Geld für diesen Mehrverkehr ist bei den Aufgabenträgern vorhanden. Dann<br />
stellt sich allerdings die Folgefrage, warum im Kapitel 7 empfohlen wird: [...] „Hierzu sind<br />
rechtzeitig Verhandlungen mit der DB AG (Fernverkehr) sowie den Bestellern der<br />
Nahverkehrsleistungen über die künftige Verkehrsbedienung aufzunehmen.“ Bezieht sich<br />
dieses nur auf die Taktlage?<br />
2. Sollen hier Orte gegeneinander „ausgespielt“ werden? Wie soll der Landkreis / die<br />
Landesregierung erklären, dass Schwarmstedt wesentliche Verschlechterungen hinnehmen<br />
muss, damit Soltau / Walsrode eine neue Regionalverkehrslinie erhält? Kann dann auf<br />
rechtlichem Wege etwas eingeklagt werden?<br />
Güterverkehr<br />
Zuerst wird die Leistungsfähigkeit betrachtet. Nach dem schalltechnischen Gutachten innerhalb<br />
des Raumordnungsverfahrens beträgt die Gesamtzahl der Güterzüge, die ausschließlich in der<br />
Relation Hamburg - Hannover verkehren, 60 pro Tag und Richtung. Da nach diesem Endbericht<br />
nur während der Betriebsruhe des Personenverkehrs Güterzüge verkehren können, verbleibt das<br />
Zeitfenster 0 bis 5 Uhr. Daraus folgt, dass dann alle 5 Minuten ein Güterzug über die Y-<strong>Trasse</strong><br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 61
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
fährt. Insofern wäre die Durchführbarkeit von einzelnen Güterzügen, die in Walsrode-Süd von der<br />
Y-<strong>Trasse</strong> auf die KBS 123 wechseln, im Einzellfall zu prüfen.<br />
Hervorgehoben wird, dass von Walsrode-Süd nach Hannover ein Güterzug etwa 40 Minuten<br />
benötigt und in Richtung Hannover direkte Fahrten in der Relation Soltau - Walsrode-Süd -<br />
Y-<strong>Trasse</strong> möglich sind. Dieses bietet sich insbesondere für in Richtung Süden fahrende<br />
Ganzzüge an, wie z. B. den Trailerzug.<br />
Mit gewissen Einschränkungen ist die Nutzung der Y-<strong>Trasse</strong> für die Güterverkehrsanbindung des<br />
Raumes Soltau / Fallingbostel / Walsrode prinzipiell möglich. Dazu gehören u. a. ausreichend<br />
lange Kreuzungsgleise in Walsrode, Fallingbostel und Soltau und die Berücksichtigung des<br />
<strong>Trasse</strong>npreises der Y-<strong>Trasse</strong>. Eine Führung über vorhandene Strecken kann kostengünstiger<br />
sein, sofern zu den gewünschten Zeiten keine Streckenruhezeiten vorhanden sind.<br />
Anmerkungen:<br />
1. Die 60 Güterzüge pro Tag und Richtung werden mit Sicherheit nicht alle in der Zeit von 0 bis 5<br />
Uhr und über die Y-<strong>Trasse</strong> geführt werden, denn die bestehende Strecke über Uelzen steht<br />
weiterhin zu Verfügung.<br />
2. Güterzüge aus dem Bereich Soltau / Walsrode können bereits heute z. B. über die OHE-<br />
Strecke Richtung Hannover - Süden fahren. Dieses kann bis 20 Uhr erfolgen, so dass ein<br />
Nachtsprung Richtung Süden möglich ist. Bei Abfahrt nach 0 Uhr ist dieses nicht mehr<br />
möglich. Es stellt sich die Frage, warum ein Güterzug aus Soltau, der z. B. um 19 Uhr<br />
abfahrbereit ist, bis 0 Uhr aufgehalten werden sollte, nur damit er dann in 40 Minuten über die<br />
Y-<strong>Trasse</strong> nach Hannover fahren kann.<br />
3. Der Hinweis auf die <strong>Trasse</strong>npreise erfolgt eher „am Rande“. Nach Tab. 3-1 ist der Preis<br />
insbesondere im Güterverkehr nicht zu vernachlässigen.<br />
4. Es entsteht der Eindruck, dass der Bereich Soltau / Walsrode ein hohes direktes<br />
Güterverkehrsaufkommen besitzt. Selbst 5 Ganzzüge mit Startpunkt Soltau, die ab z. B. 16<br />
Uhr Richtung Süden fahren müssen, können auf dem vorhandenen Streckennetz zeitgerecht<br />
durchgeführt werden.<br />
Der IBS/ConTrack-Endbericht gibt im Kapitel 7 folgende Empfehlung, zur stufenweisen<br />
Realisierung einer regionalen Anbindung des Landkreises Soltau-Fallingbostel:<br />
Der Bau eines Regionalbahnhofs südlich von Walsrode ist möglichst mit einem für die Y-<strong>Trasse</strong><br />
ohnehin zu bauenden Betriebsbahnhofs zu koordinieren. Für spätere Erweiterungen, z. B. um ein<br />
weiteres Gleis, sind bereits Vorbereitungen zu treffen. Außerdem ist so zu planen, dass eine<br />
Verbindungsstrecke zwischen der Y-<strong>Trasse</strong> / Regionalbahnhof und der KBS 123 in Form einer<br />
Südkurve möglich ist. Zeitnah mit dieser Verbindungsstrecke soll die Elektrifizierung der KBS 123<br />
im Abschnitt Walsrode - Soltau erfolgen.<br />
Finanzierungsmöglichkeiten können aus heutiger Sicht nur eingeschränkt erfolgen, es wird aber<br />
auf die generelle Finanzierungsmöglichkeit durch das Bundesschienenwegeausbaugesetz<br />
(BSchwAG) und das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) verwiesen.<br />
Ergänzend werden weitere notwendige Maßnahmen genannt. Es wird auf die Aktivitäten in<br />
Montabaur und Limburg (Lahn) verwiesen und analog diesen Beispielen sollte auch in Walsrode-<br />
Süd ein entsprechendes Konzept entwickelt werden, wie z. B. die Ansiedlung von<br />
Gewerbeflächen und/oder die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete in der Umgebung so geplant<br />
und vorbereitet werden, dass der Regionalbahnhof sinnvoll integriert wird. (siehe auch im Anhang:<br />
Strecke mit Geisterbahnhöfen)<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 62
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Gesamtwertung<br />
Dieser Endbericht zeigt auf, wie technisch und betrieblich die Gestaltung eines Regionalbahnhofs<br />
und einer Regionalverkehrslinie auf der Y-<strong>Trasse</strong> aussehen könnte. Ergebnis: Technisch und<br />
betrieblich ist beides möglich, wenn auch zum Teil mit Einschränkungen.<br />
Leider werden durch drei wesentliche Faktoren wahrscheinlich falsche Hoffnungen geweckt.<br />
Dieses sind: 1. Die Aufgabenstellung<br />
2. Die fehlende systemische Betrachtung und<br />
3. Einige getroffenen Annahmen und Vergleiche.<br />
Die Aufgabenstellung beschränkt sich nur auf die Y-<strong>Trasse</strong>, so dass eine Betrachtung anderer<br />
Möglichkeiten, wie z. B. die „Güterbahn“ mit der „Reaktivierung“ der Strecke Soltau (Han) - Celle<br />
nicht betrachtet werden. Damit wird nicht ermittelt, welche Möglichkeit die optimale ist.<br />
Durch die fehlende systemische Betrachtung wird u. a. das entscheidende Element Finanzierung /<br />
Wirtschaftlichkeit nur am Rande erwähnt. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass die<br />
Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist und der Regionalbahnhof entfallen muss. Insbesondere wird<br />
nicht erläutert, warum die DB AG keinen Bedarf sieht und diese Annahme nicht zutreffend ist.<br />
Denn schließlich wird empfohlen, mit der DB AG (Fernverkehr) Verhandlungen über die künftige<br />
Verkehrsbedienung aufzunehmen. Wird ansatzweise eine systemische Betrachtung durchgeführt,<br />
so wird durch eine einfache Annahme (Umbaumaßnahmen in Hamburg werden vorausgesetzt)<br />
eine weitere Untersuchung hinfällig. Auch die Vergleiche mit realisierten Ausführungen<br />
(Montabaur, Vaihingen(Enz) usw., höhengleiche Abzweige) erwecken den Eindruck, als ob die<br />
bisher realisierten Ausführungen gute Lösungen darstellen.<br />
(Anmerkung: Es ist aus Sicht des Verfassers grundsätzlich lobenswert, dass ein Landkreis von geplanten<br />
Projekten im Bereich der Eisenbahninfrastruktur profitieren will und entsprechende Untersuchungen in<br />
Auftrag gibt. Durch die Aufgabenstellung ist aber leider anzunehmen, dass es nicht um eine optimale<br />
Anbindung und Erschließung mit Eisenbahnverkehrsleistungen und Eisenbahninfrastruktur geht, sondern<br />
alleine um einen „prestigeträchtigen“ ICE-Halt.)<br />
6.5.5 Position des <strong>VCD</strong> LV Niedersachsen e.V.<br />
Der Verkehrsclub Deutschland (<strong>VCD</strong>), Landesverband Niedersachsen e. V., hat auf seiner<br />
Mitgliederversammlung 1998 in Aurich eine „<strong>VCD</strong>-Stellungnahme zur geplanten<br />
Hochgeschwindigkeitsstrecke Hamburg/Bremen - Hannover der Deutschen Bahn AG („Y“-<br />
<strong>Trasse</strong>)“ beschlossen (siehe www.vcd.org/nds), die u. a. folgende Aussagen enthält.<br />
„1. Ausgangssituation im betroffenen Planungsraum“<br />
Hier wird u. a. darauf hingewiesen, dass der gesamte Verkehr in Richtung Skandinavien, und hier<br />
insbesondere der Güterverkehr, zur Zeit ausschließlich über die Elbbrücken bei Hamburg läuft<br />
und östlicher gelegene Kapazitäten in Nord-Süd-Richtung nicht ernsthaft verfolgt werden.<br />
Weiter wird auf den SPNV in dieser Region eingegangen und die für den SPNV stillgelegten bzw.<br />
teilweise demontierten Strecken eingegangen.<br />
„2. Planungen für den Eisenbahnverkehr im betroffenen Gebiet“<br />
Hier wird auf die unterschiedlichen Planungen der Bundesverkehrswegepläne (BVWG) ‘85 und<br />
‘92 eingegangen. Während der BVWG ‘85 noch den Ausbau vorhandener Strecken wie<br />
Rotenburg (Wümme) - Verden (Aller) - Minden (Westf) oder auch Hamburg - Maschen - Lüneburg<br />
- Celle vorsah, enthält der BVWG ‘92 den neuen Plan, eine komplett neue Strecke, die so<br />
genannte Y-<strong>Trasse</strong>, zu bauen.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 63
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
„3. Widerstand gegen die Y-<strong>Trasse</strong>“ und<br />
„4. Der <strong>VCD</strong> lehnt die Y-<strong>Trasse</strong> kategorisch ab“<br />
Der Widerstand in den betroffenen Regionen wird hier dargestellt mit der anschließenden<br />
Aussage: „Aufgrund der erheblichen Eingriffe in den Naturhaushalt und den nicht erkennbaren<br />
positiven Effekte für den Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs in der betroffenen Region<br />
lehnte der <strong>VCD</strong>-Landesverband Niedersachsen bereits auf seiner Vorstandssitzung am 08.08.92<br />
die Y-<strong>Trasse</strong> [...] kategorisch ab.<br />
[...]<br />
Insbesondere das Mißverhältnis der geplanten 13 Minuten Fahrzeitgewinn (Hamburg - Hannover),<br />
bei einer Gesamtinvestition von rund 2,5 Milliarden DM Steuergelder, nimmt der <strong>VCD</strong> zum Anlaß,<br />
die vorhandenen Defizite unter Berücksichtigung des regionalen SPNV aufzuzeigen.“<br />
„5. Alternativen“ und<br />
„6. Position des <strong>VCD</strong>-Niedersachsen“<br />
Als die planerisch realistischen Alternativen werden aufgeführt:<br />
„- Neubau der Y-<strong>Trasse</strong> entlang der Autobahnen A 7 und A 27<br />
- das „Intelligente Netz“<br />
- Ausbau vorhandener Infrastruktur“<br />
Der Neubau entlang der Autobahnen wird abgelehnt. Das „Intelligente Netz“ enthält zwar sinnvolle<br />
Synergieeffekte, wie die Reaktivierung der (Güter-)Bahnverbindung Soltau - Celle bei<br />
gleichzeitiger Aufnahme des Schienenpersonennahverkehrs, es handelt sich aber vom Grundsatz<br />
her um ein Konzept, dass sich vornehmlich um die Belange des Fernverkehrs kümmert und<br />
Fragen des regionalen Bahnverkehrs nur untergeordnet behandelt.<br />
Im Kapitel 6 werden die Positionen aufgeführt, die der <strong>VCD</strong>-Niedersachsen unterstützt. Dieses<br />
sind:<br />
• „Aufzeigen besserer Investitionsperspektiven: Umsetzung des <strong>VCD</strong>-Konzeptes „Integraler<br />
Taktfahrplan für Niedersachsen mit Vertaktung und Reaktivierung aller wesentlichen<br />
Regionalbahnen in der betroffenen Region.<br />
• Vor Ausbau Verkehrsvermeidungseffekte ernsthaft prüfen!<br />
• Ausbau vorhandener Bahnverbindungen. Sofortmaßnahme; (Abschnittsweiser) dreigleisiger<br />
Ausbau Hamburg - Lüneburg (- Uelzen), ggf. „Versetzte Dreigleisigkeit“ (siehe „Intelligentes<br />
Netz“)<br />
• sowie zweigleisiger Ausbau Rotenburg (Wümme) - Verden (Aller), Nienburg (Weser) - Minden,<br />
dreigleisiger Ausbau Verden (Aller) - Nienburg (Weser).<br />
• nach Ausbau der o. g. Abschnitte Prüfung, ob ein zusätzlicher Ausbau der Heidebahn<br />
Buchholz/N. - Soltau und der Strecke Uelzen - Braunschweig zur Entlastung im Güterverkehr<br />
notwendig ist.“<br />
Diese systemische Betrachtung und die daraus folgende <strong>VCD</strong> LV Niedersachsen -<br />
Resolution 2003 ergänzen und konkretisieren die <strong>VCD</strong>-Stellungnahme von 1998. An der<br />
Position des <strong>VCD</strong> LV Niedersachsen ändert sich nichts. Es kann sich allerdings eine<br />
Verschiebung oder Änderung der Maßnahmen ergeben, die sich durch die Vorgehensweise nach<br />
Kapitel 7 und 8 ergeben, wie z. B. ein nicht notwendiger dreigleisiger Ausbau.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 64
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong><br />
Resolution des <strong>VCD</strong> Landesverbandes Niedersachsen zur geplanten „Y-<strong>Trasse</strong>“<br />
(Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitstrasse Hamburg / Bremen – Hannover)<br />
Beschlossen auf der <strong>VCD</strong>-Jahreshauptversammlung 2003 am 07./08.2003 in Hannover<br />
Der Verkehrsclub Deutschland (<strong>VCD</strong>), Landesverband Niedersachsen e. V., lehnt den Bau der<br />
geplanten Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitstrasse Hamburg / Bremen – Hannover („Y-<strong>Trasse</strong>“)<br />
sowohl aus verkehrspolitischen als auch aus verkehrswissenschaftlichen Gründen ab. Der <strong>VCD</strong><br />
plädiert <strong>statt</strong> dessen für den Ausbau bestehender Schieneninfrastruktur.<br />
Präambel:<br />
Verkehr und Kommunikation sind wichtige und notwendige Elemente einer Gesellschaft.<br />
Allerdings ist Verkehr immer nur Mittel zum Zweck. Daher müssen die Ziele einer nachhaltigen<br />
Verkehrspolitik die dauerhafte Sicherung der Mobilität, die Verringerung des Verkehrsaufwandes<br />
und die spürbare Reduzierung der unerwünschten Verkehrsfolgen sein. Instrumente und<br />
Handlungsansätze dazu sind die Förderung von verkehrsreduzierenden Strukturen, die<br />
Verbesserung der Effizienz des Verkehrs sowie die Schonung von Umwelt und Ressourcen.<br />
Ebenso gehören dazu die Verkehrsvermeidung gänzlich unnötiger Transporte und die<br />
Verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrssysteme, hier vor allem auf die Schiene.<br />
1. Ausgangssituation im betroffenen Planungsraum<br />
Die Eisenbahnstrecke Hamburg - Lüneburg - Hannover ist speziell im Abschnitt Stelle - Lüneburg<br />
überlastet. Auch die Strecken Hamburg - Bremen oder Bremen - Hannover sind teilweise<br />
überlastet und können zusätzliche Verkehre - insbesondere Güterverkehre - nicht mehr<br />
aufnehmen. Für die deutschen Seehäfen der Reihe Emden - Lübeck sind gute und<br />
leistungsfähige Hinterlandverbindungen lebenswichtig.<br />
Um für den Güterverkehr zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, wollen Deutsche Bahn AG und die<br />
betroffenen Landesregierungen die so genannte Y-<strong>Trasse</strong>, eine Hochgeschwindigkeitsstrecke<br />
zwischen Hamburg / Bremen - Hannover realisieren. Die Planer gehen auch für den<br />
Personenverkehr von einer Verbesserung in Form einer Reisezeitverkürzung aus.<br />
Auf der anderen Seite ist in Niedersachsen noch umfangreiche Schieneninfrastruktur vorhanden,<br />
die allerdings nicht leistungsfähig ausgebaut ist und sich teilweise auf veraltetem technischen<br />
Stand befindet. Auch in Nord-Süd-Richtung liegen hier Kapazitäten brach.<br />
2. Positionen und Forderung des <strong>VCD</strong>-Landesverbandes Niedersachsen<br />
Position<br />
Die Y-<strong>Trasse</strong> wird aus folgenden Gründen abgelehnt:<br />
1. Betrieblich ist ihre Entlastungswirkung relativ gering bzw. von der Kapazitätserweiterung dem<br />
Ausbau vorhandener Strecken unterlegen. Der Reisezeitgewinn durch die Y-<strong>Trasse</strong> dagegen<br />
ist „minimal“ und stellt keinen „Quantensprung“ dar, wie dieses bei anderen Neubaustrecken<br />
zum Teil der Fall ist. Die Baukosten von etwa 1,5 Milliarden Euro können wesentlich effektiver<br />
und haushaltsschonender in den Ausbau des bestehenden Netzes investiert werden.<br />
2. Sollte sie gebaut werden, wird für andere Projekte im SPNV in Niedersachsen kaum noch Geld<br />
vorhanden sein.<br />
3. Sie wird sich nicht amortisieren.<br />
4. Die Region wird nicht erschlossen, auch nicht mit einem Regionalbahnhof.<br />
5. Die Realisierung ist fraglich und der Zeitpunkt ist offen. Sollten Kapazitätserweiterungen die<br />
nächsten Jahre tatsächlich benötigt werden, ist die Y-<strong>Trasse</strong> noch nicht vorhanden,<br />
„bescheidene“ und wirkungsvolle Alternativen sind aber blockiert, da Gelder und<br />
Planungskapazitäten für die Y-<strong>Trasse</strong> „reserviert“ werden.<br />
6. Für die Hinterlandverbindungen der deutschen Seehäfen werden keine preislich günstigen<br />
Fahrplantrassen angeboten werden können.<br />
7. Die Probleme im Bereich Stelle - Lüneburg werden auf die Strecke Scheeßel - Buchholz<br />
(Nordheide) - Hamburg-Harburg verlagert.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 65
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
8. Dem Eingriff in das ökologische Teilsystem „Lüneburger Heide“ steht absolut kein Ausgleich<br />
für das Gesamtsystem Natur entgegen, im Gegenteil, das Gesamtsystem wird eher<br />
geschwächt.<br />
Forderung des <strong>VCD</strong> LV Niedersachsen:<br />
Für die Relation Hamburg bzw. Bremen Richtung Süden und gleichzeitig für die Knoten Hamburg<br />
und Hannover / Lehrte fordert der <strong>VCD</strong> LV Niedersachsen die Umsetzung von folgenden<br />
Maßnahmen, die weitestgehend Projekten des Bundesverkehrswegeplans 1992, dem Landes-<br />
Raumordnungsprogramm Niedersachsen 1994 und Planungen der<br />
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen 2001 entsprechen.<br />
Grundgedanke ist dabei nicht die Konzentrierung auf eine Einzelrelation, sondern eine<br />
Netzbetrachtung, die nicht nur die Streckenengpässe entlastet, sondern zusätzlich die Engpässe<br />
in den Knoten, wie beispielsweise Hamburg oder Hannover / Lehrte. Gleichzeitig wird<br />
Niedersachsen mit hochwertiger Eisenbahninfrastruktur „flächenmäßig“ erschlossen und die<br />
vorhandene Infrastruktur effizienter genutzt. Durch den Abbau von Engpässen und die Schaffung<br />
von Kapazitäten wird auch dem Wettbewerbsgedanken entsprochen.<br />
Dieses sind im Einzelnen:<br />
• Entlastung der Strecke Hamburg - Celle durch Ausbau der Strecke Buchholz (Nordheide) -<br />
Soltau (Han) - (OHE) - Celle und<br />
• durch Ausbau einer weiteren Nord - Süd - Relation, der Strecke Lübeck (Ostseehafen) -<br />
Büchen - Lüneburg - Uelzen - Gifhorn (- Wolfsburg) - Braunschweig (im Rahmen der<br />
Einführung der RegioStadtBahn im Bereich des Zweckverband Großraums Braunschweig<br />
teilweise ohnehin notwendig), ggf. drittes Gleis von Lüneburg bis Uelzen verlängern.<br />
• Erste Fortführung dieser Strecke - und gleichzeitig südliche Entlastung der Knoten und der<br />
Strecke Lehrte - Hannover - Wunstorf - Minden (Westf) - Ausbau bzw. Fertigstellung des<br />
Ausbaus der Strecke Wolfsburg - Braunschweig - Hildesheim - Elze (Han) - Hameln -<br />
Löhne (- Ruhrgebiet) (zweite Ost - West- Verbindung).<br />
• Zweite Fortführung durch Ausbau der Strecke Braunschweig - Salzgitter Ringelheim -<br />
Seesen - Kreiensen.<br />
• Weitere nördliche Entlastung der Strecke Wunstorf - Hannover - Lehrte durch Ausbau der<br />
Strecke (Bremen -) Langwedel - Soltau (Han) - Uelzen (- Stendal)<br />
• „Fortsetzung“ der S-Bahn Hannover - Bennemühlen nach Soltau (Han)<br />
• zweigleisiger Ausbau der Strecken Rotenburg (Wümme) - Verden (Aller) und Nienburg<br />
(Weser) - Minden (Westf), ggf. dreigleisiger Ausbau Verden (Aller) bzw. Eystrup (Abzweig der<br />
Strecke Richtung Syke - Bremen) bis Nienburg (Weser)<br />
• Beseitigung höhengleicher Kreuzungen<br />
Diese Maßnahmen sind Schritte auf dem Weg zu einem <strong>Hochleistungsnetz</strong>, welches gleichzeitig<br />
die Fläche erschließt. Der jeweilige Ausbaustandard ergibt sich durch entsprechende<br />
eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchungen.<br />
Parallel dazu müssen von politischer Seite Maßnahmen der Eisenbahnverkehrs- und<br />
Eisenbahninfrastrukturunternehmen unterstützt werden, den Eisenbahnverkehr leiser zu<br />
gestalten.<br />
Im Rahmen zukunftsweisender Verkehrs- und Raumpolitik sollte insbesondere geprüft werden,<br />
wie durch Reaktivierung bzw. Ausbau von bestehenden Strecken, „neue“ wichtige Verbindungen<br />
geschaffen werden können. Hier sei beispielsweise die Relation (Landeshauptstadt) Hannover –<br />
(Landeshauptstadt) Schwerin – (Seehafen) Rostock – Stralsund – Rügen genannt. Während<br />
heute nur über die Umwege und überlasteten Knoten Hamburg oder Berlin gefahren werden<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 66
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
kann, ist die „Luftlinienverbindung“ Hannover - Uelzen - Dannenberg - Dömitz - Schwerin<br />
unterbrochen. Verkehrspotenziale in und auf dieser Relation können heute nicht genügend<br />
ausgeschöpft werden.<br />
Eine Konkretisierung dieser Resolution findet sich in der Studie „Hochleistungsschienennetz für<br />
Niedersachsen, Bremen und Hamburg <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong>“ (<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen, Sellien, 2003).<br />
Zur Verkürzung der Reisezeit und Verringerung des Energieverbrauchs der ICE-Züge sollte die<br />
Geschwindigkeit der Bahnhofsdurchfahrten in Celle, Uelzen und Lüneburg an die<br />
Streckenhöchstgeschwindigkeit von 200 km/h angeglichen werden (Beibehaltung der<br />
Beharrungsgeschwindigkeit bzw. Verringerung der Geschwindigkeitseinbrüche). Allerdings ist auf<br />
Maßnahmen, wie z.B. die Beanspruchung des Zustimmungswertes bei der ausgleichenden<br />
Überhöhung von u 0 = 310 mm zu verzichten, da auch weiterhin „langsamer“ Personenverkehr und<br />
Güterverkehr <strong>statt</strong>finden wird. Auch sollte dieses nur im Rahmen notwendiger Instandsetzungsoder<br />
Umbaumaßnahmen eher kostenneutral erfolgen.<br />
(Anmerkung: Bei durchgehend 200 km/h kann nach [Vieregg&Rössler, 1993, S. 18] der Energieverbrauch<br />
gegenüber heute um ca. 17 % gesenkt werden. Als positiver Nebeneffekt - nicht als Haupteffekt! - ergibt sich<br />
eine Fahrzeitverkürzung um 5 Minuten. Die Bahnhofsdurchfahrten sind dabei mit jeweils 120 km/h angesetzt<br />
worden, sie betragen jedoch 150 km/h (Celle), 130 km/h (Uelzen) und 110 km/h (Lüneburg), so dass die<br />
Einspareffekte etwas geringer ausfallen dürften. Damit könnte die Fahrzeit Hamburg Hbf - Hannover Hbf auf<br />
ca. (70 - 4 (geschätzt) =) 66 Minuten gesenkt werden.)<br />
Eine Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit (und im Bahnhof Celle) auf 230 km/h - sofern<br />
realisierbar - wird abgelehnt. Dadurch könnte die Fahrzeit zwar um weitere 5 Minuten verkürzt<br />
werden, lässt den Energieverbrauch gegenüber heute um 10% und gegenüber dem Ausbau auf<br />
durchgehend 200 km/h dagegen um 33% ansteigen. Damit stehen die rechnerisch gewonnenen 5<br />
Minuten in keinem Verhältnis zum 33% erhöhten Energieverbrauch.<br />
(Hinweis zur Zwangsfolge: Während durch die Verringerung des Energieverbrauchs ein Teil des<br />
Mehrverkehrs mit der bisher installierten Unterwerksleistung bewerkstelligt werden kann, wird mit dem<br />
erhöhten Energiebedarf eine im Regelfall teure Erweiterung der installierten Kraftwerksleistung notwendig<br />
werden. 1992 waren in den Unterwerken Celle-Garßen und Uelzen jeweils 30 Megawatt (MW)<br />
Transformatorleistung installiert [Lanz, Hardebber, 1992, S. 45]. Eine zuverlässige Harmonisierung der<br />
Geschwindigkeiten des einzelnen Zuges ermöglicht es, die teure Reserve für Spitzenleistung zu reduzieren.)<br />
Die Finanzierung des „Lückenschlusses“, der Ausbaus der NE - Bahnstrecke Soltau - Celle,<br />
gestaltet sich heute bezogen auf den Landeshaushalt etwas „schwierig“, da nach<br />
Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSchwAG) keine Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden<br />
können. Hier muss eine Regelung gefunden werden, die ggf. so aussieht, dass mit dem<br />
BSchwAG alle Schienenwege bei überregionalen / bundespolitischen Interessen ebenfalls<br />
gefördert werden können.<br />
Ein Ausbau in zügig durchgeführten „kleineren“ Einzelprojekten schont die öffentlichen Haushalte,<br />
da keine große Einzelinvestition finanziert werden muss. Die Gesamtinvestitionen sind im<br />
Gegenzug aber nicht geringer, da sie gestreckt bzw. verteilt werden. Gleichzeitig können getätigte<br />
Investitionen sich frühzeitig amortisieren. Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass<br />
investiert wird.<br />
Sollte dennoch „Geld zuviel“ vorhanden sein, so kann dieses dann in den Abbau von Engpässen<br />
gesteckt werden, die die Leistungsfähigkeit der Strecke Hamburg - Hannover begrenzen, wie z.B.<br />
die Elbbrücken in Hamburg, Verbindungsbahn Hamburg Hbf - Hamburg-Dammtor - Abzweig<br />
Holstenstraße oder auch der Knoten Lehrte. Allein der Ausbau des Haltepunktes Hamburg-<br />
Dammtor (ein Bahnsteiggleis pro Richtung) zu einem Bahnhof analog Berlin Zoologischer Garten<br />
(zwei Bahnsteiggleise pro Richtung) würde die Zuverlässigkeit und Flexibilität in der<br />
Betriebsführung deutlich erhöhen.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 67
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
6.6 Alternativen für die Relation Hamburg / Bremen - Hannover<br />
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden hier kurz in Tabellenform die Vor- und Nachteile<br />
verschiedener Lösungen für die Relation Hamburg - Hannover aufgeführt werden. Sie ersetzen<br />
nicht den Planungsablauf nach Kap. 8.2, sondern sollen lediglich als Diskussionsgrundlage<br />
dienen.<br />
Verbesserungen und Nachteile der Y-<strong>Trasse</strong> (nicht gewichtet)<br />
Verbesserungen<br />
Nachteile<br />
Entlastet Engpassstrecke Stelle - Celle um 30 ICE pro<br />
Richtung, -> günstigeres Mischungsverhältnis der<br />
Zuggeschwindigkeiten<br />
Verkürzt wahrscheinlich Fahrzeit Hannover - Hamburg<br />
auf unter 1 Std. (psychologisch wichtig)<br />
Strecke Hamburg-Harburg - Buchholz(Nordh) (19 km)<br />
„wirtschaftlicher“, da zwei ICE-Linien zusätzlich<br />
Tab. 6-6: Verbesserungen und Nachteile der Y-<strong>Trasse</strong><br />
Tagsüber nicht für Güterverkehr geeignet (wg. Hannover Hbf), nachts<br />
für Güterverkehr nicht unbedingt benötigt<br />
Verkürzt Fahrzeit absolut nur um wenige Minuten, im Vergleich zu<br />
einem möglichen Ausbau der Altstrecke und zu bisherigen<br />
Neubaustrecken<br />
Strecke Langenhagen - Celle (30 km) „unwirtschaftlich“, da nur noch<br />
eine RE- und eine IR-Linie<br />
Strecke Hamburg-Harburg - Buchholz (Nordheide) mit 4 ICE/IC/METund<br />
2 RE/RB-Linie belegt<br />
-> ICE/IC/MET können sich gegenseitig stören, so dass eine Linie<br />
Fahrzeitverlängerungen erhalten muss (Fahrzeitgewinn schrumpft)<br />
Keine Entlastung der Strecke Bremen - Langwedel (-Hannover)<br />
Beseitigt nicht automatisch dass Problem, dass das der RE vom IR<br />
überholt wird und warten muss<br />
„knotenorientiert“: Erschließt nicht die Region Lüneburger Heide, ein<br />
Zwischenhalt ist unrealistisch, Verbindungskurven zu einzelnen<br />
Orten sind teuer und eine SPNV-Linie „behindert“ den ICE-Verkehr<br />
(vergleiche Rathenow - Berlin-Spandau)<br />
Verschiebt Betriebsführungsprobleme auf die Strecke Bremen -<br />
Hamburg (Lauenbrück - Buchholz(Nordh); sollten die Probleme<br />
durch Bündelung des SPFV nicht gänzlich behebbar sein, so müsste<br />
ggf. viergleisig ausgebaut werden -> technisch möglich, verteuert<br />
aber Variante Y-<strong>Trasse</strong> um schätzungsweise 230 Mio. EUR<br />
([Breimeier, 2/2001, S. 93])<br />
Erhöhte Konflikte durch Kreuzung der Güterzüge Maschen -><br />
Buchholz(Nordh) -> Bremen mit SPFV-Zügen Bremen/Hannover -><br />
Buchholz(Nordh) -> Hamburg im Bahnhof Buchholz(Nordh)<br />
Zerschneidet ökologisch wertvolles Gebiet<br />
Sehr großer Widerstand in der Bevölkerung<br />
Absolut betrachtet sehr teuer<br />
Auf der Altstrecke verbleiben mind. eine RE- und eine IR-Linie,<br />
weiter Behinderung des Güterverkehrs<br />
Altstrecke wird nicht „zurückgebaut“ werden, da sie mindestens als<br />
Ersatzstrecke zur Y-<strong>Trasse</strong> vorgehalten wird<br />
Strecke Buchholz (Nordheide) - Soltau wird zusätzlich ausgebaut<br />
[LNVG, 2001, S. 9], Realisierungszeitraum noch offen<br />
Hoher Flächenverbrauch, da zwei Gleise neu verlegt werden müssen<br />
Eine spürbare Erhöhung der Zugzahlen auf der Relation<br />
Hamburg/Bremen - Hannover ist unwahrscheinlich<br />
Inbetriebnahme: 2015, 2020,...? (vgl. andere Neubauprojekte),<br />
Kapazitäten werden aber heute schon benötigt<br />
Die Möglichkeit der Y-<strong>Trasse</strong>, die alte Strecke zu entlasten, ist vorhanden, allerdings ist damit<br />
keine Aussage verbunden, dass dieses Ziel nicht auch anders und insgesamt betrachtet optimaler<br />
erreicht werden kann. Dieses sollen die beiden folgenden Varianten zeigen.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 68
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Verbesserungen / Vorteile und Nachteile der „Güterbahn 1“ (nicht gewichtet)<br />
(Kursiv: Unterschied zur Variante „Güterbahn 2“)<br />
Verbesserungen / Vorteile<br />
Nachteile<br />
Praktisch eigenständige „Güterbahn“, da nur eine SPNV-<br />
Linie, dadurch sehr leistungsfähig<br />
Erschließt Region Lüneburger Heide, Anteil der Schiene<br />
kann erhöht werden („netzorientiert“)<br />
SPNV auf Relation Soltau - Celle wieder möglich<br />
Absolut betrachtet sehr günstige Variante, zusätzlich<br />
Synergieeffekt durch „Entfall“ des geplanten Ausbaus durch<br />
[LNVG, 2001, S. 9] -> andere Strecken können zusätzlich<br />
ausgebaut werden<br />
Relativ zügig umsetzbar, kann theoretisch sofort begonnen<br />
werden<br />
Geringer Flächenverbrauch (ein Gleis ist bereits<br />
vorhanden), es wird kein neues Gebiet zerschnitten<br />
Auch Teilausbau, wie vorerst eingleisig, ist möglich und<br />
bewirkt Verbesserung<br />
Güterzüge kommen in Celle auf der „richtigen“, der<br />
östlichen Seite an (zur Weiterfahrt Richtung Lehrte)<br />
Strecke Langenhagen - Celle bleibt mit 4 Linien gut<br />
ausgelastet<br />
Mögliche Konflikte auf der Strecke Hamburg-Harburg -<br />
Buchholz(Nordh) entfallen<br />
Reduzierte Konflikte durch Kreuzung der Güterzüge<br />
Maschen -> Buchholz(Nordh) -> Bremen/Hannover mit<br />
SPFV-Zügen Bremen/Hannover -> Buchholz(Nordh) -><br />
Hamburg im Bahnhof Buchholz(Nordh)<br />
Fahrzeit im SPFV Hamburg - Hannover kann wahrscheinlich nicht<br />
unter 1 Std. gesenkt werden (psychologisch wichtig)<br />
Für den Abschnitt Soltau - Celle kann z.Zt. nicht mit Mitteln aus<br />
dem Bundesschienenenwegeausbaugesetz finanziert werden, da<br />
Strecke im Besitz der (privaten) OHE.<br />
Lärmschutz notwendig<br />
Beseitigt nicht automatisch dass Problem, dass der RE vom IR<br />
überholt wird und warten muss<br />
Neubauabschnitte:<br />
- Ostumfahrung von Soltau notwendig<br />
- Bergen - Sülze (dann Stilllegung Bergen - Beckedorf)<br />
Tab. 6-7: Verbesserungen und Nachteile der Variante „Güterbahn 1”<br />
Auf der Strecke Hamburg - Lüneburg - Celle wird mit Sicherheit auch nach Ausbau der<br />
„Güterbahn 1“ weiterhin Güterverkehr verbleiben, z.B. der von/nach (Skandinavien-) Lübeck<br />
kommende Verkehr. Diesen über eine ausgebaute „Strecke im Leistungsnetz“ nach Netz 21<br />
Lübeck - Büchen - Lüneburg zu führen ist sinnvoll, da hiermit der Engpass Hamburg entlastet<br />
werden kann. Auch löst die Güterbahn 1 nicht automatisch das Problem, dass - wie im derzeit<br />
gültigen Fahrplan - der RE vom IR überholt wird.<br />
Als Lösung bietet es sich an, die Variante Güterbahn 1 „aufzuspalten“, indem das zweite Gleis<br />
kurz vor Garßen von der Strecke Celle - Soltau auf die östliche Seite der Strecke Celle - Uelzen<br />
„abzweigt“. Damit wäre ein späterer möglicher zweigleisige Ausbau der Strecke Celle - Soltau<br />
diesbezüglich unproblematisch. Der Nord-Süd-Güterverkehr wird über Soltau geführt, der Süd-<br />
Nord Güterverkehr und Regionalverkehr auf einem dritten „Einrichtungs-“Gleis zur Strecke Celle -<br />
Uelzen - Lüneburg, mit einer Brutto-Länge von 87 km (bestehende dritte Bahnhofsgleise nicht<br />
gerechnet). Da die Strecke Lüneburg - Celle bereits heute für den Gleiswechselbetrieb ausgebaut<br />
ist, können wechselweise jeder Richtung zwei Streckengleise zur Verfügung gestellt werden.<br />
Vom Prinzip ist - auf die Strecke Lüneburg - Celle bezogen - dieses eine weitere Form der<br />
„verschränkten Dreigleisigkeit“ (nur ohne Verschränkung), die in [Pachl, 1998] beschrieben wird.<br />
„Die verschränkte Dreigleisigkeit empfiehlt sich [...] nur für Strecken, deren Betriebsprogramm<br />
sich durch hohe Fahrzeitdifferenzen und einen häufigen Wechsel zwischen schnellen und<br />
langsamen Zügen auszeichnet. [...] Eine solche Ausbauform bietet gegenüber konventionellen<br />
Formen des dreigleisigen Ausbaus folgende Vorteile:<br />
- reiner Einrichtungsbetrieb, dadurch geringer signaltechnischer Aufwand,<br />
- nur wenige Weichen erforderlich, dadurch geringer baulicher Aufwand, (und)<br />
- einfache Disposition, sehr automatisierungsfreundlich,“ [ebd., S. 28, 27],<br />
d. h. verbessertes Leistungsverhalten bei geringen Kosten.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 69
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Verbesserungen / Vorteile und Nachteile der „Güterbahn 2“ (nicht gewichtet)<br />
(Kursiv: Unterschied zur Variante „Güterbahn 1“)<br />
Verbesserungen / Vorteile<br />
Nachteile<br />
Praktisch eigenständige „Güterbahn“, da nur eine SPNV-<br />
Linie, dadurch sehr leistungsfähig<br />
Erschließt Region Lüneburger Heide, Modal-Split Anteil der<br />
Schiene kann erhöht werden („netzorientiert“)<br />
SPNV auf Relation Soltau - Celle wieder möglich<br />
Absolut betrachtet sehr günstige Variante, zusätzlich<br />
Synergieeffekt durch „Entfall“ des geplanten Ausbaus durch<br />
[LNVG, 2001, S. 9] -> andere Strecken können zusätzlich<br />
ausgebaut werden<br />
Relativ zügig umsetzbar, kann sofort begonnen werden<br />
Geringer Flächenverbrauch (ein Gleis ist bereits<br />
vorhanden), es wird kein neues Gebiet zerschnitten<br />
Auch Teilausbau, wie vorerst Ausbau eine Richtung, ist<br />
möglich und bewirkt Verbesserung<br />
Güterzüge kommen in Celle auf der „richtigen“, der<br />
östlichen Seite an (zur Weiterfahrt Richtung Lehrte)<br />
Strecke Langenhagen - Celle bleibt mit 4 Linien gut<br />
ausgelastet<br />
Beseitigt dass Problem, dass das der RE vom IR überholt<br />
wird und warten muss<br />
Mögliche Konflikte auf der Strecke Hamburg-Harburg -<br />
Buchholz(Nordh) entfallen<br />
Reduzierte Konflikte durch Kreuzung der Güterzüge<br />
Maschen -> Buchholz(Nordh) -> Bremen/Hannover mit<br />
SPFV-Zügen Bremen/Hannover -> Buchholz(Nordh) -><br />
Hamburg im Bahnhof Buchholz(Nordh)<br />
Der nächtliche Güterverkehr (22:00 - 6:00 Uhr) kann auf der<br />
bisher belasteten Strecke verbleiben, da z. B. bis 1:00 Uhr<br />
in Nord-Süd-Richtung auf zwei Gleisen gefahren werden<br />
kann, danach dann in Süd-Nord-Richtung, so dass auf der<br />
Heidebahn nachts allenfalls leiser Personenverkehr<br />
<strong>statt</strong>findet.<br />
Fahrzeit im SPFV Hamburg - Hannover kann wahrscheinlich<br />
nicht unter 1 Std. gesenkt werden (psychologisch wichtig)<br />
Für den Abschnitt Soltau - Celle kann z.Zt. nicht mit Mitteln aus<br />
dem Bundesschienenenwegeausbaugesetz finanziert werden, da<br />
Strecke im Besitz der „privaten“ OHE.<br />
Lärmschutz notwendig<br />
Neubauabschnitte:<br />
- Ostumfahrung von Soltau notwendig<br />
- Bergen - Sülze (dann Stilllegung Bergen - Beckedorf)<br />
Tab. 6-8: Verbesserungen und Nachteile der Variante „Güterbahn 2“<br />
Wie der Regionalverkehr in der Lüneburger Heide vom Ausbau Variante Güterbahn profitieren<br />
könnte, zeigt Tab. 7-1. Da bei der „Güterbahn 2“ im Wesentlichen die Eingleisigkeit bestehen<br />
bleibt, können im Einzellfall etwas längere Fahrzeiten die Folge sein. Davon abgesehen, erhöht<br />
ein Ausbau auf eine Streckenhöchstgeschwindigkeit von 140(160) km/h die Investitionen im<br />
Regelfall nur unwesentlich. So könnten bei Verlängerung der S-Bahn Hannover die eingesetzten<br />
Fahrzeuge ihre Höchstgeschwindigkeit optimal ausnutzen, aber auch eine mögliche SPFV-Linie<br />
würde attraktiver werden.<br />
Damit auf der eingleisigen Strecke der SPNV auch zu stark belasteten Zeiten durch den<br />
Güterverkehr kundenfreundlich durchgeführt werden kann, sollten entsprechend einer<br />
Bildfahrplanstudie mit realistischem Betriebskonzept Kreuzungsstellen bzw. längere zweigleisige<br />
Abschnitte vorgesehen werden. Auch wenn dadurch die Investitionen etwas höher ausfallen, so<br />
werden die Vorteile durch die Dreigleisigkeit überwiegen, zumal hier eine „klassische“<br />
Dreigleisigkeit zu den reduzierten Kosten einer „verschränkten“ Dreigleisigkeit hergestellt werden<br />
kann, so dass bei Bedarf auch in Nord-Süd-Richtung zwei Richtungsgleise zur Verfügung stehen.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 70
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Verbesserungen / Vorteile und Nachteile „Ausbau Celle - Lüneburg 4-gleisig“<br />
(Vmax = 160 km/h), (nicht gewichtet)<br />
Verbesserungen / Vorteile<br />
Nachteile<br />
Praktisch eigenständige „Güterbahn“, da nur eine SPNV-<br />
Linie, dadurch sehr leistungsfähig<br />
Zum Teil Gelände von Überholbahnhöfen nutzbar, es wird<br />
kein neues Gebiet zerschnitten<br />
Relativ zügig umsetzbar, kann „sofort“ begonnen werden<br />
Güterzüge kommen bei östlicher Lage der zusätzlichen<br />
Gleise in Celle auf der „richtigen“ Seite an (zur Weiterfahrt<br />
Richtung Lehrte)<br />
Strecke Langenhagen - Celle bleibt mit 4 Linien gut<br />
ausgelastet<br />
Beseitigt dass Problem, dass das der RE vom IR überholt<br />
wird und warten muss<br />
Mögliche Konflikte auf der Strecke Hamburg-Harburg -<br />
Buchholz(Nordh) entfallen<br />
Reduzierte Konflikte durch Kreuzung der Güterzüge<br />
Maschen -> Buchholz(Nordh) -> Hannover mit SPFV-Zügen<br />
Bremen -> Buchholz(Nordh) -> Hamburg im Bahnhof<br />
Buchholz(Nordh)<br />
Fahrzeit im SPFV Hamburg - Hannover kann wahrscheinlich nicht<br />
unter 1 Std. gesenkt werden (psychologisch wichtig)<br />
Erschließt nicht die Region Lüneburger Heide, daher muss<br />
zusätzlich investiert werden<br />
SPNV auf Relation Soltau - Celle wird nicht ermöglicht<br />
Ausbau wahrscheinlich relativ kostenintensiv, da bisherige Strecke<br />
überwiegend in hoher Damm- bzw. Einschnittslage verläuft. Relativ<br />
viele Straßenbrücken (subjektive Beobachtung) müssen für<br />
Durchlass von vier Gleisen neu gebaut werden.<br />
Zum Teil dichter „Heidewald“ muss gerodet werden.<br />
Mögliche Probleme in einigen Bahnhöfen, zusätzlich noch ein<br />
viertes durchgehendes Gleis zu verlegen.<br />
Tab. 6-9: Verbesserungen und Nachteile der Variante „Ausbau Celle - Lüneburg 4-gleisig“<br />
Die behandelten Lösungsvarianten sind hier nur singulär - für die Relation Hamburg - Celle /<br />
Lehrte / Hannover betrachtet worden. Da bei dieser Betrachtung eine Steigerung von 70 % im<br />
Güterverkehr unterstellt ist, wird diese Steigerung auch andere Relationen wie Hamburg -<br />
Ruhrgebiet oder Berlin - Braunschweig / Wolfsburg / Salzgitter - Lehrte - Hannover - Ruhrgebiet<br />
betreffen. So ist vor allem näher zu untersuchen, welche Verkehre Hamburg (insbesondere die<br />
Verbindungsbahn Hbf - Dammtor - Altona / Schleswig-Holstein), der Knoten Lehrte und die<br />
Strecke Lehrte - Misburg - Hannover-Linden / -Wülfel noch aufnehmen können.<br />
Sehr ungünstig sind dabei Güterzüge der Richtung Celle - Lehrte - Braunschweig, da sie auf den<br />
jeweils äußeren Streckengleisen fahren und damit die Fahrstraßen so belegt werden, dass alle<br />
anderen Relationen (Wolfsburg / Braunschweig - Hannover, Hannover - Lehrte - Celle, Hannover<br />
- Lehrte - Wolfsburg) für diese Zeit gesperrt sind. Die Relation Hannover - Braunschweig ist<br />
insofern blockiert, als dass nur ein Zug den Blockabschnitt belegen kann. So kommt es vor, dass<br />
dann der 5400 t schwere Erzzug den RE Hannover - Braunschweig vorlassen muss. Das<br />
einmalige Beschleunigen des Erzzuges auf 80 km/h kostet dann nur an kinetischer Energie<br />
370 kWh.<br />
(Nebenrechnung: Annahme: 4 beladene Erzzüge pro Tag, je zweimal Überholungsaufenthalt, Kosten pro<br />
kWh 0,08 Eurocent, Zeitraum 10 Jahre ergeben „zusätzliche“ Energiekosten von mindestens 864.320 EUR<br />
nur für diese 4 Züge!)<br />
Um den Knoten Lehrte zu entlasten bzw. um überhaupt benötigte Kapazitäten zu schaffen, sollte<br />
mindestens der (langsame) Erzverkehr Hamburg - Salzgitter auf direktem Weg über Uelzen -<br />
Wittingen - Gifhorn nach Salzgitter geführt werden. Entsprechend leistungsfähige mit<br />
entsprechender Anfahrzugkraft benötigte Diesellokomotiven können von der Eisenbahnindustrie<br />
geliefert werden. Die Entlastung des Knotens Lehrte dürfte dabei höher zu bewerten sein, als das<br />
Belassen dieses Zuges auf der dann entlasteten Strecke Stelle - Uelzen.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 71
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
6.7 Fragen und Antworten zur Y-<strong>Trasse</strong> (Zusammenfassung)<br />
Die Zusammenfassung soll hier in Form von Frage und Kurzantwort erfolgen.<br />
Löst die Y-<strong>Trasse</strong> die Probleme auf der Strecke Hamburg - Uelzen - Hannover?<br />
• Die Frage ist in dieser Form zu singulär gestellt. Sie muss lauten: Wirkt sich die Y-<strong>Trasse</strong> positiv auf den<br />
Eisenbahnverkehr im Bereich Hamburg / Bremen / Hannover aus? Antwort: In der Summe „Nein“. Zwar<br />
wird die Strecke Stelle - Uelzen - Celle von den ICE-Zügen entlastet, so dass hier die Probleme gemildert<br />
werden, sie werden dagegen insbesondere auf dem Abschnitt (Bremen-) Buchholz (Nordheide) -<br />
Hamburg-Harburg wesentlich verschärft (Problemverlagerung).<br />
Profitiert der Nahverkehr von der Y-<strong>Trasse</strong>?<br />
• Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Der Abschnitt Stelle - Lüneburg wird ohnehin dreigleisig ausgebaut.<br />
Der IC(IR), der heute den RE überholt, verbleibt weiterhin auf der Altstrecke. Im Abschnitt (Scheeßel-)<br />
Buchholz (Nordheide) - Hamburg-Harburg wird es voraussichtlich zu erhöhten Problemen im Nahverkehr<br />
durch die mind. zwei zusätzlichen ICE-Züge pro Stunde kommen. Es findet im Endeffekt nur eine<br />
Problemverlagerung <strong>statt</strong>.<br />
Ist Nahverkehr mit einem Regionalbahnhof auf der Y-<strong>Trasse</strong> machbar und sinnvoll?<br />
• Machbar - ja, sinnvoll - nein. Auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke wird langsamer Nahverkehr nur<br />
stören. Es sei denn, er wird mit beschleunigungsstarken und sehr teuren ICE3-Einheiten durchgeführt.<br />
Davon abgesehen werden seitens der Aufgabenträger, die den Nahverkehr bestellen müssen, keine<br />
Regionalisierungsmittel zur Verfügung stehen, sofern sie nicht an anderer Stelle abgezogen werden.<br />
Erschließt die Y-<strong>Trasse</strong> das Land Niedersachsen?<br />
• Nein. Auch mit einem Regionalbahnhof kann nicht von einer Erschließung gesprochen werden.<br />
Schafft die Y-<strong>Trasse</strong> die gewünschten, preisgünstigen Kapazitäten für die<br />
Hinterlandverbindungen der Häfen, insbesondere für den geplanten Jade-Port in<br />
Wilhelmshaven?<br />
• Ein Blick in die Karte zeigt eindeutig: Nein. Am Streckennetz westlich der Achse Rotenburg (Wümme) -<br />
Visselhövede ändert sich nichts. Auf der Strecke Hamburg - Uelzen - Celle werden zwar zusätzliche<br />
Kapazitäten geschaffen, allerdings besteht für den Güterverkehr die Hauptnachfrage tendenziell dann,<br />
wenn die ICE-Züge nicht mehr fahren, so dass die geschaffenen Kapazitäten nur wenig genutzt werden<br />
können. Für die Häfen der Reihe Emden - Bremen ändert sich nichts. Die <strong>Trasse</strong>npreise werden<br />
tendenziell durch die Y-<strong>Trasse</strong> höher ausfallen.<br />
Zu Spitzenzeiten der Nachfrage im Güterverkehr werden durch die Y-<strong>Trasse</strong> etwa fünf<br />
zusätzliche Fahrplantrassen pro Stunde geschaffen. Ist das ein guter Wert?<br />
• Natürlich sind fünf Fahrplantrassen nicht abzulehnen. Eine neue zweigleisige „Hochleistungsstrecke“<br />
sollte allerdings mindestens 15 zusätzliche Fahrplantrassen ermöglichen, die auch real verkauft werden<br />
können. Eine Variante der „Güterbahn“ ermöglicht bis zu 20 Fahrplantrassen pro Stunde.<br />
Warum ist der Reisezeitgewinn bei der Y-<strong>Trasse</strong> trotz 300 km/h Höchstgeschwindigkeit so<br />
gering?<br />
Weil die bestehenden Strecken im norddeutschen Flachland bereits „zügig“ und im Vergleich zu<br />
Mittelgebirgsstrecken direkt trassiert wurden, so dass ein Ausbau auf 200 km/h erfolgen konnte. Zusätzlich<br />
ist der 300 km/h - Abschnitt relativ kurz. Damit wirkt sich der abnehmende Grenznutzen der Geschwindigkeit<br />
besonders gravierend aus.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 72
6 Die Y-<strong>Trasse</strong> - Problem- oder Scheinlösung?<br />
Warum ist Geld für die Y-<strong>Trasse</strong> vorhanden, aber für andere wichtige Projekte in<br />
Niedersachsen können z. B. keine 19 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden<br />
(RegioStadtBahn im Bereich Braunschweig)?<br />
• Diese Frage kann leider nicht beantwortet werden, möglicherweise ist dieses politisch begründet.<br />
Wann erhält z. B. die Lüneburger Heide ein zeitgemäßes und modernes Schienennetz mit<br />
einem entsprechenden Zugangebot?<br />
• Realisierungszeitraum offen, bei Festhalten an Y-<strong>Trasse</strong>n-Planung eher unbestimmt nach Realisierung<br />
der Y-<strong>Trasse</strong>.<br />
Werden durch eine Variante „Güterbahn“ „rund um die Uhr“ Güterzüge durch die<br />
Lüneburger Heide fahren?<br />
• Nein, da nur zu bestimmten Zeiten zusätzlicher Bedarf an Fahrplantrassen besteht. Ab 20:00 bis 21:00<br />
Uhr sind auf dem vorhandenen Netz ausreichend Kapazitäten vorhanden. Außerdem werden die<br />
Güterzüge in Zukunft wesentlich leiser fahren.<br />
Werden durch die Y-<strong>Trasse</strong> die Kosten für den schienengebundenen Hinterlandverkehr von<br />
und zu den deutschen Seehäfen gesenkt werden können?<br />
• Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Da keine „günstige Güterzugstrecke“, sondern eine teure und<br />
unterhaltungsaufwändige Hochgeschwindigkeitsstrecke gebaut wird, werden die <strong>Trasse</strong>npreise<br />
tendenziell steigen. Insbesondere dann, wenn der Güterverkehr über die Y-<strong>Trasse</strong> geführt wird.<br />
Die damals ebenfalls bekämpfte NBS Hannover - Würzburg kann heute zumindest<br />
abschnittsweise als „sinnvoll“ betrachtet werden. Könnte die Y-<strong>Trasse</strong> im Nachhinein auch<br />
als „sinnvoll“ bezeichnet werden?<br />
• Nein, da die Ausgangslage und z. B. die realisierbare Reisezeitverkürzung sehr unterschiedlich ausfallen.<br />
Die NBS Hannover - Würzburg hat die Betriebsprobleme nicht auf eine andere vorhandene Strecke<br />
verlagert. Auch sind die Ziele unterschiedlich. Bei der NBS Hannover - Würzburg sollten Kapazitäts- und<br />
Reisezeitprobleme beseitigt werden, mit der Y-<strong>Trasse</strong> sollen (nur) Kapazitätsprobleme im Güterverkehr<br />
behoben werden. Die NBS Hannover - Würzburg ist im Vergleich zur Y-<strong>Trasse</strong> eine eigenständige<br />
Verbindung zwischen mehreren Knoten (Städten), die Y-<strong>Trasse</strong> eine Verbindungsstrecke zwischen<br />
vorhandenen Strecken.<br />
Wird der Wirtschaftsstandort Bundesland Niedersachsen durch die Y-<strong>Trasse</strong> (nachhaltig)<br />
gestärkt?<br />
• Nein, relativ zu den anderen Bundesländern betrachtet wird er sogar geschwächt. Profitieren wird wenn<br />
überhaupt nur der Wirtschaftsstandort Hamburg. Dieses liegt daran, dass die Y-<strong>Trasse</strong> - wie schon<br />
erwähnt - das Land Niedersachsen nicht erschließt sondern (wenn auch bescheidene) Kapazitäten für<br />
den Transitverkehr Schleswig-Holstein - Hamburg - Süddeutschland schafft. Die „niedersächsischen“<br />
Mittel werden zwar in Niedersachsen investiert, wirken werden sie aber außerhalb Niedersachsens. Auch<br />
die niedersächsischen (und bremischen) Häfen liegen außerhalb der betrieblichen Wirkungsgrenze der<br />
Y-<strong>Trasse</strong>.<br />
Erhöht die Y-<strong>Trasse</strong> die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit des Netzes?<br />
• Vom Prinzip her nein. Denn sie verbindet Strecken und keine Knoten. Zwar wird auf der Strecke<br />
Hamburg - Lüneburg - Celle die Zuverlässigkeit erhöht (dieses erfolgt allerdings auch mit dem dritten<br />
Gleis bis Lüneburg), auf der Strecke Bremen - Buchholz (Nordheide) - Hamburg wird die Zuverlässigkeit<br />
dagegen beeinträchtigt werden, auch für den ICE-Verkehr. Die beiden Konfliktknoten Hamburg und<br />
Hannover werden durch die Y-<strong>Trasse</strong> nicht entlastet.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 73
7 Wie sieht die optimale Lösung aus?<br />
7 Wie sieht die optimale Lösung aus?<br />
7.1 Allgemein<br />
Es stellt sich nun die Frage, wie die optimale, oder zumindest eine gute Lösung aussieht. Diese<br />
Frage kann weder in einem Satz noch „aus dem Bauch heraus“ beantwortet werden. Auch ist<br />
diese von der Zielsetzung abhängig: betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich oder<br />
raumordnungspolitisch optimal. Das optimale Netz für z. B. DB Reise&Touristik sieht anders aus<br />
als dass für DB Cargo. Allerdings kann eine grobe Richtung aufgezeigt werden, wie dieses Netz<br />
aussehen könnte. Denn zum einen sind bestimmte Rahmenfakten vorhanden - so wird Hamburg<br />
z. B. auch in 20 Jahren weiterhin eine bedeutende Millionenstadt sein - zum anderen bestehen<br />
gewisse Planungszwänge. Zusätzliche Gleise in den Ballungsräumen bzw. Städten können oft<br />
nicht mehr verlegt werden, wenn von kostenträchtigen Untertunnelungen oder aufgeständerten<br />
Strecken abgesehen wird.<br />
Aus den vorherigen Kapiteln lassen sich folgende „Leitgedanken“ für ein optimales Netz aufstellen<br />
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit):<br />
• Knoten oder Engpässe - oder in der Straßenverkehrsterminologie „Staus“ - sollten umfahren<br />
werden (können).<br />
• Die Ansprüche der Kunden sind unterschiedlich, nicht jeder muss möglichst schnell von A nach<br />
B kommen, einige wollen z. B. sehr preiswert fahren.<br />
• Transitverkehr ist flexibel bzgl. der geografischen Führung.<br />
• Eisenbahninfrastruktur ist vorhanden, zum Teil aber kaum genutzt.<br />
• Die finanziellen Mittel sind begrenzt.<br />
• Die Verkehrsprobleme bestehen heute, Neubaustrecken können erst in ungewisser Zukunft<br />
fertiggestellt werden.<br />
• Neben verkehrlichen Aspekten sind auch raumordnerische Aufgaben - wie „gleichwertige<br />
Lebensbedingungen“ - zu berücksichtigen.<br />
• Das Netz muss flexibel bleiben und zukünftigen Anforderungen gerecht werden - Eröffnung<br />
eines neuen Hafenterminals führt zu steigenden Güterverkehren.<br />
Unter Berücksichtigung dieser „Leitgedanken“ entsteht das in Abb. 7-1 dargestellte<br />
Eisenbahnnetz. Im Vergleich zur Abb. 2-1 ist auf den ersten Blick möglicherweise kein großer<br />
Unterschied zu sehen, da nur mehrere Strecken dicker dargestellt sind. Doch genau dieses ist der<br />
entscheidende Unterschied. Die Strecken, die heute (Abb. 2-1) zum Teil unvernetzt und zum Teil<br />
nicht leistungsfähig nebeneinander bestehen, sind vernetzt und entsprechend ihrer Anforderung<br />
ausgebaut. Dieses muss in einer Untersuchung näher festgelegt werden. Dadurch wird auch die<br />
Y-<strong>Trasse</strong> nicht mehr notwendig sein.<br />
Auch mag die Forderung des <strong>VCD</strong> LV Niedersachsen (in Abb. 7-1 grün dargestellt) sehr<br />
umfangreich und unbezahlbar erscheinen. Dieses entbehrt jeder Grundlage, da zum einen die für<br />
die Y-<strong>Trasse</strong> benötigten 1,5 Milliarden Euro zu Verfügung stehen und zum anderen ein Ausbau<br />
nach BVWP und anderen Programmen zusätzlich vorgesehen ist. Auch z. B. die Strecke<br />
Braunschweig - Uelzen soll nach [NVPZGB, 2003, S. 157] im Rahmen der RegioStadtBahn<br />
teilweise zweigleisig ausgebaut werden, so dass teilweise Synergieeffekte realisierbar sind.<br />
Dieses bedeutet nicht, dass alle Strecken durchgehend zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert<br />
werden müssen. Auch mit Diesellokomotiven kann effektiver Eisenbahnbetrieb durchgeführt<br />
werden. Ebenso folgt daraus nicht, dass auf diesem „optimalen“ Netz „rund um die Uhr“ die Züge<br />
im Minutentakt fahren.<br />
Im Vergleich zum heutigen Netz fällt auf, dass eine Konzentration auf die Knoten Hamburg,<br />
Bremen und Hannover nicht mehr gegeben ist. Das Netz ist flächendeckend, fast im gesamten<br />
Gebiet von Niedersachsen ist eine leistungsfähige Eisenbahninfrastruktur vorhanden.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 74
7 Wie sieht die optimale Lösung aus?<br />
Im Kapitel 2.3 wurden als Engpässe bzw. Konfliktpunkte u. a. die Bahnhöfe Buchholz (Nordheide)<br />
und Celle genannt. Im „optimalen“ Netz entfallen diese als Konfliktpunkte, wie Abb. A-2 zeigt: Die<br />
Personen- und Güterverkehre sind weitgehend getrennt.<br />
Eisenbahninfrastruktur Bereich Hannover / Bremen / Hamburg (Ausschnitt)<br />
(optimale Lösung?, durch Ausbau vorhandener Infrastruktur, ohne Y-<strong>Trasse</strong>)<br />
(ohne Maßstab)<br />
Kiel<br />
Skandinavien<br />
Westerland / Kiel / Flensburg /<br />
Dänemark<br />
Lübeck<br />
Cuxhaven<br />
Wilhelmshaven<br />
Nordenham<br />
Bremervörde<br />
EVB<br />
Hamburg<br />
Buxtehude<br />
Buchholz(Nordheide)<br />
Maschen<br />
Stelle<br />
Büchen<br />
OLDB<br />
Delmenhorst<br />
Bremen<br />
Osterholz-Scharmbeck<br />
Rotenburg(Wümme)<br />
Winsen(Luhe)<br />
OHE<br />
Lüneburg<br />
Wittenberge /<br />
Stendal / Berlin<br />
Norddeich /<br />
Emden /<br />
Niederlande<br />
Osnabrück<br />
BTE<br />
Kirchweyhe<br />
Syke<br />
Langwedel<br />
Thedinghausen<br />
Verden(Aller)<br />
Soltau(Han)<br />
Uelzen<br />
Osnabrück /<br />
Ruhrgebiet<br />
VGH<br />
Eystrup<br />
Nienburg(Weser)<br />
OHE<br />
Celle<br />
OHE<br />
Wittingen<br />
Stendal /<br />
Magdeburg / Berlin<br />
Wunstorf<br />
Gifhorn<br />
Wolfsburg<br />
Hannover<br />
Lehrte<br />
Peine<br />
Stendal / Berlin<br />
Minden(Westf)<br />
VPS<br />
Braunschweig<br />
Magdeburg /<br />
Berlin /<br />
Halle(Saale)<br />
Niederlande / Osnabrück<br />
Elze(Han)<br />
Hildesheim<br />
Löhne<br />
Hameln<br />
SFS<br />
Salzgitter<br />
Ruhrgebiet / Bielefeld<br />
Paderborn / Dortmund<br />
Kreiensen<br />
Seesen Goslar /<br />
Bad Harzburg<br />
Halberstadt /<br />
Halle (Saale)<br />
Nordhausen / Erfurt<br />
Strecken der DB Netz AG:<br />
Göttingen /<br />
Süddeutschland<br />
"leistungsfähig"<br />
Forderung des <strong>VCD</strong> LV Niedersachsen<br />
Ausbau dieser Strecken als Teil des<br />
<strong>Hochleistungsnetz</strong>tes <strong>statt</strong> singuläre Y-<strong>Trasse</strong><br />
Strecken der BTE, EVB, VGH, OHE und VPS :<br />
"leistungsfähig"<br />
BTE: Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH (ab Bremen-Huchting)<br />
EVB: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH<br />
OHE: Osthannoversche Eisenbahn AG<br />
VGH: Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH<br />
VPS: Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH<br />
Abb. 7-1: Eisenbahninfrastruktur Untersuchungsraum optimal? Ohne Y-<strong>Trasse</strong>.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 75
7 Wie sieht die optimale Lösung aus?<br />
7.2 Beispiele für mögliche Verbesserungen<br />
Hier soll auf weitere Verbesserungen eingegangen werden, die in den vorangegangenen Kapiteln<br />
nicht genannt worden sind.<br />
Reisezeiten<br />
Wird der in Abb. 7-1 dargestellte Ausbauzustand der Eisenbahninfrastruktur angenommen (bzw.<br />
die Forderungen des <strong>VCD</strong> LV Niedersachsen) könnten für den Bereich Lüneburger Heide<br />
beispielsweise die in Tab. 7-1 Verbesserungen erreicht werden können.<br />
Nah- und Regionalverkehr in der Lüneburger Heide durch Variante „Güterbahn“ 1 (Vmax: 120 km/h)<br />
(mit „Lückenschluss“ Soltau - Bennemühlen)<br />
Strecke 2002 bzw. vor Ausbau (1996) nach Ausbau Bemerkungen<br />
Reisezeit<br />
(Zwischenhalte)<br />
Züge<br />
Mo-Fr / Sa / So<br />
Reisezeit<br />
(Zwischenhalte)<br />
Züge<br />
Mo-Fr / Sa /<br />
So<br />
Hannover - Mellendorf (22 km) 23 - 29 Min (2-3) 16 / 14 / 8 18 / 23 Min. (1/7) 44 / 40 / 28 + 175 - 250 % !<br />
Mellendorf - Soltau (66 km) 1) 71 / 92 Min. (8) 14 / 11 / 8 2) 51 Min. (8) 3) 17 / 14 / 12 5)<br />
Soltau - Buchholz(Nordheide)<br />
(45 km)<br />
51 - 69 Min. (7/9) 16 / 12 / 8 35 Min. (9) 3) 17 / 14 / 12 5) tägl. Durchbindung bis<br />
Hamburg möglich<br />
Soltau - Celle keine Verbindung 24 Min. (1-3) 4) 17 / 14 / 12 5) Soltau - Hannover: 50<br />
Min, bei Anschluss IR<br />
1) 5) alle zwei Stunden umsteigen in Bennemühlen<br />
mindestens<br />
2) + 3 / 1 / 1 bis Walsrode<br />
3) Reisegeschwindigkeit der S 94409 im Fahrplan 2003 von Bennemühlen - Hannover Hbf<br />
26 km, 20 Minuten, 3 Zwischenhalte = 78 km/h angesetzt.<br />
4) nach [Andersen, 2000, S.522]<br />
Tab. 7-1: Nah- und Regionalverkehr in der Lüneburger Heide durch „Güterbahn“<br />
Insbesondere die Reisezeitverkürzungen und die neue Verbindung Soltau (Han) - Celle fallen hier<br />
auf.<br />
Ähnlich werden in anderen Relationen die Verbesserungen ausfallen, wie Bremen - Uelzen,<br />
Braunschweig - Lüneburg - Hamburg / Kiel / Lübeck oder Hildesheim - Hameln - Bielefeld. Für<br />
den Bereich Hannover ergeben sich die Verbesserungen in der Form, als dass hier die<br />
Zuverlässigkeit erhöht wird und zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden. Die Strecken<br />
Hannover - Hamburg bzw. Bremen können im Vergleich zu heute zuverlässig auf mindestens 70<br />
bzw. 55 Minuten reduziert werden.<br />
Wirtschaftlicher Aufschwung?<br />
In einem sehr interessanten Artikel in der Frankfurter Rundschau vom 19. 02. 2003 beschreibt<br />
Karl-Otto SATTLER, wie die Region Karlsruhe mit einem vorbildlichen Nahverkehrssystem in den<br />
Wirtschaftsaufschwung fährt.<br />
„Da wundert sich der schaffige Schwabe. Und auch ansonsten reibt sich in Baden-Württemberg<br />
so mancher unter Politikern, Managern und Journalisten erstaunt die Augen. Nicht mehr der<br />
Großraum Stuttgart mit seiner Automobilindustrie und seinem Maschinenbau ist im „Musterländle“<br />
der dynamischste ökonomische Motor, sondern, wer hätte das jemals gedacht, der Landkreis<br />
Karlsruhe. [...] [D]as Umfeld der badischen Fächerstadt, so offenbaren es die Statistiken, weist<br />
unter allen 44 südwestdeutschen Stadt- und Landkreisen mittlerweile die stärksten<br />
Wachstumsraten auf.“<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 76
7 Wie sieht die optimale Lösung aus?<br />
Im vergangenen Jahrzehnt lag die Steigerungsrate im Karlsruher Umland bei 50 Prozent, der<br />
Durchschnitt lag nur um die 30 Prozent. Auch wenn die Ansiedlungspolitik mit<br />
Technologieprojekten eine zentrale Rolle spielte, ist für die Kommunalpolitiker „indes unstreitig,<br />
dass noch ein anderer Aspekt ins Gewicht fällt: nämlich ein „extrem gutes Stadtbahnnetz“, so<br />
Landrat Claus Kretz.<br />
Was vor 20 Jahren noch als abwegig galt, hat sich inzwischen bewahrheitet: Ein effizienter<br />
öffentlicher Nahverkehr ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern noch ein erstrangiger<br />
Wirtschaftsfaktor.“ (Im Original nicht fett markiert.)<br />
Den Startschuss für dieses erfolgreiche Karlsruher Modell, bei dem die Stadtbahn auch<br />
Eisenbahnstrecken mit Zweisystem-Fahrzeugen befährt (Planung in Bremen als<br />
RegionalStadtbahn, in Braunschweig als RegioStadtBahn), war 1992 die Linie Karlsruhe -<br />
Bretten. Waren es zuvor etwa 2.000 Fahrgäste täglich, so sind es inzwischen 16.000 tägliche<br />
Kunden.<br />
(Anmerkung des Verfassers: Im DB-Kursbuch sind es u. a. die Kursbuchstrecken 710.1 - 710.9 die den<br />
Fahrplan dieses Erfolgsmodells zeigen.)<br />
Was bedeutet dieses für die Y-<strong>Trasse</strong> bzw. für die Raum- und Wirtschaftsplanung. Der Nah- und<br />
Regionalverkehr wird durch die Y-<strong>Trasse</strong> nur sehr wenig profitieren, überhaupt nicht (Lüneburger<br />
Heide) oder sogar Nachteile in Kauf nehmen müssen (Rotenburg (Wümme) - Hamburg). Der<br />
Fernverkehr ist bereits heute sehr gut im norddeutschen Bereich und wird nicht<br />
„quantensprungmäßig“ verbessert, wie es beispielsweise bei der Neubaustrecke Hannover -<br />
Würzburg der Fall war.<br />
Die Region Lüneburger Heide ist zwar nicht mit der Region Karlsruhe vergleichbar - eher die<br />
Regionen Bremen und Braunschweig, wo ein vergleichbares System aufgebaut werden soll - aber<br />
die prinzipielle Aussage ist, dass ein effizienter Nahverkehr ein erstrangiger Wirtschaftsfaktor ist.<br />
Auch zeigt ein Blick auf die Eisenbahninfrastruktur, das z. B. in Baden-Württemberg ein dichtes<br />
Netz generell und insbesondere an leistungsfähigen, zweigleisig elektrifizierten<br />
Eisenbahnstrecken besteht. In einem überwiegend sehr dünn besiedelten Flächenland wie<br />
Niedersachsen, ist ein solches Netz auf Grund des eigenen Potenzials eher nicht notwendig bzw.<br />
wirtschaftlich. Der „Transitverkehr“ u. a. von und zu den Häfen erlaubt es dagegen, hier eine<br />
moderne, wirtschaftliche und leistungsfähige Infrastruktur zu erhalten. Damit steht den negativen<br />
Belastungen aus dem Transitverkehr ein positiver Ausgleich entgegen. Die Y-<strong>Trasse</strong> schafft<br />
keinen positiven Ausgleich, es ist eine „reine Transitstrecke“.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 77
8 Auf dem Weg zum leisen <strong>Hochleistungsnetz</strong><br />
8 Auf dem Weg zum leisen <strong>Hochleistungsnetz</strong><br />
8.1 Was ist ein <strong>Hochleistungsnetz</strong>?<br />
Unter einem „<strong>Hochleistungsnetz</strong>“ wird möglicherweise an ein durchgehendes Netz von zweigleisig<br />
elektrifizierten Strecken mit Schallschutzwänden für eine Geschwindigkeit von über 200 km/h<br />
gedacht. Dadurch wäre z. B. nach Abb. 7-1 Soltau (Han) von Eisenbahnstrecken umschlossen.<br />
Diesem ist nicht so. Unter einem „<strong>Hochleistungsnetz</strong>“ soll hier ein Eisenbahnnetz mit folgenden<br />
Eigenschaften verstanden werden.<br />
Definition <strong>Hochleistungsnetz</strong><br />
• Es ist netz- nicht knoten- bzw. linienorientiert und nutzt die gesamte vorhandene<br />
Eisenbahninfrastruktur. Verkehre, die nicht über bestimmte Abschnitte geführt werden müssen,<br />
können um Engpässe herumgeleitet werden. Einige Strecken können dabei auch nur die<br />
Funktion der Übernahme der zeitlich begrenzten Spitzennachfrage übernehmen.<br />
• Verkehrsströme unterschiedlicher Richtungen behindern sich nicht durch höhengleiche<br />
Kreuzungen der Wege. Dieses führt zu Über- bzw. Unterführungen. Damit werden die<br />
Abhängigkeiten bei der Fahrplangestaltung verringert, ebenso der Energieaufwand des<br />
Systems.<br />
• Das Netz ist sehr zuverlässig, d. h. netzbedingte Verspätungen treten kaum auf.<br />
• Das Netz ist flexibel, d. h. zusätzliche Züge können ohne Probleme und sehr kurzfristig<br />
gefahren werden.<br />
• Es erfüllt die biokybernetischen Grundregeln (siehe u. a. Kap. 6.3), so dass es sehr<br />
wirtschaftlich ist.<br />
8.2 Planungsablauf<br />
Die Planung von Verkehrsinfrastruktur steht vor dem Problem, dass das Ergebnis der Planung<br />
erst nach einigen Jahren oder sogar Jahrzehnten (siehe NBS Hannover - Würzburg) für den<br />
Verkehr zur Verfügung steht, sofern sich die Rahmenbedingungen nicht geändert haben und das<br />
Projekt realisiert wird. Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur stellen im Regelfall eine<br />
bedeutende absolute Belastung für den Haushalt dar. Eine einmal erstellte Infrastruktur kann<br />
nach dem Bau nicht einfach an einen anderen Ort verkauft oder durch Umbau einer anderen<br />
Nutzung zugeführt werden, wie dieses z. B. bei Fahrzeugen der Fall ist. Daher ist eine<br />
sorgfältigste Planung notwendig.<br />
Beim BVWP wird als Planungsgrundlage eine koordinierte Gesamtverkehrsprognose verwendet,<br />
die sich aus mehreren Einzelprognosen, z. B. zur soziodemographischen Entwicklung,<br />
zusammensetzt. Prognosen für einen sehr langen Zeitraum sind sehr fehleranfällig. Dieses liegt<br />
darin begründet, dass viele Annahmen für eine Prognose getroffen werden müssen, u. U. wird<br />
dazu wieder nur auf eine Prognose zurückgegriffen. Tritt eine dieser Annahmen nicht ein, stimmt<br />
damit im Regelfall auch die Prognose nicht mehr. Dieses liegt in der Methodik begründet und ist<br />
kein Zeichen von mangelhafter Erstellung, sofern nicht bewußt „manipuliert“ wird. Wie im Kapitel<br />
4 gezeigt wurde, sind Prognosen im Endeffekt kein effektives Hilfsmittel für die Planung,<br />
insbesondere dann, wenn vergangene Entwicklungen „einfach“ durch Hochrechnung<br />
(Extrapolation) in die Zukunft übertragen werden. „Außer für einen beschränkten - jeweils<br />
systemspezifischen - Zeithorizont ist sie für eine Prognose des Verhaltens komplexer Systeme<br />
völlig ungeeignet und eine daran orientierte Planung kann zu schwerwiegenden<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 78
8 Auf dem Weg zum leisen <strong>Hochleistungsnetz</strong><br />
Fehlentwicklungen führen.“ [Vester, 2000, S. 61] Wegen ihrer „methodischen Schwäche“ und<br />
„ihrer leider kaum zu bremsenden Beliebtheit“ [ebd., S. 61], widmet VESTER ihr ein eigenes<br />
Unterkapitel. Danach ist für die langfristige Entwicklung eines Systems weniger dessen Ist-<br />
Zustand zugrunde zu legen, „als vielmehr das übergeordnete Gesamtmuster des Systems, das je<br />
nach seiner inneren Struktur auch bei sehr unterschiedlichen Konstellationen der Einzelelemente<br />
eine Aussage erlaubt.“ [ebd., S. 94].<br />
Was bedeutet dieses für die Planung? Der grobe Ablauf der Planung ist in Abb. 8-1<br />
zusammengefasst. Bevor überhaupt geplant werden kann, muss das Ziel definiert werden. Soll<br />
beispielsweise primär für den Güterverkehr Kapazität geschaffen werden oder soll der<br />
Personenverkehr beschleunigt werden mit dem „Nebenprodukt“, dass auch für den Güterverkehr<br />
Kapazitäten geschaffen werden, die dann allerdings für den Güterverkehr wahrscheinlich nicht<br />
optimal sind.<br />
Erst danach kann - entsprechend dem gewünschten Ziel - in einem ersten Schritt das<br />
„übergeordnete Gesamtmuster des Systems“ ermittelt werden, hier also die Struktur der<br />
Verkehrsnachfrager, so das ein Anforderungsprofil erstellt werden kann.<br />
Anforderungsprofil erstellen: Wer benötigt was, zu welcher Zeit und in welcher Qualität?<br />
In diesem Schritt müssen die Nutzer und potenziellen Nutzer der Schieneninfrastruktur befragt<br />
werden. Dazu gehören die entsprechenden Unternehmen der Wirtschaft, die<br />
Eisenbahnverkehrsunternehmen, die die Wünsche bzw. den Bedarf ihrer Kunden sehr gut kennen<br />
und auch die jeweiligen Aufgabenträger für den SPNV. Insbesondere für den norddeutschen<br />
Bereich müssen hier die Bedürfnisse und Planungen der Seehäfen berücksichtigt werden. Aber<br />
auch die politischen Vorgaben der Landesraumordnungsprogramme finden hier Eingang.<br />
Dieses ist wichtig, um herauszufinden, wer was zu welcher Zeit und in welcher Qualität benötigt.<br />
Wenn beispielsweise die Seehäfen der Reihe Emden - Bremen ab etwa 17:00 Uhr ihre Güterzüge<br />
Richtung Hannover schicken wollen, dann sind dieses unter Umständen relativ viele Züge, weil<br />
sie aber ab Bremen auf Grund der unterschiedlichen Entfernungen zeitlich versetzt ankommen,<br />
wird vom Prinzip her keine zusätzliche Infrastruktur benötigt.<br />
In einem nächsten Schritt wird dieses Anforderungsprofil in eine Fahrplanstruktur umgesetzt.<br />
Diese wird simuliert und bezüglich der Betriebsqualität bewertet.<br />
Parallel dazu wird eine Netz- und Raumanalyse durchgeführt. Hier wird ermittelt, an welchen<br />
Stellen des bestehenden Netzes bereits Engpässe vorhanden sind bzw. wo die Leistungsgrenze<br />
liegt. Auch müssen die Zwangspunkte für einen Netzausbau festgestellt werden, also die Punkte,<br />
an denen z. B. ein verlegen zusätzlicher Gleise praktisch nicht mehr möglich ist, wie auf dem<br />
Abschnitt Hannover Hbf - Hannover Bismarckstraße.<br />
Die als gut ermittelte Fahrplanstruktur wird dann auf die vorhandenen Schienenwege umgelegt<br />
und mit dem analysierten Netz verglichen. Hier werden dann weitere oder zukünftige<br />
Engpässe sichtbar. Durch ein „Anpassen“ der optimalen Fahrplanstruktur an das Netz kann dann<br />
u. U. einer Verbesserung erreicht werden. Dieser Schritt ist notwendig, um das vorhandene Netz<br />
optimal und damit kostengünstig auszulasten. Allerdings darf es auch nicht dazu führen, dass die<br />
ICE-Züge mit z. B. 140 km/h von Hannover nach Hamburg fahren müssen.<br />
Es muss immer überprüft werden, welche (Rück-)Wirkungen eine jeweilige Maßnahme erzeugt.<br />
Was passiert, wenn beispielsweise ein Abschnitt nur eingleisig gebaut wird, ein anderer nicht<br />
elektrifiziert wird.<br />
Ist in diesem rekursiven Prozess keine Verbesserung mehr zu erzielen, steht die<br />
Fahrplanstruktur. Gleichzeitig steht durch die vorherige Ermittlung der Zwangspunkte fest, wieviel<br />
Verkehr „umgeleitet“ werden muss. Daraus kann dann das „optimale“ Netz ermittelt werden.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 79
8 Auf dem Weg zum leisen <strong>Hochleistungsnetz</strong><br />
Der Planungsablauf zum <strong>Hochleistungsnetz</strong><br />
eindeutige Zielbeschreibung<br />
Hauptziel(e), Nebenziel(e)<br />
Anforderungsprofil erstellen<br />
Ermittlung der Bedarfs- und<br />
Nachfragestruktur<br />
- Quelle - Ziel - Relation<br />
- Betriebsmengen / Zahl der Züge<br />
- Zeit- / Taktlage<br />
- Betriebsqualität<br />
Netz- und Raumanalyse<br />
(Engpässe, Konfliktpunkte)<br />
Fahrplanstruktur erstellen<br />
(simulieren und bewerten bzgl.<br />
Betriebsqualität)<br />
Fahrplanstruktur auf vorhandene Schienenwege umlegen und<br />
mit analysiertem Netz vergleichen (betriebssystematische Untersuchung)<br />
(Defizite werden erkennbar)<br />
"optimales" Netz<br />
Festlegen und Umsetzen der<br />
kurz- , mittel- und langfristigen<br />
Maßnahmen<br />
Abb. 8-1: Der Planungsablauf<br />
Als letzter Schritt muss dann ein zeitlicher Ausbauplan mit den kurz- mittel- und langfristigen<br />
Maßnahmen aufgestellt werden. Dieser muss flexibel bleiben, so dass bei Änderung von<br />
Rahmenbedingungen auch reagiert werden kann und z. B. Maßnahmen in der Reihenfolge<br />
getauscht werden können.<br />
Dieser Prozess ist nicht starr. Es muss in kürzeren Abständen oder nach Realisierung einer<br />
Maßnahme geprüft werden, inwieweit eine Korrektur des Ablaufs notwendig ist.<br />
8.3 Finanzierung<br />
Für die Finanzierung dieses <strong>Hochleistungsnetz</strong>es stehen etwa 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung.<br />
Dieses ist die Summe, die die Bundes- und Landesregierung für die Y-<strong>Trasse</strong> in ihren Haushalten<br />
eingeplant haben (müssen), sofern sie beschlossen wird. Sollten diese 1,5 Milliarden Euro nicht<br />
zur Verfügung gestellt werden können oder stehen, muss der Bau der Y-<strong>Trasse</strong> aus finanzieller<br />
Sicht entfallen. Das Hochleistungsschienennetz kann auch abschnittsweise mit kleineren<br />
Beträgen realisiert werden.<br />
Diese Mittel werden u.a. über das Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSchwAG) bereitgestellt<br />
bzw. die Verteilung wird dort geregelt. Der Geltungsbereich des BSchwAG ist allerdings auf<br />
Eisenbahnen des Bundes bzw. bundeseigene Gesellschaften beschränkt. Eine Investition in<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 80
8 Auf dem Weg zum leisen <strong>Hochleistungsnetz</strong><br />
Infrastruktur Nichtbundeseigener Eisenbahnen (NE), wie BTE, EVB, OHE oder VGH, scheidet<br />
damit aus.<br />
Angesichts der überregionalen Verkehrsströme und des dichtbesiedelten Raumes der<br />
Bundesrepublik Deutschland ist dieser Zustand zur Lösung der Probleme nicht förderlich. Denn<br />
für den Ausbau von NE-Infrastruktur stehen von gesetzlicher Seite im wesentlichen nur Mittel aus<br />
dem Regionalisierungsgesetz (RegG) und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)<br />
zur Verfügung. In fortschrittlichen Bundesländern besteht ein eigenes<br />
Ländereisenbahnfinanzierungsgesetz, so z. B. in Baden-Württemberg mit der langen<br />
Bezeichnung „Gesetz über die Finanzierung von Schienenwegen und Schienenfahrzeugen der<br />
nichtbundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen in Baden-Württemberg“. Abgesehen davon, dass<br />
diese Mittel unter Umständen im Vergleich zum Umfang der BSchwAG-Mittel relativ gering sind,<br />
würde eine Verwendung der Mittel aus RegG oder GVFG eine „Zweckentfremdung“ darstellen, da<br />
diese für „lokale“ Infrastrukturinvestitionen vorgesehen sind.<br />
Zur Bewältigung der nationalen und internationalen Verkehrsströme ist daher das BSchwAG<br />
dahingehend zu ändern, dass jegliche Schienenwegeinvestition gefördert wird, also eine<br />
Änderung in ein „neutrales“ Schienenwegeausbaugesetz.<br />
8.4 Lärmschutz und -vermeidung<br />
Der Lärmschutz bzw. die Lärmvermeidung ist beim Ausbau bestehender Strecken ein sehr<br />
wichtiger und nicht zu vernachlässigender Faktor. Dieses aus dem Grund, dass vor allem auf<br />
Strecken, die bisher kaum Verkehr aufgewiesen haben, insbesondere der Güterverkehr gelenkt<br />
werden soll. Auch wenn die betroffenen Regionen vom Ausbau profitieren werden - durch ein<br />
besseres Angebot im Personenverkehr oder durch sehr gute Standortbedingungen für die<br />
Wirtschaft - wird die Bevölkerung dem Ausbau ablehnend gegenüberstehen. Der persönliche<br />
Vorteil durch den Ausbau wird erst später erlebbar (siehe z. B. S-Bahn Hannover).<br />
Während die neuen, modernen Personenzüge bereits sehr leise sind, sieht dieses bei den<br />
Güterzügen anders aus. Die DB AG bzw. DB Cargo geht hier den richtigen Weg und rüstet alle<br />
ihre Neubestellungen an Güterwagen mit so genannten Flüsterbremsen aus. Diese sind im<br />
Vergleich zu den alten Bremsen um bis zu zehn Dezibel leiser. Dieses entspricht einer Halbierung<br />
des Lärms.<br />
Da aber diese Flüsterbremsen nicht den gleichen gesetzlichen Stellenwert wie Lärmschutzwände<br />
oder Schallschutzfenster besitzen, werden die vorhandenen 90.000 Güterwagen der DB AG nicht<br />
umgerüstet. (Siehe dazu den sehr interessanten Artikel aus der Zeitschrift DB-mobil „Die Bahn<br />
rückt dem Lärm zu Leibe“ im Anhang.)<br />
Eine vergleichbare Regelung wie in der Schweiz, bei der der Staat die Nachrüstung der<br />
vorhandenen Güterwagen finanziert, sollte auch für Deutschland umgesetzt werden.<br />
Dieses ist nur ein Beispiel für die Reduzierung der Lärmemissionen. Die Kombination mehrerer<br />
Maßnahmen bewirkt eine weitere Lärmminderung.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 81
9 Zusammenfassung und Fazit<br />
9 Zusammenfassung und Fazit<br />
Die Strecke Hamburg - Hannover ist vor allem im Abschnitt Stelle - Lüneburg überlastet, so dass<br />
hier insbesondere zusätzliche Güterzüge nicht verkehren können. Die zur Zeit favorisierte<br />
Lösungsvariante ist die so genannte Y-<strong>Trasse</strong>, eine relativ kurze Hochgeschwindigkeitsstrecke,<br />
die vor allem für den Güterverkehr zusätzliche Kapazitäten zwischen Hannover und Hamburg /<br />
Bremen schaffen soll. Für den Personenfernverkehr soll zusätzlich eine Fahrzeitverkürzung<br />
erreicht werden. Gleichzeitig ist in Niedersachsen noch umfangreiche Schieneninfrastruktur<br />
vorhanden, die überwiegend nicht leistungsfähig ausgebaut ist.<br />
Die geplanten Ziele werden mit der Y-<strong>Trasse</strong> zwar nicht verfehlt, im Vergleich zu den Alternativen,<br />
erweist sich die Y-<strong>Trasse</strong> allerdings als weit unterlegen, so dass den Baukosten von etwa 1,5<br />
Milliarden Euro kein entsprechender Nutzen gegenübersteht. Dieses liegt vom Prinzip an zwei<br />
Gründen, die systembedingt sind: Die Y-<strong>Trasse</strong> verbindet vorhandene Strecken (Langenhagen -<br />
Visselhövede / Scheeßel) in Form einer Transitstrecke , keine überlasteten Knoten (Hannover Hbf<br />
- Bremen Hbf / Hamburg Hbf) und ist eine für den Personenverkehr optimierte Strecke, die den<br />
Anforderungen des Güterverkehrs widerspricht. Bei der zur Zeit geführten Diskussion wird<br />
zusätzlich außer Acht gelassen, dass nicht nur die Strecken, sondern vor allem auch die Knoten<br />
(Bahnhöfe, Abzweigstellen) die leistungsbegrenzenden Elemente sind.<br />
Die Y-<strong>Trasse</strong> verbessert nicht die Schieneninfrastruktur in Niedersachsen und erschließt nicht die<br />
Fläche. Damit stärkt die Y-<strong>Trasse</strong> weder die Wettbewerbsfähigkeit Niedersachsens noch den<br />
Wirtschaftsstandort Niedersachsen. Für Bremen ergeben sich keine Verbesserungen. Aus<br />
betrieblicher Sicht wird weder die Zuverlässigkeit des Netzes erhöht, noch werden in der Summe<br />
Probleme beseitigt (siehe dazu insbesondere die Zusammenfassung in Kapitel 6.7).<br />
Die Alternativen bestehen in dem Ausbau der vorhandenen Schieneninfrastruktur. Die<br />
Grundgedanken sind die, dass vor allem für den Güterverkehr Kapazitäten benötigt werden<br />
(Beachtung der Zielsetzung), die vorhandene Infrastruktur ohnehin ausgebaut werden soll<br />
(Vermeidung von Doppelinvestitionen und Nutzung von Synergieeffekten), das Flächenland<br />
Niedersachsen mit hochwertiger Schieneninfrastruktur zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes<br />
erschlossen werden muss und die öffentlichen Mittel begrenzt sind. Zusätzlich entsprechen die<br />
Alternativen den Zielen der Landesraumordnung, in dem diese einen Beitrag zu den<br />
„gleichwertigen Lebensbedingungen“ leisten. Dabei werden die biokybernetischen Grundregeln<br />
nicht missachtet. Die negativen Auswirkungen des Transitverkehrs durch Niedersachsen können<br />
zwar nicht beseitigt werden, aber nach dem Jiu-Jitsu-Prinzip positiv genutzt werden können.<br />
Die wesentlichen Ausbaunotwendigkeiten sind in der <strong>VCD</strong> - Resolution 2003 zum<br />
Hochleistungsschienennetz (Kap. 6.5.5) enthalten. Der entsprechende Ausbaustandard muss in<br />
einer eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Untersuchung ermittelt und festgelegt werden.<br />
Fazit:<br />
Die in dieser Arbeit vorgestellten Alternativen sind aus verkehrswissenschaftlicher und<br />
finanzierungstechnischer Sicht und aus raumordnungspolitischen Gründen der Y-<strong>Trasse</strong> weit<br />
überlegen. Dadurch ist - im Gegensatz zur Y-<strong>Trasse</strong> - die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die<br />
Kapazitäten überhaupt und in naher Zukunft erweitert werden können.<br />
Gleichzeitig kann das Land Niedersachsen mit hochwertiger Eisenbahninfrastruktur flächenmäßig<br />
erschlossen werden (vergleichbar Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen),<br />
wodurch sowohl der Wirtschaftsstandort Niedersachsen nachhaltig gestärkt wird, als auch den<br />
Seehäfen - einschließlich denen in Bremen und Hamburg - zukunfts- und leistungsfähige<br />
Hinterlandverbindungen zur Verfügung stehen.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 82
9 Zusammenfassung und Fazit<br />
Prof. Dr. Gerd Aberle im Editorial von Internationales Verkehrswesen Nr. 4/2003:<br />
„Güterverkehr - unterbewertet und wenig geschätzt“<br />
„[...] Auch bei der Bahn - hier der DB AG - dreht sich zunächst alles um den<br />
Personenverkehr. Die Investitionsmittel fließen in extrem teure Hochleistungsstrecken, in<br />
aufwendige Bahnhofsumbauten und hochpreisige Hochleistungszüge. Rechnen tut sich<br />
dies alles nicht; vielmehr steht der Steuerzahler stark in der Verantwortung. [...] Obwohl<br />
die zukünftigen Wachstumsraten des Güterverkehrs auf besorgniserregende<br />
Kapazitätsengpässe stoßen, sind die schon seit vielen Jahren diskutierten Maßnahmen zur<br />
Schaffung spezieller Güterverkehrsstrecken, Knotenumgehungen, dritter Gleise und<br />
ähnliches offensichtlich zeitlich erheblich gestreckt worden. [...]“ (im Original nicht fett)<br />
Für Niedersachsen, Hamburg und Bremen wird in dieser Studie ein entsprechendes Konzept<br />
vorgestellt. Es kann gehandelt werden, die Möglichkeiten sind vorhanden.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 83
Literatur<br />
Literatur<br />
Verwendete Literatur<br />
[Andersen, 2000] Andersen, Sven: Betriebliche Betrachtungen zu einem Netzausbau im norddeutschen Raum.<br />
Eisenbahn-Revue International 11/2000, S. 515 - 523<br />
[Andersen, 2002] Andersen, Sven: Quo vadis, Hochgeschwindigkeitsverkehr in Deutschland? Eine kritische<br />
Bestandsaufnahme. Eisenbahn-Revue International 11/2002, S. 525 - 535<br />
[Bodack, 2002]<br />
Bodack, Karl-Dieter: Fahrpläne und Zugangebote im Fernverkehr der DB,<br />
Eisenbahn-Revue International 4/2002, S. 197 - 205<br />
[Breimeier, 1999] Breimeier, Rudolf: Die Planung von Neubau- und Ausbaustrecken im deutschen Eisenbahnnetz<br />
Eisenbahn-Revue International 3/1999, S. 79 - 87<br />
[Breimeier, 2/2001] Breimeier, Rudolf: Eine Neubaustrecke oder eine Ausbaustrecke in Norddeutschland, Entgegnung zum<br />
Aufsatz [Andersen, 2000], Eisenbahn-Revue International 2/2001, S. 90 - 93<br />
[Breimeier, 12/2001] Breimeier, Rudolf: Wettbewerb auf der Schiene und Trennung von Netz und Transport - der einzige Weg<br />
zur wirtschaftlichen Gesundung der Eisenbahn? in<br />
ZEV + DET Glasers Annalen 125, Ausgabe 12/2001, S.528 - 543<br />
[der schienenbus] der schienenbus, das Nachrichtenmagazin der Arbeitsgemeinschaft Schienenverkehr e.V.,<br />
Rotenburg(Wümme), Ausgabe jeweils direkt angegeben<br />
[Eisenbahn-Revue,...] Eisenbahn-Revue International,<br />
Ausgabe 1/2001: Zwischenbilanz deutsche Bahnreform - eine finanzpolitische, unternehmerische und<br />
verkehrliche Bewertung<br />
Ausgabe 5/2001: Neues <strong>Trasse</strong>npreissystem der DB Netz AG, S. 229<br />
[Drucksache, 14/8754] Deutscher Bundestag - 14. Wahlperiode: Straßenbaubericht, 8. 4. 2002<br />
[IBB, 2000]<br />
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb, TU Braunschweig, Univ.-Prof. Dr. R. Wanninger: Wirtschaftliche<br />
Aspekte des Bauens, Skript zur Vorlesung, 3. Auflage, Stand 09/2000<br />
[IBS/ConTrack, 2001] Arbeitsgemeinschaft IBS/ConTrack (Ing.büro für Bahnbetriebssysteme GmbH und Consulting-Gesellschaft<br />
für Schienenbahnen mbH): Möglichkeiten der Nutzung der Aus-/Neubaustrecke Hamburg/Bremen -<br />
Hannover (Y-<strong>Trasse</strong>) für den Nah- und Regionalschienenverkehr, Hannover, Dezember 2001<br />
[IHK BS, 1960]<br />
Die Braunschweiger Wirtschaft und der neue Bahnhof. Broschüre herausgegeben von der Industrie- und<br />
Handelskammer Braunschweig aus Anlass der Eröffnung des neuen Braunschweiger Personenbahnhofs<br />
am 1. Oktober 1960.<br />
[Jänsch, 2001] Jänsch, Eberhard: Netz und Fahrwegentwicklung, in 50 Jahre ETR, S. 96 - 110<br />
Eisenbahntechnische Rundschau, 2001<br />
[Kügler, Lorenzen, 2002] Kügler, Hubert, Lorenzen, Carsten: Netzinfrastruktur für NeiTech-Züge auf 3500 Streckenkilometern.<br />
ETR - Eisenbahntechnische Rundschau März 2002, S. 127 - 139<br />
[Lanz, Hardebber, 1992] Lanz, Peter, Hardebber, Hans Peter: Chance, Illusion, Realität. Über das behinderungsfreie Fahren von<br />
Zugbündeln mittels rechnerunterstützter Betriebsführung. Eisenbahn-Kurier, Ausgabe 7/1992, S. 42 - 45<br />
[LNVG, 5/2001] LNVG-Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH: Zeit für Bahnhöfe. Mit Engagement<br />
gemeinsam zum Erfolg. Hannover, Juni 2001<br />
[LNVG, 11/2001] LNVG-Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH und Niedersächsisches Ministerium für<br />
Wirtschaft, Technologie und Verkehr: Niedersachsen ist am Zug! Strategien für den<br />
Schienenpersonennahverkehr in Niedersachsen 2001-2005, Hannover, November 2001<br />
[Moorexpress, 2002] Freie Fahrt für den Moorexpress. Dokumentation der Tagung „Eine Zukunft für die Moorbahn“ am 6. März<br />
2002 des Niels-Stensen-Hauses und des Verkehrsclub Deutschland (<strong>VCD</strong>) im Niels-Stensen-Haus in<br />
Worphausen / Lilienthal bei Bremen.<br />
[NVPZGB, 2003, (S)] Nahverkehrsplan 2003 für den Großraum Braunschweig. Zweckverband Großraum Braunschweig,<br />
Braunschweig 2003. (S) = Synopse der Stellungnahmen des Anhörverfahrens zum Entwurf des<br />
Nahverkehrsplans 2003 - 2007 vom Oktober 2002.<br />
[Pachl, 1998]<br />
Pachl, Jörn: Die verschränkte Dreigleisigkeit; Ein innovatives Ausbaukonzept für Mischbetriebsstrecken.<br />
in EI - DerEisenbahningenieur(49), Ausgabe 3/1998, S. 27 - 29<br />
[Pachl, 1999] Pachl, Jörn: Systemtechnik des Schienenverkehrs, B.G. Teubner Verlag, Stuttgart ; Leipzig, 1999<br />
[Schwarz, 2002] Schwarz, Axel: Richtig nah am Wasser gebaut. Die deutschen Seehäfen und ihr Hinterlandverkehr.<br />
Internationales Verkehrswesen Nr. 4 April 2002, S. 170 - 173<br />
[Sichelschmidt, 2003] Sichelschmidt, Henning: Wettbewerbspolitik und Infrastrukturprojekte in den deutschen Seehäfen.<br />
Internationales Verkehrswesen Nr 1+ 2 Januar / Februar 2003, S. 16 - 19<br />
[Siegmann, 2001] Siegmann, Jürgen: Angebotsstrategien und Produktionsplanungen einer zukunftsfähigen Bahn, in 50 Jahre<br />
ETR, S. 84 - 95, Eisenbahntechnische Rundschau, 2001<br />
[Vieregg&Rössler,1993] Vieregg&Rössler GmbH, Innovative Verkehrs- und Umweltberatung: Vorstudie über Ausbaumöglichkeiten<br />
im Schienenverkehr zwischen Hamburg und Hannover. München, Dezember 1993<br />
[Vester, 2000]<br />
Vester, Frederic: Die Kunst, vernetzt zu denken; Ideen und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit<br />
Komplexität, Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart, 2000<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 84
Literatur<br />
[Zimmer, 2003]<br />
Zimmer, Christoph: Neue Organisationsmodelle für den Nebennetzbetrieb der Eisenbahn.<br />
Internationales Verkehrswesen Nr. 3 März 2003, S. 82 - 86.<br />
Quellen aus Internet, Frankfurter Rundschau, Braunschweiger Zeitung, usw. sind direkt im Text angegeben.<br />
Empfohlene Literatur<br />
Pachl, Jörn: Systemtechnik des Schienenverkehrs, B.G.Teubner Stuttgart, Leipzig<br />
• Dieses Buch vermittelt in seinen acht Kapiteln (Grundbegriffe des Schienenverkehrs,<br />
Fahrdynamische Grundlagen, Regelung und Sicherung der Zugfolge, Steuerung und<br />
Sicherung der Fahrwegelemente, Leistungsuntersuchung von Eisenbahn-Betriebsanlagen,<br />
Fahrplankonstruktion, Integraler Taktfahrplan und Betriebssteuerung) auch dem fachlichen<br />
Quereinsteiger ein grundlegendes Wissen über das System Schienenverkehr. In einem<br />
umfangreichen Glossar werden etwa 200 Fachbegriffe kurz definiert. Dieses Buch ist<br />
deswegen zu empfehlen, weil es die systemtechnischen Zusammenhänge des<br />
Schienenverkehrs erklärt, die sich grundlegend von denen des Straßenverkehrs<br />
unterscheiden.<br />
Eisenbahn-Revue International (www.minirex.ch)<br />
• Diese Zeitschrift bietet den verkehrspolitisch interessierten Lesern neben aktuellen Berichten<br />
aus Deutschland sehr interessante und umfangreiche Berichte zu Themen des<br />
Hochgeschwindigkeitsverkehrs (Planung, Betrieb,...) oder zur Eisenbahninfrastruktur, es<br />
werden moderne Schienenfahrzeuge vorgestellt, Prozesse zu Eisenbahnunfällen oder<br />
Rechtsfragen behandelt. Erhältlich ist die Eisenbahn-Revue International mindestens im<br />
Bahnhofsbuchhandel (oder per Abo).<br />
der schienenbus (www.der-schienenbus.de)<br />
• Die Zeitschrift „der schienenbus“ ist das Nachrichtenmagazin der Arbeitsgemeinschaft<br />
Schienenverkehr e. V. aus Rotenburg (Wümme). Der Titel, wie auch zum Teil die Titelfotos<br />
lassen womöglich den Eindruck entstehen, als ob es sich um ein „Pufferküsser“-Magazin<br />
handelt. Diesem ist aber erfreulicherweise nicht so. Neben den obligatorischen<br />
Triebfahrzeugmeldungen sind umfangreiche Berichte und Meldungen zum (aktuellen)<br />
Bahnbetrieb, zur Verkehrspolitik, über Eisenbahnstrecken oder „brisante“ Themen wie z. B.<br />
„Fairer Wettbewerb zwischen DB und Privatbahnen?“ enthalten. Der Schienenbus ist<br />
insbesondere deswegen zu empfehlen, weil er umfangreich über die unzähligen<br />
Nichtbundeseigenen Eisenbahnen in Deutschland und deren Betrieb berichtet, die oft von der<br />
Öffentlichkeit unbemerkt ihre Leistung erbringen. Der Schienenbus ist ebenfalls im<br />
Bahnhofsbuchhandel erhältlich (oder per Abo).<br />
Sonstiges<br />
• Im Bahnhofsbuchhandel, und eigentlich nur dort, ist je nach Größe eine sehr umfangreiche<br />
Auswahl an Eisenbahnfachzeitschriften vorhanden. Auch Magazine zum Stadtverkehr sind<br />
vorhanden. Jedem, der sich regelmäßig über spezielle Themen informiert wissen möchte, sei<br />
empfohlen, sich dort „seine“ Zeitschrift auszusuchen, auch wenn die Themen Geschichte und<br />
Modellbahn das Angebot dominieren.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 85
Literatur<br />
Glossar<br />
Bahnanlagen<br />
Bahnanlagen sind alle zum Betrieb (Abwicklung und Sicherung) einer Eisenbahn erforderlichen Anlagen wie<br />
Grundstücke, Bauwerke und sonstige Einrichtungen. Fahrzeuge gehören nicht dazu.<br />
Bahnhof<br />
Bahnhöfe sind Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Züge beginnen, enden, kreuzen, überholen<br />
oder wenden dürfen.<br />
Bildfahrplan<br />
Grafische Darstellung des (geplanten) Betriebsablaufes bzw. Fahrplans, bei der auf der einen Achse die<br />
Zeit, auf der anderen Achse die Strecke dargestellt wird. Die einzelne (mögliche) Zugfahrt wird als Linie<br />
dargestellt. Vereinfacht ausgedrückt, stellt diese Linie eine Fahrplantrasse dar.<br />
Blockabschnitt / Blockstrecke<br />
Ein Gleisabschnitt, in den ein Zug nur einfahren darf, wenn er frei von Fahrzeugen ist (bei Fahren im festen<br />
Raumabstand).<br />
Fahrplantrasse<br />
Im Fahrplan vorgesehene Inanspruchnahme der Infrastruktur durch eine Zugfahrt. Dazu sind bestimmte<br />
Zeiten für diese Zugfahrt im Bildfahrplan bzw. auf der Strecke (Blockabschnitt) zu reservieren (z. B. Fahrzeit,<br />
Räumfahrzeit, Pufferzeit), d. h., ein Streckenabschnitt kann durch einen Zug „belegt“ sein, auch wenn dieser<br />
erst z. B. in vier Minuten dort fährt.<br />
Gleiswechselbetrieb<br />
Beim Gleiswechselbetrieb können bei einer zweigleisigen Strecke ein oder beide Gleise signaltechnisch<br />
gesichert auch entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (auf dem rechten Gleis) befahren werden.<br />
Haltepunkt<br />
Haltepunkte sind Bahnanlagen ohne Weichen, wo Züge planmäßig halten, beginnen oder enden dürfen.<br />
Nach dieser betrieblichen Definition ist z. B. Hamburg-Dammtor kein Bahnhof sondern ein Haltepunkt.<br />
Hochleistungsblock<br />
Ein Verfahren, bei dem stark verkürzte, auch unterzuglange Blockabschnitte speziell signalisiert werden.<br />
ICE1, ICE2, ICE3<br />
Verschiedene Generationen (1., 2. und 3.) der ICE-Züge. Die ICE1-Züge haben an beiden Enden ein<br />
Triebkopf und sind am erhöhten Speisewagen erkennbar. Die ICE2-Züge sind kürzer und haben nur an<br />
einem Ende ein Triebkopf. Sie werden oft gekuppelt gefahren. Die ICE3-Züge besitzen keinen Triebkopf<br />
mehr. Sie bestehen wie eine S-Bahn nur aus „Sitzwagen“. Dem Triebfahrzeugführer kann über die Schulter<br />
auf die Strecke geschaut werden. Sie werden z. B. auf der SFS Köln - Frankfurt (Main) eingesetzt.<br />
ITF / Integraler Taktfahrplan<br />
Beim ITF ist der Fahrplan in einem größeren Gebiet (z. B. Niedersachsen) so gestaltet, dass sich an<br />
bestimmten (Knoten-) Bahnhöfen die Züge zur gleichen Zeit treffen, so dass die Reisenden ohne Wartezeit<br />
in alle Richtungen umsteigen können.<br />
Kybernetik / Biokybernetik<br />
Unter (Bio-)Kybernetik (vom griechischen kybernetes, der Steuermann) versteht man die Erkennung,<br />
Steuerung und selbsttätige Regelung ineinandergreifender, vernetzter Abläufe bei minimalem<br />
Energieaufwand.<br />
So ist das dritte Murphysche Gesetz quasi schön höhere Kybernetik. Es besagt: Auch wenn etwas, das<br />
eigentlich schief gehen sollte, nachher nicht schief gegangen ist, wird man feststellen, es sei besser<br />
gewesen, es wäre schief gegangen.<br />
Puffertrasse / Freitrasse<br />
Im Güterverkehr kommt es oft zu Abweichungen in der Zugreihenfolge. Daher werden hier die<br />
Fahrplantrassen im Abstand der Mindestzugfolgezeit geplant. Anschließend werden dann eine oder mehrere<br />
Fahrplantrassen als Freitrasse oder Puffertrasse vorgesehen, so dass Verspätungen ausgeglichen werden<br />
können. (Im Personenverkehr oder hochwertigen Güterverkehr wird die Zugreihenfolge im Regelfall<br />
eingehalten, so dass hier nach jeder Fahrplantrasse eine bestimmte Pufferzeit freigehalten wird.)<br />
systemisch / systemische Sichtweise<br />
Bei einer systemischen Sichtweise [...] steigt man aus dem System heraus, schaut von außen nach innen<br />
und untersucht vor allem das eigene System und dessen Verhalten. Dabei stellt man ganz andere Fragen:<br />
Wo sind die kritischen, wo die puffernden Bereiche, mit welchen Hebeln läßt sich das System steuern, mit<br />
welchen nicht, wie ist seine Flexibilität, seine Selbstregulation, seine Innovationskraft, wo liegen<br />
Symbiosemöglichkeiten [...] usw. [Vester, 2000, S. 101,102]. Die Denkweise ist evolutionär, ganzheitlich,<br />
funktionsorientiert und kybernetisch.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 86
Anhang<br />
Anhang<br />
Eisenbahninfrastruktur Bereich Hannover / Bremen / Hamburg (Ausschnitt) (ohne Maßstab)<br />
(einschließlich drittes Gleis Stelle - Lüneburg und zweigleisiger Ausbau Hildesheim - Braunschweig)<br />
Kiel<br />
Skandinavien<br />
Westerland / Kiel / Flensburg /<br />
Dänemark<br />
Lübeck<br />
Cuxhaven<br />
Bremerhaven<br />
Wilhelmshaven<br />
Nordenham<br />
OLDB<br />
Delmenhorst<br />
Bremen<br />
Bremervörde<br />
EVB<br />
Osterholz-Scharmbeck<br />
Rotenburg(Wümme)<br />
Hamburg<br />
Buxtehude<br />
Buchholz(Nordheide)<br />
+<br />
-<br />
+<br />
Winsen(Luhe)<br />
Maschen<br />
Stelle<br />
OHE<br />
Büchen<br />
Lüneburg<br />
Wittenberge /<br />
Stendal / Berlin<br />
Norddeich /<br />
Emden /<br />
Niederlande<br />
Osnabrück<br />
BTE<br />
Kirchweyhe<br />
Syke<br />
Langwedel<br />
Thedinghausen<br />
"Y-<strong>Trasse</strong>"<br />
Soltau(Han)<br />
Uelzen<br />
Verden(Aller)<br />
Osnabrück /<br />
Ruhrgebiet<br />
VGH<br />
Eystrup<br />
Nienburg(Weser)<br />
-<br />
OHE<br />
Celle<br />
OHE<br />
Wittingen<br />
Stendal /<br />
Magdeburg / Berlin<br />
Wunstorf<br />
Gifhorn<br />
Wolfsburg<br />
Minden(Westf)<br />
Hannover<br />
Lehrte<br />
VPS<br />
Peine<br />
Braunschweig<br />
Stendal / Berlin<br />
Magdeburg /<br />
Berlin /<br />
Halle(Saale)<br />
Niederlande / Osnabrück<br />
Elze(Han)<br />
Hildesheim<br />
Löhne<br />
Hameln<br />
SFS<br />
Salzgitter<br />
Ruhrgebiet / Bielefeld<br />
Paderborn / Dortmund<br />
Kreiensen<br />
Seesen<br />
Goslar /<br />
Bad Harzburg<br />
Halberstadt /<br />
Halle (Saale)<br />
Nordhausen / Erfurt<br />
Strecken der DB Netz AG:<br />
Strecken der BTE, EVB, VGH, OHE und VPS :<br />
zweigleisig: elektrifiziert / nicht elektrifiziert<br />
eingleisig: elektrifiziert / nicht elektrifiziert<br />
eingleisig: nicht elektrifiziert<br />
Göttingen /<br />
Süddeutschland<br />
Engpässe, Konfliktpunkte,...:<br />
+<br />
heute / zusätzlich durch Y-<strong>Trasse</strong><br />
/<br />
-<br />
Entfall des Konfliktpunktes durch<br />
Ausbau nach Variante "Güterbahn"<br />
Entfall /Entschärfung durch Variante<br />
"Güterbahn" und Y-<strong>Trasse</strong><br />
Entfall weiterer Konfliktpunkte durch<br />
Ausbau nach <strong>VCD</strong>-Forderung<br />
BTE: Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH (ab Bremen-Huchting)<br />
EVB: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH<br />
OHE: Osthannoversche Eisenbahn AG<br />
VGH: Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH<br />
VPS: Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH<br />
Abb. A-1: Eisenbahninfrastruktur Untersuchungsraum heute, mit Engpässen,...<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 87
Anhang<br />
konfliktfreie Streckenführung im Bahnhof Buchholz (Nordheide) und Celle<br />
(Variante Güterbahn)<br />
Buchholz (Nordheide)<br />
von / nach Hamburg<br />
von / nach Soltau (Han) - Maschen<br />
von / nach Hamburg<br />
von / nach Wittingen<br />
von / nach Bremen<br />
von / nach Maschen<br />
von / nach Hannover<br />
von / nach Lehrte<br />
von / nach Soltau (Han) - Celle / Hannover<br />
Celle<br />
Abb. A-2: konfliktfreie Streckenführung im Bahnhof Buchholz (Nordheide) und Celle<br />
Abfahrtszeiten (ab Minute)der IC- und ICE-Züge in Hamburg Hbf Richtung Bremen und Hannover<br />
Fahrplan<br />
03 02 01/00 99 98/97 97/96 96/95<br />
nach Bremen 46 47 47 47 53 53 53<br />
nach Frankfurt (M) 19 18 24 11 bzw. 16 36 38 38<br />
nach München 56 02 bzw. 57 01 bzw. 05 00 bzw. 56 08 08 bzw. 13 08 bzw. 13<br />
Abb. A-3: Abfahrtszeiten ICE und IC Hamburg Hbf Æ Bremen und Hannover<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 88
Anhang<br />
- Kontrollrechnung zu [Breimeier, 2/2001]<br />
Mit Hilfe eines Überschlagverfahrens [Breimeier, 1999], das die auf den deutschen Neubaustrecken erzielten<br />
Verkehrsgewinne realitätsnah widerspiegelt, lassen sich folgende zusätzliche Personen-Verkehrsleistungen<br />
errechnen, gemessen in Reisenden-Kilometer je Jahr(Rkm/a):<br />
Güterbahn 57,77 Mio. Rkm/a<br />
Direttissima<br />
247,81 Mio. Rkm/a<br />
Y-<strong>Trasse</strong><br />
250,79 Mio. Rkm/a<br />
Die Formel für das Überschlagsverfahren im SPFV lautet [Breimeier, 1999, S. 79]:<br />
RE= 7951 • (E1 • E2) 0,954 / LE 1,535 • (d1/dd • d2/dd) 0,954 • (VR / 100) 0,875<br />
RE: Anzahl der Eisenbahnreisenden einer Relation je Tag, Summe beider Richtungen<br />
E: Einwohnerzahl einer Stadt oder Verkehrszelle (100 000)<br />
LE: Eisenbahn-Entfernung (km)<br />
d: Dienstleistungsanteil des Brutto-Inlands-Produkts (BIP) je Einwohner und Jahr (DM/E und Jahr)<br />
di: d-Wert in der Stadt i (DM/E und Jahr)<br />
dd: Durchschnittswert von d im Bundesgebiet (DM/E und Jahr)<br />
VR: Durchschnittliche Reisegeschwindigkeit der Züge einschließlich aller Zwischenhalte (km/h)<br />
Die Werte di und dd sind von den Statistischen Landesämtern zu erfragen. Für Großstädte gilt in etwa di / dd = 2.<br />
Dieses ist ein einfaches Gravitationsmodell. Insgesamt ist, so Breimeier, die starke Entfernungsdegression<br />
des Verkehrsvolumens auffallend.<br />
Kontrollrechnung<br />
Für die Kontrollrechnung werden folgende Werte angesetzt bzw. angenommen:<br />
Einwohnerzahl Hamburg: 1,70 Mio. Æ 17,0; Stadt Bremen: 0,54 Mio. Æ 5,4; Hannover: 0,52 Mio. Æ 5,2<br />
Länge der Eisenbahnstrecken / Fahrzeit / durchschnittliche Reisegeschwindigkeit:<br />
Bremen - Hannover (heute): 122 km 60 min. 122 km/h<br />
Bremen - Hannover (Y-<strong>Trasse</strong>):<br />
130 km 51 min 153 km/h<br />
(130 km wg. Umweg über Langenhagen)<br />
Hamburg Hbf - Hannover (heute): 178 km 75 min 142 km/h<br />
Hamburg Hbf - Hannover (Güterbahn) 178 km 70 min 152 km/h<br />
Hamburg Hbf - Hannover (Y-<strong>Trasse</strong>) 170 km (geschätzt) 61 min 167 km/h<br />
Hamburg Hbf - Hannover (Direttissima) 160 km (geschätzt) 57 min 168 km/h<br />
Daraus folgen Reisende pro Tag / pro Jahr (•365)<br />
Reisende heute Bremen - Hannover 536<br />
Reisende „Y-<strong>Trasse</strong>“ Bremen - Hannover 593<br />
zusätzliche Reisende<br />
+57 / +20.805 Reisende<br />
Reisende heute Hamburg - Hannover 1.025<br />
Reisende Y-<strong>Trasse</strong> Hamburg - Hannover 1.267<br />
zusätzliche Reisende Y-<strong>Trasse</strong><br />
+242 / + 88.330 Reisende<br />
Reisende „Güterbahn“ Hamburg - Hannover 1.087<br />
zusätzliche Reisende Güterbahn<br />
+ 62 / + 22.630 Reisende<br />
Reisende „Direttissima“ 1.398<br />
zusätzliche Reisende Direttissima<br />
+ 373 / + 136.142 Reisende<br />
Dieses ergibt folgende zusätzliche Rkm/a (nur Direktfahrer Hamburg/Bremen - Hannover):<br />
Güterbahn 4.03 Mio.<br />
Y-<strong>Trasse</strong> 2.70 Mio. + 15.02 Mio. = 17.72 Mio.<br />
Direttissima<br />
21,80 Mio.<br />
Für die Relation Hamburg - Großraum Frankfurt(M) (Schwerpunkt Frankfurt(M) Hbf) mit angenommenen 2<br />
Mio. Einwohnern einer Entfernung von 517 km / 509 km (heute/mit Y-<strong>Trasse</strong>), einer Reisezeit von 217 Min. /<br />
203 Min, einer Reisegeschwindigkeit von 142,95 km/h / 150,44km/h ergeben sich 725 / 777 Reisende (heute<br />
/ mit Y-<strong>Trasse</strong>) täglich oder 52 zusätzliche Reisende. Bei einer Entfernung von 517 km ergeben sich pro<br />
Jahr zusätzlich 9,81 Mio. Rkm.<br />
Werden diese zu den 17,72 Mio. Rkm addiert ergeben sich nur 27,53 Mio. zusätzliche Rkm.<br />
<strong>VCD</strong> LV Niedersachsen: Hochleistungsschienennetz <strong>statt</strong> Y-<strong>Trasse</strong> Seite 89