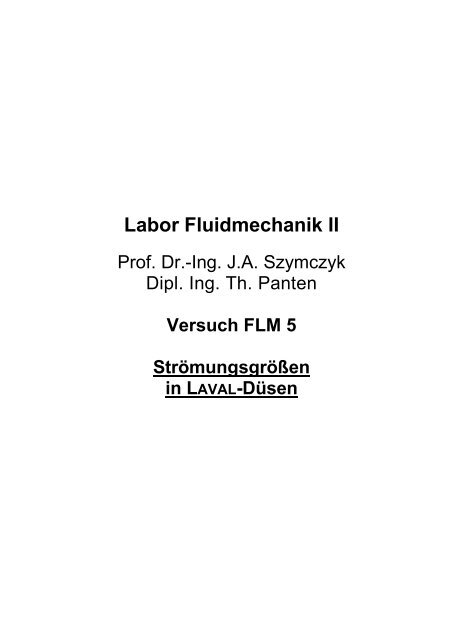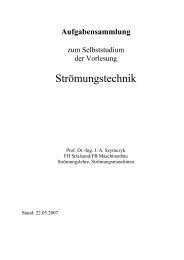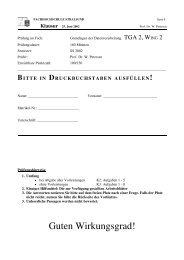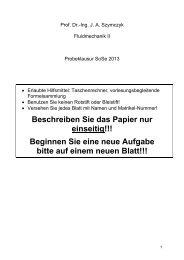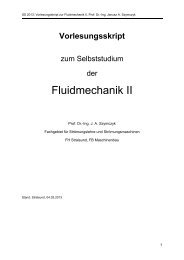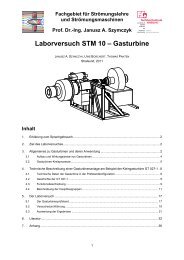Strömungsgrößen in Laval-Düsen - Fachhochschule Stralsund
Strömungsgrößen in Laval-Düsen - Fachhochschule Stralsund
Strömungsgrößen in Laval-Düsen - Fachhochschule Stralsund
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Labor Fluidmechanik II<br />
Prof. Dr.-Ing. J.A. Szymczyk<br />
Dipl. Ing. Th. Panten<br />
Versuch FLM 5<br />
<strong>Strömungsgrößen</strong><br />
<strong>in</strong> LAVAL-<strong>Düsen</strong>
Versuch FLM 5: LAVAL-<strong>Düsen</strong><br />
Labor Fluidmechanik II<br />
E<strong>in</strong>leitung<br />
Der Versuchsaufbau HM 261 der Firma GUNT ermöglicht e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die<br />
Fluidmechanik mit kompressiblen Medien. Das reale Verhalten e<strong>in</strong>er kompressiblen<br />
Strömung soll bei Versuchen mit den LAVAL-<strong>Düsen</strong> die Theorie bestätigen.<br />
Das Modell wird mit Druckluft betrieben. Durch die Verwendung e<strong>in</strong>es Druckreglers auf<br />
der E<strong>in</strong>gangsseite vor der Düse (p 0 ) und e<strong>in</strong>es Nadelventils auf der Ausgangsseite (p G )<br />
lassen sich e<strong>in</strong>fach Druckdifferenzen (p 0 - p G ) für die unterschiedlichen <strong>Düsen</strong><br />
e<strong>in</strong>stellen. Es werden der E<strong>in</strong>gangsdruck und der Ausgangsdruck und bis zu 8 weitere<br />
Drücke entlang des <strong>Düsen</strong>profils gemessen und angezeigt.<br />
Aus dem gemessenen Druck kann die jeweilige Geschw<strong>in</strong>digkeit zu den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Messpunkten berechnet werden.<br />
Die Temperaturen des Luftstroms vor und nach der Messdüse werden digital angezeigt.<br />
Der Massenstrom wird am Ende der Versuchsanordnung mit e<strong>in</strong>em<br />
Glaskonusdurchflussmesser gemessen.<br />
Es werden folgende Themen untersucht:<br />
• Abhängigkeit E<strong>in</strong>gangsdruck - Massenstrom<br />
• Abhängigkeit Ausgangsdruck - Massenstrom<br />
• Druckverteilung <strong>in</strong>nerhalb der <strong>Düsen</strong><br />
Strömung <strong>in</strong> LAVAL-<strong>Düsen</strong><br />
• Düse A: lange LAVAL-Düse<br />
• Düse B: lange LAVAL-Düse<br />
Abb. 1: Ansicht des Versuchstandes<br />
Version SS 2013 2
Versuch FLM 5: LAVAL-<strong>Düsen</strong><br />
Labor Fluidmechanik II<br />
Versuchsaufbau<br />
Abb. 2: Schematischer Aufbau des Versuchstandes<br />
Version SS 2013 3
Versuch FLM 5: LAVAL-<strong>Düsen</strong><br />
Labor Fluidmechanik II<br />
Für den Versuchsstand stehen zwei unterschiedliche LAVAL-<strong>Düsen</strong> zur Verfügung und<br />
können montiert werden.<br />
Abb. 3: Düse A: lange LAVAL-Düse<br />
Düse B: kurze LAVAL-Düse<br />
Zur Ermittlung der Geometrie der <strong>Düsen</strong> werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Schnittdarstellung die Längenund<br />
Durchmesserkoord<strong>in</strong>aten Abb.4 und Abb.5 angegeben.<br />
Abb. 4: Koord<strong>in</strong>aten und Durchmesser der langen LAVAL-Düse (Düse A)<br />
Abb. 5: Koord<strong>in</strong>aten und Durchmesser der kurzen LAVAL-Düse (Düse B)<br />
Version SS 2013 4
Versuch FLM 5: LAVAL-<strong>Düsen</strong><br />
Labor Fluidmechanik II<br />
Theoretische Grundlagen: Betriebszustände der LAVAL-Düse<br />
Zur Beschreibung der möglichen Betriebszustände der LAVAL-Düse werden folgende<br />
dimensionslose Drücke durch Bezug auf den Ruhedruck p 0 e<strong>in</strong>geführt<br />
1. Gegendruck p u ’ = p u /p 0 ändert sich für jeden Betriebszustand<br />
2. lokaler Druck p’ = p/p 0<br />
3. kritischer Druck p * ’ = p * /p 0<br />
4. Druck im Austritt (E) p E ’ = p E /p 0<br />
5. Druck im Auslegungszustand p Ausl ’ = p Ausl /p 0<br />
6. Kesseldruck p 0 p 0 ’ = p 0 / p 0 = 1<br />
Abb. 6: Druck und Machzahl <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er <strong>Laval</strong>düse bei verschiedenen Gegendrücken<br />
Zur Vorbereitung sollte das Wissen zu den verschiedenen Betriebszuständen aus dem<br />
Vorlesungsmanuskript verwendet werden.<br />
Version SS 2013 5
Versuch FLM 5: LAVAL-<strong>Düsen</strong><br />
Labor Fluidmechanik II<br />
Abb. 7:<br />
<strong>Strömungsgrößen</strong> als Funktion des Druckverhältnisses<br />
Ti<br />
T<br />
a<br />
a<br />
⎛ p<br />
=<br />
⎜<br />
⎝<br />
0<br />
p 0<br />
i<br />
i<br />
⎛ p<br />
=<br />
⎜<br />
⎝<br />
0<br />
p 0<br />
i<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎠<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎠<br />
κ−1<br />
κ<br />
κ−1<br />
2κ<br />
Ma<br />
i<br />
1−κ<br />
⎛ ⎞<br />
2 ⎛ κ<br />
p ⎞<br />
i<br />
=<br />
⎜<br />
1<br />
⎟<br />
⎜ ⎟ −<br />
κ −1 p<br />
⎜⎝<br />
0 ⎠ ⎟<br />
⎝ ⎠<br />
ρ i<br />
ρ<br />
A<br />
A<br />
⎛<br />
=<br />
⎜<br />
⎝<br />
p i<br />
0<br />
p 0<br />
*<br />
i<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎠<br />
1<br />
κ<br />
⎛ p<br />
= 38639266 , ⋅<br />
⎜<br />
⎝ p<br />
i<br />
0<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎠<br />
1<br />
κ<br />
⋅<br />
⎛ p<br />
1−<br />
⎜<br />
⎝ p<br />
i<br />
0<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎠<br />
κ−1<br />
κ<br />
.<br />
Version SS 2013 6
Versuch FLM 5: LAVAL-<strong>Düsen</strong><br />
Labor Fluidmechanik II<br />
Abb. 8:<br />
Verhältnisse verschiedener Größen über die Machzahl<br />
Der Verlauf folgender Formeln ist hier grafisch dargestellt:<br />
p<br />
p<br />
⎛<br />
= ⎜<br />
⎝<br />
κ − 1<br />
+ ⋅ Ma<br />
i<br />
2<br />
1<br />
i<br />
0<br />
2<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎠<br />
1<br />
κ<br />
−κ<br />
−1<br />
Ti<br />
⎛ κ −1<br />
2 ⎞<br />
= ⎜1+<br />
⋅Mai<br />
⎟<br />
T0 ⎝ 2 ⎠<br />
ρ 1<br />
⎞ −κ<br />
i ⎛ κ − 1 2<br />
= ⎜1 + ⋅ Ma ⎟<br />
1<br />
i<br />
ρ0 ⎝ 2 ⎠<br />
a<br />
a<br />
⎛<br />
κ −1<br />
i<br />
2<br />
= ⎜1+<br />
⋅Ma<br />
i<br />
0 ⎝ 2<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎠<br />
1<br />
−<br />
2<br />
A 1+κ<br />
*<br />
⎡ κ −1<br />
2 ⎤<br />
= Ma<br />
i<br />
⋅ ⎢1<br />
+ ( Ma<br />
i<br />
−1)<br />
2<br />
A<br />
⎥<br />
i ⎣ κ + 1 ⎦<br />
( 1−κ<br />
)<br />
Version SS 2013 7
Versuch FLM 5: LAVAL-<strong>Düsen</strong><br />
Labor Fluidmechanik II<br />
Formeln zur Berechnung von LAVAL - <strong>Düsen</strong><br />
Das kritische Druckverhältnis bei e<strong>in</strong>er konvergenten Düse:<br />
p<br />
*<br />
⎛ p<br />
=<br />
⎜<br />
⎝ p<br />
*<br />
κ<br />
⎞ 2 κ−1<br />
E ⎛ ⎞<br />
⎟ = ⎜ ⎟<br />
0 ⎝ κ + 1⎠<br />
⎠<br />
Mit κ 1,4 (bei zweiatomigen Gasen)<br />
p E<br />
Druck am Ende der Düse<br />
p 0<br />
Druck im Kessel vor der Düse<br />
p* Druckverhältnis bei dem die Schallgeschw<strong>in</strong>digkeit erreicht wird<br />
Gl:1<br />
(Gl.11.5-16)<br />
Die maximale Austrittsgeschw<strong>in</strong>digkeit stellt sich bei maximalem Massestrom e<strong>in</strong>, dass<br />
∗<br />
⎛ p ⎞<br />
E<br />
heißt bei<br />
⎜<br />
⎟ =0,5282818... für die Luft als zweiatomiges Gas.<br />
⎝ pi<br />
⎠<br />
w<br />
kritisch<br />
= a =<br />
κ ⋅R<br />
⋅ T<br />
i<br />
Es<br />
Mit a Schallgeschw<strong>in</strong>digkeit des Mediums<br />
R i<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Gaskonstante<br />
Temperatur bei isentroper Expansion <strong>in</strong> der Austrittsebene<br />
T Es<br />
Gl:2<br />
(Gl.11.4-8)<br />
Für die theoretische (isentrope) Ausströmgeschw<strong>in</strong>digkeit gilt:<br />
w<br />
E<br />
=<br />
2κ<br />
p<br />
⋅<br />
κ −1<br />
ρ<br />
0<br />
0<br />
⎛<br />
⎜ ⎛ p<br />
⎜1−<br />
⎜<br />
⎜ ⎝ p<br />
⎝<br />
E<br />
0<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎠<br />
κ−1<br />
κ<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎟<br />
⎟<br />
⎠<br />
Gl:3<br />
(Gl.11.5-2)<br />
Die Formeln, die hier erläutert werden, gelten nur für die isentrope Strömung. Alle<br />
Größen, die hier im Skript verwendet wurden, entsprechen der gleichen Nomenklatur,<br />
wie im Vorlesungsmanuskript FLM II.<br />
ergibt sich der Massenstrom:<br />
Q = A E<br />
⋅ w E<br />
⋅ρ<br />
E<br />
Gl:4<br />
(Gl.11.3-1)<br />
Oder<br />
2<br />
κ+ 1<br />
κ ⎜⎛<br />
pE<br />
⎞ κ ⎛ p ⎟<br />
E<br />
⎞ κ<br />
& = 2 ⋅p<br />
⋅ρ ⋅⎜<br />
⎜ − ⎟ ⋅ A<br />
E<br />
p<br />
⎟<br />
⎜<br />
p<br />
⎟<br />
0 0<br />
=<br />
κ −1<br />
m & = 2 ⋅p<br />
⋅ρ ⋅ Ψ ⋅ A<br />
0 0 E E<br />
0<br />
0<br />
m<br />
⎛<br />
⎜⎝<br />
⎝<br />
⎠<br />
⎝<br />
⎠<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎠<br />
Gl:8<br />
(Gl.11.5-3)<br />
Version SS 2013 8
Versuch FLM 5: LAVAL-<strong>Düsen</strong><br />
Labor Fluidmechanik II<br />
Temperatur vor und nach der LAVAL-Düse<br />
T<br />
E<br />
2<br />
w<br />
E<br />
= T0<br />
−<br />
Gl:5<br />
2 ⋅ c<br />
p<br />
Mit T E Temperatur nach der Düse<br />
T 0<br />
Temperatur vor der Düse<br />
w E Austrittsgeschw<strong>in</strong>digkeit<br />
spezifische Wärmekapazität<br />
c p<br />
Dichte am <strong>Düsen</strong>e<strong>in</strong>tritt<br />
p<br />
0<br />
ρ<br />
0<br />
=<br />
Gl:6<br />
RL<br />
⋅ T0<br />
Mit ρ 0 Dichte bei <strong>Düsen</strong>e<strong>in</strong>tritt<br />
T 0<br />
Temperatur vor der Düse<br />
allgeme<strong>in</strong>e Gaskonstante<br />
R L<br />
Dichte am <strong>Düsen</strong>austritt<br />
p<br />
E<br />
ρ<br />
E<br />
=<br />
Gl:7<br />
RL<br />
⋅ TE<br />
Mit ρ E Dichte bei <strong>Düsen</strong>austritt<br />
T E Temperatur nach der Düse<br />
allgeme<strong>in</strong>e Gaskonstante<br />
R L<br />
Literatur<br />
/1/ Versuchsanleitung HM 261 Firma Gunt Stand 4/2010<br />
/2/ Szymczyk: Vorlesungsmanuskript Fluidmechanik II<br />
<strong>Fachhochschule</strong> <strong>Stralsund</strong><br />
/3/ Kalide: Technische Strömungslehre E<strong>in</strong>führung<br />
Carl Hanser Verlag München<br />
/4/ Bohl: Technische Strömungslehre<br />
Kaprath-Reihe Vogel Buchverlag<br />
/5/ Böswirth,Bschorer: Technische Strömungslehre<br />
Vieweg und Teubner Verlag Wiesbaden<br />
Version SS 2013 9
Versuch FLM 5: LAVAL-<strong>Düsen</strong><br />
Labor Fluidmechanik II<br />
Versuchsdurchführung<br />
Im Rahmen der Versuchsdurchführung werden die verschiedenen Messgrößen<br />
gemessen die an Hand des Schemas näher bezeichnet s<strong>in</strong>d.<br />
p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 p 6 p 7 p 8<br />
Q<br />
V1<br />
T 0<br />
p 0<br />
T R<br />
pR<br />
V2<br />
Messdüse A/B<br />
Abb. 9:<br />
Schaltbild des Versuchstandes<br />
Für die LAVAL-Düse, die <strong>in</strong> dem Bereich der Messdüsen montiert ist, wird mit dem<br />
Druckregler (V 1 ) der E<strong>in</strong>gangsdruck der <strong>Düsen</strong> (p 0 ) e<strong>in</strong>gestellt und gemessen. Durch<br />
diese E<strong>in</strong>stellung stellt sich die Temperatur vor der Düse (T 0 ) <strong>in</strong> Abhängigkeit von den<br />
Versuchsbed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>. An den Messstellen für die Druckverteilung (1 bis 8) werden<br />
die unterschiedlichen statischen Drücke (p 1 bis p 8 ) gemessen. Nach der Düse werden<br />
der <strong>in</strong> der Rohrleitung der Druck (p R ) und die Temperatur (T R ) gemessen. Mit dem<br />
Nadelventil (V 2 ) werden unterhalb des Massendurchflussmessers die verschiedenen<br />
Betriebszustände e<strong>in</strong>gestellt.<br />
Ermittlung des Druckverlaufes <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er LAVAL-Düse<br />
Für den Versuch werden verschiedene Drücke (p 0 ) und (p R ) e<strong>in</strong>gestellt und<br />
Druckverlauf entlang der Düse gemessen. Der Gegendruck (p G ) soll gleich dem Druck<br />
<strong>in</strong> Rohrleitung nach der Düse (p R ) gesetzt werden.<br />
Stellen Sie zwei Betriebszustände der LAVAL-Düse e<strong>in</strong>:<br />
1 Unterkritisch<br />
2 Kritisch<br />
Version SS 2013 10
Versuch FLM 5: LAVAL-<strong>Düsen</strong><br />
Labor Fluidmechanik II<br />
1. Ermittlung der <strong>Strömungsgrößen</strong> bei e<strong>in</strong>em unterkritisches Druckverhältnis<br />
Vorbereitung:<br />
• Düse A (lange LAVAL-Düse) oder Düse B (kurze LAVAL-Düse) e<strong>in</strong>bauen<br />
Ablauf der Messung:<br />
Unterkritisches Druckverhältnis zwischen (p 0 ) und (p R ) im Bereich des möglichen<br />
Druckes (p 0 max 5 bar) festlegen.<br />
• Druckregler den E<strong>in</strong>gangsdruck (p 0 ) e<strong>in</strong>stellen<br />
• Handrad des Nadelventils öffnen (p R ) e<strong>in</strong>stellen<br />
Damit ist die entsprechende Betriebsart e<strong>in</strong>gestellt.<br />
Messwerte aufnehmen:<br />
• Druck (Kessel) vor der Düse p 0 (bar)<br />
• Temperatur (Kessel) vor der Düse T 0 (°C)<br />
• Druck <strong>in</strong> der Rohrleitung p R (bar)<br />
• Temperatur <strong>in</strong> der Rohrleitung T R (°C)<br />
• Druck (1) bis Druck (8) p 1..8 (bar)<br />
• Massenstrom m&<br />
gem<br />
(g/s)<br />
Dabei messen Sie die Drücke jeweils analog (Manometer) und digital (Drucksensor) um<br />
auch e<strong>in</strong>e Abweichung zwischen den Messgeräten mit <strong>in</strong> Ihre Beurteilung e<strong>in</strong>fließen<br />
lassen zu können.<br />
Berechnung:<br />
• Dichte im Kessel (0) ρ 0 (kg/m³)<br />
• Dichte <strong>in</strong> Rohrleitung (R) ρ R (kg/m³)<br />
• Geschw<strong>in</strong>digkeit <strong>in</strong> der Rohrleitung (R) w R (m/s)<br />
• Temperatur am Ende der Düse (E) T E (K)<br />
• Dichte am Ende der Düse (E) ρ E (kg/m³)<br />
• Geschw<strong>in</strong>digkeit am Ende der Düse (E) w E (m/s)<br />
• Temperatur an den Stellen (1) bis (8) T 1..8 (K)<br />
• Dichte an den Stellen (1) bis (8) ρ 1..8 (kg/m³)<br />
• Geschw<strong>in</strong>digkeit an den Stellen (1) bis (8) w 1..8 (m/s)<br />
• Schallgeschw<strong>in</strong>digkeit an den Stellen (1) bis (8) a 1..8 (m/s)<br />
• Machzahl an den Stellen (1) bis (8) Ma 1..8 (-)<br />
• Massenstrom<br />
isent<br />
m& (g/s)<br />
Dafür s<strong>in</strong>d der Durchmesser nach der Düse mit d E =8mm und d R =14mm anzunehmen<br />
Darstellung und Auswertung:<br />
a) Zeichnen Sie den Verlauf der dimensionslose Schallgeschw<strong>in</strong>digkeit, Dichte und<br />
Temperatur als Funktion des Druckverhältnisses (<strong>in</strong>nerhalb der Düse)! (siehe<br />
Abb. 7)<br />
b) Zeichnen Sie den Verlauf der dimensionslosen Zustandsgrößen (Druck, Dichte,<br />
Temperatur) über die X-Koord<strong>in</strong>aten der Düse! Erklären Sie die Abweichung<br />
zwischen dem Verlauf <strong>in</strong> der Abbildung und des theoretischen (isentropen)<br />
Verlaufes.<br />
c) Zeichnen Sie den Verlauf der MACH-Zahl, der Schallgeschw<strong>in</strong>digkeit und der<br />
Strömungsgeschw<strong>in</strong>digkeit über die X-Koord<strong>in</strong>aten der Düse!<br />
d) Zeichnen Sie den Verlauf der dimensionslosen <strong>Strömungsgrößen</strong> (Druck, Dichte<br />
Temperatur, Schallgeschw<strong>in</strong>digkeit) und das Flächenverhältnis als Funktion der<br />
Ma-Zahl. (siehe Abb.8)<br />
Version SS 2013 11
Versuch FLM 5: LAVAL-<strong>Düsen</strong><br />
Labor Fluidmechanik II<br />
2. Ermittlung der <strong>Strömungsgrößen</strong> bei e<strong>in</strong>em kritisches Druckverhältnis<br />
Vorbereitung:<br />
• Düse A (lange LAVAL-Düse) oder Düse B (kurze LAVAL-Düse) e<strong>in</strong>bauen<br />
Ablauf der Messung:<br />
Kritisches Druckverhältnis zwischen (p 0 ) und (p R ) im Bereich des möglichen Druckes (p 0<br />
max 5 bar) festlegen.<br />
• Druckregler den E<strong>in</strong>gangsdruck (p 0 ) e<strong>in</strong>stellen<br />
• Handrad des Nadelventils öffnen (p R ) e<strong>in</strong>stellen (z.B: