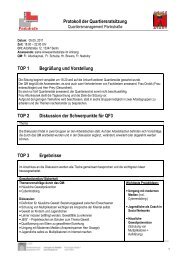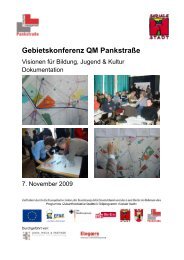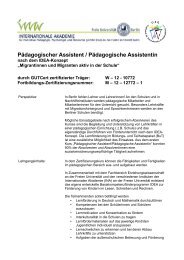Wie Arbeiterfamilien im Wedding lebten - Quartier Pankstrasse
Wie Arbeiterfamilien im Wedding lebten - Quartier Pankstrasse
Wie Arbeiterfamilien im Wedding lebten - Quartier Pankstrasse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Titelfoto Quelle: Mitte Museum, Bezirksamt Mitte von Berlin. Motiv: Alteisen- und Metallwaren-Handlung Max Rochow, Gerichtstreße 52, 1905<br />
Editorial<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
Geschichte und Geschichten – nicht zufällig sind beide<br />
Worte ähnlich. In den Geschichten, die sich mit einem<br />
best<strong>im</strong>mten Gebiet verbinden, verbirgt sich auch dessen<br />
Geschichte. Wir gehen in dieser Ausgabe der Geschichte<br />
und den Geschichten des Kiezes nach.<br />
Zum Beispiel in der <strong>Wie</strong>senburg. Während eines Rundgangs<br />
durch die zum großen Teil verfallenen Gebäude<br />
erzählte uns Joach<strong>im</strong> Dumkow, der seit seiner Geburt<br />
in der <strong>Wie</strong>senburg lebt, einiges über deren Entstehung<br />
als Obdachlosenasyl und über ihre weitere wechselhafte<br />
Geschichte. Der <strong>Wedding</strong> war früher bekannt als<br />
eine Hochburg der Arbeiterbewegung. Dies gründet<br />
<strong>Wedding</strong>Geschichte<br />
Der erste Januar 1861 war ein bedeutender Tag.<br />
Zusammen mit Gesundbrunnen und Moabit wird<br />
der <strong>Wedding</strong> offiziell ein Teil von Berlin. Über 600<br />
Jahre zuvor – 1251 – wurde der <strong>Wedding</strong> erstmals<br />
urkundlich erwähnt. Man muss sich den <strong>Wedding</strong><br />
bis zur Industrialisierung als eine kleine Ansammlung<br />
von Häusern außerhalb der Stadtmauern<br />
Berlins vorstellen. Der <strong>Wedding</strong> galt als notorisch<br />
bedürftig und wenig rentabel, sodass der Landkreis<br />
Niederbarn<strong>im</strong> sich über die Eingemeindung des<br />
<strong>Wedding</strong> in das Stadtgebiet von Berlin erleichtert<br />
zeigte. Auch Berlin hatte lange gezögert, den <strong>Wedding</strong><br />
einzugemeinden. Doch mit der Industrialisierung<br />
änderte sich die Lage.<br />
Berlin war eine Weltstadt geworden. Die Innenstadt<br />
wurde mit Verwaltungs- und Repräsentationsbauten<br />
neu gestaltet. Arbeiter und Angestellte zogen<br />
in die Randbezirke, wo inzwischen Fabriken ihren<br />
Platz fanden. Ernst Schering, Begründer einer der<br />
größten Chemiekonzerne, eröffnete 1871 die »Chemische<br />
Fabrik auf Actien (vormals E. Schering)«.<br />
Der Druckmaschinenhersteller Rotaprint errichtete<br />
seine Fabrik in der Gottschedstraße. Im Osram-<br />
Werk, dem ehemals größten Glühlampenwerk Europas,<br />
wurden bis in die 1980er Jahre Glühlampen<br />
produziert. Der Ingenieur Emil Rathenau gründete<br />
ein Werk, welches später unter dem Namen AEG<br />
(Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft) zur größten<br />
Fabrik des <strong>Wedding</strong> in den 1920ern werden sollte.<br />
sich auch in den Wohnverhältnissen der Arbeiter. Wir<br />
geben einen kleinen Einblick, wie die Menschen damals<br />
<strong>lebten</strong>. Und was wissen Sie, die Anwohner, über<br />
die Geschichte des Areals? Unserer Straßenumfrage.<br />
Die Rückseite bietet ein gewohntes, aber auch ganz<br />
neues Bild. Dieses Mal haben wir passend zum Thema<br />
eine historische Karte von 1893 gewählt, auf der Sie<br />
sehr anschaulich nachvollziehen können, wie sich der<br />
Kiez seit damals verändert hat.<br />
Geschichte, das ist der Blick zurück. Damit allein<br />
wollen wir uns nicht zufrieden geben. Deshalb wird<br />
das Thema unserer nächsten Ausgabe „Zukunft“<br />
sein. Wir freuen uns darauf!<br />
Viel Spaß be<strong>im</strong> Lesen wünscht<br />
Ihre Redaktion<br />
Mit den Fabriken kam nicht nur Arbeit, sondern<br />
Armut, Wohnungsnot und soziales Elend. Die Arbeiter<br />
organisierten sich <strong>im</strong> Metallarbeiter-Verband,<br />
Vorgänger der IG Metall. Arbeitskämpfe wurden<br />
erbittert geführt, Streiks organisiert. Der <strong>Wedding</strong><br />
war auch ein Zentrum der Mieterstreikbewegung.<br />
Dazu kamen politischen Auseinandersetzungen<br />
mit den zunehmend auftretenden Nazis und deren<br />
SA. Die NSDAP beschrieb die St<strong>im</strong>mung Ende der<br />
zwanziger Jahre so: »Die verhetzten Marxisten bewarfen<br />
die SA mit Blumen, an denen aber noch die<br />
Töpfe waren.« Doch nach der Machtübernahme<br />
der Nazis 1933 wurden die meisten Kommunisten<br />
und Sozialdemokraten verhaftet, getötet oder in<br />
KZs verschleppt. Trotzdem gab es <strong>im</strong> <strong>Wedding</strong><br />
kommunistische Widerstandsgruppen. Nachdem<br />
man ihre Synagogen zerstörte, wurde die jüdische<br />
Bevölkerung vernichtet; Stolpersteine in den Straßen<br />
erinnern an ihre ehemaligen Wohnorte.<br />
Nach dem Krieg wurde der <strong>Wedding</strong> Teil Westberlins.<br />
Viele Gebäude wurden saniert oder abgerissen<br />
und neugebaut – wie die Ernst-Reuter-Siedlung<br />
oder das Kurt-Schumacher-Haus. Ein Teil der alten<br />
Bausubstanz ist verloren gegangen, neue entstand.<br />
Die <strong>Wie</strong>dervereinigung 1990 hat den <strong>Wedding</strong> aus<br />
dem Grenzgebiet in die Mitte der Stadt geholt. Doch<br />
auch andere Entwicklungen prägen die Gegenwart.<br />
Die Fabriken sind zu. Viele Menschen arbeiten heute<br />
<strong>im</strong> Dienstleistungssektor, andere sind arbeitslos.<br />
Wohin die Entwicklung des <strong>Wedding</strong>, dem ehemaligen<br />
Arbeiterbezirk, geht, wird sich zeigen.<br />
Jakob Hayner<br />
Standpunkt<br />
Geschichte, was sagt uns das noch? Sind Traditionen<br />
und Gedenktage nicht zu Ritualen erstarrt, die wir<br />
über uns ergehen lassen? Heute ist doch angesagt,<br />
sich auf die Gegenwart zu konzentrieren und zu erleben,<br />
was der Moment bringt. Trotzdem, wer in<br />
einem alten Großstadtbezirk wohnt, stößt überall<br />
auf Spuren der Geschichte. Man fragt sich: Was war<br />
hier, wie ist das entstanden, wie wurde hier gelebt,<br />
was ist hier passiert?<br />
Das alltägliche Leben <strong>im</strong> <strong>Wedding</strong>er <strong>Quartier</strong> ist<br />
überall von Geschichte geprägt: Schüler lernen<br />
in Schulgebäuden aus der Gründerzeit. Neue Unternehmen<br />
richten sich mit ihren Schreibtischen,<br />
Computer und Ateliers dort ein, wo früher an<br />
Werkbänken und Maschinen gearbeitet wurde.<br />
Viele <strong>Wedding</strong>er Wohnungen zeigen in Anlage<br />
und Zuschnitt, wie hier früher gelebt wurde. Hier<br />
kommt ein Lebensgefühl auf, das <strong>im</strong>mer wieder an<br />
die geschichtliche Erinnerung stößt.<br />
Das nachbarschaftliche Leben mit allen Generationen<br />
bewegt sich ständig auf historischen Ebenen.<br />
Ob die Alten von den „guten“ oder „schlechten“<br />
Zeiten sprechen, <strong>im</strong>mer erzählen sie anschaulich,<br />
was sich früher unter Menschen abgespielt hat. Sie<br />
als Zeitzeugen zu befragen, lohnt sich und als Zuhörer<br />
ist man erstaunt, welches riesige Spektrum<br />
an Lebensgeschichten sich in einem Stadtteil in den<br />
wechselnden Zeitläufen angesammelt hat.<br />
<strong>Wie</strong> stark prägt die Geschichte ein <strong>Quartier</strong>? Der<br />
Begriff des „Roten <strong>Wedding</strong>“ ist keine endgültige<br />
Formel für diesen Stadtteil. Damit werden historische<br />
Phasen benannt, die nichts mehr mit der aktuellen<br />
Entwicklung zu tun haben müssen. Migration,<br />
Zuzug neuer sozialer Gruppen und Berufe, die<br />
aktive Bewältigung von Problemen durch engagierte<br />
Leute bringen Bewegung ins <strong>Quartier</strong> und zeigen,<br />
dass soziale Gestaltung in der Stadt möglich ist. Die<br />
Auseinandersetzung mit der Geschichte schafft ein<br />
tieferes Verständnis für die Nachbarschaft. Das<br />
stärkt das Bewusstsein, an einem Ort zu leben, in<br />
dem die Menschen durch Krisen und gute Entwicklungen<br />
einen großen Erfahrungsschatz gesammelt<br />
haben. Und es macht Mut, sich <strong>im</strong>mer wieder den<br />
Herausforderungen zu stellen und die neue Geschichte<br />
des <strong>Quartier</strong>s mitzugestalten.<br />
Ewald Schürmann<br />
Kiez aktuell _ Neuigkeiten aus dem QM-Gebiet Reinickendorfer Straße/Pankstraße<br />
„Du bist das Fest“ am 13. September auf dem<br />
Nettelbeckplatz<br />
„Wir <strong>im</strong> <strong>Quartier</strong>“<br />
Kunst- und Kulturvermittlung als Chance für Bildung<br />
und Image <strong>im</strong> <strong>Quartier</strong> nutzen, das ist die Idee hinter<br />
dem Projekt „Wir <strong>im</strong> <strong>Quartier</strong>“. Das vom <strong>Quartier</strong>smanagement<br />
geförderte Projekt führen die „Kulturermittler“<br />
seit Mitte des Jahres hier durch. Neben<br />
verschiedensten Aktionen und Angeboten für Kinder,<br />
Jugendliche und Erwachsene soll dieses Projekt die<br />
Zusammenarbeit der Kunst- und Kulturschaffenden<br />
mit schulischen und außerschulischen Einrichtungen<br />
fördern. Im Rahmen des Projektes entsteht eine mobile<br />
Infrastruktur, um einen alltäglichen Kunst- und<br />
Kulturbegriff unter die Leute zu bringen. Zentrales<br />
Element ist das QMobil, ein mobiles Atelier mit<br />
Außeneinrichtungen auf drei Rädern. Es enthält Arbeitsmaterialien<br />
etwa für Objektbau, Puppentheater,<br />
oder Fotografie. Im Projekt „Wir <strong>im</strong> <strong>Quartier</strong>“, das<br />
bis Ende 2015 läuft, werden gemeinsam mit den BewohnerInnen<br />
Aktionen erfunden und gestaltet. Ganz<br />
nach dem Motto: „Wir alle sind Künstler!“ Die erste<br />
Aktion war „Du bist das Fest“ während des Kulturfestivals<br />
<strong>Wedding</strong> Moabit. Aus Kartons bauten<br />
Kinder und Erwachsene auf dem Nettelbeckplatz<br />
Stühle, Hocker, Bänke, ja, ein Haus mit Dusche. Die<br />
ca. 100 Teilnehmer waren auf dem Weg, möglichst<br />
viele <strong>im</strong> Kiez zu erreichen, ein toller Erfolg. Weiter<br />
geht’s in der 2. Herbstferienwoche (8.-11.10.2013)<br />
mit der Aktion „Porträtier Dein <strong>Quartier</strong>“ auf vier<br />
Plätzen <strong>im</strong> Kiez. Am 8.10. um 10 Uhr steht der Fotobus<br />
auf dem Nettelbeckplatz. Merken kann man sich<br />
auch den 23.10., denn das ist der zweite der regelmäßigen<br />
Mittwochstermine, an denen von 15 bis 18<br />
Uhr Aktionen für alle <strong>im</strong> Kiez stattfinden. Näheres<br />
dazu jeweils aktuell auf der QM-Website.<br />
Das Teezelt macht be<strong>im</strong> Kulturfestival <strong>Wedding</strong> Moabit<br />
Station an der Panke<br />
Panke belebt!<br />
Ein neues QM-Projekt rückt die Panke in den Mittelpunkt<br />
seiner Arbeit. „Begegnungsanlässe entlang<br />
der Panke“ heißt es, und eigentlich verrät der Name<br />
schon das zentrale Anliegen der Betreiber. Es geht darum,<br />
das Flüsschen mehr ins Bewusstsein des Kiezes<br />
zu bringen und die dortigen Freizeitmöglichkeiten<br />
dafür zu nutzen, Bewohner aufeinander neugierig zu<br />
machen. Das Projekt wird durchgeführt von „Stadtgeschichen<br />
e.V.“, einem Verein, der Kultur- und Theaterwissenschaften,<br />
Stadtplanung und Stadtsoziologie<br />
zusammen führt. Stadtgeschichten erprobt stets<br />
neue Formen der Beteiligung, um Menschen einzubeziehen<br />
und dabei zu helfen, Vorurteile abzubauen.<br />
Von Juni bis September gab es vier Mal ein Teezelt <strong>im</strong><br />
Kiez – zum letzten Mal während des Kulturfestivals<br />
<strong>Wedding</strong> Moabit neben dem Stattbad. Dort trafen<br />
sich Anwohner aus verschiedenen Generationen,<br />
Ethnien und sozialen Hintergründen. Ein Highlight<br />
war der Besuch einer Gruppe älterer türkischstämmiger<br />
Frauen <strong>im</strong> Stattbad – zwei Sphären, die nicht<br />
zwingend zusammen gedacht werden. So aber konnte<br />
sich dort ein interessanter Austausch anbahnen.<br />
Die nächsten Projekte sind in Vorbereitung. Am 11.<br />
Oktober gibt es „<strong>Wedding</strong> Walking“, einen gemeinsamen<br />
Fitness-Spaziergang entlang der Panke. Zum<br />
Programm gehören Dehnübungen, Tipps für richtiges<br />
Laufen und Gesundheitsberatung. Teilnehmen<br />
werden u.a. auch die über ein QM-Projekt ausgebildeten<br />
Gesundheitsberaterinnen. Treffpunkt ist um<br />
15 Uhr am Haus Bottrop. Zum Abschluss geht es<br />
zu Panke e.V., dem neuen Off-Café an der Panke.<br />
Außerdem ist am 11. November zum Martinstag ein<br />
Laternenumzug mit Kindern aus drei Kitas geplant.<br />
Festivalatmosphäre auf den Straßen in <strong>Wedding</strong> und<br />
Moabit, hier vor dem Stattbad <strong>Wedding</strong><br />
Kultur <strong>im</strong> <strong>Quartier</strong><br />
Vom 13. bis 15.09. fand das erste Kulturfestival<br />
<strong>Wedding</strong> Moabit statt. Das Samenkorn dafür liegt<br />
hier <strong>im</strong> QM-Gebiet, wo in den letzten beiden Jahren<br />
das <strong>Wedding</strong> Kulturfestival stattfand. Nun trat das<br />
neue Festival mit erweitertem Spielraum und verändertem<br />
Konzept auf die Bühne. Anders als zuvor<br />
gab es 2013 keine zentrale Spielstätte, das Festival<br />
fand an den Orten statt, an denen die Kultur hier <strong>im</strong><br />
Stadtgebiet entsteht. Geplant war, einen Überblick<br />
über die mannigfaltige Kulturszene in den beiden<br />
oft unterschätzten Stadtbezirken zu geben. Und der<br />
Start war eindrucksvoll: Trotz kurzer Vorlaufzeit gab<br />
es mehr als 130 Veranstaltungen in ganz <strong>Wedding</strong><br />
und Moabit. In den Ateliers, Werkstätten, Eventräumen<br />
und Galerien überzeugten sich schätzungsweise12.000<br />
Besucher von Qualität und Kreativität<br />
des hier Entstehenden. 2014 wird das <strong>im</strong> Aufbau<br />
befindliche Kulturnetzwerk <strong>Wedding</strong> Moabit die<br />
Ausrichtung des Festivals von der aus dem Stattbad<br />
<strong>Wedding</strong>, dem Kulturnetzwerk <strong>Wedding</strong> und der<br />
Kommunikationsagentur georg+georg bestehenden<br />
Ausrichter-Arbeitsgemeinschaft übernehmen.<br />
Dein Kiez für die Hosentasche<br />
Mit QF2-Mitteln wird bis Ende 2013 ein illustrierter<br />
Kiez-Stadtplan entstehen, auf dem die wichtigsten<br />
Institutionen, Gebäude und Sehenswürdigkeiten des<br />
QM-Gebiets vorgestellt werden. Im Rahmen eines<br />
Workshops können sich Anwohner mit Vorschlägen<br />
für die Auswahl dieser Punkte und für die Gestaltung<br />
der Karte einbringen. Zeitpunkt und Ort dieses<br />
Workshops können Sie in Kürze auf der QM-Website<br />
www.pankstrasse-quartier.de erfahren.<br />
Was weißt Du<br />
über die Geschichte<br />
des Kiezes?<br />
Stefan, 48, wohnt am nördlichen Rand unseres Kiezes.<br />
„Die SPD war hier mal stark in den 30ern. Während der<br />
Spaltung Berlins war <strong>Wedding</strong> ja absolute Randlage. Bis<br />
zum Mauerfall. <strong>Wie</strong> eine Sackgasse. Kann man sich heute<br />
kaum noch vorstellen. Heute hingegen: Offen nach allen<br />
Richtungen: Multikulti! Viel Krach und viel Dreck. Aber die<br />
Mieten sind bezahlbar und es gibt günstige Einkaufsmöglichkeiten.<br />
Und es ist <strong>im</strong>mer was los!“<br />
Knud, 56, Kranfahrer, <strong>Wedding</strong>er, wohnt <strong>im</strong> Kiez. „Immer<br />
dasselbe hier. Hat sich nicht viel getan. Vielleicht, dass man<br />
jetzt überall türkisch und chinesisch essen kann. Deutsche<br />
Kneipen verschwinden dafür. Den Nettelbeckplatz haben sie<br />
2x umgebaut. Kreisverkehr hin, Kreisverkehr weg. Ist schon<br />
ne Weile her. Schön, dass sie am Leopoldplatz endlich mal<br />
was modernisieren. Den Park neu machen. Die letzten zwei,<br />
drei Jahre bewegt sich wieder was. Das freut einen schon!“<br />
Straßenumfrage<br />
Brigitte,67, ist Floristin in Rente. Seit 34 Jahren <strong>im</strong> <strong>Wedding</strong>.<br />
„<strong>Wedding</strong> ist voller Historie! Das Mitte Museum in der<br />
Pankstraße ist eines der ältesten in Berlin. Otto Nagel wohnte<br />
in der Brunnenstraße und das Arbeiterehepaar, das Fallada in<br />
„Jeder stirbt für sich allein“ beschreibt, lebte direkt ums Eck<br />
<strong>im</strong> „<strong>Wedding</strong>er Milieu“. Ich habe kürzlich die Neuauflage gelesen<br />
und zu diesem Anlass auch die Gedenktafel von „Otto<br />
und Elise Hampel“ in der Amsterdamer Str. 10 besucht.“<br />
Mahamed, 44, geboren in Tunesien, Koch, zu Besuch bei<br />
Verwandten <strong>im</strong> Kiez. „Ich finde den <strong>Wedding</strong> <strong>im</strong> Vergleich zu<br />
Schöneberg unaufgeräumt und chaotisch. Viel Polizei. Sehr<br />
quirlig alles. Mir ist das zu viel. Ich brauche es ruhiger, bürgerlicher.<br />
Nicht mein Bezirk. Im alten Schw<strong>im</strong>mbad (heute<br />
Stattbad Anm. d. Redaktion) wurde doch in den 50ern der<br />
Film „Die Halbstarken“ gedreht. Das ist allerdings ein klasse<br />
Streifen!“<br />
DJ Arab, 28, Musiker, Eltern Libanesen, geboren in Berlin-<strong>Wedding</strong>.<br />
„<strong>Wedding</strong> ist ne Klasse für sich! Eine tolle<br />
Internationalität. Viele unterschiedliche Mentalitäten. Ich<br />
komme mit allen klar. Für mich sind die Boatengs <strong>Wedding</strong>-Geschichte.<br />
Hier aufgewachsen und <strong>im</strong> Käfig kicken<br />
gelernt! Krass was die jetzt sind: Weltklasse-Fußballer! Und<br />
jetzt hat der kleine Jerome <strong>im</strong> Bundesliga-Bruderkampf<br />
dem älteren Bruder Kevin-Prince auf die Mütze gegeben.“<br />
Georg, 57, Industriekaufmann, momentan arbeitssuchend,<br />
wohnt seit 4 Jahren <strong>im</strong> Kiez.„<strong>Wedding</strong>? Geschichte?<br />
Ernst Busch! Roter <strong>Wedding</strong>! Die Musik war von Hanns<br />
Eisler: >Die Arbeiterklasse marschiert. Wir fragen euch<br />
nicht nach Verband und Partei / Seid ihr nur ehrlich <strong>im</strong><br />
Kampf mit dabei / Gegen Unrecht und Reaktion.< Die Arbeiterbewegung<br />
zur Jahrhundertwende ist für mich DAS<br />
historische Ereignis, das ich mit dem <strong>Wedding</strong> verbinde.“<br />
Ralph, 60, Gesinnungsberliner seit 1978. „Verschiedene<br />
Etappen: Der Rote <strong>Wedding</strong>! SPD und <strong>Wedding</strong> gehören dicht<br />
zusammen. Willi Brand hatte hier seine Parteizentrale. Das<br />
Kurt Schumacher-Haus gibt es ja <strong>im</strong>mer noch. Und Steinbrück<br />
wohnt da am Kanal in Eva Högels Haus. Der <strong>Wedding</strong> hat sich<br />
ziemlich von dem weg entwickelt, für das er mal stand. Wir<br />
haben jetzt die 5. Mieterhöhung in 5 Jahren erhalten. Am bösen<br />
Wort >Gentrifizierung< kommt man nicht mehr vorbei.“<br />
Markus, 27. „Ich bin vor einem Jahr hierher gezogen und<br />
kenne mich nicht so aus, bemerke aber Tendenzen der<br />
Gentrifizierung. Ich glaube eher an eine langsame Wandlung<br />
des <strong>Wedding</strong>, nicht so rasant wie in Neukölln. Ich liebe<br />
die bunte Mischung und Vielfalt und hoffe, dass sie uns<br />
möglichst lange erhalten bleibt. Meinen Besuch aus Köln<br />
schicke ich heute ins >Pr<strong>im</strong>e T<strong>im</strong>e TheaterHouse of Nations>, <strong>im</strong> Ernst-Reuter Haus, einem Wohnhe<strong>im</strong><br />
um die Ecke. Das hat mich <strong>im</strong> Grunde in den Kiez<br />
geführt. Finde die zentrale Lage innerhalb Berlins und auch<br />
die Verkehrsanbindung mit U9, U6 und Ringbahn phantastisch.<br />
Über die Historie weiß ich nicht viel, außer, dass hier<br />
ehemals eine Hochburg der Sozialdemokratie war.“<br />
Ausgabe 3/2013<br />
Die <strong>Wie</strong>senburg _ Geschichte des Obdachlosenasyls in der <strong>Wie</strong>senstraße 55<br />
<strong>Wie</strong> <strong>Arbeiterfamilien</strong> <strong>im</strong> <strong>Wedding</strong> <strong>lebten</strong><br />
Ein Gespräch mit Joach<strong>im</strong> Wolfgang Dumkow,<br />
46. Der Enkel des ehemaligen Asyl-Koches ist examinierter<br />
Krankenpfleger, sowie Filmemacher und<br />
Schauspieler. Er lebt seit seiner Geburt <strong>im</strong> „Beamtenwohnhaus“<br />
der <strong>Wie</strong>senburg. Seit 13 Jahren arbeitet<br />
er an der Chronik des Obdachlosenasyls.<br />
Ende des 19. Jahrhunderts wurde Obdachlosigkeit<br />
in Berlin zum gesellschaftlichen Problem. Neben<br />
städtischen und kirchlichen Asylen gab es private,<br />
die etwas mehr Komfort boten. So unterhielt der<br />
Berliner Bürgerverein ein Männerasyl in der Fröbelstraße.<br />
Als dieses zu klein wurde, brauchte man ein<br />
weiteres. Der Berliner Asylverein für Obdachlose<br />
<strong>im</strong> <strong>Wedding</strong> wurde gegründet und die <strong>Wie</strong>senburg<br />
nach weniger als einem Jahr Bauzeit 1896 eröffnet.<br />
Grund für dieses rasante Bautempo war ein Ult<strong>im</strong>atum<br />
des damalige Polizeichefs. Er hatte den Bau dieses<br />
„Ortes der Verfehlung“ verhindern wollen, um<br />
eine Verbrüderung der „assozialen und vagabundierenden<br />
Kräfte“ zu unterbinden. Es drohte ein Entzug<br />
des Grundstückes, sollte der Bau nicht binnen<br />
12 Monaten abgeschlossen sein. Die Architekten<br />
Toebelmann und Schnock, Schüler des Baumeisters<br />
Schinkel, setzten die Pläne mit mehr als 400 Handwerkern<br />
auf 6.684 qm bebauter Fläche inklusive<br />
6.600 qm funktionaler Kellergewölbe um. Mit ihrer<br />
Kapazität für 700 Männer war die <strong>Wie</strong>senburg<br />
mit ihren ausgeklügelten Hygieneinstrumentarien<br />
wie 60 beheizbaren Duschen, 40 Desinfektionsbadewannen,<br />
einem Autoklaven (Überdruckreiniger),<br />
Wäscherei und Küche ein hochmodernes, funktionelles<br />
Asyl. Die Betten mit metallenen Rosten stellten<br />
aus hygienischer Sicht einen großen Fortschritt<br />
gegenüber den bis dato verwendeten Holzkonstruktionen<br />
in den „Läusepennen“ dar. Es gab um die 30<br />
Festangestellte in Hausmeisterei, Küche, Wäscherei<br />
und Werkstätten. Asylhausknechte waren „Allrounder“,<br />
die unterschiedlichste Aufgaben übernahmen.<br />
Finanziert wurden Bau und Betrieb der <strong>Wie</strong>senburg<br />
durch ein Konglomerat Berliner Bürgerlicher um<br />
den jüdischen Damenmantelfabrikanten und Sozialisten<br />
Paul Singer, Kurator des Asyls, den Gehe<strong>im</strong>rat<br />
Prof. Dr. Rudolf Virchow, Hygienebeauftragter und<br />
den Bankier Gustav Tölde, Vorstand und Verwaltungsrat.<br />
Speisen waren oft Spenden z.B. von der<br />
Molkerei Karl Bolle.<br />
Obdachlose, die in der <strong>Wie</strong>senburg Asyl suchten,<br />
waren von der Meldepflicht befreit. Pflichtangaben<br />
waren nur, woher man kam und welchen Beruf<br />
man hatte. Niemand durfte öfter als 4x <strong>im</strong> Monat<br />
hier nächtigen. Um 18 Uhr öffnete die <strong>Wie</strong>senburg:<br />
Zuerst wurde der „Asylist“ in „Augenschein“ genommen.<br />
Falls nötig, wurde parasitär befallene<br />
Kleidung gewaschen, ihr Träger bekam ein Desinfektionsbad.<br />
Anschließend gab es Abendbrot: eine<br />
Reis- oder Mehlsuppe und 1/7 Laib Brot. Nachtruhe<br />
war um 22 Uhr. Rauchen, Alkohol und „Lärmen“<br />
waren absolut verboten. Nach einem „Napf<br />
Milchkaffe und einer Schrippe“ musste das Asyl um<br />
6 Uhr morgens verlassen werden.<br />
Joach<strong>im</strong> Dumkow: „Beten musstest Du nicht, Du<br />
musstest kein Parteibuch haben, hier warst Du frei.<br />
Daher war die <strong>Wie</strong>senburg so beliebt bei Vagabunden,<br />
Obdachlosen, Streunern, Wanderarbeitern,<br />
Erntehelfern und Dienstmädchen.“ Und bis 1910<br />
hatte die Berliner Polizei kein Zutrittsrecht. 1907<br />
wurde das Asyl um 400 Schlafplätze für Frauen erweitert.<br />
1910 starb Paul Singer. Damit versiegte eine<br />
wichtige Geldquelle und läutete den allmählichen<br />
Verfall ein. Auch aufgrund der neuen Steuerpflicht<br />
wurde von nun an eine Gebühr von 10 Pfennig pro<br />
Nacht und Gast erhoben.<br />
Als <strong>im</strong> ersten Weltkrieg Soldaten oft verletzt von<br />
der Front he<strong>im</strong>kehrten, hatte das Asyl besonders<br />
hohen Zulauf und verzeichnete <strong>im</strong> Jahre 1915 einen<br />
Rekord mit 256.680 Übernachtungen. In den 20er<br />
Jahren besuchten viele Literaten die <strong>Wie</strong>senburg,<br />
zumeist für Milieustudien: Rosa Luxemburg, Hans<br />
Fallada, Kurt Tucholsky, Carl von Ossietzky, Erich<br />
Kästner, Heinrich Zille, ... Einige ihrer Geschichten<br />
spielen hier. 1931 dreht Fritz Lang den Film „M -<br />
Eine Stadt sucht einen Mörder“ auf dem Gelände.<br />
Von dem Geld, das man dafür erhielt, wurden die<br />
letzten Investitionen getätigt. Seit den1920er Jahren<br />
bis 1933 nutzte die jüdischen Gemeinde die <strong>Wie</strong>senburg<br />
als He<strong>im</strong>. 1933 schlossen die Nazis das Asyls<br />
und missbrauchten es als Fahnendruckerei des NS-<br />
Reg<strong>im</strong>es. Insgesamt nächtigten bis zu diesem Jahre<br />
über 2,4 Millionen Menschen in der <strong>Wie</strong>senburg.<br />
1944/45 wurde die <strong>Wie</strong>senburg durch Bombenangriffe<br />
weitgehend zerstört.<br />
Das Gebäude wurde nach dem Krieg „enttrümmert“<br />
und lange als Notquartier von Leuten, die<br />
keine eigene Bleibe besaßen, genutzt. Noch heute<br />
finden sich bauliche Spuren einer Zwischennutzung,<br />
z.B. eingezogene Wände, alte Öfen, Hängevorrichtungen<br />
für Vorhänge u.v.m. Daneben diente<br />
die <strong>Wie</strong>senburg oft als Kulisse für Film- und Fernsehproduktionen,<br />
so z.B. der Verfilmung von Falladas<br />
Buch „Ein Mann will nach oben“ (1978), bei<br />
Schlöndorffs „Blechtrommel“( 1979) oder Fassbinders<br />
„Lili Marleen“ (1981).<br />
Seit vielen Jahren versucht Joach<strong>im</strong> Dumkow, die<br />
<strong>Wie</strong>senburg in ihren Originalzustand zurückzuführen.<br />
„Das ist mühevolle Kleinarbeit, manchmal<br />
komme ich mir vor, als räumte ich den Dreck von<br />
einer Seite auf die andere.“<br />
Heute ist die <strong>Wie</strong>senburg inspirierender Ort für<br />
Künstler, Musiker und Handwerker: Maler, Tischler,<br />
Metallarbeiter agieren hier. Es gibt ein Tonstudio,<br />
mehrere Proberäume für Bands und eine mit<br />
<strong>Quartier</strong>smanagement-Mitteln modern ausgebaute<br />
Tanzhalle, in der unterschiedlicher Projekte stattfinden.<br />
In Ruinen und Gärten gibt es Workshops und<br />
naturnahe Projekte für Kinder. Sogar ein Imker arbeitet<br />
auf dem Gelände. „Der Honig ist jetzt schon<br />
sehr lecker und wird von Jahr zu Jahr besser!“<br />
Volker Kuntzsch<br />
Der sozialkritische Zeichner, Maler und Fotograf<br />
Heinrich Zille klagte die katastrophalen Wohnverhältnisse<br />
in den Berliner Arbeiterquartieren um<br />
1900 mit dem drastischen Vergleich an, dass eine<br />
schlechte Wohnung einen Menschen totschlagen<br />
kann. Der Schriftsteller Kurt Tucholsky nannte<br />
die Wohnungen in den grauen Mietskasernen<br />
und Hinterhöfen „finstere Löcher“ und befand,<br />
dass in der <strong>Wedding</strong>er Ackerstraße geboren zu<br />
sein, ein „Fluch“ wäre. Und wie depr<strong>im</strong>iert Menschen<br />
in solchen engen Behausungen existieren,<br />
zeigt die Szene in dem Film „Kuhle Wampe“ von<br />
Bertold Brecht und Slátan Dudow (1932), in der<br />
sich ein junger Arbeitsloser verzweifelt aus dem<br />
Küchenfenster in den Hinterhof stürzt. Neben<br />
Zille haben sich die Berliner Künstler Otto Nagel,<br />
Hans Baluschek, Käthe Kollwitz und andere in<br />
eindringlich realistischen Bilddarstellungen über<br />
die Wohnsituation der <strong>Arbeiterfamilien</strong> kritisch<br />
und anklagend mit den Lebenssituationen und<br />
sozialen Zuständen auseinandergesetzt.<br />
Der <strong>Wedding</strong> erlebte als Berliner Arbeiterbezirk<br />
eine starke Dynamik in der Ansiedlung von Industrie<br />
und Wohnungsbau. Noch bis zur Hälfte<br />
des 19. Jahrhundert weitgehend Brachland, bauten<br />
nach der Eingemeindung des <strong>Wedding</strong> in die<br />
Stadt Berlin ab 1860 hier <strong>im</strong>mer mehr Unternehmen<br />
Fabriken auf. Die Konzerne der Chemie-,<br />
Maschinenbau- und Elektroindustrie Schering,<br />
Schwartzkopff, Deutsche Edison Gesellschaft<br />
(AEG) und Bergmann AG (Osram) boten in ihren<br />
Massenproduktionsstätten für Tausende Menschen<br />
Arbeitsplätze, allerdings unter den Bedingungen<br />
von Hungerlöhnen und inhumanen Arbeitsbedingungen.<br />
Die auf effektive Produktivität<br />
angelegten Fabrikbauten mit ihren langgestreckten<br />
Hallen gaben das Muster für die Anlage der<br />
Wohnquartiere in der Nähe der Arbeitsstätten:<br />
Stadtbaurat James Hobrecht baute ab 1862 nach<br />
einem Flächennutzungsplan ein Straßengeflecht<br />
wie mit dem Lineal gezogen. Ebenso monoton<br />
wurden Mietskasernen als Massenquartiere gebaut,<br />
um Wohnraum für die rasant anwachsende<br />
Bevölkerung zur Verfügung zu stellen: Zwischen<br />
1850 bis 1867 stieg die Bewohnerschaft des <strong>Wedding</strong><br />
von 3.000 auf 16.000 und erreichte die Hunderttausend<br />
<strong>im</strong> Jahr 1890.<br />
Preußisch schlicht und gerade, nur sparsam mit<br />
Stuck verzierte Häuserfassaden kennzeichnen<br />
die Reihen von vier- bis fünfstöckigen Wohnhäusern<br />
zur Straßenseite hin. Nach hinten sind meist<br />
drei bis vier quadratische Hinterhöfe angelegt,<br />
in deren Wohnungen kaum Tageslicht durch die<br />
schmalen Lichtschächte gelangt. In den kleinen<br />
Arbeiterwohnungen <strong>lebten</strong> zwischen acht und<br />
zwölf Menschen. Oft mussten die Familien auch<br />
noch Untermieter aufnehmen, für die als „Schlafburschen“<br />
ein Bett zur Verfügung gestellt wurde.<br />
Während die Männer am Fließband arbeiteten,<br />
verdienten sich viele Frauen durch He<strong>im</strong>arbeit<br />
als Näherinnen einen kleinen Zuverdienst und<br />
die Kinder trugen Zeitungen aus oder verrichteten<br />
andere Hilfsarbeiten in Kneipen oder anderswo.<br />
In den überbelegten Wohnungen grassierten<br />
Krankheiten durch schlechte Hygiene. Die Gemeinschaftstoiletten<br />
auf dem Treppenpodest oder<br />
<strong>im</strong> Hof wurden durchschnittlich von vierzig Menschen<br />
frequentiert. In den überbelegten Häusern<br />
stank es nach Körpergerüchen und Kochdunst, es<br />
war laut durch schreiende Kinder und das aus den<br />
Wohnungen dringende St<strong>im</strong>mengewirr. Feuchtigkeit,<br />
abbröckelnder Putz, Rattenplage, knappe<br />
Lebensmittel und andere Mängel vor allem nach<br />
dem Ersten Weltkrieg waren Ursachen für Kinderkrankheiten<br />
und hohe Kindersterblichkeit. In<br />
Klaus Kordons Roman „Die roten Matrosen oder<br />
ein vergessener Winter“ wird die <strong>Wedding</strong>er Situation<br />
dieser Zeit anschaulich beschrieben.<br />
Schon früh traten engagierte Bürger mit Initiativen<br />
gegen die sozialen Missstände auf, so der<br />
Berliner Asylverein von 1868, der die <strong>Wie</strong>senburg<br />
als Einrichtung für Obdachlose betrieb. Weiterhin<br />
entstanden Vereine der Sozialdemokraten<br />
und Kommunisten, die in Selbsthilfe die verschiedensten<br />
Angebote von der Gesundheitspflege bis<br />
zum Kulturleben organisierten. Damit ging auch<br />
eine Politisierung der Arbeiterschaft einher, die<br />
den Ruf des „Roten <strong>Wedding</strong>“ begründete.<br />
Ewald Schürmann<br />
Darstellung der beengten Wohnverhältnisse in<br />
einer typischen <strong>Wedding</strong>er Wohnung <strong>im</strong> Mitte<br />
Museum<br />
<strong>Wedding</strong>er Geschichte <strong>im</strong> Mitte-Museum<br />
Das Mitte-Museum in der Pankstraße gibt in einer<br />
Dauerausstellung eine anschauliche Vorstellung<br />
von den Wohnverhältnissen der <strong>Arbeiterfamilien</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Wedding</strong>. Detailgetreu sind Wohnelemente mit<br />
Z<strong>im</strong>mereinrichtungen rekonstruiert, wobei die Enge<br />
der Raumzuschnitte als bedrückende Lebensrealität<br />
auffällt. Das Museum greift seit 1989 <strong>im</strong>mer wieder<br />
historische Themen aus dem <strong>Wedding</strong> auf und<br />
präsentiert sie in Sonderausstellungen. Dazu gibt<br />
es auch entsprechend fundierte Publikationen. Ein<br />
Besuch ist für Geschichtsinteressierte ein Muss.<br />
Pankstraße 47, So – Mi 10 – 17, Do 10 – 20 Uhr<br />
www.mittemuseum.de
Die Kinder erziehen, sparsam und effizient den Haushalt führen, dem<br />
Partner den Rücken frei halten: Früher fielen diese Aufgaben nahezu ausschließlich<br />
in die Zuständigkeit der Frauen. Und in den Jahren des Nationalsozialismus<br />
wurden sie ideologisch überhöht als Dienst der Frauen am<br />
Vaterland und zum Erhalt der „arischen Rasse“. Zu diesem Zweck gab<br />
es hier <strong>im</strong> Kiez ab 1936 die Reichsmütterschule an der Ecke Ruheplatz-/<br />
Schulstraße. In Kursen erwarben Frauen praktisches Wissen zu Haushalt,<br />
Hygiene und Babypflege, wurden aber auch massiv ideologisch indoktriniert.<br />
Dieser <strong>im</strong> Krieg zerstörten Schule widmet sich noch bis August 2014<br />
eine sehr sehenswerte Ausstellung <strong>im</strong> Mitte Museum unter dem Titel „Frau<br />
Familie Volk Rasse“. Gezeigt werden Exponate, welche die Geschichte<br />
der Institution und den ideologischen Hintergrund beleuchten. Die Ausstellung<br />
findet <strong>im</strong> Rahmen des Berliner Themenjahres „Zerstörte Vielfalt“<br />
statt. www.mittemuseum.de<br />
Alte Schriftzüge an Häuserwänden, in Hinterhöfen oder an Geschäften<br />
sind Spuren der Geschichte, die man be<strong>im</strong> Gang durch die Straßen des<br />
<strong>Quartier</strong>s entdecken kann. Sie sind beliebte Fotomotive. Diese an vielen<br />
Stellen erhaltenen historischen Spuren sind eine Attraktion Berlins, weil<br />
sie in anderen Städten kaum noch zu finden sind.<br />
QM<br />
Auf Friedhöfen lässt sich Geschichte ganz persönlich erfahren. Einfache<br />
Gräber bis aufwändig gestaltete Grabanlagen nennen Namen mit Berufen<br />
und Lebensdaten von Personen und Familien. Der „Urnenfriedhof Gerichtstraße“<br />
besteht seit 1828 und hieß ursprünglich „Ruheplatz“ (heute noch:<br />
Ruheplatzstraße). Ab 1912 wurde das Krematorium mit der Urnenhalle<br />
und dem Kolumbarium zur Aufstellung der Urnen errichtet. Die Anlage wird<br />
gegenwärtig zu einem Zentrum für Kunst und Kultur umgebaut. Auf dem<br />
Friedhof befinden sich Gräber und Urnen bekannter Persönlichkeiten:<br />
Der Begründer der Dresdner Bank Eugen Gutmann und seiner Familie (s.<br />
Foto), Schauspieler Rudolf Platte, Bildhauer Louis Tuaillon, Innenminister<br />
Hugo Preuss, Gründer des philharmonischen Chors Siegfried Ochs, Direktor<br />
des Burgtheaters Paul Schleuther, Mediziner August von Wassermann<br />
und anderen.<br />
Karte des heutigen <strong>Wedding</strong>er Stadtgebietes von 1857. Gut zu erkennen ist der bis heute gleich gebliebene Verlauf der Müllerstraße<br />
von Nordwest (oben links) nach Südost (Mitte unten). Viele große Straßen sind bereits angelegt. Wo heute der Humboldthain<br />
ist, wurde damals der Galgenberg eingetragen. Der „kleine <strong>Wedding</strong>“ liegt am heutigen <strong>Wedding</strong>platz. Die ganze<br />
Gegend ist spärlich bebaut und wird vor allem landwirtschaftlich genutzt. Eine sehr schöne Karte aus dem Jahr 1827 kann als<br />
Nachdruck übrigens <strong>im</strong> Mitte Museum erworben werden. Dort ist die landwirtschaftliche Prägung des Gebiets noch deutlicher.<br />
Der „Rote <strong>Wedding</strong>“ konzentrierte sich in der We<strong>im</strong>arer Republik in der<br />
Kösliner Straße. Die „rote Gasse“ war eine Hochburg der Kommunistischen<br />
Partei. Hier lag ein <strong>Quartier</strong> der Armut und des Protestes an den<br />
gesellschaftlichen Verhältnissen, denn 2.500 Menschen drängten sich in<br />
24 Wohnhäusern. Ab dem 1. Mai 1929 spitzte sich ein Konflikt zwischen<br />
kommunistischen Demonstranten und der Polizei zu, die wegen eines Demonstrationsverbotes<br />
auf Arbeiter schoss. Es gab 19 tote Zivilisten und<br />
250 Verletzte. Der große Gedenkstein an der <strong>Wie</strong>sen-, Ecke Uferstraße<br />
erinnert an das Ereignis. Mehr über den sogenannten Blutmai kann man<br />
in der vom Mitte Museum 2009 <strong>im</strong> Rahmen einer Ausstellung herausgegebenen<br />
Publikation „Berliner Blutmai 1929. Eskalation der Gewalt oder<br />
Inszenierung eines Medienereignisses“ erfahren.<br />
Das Verhältnis zu Vergangenheit und Geschichte ist auch eine Frage des<br />
Verhältnisses zu den vorigen Generationen. Wenn wir über die Geschichte<br />
der Stadt sprechen, müssen wir uns auch fragen: Was passiert mit den<br />
älteren Mitmenschen <strong>im</strong> Kiez? <strong>Wie</strong> sprechen wir über sie? Nur als Ballast<br />
vergangener Tage, als Demografie-Falle? Die SeniorInnenvertretung Mitte<br />
wehrt sich gegen diese Wahrnehmung und Behandlung von Menschen<br />
<strong>im</strong> Alter. »Die Alten müssen aus der Unsichtbarkeit geholt werden.«, sagt<br />
die Vorsitzende Elke Schilling (Bild Mitte mit blauer Bluse) . »Unsichtbarkeit<br />
meint, dass die Belange von älteren Menschen öffentlich nicht wahrgenommen<br />
werden.« Dass die Stadt auch für ältere Menschen lebenswert<br />
ist und bleibt, ist dabei ein Hauptanliegen der SeniorInnenvertretung. Dabei<br />
geht es nicht um einen Blick in die Vergangenheit, sondern um die<br />
aktive Gestaltung der Zukunft. »Letztes Jahr wurde nur eine statt den angekündigten<br />
zwei Begegnungsstätten geschlossen, das war schon auch<br />
ein Erfolg. Wir haben gezeigt: Mit uns nicht. Da machen wir Rabatz.«, sagt<br />
Elke Schilling. Auf die Frage, was die Themen der näheren Zukunft sind,<br />
lautet die Antwort: »Steigende Mieten, Gentrifizierung und Altersarmut.«<br />
Alte Menschen sind von diesen Prozessen besonders betroffen. Sind<br />
sie aufgrund steigender Mieten und der noch unter Hartz IV liegenden<br />
Grundsicherung gezwungen, ihre Wohnung zu verlassen, so werden sie<br />
ihrem Umfeld entrissen, in die soziale Isolation getrieben. Neue Kontakte<br />
zu knüpfen ist schwierig <strong>im</strong> Alter. Es zeigt sich: das Verhältnis zur eigenen<br />
Geschichte und zu den Älteren wird in der Gegenwart gestaltet. Das hat<br />
sich die SeniorInnenvertretung zur Aufgabe gemacht.<br />
www.seniorinnenvertretung-mitte.de<br />
...eine Chance durch Europa!<br />
Berlin ist für die Großstadtliteratur ein unerschöpflicher Themenraum. In der<br />
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kommt dabei der <strong>Wedding</strong> vor allem<br />
als Kiez der Arbeiter und kleinen Leute mit ihrem Situations- und Sprachwitz<br />
aber auch mit ihren existentiellen Problemen vor. Echtes <strong>Wedding</strong>er<br />
„Milieu“ erzählt Jonny Liesegang, der in der Pankstraße wohnte, in seinen<br />
Geschichten von „Det fiel mir uff“ und drei weiteren Büchern. Das Elend<br />
der Erwerbslosen beschreibt Otto Nagel, der in der Reinickendorfer Straße<br />
geboren wurde, in Szenen einer „Pennerkneipe“ in dem Roman „Die<br />
weiße Taube oder Das nasse Dreieck“. Theodor Plivier war das 13. Kind<br />
einer Arbeiterfamilie aus der <strong>Wie</strong>senstraße und schrieb als Schriftsteller<br />
eine große Romantrilogie über den Zweiten Weltkrieg. Der <strong>Wedding</strong> bot<br />
auch literarischen Stoff: So der authentische private Kampf gegen das<br />
Hitlerreg<strong>im</strong>e eines Ehepaares aus der Amsterdamer Straße, der von Hans<br />
Fallada <strong>im</strong> Roman „Jeder stirbt für sich allein“ gestaltet wurde. Ein anderes<br />
Beispiel ist eine kurze Episode in Erich Kästners Roman „Fabian“, die in<br />
der Müllerstraße spielt.<br />
gefördert aus Mitteln der Europäischen Union<br />
(Europäischer Fonds für regionale Entwicklung),<br />
der Bundesrepublik Deutschland und des Landes<br />
Berlin <strong>im</strong> Rahmen des Programms „Soziale Stadt“<br />
Impressum<br />
Herausgeber: L.I.S.T. GmbH - <strong>Quartier</strong>smanagement<br />
Reinickendorfer Straße | Pankstraße<br />
V.i.S.d.P: Johannes Hayner | Volker Kuntzsch<br />
Redaktion: georg+georg | Ewald Schürmann<br />
So sieht die <strong>Wie</strong>senburg heute aus. Aus den verfallenen Gebäuden<br />
wachsen Bäume.<br />
Illustrierend zum Artikel auf der Vorderseite hier ein historisches Foto aus<br />
der <strong>Wie</strong>senburg. Es zeigt den Schlafsaal 29 für Männer.<br />
Grafik und Satz: georg+georg | www.georg-georg.de<br />
<strong>Quartier</strong>smanagement, Prinz-Eugen-Str. 1, 13347 Berlin<br />
Tel: 030 74 74 63 47 | Fax: 030 74 74 63 49<br />
qm-pank@list-gmbh.de | www.pankstrasse-quartier.de<br />
www.facebook.com/QM.<strong>Pankstrasse</strong><br />
http://twitter.com/QM_<strong>Pankstrasse</strong><br />
Der Nettelbeckplatz wurde1884 eröffnet und nach<br />
dem Seefahrer Joach<strong>im</strong> Nettelbeck benannt, der<br />
durch autobiografischen Schriften Bekanntheit erlangte.<br />
Im 20. Jahrhundert wurde der Platz den Anforderungen<br />
des Autoverkehrs unterworfen. Bis in<br />
die späten 1980er Jahre war der Platz von einem<br />
Kreisverkehr umgeben, vom Verkehr umflutet. Erst<br />
eine Umgestaltung, die mit der Neueröffnung des<br />
Platzes 1987 endete, grenzte den Platz mit Neubauten<br />
ab. In der Mitte des Platzes befindet sich<br />
nun ein Brunnen der Künstlerin Ludmila Seefried-<br />
Matejkova. Zu sehen sind junge Menschen, die auf<br />
einem Vulkan ausgelassen zur Musik eines Piano-<br />
Spielers tanzen. Ein genauer Blick auf den linken<br />
Fuß des Pianisten, der sich plötzlich als Teufel erweist,<br />
gibt dem unbeschwerten Spiel eine gefährliche<br />
Note. Die nächste Umgestaltung des Platzes<br />
folgte in den Jahren 2005 und 2006 mit QM-Mitteln,<br />
als der Platz unter Beteiligung der Anwohner<br />
freundlicher gestaltet wurde – mit neuen Sitzgruppen<br />
und einer stärkeren Betonung der ganz eigenen<br />
dreieckigen Form, die einen Kreis in sich fasst.<br />
Die formatfüllende Karte auf dieser Seite entstammt einem Straube-Stadtplan Berlin aus dem Jahr 1893. Viel hat sich<br />
getan seit 1857 (kleiner Plan oben), aber man sieht <strong>im</strong>mer noch viele Straßen, die nur angelegt, aber noch nicht bebaut<br />
sind. Interessant sind auch abweichende Straßenführungen etwa am Nettelbeckplatz.<br />
Schilder und Tafeln an Hauseingängen erinnern an best<strong>im</strong>mten Orten <strong>im</strong><br />
<strong>Quartier</strong> an Menschen, die dort gelebt haben. Nachbarn und Passanten<br />
werden so direkt vor Ort mit Geschichte konfrontiert. Meist lassen sich<br />
über die kurzen Texte hinaus <strong>im</strong> Internet weitere Angaben finden. Erinnert<br />
wird an unterschiedliche Personen. So gibt es z.B. einen Stolperstein vor<br />
dem Haus Maxstraße 12, der an den Widerstandskämpfer gegen den<br />
Nationalsozialismus Willi Bolien erinnert. Die Gedenktafel <strong>im</strong> Bild wurde<br />
für den Clown Onkel Pelle, ein Berliner Original, auf dem Platz vor dem<br />
Rathaus <strong>Wedding</strong> errichtet.<br />
Die Straßen <strong>im</strong> <strong>Wedding</strong> hatten nach ihrer Erbauung zunächst nur einfache<br />
Ziffern. So die Straße Nr. 51, die 1889 in Prinz-Eugen-Straße umbenannt<br />
wurde. Der Magistrat von Berlin best<strong>im</strong>mte damals, dass auch<br />
weitere Straßen nach Ereignisse und Persönlichkeiten des Spanischen<br />
Erbfolgekrieges (1701 – 1714) benannt wurden, so nach den Schlachten<br />
bei Turin, Höchstedt, Oudenaarde und Malplaquet. Die Gerichtstraße ist<br />
seit 1827 bekannt, weil dort ein Hochgericht mit einer Hinrichtungsstätte<br />
mit einem Galgen befand. Auf der Müllerstraße gab es noch Anfang des<br />
19. Jahrhunderts 25 Müller. Wer sich für die Bedeutung der Straßennamen<br />
interessiert, kann ausführliche Erklärungen hier finden:<br />
www.luise-berlin.de/strassen