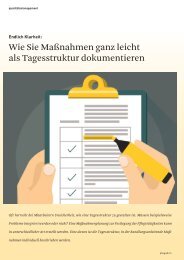Praxis Altenpflege
Kurze Anleitungen und praktische Tipps für Ihren Pflegealltag
Kurze Anleitungen und praktische Tipps für Ihren Pflegealltag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Praxis</strong>:<br />
Ausgabe 4 • KW 6<br />
9. Februar 2016<br />
<strong>Altenpflege</strong><br />
Kurze Anleitungen und praktische Tipps<br />
für Ihren Pflegealltag<br />
„Mehr Zeit für den Menschen…“<br />
VATI & Co 3<br />
Insulingabe 4<br />
Winterfest 7<br />
Kündigung 8<br />
Kennen Sie sich mit der Wirkung<br />
atemerleichternder Lagerungstechniken<br />
aus? Mit diesem<br />
Selbst-Test prüfen Sie es<br />
und frischen gleichzeitig Ihr<br />
Wissen auf.<br />
Insulininjektionen sind keine<br />
einfachen Routinetätigkeiten.<br />
Feinheiten wie die Wahl der<br />
Injektionsstelle können die Wirkung<br />
des Insulins gravierend<br />
beeinflussen.<br />
Der nächste Frühling kommt<br />
bestimmt. Doch bis dahin wird<br />
es noch einmal richtig kalt.<br />
Lesen Sie hier, wie Sie sich<br />
gegen das große Frieren am<br />
besten schützen können.<br />
Viele Pflegekräfte befürchten,<br />
dass ihnen wegen häufiger<br />
Krankmeldungen gekündigt<br />
werden könnte. Dieser Artikel<br />
zeigt, warum das nicht so einfach<br />
möglich ist.<br />
Zuhören<br />
können<br />
Liebe Leserin,<br />
lieber Leser,<br />
vor einigen Tagen berichtete eine<br />
Kollegin während der Übergabe von<br />
diesem Erlebnis: Die beiden Töchter<br />
einer Pflegekundin trafen sich bei<br />
ihrer Mutter und nutzten die Gelegenheit,<br />
um deren 90. Geburtstag<br />
zu planen. Die alte Dame holte<br />
immer wieder Luft und wollte etwas<br />
sagen, doch im Eifer des Gefechts<br />
bemerkten die Töchter dies gar nicht.<br />
Zwischenzeitlich kam die Pflegekraft<br />
ins Zimmer und fragte: „Na,<br />
Frau Sobel, freuen Sie sich schon auf<br />
Ihren Geburtstag?“ Die Töchter wirkten<br />
verärgert, weil sie in ihren Planungen<br />
unterbrochen wurde. Die<br />
Pflegekundin hingegen strahlte die<br />
Mitarbeiterin an und sagte laut und<br />
deutlich: „Danke, dass Sie noch nicht<br />
vergessen haben, dass es mich gibt!“<br />
Die alte Dame war dafür dankbar,<br />
dass jemand bereit war, ihr zuzuhören<br />
– denn die wichtigste Fähigkeit<br />
in der Gesprächsführung ist das<br />
Zuhören.<br />
Herzliche Grüße<br />
Brigitte Leicher ist Pflegedienstleiterin,<br />
Demenzberaterin und Fachautorin<br />
Kontakt: altenpflege@ppm-verlag.org<br />
Achtung, Erkältungszeit! Wie<br />
Sie Ihren Pflegkunden mit<br />
natürlichen Schleimlösern helfen<br />
Milch schleimt, daher sollten Ihre<br />
Pflegekunden sie bei Husten<br />
und Bronchialerkrankungen<br />
meiden.“ Haben Sie diese Information<br />
auch in Ihrer Ausbildung verinnerlicht<br />
und an später an Ihre eigenen Azubis weitergegeben?<br />
Oder sind Sie der Meinung,<br />
dass es sich hierbei um einen Irrglauben<br />
handelt? In diesem Artikel finden Sie die<br />
Antwort und eine Zusammenstellung<br />
wirksamer Methoden, um Ihre Pflegekunden<br />
von Lungensekret zu befreien.<br />
Durch besseres Zuhören<br />
schneller ans Ziel<br />
Für Sie ist der Pflegealltag Normalität,<br />
für Ihre Pflegekunden und Angehörigen<br />
hingegen ist dies der Ausnahmezustand,<br />
und sie müssen zuerst lernen,<br />
mit der veränderten Situation<br />
umzugehen. Wenn Ihre Sichtweise als<br />
Profi und das Pflegeverständnis von<br />
Laien sich stark unterscheiden, kann dies<br />
zu Konflikten führen. In diesen Situationen<br />
ist es besonders wichtig, dass Sie<br />
gut zuhören.<br />
Fallbeispiel: Die Angehörigen von Frau<br />
Kraus sind sehr aufgeregt, da sich der<br />
Zustand der alten Dame in den letzten<br />
Es gibt keine wissenschaftlichen<br />
Beweise<br />
Es gibt keine Studie, die belegt, dass Milch<br />
die Schleimproduktion anregt. Es gibt<br />
hierüber nur 2 kleinere australische Studien,<br />
die zeigen, dass sowohl Milch als<br />
auch Sojamilch bei manchen Personen zu<br />
Verschleimungen der Atemwege führen.<br />
Vermutlich liegt dies jedoch nicht daran,<br />
dass Milch die Speichelproduktion<br />
anregt.<br />
Fortsetzung auf Seite 2 ➔<br />
Tagen sehr verschlechtert hat. Sie sind so<br />
verunsichert, dass sie ständig kritische<br />
Fragen an die Pflegekräfte richten und<br />
jede Handlung hinterfragen. Die ständigen<br />
Gespräche brauchen Zeit und das<br />
Misstrauen der Angehörigen ärgert die<br />
Pflegekräfte. Dennoch erklären sie ihr<br />
Vorgehen ausführlich und stellen immer<br />
wieder ihre eigenen Erfahrungen mit<br />
ähnlichen Situationen dar, um zu vermitteln,<br />
dass Frau Kraus in guten Händen ist.<br />
Doch die zahlreichen Gespräche scheinen<br />
das Misstrauen der Angehörigen<br />
nicht zu besänftigen.<br />
Fortsetzung auf Seite 6 ➔<br />
Dieser Fachinformationsdienst wird herausgegeben vom PRO PflegeManagement Verlag<br />
Alle Checklisten und Muster dieser Ausgabe finden Sie als Download im Exklusivbereich für Leser unter: www.ppm-online.org/ap
PROFESSIONELL PFLEGEN<br />
<strong>Praxis</strong>:<br />
<strong>Altenpflege</strong><br />
➔ Fortsetzung von Seite 1<br />
Der Grund liegt darin, dass sich beim<br />
Trinken Milch und Speichel vermischen<br />
und sich je nach Fettgehalt der Milch eine<br />
dickflüssige Emulsion bildet.<br />
So entsteht Bronchialschleim<br />
Beim Einatmen gelangen immer wieder<br />
kleinste Fremdkörperpartikel in die Lunge.<br />
Um die Lunge hiervon zu befreien,<br />
reicht die Atmung allein nicht aus. Hierfür<br />
sind die auf der Bronchialschleimhaut<br />
liegenden Flimmerhärchen und die<br />
Becherzellen zuständig. Die Becherzellen<br />
produzieren Schleim und die Flimmerhärchen<br />
transportieren den Schleim ab,<br />
sodass er durch die Luftröhre nach außen<br />
gelangen kann. Dort verlagert er sich<br />
durch Schlucken im Rachen in die Speiseröhre.<br />
Husten beschleunigt den<br />
Abtransport des Schleims.<br />
Hilfe der natürlichen Art<br />
In der Luft befinden sich auch Krankheitserreger.<br />
Gelangen diese in die Lunge,<br />
produzieren die Becherzellen vermehrt<br />
Schleim, um diese gefährlichen Fremdkörper<br />
abzutransportieren.<br />
Durch die vermehrte Schleimproduktion<br />
wird jedoch die Atmung behindert. Um<br />
Ihrem Pflegekunden das Atmen zu<br />
erleichtern, sind Hausmittel eine sinnvolle<br />
Ergänzung zu den vom Arzt verordneten<br />
Medikamenten. Diese kennen die<br />
meisten Ihrer Pflegekunden zudem von<br />
früher, sodass sie sie daher auch gut<br />
akzeptieren und bei deren Anwendung<br />
mitwirken. Die unten stehende Übersicht<br />
gibt Ihnen weitere Anregungen hierzu.<br />
Mein Tipp für Sie: Natürliche<br />
Methoden bieten das Plus an<br />
Zuwendung<br />
Natürliche Methoden sind vor allem eine<br />
sinnvolle Ergänzung zur ärztlichen<br />
Behandlung. Als Zusatzbehandlung können<br />
Sie den Krankheitsverlauf positiv<br />
unterstützen und bieten Ihrem Pflegekunden<br />
ein Plus an Zuwendung. Hierdurch<br />
fühlt er sich wahrgenommen und<br />
unterstützt.<br />
Ihr Vorteil dabei: Die restliche Pflege verläuft<br />
angenehmer und reibungsloser als<br />
bei einem unzufriedenen Pflegekunden.<br />
Übersicht: Natürliche schleimlösende Methoden<br />
Methode<br />
heiße<br />
Getränke<br />
Flüssigkeitszufuhr<br />
Hausmittel<br />
Brustwickel<br />
Brustwickel lösen den Schleim durch gezielte Wärmezufuhr im Lungenbereich. Sie benötigen 2 Wickeltücher (1 dickes<br />
Frotteetuch als Feuchtigkeitsschutz für das Bett, 1 schmaleres Tuch für den Wickel).<br />
Anwendung: Befeuchten Sie den Wickel mit 40 °C bis maximal 45 °C heißem Wasser (gegebenenfalls mit Zusätzen<br />
wie Thymian oder Zitrone) und wringen Sie ihn aus.<br />
Bringen Sie Ihren Pflegekunden in eine sitzende Position. Breiten Sie das größere Tuch für die äußere Lage quer über<br />
dem Bett aus. Legen Sie den warmen, feuchten Wickel darüber, sodass sich beide Tücher in Brusthöhe Ihres Pflegekunden<br />
befinden, wenn Sie diesen anschließend hinlegen. Danach können Sie den Wickel und das Außentuch nach<br />
vorn über der Brust zusammenlegen. Decken Sie Ihren Pflegekunden zu und lassen Sie den Wickel bis zu 1/2 Stunde<br />
wirken.<br />
Hinweis: Sie dürfen Brustwickel ohne Rücksprache mit dem Arzt nicht anwenden bei: Fieber, schlechtem Allgemeinzustand,<br />
Herz-Kreislauf-Einschränkungen, Hyper- oder Hypotonie, arterieller Verschlusskrankheit und Polyneuropathien.<br />
Vibrationsmassage<br />
Anleitung<br />
zum Husten<br />
Atemübungen<br />
Informationen<br />
Sie wirken durch ihre Temperatur schleimlösend und mildern zudem den Hustenreiz.<br />
Besonders geeignet sind Kräuter-, Zitronen-, Thymian-, Salbei- und Ingwertee (besonders aus frischem Ingwer).<br />
Tipp: Geben Sie zirka 1 EL gehackten Ingwer in eine Tasse mit heißem Wasser und lassen Sie den Sud 5 Minuten ziehen.<br />
Gießen Sie die Flüssigkeit durch ein Teesieb und süßen Sie den Sud mit Honig.<br />
Ihr Pflegekunde sollte mehr Flüssigkeit zu sich nehmen als gewohnt, da sich hierdurch das Bronchialsekret verflüssigt<br />
und er es besser abhusten kann. Dies allein kann ebenso effektiv wirken wie ein chemischer Sekretlöser.<br />
Honig: hilft, den angesammelten Schleim zu verflüssigen. Dadurch kann er leichter entfernt und die Sauerstoffversorgung<br />
verbessert werden. Honig besitzt außerdem antivirale und antibakterielle Eigenschaften, welche den Atemtrakt<br />
vor weiteren Infektionen schützen. Geben Sie Ihrem Pflegekunden mehrmals täglich Honigwasser zu trinken<br />
(1 TL Honig auf 1 Glas mit warmem Wasser).<br />
Zwiebel: wirken mikrobakteriell und helfen daher, Infektionen zu vermeiden.<br />
Zwiebelsaft-Rezept: Schneiden Sie eine Zwiebel in Würfel und geben Sie sie mit 3 EL Zucker in ein Schraubglas. Lassen<br />
Sie das Gemisch etwa 10 Stunden ziehen. Nach der Ruhezeit hat sich ein Sirup gebildet, den Sie mit einem Teesieb<br />
abgießen können. Hiervon kann Ihr Pflegekunde 3-mal täglich jeweils 1 Esslöffel einnehmen. Lassen Sie den Sud<br />
niemals mehr als 24 Stunden abgedeckt im Kühlschrank stehen. Beim Einnehmen sollte er Zimmertemperatur haben.<br />
Die bei dieser Technik entstehenden Schwingungen sollen schleimlösend wirken. Bringen Sie Ihren Pflegekunden<br />
hierzu in die Sitzposition oder, falls dies nicht möglich ist, in die Seitenlage.<br />
Bearbeiten Sie den Lungenbereich nun mit schnellen, sanften Klopfbewegungen der hohlen Hand, der Kleinfingerkante<br />
oder der lockeren Faust. Sparen Sie hierbei unbedingt Nierengegend und Wirbelsäule aus.<br />
Hinweis: Diese Methode sollten Sie keinesfalls anwenden, wenn Ihr Pflegekunde degenerative Knochenerkrankungen<br />
hat. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollten Sie ebenfalls immer Rücksprache mit dem Arzt halten.<br />
Husten belastet den Gesamtorganismus stark und kann sogar zu Erbrechen führen. Leiten Sie Ihren Pflegekunden<br />
daher zum effektiven Abhusten an, indem er zunächst tief durch die Nase einatmet und dann kurz und kraftvoll<br />
abhustet.<br />
Atemübungen haben einen ähnlichen Effekt wie die Vibrationsmassage. Das Ausatmen auf „a“ sorgt für Vibrationen<br />
in der Brust. Das Ausatmen auf „e“ hilft, den Schleim in der Luftröhre und der Kehle zu lösen. Bitten Sie Ihren Pflegekunden,<br />
tief durch die Nase einzuatmen und anschließend 5 Sekunden auf „a“ oder „e“ auszuatmen. •<br />
2 www.ppm-online.org/ap Ausgabe 4/2016
PROFESSIONELL PFLEGEN<br />
<strong>Praxis</strong>:<br />
<strong>Altenpflege</strong><br />
Atemerleichternde Lagerungen: Wissen Sie noch,<br />
wie es geht?<br />
Herr Horch hatte einen fieberhaften<br />
Harnwegsinfekt und ist aufgrund<br />
seines schlechten Allgemeinzustandes<br />
in den Tagen danach noch sehr<br />
erschöpft. Daher befürchten die Pflegekräfte,<br />
dass er zusätzlich eine Pneumonie<br />
entwickeln wird. Eine Kollegin erinnert<br />
sich: „Es gibt doch spezielle Lagerungen,<br />
die die Lunge belüften.“ Da sich jedoch<br />
niemand an die genaue Durchführung<br />
erinnert, beschränken sich die Pflegekräfte<br />
darauf, den Oberkörper erhöht zu<br />
lagern. Würde es Ihnen ähnlich ergehen<br />
oder kennen Sie sich gut mit atemerleichternden<br />
Lagerungstechniken aus? Prüfen<br />
Sie Ihr Wissen mit dem folgenden Selbst-<br />
Test. Beantworten Sie zunächst die Fragen<br />
auf der linken Seite und lesen Sie<br />
anschließend die Antworten auf der rechten<br />
Seite nach. So können Sie leicht Ihr<br />
Wissen auf den Prüfstand stellen.<br />
Selbst-Test: Atemerleichternde Lagerungen: Prüfen Sie Ihr Wissen<br />
Fragen<br />
Was ist die<br />
VATI-Lagerung?<br />
Wie lange dürfen<br />
die Lagerungen<br />
durchgeführt werden?<br />
Sind die Lagerungen<br />
auch für den ambulanten<br />
Bereich geeignet?<br />
Welches Material<br />
benötigen Sie?<br />
Wie gehen Sie am<br />
besten bei der<br />
Lagerung vor?<br />
Wozu dient die<br />
V-Lagerung?<br />
Wie liegen die Kissen<br />
bei der V-Lagerung?<br />
Wozu dient die<br />
A-Lagerung?<br />
Wie ordnen Sie die<br />
Kissen bei der<br />
A-Lagerung an?<br />
Was bewirkt die<br />
T-Lagerung?<br />
Wie führen Sie die<br />
T-Lagerung durch?<br />
Bei wem wenden Sie<br />
die I-Lagerung an?<br />
Wie lagern Sie Ihren<br />
Pflegekunden?<br />
Wie führen Sie eine<br />
korrekte Oberkörperhochlagerung<br />
aus?<br />
Antwort<br />
Der Name basiert auf den 4 verschiedenen Kissenpositionen. Mit jeder dieser Positionen belüften Sie<br />
jeweils einen bestimmten Lungenbereich.<br />
Sie dürfen so lange durchgeführt werden, wie sie für Ihren Pflegekunden bequem sind. Einige empfinden<br />
die Dehnung des Brustkorbes und den ungewohnten Druck der Kissen als unangenehm. Daher akzeptieren<br />
wahrscheinlich die meisten Ihrer Pflegekunden eine Dauer von 20–30 Minuten je Lagerungsart.<br />
Da die Lagerungen in kürzeren Abständen gewechselt werden müssen, benötigen Sie die Hilfe der<br />
Angehörigen. Leiten Sie diese daher bei der Durchführung an. Dies kann etwa Bestandteil eines Beratungsgespräches<br />
sein.<br />
Sie benötigen 2 zu Schiffchen geformte Kissen, die formstabil bleiben, aber nicht zu fest sind. Hinzu<br />
kommt ein kleineres Kissen für den Kopf.<br />
Setzen Sie Ihren Pflegekunden zunächst auf, und platzieren Sie die Kissen, wie es für die jeweilige<br />
Lagerung erforderlich ist. Anschließend legen Sie Ihren Pflegekunden auf die vorbereiteten Kissen und<br />
korrigieren gegebenenfalls seine Position.<br />
Sie ermöglicht die Belüftung der unteren Lungenbereiche (Lungenspitzen und Flanken), da diese<br />
gedehnt werden.<br />
Der untere Winkel der V-förmig angeordneten Kissen liegt direkt unterhalb des Kreuzbeinbereichs. Die<br />
beiden Schenkel des V verlaufen zu den Schultern. Ein weiteres kleineres Kissen liegt zur Bequemlichkeit<br />
unter dem Kopf.<br />
Durch diese Technik sollen die oberen Lungenbereiche gedehnt werden. Hierdurch gelangt mehr Atemluft<br />
in diese Regionen.<br />
Der Winkel der A-förmig angeordneten Kissen liegt unter den Schulterblättern. Nur die 1. 4 Wirbel liegen<br />
auf. Die restliche Wirbelsäule liegt frei. Die Arme liegen locker auf den Kissen.<br />
Hierdurch werden alle Lungenbereiche belüftet.<br />
Ordnen Sie die Kissen T-förmig an. Der senkrechte Teil liegt an der Wirbelsäule, der waagerechte bildet<br />
eine Linie von der linken zur rechten Schulter. Damit der Kopf nicht nach hinten fällt, verlängern Sie das<br />
T mit einem zusätzlichen Kopfkissen nach oben.<br />
Sie eignet sich vor allem zur Belüftung aller Lungenbereiche bei schmalen Bewohnern.<br />
Legen Sie ein schiffchenförmiges Kissen direkt unter die Wirbelsäule und ein zusätzliches Kopfkissen<br />
unter den Kopf.<br />
Damit Ihr Pflegekunde durchatmen kann, ist es bei der Oberkörperhochlagerung unbedingt notwendig,<br />
dass die Hüfte Ihres Pflegekunden auf Höhe des Knicks des Bettes liegt. Auf diese Weise bleibt der<br />
Oberkörper gerade. Damit Ihr Pflegekunde nicht nach unten rutscht, ist es wichtig, die Füße mit einer<br />
festen Decke abzustützen. Legen Sie außerdem ein gerolltes Handtuch vor die Sitzbeinhöcker.<br />
Stellen Sie das Kopfteil des Bettes so weit hoch (etwa 30–45°), dass das Gewicht Ihres Pflegekunden<br />
auf den Sitzbeinhöckern liegt.<br />
Lagern Sie die Beine leicht gespreizt. Die Knie sollten hierbei nach außen geneigt und leicht gebeugt<br />
sein. Eine Rolle unter den Knien entspannt die Bauchmuskulatur und erleichtert die Atmung.<br />
Positionieren Sie die Arme seitlich des Körpers leicht erhöht und auf Kissen gelagert. Hierdurch unterstützen<br />
Sie die Schultern und die Atemhilfsmuskulatur.<br />
Auswertung: Konnten Sie alle Fragen beantworten? Herzlichen Glückwunsch, Sie kennen sich aus! Falls Sie einige Antworten<br />
nicht mehr wussten, haben Sie Ihr Wissen nun wieder aufgefrischt.<br />
•<br />
Ausgabe 4/2016 www.ppm-online.org/ap 3
PROFESSIONELL PFLEGEN<br />
<strong>Praxis</strong>:<br />
<strong>Altenpflege</strong><br />
Oft unterschätzt und doch so wichtig:<br />
die korrekte Insulininjektion<br />
Die meisten insulinpflichtigen Diabetiker<br />
spritzen sich die notwendige<br />
Insulindosis ohne fremde<br />
Hilfe. Teilen Sie daher auch die Meinung<br />
vieler Pflegekräfte, dass die Insulininjektion<br />
mit einem Pen keine großen Kenntnisse<br />
mehr erfordert? Lesen Sie diesen<br />
Artikel und Sie werden überrascht sein,<br />
welche Feinheiten die Wirkung des Insulins<br />
beeinflussen können.<br />
Auch für adipöse Pflegekunden<br />
reichen kurze Nadeln<br />
Insulin wird subkutan, d. h. ins Unterhautfettgewebe<br />
gespritzt. Unabhängig<br />
davon, welche Injektionsstelle Sie wählen,<br />
die Haut ist immer zirka 1,8–2,4 mm<br />
dick. Dies ist unabhängig von Gewicht,<br />
Alter und Geschlecht Ihres Pflegekunden.<br />
Die Dicke des Unterhautfettgewebes<br />
hängt hingegen von den genannten Faktoren<br />
ab.<br />
Für die Wahl der Injektionsnadel bedeutet<br />
dies: Eine kurze Penkanüle mit<br />
4–5 mm Länge reicht bei jedem Pflegekunden<br />
aus, um bis ins Unterhautfettgewebe<br />
zu gelangen. Die Geschwindigkeit<br />
der Insulinresorption wird nicht durch<br />
die Tiefe der Injektion im Unterhautfettgewebe<br />
beeinflusst.<br />
Ist die Nadel hingegen zu lang, besteht die<br />
Gefahr, dass Sie das Insulin in den Muskel<br />
injizieren. In diesem Fall wirkt es schneller<br />
und unkontrolliert, sodass es zu<br />
Unterzuckerung oder Blutzuckerschwankungen<br />
kommen kann.<br />
Der richtige Griff zur<br />
perfekten Hautfalte<br />
Um eine Injektion in den Muskel zu verhindern,<br />
sollten Sie bei Nadeln ab 5 mm<br />
bzw. bei wenig Unterhautfettgewebe vor<br />
der Injektion immer eine Hautfalte bilden.<br />
Heben Sie zur Bildung die Hautfalte<br />
locker mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger.<br />
Wenn Sie die Haut zu fest abheben,<br />
besteht die Gefahr, dass Sie den Muskel<br />
mit erfassen. Setzen Sie den Griff weit<br />
genug an. Bei einer zu dünnen Hautfalte<br />
kann nach Lösen des Griffs Insulin aus<br />
dem Injektionskanal austreten.<br />
Checkliste: Sichere Insulininjektion<br />
Sie überprüfen die Funktion des Pens vor jeder Anwendung.<br />
Sie gehen hierbei folgendermaßen vor: Sie stellen am Insulinpen 1–2 Einheiten<br />
Insulin ein und drücken den Injektionsknopf bei senkrecht nach oben gerichteter<br />
Pen-Nadel. Tritt Insulin an der Nadelspitze aus, können Sie fortfahren. Falls<br />
nicht, wiederholen Sie den Vorgang.<br />
Sie achten auf kleine Luftbläschen an der Wand der Insulinpatrone und entfernen<br />
diese vor der Injektion.<br />
Tipp: Halten Sie den Pen senkrecht und klopfen Sie hierzu leicht an die Wand des<br />
Patronenhalters. Stellen Sie den Pen auf 2 Einheiten ein und spritzen Sie die<br />
Luftblasen heraus.<br />
Die korrekte Insulindosis stellen Sie nicht aus dem Kopf ein, sondern nehmen<br />
die Dokumentation zu Hilfe.<br />
Sie desinfizieren die Injektionsstelle und lassen das Desinfektionsmittel auf der<br />
Haut abtrocknen.<br />
Sie bilden eine Hautfalte vor der Injektion.<br />
Sie stechen die Injektionsnadel senkrecht in die weiterhin gehaltene Hautfalte.<br />
Sie injizieren das Insulin durch langsames und gleichmäßiges Drücken des Injektionsknopfes<br />
am Pen.<br />
Die Pen-Nadel belassen Sie nach vollständigem Eindrücken des Injektionsknopfes<br />
noch 10 Sekunden in der Haut.<br />
Begründung: Das Insulin kann sich so ausreichend im Unterhautfettgewebe<br />
verteilen und tritt beim Herausziehen der Kanüle nicht wieder aus.<br />
Sie lassen die Hautfalte erst los, nachdem Sie die Nadel aus der Haut herausgezogen<br />
haben.<br />
Sie nutzen sichere Insulinkanülen, die sich sofort nach dem Spritzen zurückziehen.<br />
Falls Sie den vorherigen Punkt nicht erfüllen: Sie nutzen jede Kanüle nur 1-mal.<br />
Auswertung: Prüfen Sie, ob Sie alle Kriterien erfüllen. Falls es einzelne Punkte gibt,<br />
die sie nicht erfüllen, verändern Sie Ihr Vorgehen entsprechend.<br />
Tipp: Denken Sie daran, dass Sie den<br />
Griff erst lösen, nachdem Sie die Injektionsnadel<br />
aus der Punktionsstelle herausgezogen<br />
haben. Ein zu frühes Lösen des<br />
Griffs kann zu einer intramuskulären<br />
Injektion führen.<br />
Gehen Sie bei der<br />
Insulininjektion korrekt vor?<br />
Die oben aufgeführte Checkliste gibt<br />
Ihnen einen Überblick über die einzelnen<br />
notwendigen Schritte bei der Injektion.<br />
Prüfen Sie, ob Sie alle Kriterien erfüllen.<br />
Denken Sie daran: Sie<br />
dürfen Pen-Nadeln nur 1-mal<br />
benutzen!<br />
Bei der Injektion wird die Nadelspitze<br />
beschädigt. Dies ist für das bloße Auge<br />
nicht erkennbar, dennoch kann die Kanüle<br />
Ihrem Pflegekunden bei der Wiederverwendung<br />
Schmerzen oder Hautverletzungen<br />
zufügen. Im schlimmsten Fall<br />
bricht die Kanüle ab. Außerdem können<br />
sich Insulinkristalle an der Kanüle bilden,<br />
die bei der nächsten Injektion zu einer<br />
Wirkungsveränderung des Insulins führen.<br />
Hinweis: Im ambulanten Bereich verlangen<br />
manche Pflegekunden, dass Sie die<br />
Pen-Nadel aus Sparsamkeitsgründen<br />
mehrmals verwenden. Lehnen Sie dies ab,<br />
da Sie als Fachkraft für die fachlich korrekte<br />
Handhabung verantwortlich sind.<br />
Der Injektionsbereich<br />
beeinflusst die Resorption<br />
Wussten Sie, dass Sie die Applikationsstelle<br />
dem Insulin anpassen sollten? Die<br />
Resorption von Insulin ist nicht nur von<br />
der Insulinart abhängig, sondern auch<br />
von dem Körperbereich, in den Sie injizieren.<br />
Die folgende Übersicht zeigt<br />
Ihnen die einzelnen Resorptionsgeschwindigkeiten<br />
und Besonderheiten.<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
4 www.ppm-online.org/ap Ausgabe 4/2016
PFLEGEKUNDEN, BEWOHNER & ANGEHÖRIGE<br />
<strong>Praxis</strong>:<br />
<strong>Altenpflege</strong><br />
Übersicht: Das sind die Besonderheiten der verschiedenen Injektionsstellen<br />
Injektionsstelle<br />
Bauch<br />
Am Bauch wird Insulin schnell resorbiert. Injizieren Sie<br />
hier<br />
• zkurz wirkendes Normalinsulin/schnell wirkende Insulinanaloga,<br />
• zMischinsuline mit hohem Anteil Normalinsulin vor<br />
den Mahlzeiten, wenn die Wirkung schnell eintreten<br />
soll (z. B. bei hohem Nüchtern-Blutzucker).<br />
Oberschenkel<br />
Gesäß<br />
Oberarm<br />
Darauf sollten Sie achten<br />
Injizieren Sie nicht zu weit an der Außenseite des<br />
Bauches, um den Muskel nicht zu treffen. Vermeiden Sie<br />
außerdem Injektionen zu nahe am Nabel. Halten Sie<br />
mindestens 3 cm Abstand.<br />
Verabreichen Sie die Injektion in mittlerer Höhe auf der<br />
vorderen Außenseite des Oberschenkels. Auf der Innenseite<br />
des Oberschenkels befinden sich zahlreiche Blutgefäße<br />
und Nerven. Diese können durch die Injektionsnadel<br />
leicht verletzt werden.<br />
Da sich an der Außenseite des Oberschenkels nur wenig<br />
Unterhautfettgewebe befindet, ist es hier besonders<br />
wichtig, dass Sie eine Hautfalte bilden und kurze<br />
Penkanülen verwenden.<br />
Am Gesäß ist auch bei sehr schlanken Personen meist<br />
ausreichend Unterhautfettgewebe vorhanden, sodass<br />
dies eine gute Alternative zum Oberschenkel darstellt,<br />
sofern Ihr Pflegekunde dies toleriert.<br />
Resorptionsgeschwindigkeit<br />
Die Insulinresorption erfolgt am Oberschenkel langsam<br />
und ist daher besonders geeignet für<br />
• zVerzögerungsinsulin,<br />
• zMischinsuline mit hohem Anteil Verzögerungsinsulin,<br />
wenn die Wirkung des Verzögerungsinsulins langsam<br />
eintreten soll, z. B. über Nacht.<br />
Die Insulinresorption verläuft am Gesäß langsam und<br />
diese Stelle ist daher ebenso wie der Oberschenkel<br />
besonders geeignet für Verzögerungsinsulin und<br />
Mischinsuline (mit hohem Anteil Verzögerungsinsulin).<br />
Injektionen in den Oberarm (mittelschnelle Resorption) werden in Deutschland wegen des Risikos der Injektion in<br />
den Muskel (intramuskuläre Injektion) nicht empfohlen. Eine sichere Arminjektion in eine Hautfalte ist nicht möglich.<br />
Grafik: So wirkt sich die<br />
Applikationsstelle auf die<br />
Insulinresorption aus<br />
schnell<br />
langsam<br />
langsam<br />
Es gibt kurz, mittellang und lang wirkendes<br />
Insulin. Injizieren Sie schnell<br />
wirksame Insuline in dem Bauch und<br />
langsam wirkende Insuline in den Oberschenkel<br />
oder ins Gesäß. Die unten stehende<br />
Übersicht gibt Ihnen einen Überblick<br />
über die einzelnen Insulinarten und<br />
deren Wirkungsdauer.<br />
Wechseln Sie die<br />
Injektionsstellen<br />
Eine Insulininjektion ist zwar nur ein<br />
kleiner Stich, dennoch verletzen Sie hierdurch<br />
die Haut. Entsprechend können<br />
Verhärtungen des Gewebes entstehen, die<br />
schmerzhaft sein können und die Insulinresorption<br />
beeinträchtigen. Dies können<br />
Sie durch einen ständigen Wechsel<br />
der Injektionsstellen verhindern, d. h. je<br />
nach Insulinwirkung spritzen Sie zwar<br />
immer in die gleiche Körperregion,<br />
wechseln aber die Punktionsstelle bei<br />
jeder Injektion, indem Sie mindestens<br />
3 cm neben der vorherigen Injektionsstelle<br />
einstechen.<br />
Tipp: Legen Sie die Wechsel in der Pflegeplanung<br />
fest. Verwenden Sie bei Bedarf<br />
Rotationsschablonen als Hilfe.<br />
Mein Tipp für Sie: Mit der<br />
richtigen Technik wirkt Insulin<br />
besser<br />
Besonders bei Pflegekunden mit starken<br />
Blutzuckerschwankungen und extrem<br />
niedrigen bzw. hohen Werten sollten Sie<br />
und Ihre Kollegen die eigene Injektionstechnik<br />
hinterfragen. Besprechen Sie im<br />
Team, ob alle Kollegen identisch bei der<br />
Injektion vorgehen. Tauschen Sie sich<br />
dabei ebenso über Ihre genaue Ablaufplanung<br />
aus.<br />
Übersicht: Insulinarten und deren Wirkungsdauer<br />
Produktnamen<br />
kurzwirksame Insuline<br />
Berlinsulin H Normal®,<br />
Humaject Normal®,<br />
Huminsulin Normal® 40,<br />
Insulin Actrapid HM®,<br />
Insuman RAPID®<br />
kurzwirkende<br />
Insulinabkömmlinge<br />
(Insulinanaloga)<br />
Liprolog®<br />
Humalog®<br />
Apidra®<br />
Verzögerungsinsuline<br />
Berlinsulin H Basal®,<br />
Humaject Basal®,<br />
Huminsulin Basal®,<br />
Insulin Protaphan HM®,<br />
Insuman BASAL®<br />
Kombinationsinsuline<br />
wirkt nach 10–15 Minuten wirkt sofort 90–120 Minuten 30 Minuten<br />
stärkste Wirkung nach 1–1 1/2 Stunden nach 1/2 –1 1/2 Stunden nach 4–6 Stunden 4–6 Stunden<br />
Insulin Actraphane HM®<br />
(Mischungen: 10/90, 30/70,<br />
40/60 oder 20/80),<br />
Insuman Comb 1®5, 25 oder<br />
50, Berlinsulin H 30/70®,<br />
Huminsulin Profil III®<br />
Wirkdauer 4–6 Stunden 2–3 Stunden 8–12 Stunden 8–12 Stunden •<br />
Ausgabe 4/2016 www.ppm-online.org/ap 5
PFLEGEKUNDEN, BEWOHNER & ANGEHÖRIGE<br />
<strong>Praxis</strong>:<br />
<strong>Altenpflege</strong><br />
Durch besseres Zuhören schneller ans Ziel<br />
➔ Fortsetzung von Seite 1<br />
Echtes Interesse wirkt als<br />
Eisbrecher<br />
Das Beispiel zeigt die Fallen beim Zuhören<br />
sehr deutlich: Die Gespräche verlaufen<br />
immer ähnlich. Der Ehemann sagt<br />
etwa: „Meine Frau liegt ja nur noch im<br />
Bett. Nicht, dass sie wie meine eigene<br />
Mutter noch eine Lungenentzündung<br />
bekommt.“ Die Pflegekraft hat es eilig. Sie<br />
meint zu wissen, dass der Angehörige sie<br />
verdächtigt, die Pflegekundin aus<br />
Bequemlichkeit seltener aus dem Bett zu<br />
holen. Daher erläutert sie, warum die<br />
Pflegekundin nicht mobilisiert wurde<br />
und welche Maßnahme sie zur Pneumonieprophylaxe<br />
ergreift.<br />
Zufällig kommt eine andere Pflegekraft<br />
hinzu. Diese fragt interessiert: „Wann ist<br />
Ihre Mutter denn gestorben?“ Daraufhin<br />
erzählt der Ehemann, wie er die Pflegebedürftigkeit<br />
seiner eigenen Mutter erlebt<br />
hat und dass er Ähnliches bei seiner Frau<br />
befürchtet. Die Mitarbeiterin lächelt ihn<br />
an und sagt unverbindlich: „Gemeinsam<br />
passen wir gut auf Ihre Frau auf.“ Der<br />
Ehemann nickt lächelnd und verbringt<br />
den Nachmittag ruhig und ohne weitere<br />
Zwischenfälle bei seiner Frau. Ihn haben<br />
das echte Interesse und der kurze<br />
Abschlusssatz der Mitarbeiterin mehr<br />
beruhigt als die fachliche Erläuterung.<br />
Grafik: Wovon Zuhören abhängt<br />
JDer Sprecher<br />
wandelt seine<br />
Information in<br />
Sprache und nonverbale<br />
Signale<br />
um.<br />
abhängig von seiner<br />
Ausdrucksfähigkeit,<br />
seinen<br />
aktuell vorherrschenden<br />
Gefühlen<br />
etc.<br />
Die oben stehende Grafik erläutert, von<br />
welchen Faktoren es abhängt, wie der<br />
Zuhörer eine Botschaft auffasst. Denn die<br />
Übermittlung der Nachricht ist sehr störanfällig<br />
im Hinblick auf äußere Faktoren<br />
und stark von den Gefühlen und Interessen<br />
der Beteiligten abhängig.<br />
Die Übermittlung<br />
wird beeinflusst/<br />
ist störanfällig …<br />
z. B. durch äußere<br />
Umstände (etwa<br />
Zeitdruck, Aufgabenvielfalt,<br />
Umgebungslautstärke,<br />
aber auch<br />
durch die Beziehung<br />
beider Gesprächspartner).<br />
JDer Zuhörer<br />
nimmt die Botschaft<br />
auf und<br />
interpretiert sie<br />
gleichzeitig.<br />
abhängig von dem<br />
Interesse und der<br />
Fähigkeit zuzuhören,<br />
seiner persönlichen<br />
Einstellung<br />
und aktuellen<br />
Gefühlen.<br />
schauen Sie zwischenzeitlich für 1–2<br />
Sekunden auf einen anderen Punkt.<br />
• zSignalisieren Sie durch Ihre zugewandte<br />
Körperhaltung Interesse.<br />
• zStellen Sie Fragen. Vor allem offene<br />
Fragen, die den Menschen dazu animieren,<br />
etwas zu erzählen.<br />
Warum eine Botschaft anders<br />
beim Gegenüber ankommt, als<br />
sie gemeint ist<br />
Die Wahrnehmung des Gesagten hängt<br />
immer von der jeweiligen Situation und<br />
der Persönlichkeit der Gesprächspartner<br />
ab. In dem beispielhaften Gespräch hat<br />
die 1. Pflegekraft nicht wahrgenommen,<br />
worum es dem Angehörigen eigentlich<br />
ging:<br />
1. Der Ehemann wirkte auf die Mitarbeiterin<br />
vorwurfsvoll. Dieser hingegen<br />
konnte seine Besorgnis jedoch nur auf<br />
die ihm eigene Weise in Worte fassen.<br />
2. Da die Mitarbeiterin unter Zeitdruck<br />
stand, wollte sie das Gespräch abkürzen<br />
und ging sofort zur Erklärung über.<br />
3. Durch ihre Vorerfahrungen mit diesem<br />
und vielen anderen Angehörigen fasste<br />
die 1. Pflegekraft die Bemerkung direkt<br />
als Kritik auf.<br />
3 Tipps für gutes Zuhören<br />
Als guter Zuhörer wirken Sie vertrauenswürdig.<br />
Diese Fähigkeit können Sie sich<br />
antrainieren. Die folgenden Tipps zeigen<br />
Ihnen, wie es Ihnen gelingt.<br />
1. Tipp: Hören Sie geduldig zu. Auch<br />
wenn Sie schon zu wissen glauben, was<br />
Ihr Gegenüber sagen will: Lassen Sie ihn<br />
ausreden, denn sonst besteht die Gefahr,<br />
dass Sie Wichtiges überhören. Ihnen entgehen<br />
möglicherweise stichhaltige Argumente<br />
oder notwendige Informationen.<br />
2. Tipp: Signalisieren Sie, dass Sie Ihrem<br />
Gegenüber aufmerksam zuhören.<br />
• zNicken Sie zwischendurch beim Zuhören<br />
und werfen Sie ab und zu ein interessiertes<br />
„hm“ oder „aha“ ein.<br />
• zNehmen Sie Blickkontakt auf. Halten<br />
Sie diesen jedoch nicht starr, sondern<br />
3. Tipp: Halten Sie sich zurück. Sie müssen<br />
nicht immer auf Anhieb eine kluge<br />
und fachlich kompetente Äußerung parat<br />
haben. Viel wichtiger ist, dass sich Ihr<br />
Gegenüber verstanden fühlt.<br />
Hören Sie Ihrem Gesprächspartner<br />
immer so zu, als müssten Sie das Gesagte<br />
im Anschluss möglichst genau wiedergeben.<br />
Diese Übung hilft Ihnen, sich in den<br />
anderen hineinzuversetzen.<br />
Fazit: Zuhören bringt Sie<br />
schneller zum Ziel<br />
Die meisten Menschen freuen sich über<br />
ein ernst gemeintes Interesse an ihrer Person.<br />
Stellen Sie daher offene Fragen, um<br />
in Gesprächen herauszufinden, worum es<br />
Ihrem Pflegekunden oder seinem Angehörigen<br />
wirklich geht. Dann finden Sie<br />
auch schnell eine passende Lösung. •<br />
6 www.ppm-online.org/ap Ausgabe 4/2016
5 MINUTEN FÜR IHR WOHLBEFINDEN<br />
<strong>Praxis</strong>:<br />
<strong>Altenpflege</strong><br />
Mit diesen 5 Tipps trotzen Sie der Erkältungswelle<br />
Geht es Ihnen auch so? Nach den<br />
Weihnachtstagen zieht sich der<br />
Winter in die Länge. Bis zum<br />
Frühling müssen wir alle noch einige<br />
kalte Tage überstehen.<br />
Lesen Sie hier, wie Sie sich zum Winterendspurt<br />
noch wirkungsvoll gegen Kälte<br />
schützen können. So bleiben Sie gesund,<br />
bis der Frühling endlich beginnt.<br />
Fazit: Achten Sie auf sich!<br />
Besonders in der ambulanten Pflege müssen<br />
Sie innerhalb kurzer Zeit stark<br />
schwankende Temperaturen bewältigen.<br />
Die Arbeit in oft überheizten Wohnungen<br />
bringt Sie bestimmt auch manchmal zum<br />
Schwitzen. Und damit nicht genug: Kurz<br />
darauf müssen Sie in die Kälte und auch<br />
das Auto heizt sich so schnell nicht auf.<br />
Beachten Sie daher die Tipps aus diesem<br />
Artikel, um möglichst gesund in den<br />
Frühling zu starten.<br />
Übersicht: Mit den richtigen Maßnahmen frieren Sie weniger<br />
Warum Sie mit<br />
Schal weniger<br />
frieren.<br />
Auch die Mütze<br />
darf nicht<br />
fehlen.<br />
Darum sorgt guter<br />
Schlaf für Wärme.<br />
Die Zwiebeltechnik<br />
hält die Wärme am<br />
Körper.<br />
Wasser hilft gegen<br />
Hitze und Kälte.<br />
Tipps und Anregungen<br />
Am Hals befinden sich mehrere kälteempfindliche Punkte, die besonders auf Kälte, Nässe und Zugluft reagieren.<br />
Diese geben das Kältegefühl an den ganzen Körper weiter. Schützen Sie diese Punkte, indem Sie einen<br />
Schal tragen.<br />
Haben Sie als Kind auch noch gelernt, dass der Körper über den Kopf besonders viel Wärme verliert? Dies<br />
stimmt nicht, der Kopf ist nur besonders kälteempfindlich, da sich hier so viele Nervenzellen befinden (besonders<br />
an der Kopfhaut und im Gesicht).<br />
Schlafmangel beeinträchtigt die körpereigene Wärmeregulation. Dies führt dazu, dass wir schneller und<br />
stärker frieren. 7 Stunden Schlaf sind daher für die meisten Menschen ein Muss.<br />
Tipp: Warme Füße fördern das Einschlafen.<br />
Über die Haut verliert der Körper ständig Wärme. Um die Körperwärme bei Kälte zu erhalten, hilft geschicktes<br />
Anziehen:<br />
1. Die Basisschicht besteht aus einer dünnen und eng anliegenden Unterwäsche.<br />
2. Die Wärmeschicht besteht aus wärmenden Kleidungsstücken wie etwa einem Woll- oder Fleecepullover.<br />
3. Die Außenschicht besteht aus einem wind- und wasserabweisenden Kleidungsstück.<br />
Die Niere hält den Wassergehalt im Körper konstant. Wasser speichert Wärme und gibt sie langsam frei. So<br />
bleibt die Körpertemperatur stabil. Im Umkehrschluss wird der Körper bei Flüssigkeitsmangel kälteempfindlicher.<br />
•<br />
Leserfrage: Helfen opioide Schmerzmittel gegen<br />
Atemnot?<br />
Anna K. aus Düren fragt: Eine Pflegekundin<br />
hat eine weit fortgeschrittene<br />
COPD. Nun hat der Facharzt ihre Medikamente<br />
komplett umgestellt. Unter<br />
anderem bekommt sie Fentanyl als<br />
Nasenspray, das sie bei Atemnot einnehmen<br />
soll. Dies ist doch ein opioides<br />
Schmerzmittel. Kann diese Anordnung<br />
so bestehen bleiben oder müssen wir den<br />
Arzt darauf hinweisen, dass möglicherweise<br />
ein Irrtum vorliegt?<br />
Antwort der Redaktion: Die ärztliche<br />
Anordnung ist vollkommen gerechtfertigt,<br />
wenn Ihre Pflegekundin häufiger<br />
unter starker Atemnot leidet. In den letzten<br />
Jahren ist die nasale Anwendung von<br />
Fentanyl bei Atemnot stark in den Vordergrund<br />
getreten. Opioide erhöhen die<br />
Toleranz des Atemzentrums, d. h., Ihre<br />
Pflegekundin reagiert nicht mehr so<br />
schnell auf einen Sauerstoffmangel im<br />
Gehirn. Entsprechend wirkt das Fentayl<br />
angstlösend und verhindert, dass sie<br />
hyperventiliert. Hierdurch atmet sie<br />
wirksamer und gleichmäßiger. Solange<br />
das Medikament nicht überdosiert ist,<br />
wirkt es sich daher auch nicht negativ auf<br />
die Atmung aus.<br />
Ursprünglich ist die Beeinflussung des<br />
Atemzentrums eine Nebenwirkung von<br />
Fentanyl, die in diesem Fall bewusst<br />
genutzt wird. Hierüber muss der Arzt seinen<br />
Patienten aufklären. <br />
•<br />
Impressum:<br />
<strong>Praxis</strong>: <strong>Altenpflege</strong><br />
Kurze Anleitungen und praktische Tipps für Ihren<br />
Pflegealltag<br />
ISSN: 1869-4306<br />
PRO PflegeManagement Verlag<br />
Theodor-Heuss-Str. 2–4 · 53177 Bonn<br />
Tel.: 02 28 / 9 55 01 30 · Fax: 02 28 / 3 69 60 90<br />
E-Mail: kundendienst@ppm-verlag.org<br />
Internet: www.ppm-verlag.org<br />
Chefredaktion: Claudia Heim, Petersthal;<br />
Brigitte Leicher, Köln<br />
Herausgeberin: Kathrin Righi, Bonn<br />
Produktmanagerin: Alena Althaus, Bonn<br />
Beratende Fachkräfte: Stefanie Gadow, Jork;<br />
Anne Muhle, Münster<br />
Satz: Holger Hellendahl, Neuss<br />
Druck: ADN Offsetdruck, Battenberg (Eder)<br />
© 2016 by PRO PflegeManagement Verlag, einem<br />
Unternehmensbereich der VNR Verlag für die<br />
Deutsche Wirtschaft AG, Amtsgericht Bonn, HRB<br />
8165, Vorstand: Helmut Graf, Guido Ems.<br />
„<strong>Praxis</strong>: <strong>Altenpflege</strong>“ ist unabhängig. Alle Informationen<br />
wurden mit Sorgfalt ermittelt und überprüft.<br />
Es kann jedoch keine Gewähr übernommen<br />
werden, eine Haftung ist ausgeschlossen. Vervielfältigungen<br />
jeder Art sind nur mit ausdrücklicher<br />
Genehmigung des Verlages gestattet. Alle Rechte<br />
vorbehalten.<br />
Ausgabe 4/2016 www.ppm-online.org/ap 7
AUS DEM PFLEGEALLTAG<br />
<strong>Praxis</strong>:<br />
<strong>Altenpflege</strong><br />
Zu häufig krank? Wann der Arbeitgeber Ihnen<br />
kündigen darf<br />
Krankmeldungen in der Pflege gehen<br />
immer zu Lasten der Kollegen und<br />
der Pflegekunden. Dies ist besonders<br />
ärgerlich, wenn sich ein Kollege<br />
immer wieder scheinbar ungerechtfertigt<br />
krankmeldet. Viele Mitarbeiter verstehen<br />
nicht, warum ein solches Verhalten keine<br />
Kündigung nach sich zieht. Hingegen<br />
machen sich andere schwer erkrankte<br />
Mitarbeiter möglicherweise unnötige<br />
Sorgen um ihren Arbeitsplatz, weil sie<br />
nicht wissen, wie weit der Kündigungsschutz<br />
geht. Lesen Sie hier, warum eine<br />
krankheitsbedingte Kündigung nur in<br />
Ausnahmefällen wirksam ist.<br />
Das Kündigungsschutzgesetz<br />
verhindert ungerechtfertigte<br />
Kündigungen<br />
Sie als Arbeitnehmer werden durch das<br />
Gesetz vor vorschnellen und ungerechtfertigten<br />
Kündigungen geschützt. Hiernach<br />
gelten nur 3 zulässige Gründe:<br />
1. verhaltensbedingte Kündigungen (etwa<br />
bei mangelhafter Arbeitsleistung),<br />
2. betriebsbedingte Kündigungen, (z. B.<br />
bei Verkleinerung der Einrichtung,<br />
Verkleinerung des Einzugsgebietes im<br />
ambulanten Bereich),<br />
3. personenbedingte Gründe, d. h., seine<br />
persönlichen Fähigkeiten machen es<br />
dem Mitarbeiter unmöglich, seine<br />
Arbeit weiterhin auszuüben. Die krankheitsbedingte<br />
Kündigung ist die häufigste<br />
personenbedingte Kündigung.<br />
Diese 3 Voraussetzungen<br />
bilden die Grundlage für die<br />
Kündigung<br />
Eine krankheitsbedingte Kündigung<br />
bedeutet, dass dem Mitarbeiter wegen<br />
Krankheit gekündigt werden kann. Hierbei<br />
müssen 3 Voraussetzungen erfüllt<br />
sein:<br />
1. Es muss eine negative<br />
Prognose bestehen<br />
Dies bedeutet, die betroffene Person kann<br />
die im Vertrag vereinbarte Arbeitsleistung<br />
nicht mehr erbringen oder die Wiederherstellung<br />
der Arbeitskraft ist völlig<br />
ungewiss, d. h., es ist so gut wie sicher,<br />
dass der Mitarbeiter innerhalb der nächsten<br />
24 Monate nicht arbeiten kann.<br />
Wichtig: Falls Sie oder ein Kollege nach<br />
einer Langzeiterkrankung eine Wiedereingliederungsmaßnahme<br />
(Hamburger<br />
Modell) beginnen, besteht immer die<br />
Aussicht auf die Wiederaufahme der<br />
Arbeit, sodass eine Kündigung nicht<br />
rechtens wäre.<br />
Bei häufigen Kurzerkrankungen ist ein<br />
Richtwert für eine negative Krankheitsprognose,<br />
dass die betroffene Person in<br />
den letzten 3 Kalenderjahren jeweils<br />
mehr als 6 Wochen krank war.<br />
2. Der betriebliche Ablauf muss<br />
erheblich gestört sein<br />
Die entstandenen und voraussichtlichen<br />
Fehlzeiten müssen zu einer erheblichen<br />
Beeinträchtigung der betrieblichen oder<br />
wirtschaftlichen Belange des Arbeitgebers<br />
führen. Für Mitarbeiter mit einer<br />
Langzeiterkrankung trifft dies meist<br />
nicht zu, da diese nach 6 Wochen aus der<br />
Lohnfortzahlung herausfallen. Somit<br />
kann ein anderer Mitarbeiter als Krankheitsvertretung<br />
eingestellt werden.<br />
Hingegen entsteht dem Arbeitgeber bei<br />
häufigen Kurzerkrankungen, die immer<br />
unter 6 Wochen dauern, ein erheblicher<br />
finanzieller Schaden, da der Lohn jedes<br />
Mal weitergezahlt werden muss.<br />
Hinweis: In diesem Fall fragt der Arbeitgeber<br />
bei der Krankenkasse nach, ob es<br />
sich bei den verschiedenen Kurzerkrankungen<br />
in Wirklichkeit um dieselbe<br />
Krankheit handelt, die immer wieder auftritt.<br />
Ebenso ist denkbar, dass verschiedene<br />
unterschiedliche Erkrankungen auf<br />
dieselbe Grunderkrankung zurückzuführen<br />
sind. In beiden Fällen werden die<br />
Krankheitstage zusammengerechnet und<br />
der Mitarbeiter nach 6 Wochen ursächlich<br />
zusammenhängender Krankheit als<br />
langzeitkrank eingestuft.<br />
Der Arbeitgeber bekommt nur die Auskunft,<br />
das ein Zusammenhang besteht.<br />
Die Diagnose teilt die Krankenkasse<br />
nicht mit.<br />
3. Die Kündigung muss<br />
verhältnismäßig sein<br />
Wenn die beiden vorangegangenen<br />
Voraussetzungen zutreffen, werden die<br />
Interessen des Mitarbeiters gegen die des<br />
Arbeitgebers abgewogen. Hierbei muss<br />
der Arbeitgeber nachweisen, dass die<br />
Weiterbeschäftigung zu einer nicht mehr<br />
tragbaren Belastung führt. Eine Rolle<br />
spielen unter anderem auch Beschäftigungsdauer,<br />
soziale Situation und Alter<br />
des Mitarbeiters.<br />
Verhältnismäßigkeit bedeutet in diesem<br />
Zusammenhang ebenso, dass ein betriebliches<br />
Eingliederungsmanagement vorangegangen<br />
ist, in dem Arbeitgeber und Mitarbeiter<br />
klären, ob und wie die Arbeitsfähigkeit<br />
wieder hergestellt und eine erneute<br />
Arbeitsunfähigkeit verhindert werden<br />
kann.<br />
Fazit: Widerspruch lohnt sich<br />
Der Arbeitgeber kann eine krankheitsbedingte<br />
Kündigung nur äußerst selten<br />
durchsetzen. Ein Widerspruch vor dem<br />
Arbeitsgericht hat daher gute Erfolgschancen.<br />
Wichtig ist nur, dass er vor<br />
Ablauf einer Frist von 3 Wochen ab Erhalt<br />
der Kündigung beim Arbeitsgericht eingereicht<br />
wurde. <br />
•<br />
Leser-Service:<br />
Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge<br />
an die Redaktion von „<strong>Praxis</strong>: <strong>Altenpflege</strong>“ richten möchten,<br />
senden Sie diese bitte per E-Mail an:<br />
altenpflege@ppm-verlag.org<br />
Unseren Kundendienst erreichen Sie unter: 02 28 / 95 50 130<br />
oder per Mail an: kundendienst@ppm-verlag.org<br />
In den nächsten Ausgaben:<br />
l Schritt für Schritt zum richtigen Pütter-Verband<br />
l Sind die Medikamente Ihrer muslimischen Pflegekunden<br />
„halal“?<br />
l Was Sie über die Pflegekammer wissen sollten<br />
8 www.ppm-online.org/ap Ausgabe 4/2016