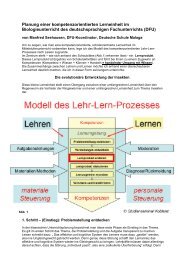Grundwerte im Wilhelminischen Zeitalter - Praktikum macht Schule
Grundwerte im Wilhelminischen Zeitalter - Praktikum macht Schule
Grundwerte im Wilhelminischen Zeitalter - Praktikum macht Schule
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diskussionen oft nicht aufeinander. Damit ergibt sich ein weiterer Bereich, der zu üben<br />
ist: Im Unterrichtsgespräch gilt es, die verschiedenen Beiträge miteinander zu verknüpfen<br />
und die Verantwortung für den Gesprächsverlauf zusehends abzugeben. Positiv<br />
entwickelt ist hingegen das soziale Kl<strong>im</strong>a der 10a. So sind selten Spannungen oder Misstöne<br />
aufgetreten. Vielmehr sind die Schülerinnen und Schüler bemüht, rücksichtsvoll<br />
miteinander umzugehen. Dies zeigt sich z.B. bei der Zusammensetzung der Gruppen<br />
und nach Stundenausfällen bei der Suche nach Ausgleichsmöglichkeiten für die verlorene<br />
Arbeitszeit.<br />
2. Einordnung der Stunde<br />
Seit Beginn des neuen Halbjahres wurden zwei Unterrichtseinheiten über Die nationale<br />
deutsche Bewegung zwischen 1815 und 1848 sowie über Die Reichsgründung von 1849 bis<br />
1871 abgeschlossen. Hier wurden die eigenwilligen Dynamiken einer politischen Entwicklung<br />
von unten und oben nachvollzogen. Im Kontrast zu dieser Entwicklung (<strong>im</strong><br />
Sinne einer Ereignisgeschichte) geht es in der jetzigen Unterrichtseinheit um die gesellschaftliche<br />
Entwicklung des Kaiserreiches (<strong>im</strong> Sinne einer Mentalitätsgeschichte). Zum<br />
einen wird mit diesem Schwerpunkt den Ansprüchen des Stoffverteilungsplanes für das<br />
Fach „Deutschsprachiger Geschichtsunterricht an den Deutschen <strong>Schule</strong>n auf der Iberischen<br />
Halbinsel“ entsprochen 1 . Zum anderen wird mit dem Thema ein Blick in den vielschichtigen<br />
Nährboden für die weitere deutsche Geschichte, den Ausbruch des Ersten<br />
Weltkrieges, die Schwierigkeiten der We<strong>im</strong>arer Republik, die Machtergreifung A. Hitlers<br />
und den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges eröffnet. Im Zentrum der Einheit stehen<br />
dabei nicht politische Zäsuren, sondern vielmehr der Habitus einer ganzen Generation.<br />
Deutlich wird hier die inhaltliche Akzentuierung dieser Unterrichtseinheit: Sie ist zuerst<br />
systemisch ausgerichtet (mit Blick auf die Geisteshaltungen <strong>im</strong> <strong>Wilhelminischen</strong> <strong>Zeitalter</strong>)<br />
und folgt nur bedingt einem chronologischen Muster (mit dem Umbruch <strong>im</strong> Dreikaiserjahr<br />
1888). Damit wird ein zweiter Schwerpunkt berührt, das Verhältnis von Kontinuitäten<br />
und Brüchen. Tatsächlich <strong>im</strong>pliziert das Thema die Akzentuierung und Verbreitung<br />
eines neuen gemeinsamen Wertekanons <strong>im</strong> Deutschen Reich und damit die Grundlage<br />
für die St<strong>im</strong>mungslage vor dem Ersten Weltkrieg. Methodisch stehen <strong>im</strong> Zentrum dieser<br />
Unterrichtseinheit nach der Analyse von Karikaturen und Techniken der Quellenreduktion<br />
vor allem Umgangsweisen mit Sachtexten. (Damit wird auch das Fach Deutsch berührt,<br />
denn hier wird am 17. Mai die letzte Klausur zur Analyse von Sachtexten geschrieben.)<br />
Die Prüfungsstunde befindet sich relativ am Anfang der Unterrichtseinheit. Nachdem zu<br />
Beginn die Kaiserproklamation <strong>im</strong> Spiegelsaal von Versailles anhand einer autobiographischen<br />
Erinnerung des Malers Anton von Werner wiederholt wurde, und vor der Prüfungsstunde<br />
in einer Doppelstunde die Lehrbuchseiten (a) zur Bedeutung des Militärs,<br />
(b) zur Rolle der Frau, (c) zum nationalen Selbstbild sowie (d) zum Umgang mit Andersdenkenden<br />
in Gruppen erarbeitet wurden, sollen nun die Ergebnisse referiert werden.<br />
Damit eröffnet sich die Möglichkeit, die verschiedenen Anstrengungen um eine<br />
gemeinschaftliche deutsche Identität am Ende des 19. Jahrhunderts nachzuvollziehen 2 .<br />
3. Sachanalyse<br />
Am 18. Januar 1871 fand <strong>im</strong> Spiegelsaal von Versailles die Kaiserproklamation von Wilhelm<br />
I. statt. Damit einher ging die Gründung des Deutschen Reiches. Schon am 16. April<br />
trat die Verfassung in Kraft. Der neue deutsche Nationalstaat entwickelte sich schnell,<br />
dabei suchte er sein Selbstbild nicht nur über politische Strukturen und eine außenpolitische<br />
Neuorientierung, sondern auch mittels unterschiedlicher Wertemuster und Refe-<br />
1 Vgl. Stoffverteilungsplan für das Fach Deutschsprachiger Geschichtsunterricht an den Deutschen <strong>Schule</strong>n auf der<br />
Iberischen Halbinsel. Klasse 10, Punkt 2.<br />
2 Das Ende der achtstündigen Unterrichtseinheit wird mit dem Film „Der Untertan“ von W. Staudte beschlossen.<br />
2