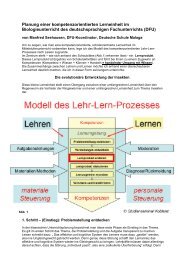Grundwerte im Wilhelminischen Zeitalter - Praktikum macht Schule
Grundwerte im Wilhelminischen Zeitalter - Praktikum macht Schule
Grundwerte im Wilhelminischen Zeitalter - Praktikum macht Schule
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ergebnisse der Gruppenarbeitsphase nacheinander zu präsentieren und die dazugehörigen<br />
Schaubilder nebeneinander an der Tafel zu befestigen. Erst danach kann in einer<br />
Diskussion auf die eingangs gestellte Frage eingegangen werden.<br />
Bei der Umsetzung dieses Stundenkonzeptes sind verschiedene methodische Entscheidungen<br />
und organisatorische Probleme zu berücksichtigen:<br />
Dazu gehört die Form, in der das Material vorgegeben wird. Es umfasst <strong>im</strong> Durchschnitt<br />
drei Lehrbuchseiten, die zu einem Drittel aus Bild- und überschaubaren Textquellen<br />
mit Einleitung und Zeilenangaben bestehen. Die Gruppen können also die Daten aus<br />
Pr<strong>im</strong>är- und Sekundärquellen, aus abstrakten und empirischen Darstellungen gewinnen<br />
11 .<br />
Sodann muss auf die Sozialform der vorbereitenden Doppelstunde eingegangen werden.<br />
Es wurde schon darauf verwiesen, dass die Klasse <strong>im</strong> Umgang mit der Gruppenarbeit<br />
noch Routine entwickeln muss. Doch nicht nur darum schien diese Form der Selbstorganisation<br />
sinnvoll. Denn zugleich wurde der Austausch von fachlichem und sprachlichem<br />
Wissen sowie von Wahrnehmungsmustern und damit der für die Prüfungsstunde<br />
vorbereitende Prozess eines Gedankenaustausches angeregt. Überdies wurden die sozialen<br />
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler trainiert. Die Zusammensetzung der<br />
Gruppen (vier Gruppen mit je vier Mitgliedern) wurde durch den Lehrer gelenkt. Dadurch<br />
sollte vermieden werden, dass sich Schülerinnen und Schüler zusammenfinden,<br />
die nicht gut zusammenarbeiten können oder sich ablenken. Außerdem wurden die<br />
Leistungsstärkeren auf verschiedene Gruppen verteilt und auf eine Mischung von verschiedenen<br />
Muttersprachlern geachtet 12 .<br />
Ferner muss auf die Präsentationsmodi des Kurses hingewiesen werden: Einerseits haben<br />
einige Schülerinnen und Schüler <strong>im</strong> bisherigen Unterrichtsverlauf bewiesen, dass sie<br />
selbstbewusst und pointiert kurze Referate halten können. Andererseits zeigte sich aber<br />
auch, dass die durchgängige Arbeit am Text (die Verwendung von Zeilenangaben und<br />
Zitaten) sowie die graphische Begleitung (in Form eines Mind Mappings, eines Clusters<br />
oder symbolischen Transfers) nicht selbstverständlich sind. Da die Präsentationen der<br />
Schülerinnen und Schüler mit diesen Verfahren allerdings interessanter, nachvollziehbarer<br />
und einprägsamer werden, soll diese Vorgehensweise mit der Austeilung von Kartons<br />
und Stiften angeregt werden. Damit wird zugleich den Anforderungen des schulinternen<br />
Methodenkonzepts entsprochen 13 . Ziel der Präsentation ist es, das freie Sprechen<br />
nach Stichwörtern und zugleich das aufmerksame (kritische) Zuhören zu schulen. Dementsprechend<br />
und zur Sicherung der präsentierten Ergebnisse sollen jeweils nach jedem<br />
Referat Mitglieder aus anderen Gruppen die vorgestellten Befunde wiederholen.<br />
Überdies soll auf die Art des Unterrichtsgespräches eingegangen werden: Angestrebt<br />
wird insbesondere in der abschließenden Diskussion zur Frage nach den Folgen des herausgearbeiteten<br />
Wertekanons ein „Gespräch der gleichen Ebene“: „Hier soll der Lehrer<br />
keine Vorzugsstellung innehaben und prinzipiell nicht mehr Gesprächsbeiträge leisten<br />
als jeder einzelne Schüler. Solange ihm allerdings die Gesprächsleitung obliegt, wird sich<br />
diese Gleichheit kaum herstellen lassen.“ 14 Tatsächlich müssen aus der Position des Mo-<br />
11 Auf Wortlisten (<strong>im</strong> Sinne einer DaF-Konvention) wurde dabei verzichtet. Denn <strong>im</strong> Rahmen der Gruppenarbeit<br />
sollten unverständliche Wörter einen zusätzlichen Impuls für einen Austausch zwischen spanischen und deutschen<br />
Muttersprachlern bieten.<br />
12 Die Betreuung der Gruppenarbeit orientierte sich an den Ergebnissen der aktuellen Forschung. Dazu gehörte<br />
die Erteilung kombinierter Arbeitsaufträge sowie der Versuch, Lehrerinterventionen während der eigentlichen<br />
Gruppenarbeitsphase zu vermeiden. Vgl. Dann, Diegritz, Rosenbusch, 1999.<br />
13 Bereits in Klasse 9 wird das „Freie Sprechen vor Publikum (<strong>im</strong> Sinne eines Prüfungsgesprächs)“ gefordert. Vgl.<br />
Curriculum zu den Lern- und Arbeitstechniken, sowie Kommunikationstechniken der DS Málaga.<br />
14 Rohlfes, 1986, S.275. Zugleich wird ein zweiter Typus berührt: „Diskutieren lässt sich nur, was umstritten ist,<br />
was man von unterschiedlichen Standpunkten sehen und beurteilen kann.“<br />
6