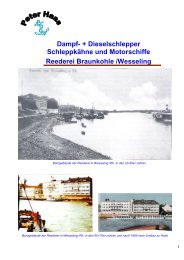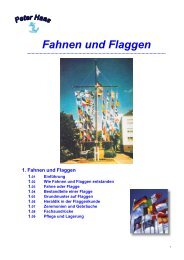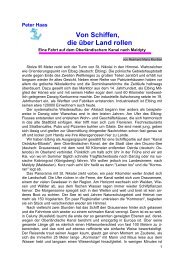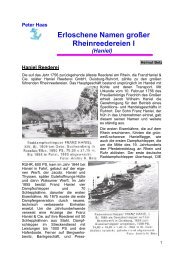Entwicklung des Wahrschauerdienstes im Gebirge
Entwicklung des Wahrschauerdienstes im Gebirge
Entwicklung des Wahrschauerdienstes im Gebirge
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Peter Haas<br />
Die <strong>Entwicklung</strong> <strong>des</strong> Wahrschaudienstes<br />
in der Gebirgsstrecke <strong>des</strong> Rheins<br />
zwischen Bingen und St. Goar (1984)<br />
von U l r i c h K n o b l o c h<br />
1. Vorbemerkung<br />
Wahrschauen ist der schiffahrtsübliche Begriff für eine Tätigkeit, die darauf gerichtet<br />
ist, die Schiffahrt vor Gefahren zu warnen, sie auf schwierige, gefahrbringende Verkehrssituationen<br />
hinzuweisen. Dieses erfolgte und erfolgt in der Regel durch Setzen<br />
von Zeichen in Form von Flaggen, Tafeln oder Lichtern an den für die Schiffahrt besonders<br />
unübersichtlichen, strömungsmässig problematischen Flussstellen. Hierzu<br />
zählte schon <strong>im</strong>mer die Rheinstrecke zwischen Bingen und St. Goar. Über die <strong>Entwicklung</strong><br />
der Wahrschauregelung reden heißt, die <strong>Entwicklung</strong> der Polizeivorschriften<br />
für die Schiffahrt auf dem Rhein gedanklich nachzuvollziehen, da der Wahrschaudienst<br />
als verkehrsbeobachtende Einrichtung in diesen Vorschriften verankert war<br />
und ist.<br />
Zwei historisch bedeutende Ereignisse waren es, die das Prinzip <strong>des</strong> teilweise in seinen<br />
Grundzügen heute noch gültigen Wahrschausystems in der rheinischen Gebirgsstrecke<br />
entstehen ließen:<br />
1. die Veränderung der politischen und territorialen Verhältnisse am Rhein<br />
nach der französischen Revolution,<br />
2. die Einführung und <strong>Entwicklung</strong> der Dampfschiffahrt auf dem Rhein.<br />
2. Die Verhältnisse am Rhein zu Beginn <strong>des</strong> 19. Jahrhunderts<br />
2.1 Die politische Situation<br />
Jahrhunderte lange Kleinstaaterei, während der an den Ufern <strong>des</strong> Rheins eine Vielzahl<br />
von Fürsten und Herren saßen, die jeder für sich aus dem Wasser nur Nutzen<br />
für ihr Land ziehen wollten, ohne das Wohl der Gesamtheit dabei <strong>im</strong> Auge zu behalten,<br />
hat die Rheinschiffahrt bis zum Beginn <strong>des</strong> 19. Jhd. in ruinöse, wirtschaftliche<br />
Verhältnisse gebracht. Willkürlich erhobene Zölle und die Stapelrechte der Städte<br />
(hier Mainz und Köln) lähmten die freie Entfaltung der Rheinschiffahrt.<br />
In diese Situation hinein stößt Ende <strong>des</strong> 18. Jahrhunderts der freiheitliche Gedanke<br />
der französischen Revolution. Durch die Revolutionskriege und die wenig erfolgreiche<br />
Abwehr der französischen Heere durch die Armeen der Koalition gelangt Frankreich<br />
über den Frieden von Luneville (1801) in den Besitz der linksrheinischen Länder<br />
und fasst damit für das nächste Jahrzehnt festen Fuß am Rhein.<br />
Nur eine einseitige Betrachtungsweise dieser geschichtlichen <strong>Entwicklung</strong> sieht in<br />
dem Verlust der deutschen Souveränität am Rhein etwas absolut Negatives. Sie ü-<br />
bersieht dabei den Fortschritt, der durch den Einfluss einer auf vielen Gebieten mustergültigen<br />
Gesetzgebung an den Rhein - und dort insbesondere für die Schiffahrt<br />
herangetragen wurde. Zur Erleichterung der Schiffahrt sollten unter dem Einfluss<br />
Frankreichs bald einschneidende Maßnahmen in Angriff genommen werden.<br />
1
Die ersten Vorstellungen in dieser Richtung wurden in dem Reichsdeputationshauptschluss<br />
von 1803 verwirklicht, in dem die Abschaffung aller Rheinzölle und die Einführung<br />
eines neuen, vereinfachten Erhebungsprinzips vereinbart wurde.<br />
Konkrete Gestalt erhielt diese Vorstellung in der sogenannten Oktroikonvention von<br />
1804. Sie gilt als der entschiedene Anfang einer besseren Ordnung der Schiffahrtsverhältnisse.<br />
Diese Vereinbarung enthält neben der genauen Regelung der internationalen<br />
Verhältnisse eine Vielzahl staatsrechtlicher und polizeilicher Vorschriften und<br />
Grundsätze von besonderer Tragweite. Neben der Beseitigung der Zölle war der<br />
Hauptvorzug dieser Vereinbarung die Schaffung einer einheitlichen, zentralen Verwaltung.<br />
Die Uferstaaten mit ihren örtlich beschränkten Interessen verloren ihren Einfluss<br />
am Wasserweg Rhein.<br />
Mit der Besiegung Napoleons 1813 wird Frankreich, was jedenfalls den mittleren Teil<br />
<strong>des</strong> Stromes anbelangt, wieder vom Rhein verdrängt.<br />
Die von Frankreich angebahnte Befreiung wird jedoch beibehalten und später sogar<br />
erweitert.<br />
Der auf den Pariser Frieden 1814 folgende Wiener Kongress schafft durch Einfügung<br />
entsprechender Artikel in die Kongressakte die unverrückbare Voraussetzung für die<br />
freie Schiffahrt auf den Flüssen, die mehrere Länder durchströmen.<br />
Zur Überwachung dieses Grundsatzes wurde eine Zentralkommission gebildet, über<br />
die auch gleichzeitig der amtliche Austausch unter den Uferstaaten erfolgte.<br />
Unter ihrem Einfluss und auf der Grundlage ihrer Beschlüsse entstanden in der Folgezeit<br />
die ersten aufeinander abgest<strong>im</strong>mten Schiffahrtspolizeivorschriften für den<br />
Rhein, die anfänglich noch von den Anliegerstaaten in eigener hoheitlicher Zuständigkeit<br />
erlassen, später jedoch gemeinschaftlich herausgegeben wurden. Hier begegnen<br />
uns auch zum ersten Mal klare Anweisungen über die Wahrschauregelungen<br />
für die besonders unübersichtlichen und gefahrbringenden Abschnitte der rheinischen<br />
Gebirgsstrecke.<br />
2.2 Die Einführung der Dampfschiffahrt auf dem Rhein<br />
Noch Anfang <strong>des</strong> vorigen Jahrhunderts dienten in erster Linie Ruder und Segel der<br />
Rheinschiffahrt als Fortbewegungsmittel. Den erschwerenden Verhältnissen durch<br />
stark wechselnde Windstärken und dem Gefälle <strong>des</strong> Flusses begegnete man schon<br />
frühzeitig in der Bergfahrt durch Einsatz der Zugkraft von Mensch und Tier. Es wurde<br />
vielfach über die Leinpfade getreidelt. Daneben fuhren - und das nicht <strong>im</strong>mer nur<br />
gemächlich - gewaltige Holzflöße in den Abmessungen wie ein moderner Schubverband<br />
zu Tal.<br />
Den ersten Schritt zur Einführung der Dampfschiffahrt <strong>im</strong> Rheingebiet unternahmen<br />
die Holländer. Nachdem bereits 1816 das erste Dampfboot, ein englischer Raddampfer,<br />
den Rhein von Rotterdam nach Köln befahren hatte, setzten die Holländer ein<br />
Jahr später einen eigenen Dampfer zu gelegentlichen Fahrten auf der gleichen Strecke<br />
ein. 1825 befuhr dann das erste Dampfschiff den Mittelrhein von Köln bis Mainz.<br />
Diese Erfolge regten allerorts zur Gründung von kapitalkräftigen Dampfschiffahrtsgesellschaften<br />
an, um die neue Erfindung rationell auszunutzen. Anfang der 40er Jahre<br />
gestaltete sich der Schiffsverkehr mit Dampfschiffen bereits so rege, dass sich die<br />
Uferstaaten auf Beschluss der Rheinschiffahrts-Central-Commission genötigt sahen,<br />
etwa gleichlautende Vorschriften über das Vorbeifahren vom Dampf- und Segelschiffen<br />
aneinander auf dem Rhein zu erlassen. Diese Verordnungen waren die ersten e<br />
i n h e i t I i c h e n Polizeiverordnungen auf dem Rhein. In ihnen sind auch zum ersten<br />
Mal umfassende Vorschriften über die Wahrschauregelungen in der rheinischen<br />
2
Gebirgsstrecke enthalten. Die Geschichte dieser Vorschriften spiegelt die <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>des</strong> Wahrschaudienstes wieder.<br />
3. Die Wahrschauregelungen seit Beginn <strong>des</strong> 19. Jahrhunderts<br />
3.1 Die wandernden Wahrschauer<br />
Klammern wir einmal das Wahrschauen der Flöße, das in der Form erfolgte, dass jedem<br />
Floß in einem zeitlichen Abstand von einer Stunde ein Nachen vorausfahren<br />
musste, der das Nachfolgen <strong>des</strong> Floßes durch eine schwarz/rot karierte Fahne anzeigte,<br />
als sicher einer der ältesten, räumlich jedoch nicht beschränkten Form eines<br />
Wahrschaudienstes aus, so waren es in der hier behandelten rheinischen Gebirgsstrecke<br />
drei markante Streckenabschnitte, auf denen nach Einführung der<br />
Dampfschiffahrt ein Wahrschaudienst vorgeschrieben und später eingerichtet wurde:<br />
a) Aßmannshausen - Bingen (Binger Loch)<br />
b) Oberhalb Kaub - Lorchhausen (Wirbelley)<br />
c) St. Goar - Loreley (später bis Oberwesel).<br />
Zu Anfang dieser Regelungen, wo der Schiffsverkehr doch noch gemächlicher einherging<br />
und die Zahl der Dampfschiffe noch sehr gering war, konnte man sich damit<br />
begnügen, den an vorgenannten Stellen zu Berg kommenden Schiffen einen Boten<br />
(den sogenannten wandernden Wahrschauer) auf dem Leinpfad vorauszusenden,<br />
der durch Zeichengebung mit Hilfe einer weit sichtbaren Signalflagge - <strong>im</strong> Bereich<br />
der Loreley einer roten, sonst einer schwarzen - das Begegnen von Schiffen an den<br />
gefährlichen Engstellen und Krümmungen zu verhindern hatte. Dazu legten die etwa<br />
gleichlautenden Polizeiverordnungen der Länder Hessen, Nassau und Preußen von<br />
1840/41 folgen<strong>des</strong> fest:<br />
- Dampfschiffe und Segelschiffe, die ab St. Goar bergwärts fahren wollten, hatten bis<br />
zur Einsicht der Strecke um das Bankeck (das waren in diesem Fall nur einige<br />
hundert Meter) einen Wahrschauer vorauszuschicken, der mit einer roten Flagge<br />
anzeigte, ob Schiffe zu Tal kamen. Die bergfahrende Schiffahrt hatte gegebenenfalls<br />
so lange dann in St. Goar zu warten.<br />
- Bei der Umfahrung der Wirbelley gegenüber Bacharach hatten nur die Dampfschiffe,<br />
die wegen niedriger Wasserstände durchs Wilde Gefähr Vorspannpferde nehmen<br />
mussten, einen Wahrschauer bis Lorchhausen (das waren <strong>im</strong>merhin schon<br />
2,5 - 3 km) vorauszuschicken, da durch das Vorspannseil der Talweg für die Schiffahrt<br />
gänzlich gesperrt wurde. In diesem Fall musste in der Regel die Talschiffahrt<br />
vor der Wirbelley vor Anker gehen; es sei denn, der Talfahrer hatte bei Ankunft <strong>des</strong><br />
Wahrschauers Lorchhausen bereits passiert. Dann musste das Dampfschiff informiert<br />
werden und unterhalb <strong>des</strong> Wilden Gefährs liegen bleiben.<br />
Ähnlich, jedoch die Gesamtschiffahrt betreffend und damit problematischer, gestaltete<br />
sich die Wahrschauregelung am Binger Loch. Hier hatten alle Schiffe von Aßmannshausen<br />
aus einen Wahrschauer bis auf die Höhe von Bingen (ca. 3,5 km) vorauszusenden,<br />
der eine weit sichtbare Signalflagge so lange zu zeigen hatte, bis das<br />
zu Berg gehende Schiff die sogenannte Fiddel - einen markanten Stein oberhalb der<br />
Mäuseturminsel - passiert hatte. So lange durften von Bingen keine Schiffe abfahren<br />
und die oberhalb Bingen zu Tal kommenden Schiffe mussten vor Anker gehen. War<br />
jedoch vor Ankunft <strong>des</strong> Wahrschauers bereits ein Schiff von Bingen abgefahren, so<br />
musste der Wahrschauer, nachdem er die Signalflagge sichtbar aufgestellt hatte, sofort<br />
das zu Berg kommende Schiff davon benachrichtigen, das dann unterhalb <strong>des</strong><br />
Binger Loches bis zur Vorbeifahrt <strong>des</strong> Talschiffes anhalten musste.<br />
Auch die aus Bingen talwärts abfahrenden Dampfschiffe mussten sich eines Wahrschauers<br />
bedienen, der ihnen vom rechten Rheinufer aus mit einer schwarzen Flag-<br />
3
ge zu erkennen gab, ob ein Bergschiff <strong>im</strong> Begriff war, das Binger Loch zu passieren.<br />
In diesem Fall musste das Talschiff halten, bis der Wahrschauer seine Flagge niedergelegt<br />
hatte.<br />
3.2 Einrichtung fester Wahrschaustationen<br />
Die aufwärts strebende <strong>Entwicklung</strong> <strong>des</strong> Schiffsverkehrs nach Einführung der<br />
Dampfschiffahrt macht es rund 10 Jahre später - also 1850 - erforderlich, zur Sicherheit<br />
<strong>des</strong> Schiffsverkehrs den noch wohl umständlichen, wie sicher auch nicht so wirkungsvollen<br />
Wahrschaudienst "zu Fuß" durch feste Wahrschaustationen zu ersetzen.<br />
Kurz vor Erscheinen der ersten gemeinschaftlichen Polizeiverordnung über das Befahren<br />
<strong>des</strong> Rheinstromes durch die Zentralkommission für die Rheinschiffahrt wurde<br />
Mitte <strong>des</strong> vorigen Jahrhunderts die Einrichtung stehender Wahrschauer bekannt gegeben.<br />
Es waren die bereits genannten Gefahrenbereiche, an denen in der Gebirgsstrecke<br />
feste Wahrschaustationen errichtet wurden. So entstand eine Station am Binger Loch<br />
auf dem Mäuseturm, an der Wirbelley bei Bacharach und auf der Strecke Oberwesel<br />
bis St. Goar am Ochsenturm in Oberwesel, gegenüber dem Kammereck und an der<br />
Bank bei St. Goar. In welcher Form zu wahrschauen und was von der vorbeifahrenden<br />
Schiffahrt zur Deckung der durch diese Art von Wahrschaudienst entstehenden<br />
Unkosten an Entgelten zu zahlen war - eine Kostenart für die Schiffahrt, die bis in<br />
unser Jahrhundert hinein Bestand hatte - wurde durch besondere Best<strong>im</strong>mungen geregelt.<br />
Ab 1864 finden wir dann die Regelungsanweisungen für die Wahrschauer in die Polizeivorschriften<br />
eingearbeitet. Danach hatten die an den vorstehend genannten Stellen<br />
stationierten Wahrschauer die jeweils gleiche Verpflichtung, das Annähern aller<br />
zu Tal gehenden Fahrzeuge durch Aufziehen von Flaggen bemerkbar zu machen,<br />
und zwar in folgender Weise:<br />
a) wenn ein einzelnes Schiff zu Tal kommt, durch Aufziehen der r o t e n<br />
b) wenn ein S c h I e p p z u g zu Tal fährt, durch Aufziehen der w e i ß e n<br />
c) wenn ein Floß antreibt, durch Aufziehen der r o t e n und w e i ß e n Flagge.<br />
Durch diese Zeichen wurde ganz allgemein gleichzeitig angezeigt, dass die Talschiffahrt<br />
frei ist, während das Fehlen dieser Zeichen andeutete, dass die Bergfahrt frei ist<br />
(Abb. 1). Neben den neu eingerichteten festen Wahrschaustationen bestand noch bis<br />
1910 eine wandernde Wahrschau zwischen St. Goar und Oberwesel, die jedoch nur<br />
<strong>im</strong> Einzelfall bei zu Berg gehenden D a m p f s c h l e p p z ü g e n diesen vorauszugehen<br />
und mittels einer r o t e n Flagge zu Tal kommende Fahrzeuge anzuzeigen<br />
hatte.<br />
Abb. 1 Wahrschaustation am Bankeck bei St.<br />
Goar um 1953<br />
In dieser Form bestand die Wahrschauregelung<br />
etwa 60 Jahre, ergänzt nur<br />
noch durch eine zusätzliche Station gegenüber<br />
der Loreley zu Ausgang <strong>des</strong> vorigen<br />
Jahrhunderts.<br />
Der ständig zunehmende Schiffsverkehr<br />
machte es dann zu Beginn unseres Jahrhunderts<br />
erforderlich, den Wahrschaudienst<br />
zur Sicherheit <strong>des</strong> Schiffsverkehrs zu verbessern und zu intensivieren. So entstanden<br />
nach 1910 drei zusätzliche Wahrschaustationen, zwei davon <strong>im</strong> Bereich <strong>des</strong><br />
4
Binger Loches, und zwar am rechten Ufer einmal kurz unterhalb Rü<strong>des</strong>he<strong>im</strong> (gegenüber<br />
der Krausaue) und zum andern unterhalb <strong>des</strong> Binger Loches (sog. Nebelposten).<br />
Beide dienten dazu, die Schifffahrt frühzeitig durch Wiederholung verschiedener<br />
Signale über die Zeichengebung auf dem Mäuseturm selbst zu informieren. Der sog.<br />
Nebelposten (offiziell Station 3) wurde dabei nur bei unsichtigem Wetter besetzt.<br />
Eine dritte Station wurde auf der Strecke zwischen Oberwesel und St. Goar am sog.<br />
Betteck (zwischen Kammereck und Loreley) errichtet. Die Verbesserung <strong>des</strong> Wahrschaudienstes<br />
bestand aber nicht nur darin, dass die Zahl der Stationen vergrößert<br />
wurde, sondern auch die Informationsmöglichkeiten der einzelnen Stationen wurden<br />
teilweise erheblich erweitert. Bedeutsam in dieser Hinsicht war insbesondere, dass<br />
durch die Möglichkeit <strong>des</strong> Wechselns von Flaggenzeichen auf gleichfarbige Körbe<br />
(später Bälle und Scheiben) <strong>im</strong> Bereich <strong>des</strong> Binger Loches und <strong>des</strong> Kammerecks<br />
angezeigt werden konnte, für welches der bei den jeweils dort vorhandenen zwei<br />
Fahrwasser die gezeigten Wahrschausignale galten. Daneben konnten durch das<br />
Setzen zusätzlicher Flaggen an den Wahrschaustationen der Schiffahrt zu ihrer Sicherheit<br />
weitere Informationen gegeben werden. So bedeutete z. B. das Aufziehen<br />
einer blau-weißen-Flagge an den Stationen zwischen Lorchhausen und St. Goar,<br />
dass das Fahrwasser durch das Sinken oder Festfahren eines Schiffes gesperrt ist.<br />
Bis Ende der 60er Jahre wurde diese Art <strong>des</strong> Wahrschaudienstes aufrechterhalten.<br />
Hinzu kamen <strong>im</strong> laufe der Zeit noch eine Anzahl zusätzlicher Zeichen, z. B. kleine<br />
Flaggen zur Angabe der Position, in der sich der durch Hauptzeichen angekündigte<br />
Talfahrer befand, oder zusätzliche weiße oder rote Blinklichter, so dass sich einem<br />
weniger kundigen Schiffsführer bald eine Fülle von nautischen Informationen an den<br />
einzelnen Wahrschaustationen bot, ,die von ihm gar nicht mehr so leicht und schnell<br />
- da nicht in jedem Fall gleich gut sichtbar - überblickt und gelesen werden konnten.<br />
Auch für den Wahrschauer selbst wurde die Bedienung<br />
der Stationen - man stelle sich insbesondere mal den<br />
Mäuseturm mit seinen vielen verteilten Masten und<br />
Stangen vor (Abb. 2) - bei der Vielzahl der Signale und<br />
dem ständig wachsenden Verkehrsaufkommen kein so<br />
leichtes Geschäft mehr.<br />
Abb. 2 Wahrschauen vom Mäuseturm,<br />
3.3 Umstellung von Flaggen auf Lichttagessignale<br />
Es war also nur zu verständlich, dass nach einem Weg<br />
gesucht wurde, die Signalgebung an den Wahrschaustationen<br />
deutlicher sichtbar, rascher lesbar und bedienungsfreundlicher<br />
zu gestalten. Zu diesem Zweck wurden<br />
in den 60er Jahren an einigen Stellen bei den<br />
Wahrschaustationen Lichttagessignale versuchsweise<br />
aufgestellt, die über Schaltpulte einfach bedient werden<br />
konnten. Sie gaben parallel zu den Flaggensignalen verschiedenartige Lichtzeichen,<br />
die jedoch <strong>im</strong> Versuchsstadium gemäß entsprechender Mitteilungen an die Schiffahrt<br />
nicht zu beachten waren.<br />
Die ersten dieser Zeichen wurden bereits schon 1961 <strong>im</strong> Bereich <strong>des</strong> Binger Loches<br />
in Betrieb genommen, und zwar eins - nach Oberstrom gerichtet direkt am Mäuseturm,<br />
das zweite am unteren Ende der Mäuseturminsel - talwärts zeigend - und das<br />
dritte am linken Ufer bei km 531,4 an der unterstromigen Einfahrt ins linksrheinische<br />
Fahrwasser. Diese Zeichen, bestehend aus einfacheren Mastkonstruktionen mit einer<br />
Vielzahl von Einzellichtern, die einzeln oder in Gruppen geschaltet werden konn-<br />
5
ten, wurden über 10 Jahre betrieben, ohne je Bedeutung erlangt zu haben. 1964<br />
wurde versuchsweise ein weiteres Lichtsignal am Wahrschauposten gegenüber der<br />
Loreley und 1968 be<strong>im</strong> Wahrschauposten am Betteck in Betrieb genommen, wobei<br />
<strong>im</strong>mer die Flaggenregelung an diesen Stationen weiterhin maßgebend blieb. Die<br />
Lichttagessignale an den Stationen Loreley und Betteck waren bereits in ihrer Formgebung<br />
und Gliederung sowie in der Darstellung <strong>des</strong> Signals (dreieckförmig angeordnete<br />
Lichtbalken) so gestaltet, wie sie einige Jahre später als hauptamtliche Zeichen<br />
bei allen weiterbetriebenen Stationen eingeführt wurden.<br />
Im Zusammenhang mit dem Ausbau <strong>des</strong> Rheins zwischen Bingen und St. Goar zur<br />
Schaffung einer 120 m breiten und 2,10 m tiefen Fahrrinne wurde ab 1970 die Umstellung<br />
aller Wahrschaustationen auf Lichttagessignale betrieben. Übernommen<br />
wurde das an den Stationen Betteck und Loreley erprobte und bewährte System der<br />
dreieckförmig angeordneten Lichtbalken.<br />
Im Bereich der Binger Loch Strecke wurden die neuen Signale an folgenden Stellen<br />
errichtet:<br />
a} Vorsignal an der Station Krausaue (nach Oberstrom),<br />
b} Hauptsignal am Mäuseturm (ebenfalls nach Oberstrom gerichtet),<br />
c} Bergfahrtsignal bei km 531,4, linkes Ufer (an der Stelle, wo der Lichtmast III gestanden<br />
hatte).<br />
Die horizontale Gliederung der Signaltafeln in 3 Felder entsprach der damaligen<br />
Ausbauplanung für das Bingerloch, wo neben den 2 bestehenden Fahrwassern noch<br />
ein drittes, mittleres Fahrwasser geschaffen werden sollte. Jeder Fahrrinne war ein<br />
Signalfeld zugeordnet. Die Aussagekraft der nach Oberstrom gerichteten Zeichen<br />
(Krausaue und Mäuseturm s. Abb. 3) war eine etwas andere als die der übrigen, die<br />
Abb. 3 Lichttagessignal am Mäuseturm 1972<br />
Bergschiffahrt wahrschauenden Signale.<br />
Diese Zeichen besaßen verkehrsregelnden<br />
Charakter. Es bedeuteten an diesen<br />
bei den Stationen das Aufleuchten entsprechender<br />
Lichtbalken oder Balkengruppen,<br />
für welche zu Tal gehende<br />
Schiffahrt welches Fahrwasser frei war.<br />
Mit zusätzlichen roten oder grünen Einzellichtern<br />
konnten Durchfahrten gesperrt<br />
oder freigegeben werden. Von einem zentralen Steuerstand <strong>im</strong> Mäuseturm aus<br />
konnte ein Mann alle 3 Signaltafeln einfach bedienen, wobei eine Vielzahl von Kontroll-Lampen<br />
ihm die sichere Rückmeldung für eine ordnungsgemäße Schaltung gaben.<br />
Am 1. März 1972 wurden diese Lichtsignale in Betrieb genommen Aber bereits<br />
zu diesem Zeitpunkt war absehbar, dass dieser Wahrschauregelung am Bingerloch<br />
kein langes Leben beschieden sein sollte. Die Ausbauplanung war nämlich inzwischen<br />
umgestellt worden mit dem Ziel, durch das Bingerloch-Fahrwasser eine durchgehende<br />
120 m breite Fahrrinne zu schaffen. Diese machte nicht nur die Dreiteiligkeit<br />
der Signale, sondern die Wahrschauregelung in diesem Bereich selbst überflüssig.<br />
Mit Eröffnung der 120 m breiten Fahrrinne durch das Bingerloch erloschen am 5.<br />
September 1974 die Wahrschaulichter am Mäuseturm. Damit ging eine rd.<br />
125jährige Geschichte <strong>des</strong> Wahrschaudienstes von dieser Warte aus für <strong>im</strong>mer zu<br />
Ende.<br />
Ebenfalls mit dem Ausbau <strong>des</strong> Rheins verschwand die Wahrschaustation an der<br />
Wirbelley.<br />
6
Erhalten geblieben und weiterbetrieben bis heute ist die Wahrschauregelung auf der<br />
Strecke Oberwesel bis St. Goar. Mit der dauerhaften Einrichtung der Lichttagessignale<br />
in diesem Bereich zwischen 1970 und 1972 wurden jedoch auch hier - technisch<br />
bedingt - wesentliche Veränderungen vorgenommen. Anstelle der Flaggenmasten<br />
traten die über lange Jahre an den Stationen Betteck und Loreley erprobten Lichtsignale<br />
mit 2 bzw. 3 talwärts gerichteten, übereinander angeordneten Signalfeldern (s.<br />
Abb. 4). Jedem dieser Signalfelder sind genau festgelegte, stromaufwärts anschließende<br />
Teilstrecken zugeordnet. Die dreieckförmig angeordneten Lichtbalken zeigen<br />
hier an welche Art von Talfahrern (Einzelfahrer, gekuppelte Fahrzeuge über 86 m<br />
Länge oder Schleppverbände, Schubverbände) sich in welchem Streckenabschnitt<br />
befindet.<br />
Abb. 4 Lichttagessignal und Wahrschaustation<br />
am Betteck 1972<br />
Die Einführung der modernen<br />
Technik ermöglichte auch eine wesentlich<br />
rationellere Gestaltung <strong>des</strong><br />
Wahrschaudienstes auf dieser<br />
Strecke. Übersichtliche Schaltpulte<br />
mit Rückmeldeanzeigen für das<br />
Schalten der Signale sowie eingebauten<br />
Kontroll-Lampen für alle<br />
Funktionen eröffneten die Möglichkeit<br />
der Fernbedienung einiger<br />
Signale, so dass nicht mehr alle fünf Stationen besetzt zu werden brauchten. Auf der<br />
Strecke installierte Fernsehkameras unterstützten die verbliebenen 3 Wahrschauer<br />
bei der Überwachung der einzelnen Streckenabschnitte (Abb. 5).<br />
Abb. 5 Mast mit 2 Fernsehkameras bei km 552,11 linkes Ufer unterhalb<br />
Oberwesel<br />
Besetzt sind heute nur noch die Station am Ochsenturm,<br />
für die am Rheinufer zur Aufnahme der notwendigen<br />
technischen Einrichtungen extra ein neues Gebäude<br />
als Ersatz für die Räumlichkeiten auf dem Ochsenturm<br />
selbst geschaffen wurde (Abb. 6), weiter die Stationen<br />
am Betteck und am Bankeck. Die Station gegenüber<br />
dem Kammereck konnte ganz aufgegeben werden.<br />
An ihre Stelle trat am linken Ufer bei km 552,80 ein<br />
einfaches, bergwärts gerichtetes Signal. Mit diesem<br />
Abb. 6 Wahrschaustation am Ochsenturm<br />
in Oberwesel<br />
lässt sich die Talschiffahrt - wie<br />
am Ochsenturm auch - durch<br />
Setzen von 2 roten Lichtern<br />
sperren. Die Station gegenüber<br />
der Loreley besteht nur noch aus<br />
7
dem ferngesteuerten Wahrschausignal und einem Notstromaggregat für den Bedarf<br />
bei Stromausfall. Die 3 verbliebenen Wahrschauposten - besetzt jeweils mit 1 Mann<br />
pro Schicht - versehen ihren verantwortungsvollen Dienst von 1/2 Stunde vor Sonnenaufgang<br />
bis 1/2 Stunde nach Sonnenuntergang. In der übrigen Nachtzeit war die<br />
Schiffahrt nur in einer Richtung und zwar in der Bergfahrt erlaubt. Die Talfahrt war<br />
gesperrt und musste in der Regel auf den Strecken vor Geisenhe<strong>im</strong> und Bingen aufdrehen<br />
(anhalten).<br />
Als Überlegungen angestellt wurden, auch in den Nachtstunden einen gewissen Begegnungsverkehr<br />
in der Gebirgsstrecke versuchsweise zuzulassen, musste nach einem<br />
Ersatz für die in dieser Zeit nicht eingesetzten Wahrschauer gesucht werden.<br />
Auch hier half wieder die Technik durch die Möglichkeit <strong>des</strong> "Selbst-Wahrschauens"<br />
mittels UKW-Sprechfunkverkehr. Die Voraussetzungen, dass in der kurvenreichen,<br />
durch hohe Bergwände abgeschatteten Gebirgsstrecke Funkverkehr von Schiff zu<br />
Schiff überhaupt möglich ist, hat die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung durch besondere<br />
technische Installationen (Relaisstationen) in den Jahren 1976/77 geschaffen.<br />
Den nachts verkehrenden Schiffen musste nur noch die Benutzung von Funksprechgeräten<br />
entsprechend vorgeschrieben werden, um ein gefahrloses Begegnen<br />
der Schiffe durch gegenseitige Absprachen über Funk zu gewährleisten. Die Schiffahrt<br />
wahrschaut sich selbst. Ist das zukunftsweisend auch für die Tagschiffahrt?<br />
Noch steht darüber ein großes Fragezeichen. Verschiedene technische Einzelprobleme<br />
wären dazu noch zu lösen, so wie auch einige verkehrspolitische Entscheidungen<br />
zu fällen. So erstrebenswert es ist, durch Ausbaumaßnahmen am Strom sowie<br />
Einführung moderner Techniken den Schiffsverkehr auf dem Rhein <strong>im</strong>mer sicherer,<br />
reibungsloser und kostengünstiger abzuwickeln, so geht doch in vielen Fällen der<br />
Abbau althergebrachter Schiffahrtstraditionen - der Rückgang <strong>des</strong> Lotsengewerbes<br />
auf der mittelrheinischen Gebirgsstrecke zeugt auch davon - damit einher. Wird der<br />
Wahrschauer eines Tages nur noch eine Figur auf alten Lichtbildern und in den<br />
Stammtischgesprächen alter Schiffer zwischen Bingen und St. Goar sein?<br />
**************<br />
Quelle: Beiträge zur Rheinkunde 1984<br />
Rheinmuseum Koblenz<br />
Peter Haas 2009<br />
8