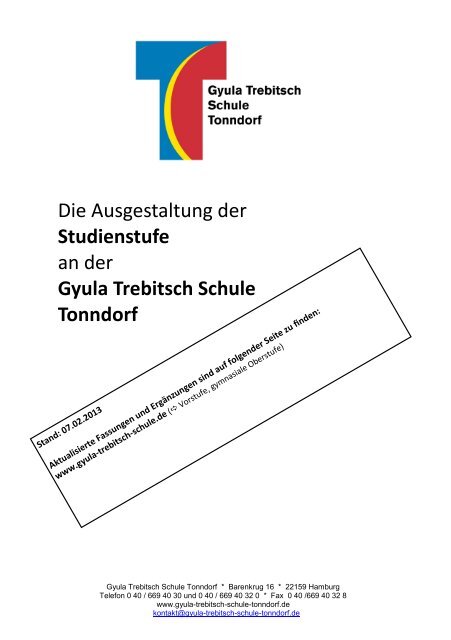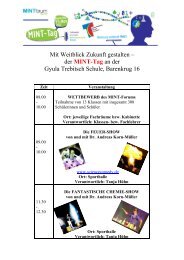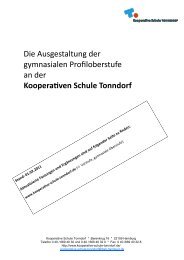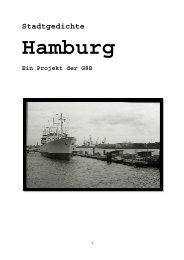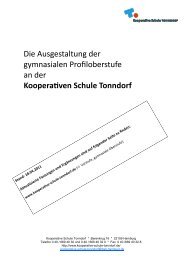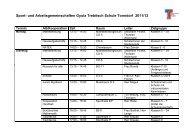downloads - Gyula Trebitsch Schule Tonndorf
downloads - Gyula Trebitsch Schule Tonndorf
downloads - Gyula Trebitsch Schule Tonndorf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Ausgestaltung der<br />
Studienstufe<br />
an der<br />
<strong>Gyula</strong> <strong>Trebitsch</strong> <strong>Schule</strong><br />
<strong>Tonndorf</strong><br />
Stand: 07.02.2013<br />
Aktualisierte Fassungen und Ergänzungen sind auf folgender Seite zu finden:<br />
www.gyula-trebitsch-schule.de ( Vorstufe, gymnasiale Oberstufe)<br />
<strong>Gyula</strong> <strong>Trebitsch</strong> <strong>Schule</strong> <strong>Tonndorf</strong> * Barenkrug 16 * 22159 Hamburg<br />
Telefon 0 40 / 669 40 30 und 0 40 / 669 40 32 0 * Fax 0 40 /669 40 32 8<br />
www.gyula-trebitsch-schule-tonndorf.de<br />
kontakt@gyula-trebitsch-schule-tonndorf.de
Reader: Version 8.0<br />
Stand: 07.02.2013 Layout: O. Lerch<br />
Impressum<br />
Vertreter der Profilarbeitsgruppen:<br />
Es gibt nur eine Erde!<br />
Günter Erbe - guenter.erbe@gts-tonndorf.de<br />
Höher, schneller, weiter<br />
Jana Eckhardt - jana.eckhardt@gts-tonndorf.de<br />
Kommunikationswelt - Weltkommunikation<br />
Gordon Riekoff - gordon.riekoff@@gts-tonndorf.de<br />
Die Welt ist eine Bühne!<br />
Eva Breiter - eva.breiter@gts-tonndorf.de<br />
Oliver Lerch - oliver.lerch@gts-tonndorf.de<br />
Weitere Informationen:<br />
Axel Janell (Abteilungsleiter der Oberstufe)<br />
Tel.: 040 - 66 94 03 - 0 (Durchwahl -27) - axel.janell@gts-tonndorf.de<br />
2
Inhalt<br />
5 Vorwort<br />
6 Allgemeine Stundentafel mit Belegauflagen<br />
7 Prüfungsfächer und Einbringungsverpflichtung zur Abiturberechnung<br />
8 Stundenplanbeispiel Studienstufe<br />
Profil 1: Höher, schneller, weiter<br />
Grenzen definieren, erfahren, überschreiten -<br />
Biologie, Sport, Geschichte, Seminar<br />
9 Kurzübersicht des Profils<br />
10 Stundentafel mit Belegauflagen<br />
11 Beschreibung der Semesterinhalte<br />
13 Detailübersicht<br />
Profil 2: Es gibt nur eine Erde!<br />
Menschliches (globales) Handeln im Spannungsfeld zwischen<br />
Möglichkeiten, Gefahren und Verantwortung -<br />
Chemie, Geografie, Biologie, Seminar<br />
17 Kurzübersicht des Profils<br />
18 Stundentafel mit Belegauflagen<br />
19 Beschreibung der Semesterinhalte<br />
23 Detailübersicht<br />
3
Inhalt<br />
Profil 3: Kommunikationswelt - Weltkommunikation<br />
Chancen und Risiken der medialen Vernetzung von<br />
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur -<br />
PGW, Informatik, Wirtschaft, Seminarkurs „Medien“<br />
27 Kurzübersicht des Profils<br />
28 Stundentafel mit Belegauflagen<br />
29 Beschreibung der Semesterinhalte<br />
31 Detailübersicht<br />
Profil 4: Die Welt ist eine Bühne!<br />
Ursachen, Ausdrucksformen und Folgen menschlichen<br />
Handelns -<br />
Geschichte, Theater, Kunst, Seminar<br />
35 Kurzübersicht des Profils<br />
36 Stundentafel mit Belegauflagen<br />
37 Beschreibung der Semesterinhalte<br />
39 Detailübersicht<br />
4
Vorwort<br />
Liebe Eltern,<br />
liebe Schülerinnen und Schüler,<br />
nachfolgend sollen Ihnen und Euch einige Informationen an die Hand gegeben werden, die<br />
zur Orientierung in der Studienstufe dienen sollen.<br />
Grundsätzliches<br />
In der Studienstufe belegen alle Schülerinnen und Schüler Kernfächer (Deutsch, Mathematik<br />
und die weitergeführte Fremdsprache), die vierstündig auf differenzierten Anforderungsniveaus<br />
unterrichtet werden.<br />
Im Profilbereich, einem Verbund aus Fächern<br />
(= Profil), der von jeder <strong>Schule</strong> individuell<br />
ausgearbeitet wird, werden im profilgebenden<br />
Fach, dem Profil zugeordneten<br />
Fächern und dem Seminar (s. Beispiel) zehn<br />
bis zwölf Wochenstunden unterrichtet.<br />
Außerdem gibt es weitere Pflichtfächer,<br />
damit die von der Kultusministerkonferenz<br />
(KMK) vorgegebenen Aufgabenfelder<br />
(sprachlich-künstlerisches / gesellschaftswissenschaftliches<br />
/ mathematisch-naturwissenschaftliches<br />
Aufgabenfeld) abgedeckt<br />
sind.<br />
3 Aufgabenfelder<br />
Für die Abiturprüfung ist es unerheblich, ob ein Fach im Rahmen des Profils oder außerhalb<br />
belegt wird. Durch das Zentralabitur müssen alle Prüfungskandidaten dieselben Aufgaben<br />
bearbeiten. Die Prüfungsthemen machen jedoch nur einen Teil der Unterrichtsinhalte aus.<br />
Aktuelle Informationen und weitere Hinweise sind auf der Homepage der <strong>Gyula</strong> <strong>Trebitsch</strong><br />
<strong>Schule</strong> <strong>Tonndorf</strong> (s.u.) vorhanden. Dort finden sich auch Links zu <strong>Schule</strong>n, mit denen bereits<br />
kooperiert wird und zu <strong>Schule</strong>n in erreichbarer Nähe.<br />
www.gyula-trebitsch-schule-tonndorf.de ( Vorstufe, gymnasiale Oberstufe)<br />
Kernfächer<br />
12 WST<br />
Profilbereich<br />
10 -12 WST<br />
2 Aufgabenfelder<br />
Weitere Pflichtfächer<br />
10 - 12 WST<br />
Hinweis zu den Bildungsplänen:<br />
Der Seminarkurs „Kommunikation und Medien“ ist eine Besonderheit der <strong>Gyula</strong> <strong>Trebitsch</strong><br />
<strong>Schule</strong> <strong>Tonndorf</strong>. Der dazu entwickelte Bildungsplan findet sich als Ergänzung zum Profil 3<br />
(s. S. 33).<br />
Die Bildungspläne aller weiteren Fächer sind zu finden unter:<br />
http://www.hamburg.de/bildungsplaene.<br />
5
Allgemeine Stundentafel mit Belegauflagen<br />
I. Kernfächer<br />
Fächer und Lernbereiche in den Aufgabenfeldern<br />
Deutsch<br />
Mathematik<br />
Fremdsprache<br />
Unterrichtsstunden insgesamt<br />
304 (4 SWS)<br />
304 (4 SWS)<br />
304 (4 SWS)<br />
II.<br />
Fächerverbund im<br />
Profilbereich<br />
Profilgebendes Fach/<br />
Profilgebende Fächer<br />
Begleitendes<br />
Unterrichtsfach/<br />
Begleitende Unterrichtsfächer<br />
608 bis 912 (8-12 SWS)<br />
ggf. Seminar<br />
152 (2 SWS)<br />
152 bis 456 (2 – 12 SWS)<br />
III.<br />
Weitere Fächer<br />
aus dem Pflichtund<br />
Wahlpflichtbereich,<br />
soweit diese nicht<br />
bereits unter II.<br />
unterrichtet werden<br />
Weitere Fächer aus dem mathematischnaturwissenschaftlich-technischen,<br />
dem<br />
gesellschaftswissenschaftlichen und/<br />
oder sprachlich-literarisch-künstlerischen<br />
Aufgabenfeld<br />
Sport<br />
jedoch mindestens 304 (4 SWS) in einem naturwissenschaftlich-technischen<br />
Fach oder mehreren naturwissenschaftlich-technischen<br />
Fächern sowie mindestens<br />
304 (4 SWS) in einem Fach oder mehreren<br />
Fächern aus dem gesellschaftswissenschaftlichen<br />
Aufgabenfeld, soweit diese nicht bereits unter II. unterrichtet<br />
werden<br />
152 (2 SWS)<br />
Kunst/Musik/Theater<br />
152 (2 SWS)<br />
SWS = Semesterwochenstunden<br />
Belegauflagen:<br />
Mindestens zwei der drei Kernfächer (Abschnitt I.) sind auf erhöhtem Anforderungsniveau zu belegen.<br />
Die weiteren Fächer (Abschnitt III.) sind im Rahmen des Angebots der <strong>Schule</strong> so zu wählen, dass die Schülerinnen und<br />
Schüler unter Berücksichtigung des gewählten Profilbereichs in folgenden Fächern unterrichtet werden:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Summe<br />
vier Semester in einem künstlerischen Fach,<br />
a) vier Semester im Fach Geschichte oder<br />
b) vier Semester im Fach PGW oder<br />
c) vier Semester im Fach Geographie,<br />
vier Semester in einem naturwissenschaftlichen Fach (nicht Informatik),<br />
vier Semester im Fach Religion oder Philosophie und<br />
vier Semester in Sport.<br />
Religion/Philosophie<br />
152 (2 SWS)<br />
2584 (34 SWS)<br />
6
Einbringungsverpflichtungen zur Abiturberechnung<br />
Block I<br />
beliebig viele Semesterergebnisse, mindestens aber 32, können eingebracht werden. Es darf auch das<br />
Ergebnis der besonderen Lernleistung eingebracht werden.<br />
alle Ergebnisse in den Kernfächern<br />
alle Ergebnisse in dem Profilfach, in dem eine Abiturprüfung abgelegt wurde<br />
alle Ergebnisse im mündlichen Prüfungsfach<br />
4 Semesterergebnisse in einem künstlerischen Fach<br />
4 Semesterergebnisse in einer Gesellschaftswissenschaft (nicht Religion/Philosophie)<br />
4 Semesterergebnisse in einer Naturwissenschaft (nicht Informatik)<br />
Doppelte Wertung von allen Semesterergebnissen in:<br />
- Profilfach, das geprüft wurde<br />
- 1 Kernfach auf erhöhtem Niveau, das geprüft wurde<br />
- 1 vierstündiges Fach nach Wahl des Schülers<br />
mindestens 200 Punkte müssen erreicht werden<br />
höchstens 20% der eingebrachten Semesterergebnisse dürfen mit weniger als 5 Punkten bewertet worden<br />
sein<br />
Block II<br />
die vier Prüfungsergebnisse werden 5fach gewichtet oder sie werden 4fach gewichtet, wenn das Ergebnis<br />
der Besonderen Lernleistung (4fach) in diesem Block eingebracht werden soll<br />
mindestens 100 Punkte müssen erreicht werden<br />
2 Prüfungsergebnisse, davon mindestens eines auf erhöhtem Niveau, müssen mit mindestens 5 Punkten<br />
der einfachen Wertung bewertet worden sein<br />
Bitte beachten Sie die konkreten Umsetzungen der Belegauflagen in den vier an der<br />
<strong>Gyula</strong> <strong>Trebitsch</strong> <strong>Schule</strong> <strong>Tonndorf</strong> angebotenen Profilen (S. 10, 18, 26 bzw. 36).<br />
Prüfungsfächer:<br />
Alle Schüler müssen in 4 Fächern eine Abiturprüfung ablegen. Hiervon sind drei schriftlich, die vierte ist eine<br />
mündliche Prüfung, die auch in Form einer Präsentation erfolgen kann. Bei der Auswahl der Prüfungsfächer<br />
müssen folgende Auflagen beachtet werden:<br />
Zwei Prüfungen stammen aus dem Kernfachbereich, mindestens eine davon muss auf erhöhtem Niveau<br />
schriftlich abgelegt werden.<br />
Das gewählte Profilfach ist ein (i.d. R. schriftliches) Prüfungsfach auf erhöhtem Niveau.<br />
Mit den vier Prüfungsfächern müssen die drei Aufgabenfelder (sprachlich-literarisch-künstlerisch:<br />
Deutsch, alle Fremdsprachen, Kunst, Musik; gesellschaftswissenschaftlich: Geschichte, Geografie, PGW,<br />
Religion, Philosophie; mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch: Mathematik, Biologie, Chemie, Physik,<br />
Informatik) abgedeckt werden.<br />
In den anderen Prüfungsfächern (neben Kern- und Profilfach auf erhöhtem Niveau) muss die Prüfung auf<br />
erhöhtem Anforderungsniveau erfolgen, wenn der Prüfling das jeweilige Fach während der Studienstufe<br />
auf erhöhtem Anforderungsniveau belegt hatte.<br />
Ein Schüler kann nur solche Fächer als Prüfungsfächer wählen, in denen er während des Schuljahres, das<br />
der Studienstufe vorausgeht, mindestens ein Schulhalbjahr lang und in der Studienstufe durchgehend unterrichtet<br />
wurde. Ausnahmen regelt die Schulleitung.<br />
Daraus ergeben sich die auf der folgenden Seite dargestellten Prüfungsfachkombinationen.<br />
7
Mögliche Prüfungsfachkombinationen:<br />
Profil 1 – Höher, schneller, weiter<br />
Bio, Deu, Eng, Ges (oder Geo, PGW, Rel, Phi)<br />
Bio, Deu, Mat, Ges (oder Geo, PGW, Rel, Phi)<br />
Bio, Eng, Mat, Ges (oder Geo, PGW, Rel, Phi)<br />
Profil 2 – Es gibt nur eine Erde<br />
Che, Deu, Eng, Geo (oder PGW, Rel, Phi)<br />
Che, Deu, Mat, Geo (oder PGW, Rel, Phi)<br />
Che, Eng, Mat, Geo (oder PGW, Rel, Phi)<br />
Geo, Deu, Mat, egal<br />
Geo, Eng, Mat, egal<br />
Geo, Deu, Eng, Che (oder Bio, Phy, Inf)<br />
Profil 3 – Kommunikationswelt<br />
PGW, Deu, Eng, Mat (oder Bio, Che, Phy)<br />
PGW, Deu, Mat, egal (nicht Inf)<br />
PGW, Eng, Mat, egal (nicht Inf)<br />
Profil 4 – Die Welt ist eine Bühne!<br />
Ges, Deu, Eng, Mat (oder Bio, Che, Phy, Inf)<br />
Ges, Deu, Mat, egal<br />
Ges, Eng, Mat, egal<br />
Stundenplanbeispiel Studienstufe:<br />
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag<br />
1 PGW<br />
Spanisch<br />
2<br />
3 Kernfach<br />
(z.B. Mathematik)<br />
4<br />
5 Kernfach<br />
(z.B. Deutsch)<br />
6<br />
Profilfächer<br />
(Biologie, Geografie,<br />
PGW, Geschichte)<br />
Profilfächer<br />
(Sport, Chemie,<br />
Informatik,<br />
Theater)<br />
Informatik<br />
Geschichte<br />
Kernfach<br />
(z.B. Mathematik)<br />
Kernfach<br />
(z.B. Englisch)<br />
Kernfach<br />
(z.B. Deutsch)<br />
Profilfächer<br />
(Sport, Chemie,<br />
Informatik,<br />
Theater)<br />
Profilfächer<br />
(Biologie, Geografie,<br />
PGW, Geschichte)<br />
Profilfächer<br />
(Geschichte,<br />
Biologie, Wirtschaft,<br />
Kunst)<br />
Physik,<br />
Chemie,<br />
Biologie<br />
Kernfach<br />
(z.B. Englisch)<br />
Kunst, Musik,<br />
Theater<br />
Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause<br />
7 Religion<br />
Philosophie<br />
8<br />
Kunst, Musik,<br />
Theater<br />
Seminare<br />
Geografie,<br />
Spanisch<br />
9 Sport<br />
Sport Sport Sport<br />
10<br />
8
Höher, schneller, weiter<br />
Grenzen definieren, erfahren, überschreiten<br />
4. Semester:<br />
Die Grenzen des Menschen<br />
3. Semester:<br />
Der Ideale Mensch<br />
2. Semester:<br />
Der gestaltende Mensch<br />
1. Semester:<br />
Der grenzenlose Mensch<br />
Neurobiologie und<br />
Selbstverständnis<br />
Evolution und<br />
Zukunftsfragen<br />
Ökologie und<br />
Nachhaltigkeit<br />
Molekulargenetik und<br />
Gentechnik<br />
Gesundheitskonzepte<br />
Olympische Spiele<br />
———————-<br />
Fitness<br />
Mannschaftssportarten<br />
Sport und Ökologie/<br />
Ökonomie<br />
Bewegungslehre<br />
———————-<br />
Leichtathletik<br />
Trainingslehre<br />
———————-<br />
Spiele der Welt<br />
Mannschaftssportarten<br />
Sport - Gesellschaft<br />
———————-<br />
Trendsportarten<br />
Nationalstaatsbildung<br />
und europäische<br />
Expansion<br />
Das 20. Jahrhundert im<br />
Spiegel der Weltkriege<br />
Die großen<br />
Revolutionen<br />
Die Welt nach 1945<br />
Seminar: Interdisziplinäres Arbeiten, gemeinsame Produkte<br />
* Profilgebendes Fach<br />
Höher, schneller, weiter<br />
Profil 1:<br />
Grenzen definieren, erfahren, überschreiten<br />
Kurzübersicht<br />
Biologie* Sport Geschichte<br />
Biologie* Sport Geschichte<br />
9
Höher, schneller, weiter<br />
Profil 1:<br />
Grenzen definieren, erfahren, überschreiten<br />
Stundentafel des Profils „Höher, schneller, weiter“ mit Belegauflagen<br />
Das Profil „Höher, schneller, weiter“<br />
Fächer und Lernbereiche in den<br />
Aufgabenfeldern<br />
Unterrichtsstunden<br />
insgesamt<br />
I.<br />
Kernfächer<br />
Deutsch<br />
Mathematik<br />
Englisch<br />
304 (4 SWS)<br />
304 (4 SWS)<br />
304 (4 SWS)<br />
II.<br />
Fächerverbund im Profilbereich<br />
Profilgebendes Fach: Biologie<br />
Begleitende Unterrichtsfächer:<br />
Sport<br />
Geschichte<br />
Seminar<br />
304 (4 SWS)<br />
304 (4 SWS)<br />
152 (2 SWS)<br />
152 (2 SWS)<br />
= 912 (12 SWS)<br />
* Kunst oder Musik oder DSP<br />
152 (2 SWS)<br />
* Religion oder Philosophie 152 (2 SWS)<br />
Weitere Fächer aus dem Pflicht- und<br />
Wahlpflichtbereich, soweit diese nicht<br />
bereits unter II. unterrichtet werden<br />
* Chemie oder Physik 152 (2 SWS)<br />
III.<br />
DSP (2)<br />
Geographie (2) / PGW (2) oder Spanisch (4)<br />
Informatik (2)<br />
* 2 x 152<br />
(2 x 2 SWS oder<br />
1 x 4 SWS)<br />
Summe * = verpflichtend mind. 2584<br />
(34 SWS)<br />
SWS = Semesterwochenstunden<br />
Mindestens zwei der drei Kernfächer (Abschnitt I.) sind auf erhöhtem Anforderungsniveau zu belegen.<br />
Prüfungsfächer: Der Prüfling wählt seine Prüfungsfächer so, dass unter ihnen zwei Kernfächer sind und die drei Aufgabenfelder<br />
(sprachlich-literarisch-künstlerisch: Deutsch, alle Fremdsprachen, Kunst, Musik; gesellschaftswissenschaftlich: Geschichte,<br />
Geografie, PGW, Religion, Philosophie; mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch: Mathematik, Biologie, Chemie,<br />
Physik, Informatik) abgedeckt werden. Er kann nur solche Fächer als Prüfungsfächer wählen, in denen er während des<br />
Schuljahres, das der Studienstufe vorausgeht, mindestens ein Schulhalbjahr und in der Studienstufe durchgehend unterrichtet<br />
wurde.<br />
Schriftlich wird im Profilbereich und in zwei weiteren Fächern, darunter mindestens ein Kernfach auf erhöhtem Niveau, geprüft.<br />
Mündlich wird in einem weiteren Fach geprüft (ggf. Präsentationsprüfung).<br />
Die Prüfung im Profilbereich orientiert sich am Fach Biologie. Die schriftliche Prüfung im Profilbereich und in mindestens einem<br />
Kernfach erfolgt auf erhöhtem Anforderungsniveau. In den anderen Fächern muss sie auf erhöhtem Anforderungsniveau<br />
erfolgen, wenn der Prüfling das Fach während der Studienstufe auf erhöhtem Anforderungsniveau belegt hatte.<br />
10
Höher, schneller, weiter<br />
Profil 1:<br />
Grenzen definieren, erfahren, überschreiten<br />
Beschreibung der Semesterinhalte<br />
Das Profil „Höher, schneller, weiter- Grenzen definieren, erfahren, überschreiten“ stellt den Menschen<br />
mit seinem Handeln in seinem gesellschaftlichen und ökologischen Umfeld in den Mittelpunkt der Betrachtung.<br />
Durch das Erfahren und Überschreiten von körperlichen, ökologischen und gesellschaftlichen<br />
Grenzen definiert der Mensch seine Sicht- und Denkweisen permanent neu. Die Fragen<br />
„Warum?“ und „Wie?“ es zu diesen ständigen Wandlungsprozessen kommt bzw. kam, werden unter<br />
historischen, natur- und bewegungswissenschaftlichen aktuellen und zukünftigen Gesichtspunkten<br />
untersucht und hinterfragt.<br />
Dabei bildet der Mensch in seiner Umgebung als sich entwickelndes Wesen den zentralen Ansatzpunkt<br />
dieses Erklärungsversuches. Eine ganzheitliche Betrachtung dieser Thematik wird durch die<br />
Verknüpfung der Fächer Biologie, Sport und Geschichte gewährleistet.<br />
1. Semester: Der grenzenlose Mensch<br />
In einer engen Verknüpfung mit den Inhalten des Faches Sport, wird im ersten Semester im Fach Biologie,<br />
ausgehend von anatomischen Betrachtungen des Menschen, der Aspekt der Leistungsphysiologie<br />
eingehend vertieft. Somit werden Grundlagen sportbiologischer Erkenntnisse vermittelt. Leistungsbestimmende<br />
Faktoren, wie das Herz-Kreislaufsystem, der Bewegungsapparat, neuronale Prozesse bei<br />
der Signalverarbeitung und die Energiebereitstellung unter aeroben und anaeroben Bedingungen werden<br />
eingehend untersucht. Fragestellungen bezüglich der Optimierung der Ausdauerfähigkeit im Zusammenhang<br />
mit den makro- und mikrobiologischen körperlichen Anpassungen werden in diesem<br />
Semester ebenso thematisiert, wie Sportverletzungen und ihre Therapie. Der Schüler erhält somit die<br />
Chance wichtige Faktoren zur Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit und zur Gesunderhaltung des<br />
eigenen Körpers zu erlernen. Darüber hinaus werden Materialentwicklung, Trainingsmethoden, bewusste<br />
Ernährung und neue Messmethoden im Bereich der angewandten Trainingswissenschaft zur<br />
Verbesserung des Leistungszustandes des Sportlers thematisiert.<br />
In der Neuzeit verschob sich der Bezugspunkt des Menschen. Die religiösen Vorstellungen des Mittelalters<br />
und der Frühen Neuzeit wichen mehr und mehr einem rationalen Denken. Es traten im wirtschaftlichen,<br />
sozialen und auch politischen Bereich im Leben der Menschen zahlreiche Änderungen ein. Diese<br />
Veränderungen fanden ihren Ausdruck in den großen Revolutionen, insbesondere der Französischen<br />
Revolution, die Thema dieses Semester sein sollen.<br />
Seminar - Im Seminar liegt das Augenmerk auf zwei Schwerpunkten. Zum einen soll eine Ski- und<br />
Snowboardexkursion mit den SuS geplant und organisiert werden. Diese Exkursion bereit das Thema<br />
des zweiten Semesters vor und deckt zugleich das Bewegungsfeld „Rollen und Gleiten“ ab. Zum anderen<br />
werden Methoden zur Präsentationsgestaltung (Zeitplanung/ Recherche/ PPP/ …) vertieft.<br />
2. Semester: Der gestaltende Mensch<br />
Der Mensch ist nicht nur in der Lage sich dem Lebensraum anzupassen, er ist auch in der Lage diesen<br />
für sich zu nutzen und sogar so zu gestalten, wie er ihn benötigt. Dies kann durchaus verheerende und<br />
nachhaltige Folgen für die Natur und den Menschen haben. Die Bildung einer eigenen kritischen Meinung<br />
zu dem Thema „Der Mensch als Gestalter seiner Umgebung“ soll ein Schwerpunkt des 2. Semesters<br />
sein. So werden im Biologieunterricht Wechselbeziehungen zwischen der belebten und unbelebten<br />
Umwelt erarbeitet. Neben Aspekten, wie Schutz der Artenvielfalt, Jäger-Beute-Beziehungen, nachhaltiger<br />
Umgang mit begrenzten Ressourcen, Schädlingsbekämpfung, Populationsdynamik und Begrenzungen<br />
durch abiotische Umweltfaktoren wird das Semester auch genutzt, um das erworbene<br />
Wissen im direkten Umgang mit der Natur anzuwenden. In Freilanduntersuchungen werden schulnahe<br />
Ökosysteme, wie z. B. die Wandse, Teiche in der Nähe, Grünflächen, renaturierte Areale auf ihre chemischen,<br />
physikalischen und biologischen Parameter erforscht. Dies schafft z.B. die Voraussetzungen,<br />
fundierte Urteile über die Auswirkungen des Sports auf aquatische oder terrestrische Ökosysteme zu<br />
fällen. Dabei wird unter anderem im Sportunterricht auch auf die Erfahrungen und Beobachtungen<br />
11
Höher, schneller, weiter<br />
Profil 1:<br />
Grenzen definieren, erfahren, überschreiten<br />
zurückgegriffen, die im 1. Semester während der Ski- und Snowboardexkursion gemacht worden sind.<br />
Eine zentrale Fragestellung könnte sein, ob es ethisch und ökologisch vertretbar ist, bestimmte Natur- oder<br />
Outdoorsportarten überhaupt zu betreiben.<br />
Die Herausbildung von Nationalstaaten, die das europäische Staatenverhältnis entscheidend prägten,<br />
und die Auswirkungen der Industrialisierung stehen im Mittelpunkt des zweiten Semesters. Hier sollen<br />
die historischen Voraussetzungen im europäischen Vergleich besprochen und die Vor- und Nachteile<br />
der Innovationen diskutiert werden.<br />
Seminar - umfassende Untersuchung eines schulnahen Biotops<br />
3. Semester: Der ideale Mensch<br />
Die Formulierung „ Der ideale Mensch“ entstammt aus einem utopischen Anspruch der Gesellschaft an<br />
das Individuum. Das Streben nach Perfektion, dauerhafter Gesundheit, ewiger Jugend, Schönheit und<br />
dem olympischen Leistungsgedanken „Höher, Schneller, Weiter“ kann den Menschen oft auch in<br />
selbstzerstörerische Situationen treiben. In diesem Semester werden in den Bereichen „ Sport und<br />
Gesundheit“ sowie „Die olympischen Spiele“ die Grenzen und Möglichkeiten aufgeführt. Wann und<br />
wie ist Sport gesund und wann fängt er an „ungesund“ zu werden. Welche Gesundheits- und Fitnesskonzepte<br />
gibt es?<br />
In der Biologie wird ein Bogen geschlagen von der Entdeckung erster genetischer Erkenntnisse über<br />
den Aufbau und die Funktion der DNA als Erbgutträger, bis hin zu gentechnischen Verfahren, die heute<br />
schon möglich, bzw. in der Zukunft verwirklicht werden könnten. Im Zusammenhang mit dem Semesterthema<br />
des Profils „der ideale Mensch“ stößt man immer wieder auf überschrittene ethische Grenzen,<br />
die es individuell zu definieren und zu bewerten gilt. Präimplantationsdiagnostik mit künftigen<br />
Katalogbabies, Supersportler, gentherapeutische Verfahren, aber auch die Eugenik des dritten Reiches<br />
werden vor diesem Hintergrund beleuchtet.<br />
Der Kriegsbegeisterung, die im Vorfeld des Ersten Weltkriegs festzustellen ist, folgt schließlich eine<br />
deutliche Ernüchterung. Dennoch kam es nur „wenig“ später erneut zu einem Weltkrieg. Welche Rahmenbedingungen,<br />
Ursachen und auslösenden Momente sind bedeutsam um diese Weltkriege zu verstehen?<br />
Seminar - Erstellen eines Lehrvideos und/oder Vorbereitung eines Orientierungslaufes für die 5. Klassen.<br />
4. Semester: Die Grenzen des Menschen<br />
Im 4. Semester werden im Biologieunterricht verschiedene Evolutiostheorien beleuchtet und die synthetische<br />
Evolutionstheorie, die auf den Erkenntnissen Charles Darwins beruht, vertiefend untersucht<br />
und Hinweise auf ihre Gültigkeit überprüft. Die Evolutionsforschung beantwortet die Frage, wie sich<br />
das Leben auf unserem Planeten entwickelt hat und welche Entwicklungen auf dem Weg zum Homo<br />
sapiens prägen.<br />
Im Sport wird im Theoriebereich der Schwerpunkt auf den Bereich „Sport und Gesellschaft- Soziales<br />
Handeln in einem sozialen Umfeld“ gelegt. Der Sport ist eine Kulturform der menschlichen Bewegungsfähigkeit,<br />
die sich abhängig von der Gesellschaft unterschiedlich entwickelt. Nicht nur der professionelle<br />
Spitzensport, sondern auch der gesellschaftliche Breitensport, hat sich zu einem mächtigen<br />
Wirtschafts- und Medienfaktor entwickelt. In diesem Semester werden viele Facetten, Möglichkeiten<br />
und Grenzen dieser „versportlichten Gesellschaft“ betrachtet. Im Sportpraktischen werden Trendsportarten<br />
vermittelt.<br />
Die sportlichen Auseinandersetzungen fanden ihre Entsprechung in der Politik, in der die Gegensätze<br />
zwischen Ost und West deutlich wurden. Betrachtet werden soll die Geschichte Deutschlands nach<br />
1945: vom Ende des 2. Weltkriegs zur Integration im vereinigten Europa.<br />
Seminar - Rekapitulation und Dokumentation der Profilarbeit und Prüfungsvorbereitung.<br />
12
Biologie (4) Sport (4) Geschichte (2) Seminar (2)<br />
Theorie (2) Praxis (2)<br />
Powerpoint<br />
Kulturelle,<br />
wirtschaftliche und soziale<br />
Wandlungsprozesse<br />
Spiele der Welt -<br />
historische Spielformen<br />
Allgemein:<br />
Molekulargenetik<br />
Höher, schneller, weiter<br />
Profil 1:<br />
Grenzen definieren, erfahren, überschreiten<br />
Detailübersicht<br />
1. Semester<br />
Bau und Replikation der<br />
DNA<br />
Proteinsynthese und<br />
genetischer Code<br />
Genetische Regulation<br />
Gentechnik<br />
PCR<br />
Künstlicher Gentransfer<br />
Gen- und Reproduktionstechnik<br />
in<br />
Medizin oder Landwirtschaft<br />
Chancen und Risiken der<br />
Planung und Organisation<br />
der Skiexkursion<br />
Sportbegriff und Bedeutung<br />
des Sports für die<br />
Gesellschaft und die<br />
eigene Person<br />
Angewandte<br />
Trainingslehre<br />
Sportbilogie—Anatomie<br />
Gen- und Reproduktionstechnik<br />
Muskelaufbau<br />
Verletzungen<br />
Muskelkontraktion<br />
Energiebereitstellung<br />
Gesetzmäßigkeiten und<br />
Prinzipien des Trainings<br />
Kulturkreise<br />
Trainingssteuerung<br />
Grundlagen der menschlichen<br />
Leistungsfähigkeit<br />
Spiele anderer<br />
Zeitmanagement<br />
Vorstellung eigener<br />
Neuzeit<br />
Spiele<br />
Mannschaftssportarten<br />
Übergang Mittelalter -<br />
Französische<br />
Revolution<br />
13
Biologie (4) Sport (4) Geschichte (2) Seminar (2)<br />
Theorie (2) Praxis (2)<br />
Durchführung der<br />
Ski-Exkursion<br />
Nationalstaatsbildung und<br />
europäische Expansion im<br />
19. Jahrhundert<br />
Ökologie<br />
Höher, schneller, weiter<br />
Profil 1:<br />
Grenzen definieren, erfahren, überschreiten<br />
Detailübersicht<br />
2. Semester<br />
Ökofaktoren, Angepasstheit,<br />
ökologische<br />
Nische<br />
Wachstum von Populationen<br />
Struktur eines Ökosystems<br />
Einfluss des Menschen<br />
auf ein Ökosystem<br />
Spannungsfeld „Sport<br />
Anthropogene Klimaveränderungen<br />
Sporttourismus<br />
Sportökologie<br />
und -ökonomie<br />
Nachhaltiges Wirtschaften<br />
(Agenda 21)<br />
Sport und Vereine<br />
und Umwelt“<br />
Bewegungsanalyse<br />
Bewegungslernen<br />
Biomechanik<br />
Videoanalyse<br />
Badminton<br />
Tennis<br />
Squash<br />
Bewegungslehre<br />
Fünf-Kampf<br />
Rückschlagsportarten<br />
Kulturbegriff<br />
Ursachen,<br />
Leichtathletik<br />
Auswirkungen auf die<br />
Umfassende<br />
Untersuchung eines schulnahen<br />
Biotops<br />
Vorbedingungen<br />
und Verlauf<br />
Gesellschaft<br />
14
Biologie (4) Sport (4) Geschichte (2) Seminar (2)<br />
Theorie (2) Praxis (2)<br />
Erstellen eines<br />
Lehrvideos<br />
Die Weltkriege<br />
Fitness und Fitnesstests<br />
Evolution<br />
Höher, schneller, weiter<br />
Profil 1:<br />
Grenzen definieren, erfahren, überschreiten<br />
Detailübersicht<br />
3. Semester<br />
Vergleich verschiedener<br />
Evolutionstheorien<br />
Gesundheitskonzepte<br />
Gesundheitsförderung<br />
Sport und Schönheit<br />
Sport und<br />
Gesundheit (= Fitness?)<br />
Evolutionsfaktoren<br />
Artbildung<br />
Menschheitsentwicklung<br />
Fair Play<br />
Olympische Erziehung<br />
Olympische Spiele<br />
Sport und Medien<br />
Sport und Politik<br />
Olympische Spiele und<br />
Kooperation<br />
Vorbereitung eines<br />
Orientierungslaufs für die<br />
5. Klassen<br />
Nationalsozialismus<br />
Fitnesscenter<br />
Rahmenbedingungen<br />
Ursachen und auslösende<br />
Momente<br />
Mannschaftssportarten<br />
Nationalsozialismus und<br />
Verfolgung<br />
Fair Play-Projekt mit den<br />
5./6. Klassen<br />
Auswirkungen und Aufarbeitung<br />
Das Ziel der Studienfahrt im 3. Semester orientiert sich an den Inhalten der Profilfächer.<br />
15
Biologie (4) Sport (4) Geschichte (2) Seminar (2)<br />
Theorie (2) Praxis (2)<br />
Rekapitulation und<br />
Dokumentation der<br />
Profilarbeit<br />
Modernisierungen in Wirtschaft<br />
und Gesellschaft<br />
nach 1945<br />
Neurobiologie<br />
Höher, schneller, weiter<br />
Profil 1:<br />
Grenzen definieren, erfahren, überschreiten<br />
Detailübersicht<br />
4. Semester<br />
Biomembran<br />
Erregungsleitung am<br />
Bau und Funktion von<br />
Axon<br />
Sport und Gewalt<br />
Sportpsychologie<br />
Sportvereine und<br />
Synapsen<br />
Sport und Wirtschaft<br />
Sportliches Handeln im<br />
sozialen Umfeld<br />
Neuronale Informationsverarbeitung<br />
Inliner<br />
Frisbee<br />
Fankulturen<br />
Neubeginn nach dem<br />
Trendsportarten<br />
Kalter Krieg in Sport,<br />
Prüfungsvorbereitung<br />
Europäische<br />
Zweiten Weltkrieg<br />
Politik, Wirtschaft und<br />
Gesellschaft<br />
Integration<br />
Entwicklung in ehemaligen<br />
Kolonien<br />
16
Es gibt nur eine Erde!<br />
Menschliches (globales) Handeln im Spannungsfeld<br />
zwischen Möglichkeiten, Gefahren und Verantwortung<br />
S4: Historische und aktuelle<br />
Entwicklungen - Probleme<br />
menschlichen Handelns<br />
S3: Evolutionäre und technische<br />
Entwicklung des Menschen<br />
S2: Die nachhaltige Nutzung<br />
globaler Ressourcen<br />
S1: Energieträger und<br />
Stoffkreisläufe<br />
Energetik<br />
Klimawandel<br />
Speicherung und<br />
Nutzung<br />
chemischer Energie<br />
Farbe und Färben<br />
Kohlenhydrat- und<br />
Proteinchemie<br />
Tensidchemie<br />
Klimawandel<br />
Aufbau, Nutzung und<br />
Veränderung von<br />
Geoökosystemen<br />
Räumliche Disparitäten<br />
Stadtentwicklung<br />
Welternährungsproblematik<br />
Energiebereitstellung in<br />
der Zelle<br />
System Erde<br />
Genetik<br />
Evolution<br />
Ökologie<br />
Zelluläre Werkzeuge<br />
Seminar: Interdisziplinäres Arbeiten, Methodenlernen,<br />
Wettbewerbe und Exkursionen<br />
* Profilgebendes Fach<br />
Profil 2: Es gibt nur eine Erde!<br />
Menschliches (globales) Handeln im Spannungsfeld zwischen<br />
Möglichkeiten, Gefahren und Verantwortung<br />
Kurzübersicht<br />
Chemie* Geografie* Biologie<br />
Chemie* Geografie* Biologie<br />
17
Profil 2: Es gibt nur eine Erde!<br />
Stundentafel des Profils „Es gibt nur eine Erde“ mit Belegauflagen<br />
Das Profil „Es gibt nur eine Erde“<br />
Fächer und Lernbereiche in den<br />
Aufgabenfeldern<br />
Unterrichtsstunden<br />
insgesamt<br />
I.<br />
Kernfächer<br />
Deutsch<br />
Mathematik<br />
Englisch<br />
304 (4 SWS)<br />
304 (4 SWS)<br />
304 (4 SWS)<br />
Profilgebendes Fach: Chemie<br />
Profilgebendes Fach: Geografie<br />
304 (4 SWS)<br />
304 (4 SWS)<br />
II.<br />
Fächerverbund im Profilbereich<br />
Begleitende Unterrichtsfächer:<br />
Biologie<br />
Seminar<br />
152 (2 SWS)<br />
152 (2 SWS)<br />
= 912 (12 SWS)<br />
* Kunst oder Musik oder DSP 152 (2 SWS)<br />
III.<br />
Weitere Fächer aus dem Pflicht- und<br />
Wahlpflichtbereich, soweit diese nicht<br />
bereits unter II. unterrichtet werden<br />
* Religion oder Philosophie 152 (2 SWS)<br />
* Sport 152 (2 SWS)<br />
DSP (2)<br />
Physik (2)<br />
PGW (2) oder Spanisch (4)<br />
Geschichte (2) oder Informatik (2)<br />
* 2 x 152<br />
(2 x 2 SWS oder<br />
1 x 4 SWS)<br />
Summe * = verpflichtend mind. 2584<br />
(34 SWS)<br />
SWS = Semesterwochenstunden<br />
Mindestens zwei der drei Kernfächer (Abschnitt I.) sind auf erhöhtem Anforderungsniveau zu belegen.<br />
Prüfungsfächer: Der Prüfling wählt seine Prüfungsfächer so, dass unter ihnen zwei Kernfächer sind und die drei Aufgabenfelder<br />
(sprachlich-literarisch-künstlerisch: Deutsch, alle Fremdsprachen, Kunst, Musik; gesellschaftswissenschaftlich: Geschichte,<br />
Geografie, PGW, Religion, Philosophie; mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch: Mathematik, Biologie, Chemie,<br />
Physik, Informatik) abgedeckt werden. Er kann nur solche Fächer als Prüfungsfächer wählen, in denen er während des<br />
Schuljahres, das der Studienstufe vorausgeht, mindestens ein Schulhalbjahr und in der Studienstufe durchgehend unterrichtet<br />
wurde.<br />
Schriftlich wird im Profilbereich und in zwei weiteren Fächern, darunter mindestens ein Kernfach auf erhöhtem Niveau, geprüft.<br />
Mündlich wird in einem weiteren Fach geprüft (ggf. Präsentationsprüfung).<br />
Die Prüfung im Profilbereich orientiert sich am Fach Chemie oder Geografie. Die schriftliche Prüfung im Profilbereich und in<br />
mindestens einem Kernfach erfolgt auf erhöhtem Anforderungsniveau. In den anderen Fächern muss sie auf erhöhtem Anforderungsniveau<br />
erfolgen, wenn der Prüfling das Fach während der Studienstufe auf erhöhtem Anforderungsniveau belegt hatte.<br />
18
Profil 2: Es gibt nur eine Erde!<br />
Beschreibung der Semesterinhalte<br />
1. Semester: Energieträger, Stoffkreisläufe und Geoökosysteme<br />
Ausgehend von den Kenntnissen und Fähigkeiten, die in der Vorstufe (Klassenstufe 10) über die Organische<br />
Chemie erworben worden sind, wird im 1. Semester der Studienstufe das Thema Kohlenhydratchemie<br />
als Schwer-punkt bearbeitet. Damit wird den Vorgaben für das Zentralabitur im Fach<br />
Chemie Rechnung getragen.<br />
Bei den Stoffumwandlungen im pflanzlichen und tierischen Organismus kommt den Kohlenhydraten<br />
die zentrale Rolle zu. Dabei steht das Monosaccharid Glucose im Mittelpunkt des Unterrichts, da<br />
aus diesem Zucker physiologisch bedeutsame Di-, Oligo- und Polysaccharide aufgebaut werden.<br />
Die mit der Zuckerchemie verbundene Stoffwechselerkrankungen (z.B. Diabetes mellitus) sowie<br />
Grundfragen zu einer gesundheitsbewussten Ernährung werden in die Unterrichtsstruktur eingebunden.<br />
Im Einzelnen werden folgende Themen inhaltlich bearbeitet:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Struktureller Aufbau der Glucose unter Berücksichtigung von Konfiguration/Konformation und optischer<br />
Aktivität.<br />
Trimeres Gleichgewicht der D-(+)-Glucose mit den a- und ß-Glucopyranosen.<br />
Struktur, Eigenschaften und chemische Umsetzungen des Monosaccharids Fructose<br />
Die Disaccharide Maltose, Lactose und Saccharose als stoffliche Energieträger<br />
Glycogen und Stärke als tierische und pflanzliche Reservestoffe.<br />
Cellulose als pflanzlicher und Chitin als tierischer Gerüststoff.<br />
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) als Stoffwechselerkrankung in einer Wohlstandsgesellschaft.<br />
Kohlenhydrate, Proteine und Fette als Bausteine einer gesundheitsbewussten Ernährung unter Berücksichtigung<br />
der Bedeutung von Vitaminen und Mineralstoffen<br />
In das Themengebiet Kohlenhydrate wird das Basiskonzept 1 "Gleichgewichtslehre" thematisch eingebunden.<br />
Im Regelfall wird im Zusammenhang mit der Chemie der Disaccharide eine Exkursion zur Nordzucker<br />
AG nach Uelzen angeboten.<br />
Aufbauend auf Kenntnisse der Sekundarstufe I erarbeiten sich die Schüler vertiefende Einblicke in<br />
verschiedene Geoökozonen und lernen diese als komplexe Ökosysteme kennen, deren Kreisläufe<br />
und anthropogene Einflüsse in einen engen Kontext zueinander stehen. An ausgewählten Raumbeispielen<br />
werden die naturräumliche Ausstattung und Nutzungskonflikte durch den wirtschaftenden<br />
Menschen in Beziehung gesetzt. Vertiefend werden in diesem Semester klimatische Zusammenhänge<br />
und Veränderungen untersucht sowie deren Auswirkungen auf Geoökosysteme wie z.B. den tropischen<br />
Regenwald oder die Weltmeere.<br />
Aminosäuren, Peptide und Proteine sind einerseits selber in die Stoffwechselprozesse der Organismen<br />
eingebunden, bilden andererseits den notwendigen stofflichen Rahmen, in dem physiologische<br />
Vorgänge ablaufen können. Wie werden Peptide und Proteine hergestellt? Was sind Mutationen?<br />
Inwieweit beeinflusst Gentechnik unseren Alltag?<br />
Diese und andere Fragen werden zentrale Rolle im Biologieunterricht des ersten Semesters spielen.<br />
2. Semester: Die Stadt als Entwicklungsraum<br />
Die natürlichen Ressourcen auf dem Planeten Erde sind begrenzt. Dies drückt sich insbesondere in<br />
den ständig steigenden Rohstoffpreisen für fossile Energieträger aus. Insofern ist ein nachhaltiges<br />
Wirtschaften mit den vorhandenen Rohstoffen oberstes Gebot, um die ökonomische und ökologi-<br />
19
Profil 2: Es gibt nur eine Erde!<br />
sche Grundlage für menschliches Leben auf diesem Planeten zu sichern. Dabei ist von besonderer<br />
Bedeutung, dass moderne effiziente und regenerative Technologien entwickelt werden, über die die<br />
Versorgung mit Energie nach dem Ausfall der fossilen Energieträger sichergestellt werden kann.<br />
Im 2. Semester der Studienstufe werden traditionelle und moderne Methoden der Energieerzeugung<br />
unter dem Gesichtspunkt der nachhaltigen Nutzung globaler Ressourcen intensiv beleuchtet.<br />
Die Schüler erhalten einen Überblick über die Möglichkeiten der Energiegewinnung, der begrenzenden<br />
Faktoren sowie der mit den Technologien verbundenen Risiken, so dass ein verantwortliches<br />
Handeln in unserer Umwelt erreicht werden kann.<br />
Einleitend in das Semester werden über die Fragestellung "Warum laufen chemische Reaktionen<br />
ab?" zentrale Grundlagen der Energetik und Thermodynamik erarbeitet. Als Triebfedern für chemische<br />
Reaktionen werden das Streben nach Energieminimum und Entropiemaximum experimentell<br />
hergeleitet. Die grundlegende Beziehung nach Gibbs-Helmholtz verknüpft beide Triebfedern und<br />
wird als zentrale Beziehung quantitativ und qualitativ bearbeitet.<br />
Die kinetische Hemmung chemischer Reaktionen eröffnet die Möglichkeit, aus ener-getischer Sicht<br />
auf die Wirkung von Katalysatoren und Enzymen einzugehen.<br />
Im Einzelnen werden folgende Themen inhaltlich bearbeitet:<br />
Reaktionsenthalpie und "Prinzip des Energieminimums".<br />
Entropiebegriff, Reaktionsentropie und "Prinzip des Entropiemaxi-mums".<br />
Beziehung nach Gibbs-Helmholtz als die Verknüpfung der universellen Triebkräfte.<br />
Kinetische Hemmung und energetische Wirkung von Katalysatoren.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Nutzung fossiler Energieträger (Kohle, Erdöl, Erdgas etc.)<br />
Elektrochemische Energiegewinnung<br />
Redoxreaktionen und elektrochemische Spannungsreihe<br />
Galvanische Elemente incl. Nernstscher Gleichung<br />
Elektrolyse<br />
Akkumulatoren<br />
Betrachtung elektrochemischer Vorgänge aus thermodynamischer Sicht<br />
Moderne Technologien<br />
Brennstoffzellentechnolgie<br />
Photovoltaik<br />
Weitere regenerative Energieträger (z.B. Wind- und Wasser-kraft, Biokraftstoffe etc.)<br />
Mobilität im 21. Jahrhundert – technologische Konzepte für eine nachhaltige Nutzung<br />
Im Rahmen dieses Semesterthemas sind begleitende Informationsveranstaltungen über die Initiative<br />
Nat und die Körber Stiftung zur energiepolitischen Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland<br />
vorgesehen.<br />
Verstädterungsprozesse nehmen weltweit zu. Global gesehen lebt über die Hälfte der Weltbevölkerung<br />
in Städten. Diese Veränderungen haben Auswirkungen auf unsere Umwelt, Kommunikationsformen<br />
und den Alltag eines jeden Menschen. Daher stehen historische Entwicklungen ebenso im<br />
Blickpunkt wie die Untersuchung von räumlichen, sozialen und funktionalen Gliederungen von Städten<br />
und die Betrachtung urbaner Räume, wobei auch verschiedene kulturgenetische Stadttypen<br />
betrachtet werden. Die Metropolregion Hamburg bietet zahlreiche Möglichkeiten, modellhafte Annahmen<br />
durch eigene stadtgeographische Untersuchungen zu analysieren.<br />
Mehrere Lebensräume sowie die gesamten Ökosysteme sind in der heutigen Zeit zahlreichen Belastungen<br />
(globale Erwärmung, Verschmutzung) ausgesetzt. Insofern ist es für die gesamte Menschheit<br />
von zentraler Bedeutung, dass Ökosysteme der Erde sowohl genau untersucht als auch nachhaltig<br />
genutzt werden, so dass auch für kommende Generationen die genetische Vielfalt erhalten bleibt.<br />
20
Profil 2: Es gibt nur eine Erde!<br />
3. Semester: Evolutionäre und technische Entwicklung<br />
des Menschen an ausgewählten Beispielen<br />
Aus der Betrachtung der Lebewesen untereinander und zur jeweiligen unbelebten Natur wird deutlich,<br />
dass auch der Mensch Teil der Biosphäre ist und seine Existenz auf der Existenz anderer Lebewesen<br />
und der unbelebten Natur aufbaut.<br />
Aus chemischen Erkenntnissen abgeleitete technische Anwendungen sind Bestandteil des täglichen<br />
Lebens und führen zur Verbesserung der Lebensqualität. Dies führt zu Daseinserleichterungen auf<br />
der einen und zu vielfältigen Gefährdungen der Biosphäre auf der anderen Seite.<br />
Im 3. Semester der Studienstufe sollen Vor- und Nachteile des wissenschaftlichen Fortschritts erkannt<br />
und kritisch gegeneinander abgewogen werden. Um zu einem eigenen Standpunkt zu finden,<br />
ist sowohl die Kenntnis chemischer Zusammenhänge als auch das Wissen um die ökologischen, ökonomischen,<br />
sozialen und globalen Auswirkungen von Bedeutung. Durch die Berücksichtigung von<br />
Alltag-, Technik-, Umwelt- und Forschungsaspekten wird am Beispiel der Kunststoffchemie die Kritikfähigkeit<br />
der Lernenden im Hinblick auf eine Beurteilung der Anwendung chemischer Erkenntnisse<br />
gefördert.<br />
In den vergangenen Jahrzehnten hat die Entwicklung synthetischer Makromoleküle (Kunststoffe)<br />
eine außerordentliche Dynamik erfahren. Synthetische Polymere haben industrielle Prozesse und<br />
unsere täglichen Umwelt maßgeblich durchdrungen. Da zahlreiche Kunststoffe nach wie vor auf der<br />
Basis fossiler Rohstoffe (Erdöl) gewonnen werden, stellt sich zunehmend die Frage nach Alternativen<br />
bzw. nach einem ökologisch und ökonomisch durchführbaren Recycling.<br />
Im Einzelnen werden folgende Themen inhaltlich bearbeitet:<br />
Veredelte Naturstoffe am Beispiel Gummi<br />
Reaktionsprinzipien zur Herstellung von synthetischen Makromolekülen<br />
Radikalische, kationische und anionische Polymerisationen an ausgewählten Beispielen (z.B.<br />
Polystyrol)<br />
Polymerisationsreaktionen an ausgewählten Beispielen (z.B. Nylonsynthese)<br />
Polyadditionsreaktionen an ausgewählten Beispielen (z.B. Synthese eines Polyurethanschaumes)<br />
Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften von Polymeren<br />
Thermoplaste in Fadenstruktur<br />
Duromere in Raum-Netz-Struktur<br />
Elastomere in variabler Raum-Netz-Struktur<br />
Recycling von Kunststoffen (z.B. Pyrolyse)<br />
Kunststoffe als Substitute für traditionelle Werkstoffe (Eisen, Stahl, Keramik)<br />
In die Semesterinhalte wird eine Exkursion zu einem kunststofferzeugenden (z.B. BASF Brunsbüttel)<br />
oder einem kunststoffverarbeitenden Unternehmen eingebunden.<br />
Über das Fach Geografie wird der Blick auf globale Zusammenhänge geöffnet. Traditionelle und moderne<br />
Methoden in der Landwirtschaft stehen in einer globalisierten Welt nebeneinander. Chancen<br />
und Risiken werden sorgsam abgewogen werden müssen, um die Ernährung der Menschheit für die<br />
folgenden Generationen zu verbessern.<br />
Aus der Betrachtung der Lebewesen untereinander und zur jeweiligen unbelebten Natur wird deutlich,<br />
dass auch der Mensch Teil der Biosphäre ist und seine Existenz auf der Existenz anderer Lebewesen<br />
und der unbelebten Natur aufbaut.<br />
Die Evolution des Lebens ist die zentrale Themenstellung im Fach Biologie.<br />
21
Profil 2: Es gibt nur eine Erde!<br />
4. Semester: Historische und aktuelle Entwicklungen - Probleme menschlichen Handelns<br />
Zentraler Unterrichtsgegenstand im 4. Semester der Studienstufe ist die globale Klimaerwärmung.<br />
Aus biologischer, chemischer und geografischer Sicht sollen die Ursachen und Auswirkungen<br />
dieser Problematik ausführlich beleuchtet werden. Dabei werden die bestehenden multilateralen<br />
Abkommen (z.B. Kyoto-Protokoll) analysiert und die Beiträge untersucht, die die modernen<br />
Naturwissenschaften zur Eingrenzung dieses Problems anbieten können. Es ist jedoch<br />
auch zu fragen, über welche konkreten Maßnahmen der einzelne Bürger dazu beitragen kann,<br />
um dieser globalen Gefährdung zu begegnen.<br />
In Anlehnung an das 2 und 3. Semester sollen die Lernenden historische wie auch aktuelle chemische<br />
Fragestellungen von Umweltaspekten am Beispiel der Körperhygiene kennen lernen anhand<br />
derer die sinnstiftenden Beiträge der Chemie einsichtig werden. Auch hier geht es darum, sowohl<br />
den Nutzen dieses Einsatzes als auch die Probleme (Rohstoffe, Gewässerbelastung, Energieverbrauch,<br />
Klimaveränderung) zu verdeutlichen.<br />
Grundlegende Basiskonzepte wie das chemische Gleichgewicht, Säure-Base-Reaktionen und Modelle<br />
chemischer Bindung werden in das Themengebiet einbezogen.<br />
Im Einzelnen werden folgende Themen inhaltlich bearbeitet:<br />
Fette und Derivate<br />
Seifen und Tenside<br />
Grenzflächenaktivität<br />
Oberflächenspannung<br />
Benetzungs-, Emulgier- und Dispergierfähigkeit<br />
Micellenbildung<br />
synthetische Tenside<br />
Vollwaschmittel<br />
Enzymwirkung in Vollwaschmitteln<br />
Umweltaspekte<br />
Detergenziengesetz<br />
Eutrophierung<br />
Phosphatersatzstoffe<br />
In das Themengebiet werden zwei Exkursionen zum Klimahaus Bremerhaven und zu einem mittelständischen<br />
Erzeuger von Seifen und Tensiden eingebunden.<br />
Die Raumwirksamkeit globaler Zusammenhänge, die Bewertung problemlösender Handlungsansätze<br />
und das Denken in virtuellen und realen Zusammenhängen befähigen die Schülerinnen<br />
und Schüler komplexe Wirkungsgefüge zu durchdringen und sich in diesen zu orientieren. Anhand<br />
der gelernten Methoden der vorangegangenen Semester werden die Schülerinnen und<br />
Schüler gezielt auf die Abiturprüfungen vorbereitet.<br />
Vor ca. 150 000 Jahren traten in Afrika die ersten modernen Menschen auf: Homo sapiens. Sie breiteten<br />
sich schnell weltweit nach dem Ende der Eiszeit auch in nördliche Regionen aus. Alle Menschen<br />
heute gehören zu dieser Spezies. Das zentrale Thema im Fach Biologie ist die Evolution des<br />
Menschen.<br />
22
Chemie (4) Geografie (4) Biologie (2) Seminar (2)<br />
Molekulare Genetik<br />
Grundlagen der Geographie<br />
Kohlenhydrate<br />
Glucuse und die sich von ihr<br />
ableitenden Derivate als<br />
molekulare Konzepte der<br />
Energiegewinnung und -<br />
speicherung<br />
Mögliche Gesamtexkursionen<br />
über alle Fächer am<br />
Projekttag:<br />
(z.B. Aufbau der Geosphäre<br />
und Bearbeitung der einzelnen<br />
Sphären)<br />
Speicherung und Abruf der<br />
Erbinformation<br />
Veränderung der Erbinformationen<br />
Einbau fremder Gene in Lebewesen<br />
(Gentechnologie)<br />
Mögliche Themen:<br />
Chemie der Monosaccharide<br />
Glucose und Fructose<br />
BRD(Raffinerien, Tidekraftwerk,<br />
Bohrplattformen,<br />
Forschungszentren)<br />
Chemie wichtiger Disaccharide<br />
Die Chemie der Polysaccaride<br />
Stärke, Glycogen, Cellulose<br />
und Chitin<br />
Kohlenhydrate als zentrale<br />
Bausteine der Ernährung<br />
Profil 2: Es gibt nur eine Erde!<br />
Detailübersicht<br />
1. Semester<br />
Versiegt der Golfstrom<br />
Palmen am Elbstrand:<br />
Ist der tropische Regenwald<br />
noch zu retten?<br />
Deponie Georgswerder<br />
Helgoland<br />
Brauereien<br />
Energiekonzerne der<br />
Ist nachhaltiges Wirtschaften<br />
möglich?<br />
Nordzucker AG<br />
oder trinken wir bald<br />
Wein aus Norwegen?<br />
Einführung in das wissenschaftliche<br />
Arbeiten<br />
Traum oder Horrorszenario?<br />
Möglichkeit zur Erstellung<br />
einer „Besonderen Lernleistung“<br />
(BLL), Facharbeiten<br />
(FA) oder der Teilnahme an<br />
geeigneten Wettbewerben.<br />
Übungen zu Präsentationen<br />
und zur Vorbereitung der<br />
Präsentationsprüfung<br />
23
Chemie (4) Geografie (4) Biologie (2) Seminar (2)<br />
System Erde<br />
Städte im Wandel der Zeit<br />
Thermodynamik und<br />
Energetik<br />
„Warum und wie laufen<br />
biochemische und physikalische<br />
Vorgänge in unserer<br />
Umwelt ab?“<br />
Mögliche Gesamtexkursionen<br />
über alle Fächer am<br />
Projekttag:<br />
Ökosysteme und Stoffkreisläufe<br />
Entwicklung und nachhaltige<br />
Nutzung von Ökosystemen<br />
(Nahrungsketten,<br />
Schädlingsbekämpfung)<br />
Einfluss der Umweltfaktoren<br />
auf Lebewesen<br />
Andere Länder – andere<br />
Städte?<br />
Wie sieht die Stadt von morgen<br />
aus?<br />
GKSS und Wasserstoffbus<br />
<strong>Tonndorf</strong> oder Hafencity<br />
(soziale und funktionale<br />
Räume)?<br />
Am Scheideweg<br />
Fossile Energieträger und<br />
regenerative Energiequellen<br />
Zentrum<br />
Wechselbeziehungen bei<br />
Lebewesen<br />
Ersticken wir an unserem<br />
Müll? Probleme und Tendenzen<br />
der Ver- und Entsorgung<br />
von Metropolen<br />
Speicherung und Nutzung<br />
chemischer Energie<br />
Aufbau, Funktion und Wirkungsweisen<br />
von galvanischen<br />
Elementen, Akkumulatoren<br />
und Brennstoffzellen<br />
Benz® Berufsorientierung<br />
Lernen vor Ort: Hafencity,<br />
Steilshoop, Entwicklungsachsen,<br />
Industrie, Städteplanung,<br />
Quartiere<br />
Regelung der Populationsdichte<br />
Nachhaltige Nutzung<br />
Energieeffizienz, Recycling<br />
und „Grüne Chemie“<br />
Profil 2: Es gibt nur eine Erde!<br />
Detailübersicht<br />
2. Semester<br />
Feinde, Konkurrenten,<br />
Symbioten und Parasiten<br />
Übungen zu Präsentationen<br />
und zur Vorbereitung der<br />
Präsentationsprüfung<br />
Kiel: Meeresbiologisches<br />
Studienfahrt: Mercedes<br />
24
Chemie (4) Geografie (4) Biologie (2) Seminar (2)<br />
Die Entwicklung des Lebens<br />
Globale Disparitäten<br />
Die Chemie veredelter<br />
Polymere am Beispiel<br />
Gummi<br />
Mögliche Gesamtexkursionen<br />
über alle Fächer am<br />
Projekttag:<br />
Belege für die Evolution von<br />
Pflanzen, Tieren und Menschen<br />
Erste und Dritte Welt -<br />
Analyse eines unlösbaren<br />
Konflikts?<br />
Synthese, Aufbau und Eigenschaften<br />
von Polymerisaten<br />
Ursachen der Evolution<br />
Landwirtschaft in den Entwicklungsländern<br />
Chancen, Probleme und<br />
Risiken<br />
Die synthetische Theorie<br />
der Evolution<br />
Synthese, Aufbau und Eigenschaften<br />
von Polymeren<br />
auf der Basis von Polykondensationen<br />
Bodenkundliche Lehrpfade<br />
Exkurs: Anbau, Nutzung und<br />
Vermarktung von Faser- und<br />
Farbstoffen<br />
Polyaddukte am Beispiel<br />
von Polyurethanen und Expoxidharzen<br />
Übungen zu Präsentationen<br />
und zur Vorbereitung der<br />
Präsentationsprüfung<br />
Entwicklung – theoretisch<br />
möglich?<br />
Sollen Entwicklungsländer<br />
die gleichen Fehler machen<br />
dürfen wie wir?<br />
Entwicklungsländer auf der<br />
Überholspur<br />
Armut – Hunger – Perspektivlosigkeit<br />
= Flucht?<br />
Kunststoffe als Substitute<br />
für traditionelle Werkstoffe<br />
Profil 2: Es gibt nur eine Erde!<br />
Detailübersicht<br />
3. Semester<br />
BASF Brunsbüttel<br />
Grube Messel (Fossilien)<br />
Das Ziel der Studienfahrt im 3. Semester orientiert sich an den Inhalten der Profilfächer.<br />
25
Chemie (4) Geografie (4) Biologie (2) Seminar (2)<br />
Die Evolution des Menschen<br />
Die Entwicklung der Menschenaffen<br />
und des Menschen<br />
Wege der Hominisation<br />
Merkmale der Evolution<br />
(Schädel, der aufrechte<br />
Gang)<br />
Klimawandel und Kohlenstoffdioxid-Problematik<br />
Chemie der Fette<br />
Aufbau und Eigenschaften<br />
dieser Stoffklasse<br />
Mögliche Gesamtexkursionen<br />
über alle Fächer am<br />
Projekttag:<br />
Bevölkerungsentwicklung<br />
und Welternährung<br />
Chemie der Seifen<br />
Synthese und Eigenschaften<br />
der Seifen unter dem Blickwinkel<br />
grenzflächenaktiver<br />
Verbindungen<br />
Geomatikum<br />
Lokale Agenda:<br />
Nach mir die Sintflut?<br />
Chemie der Tenside<br />
Synthese ausgewählter<br />
waschaktiver Substanzen<br />
und Analyse der Waschwirkung<br />
Übungen zu Präsentationen<br />
und zur Vorbereitung der<br />
Präsentationsprüfung<br />
Nachhaltiges Handeln<br />
Z.B. Eutrophierung und Detergentiengesetz<br />
Profil 2: Es gibt nur eine Erde!<br />
Detailübersicht<br />
4. Semester<br />
Klimazentrum<br />
Seifensiederei<br />
Klimahaus Bremerhaven<br />
26
Kommunikationswelt -<br />
Weltkommunikation<br />
Chancen und Risiken der medialen Vernetzung von Gesellschaft,<br />
Wirtschaft, Politik und Kultur<br />
S1: Die Kommunikationsgesellschaft zwischen<br />
permanenter Vernetzung und sozialer<br />
Vereinsamung<br />
S2: Demokratie in der<br />
Mediengesellschaft<br />
S4: Internationale Konflikte und länderübergreifende<br />
Kommunikation<br />
S3: Wirtschaft im Zeitalter der<br />
Globalisierung – Chancen und Risiken<br />
Politik und<br />
demokratisches<br />
System<br />
Wirtschaftssystem und<br />
Wirtschaftspolitik<br />
Globale Probleme /<br />
Internationale Politik<br />
Gesellschaft und<br />
Gesellschaftspolitik<br />
Objektorientierte<br />
Modellierung und Programmiersprache<br />
Möglichkeiten und<br />
Grenzen von<br />
Informationssystemen<br />
Simulation<br />
Verteilte Systeme<br />
Internationale Wirtschaftsbeziehungen<br />
und<br />
Europa<br />
Grundfragen der Ökonomie<br />
und der Markt als<br />
Aktionsfeld<br />
Das private Unternehmen –<br />
ökonomisches und soziales<br />
Aktionszentrum im Wandel<br />
Wirtschaftspolitik als ordnende<br />
Gestaltungsaufgabe<br />
Kreative Arbeit in den<br />
Medien oder in der<br />
„Kulturindustrie“<br />
Professionelle Kommunikationskonzepte<br />
Grundlagen, Funktion der<br />
Medien<br />
Werbung und Propaganda<br />
Interdisziplinäres Arbeiten, das in die Erstellung gemeinsamer Produkte mündet:<br />
Schulprojekte/Schulaktivitäten werden journalistisch begleitet<br />
Spielfilmprojekt<br />
Eigenständige Entwicklung von Werbung (Anzeigen, Flyer, Fernsehspots - Veröffentlichung via Homepage der <strong>Schule</strong>)<br />
Einblicke in Kommunikation & Medien als Studiengang, Kooperation mit dem Ausbildungssender TIDE.<br />
* Profilgebendes Fach<br />
Profil 3: Kommunikationswelt - Weltkommunikation<br />
Kurzübersicht<br />
PGW* Informatik Wirtschaft Seminarkurs<br />
PGW* Informatik Wirtschaft Seminarkurs<br />
27
Profil 3: Kommunikationswelt - Weltkommunikation<br />
Stundentafel des Profils „Kommunikationswelt - Weltkommunikation“ mit Belegauflagen<br />
Das Profil „Kommunikationswelt - Weltkommunikation“<br />
Fächer und Lernbereiche in den<br />
Aufgabenfeldern<br />
Unterrichtsstunden<br />
insgesamt<br />
I.<br />
Kernfächer<br />
Deutsch<br />
Mathematik<br />
Englisch<br />
304 (4 SWS)<br />
304 (4 SWS)<br />
304 (4 SWS)<br />
Profilgebendes Fach: PGW<br />
304 (4 SWS)<br />
II.<br />
Fächerverbund im Profilbereich<br />
Begleitende Unterrichtsfächer:<br />
Informatik<br />
Wirtschaft<br />
Seminar<br />
(Kommunikation und Medien)<br />
304 (4 SWS)<br />
152 (2 SWS)<br />
152 (2 SWS)<br />
= 912 (12 SWS)<br />
* Kunst oder Musik oder DSP 152 (2 SWS)<br />
* Religion oder Philosophie 152 (2 SWS)<br />
Weitere Fächer aus dem Pflicht- und<br />
Wahlpflichtbereich, soweit diese nicht<br />
bereits unter II. unterrichtet werden<br />
* Sport 152 (2 SWS)<br />
* Chemie (2) oder Physik (2) 152 (2 SWS)<br />
III.<br />
DSP (2)<br />
Geschichte (2)<br />
Spanisch (4) oder Geographie (2)<br />
* 2 x 152<br />
(2 SWS + 2 SWS oder<br />
1 x 4 SWS)<br />
Summe * = verpflichtend mind. 2584<br />
(34 SWS)<br />
SWS = Semesterwochenstunden<br />
Mindestens zwei der drei Kernfächer (Abschnitt I.) sind auf erhöhtem Anforderungsniveau zu belegen.<br />
Prüfungsfächer: Der Prüfling wählt seine Prüfungsfächer so, dass unter ihnen zwei Kernfächer sind und die drei Aufgabenfelder<br />
(sprachlich-literarisch-künstlerisch: Deutsch, alle Fremdsprachen, Kunst, Musik; gesellschaftswissenschaftlich: Geschichte,<br />
Geografie, PGW, Religion, Philosophie; mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch: Mathematik, Biologie, Chemie,<br />
Physik, Informatik) abgedeckt werden. Er kann nur solche Fächer als Prüfungsfächer wählen, in denen er während des<br />
Schuljahres, das der Studienstufe vorausgeht, mindestens ein Schulhalbjahr und in der Studienstufe durchgehend unterrichtet<br />
wurde.<br />
Schriftlich wird im Profilbereich und in zwei weiteren Fächern, darunter mindestens ein Kernfach auf erhöhtem Niveau, geprüft.<br />
Mündlich wird in einem weiteren Fach geprüft (Präsentationsprüfung).<br />
Die Prüfung im Profilbereich orientiert sich am Fach PGW. Die schriftliche Prüfung im Profilbereich und in mindestens einem<br />
Kernfach erfolgt auf erhöhtem Anforderungsniveau. In den anderen Fächern muss sie auf erhöhtem Anforderungsniveau erfolgen,<br />
wenn der Prüfling das Fach während der Studienstufe auf erhöhtem Anforderungsniveau belegt hatte.<br />
28
Profil 3: Kommunikationswelt - Weltkommunikation<br />
Beschreibung der Semesterinhalte<br />
1. Semester: Die Kommunikationsgesellschaft zwischen permanenter Vernetzung und<br />
sozialer Vereinsamung<br />
Im Unterricht im Fach PGW erwerben die Schülerinnen und Schüler Einsichten in gesellschaftliche<br />
Strukturen und Prozesse, lernen Verfahren der gesellschaftlichen Konfliktregelung und gesellschaftspolitische<br />
Maßnahmen in Deutschland und der EU kennen. Sie beschäftigen sich mit sozialen<br />
Wertvorstellungen, Normen und Milieus, auch in ihrer jeweiligen Auswirkung auf ihre eigene persönliche<br />
Lebensgestaltung sowie auf politische Entscheidungen. Sie lernen gesellschaftliche Handlungs-<br />
und Beteiligungsmöglichkeiten kennen und dabei zwischen (sozial)staatlichen, zivilgesellschaftlichen<br />
und privaten Handlungsfeldern zu unterscheiden.<br />
Im Seminar „Kommunikation und Medien“ setzen sich die Schüler mit den Theorien zu Kommunikation,<br />
Gesellschaft und Sprache auseinander. Die Analyse neuer Kommunikationsformen aufgrund<br />
neuer technischer Gegebenheiten sowie die Betrachtung der Kommunikation in verschiedenen Gesellschaften<br />
verdeutlichen die Inhalte des Faches PGW in dem Semester. Sowohl Sprach- als auch<br />
Kommunikationstheorien liefern Grundlagen für die objektorientierte Programmiersprache und die<br />
Kommunikation zwischen Objekten in der Programmierumgebung im Fach Informatik im ersten Semester<br />
sowie der Kommunikation zwischen (Informatik-)Systemen in den folgenden Semestern.<br />
Kommunikation und Medien liefert ebenfalls einen Beitrag zur Stärkung der Kommunikations- und<br />
Kooperationsfähigkeit, einem Kompetenzbereich, der ebenfalls während der Projektarbeit im Informatikunterricht<br />
geschult wird.<br />
Die technischen Entwicklungen des Fachgebietes Informatik und die weltweite Verbreitung der Informationstechnologie<br />
stellen Grundlagen dar, ohne die ein großer Teil der Semesterinhalte der<br />
Fächer PGW und Kommunikation und Medien überhaupt nicht denkbar wären. Den Anforderungen<br />
des Informatiklehrplans werden die unten aufgelisteten Inhalte des Faches gerecht.<br />
Im Rahmen des Faches Wirtschaft untersuchen die Schülerinnen und Schüler wirtschaftswissenschaftliche<br />
Grundfragen und analysieren ökonomische Tatbestände, Denkmuster, Methoden und<br />
Erklärungsansätze vor dem Hintergrund des dynamischen Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft.<br />
2. Semester: Demokratie in der Mediengesellschaft<br />
Im Unterricht im Fach PGW erkennen die Schülerinnen und Schüler die Interessen und Zielvorstellungen<br />
von politisch Handelnden und beschäftigen anhand eines Fallbeispiels zur aktuellen Energiepolitik<br />
sich mit Prozessen, Institutionen, Regeln und Verfahren der politischen Willensbildung und<br />
Entscheidungsfindung in Deutschland und der EU. Sie lernen, dass in der demokratischen Debatte<br />
um konkrete Problemlösungen unterschiedliche politische Grundpositionen aufeinander treffen und<br />
dass im politischen Prozess Lösungsentwürfe ausgehandelt werden und versucht wird, diese Lösungsentwürfe<br />
unter Verwendung verfügbarer institutioneller, finanzieller und öffentlich-medialer<br />
Machtmittel durchzusetzen. Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass der politische Prozess auf<br />
mehreren, miteinander vernetzten Ebenen stattfindet und dass dabei die europäische Ebene eine<br />
zunehmende Rolle spielt.<br />
Der politische öffentliche Diskurs ist heute stark durch Medien geprägt. Wer den Diskurs in den Medien<br />
bestimmt, besitzt einen großen politischen Vorteil. Im Seminar „Kommunikation und Medien“<br />
wird analysiert, wie Kommunikationsprofis arbeiten und was dies für die demokratische Kultur bedeutet.<br />
Schülerinnen und Schüler nähern sich der Thematik praktisch und theoretisch. Die theoretischen<br />
Inhalte stammen aus der Kommunikations- und Medienwissenschaft und ergänzen die Profilfächer<br />
PGW und Wirtschaft. Es werden praktische Kenntnisse vermittelt, die bei einer Berufsorien-<br />
29
Profil 3: Kommunikationswelt - Weltkommunikation<br />
tierung im Kommunikations- und Medienbereich sinnvoll sein können. Darüber hinaus werden<br />
Schlüsselkompetenzen wie wissenschaftspropädeutisches Arbeiten, Präsentation, professionelle<br />
Kommunikation und kreatives Arbeiten vermittelt.<br />
Im Unterrichtsfach Wirtschaft untersuchen die Schülerinnen und Schüler unternehmerische Entscheidungsprozesse,<br />
befassen sich mit wesentlichen betrieblichen Grundfunktionen und Managementkonzepten<br />
und diskutieren veränderte Berufs- und Erwerbsorientierungen.<br />
3. Semester: Wirtschaft im Zeitalter der Globalisierung – Chancen und Risiken<br />
„Im Rahmen des Faches PGW erkennen die Schülerinnen und Schüler die Interessen und Zielvorstellungen<br />
von wirtschaftlich Handelnden in Deutschland, der EU sowie der Welt und lernen, verschiedene<br />
wirtschaftspolitische Grundauffassungen zu unterscheiden. Im Mittelpunkt steht dabei die<br />
umstrittene Frage nach einer ökonomisch, ökologisch und sozial angemessenen Rolle des Staates<br />
und der EU als Regulator in wirtschaftlichen Prozessen. Die wirtschaftspolitischen Grundpositionen<br />
werden anhand einer Fallanalyse zu den wirtschaftspolitischen Maßnahmen während der aktuellen<br />
Finanzkrise ab dem Jahre 2008 untersucht. Ökonomische Bildung unterstützt die Schülerinnen und<br />
Schüler bei der Planung ihrer Lebensentwürfe und dabei, sich den Herausforderungen des technischen<br />
und ökonomischen Strukturwandels aktiv zu stellen.“<br />
Die Schülerinnen und Schüler untersuchen im Fach Wirtschaft Aufgaben und Umfang, Ziele und Methoden<br />
der Staatstätigkeit in der Wirtschaft sowie die Bedeutung von Institutionen für ökonomische<br />
Prozesse.<br />
Im Seminarkurs „Kommunikation und Medien“ üben die Schülerinnen und Schüler wissenschaftspropädeutisches,<br />
projektorientiertes Arbeiten. Sie untersuchen verschiedene professionelle Kommunikationsstrategien<br />
(z.B. Otto, Google, USA im Irak-Krieg).<br />
4. Semester: Globale Probleme/ Internationale Politik<br />
„Die Schülerinnen und Schüler erkennen die Interessen und rechtlichen Rahmensetzungen, die im<br />
Verkehr der Staaten untereinander und in den internationalen Organisationen ausgetragen und geregelt<br />
werden. Sie erfahren, dass die gegenseitige Anerkennung der Staaten als Völkerrechtssubjekte<br />
sowie die Frage des Verzichts auf Gewaltanwendung in der internationalen Arena kontrovers diskutiert<br />
werden und ein Entwicklungsprozess hin zu einer „Weltinnenpolitik“ immer wieder in Frage<br />
gestellt ist.“<br />
Im Fach Wirtschaft untersuchen die Schülerinnen und Schüler grundlegende Aspekte des weltweiten<br />
ökonomischen Strukturwandels, der Durchdringung nationaler wie supranationaler Ökonomien<br />
und überprüfen die Tauglichkeit neuerer Erklärungsansätze sowie klassischer Theorien unter dem<br />
Aspekt der Gestaltbarkeit einer künftigen neuen Weltwirtschaftsordnung.<br />
Im Seminarkurs „Kommunikation und Medien“ befassen sich die Schülerinnen und Schüler mit der<br />
Zukunft der Medien. Eine sehr kreative Arbeit ist in diesem Semester möglich, die bis hin zu einem<br />
freien Spielfilmprojekt führen kann.<br />
30
PGW Informatik Wirtschaft Seminar:<br />
Kommunikation und Medien<br />
Grundlagen, Funktion der<br />
Medien<br />
Seminar-Bausteine:<br />
Grundfragen der Ökonomie und<br />
der Markt als Aktionsfeld<br />
Gesellschaft und<br />
Gesellschaftspolitik<br />
Profil 3: Kommunikationswelt - Weltkommunikation<br />
Detailübersicht<br />
1. Semester<br />
Sozialstruktur und<br />
Strukturwandel<br />
Faktoren lebensweltlicher<br />
Wandlungsprozesse<br />
Gesellschaftstheorien<br />
und -konzepte<br />
aktuelle Sozialpolitik<br />
Objektorientierte Modellierung<br />
und Programmiersprache<br />
Idee des OO-Konzepts mit Objekten<br />
und ihrer Kommunikation,<br />
Vererbung und Nutzerbeziehung<br />
Erarbeitung der Sprachelemente<br />
der verwendeten objektorientierten<br />
Programmiersprache,<br />
Berücksichtigung von Programmierkonventionen,<br />
Nutzen<br />
von Bausteinen/Libraries<br />
Erlernen einer<br />
Videoschnittsoftware<br />
im Aktionsrahmen zwischen<br />
Wirtschaftsordnung und Gesellschaftssystem<br />
Bei Bedarf: Arbeit an Seminarprojekten<br />
Ökonomisches Menschenbild<br />
Presse als „4. Gewalt“<br />
Menschliches Verhalten in<br />
ökonomischen Situationen<br />
Ökonomische Denkmuster im<br />
Wandel<br />
Angebot und Nachfrage und<br />
Arbeiten –<br />
die Funktion des Preismechanismus<br />
Demokratische Funktion der<br />
Wissenschaftspropädeuti-<br />
Praktische Pressearbeit am<br />
sches Hinterfragen von populären<br />
Irrtümern über Medien<br />
Einstieg ins wissenschaftliche<br />
Beispiel von Interviewtechnik<br />
Extra-Bausteine (in Verbindung<br />
mit dem Fach Informatik):<br />
Filmschnitt mit Premiere Elements<br />
Filmemachens<br />
Kameratechnik<br />
Praktische Grundlagen des<br />
Übungsprojekt „5-Shot-Regel“<br />
31
PGW Informatik Wirtschaft Seminar:<br />
Kommunikation und Medien<br />
Werbung und Propaganda<br />
Seminar-Bausteine:<br />
Politik und<br />
demokratisches System<br />
Profil 3: Kommunikationswelt - Weltkommunikation<br />
Detailübersicht<br />
2. Semester<br />
das demokratische System<br />
Politik und<br />
Gefahren/Herausforderungen<br />
politischer Prozess<br />
Demokratietheorie und politische<br />
Ideen<br />
Repräsentation von<br />
für die Demokratie<br />
Client-Server-Modell, Netze,<br />
Verteilte Systeme<br />
Fallanalyse: aktuelle Energiepolitik<br />
Sprache als Werkzeug der<br />
Information<br />
Sicherheit im Internet, Schutz<br />
Protokolle, TCP/IP-<br />
Schichtenmodell<br />
Verfahren zur Sicherung von<br />
Kommunikation: Aspekte formaler<br />
Sprachen, Syntax und<br />
Semantik<br />
lokaler Netze vor Angriffen<br />
von außen<br />
Grundlagen<br />
Das private Unternehmen –<br />
ökonomisches und soziales<br />
Aktionszentrum im Wandel<br />
Vertraulichkeit, Integrität und<br />
Authentizität von Kommunikation<br />
Ausgewählte<br />
Voraussetzungen für die Gründung<br />
eines<br />
Unternehmens<br />
unternehmerischer<br />
Entscheidungsprozesse<br />
Managementkonzepte<br />
Wie funktioniert Kommunikation?<br />
Unternehmenskultur und unternehmerische<br />
Verantwortung<br />
Warum funktioniert Propaganda?<br />
Übungsprojekt zum Thema<br />
Begleitung von einigen Schulaktivitäten<br />
Extra-Bausteine (in Verbindung<br />
mit dem Fach Informatik):<br />
„Zeitabläufe beim Film“<br />
Übungsprojekt: Kausalmontagen<br />
32
PGW Informatik Wirtschaft Seminar:<br />
Kommunikation und Medien<br />
Professionelle Kommunikationskonzepte<br />
Seminar-Bausteine:<br />
Wirtschaftspolitik als ordnende<br />
Gestaltungsaufgabe<br />
Möglichkeiten und Grenzen von<br />
Informatiksystemen<br />
Wirtschaftssystem und<br />
Wirtschaftspolitik<br />
Profil 3: Kommunikationswelt - Weltkommunikation<br />
Detailübersicht<br />
3. Semester<br />
Soziale Marktwirtschaft und<br />
ihre Akteure<br />
wirtschaftspolitische Grundpositionen<br />
Globalisierung und<br />
internationale<br />
Wirtschaftsbeziehungen<br />
Erhaltung der Funktionsfähigkeit<br />
von Märkten als selbstregulierendes<br />
System<br />
aktuelle Wirtschaftspolitik<br />
Fallanalyse: wirtschaftspolitische<br />
Maßnamen während der<br />
aktuellen Finanzkrise<br />
Bewertung und Verfahren hinsichtlich<br />
Effizienz und Bedeutung<br />
aufgrund der Einsatzmöglichkeiten<br />
prinzipielle und praktische<br />
Grenzen der<br />
Berechenbarkeit<br />
gesellschaftliche, ethische und<br />
rechtliche Aspekte<br />
Reflexion über Möglichkeiten<br />
und Grenzen von Informatiksystemen,<br />
fachkundige Diskussion<br />
der Frage „Welche Teile<br />
der geistigen Tätigkeiten des<br />
Menschen können Maschinen<br />
übernehmen?“<br />
Arbeit mit einer Office-<br />
Standardanwendung<br />
Wissenschaftspropädeutisches,<br />
projektorientiertes Arbeiten<br />
Bei Bedarf: Arbeit an Seminarprojekten<br />
Institutionelle Grundlagen zur<br />
SuS untersuchen verschiedener<br />
Kommunikationsstrategien<br />
von Profis (z.B. Otto,<br />
Google, USA im Irak-Krieg)<br />
Politische Korrektur von<br />
Marktergebnissen durch den<br />
Staat<br />
Auswirkungen von Anreizen<br />
und Sanktionen in der staatlichen<br />
Wirtschaftspolitik auf die<br />
Konjunktur<br />
Ausgewählte theoretische<br />
Begleitung von einigen Schulaktivitäten<br />
Grundlagen<br />
Extra-Baustein (in Verbindung mit<br />
dem Fach Informatik):<br />
Profile<br />
Das Ziel der Studienfahrt im 3. Semester orientiert sich an den Inhalten der Profilfächer.<br />
Erstellung neuer Spots für die<br />
33
PGW Informatik Wirtschaft Seminar:<br />
Kommunikation und Medien<br />
Globale Probleme/<br />
Internationale Politik<br />
Profil 3: Kommunikationswelt - Weltkommunikation<br />
Detailübersicht<br />
4. Semester<br />
das System internationaler<br />
internationale<br />
Beziehungen<br />
aktuelle internationale<br />
Konfliktlösungsstrategien<br />
Zukunft der internationalen<br />
Konflikte<br />
Modellbildung: Wortmodell,<br />
Simulation<br />
Beziehungen<br />
vergleichende Untersuchung<br />
Wirkungsdiagramm und Simulationsdiagramm<br />
nummerische Verfahren bei<br />
Implementierung von<br />
von grundlegenden<br />
Wachstumsformen<br />
Dokumentation und<br />
Bewertung der<br />
Kreative Arbeit in den Medien<br />
oder „Kulturindustrie“?<br />
Seminar-Bausteine:<br />
der Simulation dynamischer<br />
Systeme<br />
Modellen mit einer<br />
Simulationssoftware<br />
Arbeit mit einer Office-<br />
Präsentation des<br />
Modellierungsprozesses und<br />
der Ergebnisse<br />
Bei Bedarf: Arbeit an<br />
Aussagekraft von Simulationsergebnissen<br />
Standard-Anwendung<br />
Ambivalenzen des<br />
Internationale<br />
Wirtschaftsbeziehungen<br />
und Europa<br />
Europa zwischen<br />
Theoretische Erklärungsansätze<br />
internationalen<br />
Handels<br />
die deutsche<br />
Globalisierungsprozesses<br />
Kann man kreatives Arbeiten<br />
Regionalisierung und<br />
Globalisierung<br />
Wie kreativ ist die Medienwelt<br />
lernen? (Brainstorming)<br />
Volkswirtschaft im<br />
internationalen Wirtschaftsgefüge<br />
Zukunftswerkstatt: Zukunft<br />
wirklich? Adornos Theorie zur<br />
„Kulturindustrie“<br />
der Medien<br />
Freies Spielfilmprojekt<br />
Begleitung von einigen Schulaktivitäten<br />
Extra-Baustein (in Verbindung mit<br />
dem Fach Informatik):<br />
34
Die Welt ist eine Bühne!<br />
Ursachen, Ausdrucksformen und Folgen<br />
menschlichen Handelns<br />
4. Semester:<br />
Kampf der Welten & Systeme<br />
2. Semester:<br />
Das Elend der Moderne<br />
1. Semester:<br />
Europa - Der Nabel der Welt<br />
3. Semester:<br />
„… und morgen die ganze Welt“<br />
Vom Zweiten<br />
Weltkrieg zur<br />
internationalen<br />
Staatengemeinschaft<br />
Der Weg in die Moderne:<br />
Entdeckung & Kolonisation<br />
Revolutionen in England,<br />
Amerika und Frankreich<br />
Das kurze 20. Jh.:<br />
Weltkriege, Aufstieg und<br />
Untergang von Staaten<br />
Nationalstaatsbildung<br />
Industrialisierung<br />
Rollenarbeit,<br />
Dramaturgie und<br />
Inszenierung<br />
Theaterästhetische<br />
Grundlagen -<br />
Schwerpunkt: Raum<br />
Postdramatisches<br />
Theater<br />
Theaterlabor<br />
Kunstgeschichte:<br />
Architektur und<br />
Wohnen—<br />
früher und heute<br />
Kunst nach dem Ersten<br />
Weltkrieg—eine Vielzahl<br />
neuer Ausdrucksformen<br />
Kunstlabor<br />
Produktdesign<br />
Seminar: Interdisziplinäres Arbeiten, Methodenlernen,<br />
Wettbewerbe und Exkursionen<br />
* Profilgebendes Fach<br />
Profil 4: Die Welt ist eine Bühne<br />
Ursachen, Ausdrucksformen und Folgen menschlichen Handelns<br />
Kurzübersicht<br />
Geschichte* DSP Kunst<br />
Seminar<br />
Geschichte* DSP Kunst<br />
Seminar<br />
35
Profil 4: Die Welt ist eine Bühne<br />
Stundentafel des Profils „Die Welt ist eine Bühne“ mit Belegauflagen<br />
Das Profil „Die Welt ist eine Bühne“<br />
Fächer und Lernbereiche in den<br />
Aufgabenfeldern<br />
Unterrichtsstunden<br />
insgesamt<br />
I.<br />
Kernfächer<br />
Deutsch<br />
Mathematik<br />
Englisch<br />
304 (4 SWS)<br />
304 (4 SWS)<br />
304 (4 SWS)<br />
II.<br />
Fächerverbund im Profilbereich<br />
Profilgebendes Fach: Geschichte<br />
Begleitende Unterrichtsfächer:<br />
Theater<br />
Kunst<br />
Seminar: Interdisziplinäres Arbeiten<br />
304 (4 SWS)<br />
304 (4 SWS)<br />
152 (2 SWS)<br />
152 (2 SWS)<br />
= 912 (12 SWS)<br />
* Musik<br />
152 (2 SWS)<br />
* Religion oder Philosophie 152 (2 SWS)<br />
Weitere Fächer aus dem Pflicht- und<br />
Wahlpflichtbereich, soweit diese nicht<br />
bereits unter II. unterrichtet werden<br />
* Chemie oder Physik oder Biologie 152 (2 SWS)<br />
III.<br />
Geographie (2) / PGW (2) oder Spanisch (4)<br />
Informatik (2)<br />
* 2 x 152<br />
(2 x 2 SWS oder<br />
1 x 4 SWS)<br />
Summe * = verpflichtend mind. 2584<br />
(34 SWS)<br />
SWS = Semesterwochenstunden<br />
Mindestens zwei der drei Kernfächer (Abschnitt I.) sind auf erhöhtem Anforderungsniveau zu belegen. Bei diesem Profil muss<br />
eines davon Englisch sein.<br />
Prüfungsfächer: Der Prüfling wählt seine Prüfungsfächer so, dass unter ihnen zwei Kernfächer sind und die drei Aufgabenfelder<br />
(sprachlich-literarisch-künstlerisch: Deutsch, alle Fremdsprachen, Kunst, Musik; gesellschaftswissenschaftlich: Geschichte,<br />
Geografie, PGW, Religion, Philosophie; mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch: Mathematik, Biologie, Chemie,<br />
Physik, Informatik) abgedeckt werden. Er kann nur solche Fächer als Prüfungsfächer wählen, in denen er während des<br />
Schuljahres, das der Studienstufe vorausgeht, mindestens ein Schulhalbjahr und in der Studienstufe durchgehend unterrichtet<br />
wurde.<br />
Schriftlich wird im Profilbereich und in zwei weiteren Fächern, darunter mindestens ein Kernfach auf erhöhtem Niveau, geprüft.<br />
Mündlich wird in einem weiteren Fach geprüft (Präsentationsprüfung).<br />
Die Prüfung im Profilbereich orientiert sich am Fach Geschichte. Die schriftliche Prüfung im Profilbereich und in mindestens<br />
einem Kernfach erfolgt auf erhöhtem Anforderungsniveau. In den anderen Fächern muss sie auf erhöhtem Anforderungsniveau<br />
erfolgen, wenn der Prüfling das Fach während der Studienstufe auf erhöhtem Anforderungsniveau belegt hatte.<br />
36
Profil 4: Die Welt ist eine Bühne<br />
Beschreibung der Semesterinhalte<br />
1. Semester: Europa - Der Nabel der Welt<br />
Um 1500 änderte sich das Leben der Menschen radikal: Die Ideen der Renaissance, des Humanismus und der Aufklärung<br />
beeinflussten das Menschenbild, das bisher geprägt war von den kirchlichen Vorstellungen des Mittelalters. Unter anderem<br />
waren die Wiederentdeckung der Antike, menschliche Neugier und Tatendrang Auslöser und Motive der großen Entdeckungsfahrten.<br />
Das Aufspüren neuer Kontinente und Völker hatte Auswirkungen auf das Leben und die Kultur der indigenen<br />
Bevölkerung, aber auch auf die europäische Weltsicht. Untersucht werden soll u.a., wie die Hochkulturen Südamerikas auf<br />
die Invasion reagierten und inwiefern Kulturtransfer und vorhandene Gegensätze das Leben in beiden Welten prägten. – Die<br />
Europäisierung der Erde setzte sich in den folgenden Jahrhunderten fort, es entstanden neue Kulturen, die einerseits alteuropäische<br />
Merkmale, andererseits Kennzeichen einer eigenständigen Entwicklung aufwiesen. Mit den verbesserten technischen<br />
Möglichkeiten im 18. und 19. Jahrhundert ging auch eine Veränderung im Selbstverständnis der europäischen Völker<br />
einher. Daher soll gefragt werden, welche theoretischen Grundlagen vorhanden waren, die zur Rechtfertigung der modernen<br />
Invasion dienten. Das Hinterfragen der jeweiligen Weltsicht öffnet den Raum für die Gegenwart und stellt Bezüge zur<br />
Begegnung mit Fremdem.<br />
Das Fach Theater beginnt im ersten Semester mit der Annäherung an theaterästhetische Grundlagen. Dazu gehören Übungen<br />
zum Körperbewusstsein, Gestik, Mimik und Ausdruck, sowie dem Zusammenspiel im Ensemble. Die Gruppe experimentiert<br />
in szenischer Interpretation und dem Entwurf szenischer Konzepte. Die Auseinandersetzung mit dem Thema<br />
„Raum“ (u.a. Spielimpulse durch Räume, Nutzung des Raumes als Gestaltungsmittel) bildet in diesem Semester einen<br />
Schwerpunkt.<br />
Im Mittelpunkt des Begleitfaches Kunst steht das Thema Architektur und Wohnen. Architektur richtet sich immer nach dem<br />
vorherrschenden Menschenbild und ist somit oft als Ausdruck von Herrschaftsansprüchen und Weltbildern im historischen<br />
Kontext zu verstehen.<br />
In der gesamten Studienstufe soll der Seminarunterricht dazu dienen, methodisches Arbeiten zu festigen bzw. neue Methoden<br />
kennen zu lernen und mit den anderen Fächern des Profils interdisziplinär zu arbeiten. Dabei wird großen Wert auf eine<br />
Projekt- und Produktorientierung gelegt.<br />
2. Semester: Das Elend der Moderne<br />
Deutschland im „langen 19. Jahrhundert“ hatte zunächst eine ganz andere Gestalt als es die heutige Landkarte vermuten<br />
lässt. Verglichen mit England war das Gebiete des Deutschen Reiches ein Flickenteppich, der aus zahlreichen Kleinstaaten<br />
bestand. Dieser Umstand, der sich in verschiedenen Sprachen, Gewichten und Maßeinheiten ganz konkret zeigte, hatte natürlich<br />
auch eine politische Dimension. Die Herausbildung einer nationalen Identität und ein einheitlicher Nationalstaat stellten<br />
für das deutsche Territorium keine Selbstverständlichkeit dar. – Auch wirtschaftliche Interessen waren von großer Bedeutung.<br />
Betrachtet man den direkten Konkurrenzkampf zwischen Deutschland und England, so findet man eine ähnliche<br />
Entwicklung – allerdings zeitlich verzögert. Wie änderten sich Produktions- und Arbeitsformen? Inwieweit veränderte sich im<br />
Rahmen der Industrialisierung das Leben der Menschen, z.B. durch die zunehmende Maschinisierung?<br />
Gegenstand des zweiten Semesters sind Rollenarbeit, Dramaturgie und Inszenierung. Die Auseinandersetzung mit Figuren<br />
bzw. Rollen eines Stückes bildet die Grundlage für die Inszenierung desselben. Die Gruppe erarbeitet eine Strichfassung und<br />
ein Inszenierungskonzept zu einem Drama, das am Ende in einer Aufführung umgesetzt werden soll.<br />
Was bedeutet die Industrialisierung für die Kunst? Im zweiten Semester beschäftigt sich der Kunstunterricht mit dem Thema<br />
Produktdesign. Die neu aufkommende Massenproduktion ermöglichte die Entwicklung von Prototypen und zieht eine Neuinterpretation<br />
von Design nach sich.<br />
37
Profil 4: Die Welt ist eine Bühne<br />
3. Semester: „… und morgen die ganze Welt“<br />
Ausgehend vom „langen 19. Jahrhundert stellt das „kurze 20. Jahrhundert“ einen Gegensatz dar: Wenn man Wendepunkte<br />
in der deutschen, aber auch in der Weltgeschichte sucht, werden zwangsläufig die beiden Weltkriege genannt werden müssen.<br />
Untersucht werden sollen die Rahmenbedingungen, Ursachen, Auslöser, Verlauf und Folgen der beiden Kriege. Schwerpunkt<br />
der Betrachtung ist die Entwicklung in Deutschland, diese kann aber nicht losgelöst von europäischen oder globalen<br />
Prozessen sein. So zeigt sich in der deutschen Teilung beispielsweise ein weltpolitischer Gegensatz, der im Ende des Zweiten<br />
Weltkriegs seinen Ursprung hatte. Die Vormachtstellung der USA hatte hier ihren Ursprung.<br />
Im dritten Semester liegt der Schwerpunkt auf der Arbeit mit unterschiedlichen Schauspielstilen und postdramatischen Inszenierungsformen.<br />
Unter Rückgriff auf die zuvor erarbeiteten Grundlagen zur Rollenarbeit werden in diesem Semester unterschiedliche<br />
Schauspielstile und Formen des Umgangs mit Figur und Ensemble thematisiert. Im Kontext der postdramatische<br />
Inszenierungsformen werden unterschiedliche Formen von Theater (wie z.B. das Epische Theater nach Brecht) spielerisch<br />
erprobt und umgesetzt.<br />
Nach dem Ersten Weltkrieg erfährt die Kunst eine Aufsplitterung der einzelnen Gattungen. Im Unterricht werden die unterschiedlichen,<br />
experimentierfreudigen neuen Ausdrucksformen in der Kunst thematisiert.<br />
4. Semester: Kampf der Welten und Systeme<br />
Nachdem in den ersten drei Semestern die neuzeitliche Geschichte behandelt worden ist, werden in einem Längsschnitt die<br />
Revolutionen der Neuzeit betrachtet. Ausgehend von der Amerikanischen Revolution werden die Entwicklungen in Frankreich<br />
im 18. Jahrhundert genauer untersucht. Über die Russische Revolution gelangt man schließlich zur „friedlichen Revolution“<br />
von 1989, um die Auseinandersetzung zweier unterschiedlicher Ideologien, die Folgen für das Leben der Menschen in<br />
Europa und Deutschland hatte, zu untersuchen. Die Auswirkungen des Kalten Krieges manifestieren sich im Eisernen Vorhang<br />
oder – auf Deutschland bezogen – in der Teilung der beiden deutschen Staaten. Wie gestaltete sich das Leben mit dieser<br />
Teilung in der Bundesrepublik Deutschland und in der Deutschen Demokratischen Republik? Welche Schritte führten<br />
schließlich zur Wiedervereinigung und darüber hinaus zur Eingliederung eines gesamtdeutschen Staates in das europäische<br />
Staatenbündnis? — Diese und andere Fragen sollen im Rahmen des vierten Semesters untersucht werden. Darüber hinaus,<br />
das bietet sich auch im Rahmen der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit an, sollen Fragen nach der nationalen<br />
Erinnerungskultur diskutiert werden.<br />
Das „Theaterlabor“ des vierten Semesters bietet Raum zum Experimentieren mit modernen und zeitgenössischen Theaterformen.<br />
Die Arbeit z.B. mit Montagetechnik ermöglicht es, mit Möglichkeiten und Wirkungsweisen der Kombination unterschiedlicher<br />
Medien und Kunstformen (Musik, Fotographie, Film, Installation, ...) mit nicht-dramatischen Texten zu experimentieren.<br />
Auch der Kunstunterricht ist im vierten Semester offen gestaltet und ermöglicht die individuelle Auseinandersetzung mit<br />
Video, Installation und Objekt. Wie im Theaterlabor liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf dem biographischen Arbeiten.<br />
38
Geschichte (4) Theater (4) Kunst (2) Seminar (2)<br />
Theaterästhetische Grundlagen<br />
Profil 4: Die Welt ist eine Bühne<br />
Detailübersicht<br />
1. Semester<br />
Neue Ideen und neues<br />
Schnittstelle zwischen<br />
Menschenbild<br />
Entdeckungsfahrten und<br />
Mittelalter und Moderne<br />
Kulturkontakt, Kulturaustausch<br />
Europäisierung der Erde<br />
Imperialismus: Theorien und<br />
oder clash of civilization<br />
Der Schauspieler und seine Aus-<br />
Methodentraining und fächerübergreifende<br />
Projekte<br />
Wirklichkeit<br />
Grundalgen der Darstellung<br />
drucksmittel<br />
Schwerpunkt Raum<br />
Architektur von der Antike bis<br />
Die Szene: von der Idee zur Bühnenhandlung<br />
Inszenierung von Räumen<br />
zur Gegenwart als Ausdruck von<br />
Menschenbildern und Herrschaftssystemen<br />
39
Geschichte (4) Theater (4) Kunst (2) Seminar (2)<br />
Produktdesign Methodentraining und fächerübergreifende<br />
Projekte<br />
Rollenarbeit,<br />
Dramaturgie und<br />
Inszenierung<br />
Das „lange 19. Jahrhundert“<br />
Profil 4: Die Welt ist eine Bühne<br />
Detailübersicht<br />
2. Semester<br />
Von der Kleinstaaterei zum Na-<br />
Wechselwirkungen von politi-<br />
tionalstaat<br />
Deutschland im europäischen<br />
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen<br />
Entwicklungen<br />
Figuren und Ensemble<br />
Textvorlage<br />
und globalen Markt<br />
Inszenierung einer dramatischen<br />
40
Geschichte (4) Theater (4) Kunst (2) Seminar (2)<br />
Postdramatisches<br />
Theater<br />
Vom „langen 19“. zum „kurzen<br />
20. Jahrhundert“<br />
Methodentraining und fächerübergreifende<br />
Projekte<br />
Kunst nach dem 1. Weltkrieg.<br />
Profil 4: Die Welt ist eine Bühne<br />
Detailübersicht<br />
3. Semester<br />
Wendepunkte in der<br />
Geschichte: Weltkriege<br />
Entwicklungstendenzen in Kaiserreich,<br />
Weimarer Republik<br />
und Nationalsozialismus<br />
Ausgrenzung, Entrechtung und<br />
Inszenierungsformen<br />
Vernichtung im Dritten Reich<br />
Schauspielstile und<br />
postdramatischen<br />
Theaterformen<br />
(z.B. Brecht)<br />
Auseinandersetzung mit<br />
Das Ziel der Studienfahrt im 3. Semester orientiert sich an den Inhalten der Profilfächer.<br />
Neue Ausdrucksformen in der<br />
41
Geschichte (4) Theater (4) Kunst (2) Seminar (2)<br />
Kunstlabor<br />
Theaterlabor<br />
Revolutionäre Ideen<br />
Revolutionen von der Frühen Neuzeit<br />
bis zur Gegenwart<br />
Profil 4: Die Welt ist eine Bühne<br />
Detailübersicht<br />
4. Semester<br />
Amerikanische und Französische<br />
Von der Russischen Revolution<br />
Erinnerungskultur und<br />
Revolution<br />
Arbeit mit modernen<br />
zur Wiedervereinigung: Kalter<br />
Krieg und Fall des Eisernen Vorhangs<br />
Vergangenheitsbewältigung<br />
Theater als<br />
Methodentraining und fächerübergreifende<br />
Projekte<br />
Zukunftsperspektiven<br />
Performance als<br />
Theaterformen<br />
individuelles Arbeiten mit unter-<br />
Versuchsanordnung<br />
schiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen<br />
experimentelles<br />
Projekt<br />
42