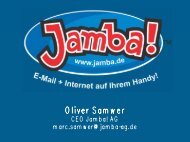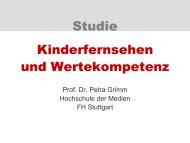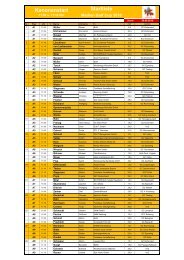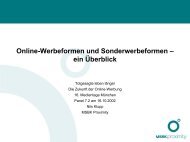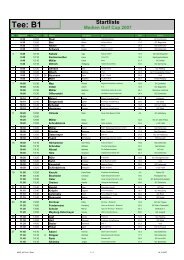KINO RETRO DIGITAL - über den Filmklassiker METROPOLIS
KINO RETRO DIGITAL - über den Filmklassiker METROPOLIS
KINO RETRO DIGITAL - über den Filmklassiker METROPOLIS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>KINO</strong> <strong>RETRO</strong> <strong>DIGITAL</strong> - <strong>über</strong> <strong>den</strong> <strong>Filmklassiker</strong> <strong>METROPOLIS</strong><br />
Bild: Dreharbeiten <strong>METROPOLIS</strong> – Brigitte Helm im Roboterkostüm während der Drehpause<br />
Vortrag zum Film <strong>METROPOLIS</strong> bei <strong>den</strong> Medientagen München am 19.Oktober 2011<br />
mit Informationen <strong>über</strong> die Restaurierungsarbeiten (Anmerkung: am 14. Oktober<br />
erscheinen die DVD und die Blu-ray der neuen restaurierten Fassung)<br />
Expose:<br />
Der deutsche Stummfilmklassiker <strong>METROPOLIS</strong> wurde von der UNESCO bereits im Jahr<br />
2001 als erster Film <strong>über</strong>haupt in die Liste des Weltdokumentenerbes (Memory of the<br />
World) aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt lag die von der Murnaustiftung digital<br />
restaurierte Fassung des Films vor, bei der immer noch gut ein Fünftel des vollständigen<br />
Originals von 1927 fehlte. Die weitere Suche nach <strong>den</strong> verlorenen Teilen war - nach<br />
jahrzehntelangen intensiven Forschungen - bereits aufgegeben wor<strong>den</strong>. So war es eine<br />
unerwartete Sensation, als 2008 in Buenos Aires die zwar schlecht erhaltene, <strong>den</strong>noch<br />
vollständige Fassung einer Exportkopie von 1927 zum Vorschein kam. Ausgehend von der<br />
restaurierten Fassung von 2001 wur<strong>den</strong> die noch fehlen<strong>den</strong> Teile aus dem neuen Material
hinzugefügt. Die Klavierauszüge der Filmmusik von Gottfried Huppertz dienten zur<br />
Orientierung für die endgültige Montage. Am 12. Februar 2010 war es dann soweit: Die<br />
Premierenfassung von <strong>METROPOLIS</strong> kehrte nach 83 Jahren auf die Kinoleinwand zurück.<br />
Die Wiederaufführung wurde als Highlight der Berlinale gefeiert, musikalisch begleitet vom<br />
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Dirigent Frank Strobel.<br />
(→ * Im Vortrag: Infos zur Aufführung am 12. Februar in Berlin; ARTE-<br />
Webseite)<br />
Nach der Welle der Begeisterung beim internationalen Fachpublikum und unter <strong>den</strong><br />
Filmliebhabern wird dieses Filmjuwel nun auch einem breiten Publikum zugänglich<br />
gemacht. Im Mai 2011 startete die neue restaurierte Fassung von <strong>METROPOLIS</strong> im Kino,<br />
im Oktober folgt die Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray. Dazu gibt es im Internet sehr<br />
gute Informationen, wie z.B. beim Deutschen Filmportal oder auf der Webseite der<br />
Murnaustiftung zur Restaurierung und Wiederaufführung des Films.<br />
(→ * Im Vortrag: Infos Filmportal und Murnaustiftung)<br />
Doch wie soll die breite Masse der Zuschauer mit einem Film umgehen, der schon bei<br />
seiner Uraufführung 1927 auf Widerstand gestoßen ist? Daraus folgte ja bekanntermaßen,<br />
dass der Film gekürzt und zu einer neuen Fassung zusammengeschnitten wurde, weil<br />
man sich damit mehr Publikumszuspruch erhofft hat. Warum ausgerechnet ist die<br />
Originalversion, die doch auf Ablehnung traf, <strong>über</strong> Jahrzehnte hinweg zu einem Mythos<br />
gewor<strong>den</strong>, dessen Wiederentdeckung nun groß gefeiert wird?<br />
Auch heute kann die Filmhandlung, deren zentrales Thema die Versöhnung von<br />
Proletariat und Kapitalismus ist und die sich hart an die Grenze zum Sozialkitsch begibt,<br />
die Zuschauer nicht wirklich begeistern. Dagegen sind die herausragen<strong>den</strong> kreativen<br />
Momente des Films – Inszenierung, Szenenbild, Bauten, Kamera, optische Spezialeffekte<br />
und die großartige Filmmusik – eine unerschöpfliche Quelle immer neuer Entdeckungen.<br />
Der Film ist ein Zeitdokument, geprägt von der Stimmung der Arbeiterbewegung in der<br />
Weimarer Republik. Es lassen sich Vergleiche mit anderen künstlerischen Werken dieser<br />
Zeit herstellen, wie z.B. dem Theaterstück MASSE MENSCH von Ernst Toller.<br />
Interessant sind auch die zeitlich unterschiedlichen historischen Schichten aus <strong>den</strong><br />
verschie<strong>den</strong>en Motiven des Films, wie dem alttestamentarischen Turmbau zu Babel, die<br />
frühchristlichen Katakomben, das gotische Mittelalter - in Abwechslung mit futuristischen<br />
Visionen. Wir Zuschauer heute erfahren etwas <strong>über</strong> die Vorstellung, die man sich in der
damals von der Zukunft gemacht hat. Manches im Film gabs noch nicht, wie z.B. das<br />
Bildtelefon, das ist für uns heute Realität.<br />
(→ * Im Vortrag: Szenenbilder des Films; Abbildung Bildtelefon)<br />
Bekanntermaßen ist <strong>METROPOLIS</strong> ein Klassiker des Science-Fiction-Genres mit<br />
Vorbildcharakter für andere SF-Filme, wie z.B. BLADE RUNNER (USA 1982) von Ridley<br />
Scott.<br />
(→ * Im Vortrag: ggf. Ausschnitt aus der Doku REISE NACH <strong>METROPOLIS</strong>)<br />
Es folgen Schlaglichter auf einzelne kreative Bereiche (Gewerke) des Films;<br />
Szenenbild:<br />
ca. 20 Minuten<br />
Die Zukunftsstadt im Film BLADE RUNNER ist nach <strong>den</strong> Entwürfen des Szenenbildners<br />
Erich Kettelhut gebaut wor<strong>den</strong> (Vergleich in REISE NACH <strong>METROPOLIS</strong>).<br />
(→ * Im Vortrag: Interview mit Rainer Rother zum Szenenbild von <strong>METROPOLIS</strong><br />
beim 24-Wissensportal der Deutschen Filmakademie; gekürzt ca. 10 Minuten<br />
einschließlich Filmszene im Maschinensaal)<br />
Die Bauten wur<strong>den</strong> von Otto Hunte durchgeführt.<br />
(→ * Im Vortrag: Werkstattbilder DVD/Transit Classics)<br />
Spezialeffekte:<br />
Bei einigen Szenen in Metropolis wurde der Hintergrund in die Kamera eingespiegelt, um<br />
zwei Bildebenen zusammenzuführen, ähnlich wie das beim Greenscreen-Verfahren in<br />
heutigen Filmproduktionen geschieht, bei dem es sich jedoch um getrennte Aufnahmen<br />
handelt. Spezialist für die optischen Tricks bei <strong>METROPOLIS</strong> war Eugen Schüfftan, das<br />
Kameraeinspiegelungs-Verfahren ist nach ihm benannt.<br />
Die berühmteste Trickaufnahme in <strong>METROPOLIS</strong> ist die Verwandlung des Roboters im<br />
Labor des Erfinders Rotwang, der ihn geschaffen hat und ihn nun in eine menschliche<br />
Gestalt transformiert. Die Skulptur des Maschinenmenschen „Maria“schuf der Bildhauer<br />
Walter Schultze-Mittendorf.<br />
(→ * Im Vortrag: Szene von DVD /Transit Classics, Kapitel 14, ca. 3 Minuten)
Kamera:<br />
Karl Freund und sein Kollege Günter Rittau gehören zu <strong>den</strong> führen<strong>den</strong> Kameramännern<br />
ihrer Zeit. Karl Freund ist berühmt für seinen Erfindungsreichtum, die Gestaltung mit der<br />
„entfesselten Kamera“ gilt als seine große Errungenschaft. Ein Beispiel dafür sind die<br />
Aufnahmen der Erschütterungen bei der Katastrophe in der Arbeiterstadt.<br />
(→ * Im Vortrag: Werkstattbilder DVD/Transit Classics - der Strachow-Kamera,<br />
die auf eine Schaukel gebun<strong>den</strong> ist; ggf. Filmbeispiel aus <strong>METROPOLIS</strong> und aus<br />
DER LETZTE MANN von F.W.Murnau)<br />
Fritz Lang und Erich Pommer hatten von ihrer Amerikareise zwei Mitchell-Kameras für die<br />
Dreharbeiten von <strong>METROPOLIS</strong> mitgebracht. Für die Aufnahmen mit der „entfesselten<br />
Kamera“ wurde eine Stachow-Kamera eingesetzt.<br />
Filmmusik:<br />
Die Originalpartitur der Filmmusik von Gottfried Huppertz zur Premierenfassung des Films<br />
war ein wichtiges Dokument zur Vorlage für die Montage bei der Wiederherstellung des<br />
Films. Frank Strobel, der auch das Orchester der Berliner Symphoniker bei der Live-<br />
Aufführung der Berlinale dirigiert hat, begleitete <strong>den</strong> Restaurierungsprozess.<br />
(→ * Im Vortrag: Orchesterprobe mit Frank Strobel; ARTE-Video, 4 Minuten;<br />
ggf. Musikbeispiel von der neuen DVD-Ausgabe)<br />
Frank Strobel <strong>über</strong>nahm zusammen mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin die<br />
Einspielung der Filmmusik für die Vertonung des Films. Die Tonmischung fand im ARRI-<br />
Tonstudio statt, unter der Leitung von Tschangis Chahrokh.<br />
Weitere Informationen <strong>über</strong> die Restaurierung:<br />
Restaurierungsarbeiten und Neuveröffentlichungen von <strong>METROPOLIS</strong><br />
Informationen zur Restaurierung des Films bzw. zur Geschichte der Restaurierung bis zur<br />
Wiederaufführung der Originalfassung von 1927 auf der Berlinale 2010<br />
(→ * Im Vortrag: Webseite Alpha-Omega mit Dokumentation der Restaurierung; ggf.<br />
Webseite Titelbearbeitung und Webseite Schnittbericht)
Hinweis auf die Tätigkeit der Murnaustiftung und auf das Verdienst von Eberhard<br />
Junkersdorf. Hinweis auf die Tätigkeit des Münchner Filmmuseums und auf das Verdienst<br />
von Enno Patalas;<br />
Abschließende Betrachtungen zum Film und zu seiner Bedeutung:<br />
Informationen zum Film und zur Einordnung in <strong>den</strong> zeitgeschichtlichen Kontext<br />
Informationen zur Quellenlage, Dokumentation, Sekundärliteratur; DVD-Studienfassung<br />
<strong>METROPOLIS</strong> (UDK);<br />
Hintergrundinformationen zur Entstehung des Films; zu weiteren Personen (Kurzbiografie<br />
Fritz Lang; Kurzbiografie Erich Pommer; <strong>über</strong> die Schauspieler;)<br />
Informationen <strong>über</strong> das Weimarer Kino und die Weimarer Zeit; Expressionistischer Film<br />
und Neue Sachlichkeit; Stellung in der deutschen und internationalen Filmgeschichte (Das<br />
Weimarer Kino gilt als das Gol<strong>den</strong>e Zeitalter des Deutschen Films);<br />
(→ * Im Vortrag: Infos Filmportal)
Text zum Weimarer Kino:<br />
1918-33 Kino in der Weimarer Republik<br />
Bereits vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Deutschland zahlreiche Lichtspielhäuser, in <strong>den</strong>en<br />
Stummfilme vorgeführt wur<strong>den</strong>. In <strong>den</strong> Jahren der Weimarer Republik konnte sich der Film als<br />
einflussreiches Massenmedium etablieren, die Lichtspielhäuser nahmen einen rasanten Aufstieg.<br />
Deutschland war der europäische Staat mit <strong>den</strong> meisten Kinos, deren Anzahl zwischen 1918 und 1930<br />
von 2.300 auf 5.000 anwuchs. Mitte der 20er Jahre gingen auf der Suche nach Unterhaltung und<br />
Freizeitvergnügen täglich etwa zwei Millionen Menschen in die Kinos. Für ihr Eintrittsgeld bekamen sie<br />
neben dem Hauptfilm kurze Vorfilme, gelegentlich Natur- oder Reisefilme und stets die Wochenschau<br />
zu sehen.<br />
Deutschland - und hier vor allem die in Potsdam-Babelsberg ansässige Universum-Film AG (UFA) -<br />
produzierte in <strong>den</strong> 20er und 30er Jahren mehr Filme als alle anderen europäischen Staaten<br />
zusammen. Der deutsche Film brachte einige große Regisseure mit bedeuten<strong>den</strong> Produktionen hervor.<br />
"Das Kabinett des Dr. Caligari " (1919/20) von Robert Wiene (1873-1938), M - Eine Stadt sucht einen<br />
Mörder" (1931) von Fritz Lang oder Josef von Sternbergs "Der blaue Engel" (1930/31) und "Die blonde<br />
Venus" mit Marlene Dietrich gehören zu <strong>den</strong> "Klassikern" der internationalen Filmgeschichte.<br />
Besonders die frühen Stummfilme - Friedrich Wilhelm Murnaus "Nosferatu" (1922) und "Faust " (1926)<br />
oder Fritz Langs Nibelungen-Verfilmungen - setzten mit expressionistischen Hell-Dunkel-Effekten und<br />
romantisch-illusionistischen Stilmitteln Maßstäbe in der Filmkunst.<br />
Der Rhythmus choreographierter Massenszenen bestimmte Langs 1927 uraufgeführten Stummfilm<br />
"Metropolis". Die Fabel verknüpft Technikkritik mit naiven Sozialphantasien: Die Arbeiter der Unterstadt<br />
sind der Macht der Kapitalisten und ihrer Maschinen rechtlos ausgeliefert. Unter der Führung eines<br />
dämonischen weiblichen Homunkulus lehnen sie sich gegen ihre Unterdrücker auf, bevor die Liebe<br />
zum klassenversöhnen<strong>den</strong> Happy-End führt. Das millionenteure Spektakel erwies sich an <strong>den</strong> Kassen<br />
jedoch als Misserfolg. Längst hatte die Filmfabrik Hollywood die deutschen Kinos erobert und setzte<br />
1927 mit dem ersten Tonfilm neue Maßstäbe. In Hollywood wurde auch Marlene Dietrich zum Weltstar,<br />
die 1932 als verführerische "Blonde Venus"; nach Deutschland zurückkehrte - allerdings nur auf<br />
Zelluloid.<br />
Den internationalen <strong>Filmklassiker</strong>n stan<strong>den</strong> eine weitaus größere Anzahl Kinofilme leichter<br />
Unterhaltung gegen<strong>über</strong>. Anfang der 30er Jahre etablierte sich der Tonfilm auch in Deutschland.<br />
Schlager aus Filmen wie "Die drei von der Tankstelle" (1930) mit Heinz Rühmann oder "Der Kongreß<br />
tanzt" (1931) mit dem Traumpaar des deutschen Films Willy Fritsch und Lilian Harvey konnten nun von<br />
einem Millionenpublikum mitgesungen wer<strong>den</strong>. Waren 1929 nur acht von 183 deutschen Spielfilmen<br />
vertont, so veränderte sich die Relation ein Jahr später auf 101 von 146 Filmen. 1932 wur<strong>den</strong> bereits<br />
alle 127 in Deutschland produzierten Spielfilme als Tonfilme hergestellt. Tausende von Berufsmusikern<br />
wur<strong>den</strong> arbeitslos, die zuvor die Stummfilmvorführungen in <strong>den</strong> Kinos musikalisch untermalt hatten.<br />
(as)<br />
Quelle: Deutsches Historisches Museum<br />
www.dhm.de/lemo/html/weimar/kunst/lichtspiele/index.htm
Zeitgenössische Satire von Thomas Theodor Heine im Simplicissimus (Simpl-Woche für Filmregisseure 31.01.1927 Jg. 31, Heft 44,<br />
Seite 587; Erläuterung: »Metropolis« Regie Fritz Lang, Uraufführung 10.1.1927 Der Film ist in der ersten wie der zweiten Fassung<br />
(August 1927) kein Publikumserfolg)