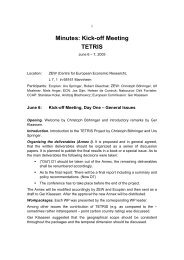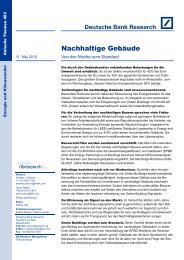Ergebnisse des Workshops des Praxisbeirats, Mannheim, 30.9.2008 ...
Ergebnisse des Workshops des Praxisbeirats, Mannheim, 30.9.2008 ...
Ergebnisse des Workshops des Praxisbeirats, Mannheim, 30.9.2008 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1<br />
<strong>Ergebnisse</strong> <strong>des</strong> <strong>Workshops</strong> <strong>des</strong> <strong>Praxisbeirats</strong>, <strong>Mannheim</strong>, <strong>30.9.2008</strong><br />
1. Diskussion nach Präsentation Projekt<br />
Erwartungen und Erkenntnisinteressen <strong>des</strong> <strong>Praxisbeirats</strong>:<br />
- Interesse an neuen Geschäftsideen (Helfrich), an Verbeserung <strong>des</strong> links Forschung-<br />
Praxis (Kallmann), an kulturellen und sozialen Aspekten (Schüle) sowie an Informationen<br />
über Kosten-Nutzen-Verhältnis von Regulierung (Gutzwiler)<br />
- Gegen „Baustein“-Denken (Weigl)<br />
- Neue Informationen bzgl. Barrieren z.B. bei Mikro KWK oder A-Klasse Geräten<br />
(Bödeker, Meixner)<br />
Fragen zur Eignung der Methodik (Conjoint Analyse):<br />
- bzgl. „Halbwertszeiten“ da es sich bei Energiesparmaßnahmen um Entscheidungen<br />
mit langfristiger Wirkung handelt;<br />
- Gefahr eines „hypothetical bias“ wird als hoch eingeschätzt (Bsp. Zahlungsbereitschaft<br />
für „grünen Strom“ in CH) (aber: <strong>Ergebnisse</strong> aus CH sind nicht unbedingt auf<br />
De übertragbar)<br />
- Relevanz individueller Konsumentscheidungen skeptisch zu beurteilen (Meixner),<br />
Konsumentscheidung vorwiegend institutionell bestimmt<br />
- Modellierung auch unbewußter bzw. Routine-Entscheidung sinnvoll (Kallmann)<br />
- Rationalitätsannahmen unrealistisch<br />
- unrealistische Anforderungen an kognitive Verarbeitungskapazität bei Vergleich von<br />
Alternativen bzgl. mehrerer Attribute (aber: es werden nicht alle Attribute gleichzeitig<br />
variiert) (Meixner, Abold)<br />
- Sind vorgegebene Ausprägungen der Attribute sinnvoll, oder besser individuelles<br />
Zusammenbasteln per Computer erlauben à la Automobilbeispiel; (anderes Bsp. wäre<br />
„Mix it baby“ Campagne von e.on mit Arnie für Strommix) (aber: Kosten der einzelnen<br />
„Module“ müssten bekannt sein) (Schüle)<br />
- Trennung der Entscheidungsebenen in Strom und Wärme wird für sinnvoll erachtet;<br />
Hinweise zu Befragungssubjekten<br />
- Nutzer-Investor Dilemma beachten, da insbes. Mieter nur begrenzt Einfluss auf<br />
Energieverbrauch in Gebäuden haben<br />
- Zielgruppen für Energiesparmaßnahmen im Gebäudebestand beachten: Zielgruppe 1<br />
sind junge Familien die Haus bauen/kaufen und einkommensbeschränkt sind; Zielgruppe<br />
2 sind „goldene 50er“, die nach Auszug der Kinder ihr Eigenheim fürs Alter<br />
auf Vordermann bringen;<br />
Hinweise zu Entscheidungskriterien für Befragung:<br />
- Finanzierung der Kaufentscheidung (Bsp. Japan) als Attribut berücksichtigen (besonders<br />
bei Investitionen im Gebäudebereich relevant – Innovatives Modell für Gebäude<br />
in Japan als Bsp. zero utility cost home (?)) (Jäger-Waldau)<br />
- Serviceleistung ist als wichtige Produkteigenschaft mit zu berücksichtigen;<br />
- Zweifel, dass sich Käufer an „total cost of ownership“ orientieren;
2<br />
- emotionale Gründe müssen bei Kaufentscheidung mit berücksichtigt werden; Herausforderung<br />
besteht darin, dies in Fragebogen abzubilden (Kallmann);<br />
- Gesamtressourcenverbrauch (stoffliche Dimension) im Lebenszyklus ist zu berücksichtigen;<br />
- „Convenience“ ist als Attribut zu erfassen;<br />
- grundsätzliche Frage, ob Nachhaltigkeit für Energiekonsumentscheidung überhaupt<br />
eine Rolle spielt;<br />
- Kriterien sind technologiespezifisch zu betrachten; zu allgemeine Darstellung nur<br />
bedingt zutreffend (Meixner);<br />
Sonstige Hinweise:<br />
- Genereller Ansatz <strong>des</strong> Projekts, die Nutzerpräferenzen zu berücksichtigen findet Zustimmung,<br />
zumal bisher vorherrschender „Bausteine-Ansatz“ zu kurz greift (Weigl);<br />
- Zustimmung, Gender-Aspekte über Tiefeninterviews zu Entscheidungsverhalten<br />
(qualitativer Ansatz) zu erforschen;<br />
- Interaktion der einzelnen Entscheidungskriterien (sozio-ökon. Faktoren etc.) nicht<br />
hinreichend dargestellt; Gesamt(schau); Bild mit Darstellung der Interaktionen fehlt;
3<br />
2. Diskussion Hypothesen<br />
Diskussion Allgemeine Hypothese: Profil <strong>des</strong> „nachhaltigen Energienutzers“<br />
Joachim Schleich<br />
Generelles: da Stellwand am Ende der Stellwandreihe stand, schafften es nur vergleichsweise<br />
wenige Teilnehmer; Diskussion mit „Zielpersonen“ war dafür sehr intensiv;<br />
1) Je höher das verfügbare Einkommen, <strong>des</strong>to eher kaufen Haushalte energiesparende<br />
Geräte/<strong>des</strong>to eher beziehen sie grünen Strom etc....<br />
Uneingeschränkte Zustimmung aller „Besucher“; inhaltlich lag die Diskussion eher auf<br />
dem Aspekt, dass sich „reichere Haushalte“ auch eher die teureren Geräte leisten könnten,<br />
denn auf der These, dass Haushalte mit höherem Einkommen auch eine höhere<br />
Zahlungsbereitschaft für saubere Umwelt hätten;<br />
2) Je höher der das Bildungsniveau, <strong>des</strong>to eher kaufen Haushalte energiesparende<br />
Geräte/<strong>des</strong>to eher beziehen sie grünen Strom etc....<br />
Auch diese Hypothese fand uneingeschränkte Zustimmung; diskutiert wurde u.a. auch<br />
der Zusammenhang mit Lifestyle; verhaltene Zustimmung zur Sub-Hypothese, dass<br />
Haushalte aus bildungsnahen Schichten besser informiert seien, oder eher in der Lage<br />
wären, die Lebenszykluskosten zu berechnen;<br />
3) Je mehr Personen in einem Haushalt leben, <strong>des</strong>to eher kaufen sie energiesparende<br />
Geräte<br />
Fand geteilte Zustimmung; da Haushalte mit höherer Kinderzahl ein niedrigeres pro<br />
Kopf Einkommen hätten, wären sie aus finanziellen Gründen u.U. nicht in der Lage, die<br />
höheren Anschaffungskosten für energiesparende Geräte zu schultern;<br />
4) Je älter und größer ein Wohngebäude, <strong>des</strong>to eher wird in energiesparende Maßnahmen<br />
investiert<br />
Eigentlich besteht die Hypothese aus zwei Teilen, Alter und Größe; Die Aussage gilt<br />
zudem nicht generell, sondern nur für bestimmte Energiesparmaßnahmen, insbesondere<br />
Wärmedämmung. Bei Wohngebäuden sei außerdem die Wohnlage zu berücksichtigen;<br />
in „heruntergekommenen Gegenden“ würde nichts investiert;
4<br />
Aus dem Kreis der Teilnehmer wurden darüber hinaus folgende Anregungen vorgebracht:<br />
- die generelle Einstellung zu ökologischen Themen ganz ist maßgebend für das<br />
Kauf/Investitionsverhalten;<br />
- das Alter der Entscheidungsträger spielt eine Rolle (allerdings keine klare Aussage, in<br />
welche Richtung)<br />
- generelle Aussagen für sämtliche Energiesparmaßnehmen sind schwer möglich; statt<strong>des</strong>sen<br />
müssten Hypothesen technologiespezifisch formuliert werden (z.B.Dämmung<br />
versus weiße Ware vs. Ökostrom)<br />
- der Wunsch nach „Selbstbestimmtheit“ kann auch dazu führen, dass z.B. in Ökostrom<br />
/ PV Anlage auf Dach / Solarthermie / Mikro-KWK investiert wird (Fremdbestimmung<br />
versus Selbstbestimmung)<br />
- Investor- Nutzer Dilemma ist unbedingt zu berücksichtigen;<br />
- Lebensstile spielen gerade beim Kauf von „umweltfreundlichen“ Produkten eine große<br />
Rolle („Lohas“)
5<br />
Diskussion Allgemeine Hypothese: Kostentransparenz<br />
Stefanie Heinzle (Universität St. Gallen)<br />
Teilnehmer:<br />
• Matthias Helfrich, Mitglied <strong>des</strong> Vorstands (Accera Venture Partners AG, <strong>Mannheim</strong>)<br />
• Hellmuth Frey, EnBW Energie Baden-Württemberg AG Karlsruhe<br />
• Roland Hellmer, Gruppenleiter Strategie, neue Produkte Wärme, Kälte, Vattenfall<br />
Europe Berlin AG & Co. KG, Berlin<br />
• Kerstin Kallmann, Berliner Energieagentur GmbH, Consulting, Kommissarische<br />
Bereichsleitung<br />
• Udo Sieverding, Bereich spezielle Verbraucherthemen, Gruppenleiter Energie,<br />
Verbraucherzentrale NRW e.V.<br />
Vorgehen: Diskussion von drei Hypothesen/Fragen mit Teilnehmern<br />
• These 1: Transparenz über die Höhe der Energiekosten (Labels, Energierechnungen)<br />
führt zu sparsamen Verbrauch<br />
• Matthias Helfrich und Hellmuth Frey (gemeinsame Diskussion)<br />
o Wenn Verbraucher ihren Verbrauch kennen, sind Minderungen von 10%<br />
<strong>des</strong> Haushaltes möglich<br />
o Markt funktioniert ohne Transparenz nicht<br />
o Der Verbraucher ist bis jetzt bewusst intransparent gehalten worden,<br />
auch weil die Energieanbieter damit Geld verdienen wollten<br />
o Diese Stromzähler gibt es ja min<strong>des</strong>tens seit dreißig Jahren und werden<br />
immer wieder ausgetauscht und bewusst nicht modernisiert<br />
• Roland Hellmer:<br />
o Aussage ist von der Höhe der Ausgaben für Energie abhängig: In welcher<br />
Höhe spielen die Kosten bei der Lebensgestaltung <strong>des</strong> Konsumenten<br />
eine Rolle?<br />
o Wenn man die Konsumenten fragt, wie viel sie für ihren Energiekonsum<br />
ausgeben, wissen weniger als 80% über die tatsächlichen Kosten ihres<br />
Energieverbrauchs Bescheid.<br />
o Diskussionen über Gas- und Strompreise werden zwar über die Medien<br />
geführt, aber trotzdem sind die Preise noch nicht so hoch, als dass sich<br />
die Leute wirklich darüber Gedanken machen.<br />
o Grundsätzlich stimmt die Aussage für die Konsumenten, für welche es<br />
dann eine Rolle in ihren Gesamtausgaben spielt.<br />
• Kerstin Kallmann:<br />
o Ja, das stimmt.<br />
o Es gibt ja schon Energielabels für Haushaltgeräte, es gibt auch Internetplattformen<br />
für einen Preisvergleich.<br />
o Der ausschlaggebende Grund sind aber oftmals nicht die Kosten, sondern<br />
der Umweltgedanke (oder „es muss sexy sein“), wie z.B. weshalb die<br />
Nachfrage nach den SUV gesunken ist: das hat nicht nur mit den Sprit-
6<br />
kosten zu tun, sondern auch, weil es mittlerweile auch schon etwas peinlich<br />
wird so ein Auto zu besitzen.<br />
• Udo Sieverding: Ja stimmt.<br />
• Frage 2: Müssen intelligente Zähl- und Messsysteme (Smart Meters) staatlich<br />
vorgeschrieben werden?<br />
• Matthias Helfrich und Hellmuth Frey (gemeinsame Diskussion)<br />
o Marktpotential für Zähl-und Messsysteme ist generell vorhanden<br />
o Wo Marktversagen vorkommt (wie im Falle von Zähl- und Messsysteme)<br />
ist staatliches Einschreiten gerechtfertigt; z.B. wenn ein Stromkunde<br />
zu seinem Stromanbieter geht und einen intelligenten Stromzähler<br />
wünscht, der aber nicht bereit ist einen solchen Stromzähler anzubieten.<br />
o Dort wo es ein Monopol gibt, und der Zähler ist ein Monopol, mit dem<br />
sehr viel Geld verdient wird muss es jemand geben der das kontrolliert.<br />
Es kann auch der Markt sein, wenn er in Gang kommt.<br />
o Messdienstleister misst Stromverbrauch ab und der Messstellenbetreiber<br />
bietet den Zähler an, das kann der Energieversorger sein, das muss es<br />
aber künftig nicht mehr.<br />
o Es gibt noch keinen Messstellenbetreiber, weil der die Zustimmung vom<br />
Energieversorger braucht, dass er seiner Messstellentätigkeit nachkommen<br />
kann. Die Verhandlungen laufen schon in diese Richtung an. Das<br />
Gesetz ist Anfang <strong>des</strong> Monats erst in Kraft getreten. Es gibt Firmen, die<br />
sich für das Thema Messstellenbetreiber interessieren, weil da ist schon<br />
letztlich Geld zu verdienen (Marktpotential ist da)<br />
• Roland Hellmer: Ja, das wäre die Konsequenz ja, wenn man das erzwingt führt<br />
das zu Kostentransparenz<br />
• Kerstin Kallmann: Ja<br />
• Udo Sieverding: Ja stimmt.<br />
o Thema <strong>des</strong> Datenschutzmissbrauch ist hier jedoch zu beachten.<br />
o Verbraucherzentralen sind da mit Sicherheit dagegen.<br />
o Wenn dieses Datenschutzmissbrauchsproblem nicht beherrschbar wird,<br />
weil es immer Probleme gibt oder anders genutzt wird, wo man gedacht<br />
hat, das bekommt man in Griff. Ich hab da jedoch schon große Hoffnung.<br />
• These 3: Private Unternehmen sind als Informationsquelle weniger glaubwürdig<br />
als staatliche Agenturen.<br />
• Matthias Helfrich und Hellmuth Frey (gemeinsame Diskussion)<br />
o Ein konsistenter Informationsfluss über Energieverbrauch ist Voraussetzung<br />
für intelligentes Energienutzen<br />
• Frey: Nicht unbedingt.
7<br />
o Frage ist, welches private Unternehmen schaue ich mir an?<br />
o Wenn ich aus der Energiebranche komme, dann mag das vielleicht<br />
stimmen, da wird uns weniger geglaubt als in anderen Branchen,<br />
aber private Unternehmen, z.B. Miele die Werbung für ihre Geräte<br />
macht, für Leute die sich das auch leisten können.<br />
o In gewissen Fragestellungen glauben die Konsumenten den Unternehmen<br />
min<strong>des</strong>tens gleich viel wie staatlichen Unternehmen. "Da<br />
kann sich eine Agentur hinstellen und sagen, die Geländewagen<br />
brauchen 3 mal so viel Sprit wie ein normales Auto, aber trotzdem<br />
kauft man diese Auto. Warum soll Vodafone unglaubwürdig<br />
sein als Informationsquelle für die Kosten und Länge <strong>des</strong> Telefongesprächs?<br />
Ich glaube die Glaubwürdigkeit hängt nicht damit<br />
zusammen, privat oder staatlich, sondern mit der verwendeten<br />
Technik, z.B. ein elektronische Technik ist immer glaubwürdiger<br />
als eine Postkarte, die irgendein Kunde oder ein Ableser ausfüllt<br />
wo er die Kilowattstunde <strong>des</strong> Stromlesers abmisst; ja was meinen<br />
Sie wie viel Schreibfehler hier vorkommen?"<br />
• Rolland Helmer: Ja, das hätte ich gesagt, das stimmt.<br />
• Kerstin Kallmann: Ja.<br />
• Udo Sieverding: Ja nicht unbedingt. Ein Unternehmen, das dies nicht zu plump<br />
macht, z.B. im Hornbach gibt es ja jetzt auch Energieberater. Kann auch ganz interessant<br />
sein, der Verbraucher weiß, dass Hornbach das Ziel hat, Baumaterialien<br />
zu verkaufen, aber wenn die Beratung gut ist ,wieso eigentlich nicht.
8<br />
Diskussion Allgemeine Hypothese: Determinante Preise<br />
Chair: Klaus Rennings (ZEW)<br />
Teilnehmer:<br />
• Maurice Bödeker, ZVEI<br />
• Matthias Helfrich, Accera Ventures<br />
• Kerstin Kallmann, Berliner Energieagentur GmbH, Consulting, Kommissarische<br />
Bereichsleitung<br />
Vorgehen: Diskussion von drei Hypothesen mit Teilnehmern<br />
• These 1: Die Höhe der Energiepreise ist entscheidend für nachhaltigen Energiekonsum<br />
• Allgemeine Zustimmung: Drei grüne Punkte für Hypothese<br />
• Hinweise auf mögliche Spezifikationen:<br />
- Nicht nur aktuelle Preise, sondern auch Erwartungen über Preisentwicklung<br />
sind wichtig<br />
- gilt nur für „ehrliche“ Steigerungen, nicht für spekulative Preisbewegungen<br />
• These 2: Eine Verteuerung der Energiepreise ist Voraussetzung für einen (ökologisch)<br />
nachhaltigen Energiekonsum<br />
• Allgemeine Zustimmung: 3 grüne Punkte<br />
• Interesse Praxisbeirat: Alternative Strategien (Preise vs. Standards) sollten in<br />
SECO@home simuliert werden<br />
• These 3: Ohne Preissignale verpuffen Einsparerfolge, weil die Konsumenten ihr<br />
Geld dann für andere energieverbrauchende Tätigkeiten ausgeben (z.B.<br />
Fernreisen).<br />
• Teilweise Zustimmung: 2 grüne Punkte<br />
• Hinweise für Spezifikationen: Geld kann auch in andere Effizienztechnologien<br />
fliessen
9<br />
Diskussion Allgemeine Hypothese: Rolle von Einstellungen und Lebensstilen<br />
Chair: Christoph Timpe, Bettina Brohmann<br />
Aus der Literatur kann keine klare Schlussfolgerung zur Wirkung von Lebensstilen auf<br />
den Energieverbrauch gezogen werden. (2 grüne Punkte)<br />
Kommentare (Karten):<br />
d.h. Energieverbrauch und Lebensstil nicht spezifisch für best. Bevölkerungsgruppen<br />
Hypothese müsste ausdifferenziert werden<br />
nachhaltiger Energiekonsum spielt bei der Lebensgestaltung eine untergeordnete Rolle<br />
soziale Trends beachten: sexy ↔ uncool<br />
Lebensstile existieren quer durch alle Bevölkerungsgruppen und sind am ehesten getrennt<br />
nach Handlungsfeldern (Wohnen, Ernährung, Transport) zu definieren. (1 grüner<br />
Punkt)<br />
Kommentare (Karten):<br />
Transaktions-Kosten unterschiedlich hoch (z.B. Stadt-Land Gefälle)<br />
geogr. Rahmen/Wohnumfeld → Information schwieriger erhältlich, weniger eingebunden<br />
Es ist zu fragen, wie bewegen sich Konsumenten innerhalb ihrer jeweiligen Optionen<br />
Der „nachhaltige Energieverbraucher“ verfügt über ein vergleichsweise hohes Einkommen<br />
und hohe Bildung, wohnt in vergleichsweise großen Wohnungen (Flächenverbrauch!),<br />
ist aber bereit, diese nachhaltig zu nutzen (offen für technische Investitionen<br />
wie z.B. Solaranlage, Mikro-KWK). (2 grüne, 1 roter Punkt)<br />
Kommentare (Karten):<br />
effiziente Geräte aber mehr Anwendungen (können sich hocheffiziente Geräte leisten,<br />
und gleichzeitig mehr „Spielereien“)<br />
„Schöner wohnen“ vs. Verbrauch/Beschränkung<br />
Weniger Investitionen, dafür aber Verbrauchsanstieg durch mehr Technologien<br />
Benchmark/Person → evtl. dann weniger Unterschiede zwischen den Verbrauchergruppen<br />
Insgesamt wurde die letzte These auch kritisch gesehen und der Aspekt der Suffizienz<br />
angesprochen
10<br />
Diskussion Methodischer Ansatz: Strom vsd. Wärme<br />
Diskutanten: Martin Achtnicht, Lukas Gutzwiler, Roland Abold<br />
Fakt 1: Ein Euro kann nur einmal ausgegeben werden!<br />
Frage: Sind Entscheidungen über energieeffiziente Nutzung von Wärme und/oder Strom<br />
unabhängig voneinander?<br />
− generell: HHe unterliegen einer Budgetrestriktion unter der sie ihre Bedürfnisse<br />
zu befriedigen versuchen Zielkonflikte sind vorprogrammiert (Den Euro, den<br />
ich mehr verheize, kann ich nicht mehr für ein energieeffizienteres HiFi-Gerät<br />
ausgeben.)<br />
− Energiekosten steigen (Strom und Wärme!) HHe suchen nach Möglichkeiten<br />
Kosten zu sparen (Strom und/oder Wärme!?)<br />
− Die Bereiche „Wärme“ und „Strom“ sollten trotzdem nicht gemeinsam in einer<br />
Conjoint-Analyse betrachtet werden, weil – neben methodischen Schwierigkeiten<br />
– sich für die meisten HHe in der Realität entsprechende Wahlsituationen<br />
nicht stellen.<br />
− Im Bereich „Wärme“ kann es aber durchaus sinnvoll sein, Alternativen der Substitution<br />
(z.B. neue, energieeffiziente Heizung) und Alternativen der Einsparung<br />
(z.B. Gebäudedämmung) gegenüber zu stellen – sofern man die richtige Zielgruppe<br />
befragt (d.h. konkret: Leute, die gerade ihr Haus bauen bzw. renovieren,<br />
denn die machen sich genau über derartige Fragen Gedanken).<br />
− (an)diskutierte Probleme aus methodischer Sicht:<br />
a) Nicht allen Wohnformen (Eigentum vs. Miete und Haus vs. Wohnung) stehen<br />
alle Alternativen der Substitution und der Einsparung gleichermaßen zur Verfügung.<br />
ggf. getrennte Befragung von Eigentümern und Mietern sinnvoll<br />
b) Die verschiedenen Alternativen müssen sich gegenseitig ausschließen.<br />
vorgeschlagene nachgelagerte Abfrage von konkreten Alternativen-<br />
Kombinationen scheint möglich und sinnvoll zu sein<br />
c) Verschiedene (heterogene) Alternativen sinnvoll durch gemeinsame Attribute<br />
beschreiben.<br />
d) Die choice sets dürfen nicht „zu groß“ geraten (betrifft: Anzahl der Alternativen<br />
sowie Anzahl der Attribute und deren Ausprägungen)<br />
generell ist einen enge Abstimmung bzgl. <strong>des</strong> Befragungs<strong>des</strong>igns mit dem beauftragten<br />
Marktforschungsinstitut empfehlenswert<br />
Fakt 2: Der Staat kann nicht beliebig fördern!<br />
Frage: Wie soll der Staat wissen, welche Technologie/Technologiekombination den<br />
größten ökologischen Nutzen bei gegebener Budgetbeschränkung stiftet?<br />
− „First-Best“-Technologie muss nicht zwingend von HHe positiv angenommen<br />
werden theoretisches Potential kann (aufgrund der anders liegenden Präferenzen<br />
der HHe) praktisch nicht ausgeschöpft werden<br />
− Energiepolitische Instrumente sowie der rechtliche Rahmen müssen durch den<br />
Staat zielführend ausgestaltet werden.
11<br />
Diskussion Gender-Hypothesen<br />
Männer kaufen anders? Frauen auch!<br />
Welche Erfahrungen haben Sie mit Männern und Frauen als KäuferInnen gemacht?<br />
Wer sind die typischen KäuferInnen?<br />
Typologie ist generell schwierig, Entscheidungen sind sehr individuell, auch gibt es<br />
immer wieder unerwartete Typen, z.B. den CSU-Lokalpolitiker, der es „cool findet im<br />
Sommer seine Solardusche zu haben und kein Öl zu brauchen“<br />
Relevant sind biographische Brüche, life events, z.B. Haushaltsgerätekauf zu Studienbeginn,<br />
erste eigene Wohnung, Scheidung etc.<br />
Klassische Familienstruktur wird immer seltener, ist Minderheit, wir müssten noch viel<br />
mehr Lebensformen unterscheiden, nicht nur das heterosexuelle Paar mit Kindern<br />
(ABER: es ist dies einer der Haupttypen beim Hausbau)<br />
Entscheidend für Beratungsprozess und Ergebnis ist vor allen Dingen auch die Situation<br />
<strong>des</strong> Hauses, neben den Präferenzen und Wünschen der Bau“herren“ bestimmen diese<br />
Gegebenheiten, was sinnvoll ist.<br />
Unterscheiden sich Männer und Frauen in Bezug auf Interesse, Kriterien, Entscheidungen?<br />
Frauen kaufen stärker nutzenorientiert<br />
Wer trifft in einem Haushalt die Kaufentscheidung?<br />
a) bei jüngeren Paaren (junge Familien): gemeinsam, es ist auch eher wichtig, dies<br />
gemeinsam zu tun<br />
b) bei älteren Paaren (empty nest): der Mann, die Frau kocht den Kaffee<br />
Generationenunterschiede im Geschlechterverhältnis<br />
(Sieverding und Weigl)<br />
Der Entscheidungsprozess in partnerschaftlichen Haushaltungen dauert länger (Weigl)
12<br />
Steht die Entscheidung in Abhängigkeit zur Verteilung von Erwerbs- und Familienarbeit<br />
im Haushalt?<br />
Gibt es bestimmte Aspekte einer Technologie, die man als besonders "männlich"<br />
oder "weiblich" bezeichnen kann?<br />
Mythos Unabhängigkeit, der z.B. beim „Wärmepumpen-Hype“ der letzten Jahre ein<br />
relevanter Faktor war, ist eher männlich konnotiert bzw. wird ausschliesslich von Männern<br />
genannt. (Weigl erzählt daraufhin von einem Mann, für den das Unabhängigkeitsargument<br />
aufgrund von Waldbesitz plausibel gewesen wäre, der es aber nicht nutzte<br />
und auch nicht nutzen wollte).<br />
Erscheinen umweltfreundliche Technologien als weniger "männlich" im Vergleich<br />
zu Gross- und Risikotechnologien?<br />
Widerspruch in der Beratung: es müssen Amortisationszeiten berechnet werden, bzw.<br />
das wird von Kunden verlangt, dabei geht es ja vor allem auch um Behaglichkeit und<br />
warme Räume, dies wird auch durch die Bafa-Strategie in den Hintergrund gerückt<br />
Motivation für Zuschüsse und Förderung: „Orden“, „Umsonst-Mentalität“, „besser<br />
jetzt als später“, bei Passivhäusern auch viel Pioniergefühl<br />
Unterschiedliche Akzeptanz bei Wohnbaugenossenschaften: Solar von Mietern akzeptiert,<br />
was noch? Allgemein scheint zu gelten: Anlage muss sichtbar sein (Wohnzimmer,<br />
Dach)<br />
Nur wenige nehmen Energieberatung in Anspruch, eventuell dadurch Verzerrung<br />
Vertriebskanäle (Weigl)<br />
- Energieberatung & Handwerker<br />
- Messen haben grosse Relevanz<br />
- Wichtige Messen: Renexpo Augsburg (Auch verbraucher), Clean Energy Power<br />
Stuttgart, März 09 (ähnlicher Fokus wie Renexpo), Heim & Handwerk, München,<br />
ca. November 08, weiterer Fokus, aber auch erneuerbare Energien, die<br />
immer wichtiger werden.
13<br />
Diskussion vergessene Hypothesen?<br />
Es wurde hier insbesondere vom Praxisbeirat darauf hingewiesen, dass der Konsument<br />
nicht wirklich die Entscheidungsfreiheit hat, die wir ihm unterstellen. Über die Zeit<br />
hinweg, werden die heute definierten Standards (so die These) zu den kostengünstigsten<br />
Technologien von Morgen. Der Konsument entscheidet <strong>des</strong>halb nicht frei, sondern in<br />
dem Sinne pfadabhängig, in dem die Gesellschaft das wünschenswerte Ziel vorgibt.<br />
Der Ansatz <strong>des</strong> Projektes sollte somit generell nochmals überdacht werden. Es ist nicht<br />
klar, wie in dem Modell zur Bestimmung der Kundenpräferenzen diese gesellschaftlich<br />
definierten Technologievorgaben berücksichtigt werden können.
14<br />
3. Diskussion in Kleingruppen<br />
Kleingruppe Wärme<br />
Chair: Rolf Wüstenhagen, Uni St. Gallen<br />
Protokoll: Bettina Brohmann, Öko-Institut<br />
• CO2 Emissionen spielen (nur) zur ex Post Rationalisierung eine Rolle beim Kaufentscheid.<br />
Primär zählen emotionale Vorlieben (Mythen) beim Individuum und<br />
sozialen Netzwerk<br />
• Sichtbarkeit der Anlagen ein wichtiger Aspekt (z.B. Pellet in Wohnung, Solarthermie,<br />
PV)<br />
• Konkrete Profile typischer Zielgruppen, z.B.<br />
o BHKW: FH-Ingenieur, Märklin.<br />
o PV1: Physiklehrer<br />
o PV2: Landwirt (Anlageentscheid)<br />
• 3 Zielgruppen EFH:<br />
o a) junge Familie<br />
o b) Arrivierte Zweithauskäufer<br />
o c) 50-60jährige "Hütte auf Vordermann bringen"<br />
• Autonomie/Autarkie: relevant bei manchen Zielgrupen, z.B. 1) kollektiv (Bioenergiedorf),<br />
2) individuell (Pellet)<br />
• Convenience (z.T. auch bei Pellet)<br />
• Dimensionen <strong>des</strong> Entscheidungsprozesses (Havarie vs. geplant, MFH vs EFH,<br />
Window of Opportunity)<br />
• Mieter: Haben Einfluss auf Investitionsentscheidung, Akzeptanz Sanierungsmassnahmen<br />
(z.B. Solar)<br />
• Heizung vs Dämmung: selten Gesamtkonzept (1 % Energieberatung), oft separate<br />
Entscheidung, Förderpraxis verleitet zu kfr. Wirtschaftlichkeitsdenken)<br />
• Fördermittel alleine helfen (Sparfuchs, Lob vom Staat, clever)
15<br />
Kleingruppe Haushaltsgeräte<br />
Chair: Joachim Schleich, ISI Fraunhofer, Karlsruhe<br />
Protokoll: Georg Bühler, ZEW, <strong>Mannheim</strong><br />
Teilnehmer:<br />
• Dr. Ulrich Denkhaus (Germanwatch, Berlin/Bonn)<br />
• Matthias Helfrich (Accera Vernture partners AG, <strong>Mannheim</strong>)<br />
• Jan Maurice Bödeker (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie, Abteilung<br />
Umweltschutz)<br />
Erkenntnissinteresse: Welche Eigenschaften und welche Haushaltesgeräte sollen in<br />
der Conjoint Untersuchung berücksichtigt werden?<br />
Vorgehen der Kleingruppe: Diskussion von ausgewählten Thesen mit Teilnehmer <strong>des</strong><br />
Praxisrats.<br />
These 1: Qualität und Preis sind wichtiger als Energiekosten<br />
Die Frage, ob die kurzfristig anfallenden Kosten (Anschaffungskosten) wichtiger als die<br />
langfristigen Kosten (Betriebskosten) wurde aufgeworfen. Darstellung der Frage ist<br />
nach Auffassung der Beiratsmitglieder (BM) nicht richtig. Diese These kann weder befürwortet<br />
noch verneint werden, da die Energiekosten bei den Haushaltsgeräten nicht<br />
ausgewiesen werden.<br />
Bei zahlreichen Haushaltsgeräten (außer bei Kühlschränken) sind die Energiekosten von<br />
der Nutzungsinstensität und –form abhängig. Ein typisierter Betriebskostenvergleich<br />
wäre sinnvoll und nötig. Das Problem ist jedoch, dass bei sich ständigen ändernden<br />
Preisen die „Etikettierung“ der Betriebskosten ebenso ständig geändert werden müssten.<br />
Dies ist für den Handel weder umsetzbar noch sinnvoll. Andere Unsicherheiten wie z.B.<br />
unterschiedliche Nutzungen müssten dann auch berücksichtigt werden.<br />
Eine an sich gewünschte Lebenszyklusanalyse der Kosten wäre zwar wünschenswert,<br />
allerdings ist sie wegen der großen Unsicherheiten hinsichtlich der Energiepreise und<br />
Nutzung nicht sinnvoll. Deshalb wird vom Beirat vorgeschlagen, die Formulierung der<br />
These umzudrehen. Sie sollte lauten: „Energieeffizienz ist kein prioritäres Kaufargument<br />
für die Entscheidung.<br />
These 2: Welche Eigenschaften sind für die Entscheidung wichtig?<br />
Es wurden bei weißer und brauner Ware folgende Eigenschaften/Attribute als relevant<br />
angesehen:<br />
1. Das Produkt<strong>des</strong>ign<br />
2. Die Innovationsfreude (wenn neues Produkt, dann min<strong>des</strong>tens „State of the Art“)
16<br />
3. Funktionalität der Produkte<br />
4. Langlebigkeit<br />
5. Kaufpreis<br />
6. Energieverbrauch<br />
In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass bei einigen Eigenschaften/Attributen<br />
gewisse Schwellenwerte min<strong>des</strong>tens erreicht werden müssen (Must have!).<br />
z.B. Wenn ich mir einen Kühlschrank für 1000 Euro kaufe, dann muss der min<strong>des</strong>tens<br />
A++ sein, den Aluminiumlook haben, …<br />
Oft wird den Kunden (z.B. durch Werbung) bei Kaufentscheidungen suggeriert, dass<br />
viel gleich gut ist. So stellt sich die Frage, ob ein Staubsauger mit 2000 Watt tatsächlich<br />
besser saugt als einer mit 1200 Watt. In der Werbung wird jedoch auf die hohe Wattzahl<br />
verwiesen.<br />
Deshalb wurde nochmals die Frage nach der Rationalität der Entscheidung von Konsumenten<br />
gestellt. Dem wurde erwidert, dass unter gegebenem Wissen (wie auch immer<br />
dies entstanden ist) der Kunde sich rational verhält. Das Problem ist lediglich, dass das<br />
Wissensdefizit zu an sich unlogischen/irrationalen Entscheidungen führen kann.<br />
These 2: Welche Haushaltsgeräte sollen in der Untersuchung berücksichtigt werden?<br />
Der Praxisbeirat sprach sich für die großen Energienachfrager (z.B. Kühlschrank) aus.<br />
Die Frage nach Klimaanlagen als Untersuchungsgegenstand war nicht von Anfang an<br />
ersichtlich. <strong>des</strong>halb wurde die Argumentation, warum der Fokus auf Klimaanlagen liegen<br />
könnte nochmals erklärt. (Zum einen sind die aktuellen Haushaltsgeräte bereits<br />
technisch sehr stark ausgereift. Es werden keine weiteren „Quantensprünge“ erwartet.<br />
Die Klimaerwärmung wird vielleicht dazu führen, dass Haushalte vermehrt auch für den<br />
privaten Bereich Klimaanlagen kaufen werden. Dann sollte man schon von Anfang an<br />
darauf achten, dass (a) die Kundenwünsche berücksichtigt werden und (b) ökologisch<br />
sinnvolle Anlagen gekauft werden. Wie ist dies möglich?...<br />
Dennoch sprach sich der Beirat für die Untersuchung herkömmlicher Technologien aus.<br />
Die Frage nach brauner oder weißer Ware konnte aufgrund der zeitlichen Einschränkung<br />
noch nicht abschließend diskutiert werden. Es spricht einiges dafür, die Großverbraucher<br />
zu nehmen. Allerdings wurde auch auf den stark steigenden Anteil <strong>des</strong><br />
häuslichen Energieverbrauchs durch Computer etc. eingegangen. Hier wurde explizit<br />
auch auf die Tatsache verwiesen, dass der Internetzugang (Flatrate) und die grenzenlosen<br />
Speicherkapazitäten im Internet (Servern) dazu führen, dass der Energieverbrauch<br />
zwar nicht bei den Haushalten direkt anfällt (sondern bei den Anbietern dieser Flatrates<br />
und Datenspeicherkapazitäten), aber durch deren Entscheidungen begründet sind.
17<br />
Kleingruppe Öko-Strom<br />
Chair: Christoph Timpe, Öko-Institut, Freiburg<br />
Protokoll: Stefanie Heinzle, Universität St. Gallen<br />
Teilnehmer:<br />
• Lukas Gutzwiller: Bun<strong>des</strong>amt für Energie, Programmleiter energiewirtschaftliche<br />
Grundlagen<br />
• Dr. Arnulf Jäger-Waldau: Gruppenleiter, Renewable Energies Unit, European<br />
Commission, DG JRC, Institut for Energy<br />
• Roland Abold: GfK – Gesellschaft für Konsumforschung, Nürnberg<br />
• Klaus Rennings: ZEW, <strong>Mannheim</strong><br />
Erkenntnissinteresse: Motive der Haushalte bei der Kaufentscheidung von Öko-<br />
Strom, Erwartungen an Öko-Stromprodukte, Erwartungen an die Anbieter im Öko-<br />
Strom-Bereich, Zahlungsbereitschaften für Ökostrom, Erfolgsfaktoren, Bedeutung für<br />
den Rest <strong>des</strong> Strommarktes;<br />
Vorgehen der Kleingruppe: Diskussion von 4 ausgewählten Thesen mit Teilnehmer<br />
<strong>des</strong> Praxisrats.<br />
• These 1: Ökostrom-Kunden erwarten einen Strommix ohne Atomkraft und mit<br />
wenig fossilen Energien<br />
• Die meisten Konsumenten wollen erneuerbare Energien in ihrem Strommix.<br />
• Besonders umweltbewusste Konsumenten wollen nur erneuerbare Energien in<br />
ihrem Strommix.<br />
• Ökostrom-Kunden sind von Haus aus gegen Atomstrom eingestellt.<br />
• Diese Einstellung ist einseitig geprägt von einem gewissen Wunschdenken,<br />
dass die Stromversorgung ohne Kernenergie gewährleistet wäre, somit dass<br />
die Umwelt ohne Kernenergie sauberer wäre.<br />
• Wenn aber CO2-Minderung im Vordergrund gestellt wird, dann wäre Atomenergie<br />
die effektivste Energieform.<br />
• Ökostrom ohne Kernenergie ist somit Wunschdenken der Konsumenten.<br />
• Versorgungssicherheit und Stromlücke (z.B. in der Schweiz wo es keine Gaskraftwerke<br />
gibt) in der Schweiz ein großes Thema. Die linken Politiker setzen<br />
auf Ökostrom, die rechten Politiker auf Kernkraft; die Konsumenten
18<br />
wollen nichts von Gaskraftwerken wissen, da sie befürchten, von Russland<br />
abhängig zu werden.<br />
• In Deutschland spielt diese Versorgungssicherheit (z.B. Stromausfälle) keine<br />
Rolle, da dies als Hygienefaktor für alle Stromanbieter als gegeben gesehen<br />
wird; für Ökostrom spielt Abhängigkeit von anderen Länder / Ressourcenverfügbarkeit<br />
derzeit noch eine gering Rolle bei der Entscheidung für ein<br />
Stromanbieter (Quelle: GfK)<br />
• Erneuerbare Energien tragen Label der Versorgungs-Unsicherheit (Argument<br />
der Gegner für Ökostrom), z.B. Wind weht nicht die ganze Zeit.<br />
• Fluktuierende EE-Erzeugung schreckt daher vom Ökostromkauf ab.<br />
• Energiepolitische Diskussion wirkt jedoch, dass erneuerbare Energien bevorzugt<br />
werden.<br />
• These 2: Auch die Mehrheit aller Stromkunden bevorzugt einen Strommix aus<br />
erneuerbaren Energien mit wenig fossilen Energien, möchte hierfür aber<br />
keine höheren Preise zahlen.<br />
• Diskrepanz zwischen dem, was der Kunde sagt, und dem, was der Kunde auch<br />
wirklich tut.<br />
• Angebot an erneuerbaren Energien im Strommix ist da, trotzdem ist Marktanteil<br />
auffallend klein.<br />
• Viele Konsumenten haben keine Ahnung wie ihr Strommix aussieht.<br />
• Rechnung muss heutzutage jedoch den Strommix ausweisen, theoretisch ist daher<br />
davon auszugehen, dass dem Kunde bewusst sein müsste, was für einen Strommix<br />
er bezieht.<br />
• Strommixkennzeichnung und Labeling schaffen somit Transparenz, nur dadurch<br />
kommt der Markt ins Rollen und es kann garantiert werden, dass der Kunde seiner<br />
Auswahlmöglichkeit bewusst ist.<br />
• Bewusstsein in der Bevölkerung ist in den letzten Jahren entstanden.<br />
• Trotzdem ist kaum eine Mehrpreisakzeptanz für Öko-Strom in der breiten Masse<br />
vorhanden.<br />
• Wenn es eine individuelle Kaufentscheidung bleibt, bleibt Ökostrom ein Nischenprodukt.<br />
• Beispielsweise, die E.On – Kampagne “ Mix it baby“ mit Arnold Schwarzenegger<br />
war nicht erfolgreich, weil sich zu diesem Zeitpunkt wenige mit der Thematik<br />
beschäftigt haben und einen grossen Energieversorger wenig Vertrauen geschenkt<br />
wurde (Stichwort „EWE ist großes Unternehmen, dem glaube ich sowieso<br />
nicht“)<br />
• Daher kann Anteil an Ökostrom kann nur gesteigert werden, wenn nichtfreiwillige<br />
Maßnahmen angewandt werden.
19<br />
• These 3: Die Mehrzahl der Stromkunden hat keine realistische Einschätzung<br />
von dem Preisverhältnis zwischen Ökostrom und „normalen Strom“<br />
• Großteil der Stromkunden hat keine Ahnung, was Strom überhaupt kostet.<br />
• Großteil der Kunden kauft Ökostrom nicht, weil sie glauben, dass er extrem teuer<br />
ist ( Informationsdefizit).<br />
• Aus diesem Grund ist der Markt der Privatkunden für Ökostrom auch noch nicht<br />
so weit entwickelt wie der Markt für Geschäftskunden.<br />
• Fehlen<strong>des</strong> Bewusstsein für Strompreise und Ökostrom-Mehrkosten hemmt die<br />
Nachfrage nach Öko-Strom.<br />
• These 4: Ökostrom-Kunden setzen Signale gegen große Energiekonzerne<br />
• Ökostrom-Kunden erwarten unabhängige Anbieter (Geringes Vertrauen in große<br />
Energiekonzerne, welche Ökostrom parallel zu „schmutzigeren“ Strommixes<br />
anbieten).<br />
• Besonders Zielgruppe LOHAs wollen Signale gegen große Energiekonzerne setzen<br />
(Ökobuttermilch von Müller Milch würden sie beispielsweise auch nicht<br />
kaufen)<br />
• Konsumenten haben generell mehr Vertrauen in regionale Stromanbieter (im Vergleich<br />
zu großen Stromanbieter) die Ökostrom anbieten.<br />
• Ökostrom-Kundschaft scheint sehr kritisch sein.<br />
• Reine Ökostrom-Anbieter haben eine höherer Glaubwürdigkeit gegenüber erneuerbare<br />
Energien als große Energiekonzerne, welche Ökostrom zusätzlich in ihrem<br />
Sortiment führen.<br />
Zusätzliche <strong>Ergebnisse</strong> der Kleingruppe Ökostrom<br />
• Stromkennzeichnung schafft Transparenz zum Strommix<br />
o Möglicherweise intelligenter Stromzähler, der CO2-Ausstoss misst<br />
• Ökostrom ist ein (wachsender) Nischenmarkt<br />
o Marketingpotential ist noch nicht ausgeschöpft<br />
• Strom: vom Low-Interest zum Lifestyle-Produkt?<br />
o Intelligente Stromzähler (z.B. Smart Meters) könnten bunt und digital<br />
gestaltet sein und nicht schwarz mit einem Rädchenzähler<br />
o Stromzähler nicht mehr im Keller, sondern im Wohnraum<br />
o Somit schafft man ein Lifestyle Produkt – „Ich bin Ökostrom-Kunde<br />
und ich steh dazu und ich fühle mich echt gut dabei“<br />
o Kann durch soziale Kontakte /Akzeptanz verbreitet werden<br />
o Damit kann politisches und Lebensstil-thematisches Signal gesetzt<br />
werden<br />
o Dadurch kann soziale Kontrolle geschaffen werden
20<br />
• Glaubwürdigkeit bezüglich erneuerbare Energien der Stromanbieter spielt eine<br />
große Rolle<br />
Mögliche Auswirkungen für Attribute: Kommentare Stefanie Heinzle<br />
1. Sortiment <strong>des</strong> Stromanbieters<br />
Attribut Attributsausprägungen<br />
Sortiment Nur Strom aus erneuerbaren<br />
Energien<br />
<strong>des</strong> Stromanbieters<br />
Strom aus<br />
erneuerbaren<br />
Energien<br />
und Kernenergie<br />
im<br />
Angebot<br />
Strom aus<br />
erneuerbaren<br />
Energien<br />
und fossilen<br />
Energien im<br />
Angebot<br />
Nur Strom<br />
aus fossilen<br />
Energien und<br />
Kernenergie<br />
im Angebot<br />
Hier müsste aber noch zunächst geklärt werden, in wie weit wir dann den Strommix als<br />
Attribut an das Attribut Sortiment <strong>des</strong> Stromanbieters koppeln müssten (also z.B.<br />
Strommix 100% Wasserkraft kann in der Conjoint-Analyse nicht mit Attributsausprägung<br />
„Nur Strom aus fossilen Energien und Kernenergie im Angebot“ angeboten werden)<br />
2. Versorgungssicherheit<br />
Die "politische Unabhängigkeit" könnte durch das Attribut "Ort der Stromproduktion"<br />
abgetestet werden.<br />
Attribut Attributsausprägungen<br />
Ort der In Ihrer Region<br />
Stromproduktion<br />
In<br />
Deutschland<br />
In der<br />
Schweiz/ In<br />
Österreich<br />
In Osteuropa<br />
3. Mögliche Stromausfälle pro Jahr<br />
Die private Versorgungssicherheit könnte durch das Attribut "Stromausfälle pro Jahr"<br />
getestet werden.<br />
Attribut Attributsausprägungen<br />
Stromausfälle<br />
pro Jahr<br />
1 Stromausfall pro Jahr 2 Stromausfälle<br />
pro Jahr<br />
3 Stromausfälle<br />
pro Jahr<br />
4 Stromausfälle<br />
pro Jahr
21<br />
4. Lifestyle<br />
Wie bekommt man die emotionale Komponente mit rein in die Befragung („quasi wie<br />
testet man ab, ob Potential besteht, dass Ökostrom zu Lifestyle Produkt wird?) Vielleicht<br />
mit unterschiedlichen Werbeplakate (von „langweilig“ bis „trendy“)<br />
Attribut Attributsausprägungen<br />
Werbung Bsp. 1 Bsp. 2 Bsp. 3<br />
Fazit<br />
Wir sollten uns beim nächsten Projektmeeting überlegen, welche Attribute wir mit aufnehmen,<br />
die wir dann bei der nächsten großen Praxisratssitzung mit dem Praxisrat diskutieren<br />
sollten.<br />
Derzeit hätte ich folgende Attribut-Vorschläge (basierend auf der Arbeit von Burkhalter/Känzig/Wüstenhagen,<br />
der Literaturrecherche und der Kleingruppen-Diskussion)<br />
1. Strommix<br />
2. Zertifizierung<br />
3. CO2-Emissionen<br />
4. Monatliche Stromkosten<br />
5. Ort der Stromproduktion<br />
6. Stromlieferant<br />
7. Preismodell<br />
8. Vertragsdauer<br />
9. Customer Service<br />
10. Werbung<br />
11. Versorgungssicherheit<br />
12. Sortiment <strong>des</strong> Anbieters