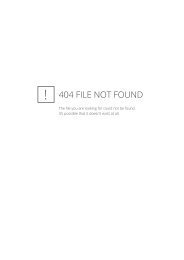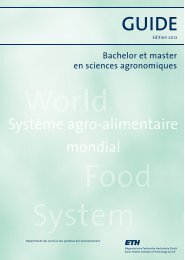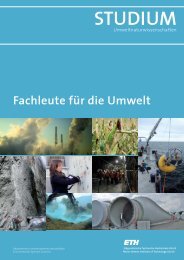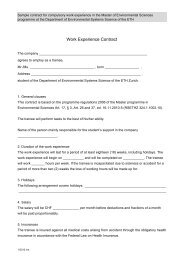Wegleitung [PDF] - ETH - ETH Zürich
Wegleitung [PDF] - ETH - ETH Zürich
Wegleitung [PDF] - ETH - ETH Zürich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WEGLEITUNG<br />
2014/2015<br />
Bachelorstudiengang<br />
Umweltnaturwissenschaften<br />
welt<br />
eit<br />
Klima<br />
Departement<br />
Umweltsystemwissenschaften
WEGLEITUNG<br />
2014/2015<br />
Bachelorstudiengang<br />
Umweltnaturwissenschaften<br />
i
Für den Bachelorstudiengang Umweltnaturwissenschaften ist das Studienreglement 2011<br />
(Ausgabe 20.08.2013 – 1) das massgebende und rechtsverbindliche Reglement. Es legt<br />
den Rahmen des Studiums fest und ist in der Rechtssammlung der <strong>ETH</strong> Zürich aufgeführt.<br />
Details zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind im Vorlesungsverzeichnis der <strong>ETH</strong> Zürich<br />
verbindlich festgehalten. Die <strong>Wegleitung</strong> erläutert das Reglement sowie das Verzeichnis der<br />
Lehrveranstaltungen.<br />
INHALTSVERZEICHNIS<br />
1 UMWELTNATURWISSENSCHAFTEN AN DER <strong>ETH</strong> ZÜRICH ............................. 1<br />
1.1 Warum Umweltnaturwissenschaften ................................................... 1<br />
1.2 Die Ausbildung in Umweltnaturwissenschaften ......................................... 1<br />
1.3 Qualifikationsprofil und berufliche Möglichkeiten ...................................... 3<br />
Studiensekretariat für Bachelorstudierende<br />
<strong>ETH</strong> Zürich<br />
Departement Umweltsystemwissenschaften, D-USYS<br />
CHN H 50.5<br />
Universitätsstrasse 8<br />
8092 Zürich<br />
E-Mail: joerg.leuenberger@usys.ethz.ch<br />
Tel: +41 44 632 53 75<br />
www.usys.ethz.ch<br />
1.4 Ein Studiengang wie kein anderer ........................................................ 5<br />
2 SKIZZE DES BACHELORSTUDIUMS ....................................................... 6<br />
2.1 Gliederung und Ablauf .................................................................... 6<br />
2.2 Grundlagenfächer I und II ................................................................. 7<br />
2.3 Systemvertiefungen ........................................................................ 8<br />
2.4 Sozial- und geisteswissenschaftliche Module ............................................ 8<br />
2.5 Naturwissenschaftliche und technische Wahlfächer .................................... 9<br />
2.6 Bachelorarbeit ............................................................................. 9<br />
Impressum<br />
Text und Redaktion:<br />
Peter Frischknecht<br />
Gestaltung:<br />
Karin Frauenfelder<br />
Graphik:<br />
Katharina Stoll<br />
Auflage: 850<br />
Ausgabe: Juli 2014<br />
3 BESCHREIBUNG DER SYSTEMVERTIEFUNGEN .......................................... 10<br />
3.1 Biogeochemie .............................................................................. 10<br />
3.2 Atmosphäre und Klima .................................................................... 10<br />
3.3 Umweltbiologie ............................................................................ 11<br />
3.4 Mensch-Umwelt Systeme ................................................................. 12<br />
3.5 Wald und Landschaft ...................................................................... 13<br />
4 STUDIENPLAN .............................................................................. 14<br />
4.1 Basisjahr .................................................................................... 14<br />
4.2 Studienplan zweites und drittes Jahr ..................................................... 16<br />
5 MOBILITÄTSSTUDIUM ..................................................................... 27<br />
6 LEISTUNGSKONTROLLEN ................................................................. 28<br />
6.1 Grundsätzliches ........................................................................... 28<br />
6.2 Leistungskontrollen im 1. Studienjahr (Basisprüfung) ................................. 28<br />
ii<br />
iii
6.3 Leistungskontrollen im 2. und 3. Studienjahr ........................................... 29<br />
7 BACHELORDIPLOM ........................................................................ 32<br />
7.1 Antrag auf Diplomerteilung .............................................................. 32<br />
7.2 Schlusszeugnis und Bachelorurkunde ................................................... 32<br />
8 WEITERFÜHRENDE AUSBILDUNGEN .................................................... 34<br />
8.1 Masterstudium ............................................................................ 34<br />
8.2 Doktorat .................................................................................... 34<br />
8.3 Didaktische Ausbildung ................................................................... 35<br />
9 ALLGEMEINE INFORMATIONEN ......................................................... 36<br />
9.1 Wissenswertes über das Departement .................................................. 36<br />
9.2 Aktuelle Informationen und Beratung ................................................... 36<br />
1 Umweltnaturwissenschaften<br />
an der <strong>ETH</strong> ZÜRICH<br />
1.1 Warum Umweltnaturwissenschaften<br />
„Ideen können nur nützen, wenn sie in vielen Köpfen lebendig werden.“<br />
Alexander von Humboldt (1769 – 1859)<br />
Die Welt ist mit bedeutenden Umweltproblemen konfrontiert, die ihren Ursprung in der<br />
Übernutzung von natürlichen Ressourcen und der Belastung von Umweltsystemen haben.<br />
Dazu gehören der Klimawandel, die Entwertung von Land und Boden, die Verschmutzung<br />
von Süss- und Salzwassersystemen, der Rückgang der Biodiversität und die Gefährdung der<br />
menschlichen Gesundheit durch von der Umwelt beeinflusste Krankheiten. Diese Probleme<br />
stehen meist im Zusammenhang mit menschlichen Aktivitäten, die nicht nachhaltig sind,<br />
sondern die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen gefährden.<br />
Obwohl das Konzept der nachhaltigen Entwicklung heute weitgehend akzeptiert ist, stellt<br />
seine Umsetzung nach wie vor eine enorme Herausforderung dar. Die Schwierigkeiten sind<br />
nicht nur politischer Art, sondern hängen mit der hohen Komplexität von Umweltsystemen<br />
zusammen, mit der grossen raum-zeitlichen Heterogenität einzelner Prozesse und Zustände<br />
und den vielfältigen Wechselwirkungen innerhalb von Umweltsystemen. Um eine nachhaltige<br />
Entwicklung zu ermöglichen, sind vertiefte Kenntnisse über das Funktionieren natürlicher<br />
Umweltsysteme und die Auswirkungen menschlichen Handelns auf Umweltprozesse<br />
notwendig. Systemwissen muss mit Zielvorstellungen über nachhaltige Problemlösungen<br />
verbunden und Wissen mit Handeln verknüpft werden.<br />
Mit dem Studium in Umweltnaturwissenschaften bietet die <strong>ETH</strong> Zürich als Schweizer Hochschule<br />
von Weltrang eine Ausbildung an, in welcher neben einer fundierten interdisziplinären<br />
naturwissenschaftlichen Grundlage auch der gesellschaftliche Wandel in Richtung<br />
Nachhaltigkeit einen besonderen Stellenwert hat. Die Studierenden lernen, wie sie das Konzept<br />
der Nachhaltigkeit auch in ihrer zukünftigen beruflichen Tätigkeit einbeziehen können.<br />
1.2 Die Ausbildung in Umweltnaturwissenschaften<br />
Leitbild<br />
Die Bachelor- und Masterausbildung in Umweltnaturwissenschaften an der <strong>ETH</strong> Zürich vermitteln<br />
Wissen und Verständnis darüber, wie die natürliche Umwelt funktioniert und wie die<br />
Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und seiner belebten und unbelebten Umwelt<br />
beschaffen sind. Die Studierenden lernen, Umweltfragen mit wissenschaftlichen Methoden<br />
zu analysieren, daraus Lösungen zu entwickeln sowie diese zu bewerten und umzusetzen.<br />
Besonderes Gewicht wird auf interdisziplinäres Arbeiten gelegt, das neben den Naturwissen-<br />
iv 1
schaften die Sozial- und Geisteswissenschaften sowie die Umwelttechnik einschliesst. Wo<br />
immer möglich wird auf allen Stufen der Ausbildung schriftliche und mündliche Kommunikation<br />
geübt.<br />
Das Studium in Umweltnaturwissenschaften eröffnet ein weites Feld von beruflichen Möglichkeiten.<br />
Absolventinnen und Absolventen befassen sie sich beispielsweise mit Fragen des<br />
Naturschutzes, dem Management von Naturgefahren, der Energie- und Wasserversorgung,<br />
nachhaltiger Finanzprodukte oder mit Umweltbildung.<br />
Die Ausbildungsziele und deren Umsetzung im Unterricht werden in enger Kooperation mit<br />
den Studierenden entwickelt. Diese als Partnerschaft verstandene Zusammenarbeit garantiert<br />
eine Ausbildung, die den Bedürfnissen der Studierenden gerecht wird und ständiger<br />
Qualitätskontrolle unterliegt.<br />
Bachelorausbildung (drei Jahre)<br />
In den ersten zwei Jahren erwerben die Studierenden ein breit vernetztes wissenschaftliches<br />
Basiswissen. Dieses umfasst naturwissenschaftliche und mathematische Grundlagen<br />
in Chemie, Physik, Biologie, Mathematik und Erdwissenschaften, ergänzt durch Grundlagen<br />
in Recht und Ökonomie. Aufbauend auf den disziplinären Grundkenntnissen lernen die Studierenden<br />
in Vorlesungen, Praktika und Exkursionen die Umweltsysteme Atmosphäre (Luft),<br />
Hydrosphäre (Wasser), Pedosphäre (Boden) sowie die Landnutzungssysteme Wald- und<br />
Landwirtschaft kennen.<br />
Die Grundlagenvorlesungen werden von den Studierenden der Ausbildungsgänge Agrar-,<br />
Erd-, Lebensmittel- und Umweltnaturwissenschaften grösstenteils gemeinsam besucht.<br />
Daher kann die Studienrichtung nach zwei Semestern ohne grossen Aufwand gewechselt<br />
werden.<br />
Im dritten Jahr vertiefen sich die Studierenden exemplarisch in einem zentralen Gebiet der<br />
Umweltnaturwissenschaften. Zur Auswahl stehen: Biogeochemie, Atmosphäre und Klima,<br />
Umweltbiologie, Mensch-Umwelt Systeme sowie Wald und Landschaft. Die Studierenden<br />
lernen in diesem vertiefenden Studienteil ein Thema systemorientiert und interdisziplinär zu<br />
betrachten und zu bearbeiten.<br />
Spezielle Module vermitteln, wie sozial- und geisteswissenschaftliche Aspekte bei der Bearbeitung<br />
von Umweltproblemen einbezogen werden können.<br />
Ein breites Wahlfachangebot gibt die Möglichkeit, nach eigenen Interessen zusätzliche naturwissenschaftliche<br />
und technische Kenntnisse zu erwerben.<br />
Mit der Abschlussarbeit (Bachelorarbeit) lernen die Studierenden das Handwerk des selbständigen,<br />
methoden-geleiteten und der wissenschaftlichen Redlichkeit verpflichteten<br />
Arbeitens.<br />
Masterausbildung (zwei Jahre)<br />
Ein Bachelorabschluss ermöglicht den direkten Zugang zum Masterstudium in Umweltnaturwissenschaften.<br />
Der Masterabschluss legt die Basis für eine wissenschaftliche Tätigkeit auf<br />
einem hohen akademischen Niveau und qualifiziert für die Bearbeitung komplexer Probleme.<br />
Während des Studiums werden auch allgemein berufsrelevante Fähigkeiten gefördert.<br />
Der Masterstudiengang bietet Vertiefungen (Major) in Atmosphäre und Klima, Biogeochemie<br />
und Schadstoffdynamik, Ökologie und Evolution, Mensch-Umwelt Systeme, Wald- und<br />
Landschaftsmanagement sowie Gesundheit, Ernährung und Umwelt an. Die Vertiefung kann<br />
unabhängig von der im Bachelor gewählten Spezialisierung und den übrigen Wahlpräferenzen<br />
erfolgen. Es ist jedoch empfehlenswert, Studienwahlen im Bachelor auch im Hinblick<br />
auf die Mastervertiefung zu bedenken.<br />
Wahl- und Ergänzungsfächer (Minor) bieten die Möglichkeit, Fachkenntnisse zu erweitern<br />
und zu vertiefen.<br />
Mindestens 18 Wochen Berufspraxis bieten Gelegenheit, durch eigene praktische Tätigkeiten<br />
Umweltprobleme in ihrer Komplexität zu analysieren und Lösungsstrategien zu erarbeiten.<br />
Das Studium wird durch eine Masterarbeit abgeschlossen. Diese vermittelt Erfahrungen, wie<br />
das Erlernte zur Bearbeitung einer konkreten naturwissenschaftlichen Fragestellung einzusetzen<br />
ist.<br />
1.3 Qualifikationsprofil und berufliche Möglichkeiten<br />
Mit dem Bachelordiplom erwerben die Studierenden allgemeine und fachbezogene Fähigkeiten:<br />
Allgemeine Fähigkeiten<br />
Die Absolventinnen und Absolventen können<br />
· selbständig, mit offener und kritischer Haltung lernen<br />
· Daten mit quantitativen Methoden bearbeiten und analysieren<br />
· unterschiedliche Informationstechnologien verwenden<br />
· mit Fachleuten wie auch mit Laien mündlich und schriftlich kommunizieren<br />
· in einem Team arbeiten<br />
Fachbezogene Fähigkeiten<br />
Die Absolventen und Absolventinnen haben<br />
· ein gutes Grundlagenwissen in Mathematik, Chemie, Physik, Biologie, Informatik sowie in<br />
Recht und Ökonomie<br />
· einen Überblick über die Umweltsysteme Erde, Atmosphäre, Hydrosphäre, Pedosphäre<br />
· die Fähigkeit, disziplinäres Wissen für eine interdisziplinäre Denk- und Arbeitsweise einzusetzen<br />
· exemplarische Kenntnisse der theoretischen Konzepte und quantitativen Methoden in<br />
einem wichtigen Gebiet der Umweltwissenschaften<br />
· exemplarische Kenntnisse umweltrelevanter Technologien und Planungsinstrumente<br />
· die Fähigkeit sozial- und geisteswissenschaftliche Aspekte in ihre Arbeit zu integrieren<br />
· Basisfähigkeiten, um Probleme aus der Praxis zu analysieren und Lösungsmöglichkeiten zu<br />
entwickeln und diese zu bewerten<br />
2 3
Berufliche Möglichkeiten<br />
Die Berufschancen der Studienabgängerinnen und Studienabgänger in Umweltnaturwissenschaften<br />
werden laufend untersucht. Die Resultate zeigen, dass die Absolventinnen und<br />
Absolventen mit einem Masterabschluss auf dem Stellenmarkt sehr gefragt sind und viele<br />
Möglichkeiten für berufliche Tätigkeiten haben. Etwa zwei Jahre nach dem Studienabschluss<br />
sieht das Spektrum der Tätigkeiten folgendermassen aus:<br />
· Forschung: Ungefähr 25% der Absolventinnen und Absolventen arbeiten in der Forschung<br />
und finden – zum grossen Teil als Doktorierende – an Hochschulen eine Stelle. Sie bearbeiten<br />
naturwissenschaftliche Forschungsprojekte, wirken aber auch in inter- und transdisziplinären<br />
Forschungsprogrammen mit.<br />
· Tätigkeiten in der Privatwirtschaft: Etwa 50% der Absolventinnen und Absolventen finden<br />
eine Anstellung in einem der Dienstleistungssektoren, vor allem in Umwelt- und Planungsbüros,<br />
aber auch bei Banken, Versicherungen, Medien oder im Handel. Sie setzen das<br />
erworbene fachspezifische Wissen aus dem Studium zur Lösung von Umweltproblemen<br />
und zur Entwicklung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen ein.<br />
· Staatliche Stellen: Rund 20 % der Absolventinnen und Absolventen sind in der öffentlichen<br />
Verwaltung – bei Bund, Kantonen oder Gemeinden – tätig. Meist arbeiten sie an Stellen,<br />
wo sie für die Umsetzung der Umweltschutzgesetzgebung zuständig sind. Mit einer didaktischen<br />
Zusatzausbildung (siehe Kapitel 8.3) sind auch Lehrtätigkeiten möglich.<br />
· Nicht-staatliche (Umwelt-)Organisationen: Rund 5% wählen eine Stelle bei einer Umweltorganisation<br />
wie WWF, Pro Natura oder ähnlichen Vereinigungen. Ihre Tätigkeit ist damit<br />
stark auf den anwaltschaftlichen Schutz der Umwelt ausgerichtet.<br />
Der Bachelorabschluss dient in erster Linie als Qualifikation für einen Masterstudiengang.<br />
Rund 95% der Bachelorstudierenden entschliessen sich daher, eine Masterausbildung in<br />
Angriff zu nehmen und nur einzelne streben nach dem Bachelor bereits eine berufliche<br />
Tätigkeit an.<br />
1.4 Ein Studiengang wie kein anderer<br />
Das Studium in Umweltnaturwissenschaften vermittelt den Zugang zu Umweltfragen und<br />
-problemen über die Auseinandersetzung mit Umweltsystemen. Dieser systemorientierte<br />
Ansatz weist breite Berührungsflächen zu Technik-, Geistes- und Sozialwissenschaften auf,<br />
stützt sich aber weitgehend auf naturwissenschaftliche Grundlagen. Ein starkes Interesse<br />
an Mathematik und Naturwissenschaften ist daher für diesen Studiengang unentbehrlich.<br />
Besonders anspruchsvoll ist die Vielfalt an Fächern, die es zu bewältigen gilt. Und es ist eine<br />
grosse Herausforderung, die wissenschaftlichen Kenntnisse zur Lösung von realen, komplexen<br />
Umweltproblemen einzusetzen.<br />
Das Maturitätsprofil, welches die Studierenden mitbringen, spielt keine massgebliche Rolle:<br />
Die naturwissenschaftliche Ausrichtung ist mit etwa 50 Prozent am häufigsten vertreten. Studierende<br />
mit einem sprachlichen oder einem wirtschaftlichen Schwerpunkt sind ebenfalls<br />
gut vertreten und nicht signifikant weniger erfolgreich.<br />
Pro Jahr schreiben sich zwischen 110 und 130 Studierende in das erste Semester ein. Der<br />
Studiengang ist für beide Geschlechter gleichermassen attraktiv und beide Geschlechter sind<br />
im Studium auch gleich erfolgreich. Daher ist das Verhältnis zwischen Studentinnen und Studenten<br />
auch ziemlich ausgeglichen.<br />
Trotz der hohen Zahl an Neueintretenden entsteht schnell eine familiäre Studienatmosphäre.<br />
Ein Einführungswochenende, Studentinnen und Studenten höherer Semester, die als<br />
„Paten“ und „Patinnen“ zur Seite stehen sowie zahlreiche praktische Unterrichtselemente<br />
wie eine Seminarwoche, Praktika und Exkursionen helfen, unter den Studierenden wie auch<br />
zu den Lehrpersonen rasch Kontakte zu knüpfen.<br />
Wer sich den Anforderungen des Bachelorstudienganges Umweltnaturwissenschaften stellt,<br />
erhält eine einzigartige wissenschaftliche Ausbildung, die viele individuelle Wege zulässt und<br />
eine hohe gesellschaftliche Relevanz besitzt.<br />
4 5
2 Skizze des Bachelorstudiums<br />
2.1 Gliederung und Ablauf<br />
Für den Erwerb des Bachelordiploms sind Studienleistungen im Umfang von 180 Kreditpunkten<br />
(KP) erforderlich. Die Ausbildung besteht dabei aus den folgenden Kategorien und<br />
Unterkategorien:<br />
Kategorien und Unterkategorien<br />
Mindestanzahl Kreditpunkte<br />
Grundlagenfächer I 60<br />
Grundlagenfächer II 52<br />
Systemvertiefung 21<br />
1. Kernfächer (mind. 12 KP)<br />
2. Obligatorisches Praktikum (7 KP)<br />
3. Seminar (2 KP)<br />
Sozial- und geisteswissenschaftliches Modul 14<br />
1. Obligatorische Fächer (mind. 7 KP)<br />
2. Wahlfächer<br />
Naturwissenschaftliche und technische Wahlfächer 23<br />
1. Modul (mind. 9 KP)<br />
2. Einzelfächer<br />
Bachelorarbeit 10<br />
1. Eine grosse Bachelorarbeit (10 KP) oder<br />
2. Zwei kleine Bachelorarbeiten (je 5 KP)<br />
Die Fächer aus der Kategorie der Grundlagenfächer I, welche als Basisprüfung geprüft werden,<br />
müssen innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen sein. Die maximale Studiendauer beträgt<br />
fünf Jahre.<br />
2.2 Grundlagenfächer I und II<br />
In den ersten beiden Jahren werden mathematisch-naturwissenschaftliche, technische und<br />
sozialwissenschaftliche Grundlagenfächer belegt.<br />
Der disziplinäre Grundlagenunterricht besteht aus Lehrveranstaltungen in Mathematik, Chemie,<br />
Mikrobiologie, Physik, Biologie, Informatik und Einführungen in Recht und Ökonomie.<br />
In Chemie, Physik, Biologie und Mikrobiologie wird die Theorie jeweils durch Praktika veranschaulicht<br />
und vertieft.<br />
Die Ausbildung im Bereich Technik vermittelt Grundkenntnisse in systematischer Problemlösung<br />
und in der Analyse und Bewertung umweltverträglicher Technologien. Sie ist stark<br />
praxisorientiert und umfasst eine Fallstudie im ersten Semester.<br />
Einführungen in Erd- und Produktionssysteme sowie in die Systeme Atmosphäre, Hydrosphäre<br />
und Pedosphäre ermöglichen erste Einblicke in die Beschaffenheit und die Prozesse von<br />
Umweltsystemen.<br />
Grundlagenfächer<br />
(Anteil an gesamthaft 112 KP)<br />
Mathematik (19 %)<br />
Physik (11 %)<br />
Informatik (4 %)<br />
Chemie/Mikrobiologie (16 %)<br />
Biologie (16 %)<br />
Sozialwissenschaften/Technik (13 %)<br />
Systemfächer (21 %)<br />
Integrierte Praktika führen ins umweltnaturwissenschaftliche Arbeiten im Labor und im Feld<br />
ein. Jeweils am Ende des zweiten und des vierten Semesters finden Blockveranstaltungen<br />
statt, in denen das Gelernte der vergangenen Semester zur Bearbeitung verschiedener<br />
Fragestellungen angewandt werden kann.<br />
6 7
2.3 Systemvertiefungen<br />
Die Studierenden müssen sich für eine der folgenden Systemvertiefungen entscheiden:<br />
· Biogeochemie<br />
· Atmosphäre und Klima<br />
· Umweltbiologie<br />
· Mensch-Umwelt Systeme<br />
· Wald und Landschaft<br />
Die Systemvertiefung vermittelt einen systemorientierten Einblick in ein bestimmtes Umweltgebiet<br />
und bildet im dritten Studienjahr den Schwerpunkt der Ausbildung.<br />
2.4 Sozial- und geisteswissenschaftliche Module<br />
Den Studierenden stehen vier sozial- und geisteswissenschaftliche Module zur Wahl:<br />
· Wirtschaftswissenschaften<br />
· Staats- und Gesellschaftswissenschaften (Politik, Recht, Soziologie u.a.)<br />
· Individualwissenschaften (Psychologie, Kommunikation u.a.)<br />
· Geisteswissenschaften (Philosophie, Ethik, Geschichte u.a.)<br />
Das Modul wird im zweiten und dritten Studienjahr belegt. Es ermöglicht den Studierenden<br />
einen exemplarischen Einblick in ein sozial- oder geisteswissenschaftliches Gebiet mit dem<br />
Ziel, Forschungsergebnisse aus diesem Gebiet zu verstehen und in die eigene Arbeit einbeziehen<br />
zu können. Die Studierenden werden so befähigt mit Fachleuten aus diesem Gebiet<br />
konstruktiv zusammenzuarbeiten.<br />
2.5 Naturwissenschaftliche und technische Wahlfächer<br />
Die naturwissenschaftlichen und technischen Wahlfächer umfassen ein breites Angebot. Sie<br />
ermöglichen es, im naturwissenschaftlichen und/oder technischen Bereich Schwerpunkte zu<br />
setzen. Die entsprechenden Lerneinheiten werden den Studierenden im zweiten und dritten<br />
Studienjahr zur individuellen Auswahl angeboten. Ein Grossteil der Lehrveranstaltungen ist<br />
in thematische Module zusammengefasst.<br />
2.6 Bachelorarbeit<br />
Vertiefung und Erweiterungsfächer<br />
(Anteil an gesamthaft 68 KP)<br />
Systemvertiefung (31 %)<br />
Sozial- und geisteswissenschaftliches<br />
Modul (21 %)<br />
Naturwissenschaftliche und technische<br />
Module (34%)<br />
Bachelorarbeit (15%)<br />
Die Studierenden verfassen entweder eine grosse Bachelorarbeit (10 KP) oder zwei kleine<br />
Bachelorarbeiten (je 5 KP). Die grosse Bachelorarbeit kann im Bereich Naturwissenschaften<br />
und Technik oder Sozial- und Geisteswissenschaften gewählt werden oder auch interdisziplinär<br />
ausgerichtet sein. Wer sich für zwei kleine Bachelorarbeiten entscheidet, führt die eine<br />
im Bereich Naturwissenschaften und Technik und die andere im Bereich Sozial- und Geisteswissenschaften<br />
durch.<br />
8 9
3 Beschreibung der Systemvertiefungen<br />
3.1 Biogeochemie<br />
Die Vertiefung Biogeochemie befasst sich mit natürlichen und anthropogen beeinflussten<br />
Stoffkreisläufen in terrestrischen und aquatischen Ökosystemen, sowie mit dem Verhalten<br />
relevanter anorganischer und organischer Schadstoffe in der Umwelt. Menschliche Aktivitäten<br />
beeinflussen die natürlichen Kreisläufe vieler Elemente (z.B. C, N, S, Hg) auf regionaler<br />
und globaler Skala und führen zu Emissionen toxischer Stoffe, zum Teil auch neuartiger Stoffe,<br />
die natürlicherweise in der Umwelt nicht vorkommen (z.B. bestimmte Chemikalien oder Nanopartikel).<br />
Diese anthropogenen Einflüsse auf Stoffkreisläufe können bedeutende Folgen<br />
für die Umwelt haben (z.B. Klimawandel, Eutrophierung, Kontamination von Böden und Gewässern).<br />
Das Verhalten von Stoffen in der Umwelt (z.B. deren Ausbreitung, Abbau, Sorption,<br />
Bioverfügbarkeit) wird von einem komplexen Zusammenspiel physikalischer, chemischer,<br />
und (mikro)biologischer Prozesse beeinflusst. In den Kernfächern der Vertiefung werden die<br />
wichtigsten biogeochemischen Prozesse behandelt und an Hand konkreter Beispiele wird<br />
aufgezeigt, wie diese das Verhalten verschiedener Stoffe in der Umwelt kontrollieren. Die<br />
Kopplung chemischer, mikrobiologischer und physikalischer Prozesse steht dann im Vordergrund,<br />
wenn Stoffkreisläufe auf regionaler oder globaler Skala diskutiert oder modelliert<br />
werden. Im Seminar Biogeochemie werden aktuelle wissenschaftliche Studien vorgestellt<br />
und kritisch hinterfragt. Im Praktikum Biogeochemie werden wichtige analytische Labor- und<br />
Feldmethoden vorgestellt, die man benötigt, um Stoffe in der Umwelt nachzuweisen und<br />
um deren Kreisläufe zu quantifizieren. Die Vertiefung Biogeochemie bietet damit eine ideale<br />
Vorbereitung für die Mastervertiefung „Biogeochemistry and Pollutant Dynamics“.<br />
3.2 Atmosphäre und Klima<br />
Das Studium des Systems Atmosphäre und Klima widmet sich dem Verständnis der atmosphärischen<br />
Prozesse und ihres Zusammenspiels – von der molekularen bis zur globalen<br />
Ebene. Die Skala der beobachteten Zeitperioden reicht dabei von Millisekunden (Turbulenzforschung)<br />
über Minuten (Wolkenbildung), Stunden (Phänomene von lokaler Ausdehnung,<br />
wie bei Gewittern), Tagen (allgemeiner Wetterablauf), Wochen (saisonaler Witterungscharakter),<br />
Jahren (Ozontrends), bis zu Jahrhunderten (Klimaänderungen) oder sogar Jahrmillionen<br />
(Paläoklima).<br />
Die Systemvertiefung vermittelt ein quantitatives Verstehen atmosphärischer Prozesse, welche<br />
die Grundlage für die Vorhersage des Wetters, physikochemischer Austauschvorgänge<br />
und Kreisläufe, als auch des Klimas sind. Um die in der Lufthülle ablaufenden Prozesse zu<br />
beschreiben, werden neben mathematischen Kenntnissen vor allem Wissen und Methoden<br />
der Disziplin Physik benötigt, aber auch Kenntnisse aus der Chemie und Biologie. Bis vor<br />
kurzem konzentrierten sich die Atmosphärenwissenschaften auf die Meteorologie, also die<br />
Erforschung atmosphärischer Strömungen (z.B. Fronten, Stürme) sowie physikalischer Prozesse<br />
auf kleinerer Skala (z.B. Konvektion, Gewitter). Heute spielt die Chemie zur Analyse der<br />
vielfältigen und komplexen Prozesse in den atmosphärischen Stoffkreisläufen eine wichtige<br />
Rolle, so dass die Atmosphärenchemie zu einem eigenen Spezialgebiet geworden ist. Zur<br />
Beschreibung der Land-Klima-Wechselwirkung sowie der Wechselwirkung mit den Ozeanen<br />
und des Wettereinflusses auf den Menschen kommen ferner Kenntnisse aus der Biologie<br />
und der Biomedizin hinzu. Da Wasser in der Atmosphäre eine zentrale Rolle spielt, bestehen<br />
mannigfaltige Querverbindungen zur Hydrologie und Pedologie.<br />
Das Prozessverständnis im System Atmosphäre und Klima basiert auf Feldmessungen und<br />
Laborexperimenten. Dabei kommt State-of-the-Art-Instrumentierung zum Einsatz. Für die<br />
Analyse, Simulation und Vorhersage atmosphärischer und klimatologischer Abläufe müssen<br />
sehr grosse Datenmengen bearbeitet werden, bei gleichzeitiger Entwicklung und Anwendung<br />
neuester Methoden der Informatik und komplexer numerischer Modelle (Entwicklung<br />
effizienter Algorithmen, Parametrisierungen, Methoden zur Visualisierung grosser Datenmengen<br />
etc.). Damit das Wetter von übermorgen und das Klima in 100 Jahren zuverlässig<br />
vorhergesagt werden.<br />
3.3 Umweltbiologie<br />
Die Vertiefung in Umweltbiologie wurde als Unterstützung und Vorbereitung derjenigen<br />
Studierenden konzipiert, die später einen Master in „Ecology and Evolution“ bzw. in<br />
„Human Health, Nutrition and Environment“ anstreben. Der Hauptfokus der Vertiefung liegt<br />
auf konzeptuellen Grundlagen der modernen Ökologie und Evolutionsbiologie, sowie der<br />
Verknüpfung dieser wissenschaftlichen Konzepte mit den vielfältigen Anwendungsbereichen<br />
im Umweltbereich.<br />
Die Vertiefung befasst sich daher primär nicht mit einem physisch abgrenzbaren Bereich der<br />
Biosphäre, sondern thematisiert die genetischen, evolutiven und ökologischen Prozesse, die<br />
dem Wandel der Populationen, Arten, und Lebensgemeinschaften zugrunde liegen. Diese<br />
Prozesse können auf verschiedensten Ebenen organismischer Komplexität wirken: z.B. bei<br />
Mutationen in den Keimzellen einzelner Organismen, bei der Ausbildung von bakterieller<br />
Resistenz gegen spezifische Antibiotika, oder bei Anpassungen und Arealveränderungen von<br />
Tier- und Pflanzenarten im Zuge des Klimawandels. Letzteres hätte sicher auch Auswirkungen<br />
auf regionale Stoffkreisläufe und die Komposition ganzer Lebensgemeinschaften.<br />
Die Systemvertiefung Umweltbiologie vermittelt grundlegende Kenntnisse und Arbeitsweisen<br />
hochaktueller und weitgehend interdisziplinärer Gebiete, u.a. der Populationsgenetik,<br />
Populationsbiologie, Systemökologie und des Artenschutzes. Diese breite wissenschaftliche<br />
Grundlage wird auch durch die Methodenvielfalt in der Umweltbiologie reflektiert. Je nach<br />
Fragestellung kommen experimentelle Freiland- oder Laborarbeiten zum Einsatz, oft unter<br />
Anwendung molekularer Marker und/oder mathematischer Modellierung. Zumindest ein<br />
Teil dieses Repertoires wird im Systempraktikum vermittelt, das beispielhaft eine konkrete<br />
Studiensituation widerspiegelt, von der Fragestellung über die Datenerhebung und -analyse<br />
zur Darstellung der Ergebnisse.<br />
10 11
Die durch der Vertiefung in Umweltbiologie erlangten Kenntnisse und Fertigkeiten sollten<br />
idealerweise durch Kurse aus den naturwissenschaftlichen Modulen „Ökologie und Naturschutz“,<br />
„Methoden der statistischen Datenanalyse“ sowie ggf. „Umweltbiomedizin“ ergänzt<br />
werden.<br />
3.4 Mensch-Umwelt Systeme<br />
In der Vertiefung Mensch-Umwelt Systeme geht es um die Integration von naturwissenschaftlichen<br />
mit sozialwissenschaftlichen Modellen. Es werden Systeme betrachtet, deren<br />
Energie- und Stoffflüsse oder deren Zustände und Qualität entscheidend durch den Menschen<br />
geprägt sind (z.B. Energie- und Mobilitätssysteme, Abfallsysteme, Wald- und Landschaftssysteme).<br />
Diese können in Industrie- wie auch in Entwicklungsländern beheimatet<br />
sein.<br />
Die Studierenden sollen einerseits lernen, diese Flüsse und Zustände qualitativ und quantitativ<br />
zu erfassen und zu bewerten. Andererseits sollen sie sich mit den natürlichen und gesellschaftlichen<br />
Regelmechanismen auseinandersetzen. Analysiert wird die Wechselwirkung<br />
zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Dabei werden nicht nur die Einflüsse des Menschen<br />
auf die natürliche Umwelt, sondern auch die Rückwirkung einer durch den Menschen<br />
veränderten Umwelt auf das Humansystem untersucht. Die Dynamik dieser Wechselwirkung<br />
wird durch ein Spektrum zeitlicher und räumlicher Skalen bestimmt, welche mit den verschiedenen<br />
Organisationsebenen des biologischen bzw. sozialen Systems assoziiert sind (Zelle,<br />
Organ, Individuum, Art, Ökosystem bzw. Individuum, Gruppe, Organisation, Gesellschaft).<br />
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, umweltrelevante Probleme systematisch<br />
zu analysieren, die relevanten Steuerungsgrössen im Umwelt- und Humansystem zu<br />
erkennen, Vorschläge zur Steuerung des Systems zu entwickeln und diese unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten<br />
zu bewerten. Diese Systemvertiefung setzt ein ausgesprochenes<br />
Interesse am Umgang mit komplexen Systemen voraus, deren Behandlung inter- und transdisziplinäre<br />
Methoden erfordert. Die Vertiefung Mensch-Umwelt Systeme bereitet bestens<br />
auf einen Major in „Human-Environment Systems“ oder „Human Health, Nutrition and Environment“<br />
vor.<br />
3.5 Wald und Landschaft<br />
Die Systemvertiefung führt die Studierenden in die Methoden und Denkweisen ein, Prozesse<br />
zu analysieren, welche den Zustand und die künftige Entwicklung von Wäldern und Landschaften<br />
bestimmen, und befähigt sie, Möglichkeiten zur gezielten Beeinflussung dieser<br />
Prozesse zu erkennen.<br />
Die Systemvertiefung vermittelt das Verständnis der Komponenten, welche Landschaftssysteme<br />
prägen:<br />
· Biologisch-physikalische Strukturen und Funktionen der natürlichen Umwelt (naturwissenschaftlicher<br />
Fokus)<br />
· Technologien der Landnutzung (ingenieurwissenschaftlicher Fokus)<br />
· Gesellschaftliche Strukturen und Funktionen, z.B. soziokulturelle Rahmenbedingungen<br />
und ökonomische Mechanismen (staats- und gesellschaftswissenschaftlicher Fokus)<br />
Die Vertiefung verbindet verschiedene räumlich-zeitliche Massstabsebenen, von einzelnen<br />
Organismen (z.B. Bäumen) bis zur Ebene von hydrologischen Einzugsgebieten und Landschaften.<br />
Die damit verbundene Komplexität bedingt ein solides Verständnis moderner Methoden<br />
der Ökosystemforschung, der Repräsentation von Raumdaten und der Sozialwissenschaften.<br />
Die Vertiefung „Wald und Landschaft“ ermöglicht eine einführende Auseinandersetzung mit<br />
der Analyse, Nutzung und Gestaltung von Waldökosystemen und extensiv genutzten Landschaften.<br />
Sie bietet die ideale Vorbereitung auf den Major „Wald- und Landschaftsmanagement“<br />
des Masterstudiengangs.<br />
12 13
4 Studienplan 1<br />
Während im ersten Studienjahr der Studienplan durch die Grundlagenfächer praktisch vollständig<br />
vorgegeben ist, bestehen im zweiten und dritten Jahr individuelle Wahlmöglichkeiten<br />
u.a. durch die Wahl einer Systemvertiefung<br />
Das Studium kann in drei Jahren abgeschlossen werden. Ein länger dauerndes Teilzeitstudium<br />
(z.B. als Werkstudent) ist bis zu fünf Jahren möglich. Es ist empfehlenswert, dieses mit<br />
dem Studienkoordinator abzusprechen. Ab dem vierten Semester kann der Besuch einzelner<br />
Studienelemente flexibler geplant werden. Für manche Lehrveranstaltungen werden jedoch<br />
Kenntnisse aus anderen Lehrveranstaltungen vorausgesetzt. Im Vorlesungsverzeichnis sind<br />
diese unter Voraussetzung /Besonderes in der Rubrik „Katalogdaten“ vermerkt.<br />
Im folgenden Studienplan sind bei jeder LV Nummer, Name des Fachs, Typ, Platzierung im<br />
Semester (HS oder im FS), Anzahl SWS und KP angegeben. Es werden die folgenden Abkürzungen<br />
verwendet:<br />
V = Vorlesung S = Seminar<br />
G = Vorlesung mit Übung K = Kolloquium<br />
U = Übung HS = Herbstsemester<br />
P = Praktikum FS = Frühjahrsemester<br />
A = Selbstständige Arbeit SWS = Semesterwochenstunde/n<br />
KP = Kreditpunkte LV = Lehrveranstaltung<br />
4.1 Basisjahr<br />
Das Basisjahr (erstes Studienjahr) beinhaltet die Grundlagenfächer I.<br />
Grundlagenfächer I<br />
Chemie<br />
529-2001-02 Chemie I HS 2 V + 2 U 4 KP<br />
529-0030-00 Praktikum Chemie HS 6 P 3 KP<br />
529-2002-02 Chemie II FS 2 V + 2 U 5 KP<br />
Mathematik<br />
401-0251-00 Mathematik I: Analysis I und Lineare Algebra HS 4 V + 2 U 6 KP<br />
401-0252-00 Mathematik II: Analysis II FS 5 V + 2 U 7 KP<br />
1<br />
Die in diesem Kapitel aufgeführten Lehrveranstaltungen basieren auf dem Vorlesungsverzeichnis der <strong>ETH</strong> Zürich und<br />
sind auf dem Stand des Datums der Drucklegung. Lehrveranstaltungen können kurzfristig, beispielsweise bezüglich<br />
Semester oder Anzahl KP, Änderungen erfahren oder ganz wegfallen. Den Studierenden wird empfohlen die Richtigkeit<br />
dieser Angaben zu Beginn des Semesters im Vorlesungsverzeichnis der <strong>ETH</strong> Zürich zu überprüfen.<br />
Zu finden unter: www.ethz.ch/content/dam/ethz/common/docs/weisungssammlung/files-de/unterrichtssprache.pdf<br />
Sozialwissenschaften<br />
701-0757-00 Ökonomie HS 2 V 3 KP<br />
851-0708-00 Grundzüge des Rechts FS 2 V 2 KP<br />
Technik der Problemlösung<br />
701-0005-00 Technik der Problemlösung mit HS 5 KP<br />
Problemlösen im Rahmen von Projekten<br />
1 G<br />
Einführung in den Umgang mit Umweltsystemen<br />
4 S<br />
Biologie<br />
551-0001-00 Allgemeine Biologie I HS 3 V 3 KP<br />
751-0801-00 Biologie I: Übungen HS 2 U 1 KP<br />
701-0243-01 Biologie III: Ökologie HS 2 V 3 KP<br />
551-0002-00 Allgemeine Biologie II FS 3 G 3 KP<br />
751-0260-00 Biologie IV: Diversität der Pflanzen und Tiere FS 2 V + 2 V 4 KP<br />
Zu den Vorlesungen Biologie IV: Biodiversität Pflanzen/Tiere werden fünf Praktika angeboten,<br />
wovon zwei besucht werden müssen:<br />
701-0264-00 Biologie IV: Übungen/Exkursionen Systematische FS 2 P 1 KP<br />
Botanik<br />
701-0264-01 Biologie IV: Exkursionen Systematische Botanik FS 2 P 1 KP<br />
(Blockkurs)<br />
701-0266-00 Biologie IV: Einführung in die Dendrologie FS 2 P 1 KP<br />
751-0260-01 Biologie IV: Praktikum Tierreich FS 2 P 1 KP<br />
751-0270-00 Biologie IV: Ökologie und Systematik von Algen FS 2 P 1 KP<br />
und Pilzen<br />
Erd- und Produktionssysteme<br />
701-0025-00 Erd- und Produktionssysteme HS 4 V 5 KP<br />
701-0026-00 Integrierte Exkursionen FS 2 P 1 KP<br />
Wahlmöglichkeit: Studierende mit besonderem Interesse am System Erde können anstelle<br />
von Erd- und Produktionssysteme die LV 651-3001-00 Dynamische Erde I wählen.<br />
Integriertes Praktikum<br />
Aus den folgenden zwei integrierten Praktika ist eines auszuwählen:<br />
701-0038-01 Feldkurs Ökologie FS 2 U 1 KP<br />
701-0038-02 Feldkurs Chemie und Umwelt FS 2 U 1 KP<br />
14 15
Informatik<br />
252-0839-00 Einsatz von Informatikmitteln HS 2 G 2 KP<br />
Studierende, die Wissen und Kenntnisse zum Einsatz von Informatikmitteln bereits mitbringen<br />
(Nachweis in einem Test), dürfen stattdessen im FS die LV 252-0840-01 Anwendungsnahes<br />
Programmieren mit Matlab wählen.<br />
Physik<br />
402-0062-00 Physik I FS 3 V + 1 U 5 KP<br />
Hinweis: Physik I wird zusammen mit Physik II im Rahmen eines Prüfungsblocks der Grundlagenfächer<br />
II ab dem dritten Semester geprüft.<br />
4.2 Studienplan zweites und drittes Jahr<br />
Grundsätzlich ist die Abfolge des Studiums nach dem Basisjahr von den Studierenden frei<br />
wählbar. Nach dem Basisjahr muss das Studium innerhalb von maximal vier Jahren abgeschlossen<br />
werden. Falls durchschnittlich etwa 30 KP pro Semester erworben werden, ist die<br />
Dauer grosszügig bemessen. Inhaltliche und stundenplantechnische Gegebenheiten führen<br />
zum im Folgenden beschriebenen „Normablauf“ des Studiums.<br />
Grundlagenfächer II<br />
Die Grundlagenfächer II werden in der Regel im zweiten Studienjahr besucht.<br />
Physik II<br />
402-0063-00 Physik II HS 3V + 1 U 5 KP<br />
701-0033-00 Praktikum Physik für Studierende in HS 4 P 2 KP<br />
Umweltnaturwissenschaften<br />
Mathematik<br />
401-0071-00 Mathematik III: Systemanalyse HS 2 V + 1 U 4 KP<br />
401-0624-00 Mathematik IV: Statistik FS 2 V + 1 U 4 KP<br />
Technik<br />
701-0352-00 Analyse und Beurteilung der Umweltverträg- FS 4 G 6 KP<br />
lichkeit<br />
Informatik<br />
252-0840-01 Anwendungsnahes Programmieren mit Matlab FS 2 G 2 KP<br />
Studierende, welche die Lehrveranstaltung Anwendungsnahes Programmieren bereits in<br />
den Grundlagenfächern I belegt haben, wählen die LV 252-0842-00 Programmieren und Problemlösen<br />
aus den naturwissenschaftlichen und technischen Wahlfächern.<br />
Integrierte Praktika<br />
701-0035-00 Beobachtungsnetze HS 3 P 1.5 KP<br />
701-0034-17 Schlusstage Int. Praktika: Nachhaltige Nutzung FS 2 P 1 KP<br />
der Kulturlandschaft<br />
Aus den folgenden sieben Integrierten Praktika sind drei auszuwählen:<br />
701-0034-06 Boden FS 3 P 1.5 KP<br />
701-0034-08 Waldökosysteme FS 3 P 1.5 KP<br />
701-0034-09* Analyse von Konflikten im Artenschutz FS 3 P 1.5 KP<br />
701-0034-10 Risikoabschätzung am Beispiel von GMO FS 3 P 1.5 KP<br />
701-0034-12 Pflanzenökologie: von der Theorie zur Praxis FS 3 P 1.5 KP<br />
701-0034-15 Aquatic Ecology FS 3 P 1.5 KP<br />
701-0034-16 Neuartige Ökosysteme in der Stadt FS 3 P 1.5 KP<br />
* wird im FS 2015 in veränderter Form durchgeführt<br />
Biologie<br />
752-4001-00 Mikrobiologie HS 2 V 2 KP<br />
701-0255-00 Biochemie HS 2 V 2 KP<br />
701-0245-00 Introduction to Evolutionary Biology HS 2 V 2 KP<br />
701-0220-00 Praktikum Mikrobiologie FS 3 P 2 KP<br />
Umweltsysteme<br />
701-0023-00 Atmosphäre HS 2 V 3 KP<br />
701-0401-00 Hydrosphäre HS 2 V 3 KP<br />
701-0501-00 Pedosphäre HS 2 V 3 KP<br />
16 17
Sozial- und geisteswissenschaftliches Modul<br />
Aus der Kategorie sozial- und geisteswissenschaftliche Module (14 KP) wird eines der vier<br />
Module gewählt. In jedem Modul sind mindestens 7 KP obligatorisch vorgegeben. Die restlichen<br />
KP können aus allen Modulen ausgesucht und im gewählten Modul angerechnet<br />
werden. Ebenfalls zur Auswahl stehen Lehrveranstaltungen aus den Modulen „Geschichte“,<br />
„Ökonomie“, „Philosophie“, „Politologie“, „Soziologie“, „Recht“, „Wissenschaftsforschung“<br />
aus dem Pflichtwahlfachangebot des D-GESS (Departement Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften).<br />
Die Lehrveranstaltungen des Moduls „Psychologie, Pädagogik“ dürfen ebenfalls<br />
gewählt werden mit Ausnahme von EW1, EW3 und EW4 (851-0240-00, 851-0238-01,<br />
851-0242-01).<br />
Die erforderlichen Studienleistungen können im zweiten Jahr und/oder im dritten Jahr erbracht<br />
werden.<br />
Modul Wirtschaftswissenschaften<br />
Obligatorische Veranstaltungen<br />
363-0387-00 Corporate Sustainability HS 2 G 3 KP<br />
751-1551-00 Ressourcen- und Umweltökonomie HS 2 V 3 KP<br />
701-0729-00 Methoden der empirischen Sozialforschung FS 2 G 2 KP<br />
Wählbare Veranstaltungen<br />
701-0763-00 Grundbegriffe des Managements HS 2 V 2 KP<br />
151-0757-00 Umwelt-Management HS 2 V 2 KP<br />
351-0778-00 Discovering Management HS/FS 3 G 3 KP<br />
351-0778-01 Discovering Management (Exercises) HS/FS 1 U 1 KP<br />
363-0503-00 Principles of Microeconomics HS 2 G 3 KP<br />
751-1101-00 Finanz- und Rechnungswesen HS 2 G 2 KP<br />
751-1651-00 Welternährung und Agrarmärkte HS 2 V 2 KP<br />
701-0758-00 Ökologische Ökonomik: Grundlagen und FS 2 V 2 KP<br />
Wachstumskritik<br />
363-0532-00 Ökonomische Theorie der Nachhaltigkeit FS 2 V 3 KP<br />
851-0609-04 The Energy Challenge – The Role of Technology, FS 2 G 2 KP<br />
Busines and Society<br />
851-0756-00 Umweltökonomie FS 2 G 2 KP<br />
Modul Staats- und Gesellschaftswissenschaften<br />
Obligatorische Veranstaltungen<br />
701-0747-00 Entwicklungen nationaler Umweltpolitik HS 2 V 3 KP<br />
851-0577-00 Politikwissenschaft: Grundlagen HS 2 V + 1 U 4 KP<br />
701-0707-00 Methoden der Textanalyse FS 2 G 2 KP<br />
oder<br />
701-0729-00 Methoden der empirischen Sozialforschung FS 2 G 2 KP<br />
Wählbare Veranstaltungen<br />
701-0727-00 Politics of Environmental Problem Solving in HS 2 G 2 KP<br />
Developing Countries<br />
701-0731-00 Umweltsoziologie HS 2 V 2 KP<br />
701-0985-00 Gesellschaftlicher Umgang mit aktuellen HS 1 V 1 KP<br />
Umweltrisiken<br />
227-0802-02 Soziologie HS 2 V 2 KP<br />
851-0591-00* Digitale Nachhaltigkeit in der Wissensgesellschaft HS 2 V 2 KP<br />
851-0594-00 International Environmental Politics I HS 2 V 4 KP<br />
701-0712-00** Naturbeziehungen in aussereuropäischen FS 2 V 2 KP<br />
Gesellschaften<br />
701-0786-00 Mediation und Umweltplanung: Grundlagen FS 2 G 2 KP<br />
und Anwendungen<br />
851-0594-02 International Environmental Politics II FS 2 V 4 KP<br />
851-0705-01 Umweltrecht: Konzepte und Rechtsgebiete FS 2 V 3 KP<br />
* Die LV findet im HS 2014 nicht statt<br />
** Die LV findet alle zwei Jahre statt.<br />
Modul Individualwissenschaften<br />
Obligatorische Veranstaltungen<br />
701-0721-00 Psychologie HS 2 V 3 KP<br />
752-2120-00 Consumer Behaviour I HS 2 V 2 KP<br />
701-0729-01 Methoden der empirischen Sozialforschung FS 2 G 2 KP<br />
Wählbare Veranstaltungen<br />
701-0771-00 Integrale Umweltkommunikation HS 2 G 2 KP<br />
701-0785-00 Umwelt- und Wissenschaftskommunikation HS 2 V 4 KP<br />
701-0696-00 Risikoverhalten in Arbeitswelt und Alltag FS 2 G 2 KP<br />
701-0782-00* Praxissicht und Forscherblick: Lernprozesse FS 1 G 2 KP<br />
für eine gelungene Zusammenarbeit<br />
701-0784-00 Marketing für Nachhaltigkeit: Konzepte, FS 2 G 2 KP<br />
Technik und Fallbeispiele<br />
701-0788-00 Medienproduktion, Mediennutzung und FS 1 V 1 KP<br />
Medienwirkung<br />
* Die LV findet alle zwei Jahre statt.<br />
Modul Geisteswissenschaften<br />
Obligatorische Veranstaltungen<br />
701-0701-00 Wissenschaftsphilosophie HS 2 V 3 KP<br />
701-0703-00 Ethik und Umwelt HS 2 G 2 KP<br />
701-0707-00 Methoden der Textanalyse FS 2 G 2 KP<br />
18 19
Wählbare Veranstaltungen<br />
701-0701-01 Wissenschaftsphilosophie (Übungen) HS 1 U 1 KP<br />
701-0791-00 Umweltgeschichte – Einführung und HS 2 V 2 KP<br />
ausgewählte Probleme<br />
851-0125-00* Einführung in die Naturphilosophie HS/FS 2 V 3 KP<br />
Gesetzmässigkeit, Zufall, Freiheit<br />
701-0792-00 Wald und Landschaft als soziale FS 1 V 2 KP<br />
Repräsentationsformen<br />
851-0101-01 Einführung in die praktische Philosophie FS 2 G 3 KP<br />
* Die LV findet alle zwei Jahre statt.<br />
In Absprache mit der Fachberaterin in Sozial- und Geisteswissenschaften können auch Angebote<br />
an der Uni Zürich ausgewählt werden.<br />
Naturwissenschaftliche und technische Wahlfächer<br />
Die Kategorie Naturwissenschaftliche und technische Wahlfächer umfasst Module und Einzelfächer.<br />
Insgesamt sind 23 KP zu erwerben. In den Modulen sind thematisch verwandte<br />
Lerneinheiten zusammengefasst. In einem gewählten Modul müssen minimal 9 KP erworben<br />
werden. Es ist mindestens ein Modul zu wählen. Einzelfächer dürfen aus allen Modulen und<br />
aus der Kategorie „Umweltsysteme“ gewählt werden. Auf Gesuch hin kann der Studienkoordinator<br />
auch Fächer aus dem übrigen Lehrangebot der <strong>ETH</strong> Zürich oder der Universität<br />
Zürich bewilligen.<br />
Die erforderlichen Studienleistungen können im zweiten und dritten Jahr erbracht werden.<br />
Die Wahl von Modul und Einzelfächern sollte auch vor dem Hintergrund der Präferenz für<br />
eine Vertiefung (Major) auf der Masterstufe überlegt werden. Untenstehende Tabelle zeigt,<br />
wie die Module auf einen bestimmten Major vorbereiten. Betreffend Voraussetzungen zur<br />
Masterausbildung gibt Kapitel 8.1 weitere Informationen.<br />
Englische Sprachkurse<br />
Von den untenstehenden englischen Sprachkursen können maximal 2 KP angerechnet werden.<br />
Werden mehr Kreditpunkte erworben, können diese im Beiblatt zum Diplomzeugnis<br />
ausgewiesen, nicht aber für die 180 KP des Bachelors angerechnet werden. Alle übrigen<br />
Sprachkurse im Angebot der <strong>ETH</strong> oder des Sprachenzentrum können nicht angerechnet werden.<br />
Für alle Sprachkurse braucht es eine Einschreibung am Sprachenzentrum.<br />
Academic Reading, Speaking and Vocabulary (B2) HS/FS 2 G 2 KP<br />
Academic Reading, Speaking and Vocabulary (C1) HS/FS 2 U 2 KP<br />
Understanding Lectures and Participating in Discussions (B2) HS/FS 1 U 1 KP<br />
Basic Academic Writing Skills – Natural Science and Engineering (B2) HS/FS 1 U 1 KP<br />
Developing Presentations Skills – Science and Engineering (B2.2 - C1) HS/FS 1 U 1 KP<br />
Module<br />
Biomedizin<br />
Major<br />
Bodenwissenschaften<br />
Methoden der<br />
statistischen<br />
Datenanalyse<br />
Ökologie &<br />
Naturschutz<br />
Umweltchemie &<br />
Ökotoxikologie<br />
Umweltphysik<br />
Technik und<br />
Planung<br />
Atmosphere<br />
&<br />
Climate<br />
<br />
<br />
<br />
Forest &<br />
Landscape<br />
Management<br />
Biogeochemistry<br />
& Pollutant<br />
Dynamics<br />
<br />
<br />
Ecology &<br />
Evolution<br />
<br />
Human-<br />
Environment<br />
Systems<br />
Human<br />
Health,<br />
Nutrition &<br />
Environ<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
= sehr passend<br />
= passend<br />
Module<br />
Biomedizin<br />
376-0151-00 Anatomie I und Physiologie I HS 4 V 6 KP<br />
551-0317-00 Immunology I HS 2 V 3 KP<br />
752-6001-00 Introduction to Nutritional Science HS 2 V 3 KP<br />
701-0612-01 Grundlagen in der Ökotoxikologie FS 2 V 3 KP<br />
701-0614-00 Allergie und Umwelt FS 1 V 1 KP<br />
376-0150-00 Anatomie II, Physiologie II und Histologie FS 4 V + 2 G 6 KP<br />
551-0318-00 Immunology II FS 2 V 3 KP<br />
20 21
Bodenwissenschaften<br />
701-0533-00 Bodenchemie HS 2 G 3 KP<br />
701-0535-00 Environmental Soil Physics/Vadose Zone Hydrology HS 2 G + 2U 3 KP<br />
651-3525-00 Ingenieurgeologie HS 2 G 3 KP<br />
701-1802-00 Ökologie von Waldböden FS 2 G 3 KP<br />
701-0524-00 Bodenbiologie FS 2 G 3 KP<br />
701-0522-01 Angewandte Bodenökologie FS 2 G 2 KP<br />
551-0252-00 Böden und Vegetation der Alpen FS 2 G 2 KP<br />
701-0518-00L Bodenschutz und Landnutzung FS 2 G 3 KP<br />
Methoden der statistischen Datenanalyse<br />
701-0105-00 Mathematik VI: Angewandte Statistik für HS 2 G 3 KP<br />
Umweltnaturwissenschaften*<br />
701-1671-00 Sampling Techniques for Forest Inventories*** HS 2 G 3 KP<br />
401-6215-00 Using R for Data Analysis and Graphics (Part I)* HS 1 G 1 KP<br />
401-6217-00 Using R for Data Analysis and Graphics (Part II)* HS 1 G 1 KP<br />
401-0649-01 Applied Statistical Regression (Part I)* HS 2 G 2 KP<br />
401-0649-02 Applied Statistical Regression (Part II)* HS 2 G 2 KP<br />
401-0625-01 Applied Analysis of Variance and Experimental HS 2 G 4 KP<br />
Design**<br />
701-0104-00 Statistical Modelling of Spatial Data*** FS 2 G 3 KP<br />
401-0102-00 Multivariate Statistics ** FS 2 G 3 KP<br />
401-6624-11 Applied Time Series Analysis** FS 2 G 4 KP<br />
* Grundlagenveranstaltungen<br />
** Vertiefende Veranstaltungen<br />
*** Spezialveranstaltungen<br />
Ökologie und Naturschutz<br />
701-0305-00 Ökologie der Wirbeltiere HS 2 G 2 KP<br />
701-0405-00 Binnengewässer: Konzepte und Methoden für HS 2 G 3 KP<br />
ein nachhaltiges Management<br />
701-0303-00 Waldvegetation und Waldstandorte FS 1 G 2 KP<br />
701-0310-00 Naturschutz und Naturschutzbiologie FS 2 G 2 KP<br />
701-0314-00 Pflanzendiversität: kollin/montan FS 90 Std P 3 KP<br />
701-0314-01 Pflanzendiversität: subalpin/alpin FS 90 Std P 3 KP<br />
701-0322-00 Praxisseminar Naturschutz FS 2 S 2 KP<br />
701-0324-00 Rain Forest Ecology FS 2 G 2 KP<br />
551-0250-00 Flora, Vegetation und Böden der Alpen FS 1 V + 2P 3 KP<br />
Umweltchemie/Ökotoxikologie<br />
701-0201-00 Einführung in die organische HS 4 G 5 KP<br />
Umweltchemie/Umweltanalytik<br />
701-0225-00 Organische Chemie HS 2 V 2 KP<br />
701-0297-00 Angewandte Ökotoxikologie HS 2 V 2 KP<br />
529-0051-00* Analytische Chemie I HS 3 V 3 KP<br />
701-0206-00 Ausgewählte Kapitel der physikalischen Chemie FS 2 V 2 KP<br />
701-0208-00 E in die Umweltchemie und Umweltmikrobiologie FS 1 P 1 KP<br />
701-0252-00 Molekularbiologie FS 2 G 2 KP<br />
701-0612-01 Grundlagen in der Ökotoxikologie FS 2 V 3 KP<br />
701-0996-00 Stofforientierte Risikoanalyse FS 3 G 4 KP<br />
529-0289-00* Instrumentalanalytik organischer Verbindungen FS 2 G 2 KP<br />
* Voraussetzung für entsprechenden Minor in der Masterausbildung<br />
Umweltphysik<br />
701-0479-00 Umwelt-Fluiddynamik HS 2 G 3 KP<br />
101-0203-01 Hydraulik I HS 3 V + 1 U 5 KP<br />
102-0455-01 Grundwasser I HS 2 G 3 KP<br />
651-3561-00 Kryosphäre HS 2 V 3 KP<br />
701-0106-00 Mathematik V: Anwendungsorientierte FS 2 G 3 KP<br />
Vertiefung von Mathematik I - III<br />
701-0234-00 Messmethoden in der Atmosphärenchemie FS 1 V 1 KP<br />
701-1236-00 Messmethoden in der Meteorologie und FS 1 V 1 KP<br />
Klimaforschung<br />
402-0048-00 Fortgeschrittene Physik für Umwelt- und FS 4 V + 2 U 6 KP<br />
ErdwissenschaftlerInnen<br />
Technik und Planung<br />
Raum- und Verkehrsplanung<br />
701-0951-00 GIST - Einführung in die räumlichen Informations- HS 4 G 5 KP<br />
wissenschaften und -technologien<br />
101-0415-01 Bahninfrastrukturen HS 2 G 3 KP<br />
701-0953-00 GIS Fallstudie FS 2 A 2 KP<br />
101-0408-00 Praktikum Siedlung und Verkehr FS 2 P 2 KP<br />
101-0414-00 Verkehr I (Verkehrsplanung) FS 2 G 3 KP<br />
102-0516-01 UVP FS 2 G 3 KP<br />
103-0357-00 Umweltplanung FS 2 G 3 KP<br />
Erneuerbare Energien<br />
701-0962-02 Energietechnik und Umwelt FS 2 V + 1 K 3 KP<br />
701-0967-00 Projektentwicklung im Bereich erneuerbare HS 2 G 2 KP<br />
Energien<br />
529-0193-00 Renewable Energy Technologies I HS 2 V + 1 U 4 KP<br />
22 23
Weitere wählbare Lehrveranstaltungen (als Einzelfächer)<br />
701-0317-00 Gehölzbestimmung im Winter HS 1 G 1 KP<br />
051-0159-00 Urban Design I HS 2 V 1 KP<br />
751-4801-00 Systembezogene Bekämpfung herbivorer Insekten I HS 2 G 2 KP<br />
701-0316-00 Gehölzpflanzen Mitteleuropas FS 2 G 2 KP<br />
701-0972-00 E in biologische Landbausysteme FS 2 V 3 KP<br />
701-0974-00 Vergleich von Landbausystemen FS 3 G 3 KP<br />
701-1638-00 Mountain Forest Ecology: Practical Training FS 4 P 2 KP<br />
102-0214-02 Siedlungswasserwirtschaft GZ FS 4 G 5 KP<br />
252-0842-00 Programmieren und Problemlösen FS 2 V + 0.5 U 3 KP<br />
751-4802-00 Systembezogene Bekämpfung herbivorer Insekten II FS 2 G 2 KP<br />
Umweltsysteme<br />
Die Studierenden wählen eine der fünf Systemvertiefungen (21 KP). Mit den LV der Kernfächer<br />
werden 12 KP erworben. Das Seminar mit 2 KP und das Praktikum mit 7 KP sind obligatorisch.<br />
Die Systemvertiefung wird im dritten Studienjahr besucht.<br />
Biogeochemie<br />
701-0216-00 Biogeochemische Kreisläufe HS 2 G 3 KP<br />
701-0419-01 Seminar für Bachelorstudierende: Biogeochemie HS 2 G 2 KP<br />
701-0423-00 Chemie aquatischer Systeme HS 2 G 3 KP<br />
701-0533-00 Bodenchemie HS 2 G 3 KP<br />
701-0535-00 Environmental Soil Physics/Vadose Zone Hydrology HS 2 G + 2 U 3 KP<br />
701-0420-01 Praktikum Biogeochemie FS 14 P 7 KP<br />
701-0426-00 Modellierung aquatischer Ökosysteme FS 2 G 3 KP<br />
701-0478-00 Introduction to physical Oceanography FS 2 V + 1U 3 KP<br />
701-0524-00 Bodenbiologie FS 2 V 3 KP<br />
Atmosphäre und Klima<br />
701-0459-00 Seminar für Bachelorstudierende: Atmosphäre HS 2 S 2 KP<br />
und Klima<br />
701-0471-01 Atmosphärenchemie HS 2 G 3 KP<br />
701-0473-00 Wettersysteme HS 2 G 3 KP<br />
701-0475-00 Atmosphärenphysik HS 2 G 3 KP<br />
701-0461-00 Numerische Methoden in der Umweltphysik HS 2 G 3 KP<br />
701-0412-00 Klimasysteme FS 2 G 3 KP<br />
701-0460-00 Praktikum Atmosphäre und Klima FS 14 P 7 KP<br />
Aus den genannten fünf Kernfächern wählen die Studierenden im Allgemeinen vier aus, um<br />
die erforderlichen 12 KP zu erwerben. In der Systemvertiefung Atmosphäre und Klima können<br />
alternativ aus diesen Kernfächern nur drei gewählt werden und zusätzlich ein Fach aus<br />
der Liste der obligatorischen Vorlesungen des Major in „Atmosphäre und Klima“ oder ein<br />
Kernfach aus einer der vier nicht gewählten Systemvertiefungen.<br />
Umweltbiologie<br />
701-0301-00* Ökosysteme: Funktionen und Prozesse HS 2 V 3 KP<br />
701-0320-00 Seminar für Bachelorstudierende: Umweltbiologie HS 2 S 2 KP<br />
701-0323-00 Pflanzenökologie HS 2 V 3 KP<br />
701-1413-00 Population and Quantitative Genetics HS 2 V 3 KP<br />
701-1415-00 Population Biology HS 2 V 3 KP<br />
701-0326-00 Ecological and Evolutionary Applications FS 2 V 3 KP<br />
701-0328-00 Advanced Ecological Processes FS 2 V 3 KP<br />
701-0340-00 Praktikum Umweltbiologie FS 14 P 7 KP<br />
* Die LV findet im HS 2014 nicht statt<br />
Mensch-Umwelt Systeme<br />
701-0651-00 Koevolution zwischen Gesellschaft und Umwelt: HS 2 V 3 KP<br />
Analyse und Einflussnahme<br />
701-0653-00* Mensch-Umwelt Systeme in der internationalen HS 2 G 3 KP<br />
Forschung<br />
701-0655-00 Modellierung von Mensch-Umweltsystemen am HS 2 G 3 KP<br />
Beispiel Ressourcenmanagement<br />
701-0963-00 Energy and Mobility HS 2 G 3 KP<br />
701-0656-00 Introduction to Modelling of Human-Environment FS 2 G 3 KP<br />
Systems<br />
701-0658-00 Seminar für Bachelorstudierende: Anthroposphäre FS 2 S 2 KP<br />
701-0660-00 Praktikum Anthroposphäre FS 14 P 7 KP<br />
* Die LV findet im HS 2014 nicht statt<br />
Wald und Landschaft<br />
701-0561-00 Waldökologie HS 2 V 3 KP<br />
701-0553-00 Landschaftsökologie HS 2 G 3 KP<br />
701-0565-00 Grundzüge des Naturgefahrenmanagements HS 2 G 3 KP<br />
701-0563-00 Wald- und Baumkrankheiten HS 3 G 3 KP<br />
701-0582-00 Waldnutzungskonzepte FS 2 G 3 KP<br />
701-0554-00 Entwicklung und Lenkung ländlicher FS 2 G 3 KP<br />
Raumnutzungssysteme<br />
701-0559-00 Seminar für Bachelorstudierende: Wald und HS 2 S 2 KP<br />
Landschaft<br />
701-0560-00 Praktikum Wald und Landschaft FS 14 P 7 KP<br />
24 25
Bachelorarbeit<br />
Als Bachelorarbeit können entweder eine grosse Arbeit (10 KP) oder zwei kleine Arbeiten (je<br />
5 KP) verfasst werden. Die grosse Bachelorarbeit kann im Bereich Naturwissenschaften und<br />
Technik oder im Bereich Sozial- und Geisteswissenschaften verfasst werden oder auch interdisziplinär<br />
ausgerichtet sein. Wer sich für zwei kleine Bachelorarbeiten entscheidet, muss<br />
die eine im Bereich Naturwissenschaften und Technik und die andere im Bereich Sozial- und<br />
Geisteswissenschaften verfassen.<br />
Zur Leitung einer grossen Bachelorarbeit berechtigt sind Professorinnen und Professoren des<br />
D-USYS, einschliesslich der am D-USYS assoziierten Professorinnen und Professoren, sowie<br />
Dozentinnen und Dozenten, die am Unterricht im Studiengang beteiligt sind. Für die Leitung<br />
einer kleinen Bachelorarbeit im Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften sind Dozentinnen<br />
und Dozenten berechtigt, welche am Unterricht im Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften<br />
beteiligt sind. Im Bereich der Naturwissenschaften und Technik sind Dozentinnen<br />
und Dozenten berechtigt, welche am Unterricht der naturwissenschaftlichen Fächer<br />
oder der System- oder Technikfächer beteiligt sind. Die zuständigen Fachberaterinnen und<br />
Fachberater entscheiden über Ausnahmen.<br />
Die Leiterin/der Leiter der Bachelorarbeit legt in Absprache mit der/dem Studierenden das<br />
Thema und den Abgabetermin fest. Die Arbeit kann als Gruppenarbeit verfasst werden, sofern<br />
die Leiterin/der Leiter damit einverstanden ist. Weitere Bestimmungen sind in einem<br />
Merkblatt festgehalten, das von der Webseite www.usys.ethz.ch/docs/env/bachelor/thesis<br />
herunter geladen werden kann. Diese Webseite enthält zusätzliche Hilfen und Links für Bachelorarbeiten.<br />
Integraler Bestandteil jeder Bachelorarbeit ist eine Eigenständigkeitserklärung. Das Formular<br />
kann auch unter www.usys.ethz.ch/docs/env/bachelor/thesis herunter geladen werden.<br />
701-0010-02 Kleine Bachelor-Arbeit in Sozial- und HS/FS 150 Std. 5 KP<br />
Geisteswissenschaften<br />
701-0010-03 Kleine Bachelor-Arbeit in Naturwissen- HS/FS 150 Std. 5 KP<br />
schaften und Technik<br />
701-0010-10 Bachelor-Arbeit HS/FS 300 Std. 10 KP<br />
5 Mobilitätsstudium<br />
Ein Semester an einer anderen Hochschule<br />
Möchten Sie eine andere Hochschule in der Schweiz oder im Ausland kennen lernen Viele<br />
Studierende spielen mit dem Gedanken, ein Auslandsemester einzulegen. Die Organisation<br />
erfordert einiges an Engagement, doch sind Auslandaufenthalte eine besondere persönliche<br />
und fachliche Bereicherung. An europäischen und aussereuropäischen Hochschulen gibt es<br />
eine Vielzahl interessanter Studiengänge. Das Spektrum umfasst allgemeine Umweltstudiengänge<br />
aber auch spezialisierte Ausbildungen, wie beispielsweise ökologischer Landbau,<br />
Forstwissenschaften, Umweltmedizin, Umweltmanagement oder Ökotourismus.<br />
Voraussetzungen<br />
Für das Bachelordiplom Umweltnaturwissenschaften können im dritten Studienjahr maximal<br />
30 Kreditpunkte an einer anderen Hochschule erworben werden. Zulassungsbedingung<br />
im Rahmen von Mobilitätsprogrammen ist die bestandene Basisprüfung mit einem Notendurchschnitt<br />
von mindestens 4.5. Bei einzelnen Programmen (z.B. weltweite Abkommen)<br />
können weitere Anforderungen gelten. Der Prüfungsblock 1 muss vor Antritt des Mobilitätsstudiums<br />
bestanden sein.<br />
In Zusammenarbeit mit den Fachberatungen und der Mobilitätsberatung für den Studiengang<br />
Umweltnaturwissenschaften ist im Voraus ein Studienprogramm (Learning Agreement)<br />
zusammenzustellen. Darin werden die Kreditpunkte festgehalten, welche an der Gastgeber-<br />
Hochschule erarbeitet werden. Das Studienprogramm muss von der Beraterin/vom Berater<br />
der Systemvertiefung bzw. von der Fachberaterin/vom Fachberater und der Mobilitätsberatung<br />
genehmigt werden.<br />
Informationen<br />
Informationen zu den einzelnen Austauschprogrammen (ERASMUS, weltweite Abkommen,<br />
Schweizer Mobilität usw.) sind auf der Seite der Mobilitätsstelle der <strong>ETH</strong> Zürich unter<br />
www.mobilitaet.ethz.ch verfügbar. Weitere Informationen und Formulare sind abrufbar<br />
unter www.usys.ethz.ch/env/bachelor/mobility .<br />
26 27
6 Leistungskontrollen<br />
6.1 Grundsätzliches<br />
Leistungen der Studierenden werden mit verschiedenen Formen von Leistungskontrollen<br />
überprüft. In der Regel erfolgt die Leistungskontrolle in einer Sessionsprüfung. Aber auch<br />
Semesterendprüfungen und Semesterleistungen wie aktive Teilnahme an Praktika und<br />
Exkursionen, schriftliche Arbeiten sowie Referate können als Leistungskontrollen dienen.<br />
Modus und Dauer der Prüfungen sind im Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Die Dozierenden<br />
sind verpflichtet die Studierenden zu Beginn einer LV schriftlich über den genauen Prüfungsstoff,<br />
die genaue Form und über die erlaubten Hilfsmittel zu orientieren.<br />
Lerneinheiten und die dazugehörenden Leistungskontrollen des Studiengangs werden in der<br />
Regel auf Deutsch oder Englisch durchgeführt. Für die Unterrichtssprache gelten die diesbezüglichen<br />
Weisungen 2 des Rektors/der Rektorin.<br />
Die in Leistungskontrollen erbrachten Leistungen können entweder mit Noten oder mit bestanden/nicht<br />
bestanden bewertet werden. Eine nicht bestandene Leistungskontrolle kann<br />
einmal wiederholt werden.<br />
Sobald eine Prüfung, ein Prüfungsblock oder eine andere Leistungskontrolle bestanden ist,<br />
werden die erbrachten Studienleistungen in Form von Kreditpunkten für den Erwerb des<br />
Bachelordiploms gutgeschrieben und sind für die Studierenden über myStudies einsehbar.<br />
Kreditpunkte werden nur für genügende Leistungen und immer in vollem Umfang erteilt.<br />
Eine Aufteilung der KP auf verschiedene Kategorien ist nicht möglich.<br />
Die Studierenden erhalten periodisch Mitteilungen (Zwischenzeugnisse) per Mail über die<br />
bewerteten Studienleistungen und die erworbenen KP. Dabei wird auch darauf hingewiesen,<br />
wie bei allfälligen Unstimmigkeiten vorzugehen ist.<br />
6.2 Leistungskontrollen im 1. Studienjahr (Basisprüfung)<br />
Basisprüfung<br />
In der Basisprüfung werden die meisten Grundlagenfächer I geprüft. Sie wird als Sessionsprüfung<br />
in der Regel im Sommer nach dem ersten Studienjahr absolviert. Es ist möglich die<br />
Prüfung erst in der nachfolgenden Wintersession abzulegen.<br />
Prüfungsfächer, Gewichtung und Prüfungsmodalitäten<br />
Die Basisprüfung umfasst je eine schriftliche Prüfung in den nachfolgenden Prüfungsfächern,<br />
die zu einem Prüfungsblock zusammengefasst werden. Es werden zwei gleichwertige Varianten<br />
angeboten. In Variante A wird die Lerneinheit Erd- und Produktionssysteme geprüft, in<br />
Variante B die Lerneinheit Dynamische Erde I.<br />
Prüfungsfächer<br />
Notengewicht<br />
Chemie I und II 12<br />
Mathematik I und II 12<br />
Recht 3<br />
Ökonomie 3<br />
Technik der Problemlösung* 6<br />
Biologie I und II 6<br />
Biologie III 2<br />
Biologie IV 4<br />
Erd- und Produktionssysteme (Variante A) 6<br />
oder<br />
Dynamische Erde (Variante B) 6<br />
* Die Prüfung setzt sich zusammen aus den zwei LV Problemlösen im Rahmen<br />
von Projekten und Einführung in den Umgang mit Umweltsystemen<br />
Prüfungsergebnis, Prüfungswiederholung<br />
Die Basisprüfung ist bestanden, wenn der Durchschnitt der gewichteten Noten aller zugehörigen<br />
Prüfungen mindestens 4.0 beträgt.<br />
Eine nicht bestandene Basisprüfung kann einmal wiederholt werden. Die Wiederholung umfasst<br />
die gesamte Basisprüfung in der gleichen Variante. Die Wiederholung muss spätestens<br />
zwei Jahre nach Studienbeginn absolviert sein. Im Falle der Prüfungswiederholung gelten<br />
immer die Noten des zweiten Versuchs.<br />
Leistungskontrollen weiterer obligatorischer Fächer<br />
Alle Lerneinheiten der Kategorie Grundlagenfächer I, die nicht in der Basisprüfung geprüft<br />
werden, werden mit Semesterendprüfungen oder Semesterleistungen während des Semesters<br />
abgeschlossen.<br />
6.3 Leistungskontrollen im 2. und 3. Studienjahr<br />
Leistungskontrollen in den Grundlagenfächern II<br />
Ein grosser Teil der Lerneinheiten der Grundlagenfächer II werden in zwei Blöcken zusammengefasst<br />
geprüft. Die zu einem Prüfungsblock zugehörigen Prüfungen müssen gesamthaft<br />
in der gleichen Prüfungssession abgelegt werden. Die beiden Prüfungsblöcke werden für<br />
gewöhnlich in unterschiedlichen Prüfungssessionen absolviert.<br />
Alle Lerneinheiten der Kategorie Grundlagenfächer II, die nicht in einem Prüfungsblock geprüft<br />
werden, werden mit Semesterendprüfungen oder Semesterleistungen während des<br />
Semesters abgeschlossen.<br />
2<br />
Zu finden unter: www.ethz.ch/content/dam/ethz/common/docs/weisungssammlung/files-de/unterrichtssprache.pdf<br />
28 29
Prüfungsblöcke der Kategorie Grundlagenfächer II<br />
Der Prüfungsblock 1 umfasst je eine schriftliche Prüfung in den nachfolgenden Prüfungsfächern:<br />
Prüfungsblock 1<br />
Notengewicht<br />
Physik I* und II 12<br />
Mikrobiologie 4<br />
Biochemie 4<br />
Introduction to Evolutionary Biology 4<br />
* Physik I aus dem Studienplan des ersten Jahres<br />
Prüfungsblock 2<br />
Notengewicht<br />
Atmosphäre 3<br />
Hydrosphäre 3<br />
Pedosphäre 3<br />
Mathematik III 4<br />
Mathematik IV: Statistik 4<br />
Technik 6<br />
Prüfungsblock 1 kann frühestens nach dem dritten, Prüfungsblock 2 frühestens nach dem<br />
vierten Semester absolviert werden.<br />
Prüfungsergebnisse<br />
Die beiden Prüfungsblöcke aus der Kategorie der Grundlagenfächer II sind bestanden, wenn<br />
der Durchschnitt der gewichteten Noten aller zugehörigen Prüfungen je Block mindestens<br />
4.0 beträgt.<br />
Wenn ein Prüfungsblock bestanden ist, werden die Kreditpunkte für die erbrachten Studienleistungen<br />
gesamthaft gutgeschrieben.<br />
wenn die Leistung mit einer Note von mindestens 4 oder mit dem Prädikat „bestanden“<br />
bewertet wird. Eine einmal nicht bestandene Leistungskontrolle kann nur einmal wiederholt<br />
werden.<br />
Bachelorarbeit<br />
Die Leiterin/der Leiter bewertet die Bachelorarbeit mit einer Note. Die grosse Bachelorarbeit<br />
ist bestanden, wenn die Note mindestens 4 beträgt. Die kleinen Bachelorarbeiten sind bestanden,<br />
wenn bei jeder der beiden Arbeiten die Note mindestens 4.0 beträgt.<br />
Für die Wiederholung einer nicht bestanden Bachelorarbeit gilt:<br />
· Eine nicht bestandene grosse Bachelorarbeit kann nur einmal wiederholt werden. Im Falle<br />
einer Wiederholung muss ein neues Thema bearbeitet werden.<br />
· Eine nicht bestandene kleine Bachelorarbeit kann nur einmal wiederholt werden; dies gilt<br />
für jede der beiden Arbeiten gleichermassen. Im Falle einer Wiederholung muss innerhalb<br />
des jeweiligen Themenbereichs ein neues Thema bearbeitet werden.<br />
· Wer die grosse Bachelorarbeit nicht bestanden hat, kann als Wiederholung zwei kleine<br />
Bachelorarbeiten verfassen, wobei jedoch für jede der beiden kleinen Arbeiten nur noch<br />
ein Versuch zur Verfügung steht.<br />
· Wer eine der kleinen Bachelorarbeiten oder auch beide nicht bestanden hat, kann als Wiederholung<br />
eine grosse Bachelorarbeit verfassen, wobei jedoch nur noch ein Versuch für<br />
die grosse Arbeit zur Verfügung steht.<br />
· Wer die Wiederholung einer Bachelorarbeit nicht besteht, kann die erforderlichen KP für<br />
das Bachelor-Diplom definitiv nicht mehr erreichen und wird aus dem Studiengang ausgeschlossen.<br />
Prüfungswiederholung<br />
Ein nicht bestandener Prüfungsblock kann einmal wiederholt werden. Die Wiederholung<br />
umfasst den gesamten Prüfungsblock. Im Falle der Prüfungswiederholung gelten immer die<br />
Noten des zweiten Versuchs.<br />
Leistungskontrollen in der Systemvertiefung, im Sozial- und geisteswissenschaftlichen<br />
Modul sowie in den Naturwissenschaftlichen und technischen Wahlfächern<br />
Zu jeder Lerneinheit der Kategorien „Systemvertiefung“, „Sozial- und geisteswissenschaftliches<br />
Modul“ sowie „Naturwissenschaftliche und technische Wahlfächer“ gehört eine Leistungskontrolle.<br />
Die Modalitäten der Leistungskontrollen werden im Vorlesungsverzeichnis<br />
festgelegt, falls die Lerneinheit aus dem Lehrangebot der <strong>ETH</strong> Zürich stammt. Stammt eine<br />
Lerneinheit aus dem Lehrangebot einer anderen Hochschule, so legt die betreffende Hochschule<br />
die Modalitäten der Leistungskontrolle fest. Eine Leistungskontrolle ist bestanden,<br />
30 31
7 Bachelordiplom<br />
7.1 Antrag auf Diplomerteilung<br />
Für den Erwerb des Bachelordiploms sind in den Kategorien bzw. Unterkategorien gemäss<br />
Kapitel 2.1 eine angegebene Mindestanzahl von Kreditpunkten (KP) zu erwerben. Nach Erfüllung<br />
dieser Anforderungen können die Studierenden innerhalb von fünf Jahren ab Beginn<br />
des Bachelorstudiums die Erteilung des Bachelordiploms beantragen. Im Antrag sind die<br />
Studienleistungen aus den Kategorien bzw. Unterkategorien anzugeben, die in das Schlusszeugnis<br />
aufgenommen werden sollen. Maximal können 190 KP aufgeführt werden. Mit dem<br />
Antrag müssen zudem die Kopie(en) der Eigenständigkeitserklärung(en) und des Deckblatts/<br />
der Deckblätter der Bachelorarbeit(en) abgegeben werden.<br />
Das Bachelordiplom berechtigt zur Führung des folgenden akademischen Titels:<br />
Bachelor of Science <strong>ETH</strong> in Umweltnaturwissenschaften<br />
(Abgekürzter Titel: BSc <strong>ETH</strong> Umwelt-Natw.)<br />
Die englische Bezeichnung des Titels lautet:<br />
Bachelor of Science <strong>ETH</strong> in Environmental Sciences<br />
(Abgekürzter Titel: BSc <strong>ETH</strong> Environ. Sc.)<br />
7.2 Schlusszeugnis und Bachelorurkunde<br />
Im Schlusszeugnis werden die Noten und die weiteren Leistungsbewertungen gemäss dem<br />
Antrag auf Diplomerteilung sowie der Notendurchschnitt aufgeführt. Dieser errechnet sich<br />
als gewichtetes Mittel aus folgenden Noten:<br />
Die Note der Basisprüfung Notengewicht 8<br />
Die Noten der beiden Prüfungsblöcke in der je Notengewicht 4<br />
Kategorie Grundlagenfächer II<br />
Der Durchschnitt der in der Kategorie „Naturwissenschaftliche und Notengewicht 4<br />
technische Wahlfächer“ erreichten Noten<br />
Der gewichtete Durchschnitt der in der Kategorie Notengewicht 4<br />
„Systemvertiefung“ erreichten Noten<br />
Der gewichtete Durchschnitt der in der Kategorie „Sozial- und Notengewicht 3<br />
geisteswissenschaftliches Modul“ erreichten Noten<br />
Note der grossen Bachelorarbeit oder Durchschnittsnote der in den Notengewicht 1<br />
beiden kleinen Bachelorarbeiten erreichten Noten<br />
Die Durchschnittsnoten errechnen sich als gewichtetes Mittel aus den zugehörigen Einzelnoten.<br />
Das Gewicht einer Einzelnote entspricht der Anzahl Kreditpunkte, die der Lerneinheit<br />
jeweils zugrunde liegen.<br />
Wer das Bachelordiplom erwirbt, erhält zudem eine Bachelorurkunde und ein Diploma Supplement.<br />
Im Diploma Supplement werden die besuchten Lerneinheiten mit Kurzbeschreibungen<br />
und die erworbenen Kreditpunkte aufgeführt.<br />
32 33
8 Weiterführende Ausbildungen<br />
8.1 Masterstudium<br />
Ein Bachelorabschluss in Umweltnaturwissenschaften ermöglicht den direkten Anschluss an<br />
ein zweijähriges Masterstudium in Umweltnaturwissenschaften oder in Umweltingenieurwissenschaften<br />
der <strong>ETH</strong> Zürich. Er ermöglicht aber auch den Zugang zu weiteren Masterausbildungen<br />
an der <strong>ETH</strong> Zürich und anderen Universitäten des In- und Auslands. Ein solcher<br />
Übertritt kann mit der Auflage zum Besuch von vorbereitenden Lehrveranstaltungen und<br />
dem Erwerb zusätzlicher Kreditpunkte verbunden sein.<br />
Unabhängig von der im dritten Studienjahr gewählten Spezialisierung gilt die Zulassung<br />
für alle Vertiefungen (Major) des Masterstudienganges in Umweltnaturwissenschaften. Es<br />
ist allerdings empfehlenswert, im dritten Jahr Bachelor die Kernfächer zu wählen, die auf<br />
die bevorzugte Mastervertiefung vorbereiten. Für jede Vertiefung kann auf der Webseite<br />
www.usys.ethz.ch/env/bachelor/prerequisites eine entsprechende Zusammenstellung herunter<br />
geladen werden.<br />
Die Masterausbildung kann im Herbst- oder Frühjahrssemester begonnen werden, sobald<br />
im Bachelorstudium insgesamt weniger als 30 KP fehlen. Umfangreiches Informationsmaterial<br />
wird über die Webseite www.usys.ethz.ch/env/master zur Verfügung gestellt. In<br />
einer separaten <strong>Wegleitung</strong> (Study Guide) ist das Lehrangebot mit einem Verzeichnis der<br />
Lehrveranstaltungen detailliert beschrieben.<br />
8.2 Doktorat<br />
Die Professoren und Professorinnen des Departements Umweltsystemwissenschaften bieten<br />
erfolgreichen Absolventen und Absolventinnen des Masterstudienganges die Gelegenheit<br />
eine Dissertation auszuarbeiten. Diese dritte Ausbildungsstufe schliesst mit dem Titel<br />
Dr. sc. nat. ab und bereitet gezielt auf eine forschungsorientierte Tätigkeit im universitären<br />
wie auch im ausseruniversitären Bereich vor. Für die prüfungsfreie Zulassung wird ein<br />
Masterdiplom der <strong>ETH</strong> Zürich oder ein gleichwertiges Diplom einer anderen Hochschule<br />
verlangt. Die Bestimmungen zum Doktoratsstudium können unter www.usys.ethz.ch/docs/<br />
doctorate/index_EN eingesehen werden.<br />
8.3 Didaktische Ausbildung<br />
Die nachfolgend beschriebenen didaktischen Ausbildungsgänge können nach dem Erwerb<br />
des Bachelordiploms begonnen werden.<br />
Didaktik Zertifikat (DZ) Umweltlehre<br />
Die Ausbildung zum DZ in Umweltlehre bescheinigt den erfolgreichen Abschluss einer didaktischen<br />
Grundausbildung in Umweltnaturwissenschaften und qualifiziert für die Lehrtätigkeit<br />
in Ökologie und Umweltlehre an Berufsschulen, Höheren Fachschulen, und Fachhochschulen<br />
sowie in der ausserschulischen Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.<br />
Sie befähigt, umweltspezifisches Wissen an ein breites Publikum zu vermitteln. Fachwissenschaftliche<br />
Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikats ist ein universitärer Master- oder<br />
Diplomabschluss in Umweltnaturwissenschaften oder eine gleichwertige Ausbildung. Die<br />
Ausbildung zum DZ umfasst 24 Kreditpunkte und ist zur Akkreditierung durch das BBT (Bundesamt<br />
für Berufsbildung und Technologie) eingereicht worden.<br />
Die Webseite www.didaktische-ausbildung.ethz.ch/ausbildung/dz gibt weitere Informationen.<br />
Lehrdiplom für Maturitätsschulen in Biologie oder Chemie oder Physik<br />
Mit einem Master in Umweltnaturwissenschaften ist es möglich, ein Lehrdiplom für Maturitätsschulen<br />
in Biologie oder Chemie oder Physik zu erwerben. Das Lehrdiplom bescheinigt<br />
den erfolgreichen Abschluss einer pädagogisch-didaktischen Ausbildung für die Lehrtätigkeit<br />
an Maturitätsschulen (Kurz- und Langzeitgymnasien). Der Ausbildungsumfang beträgt<br />
60 Kreditpunkte.<br />
Die Zulassung ist allerdings mit einer fachwissenschaftlichen Zusatzausbildung im Umfang<br />
von einem halben bis anderthalb Jahren (je nach Fach und individuellem Studienplan) verbunden.<br />
Die Auflagefächer können während der Masterausbildung als Wahlfächer belegt<br />
und geprüft werden.<br />
Unter www.didaktische-ausbildung.ethz.ch/ausbildung/lehrdipl sind genauere Informationen<br />
zu finden, insbesondere auch betreffend der Zusatzausbildung.<br />
34 35
9 Allgemeine Informationen<br />
9.1 Wissenswertes über das Departement<br />
Das Departement Umweltsystemwissenschaften (D-USYS) organisiert den Lehrbetrieb und<br />
die Prüfungen seiner Bachelor- und Masterstudiengänge, wacht über die Einhaltung der<br />
Reglemente und passt die Studiengänge an neue Entwicklungen und Erkenntnisse an. Das<br />
D-USYS bietet die beiden Studienrichtungen Umweltnaturwissenschaften und die Agrarwissenschaften<br />
(je mit einem Bachelor- und einem konsekutiven Masterstudiengang) an.<br />
An der Spitze des D-USYS steht der Departementsvorsteher. Er vertritt das D USYS nach aussen<br />
und präsidiert die Departementskonferenz als wichtigstes Beschluss fassendes Gremium.<br />
Diese Konferenz wird durch alle Professorinnen und Professoren des Departements, Vertreterinnen<br />
und Vertreter der Assistierenden, des technischen und administrativen Personals<br />
sowie der Studierenden gebildet. Die Departementskonferenz wählt Studiendelegierte, die<br />
für die Belange der Ausbildung verantwortlich sind.<br />
Alle Fragen des Unterrichts werden in den Unterrichtskommissionen behandelt. Dieses<br />
Gremium überprüft die Studiengänge laufend auf ihre Quaität, ist dafür besorgt, dass die<br />
Ausbildung stetig an neue Entwicklungen angepasst wird und ist auch Diskussionsort für die<br />
grösseren und kleineren Schwierigkeiten im täglichen Unterricht. In der Unterrichtskommission<br />
sind die Studierenden gleichgewichtig wie die Assistierenden und Dozierenden vertreten.<br />
Das grosse Gewicht der Studierenden drückt die Überzeugung aus, dass eine starke<br />
Mitverantwortung den Erfolg der Ausbildung verbessern hilft.<br />
Das Studiensekretariat ist die Anlaufstelle für die administrativen Fragen zum Studium.<br />
9.2 Aktuelle Informationen und Beratung<br />
Aktuelle Informationen zum Studienbetrieb<br />
Für allgemeine Informationen zum Studienbetrieb an der <strong>ETH</strong> Zürich und für die Studienplangestaltung<br />
werden auch folgende Informationsquellen empfohlen:<br />
· Akademischer Kalender: Unter www.ethz.ch/en/news-and-events/academic-calendar.html<br />
sind alle wichtigen Semester- und Prüfungsdaten zusammengestellt.<br />
· Vorlesungsverzeichnis: Unter www.vvz.ethz.ch kann ein laufend aktualisiertes Vorlesungsverzeichnis<br />
mit Informationen zu Inhalten und Zielen etc. aller an der <strong>ETH</strong> Zürich angebotenen<br />
Lehrveranstaltungen abgerufen werden.<br />
· Homepage des D-USYS: Verschiedene generelle Informationen zum Studium und Studienbetrieb<br />
u.a.m. werden unter www.usys.ethz.ch bekannt gegeben.<br />
· Anschlagbrett: Im D-Stock des CHN-Gebäudes ist ein Anschlagbrett mit verschiedenen<br />
Informationen.<br />
Auskünfte und Beratung in Studienfragen<br />
Folgende Kontaktstellen und Kontaktpersonen sind am für Auskünfte, Gesuche und spezifische<br />
Beratung zuständig:<br />
Studiendelegierter<br />
Spezielle Anliegen und Gesuche im Zusammenhang mit dem Studium,<br />
Abweichungen vom Studienreglement<br />
Prof. Dr. Jukka Jokela, Institut für Integrative Biologie, Eawag, BU G16,<br />
Ueberlandstrasse 133, CH-8600 Dübendorf, Tel: 058 765 51 71,<br />
E-Mail: jokela@env.ethz.ch<br />
Studienkoordinator<br />
Allgemeine Fragen im Zusammenhang mit dem Studium und Beruf,<br />
Anliegen für die Unterrichtskommission<br />
Dr. Peter Frischknecht, CHN H 45, 8092 Zürich, Tel: 044 632 36 47,<br />
E-Mail: frischknecht@env.ethz.ch<br />
Studiensekretariat<br />
Administrative Fragen zum Bachelorstudium, Verfügen von Leistungskontrollen,<br />
Ausstellen von Diplomanträgen, Dienstverschiebungsgesuche<br />
Herr Jörg Leuenberger, CHN H 50.5, 8092 Zürich, Tel: 044 632 53 75,<br />
E-Mail: joerg.leuenberger@env.ethz.ch<br />
Mobilitätsberatung<br />
Fragen im Zusammenhang mit Studiensemestern an einer anderen Hochschule<br />
Frau Dr. R. Steiner, CHN H 42.2, 8092 Zürich, Tel: 044 632 25 64,<br />
E-Mail: regula.steiner@env.ethz.ch<br />
36 37
Berater der Systemvertiefungen<br />
Sie geben Auskunft über die einzelnen Lehrgebiete und Fächer und beraten die Studierenden<br />
im Hinblick auf die Masterausbildung.<br />
Biogeochemie<br />
Prof. Dr. Ruben Kretzschmar, CHN F 29.2, 8092 Zürich, Tel: 044 633 60 03,<br />
E-Mail: ruben.kretzschmar@env.ethz.ch<br />
Atmosphäre<br />
Prof. Dr. Reto Knutti, CHN N 12.1, 8092 Zürich, Tel: 044 632 35 40,<br />
E-Mail: reto.knutti@env.ethz.ch<br />
Umweltbiologie<br />
Dr. Thomas Städler, CHN G 29, 8092 Zürich, Tel 044 632 74 29,<br />
E-Mail: thomas.staedler@env.ethz.ch<br />
Mensch-Umwelt Systeme<br />
Dr. Michael Stauffacher, CHN J 74.1, 8092 Zürich, Tel: 044 632 49 07,<br />
E-Mail: michael.stauffacher@env.ethz.ch<br />
Wald und Landschaft<br />
Prof. Dr. Harald Bugmann, CHN G 76.1, 8092 Zürich, Tel: 044 632 32 39,<br />
E-Mail: harald.bugmann@env.ethz.ch<br />
Fachberaterin sozial- und geisteswissenschaftliche Module<br />
Frau Prof. Dr. G. Hirsch, CHN H 73.2, 8092 Zürich, Tel: 044 632 58 93,<br />
E-Mail: gertrude.hirsch@env.ethz.ch<br />
Fachberater für die naturwissenschaftlichen und technischen Wahlfächer<br />
Dr. Christian Pohl, SOL F4, 8092 Zürich, Tel: 044 632 63 10,<br />
E-Mail: christian.pohl@env.ethz.ch<br />
38
Nachhaltigk<br />
Auskunft<br />
<strong>ETH</strong> Zürich<br />
Departement Umweltsystemwissenschaften (D-USYS)<br />
Studiensekretariat für Bachelorstudierende<br />
CHN H 50.5<br />
Universitätstrasse 8<br />
8092 Zürich<br />
joerg.leuenberger@usys.ethz.ch<br />
Phone +41 44 632 53 75<br />
www.usys.ethz.ch<br />
Beratungen nach Vereinbarung (per e-mail)<br />
Um


![Wegleitung [PDF] - ETH - ETH Zürich](https://img.yumpu.com/32408940/1/500x640/wegleitung-pdf-eth-eth-za-1-4-rich.jpg)