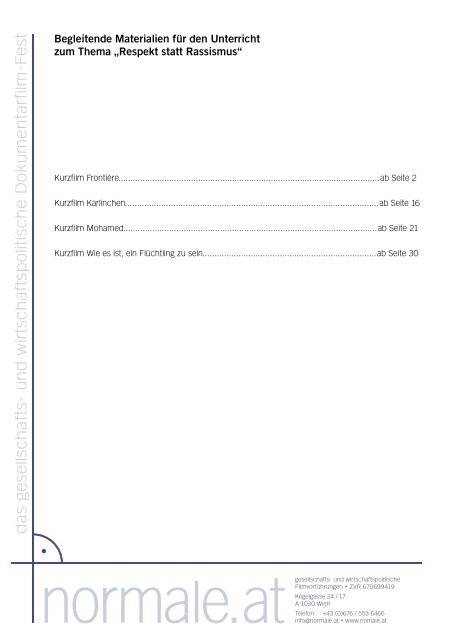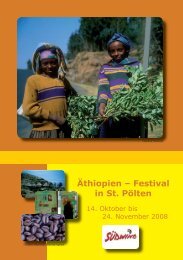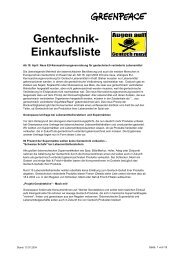Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Begleitende Materialien für den Unterricht<br />
zum Thema „Respekt statt Rassismus“<br />
Kurzfilm <strong>Frontière</strong>............................................................................................................ab Seite 2<br />
Kurzfilm Karlinchen.........................................................................................................ab Seite 16<br />
Kurzfilm Mohamed.........................................................................................................ab Seite 21<br />
Kurzfilm Wie es ist, ein Flüchtling zu sein........................................................................ab Seite 30<br />
normale.at<br />
gesellschafts- und wirtschaftspolitische<br />
<strong>Film</strong>vorführungen • ZVR 670699419<br />
Kegelgasse 24 / 17<br />
A-1030 Wien<br />
Telefon: +43 (0)676 / 553 6466<br />
info@normale.at • www.nomale.at
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
<strong>Film</strong> 1<br />
<strong>Frontière</strong><br />
Animationsfilm Plastilin-Technik<br />
Regie und Animation Christian Fischer<br />
Produktion <strong>Film</strong>akademie Baden-Württemberg,<br />
Deutschland 1997<br />
Sprache ohne Worte<br />
<strong>Film</strong>länge 5 Minuten<br />
Musik Jesse Milliner<br />
Geeignet ab 7 Jahren<br />
Auszeichnungen Internationales Animationsfilmfestival<br />
Annecy, Frankreich. Video-<strong>Film</strong>tage Koblenz<br />
D: bester Studentenfilm. Hans W. Geissendörfer-Nachwuchspreis<br />
Zum Regisseur<br />
Christian Fischer wurde in Deutschland<br />
geboren und erhielt seine Ausbildung zum<br />
<strong>Film</strong>emacher an der <strong>Film</strong>akademie Ludwigsburg.<br />
«<strong>Frontière</strong>» ist sein erster <strong>Film</strong>,<br />
den er noch während seiner Studienzeit<br />
realisiert hat.<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong> Seite 1 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
Der Regisseur zu seinem <strong>Film</strong><br />
«Dieser <strong>Film</strong> ist 1997 im Rahmen meines Studiums an der <strong>Film</strong>akademie<br />
Baden Württemberg entstanden.<br />
Die Umsetzung erfolgte damals mit meiner ehemaligen Lebensgefährtin<br />
Maud Gravereaux, einer Französin, die zu diesem Zeitpunkt an der<br />
ENSAD (Kunsthochschule) in Paris studierte. Mit minimalen Mitteln und<br />
einem kleinen Budget von ca. 1000 DM setzten wir den <strong>Film</strong> in ca. 4<br />
Monaten um. Drehort war ein improvisiertes Studio auf dem Dachboden<br />
einer WG. Es war für uns Pionierarbeit, in der wir uns der Animationstechnik<br />
naiv näherten und gegen Ende unsere eigenen Methoden<br />
entwickelt hatten. Wenig Schlaf und eine Art von Besessenheit begleiteten<br />
uns.<br />
Nachdem die Idee in einer einzigen Nacht in meinem Kopf geboren war<br />
... ohne analytische intellektuelle Erwägungen ... sehr spielerisch ...<br />
durch den Gedanken: Was passiert, wenn zwei Figuren zwar endlos<br />
Platz haben - sich aber nicht aus dem Weg gehen wollen? Dann folgte<br />
ein Gedanke dem anderen, ohne viel Kopfzerbrechen - sehr intuitiv ...<br />
wie gesagt, in einer Nacht war diese kleine Geschichte geboren.<br />
Es folgten zahlreiche Interpretationen, doch der Beginn war rein spielerisch<br />
- vielleicht getrieben auch von der Wut gegenüber Intoleranz und<br />
Egoismus ... der uns in die Sackgasse und in die Einsamkeit führt.»<br />
Christian Fischer<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong> Seite 2 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
Inhalt<br />
<strong>Frontière</strong><br />
Zwei Figuren (aus Knetmasse) begegnen sich in einer kargen Landschaft,<br />
unter blauem Himmel bei gleissendem Sonnenlicht. Sie sind als<br />
Menschen zu erkennen, haben aber kein Geschlecht und keinen Mund.<br />
Eine der beiden ist heller als die andere.<br />
Die Figuren sind erstaunt, sich zu begegnen und wirken etwas ratlos.<br />
Dann beginnt die eine der anderen mit Handzeichen klarzumachen,<br />
dass diese auf die Seite treten solle. Die andere weigert sich. Es kommt<br />
zu Handgreiflichkeiten. Beide fallen rückwärts auf den Boden. Darauf<br />
ergreift eine Figur einen herumliegenden Backstein und errichtet blitzschnell<br />
eine kleine Mauer zwischen sich und die andere Figur.<br />
Diese beginnt nun ihrerseits eine Mauer zu bauen. Die erste Figur ist<br />
zuerst erstaunt, treibt dann aber den eigenen Mauerbau umso heftiger<br />
voran. So kommt es zu einem Wettlauf. Beide bauen in rasendem Tempo<br />
eine Mauer, die immer höher und unübersichtlicher wird. Die zwei<br />
Mauern werden zu einem unübersichtlichen Labyrinth, aus dem es<br />
kein Entrinnen mehr gibt. Die erste Figur erkennt diese Situation, hastet<br />
los und sucht einen Ausgang – vergeblich. Darauf ruft sie in ihrer Verzweiflung<br />
ein «Hallo», das aber unbeantwortet verhallt.<br />
Am Schluss sind beide Figuren von oben in einer stummen Schattenwelt<br />
sichtbar, erschöpft - ohne es zu wissen - Rücken an Rücken sitzend,<br />
durch die Mauern getrennt. Der Blickwinkel weitet sich, und<br />
schliesslich zeigt sich eine Erdkugel, deren Oberfläche aus einem<br />
einzigen Labyrinth besteht.<br />
«Allgemeine Erklärung der Menschenrechte»<br />
Zur Diskussion im Zusammenhang mit dem <strong>Film</strong><br />
Artikel 1<br />
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit<br />
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie<br />
sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der<br />
Brüderlichkeit begegnen.<br />
Artikel 13<br />
Freizügigkeit<br />
und Auswanderungsfreiheit<br />
1. Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und freie Wahl seines<br />
Wohnsitzes innerhalb eines Staates.<br />
2. Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschliesslich seines eigenen,<br />
zu verlassen sowie in sein Land zurückzukehren.<br />
Artikel 17<br />
Gewährleistung des Eigentums<br />
1. Jeder Mensch hat allein oder in Gemeinschaft mit anderen das Recht auf<br />
Eigentum.<br />
2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong> Seite 3 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
Didaktische Umsetzung<br />
Zeitaufwand<br />
A) Primarstufe (ab 2. Schuljahr) mindestens<br />
3 Lektionen (auf 2 Tage verteilt)<br />
B) Sekundarstufe mindestens 2 Lektionen<br />
A) Primarstufe<br />
1. Vorbemerkungen<br />
„<strong>Frontière</strong>“ ist (auch) für SchülerInnen<br />
der Primarstufe reizvoll und auf vielseitige<br />
Weise einsetzbar. Der <strong>Film</strong> ist kurz,<br />
doch es ist wichtig, dass die Kinder den<br />
Verlauf der „Geschichte“ klar erfassen,<br />
be-vor etwas tiefer in die Aussage eingedrungen<br />
wird. Es ist deshalb dienlich,<br />
den <strong>Film</strong> zu Beginn gleich zweimal anzusehen.<br />
Der (spielerische) Auftrag bleibt ganz<br />
nahe am Thema Grenzen bzw. Mauern:<br />
es geht um Mauern, die wir selber errichten<br />
und die uns oft mehr schaden als<br />
nützen. Das Übertragen der realsichtbaren<br />
Mauer ins Symbolhaft-<br />
Metaphorische (Mauern in unserem<br />
Kopf, in unserem Herzen, in unserer Seele)<br />
wird die eigentliche Herausforderung<br />
der Arbeit sein.<br />
Mit relativ geringem Aufwand (Digitalkamera;<br />
Duplo- oder Lego-Steine zur<br />
Simulation des Mauer-baus) kann die<br />
Lehrkraft schliesslich die Art und Weise<br />
einer Animationsfilm-Produktion vorführen<br />
und von seinen Schülernnen und<br />
Schülern sogar einen Minifilm drehen<br />
lassen (s. cineastische Hinweise).<br />
2. Lernziele<br />
• Beim Betrachten des <strong>Film</strong>s einige<br />
Elemente seiner Bildsprache erkennen<br />
und benennen.<br />
• Die Zeichensprache des <strong>Film</strong>s interpretieren<br />
und Kernaussagen erkennen.<br />
• Sich mit Kernaussagen des <strong>Film</strong>s (z.B.<br />
Rassismus, Angst vor dem Fremden)<br />
auseinandersetzen; sich eine persönliche<br />
Meinung bilden und diese vertreten.<br />
3. Unterrichtsvorschläge<br />
3.1. Den <strong>Film</strong> verstehen<br />
Die Lehrkraft schaut den <strong>Film</strong> mit ihren SchülerInnen an. Anschliessend<br />
lässt sie erste Eindrücke formulieren.<br />
Dann teilt sie die Klasse in Gruppen ein. Jede Gruppe erhält 15 Streifen<br />
mit jeweils einem Satz zum Inhalt der Geschichte (s. «Arbeitsblatt Primarstufe»,<br />
weiter hinten).<br />
Richtig zusammengesetzt ergibt sich eine korrekte inhaltliche Zusammenfassung,<br />
die dann vorgelesen oder in ein Heft eingeklebt bzw. -<br />
geschrieben werden kann.<br />
3.2. Mauern in Wirklichkeit - Mauern in den Köpfen<br />
Es werden vier Bilder von Mauern aus dem Alltag gezeigt, die von<br />
der Lehrkraft besorgt werden. (z.B. Gartenmauer, Lärmschutzmauer,<br />
Gefängnismauer, See- oder Flussufermauer, Balkonmauer ...). Sie fragt<br />
die SchülerInnen, um was für Mauern es sich dabei handelt und notiert<br />
die Vorschläge an die Wandtafel, neben die aufgehängten Bilder.<br />
Im Gespräch geht es darum, dass die Kinder erkennen , wozu diese<br />
Mauern dienen, wen oder wovor sie schützen, wen oder was sie<br />
abhalten sollen.<br />
Danach wird die Klasse in (2er-, 3er- oder 4er-) Gruppen eingeteilt.<br />
Jede Gruppe erhält den Auftrag, zu einer vorgegebenen Situation<br />
ein kleines Rollenspiel vorzubereiten. Es geht dabei durchwegs um<br />
unsichtbare Mauern, um Mauern in unseren Köpfen und Herzen.<br />
Vorschläge für Spielaufträge<br />
• Fremdsprache als «Mauer»: Ihr seid in einem fremden Land und<br />
braucht dringend Hilfe, weil euer Auto kaputt ist. Ihr trefft zwei einheimische<br />
Passanten und versucht ihnen zu erklären, was passiert ist.<br />
Diese aber verstehen euch nicht …<br />
• «Mauer» der Ablehnung: Jemand lädt zu einem Geburtstagsfest ein.<br />
Alle freuen sich. Einer, den man nicht mag, aber auch dabei sein<br />
möchte, soll ausgeschlossen werden. Das will man ihm aber nicht direkt<br />
sagen, doch er spürt so etwas wie eine Mauer zwischen ihm und<br />
den anderen.<br />
• «Mauer» der Angst: Kinder verabreden sich, um zu einer Kollegin<br />
zugehen. Auf dem Weg aber müssten sie vor einem Haus vorbei, von<br />
dem unheimliche Geschichten erzählt werden. Obwohl der Weg kürzer<br />
wäre, machen sie einen grossen Bogen darum herum.<br />
• «Mauer» des Schweigens: Die Lehrerin fragt, wer in der Toilette ein<br />
Schulheft eines Kameraden versenkt hat. Sie verdächtigt drei Kinder<br />
und gibt ihnen 5 Minuten Zeit, es zu melden, und geht hinaus. Die<br />
Kinder diskutieren miteinander, entscheiden dann aber nichts zu sagen.<br />
Die Lehrerin versucht, sie zum Reden zu bringen, doch sie bleiben<br />
stumm.<br />
• «Mauer» der Gefahr: Drei Kinder rennen drauflos. Doch plötzlich<br />
bremsen sie blitzartig: Haaalt!» (wegen einer gefährlichen Strasse, einem<br />
Abhang, einem Stacheldraht ...).<br />
Die Lehrkraft versucht mit den Kindern, jeweils direkt nach der<br />
Vorführung, das Thema, bzw. den Begriff «Angst», «sich schämen»,<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong> Seite 4 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
«Feigheit» usw. im Klassengespräch zu<br />
erarbeiten. An der Wandtafel stehen<br />
zwei vorbereitete Backsteinvorlagen aus<br />
Papier, auf welche sie je einen Begriff<br />
schreibt.<br />
Die Lehrkraft sucht nun mit den<br />
Kindern weitere Beispiele / Situationen,<br />
wo sichtbare oder unsichtbare Mauern<br />
zwischen den Menschen entstehen bzw.<br />
schon existieren: Wie entstehen oder<br />
entstanden sie? Was für (Aus-<br />
)Wirkungen haben sie für mich, für uns,<br />
für andere? Nützliche Mauern? Schädliche<br />
Mauern?(Schutz, Sicherheit, Ruhe,<br />
aber auch Einsamkeit, Isolation, Langeweile,<br />
Ablehnung u.a.m.)<br />
3.3. Mauerbau<br />
Um den Kindern den Transfer von real<br />
existierenden Mauern zu den Mauern in<br />
den Köpfen zu erleichtern, lassen wir sie<br />
eine virtuelle Mauer erstellen.<br />
Hierfür zwei Möglichkeiten:<br />
Gruppenarbeit: Als Arbeitsmaterial<br />
erhalten alle Gruppen einige Blätter<br />
(dickeres Zeichnungspapier, A4 oder A5)<br />
als «Backsteine». Die SchülerInnen werden<br />
aufgefordert, Aussagen, Gefühle und<br />
Tätigkeiten in Stichworten zu notieren,<br />
welche dazu beitragen können, eine<br />
Mauer zu bauen. Jede Gruppe wählt nun<br />
aus ihrer Sammlung 5 bis 8 Aussagen aus<br />
und schreibt jede einzeln auf einen<br />
«Backstein».Die «Backsteine» werden<br />
anschliessend an eine Wand geheftet<br />
und bilden allmählich eine immer grösser<br />
werdende Mauer.<br />
Gleiche Idee, aufwändiger, doch eindrucksvoller: Schuhschachteln<br />
als Backsteine, oder sogar richtige Backsteine benützen und diese<br />
im Schulhaus aufbauen.<br />
Eventuell kleine Einladung für Eltern oder andere Klassen im Schulhaus,<br />
verbunden mit einer Präsentation der Mauer und einer Projektion<br />
des <strong>Film</strong>s.<br />
Mögliche Stichworte / Situationen<br />
• Angst vor einer schlechten Note<br />
• Jemanden plagen<br />
• Auslachen<br />
• Nicht an ein Geburtstagsfest gehen<br />
• Schlagen<br />
• Lügen<br />
• Grenzen ziehen<br />
Wichtig: Mauern können aufgebaut, aber auch wieder abgebrochen<br />
werden! Daraus könnte ein Quartalsprojekt entstehen: Die Kinder<br />
schreiben zu jedem «Backstein» eine Geschichte, oder sie improvisieren<br />
ein kleines Rollenspiel, das zeigt, wie schädliche, unsinnige Mauern<br />
«aufgeweicht» oder gar ganz entfernt werden könnten. Sind diese<br />
Lösungsansätze für die Klasse überzeugend, darf der entsprechende<br />
Backstein aus der Mauer herausgebrochen werden.<br />
Reizvoll könnte in diesem Zusammenhang auch das Vorspielen eines<br />
Auszugs des legendären Pink Floyd-Stücks «The Wall» sein. Vor allem<br />
für Kinder, die in der Schule schon etwas Englisch gelernt haben, wäre<br />
dieses Stück, (übersetzt) eine zusätzliche Inspirationsquelle.<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong> Seite 5 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
B) Sekundarstufe<br />
1. Vorbemerkungen<br />
Der <strong>Film</strong> «Frontiere» - eine klassische<br />
Parabel - erzählt eine gradlinige Geschichte<br />
mit einer einfachen Bildsprache.<br />
Viele <strong>Film</strong>sequenzen, lassen sich direkt<br />
interpretieren und zu konkreten Aussagen<br />
verdichten. Deshalb eignet sich der<br />
<strong>Film</strong>, um u.a. mit den Schülern und Schülerinnen<br />
eine Interpretationskette aufzubauen<br />
(Arbeitsblatt Sekundarstufe).<br />
2. Lernziele<br />
• Beim Betrachten des <strong>Film</strong>s einige<br />
Elemente seiner Bildsprache erkennen<br />
und benennen.<br />
• Die Zeichensprache des <strong>Film</strong>s interpretieren<br />
und Kernaussagen erkennen.<br />
• Sich mit Kernaussagen des <strong>Film</strong>s (z.B.<br />
Rassismus, Angst vor dem Fremden)<br />
auseinandersetzen, eine persönliche<br />
Meinung bilden und diese vertreten.<br />
3. Unterrichtsvorschläge<br />
3.1 Bildsprache erkennen, Interpretationen finden<br />
Den <strong>Film</strong> gemeinsam anschauen (eventuell zwei Vorführungen).<br />
Im Rahmen eines Klassengesprächs werden die Beobachtungen der<br />
SchülerInnen protokolliert (Wandtafel-Protokoll) - Beispiel einer Beobachtung:<br />
«Die haben ja gar keinen Mund».<br />
Die SchülerInnen interpretieren ihre Beobachtungen. So versuchen<br />
sie herausfinden, weshalb der Regisseur den beiden Figuren<br />
keinen Mund gegeben hat. Auch diese Vermutungen werden stichwortartig<br />
festgehalten.<br />
Danach erhalten die SchülerInnen das Arbeitsblatt (Sekundarstufe),<br />
das sie selbstständig bearbeiten (ankreuzen).<br />
Eine Auswertung der ausgefüllten Arbeitsblätter findet im Rahmen<br />
eines Klassengesprächs statt – beispielsweise durch das Übertragen<br />
der individuellen Kreuze auf eine Folie oder auf eine A3-Version des<br />
Arbeitblattes: Wo gibt es grosse Übereinstimmungen, wo nicht? Mögliche<br />
Gründe eruieren.<br />
3.2 Aussagen überprüfen, Meinungen bilden,<br />
Meinungen vertreten<br />
Die vier Meinungen (Kopiervorlage 1 / Sekundarstufe) werden -<br />
verteilt auf die vier Ecken des Unterrichtsraums - aufgehängt (möglichst<br />
als A3-Affichen).<br />
Die SchülerInnen bewegen sich im Raum, lesen die Thesen und<br />
prüfen, inwiefern diese mit ihrer Meinung übereinstimmen. Anschliessend<br />
entscheiden sie sich für eine der Thesen und stellen sich in die<br />
entsprechende Ecke.<br />
In jeder Ecke begründen die SchülerInnen, warum sie sich dahin<br />
gestellt haben. Sie bereiten sich gleichzeitig auf den nächsten Schritt<br />
vor, indem sie gemeinsam nach den besten Argumenten zur Vertretung<br />
«ihrer» These suchen.<br />
In der Mitte des Raums bilden sechs Stühle einen Kreis. Die SchülerInnen<br />
schicken je einen Vertreter respektive eine Vertreterin in<br />
diese Runde. Ein Platz ist für die Lehrkraft reserviert, welche die Gesprächsleitung<br />
übernimmt. Ein weiterer Stuhl ermöglicht es SchülerInnen<br />
aus dem Plenum, sich in die Runde zu begeben und in die Diskussion<br />
einzugreifen. Konsens ist nicht angestrebt, wohl aber aktives<br />
Zuhören und Eingehen auf die Argumente der anderen. Die Lehrkraft<br />
beendet die Diskussion im geeigneten Moment.<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong> Seite 6 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
4. Vorschlag zu einem Klassenprojekt bzw.<br />
einer selbständigen SchülerInnen-Arbeit<br />
4.1. Vorbemerkungen<br />
«<strong>Frontière</strong>» ist ein Animationsfilm, der zur eingehender thematischer<br />
Beschäftigung «animiert» - z.B. zur Vertiefung der Kernaussagen in<br />
einer individuellen, selbstständigen Arbeit oder in einem gemeinsamen<br />
Klassenprojekt. Themenvorschlag: «Mauern und Grenzen»<br />
4.2. Lernziele<br />
• «Mauerporträts» selbständig erstellen, und dabei Aufschlüsse bezüglich<br />
Sinn und Zweck der betreffenden Mauer gewinnen - Überlegungen<br />
zu «Aufwand und Ertrag» dieses Mauerbaus anstellen.<br />
• Recherchen über «Mauern und Grenzen» vornehmen, und zum<br />
Thema ein Plakat gestalten.<br />
• Eine «Mauern und Grenzen»-Ausstellung als Klassenprojekt in einer<br />
Gemeinschaftsarbeit realisieren, die den Schülern und Schülerinnen,<br />
später auch Ausstellungsbesuchern und -besucherinnen, einen<br />
differenzierten und vielseitigen Zugang zum Thema ermöglicht.<br />
4.3. Auftrag<br />
• Bildet 2-er Gruppen.<br />
• Sucht eine Mauer*, die euch interessiert; es kann sich um eine Mauer<br />
in eurer Umgebung handeln, aber auch um eine Mauer, die irgendwo<br />
in der Welt steht oder gestanden hat.*<br />
• Gestaltet und/oder sucht Bilder von dieser Mauer.<br />
• Verfasst ein Porträt der Mauer. Das Porträt umfasst:<br />
a. eine kurze Geschichte zur Entstehung dieser Mauer (höchstens 10<br />
Zeilen)<br />
b. Angaben über die Bauzeit<br />
c. Angaben über Höhe, Länge und Kosten<br />
d. Sinn und Zweck der Mauer<br />
e. Schicksal der Mauer<br />
f. eigene und fremde Ansichten über diese Mauer.<br />
• Präsentation:<br />
a. Ein selbst gestaltetes A2-Plakat (Schriftart «Arial»,<br />
Schriftgrösse 14 Punkt, Schriftgrösse der Überschriften nach eigenem<br />
Ermessen)<br />
b. Bildgrösse: zirka 20 x 15 cm<br />
c. Titel: über dem Bild (zentriert)<br />
d. Legende: unter dem Bild<br />
* Es können historische Monumente (Chinesische Mauer, israelischer Schutzwall<br />
usw.), einfache Mauern aus der Nachbarschaft (Beispiel: Gartenzaun von Herrn<br />
Meyer) oder unsichtbare Mauern (Beispiel: «grüne Grenzen», «Röstigraben») gewählt<br />
werden. Wichtig ist einfach das Element der Abgrenzung.<br />
Kopiervorlage 2 Sekundarstufe / Gruppenarbeit (Muster für ein Plakat)<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong> Seite 7 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
<strong>Film</strong>kundliche Aspekte<br />
Animationsfilm<br />
«<strong>Frontière</strong>» ist ein «klassischer» Animationsfilm, gestaltet<br />
mit Knetfiguren aus Plastilin. Wir kennen diese Tricktechnik<br />
z.B. von den «Wallace and Gromit»- <strong>Film</strong>en aus<br />
den englischen Aardman-Studios («Chicken Run», «The<br />
Wrong Trousers» u.a.)<br />
Im Gegensatz zu den Live- oder Realfilmen zeigt der<br />
Animationsfilm nicht die Bewegung bewegter Menschen,<br />
Tiere oder Gegenstände, sondern er erweckt bloss die<br />
Illusion von Bewegung. Technisch geschieht dies durch<br />
die Einzelbildschaltung der Kamera. So wird Bild um Bild<br />
aufgenommen, und der Gegenstand nach jeder Aufnahme<br />
leicht verändert oder bewegt.<br />
Die Projektion bringt dann die Bilder wieder zum Laufen;<br />
es damit entsteht der Eindruck der Bewegung. In einer<br />
Sekunde zeichnen 24 Bilder den Bewegungsablauf auf -<br />
im <strong>Film</strong> «<strong>Frontière</strong>» mit einer Länge von 5 Minuten (300<br />
Sekunden) sind es also 7200 Einzelbilder.<br />
Mit der Videokamera lassen sich solche Animationssequenzen<br />
durch Aufnahmen in Einzelbildschaltung verschiedenster<br />
Materialien (Spielzeug, Zeitungsschnipsel,<br />
Lego-Steine usw.) lustvoll erproben!<br />
Besondere Gestaltungselemente<br />
Wenn eine Bewegung beschleunigt stattfinden soll,<br />
geschieht das im Animationsfilm dank Zeitraffer-<br />
Effekten: Die Aufnahme erfolgt mit einer niedrigeren<br />
Bildzahl pro Sekunde als die Projektion. Dies lässt uns<br />
den Bau der Mauern in atemlosem Tempo erleben (im<br />
Gegensatz dazu würde eine Aufnahmenfolge in Zeitlupe,<br />
d.h. mit mehr als 24 Bildern pro Sekunde, den Anschein<br />
einer stark verlangsamten Bewegung hervorrufen).<br />
Wichtige Gestaltungselemente im Real wie im Animationsfilm<br />
sind die Perspektive (Standort der Kamea/Blickwinkel),<br />
die Einstellungsgrösse und die Kamerabewegung.<br />
Wenn das Objektiv der Kamera den Gegenstand<br />
von oben herab erfasst, erscheint der Mensch<br />
(die Figur) dadurch in der Projektion der Aufnahmen<br />
klein, verloren, unbedeutend und von Gefahren bedroht.<br />
In der Perspektive von unten entsteht dagegen der<br />
Eindruck von Beherrschung, Macht und Einfluss.<br />
Ohne Gesamtansichten des Blickfeldes können wir uns<br />
im szenischen Raum nicht orientieren. Dieser Überblick<br />
fehlt den beiden Figuren im <strong>Film</strong> und uns Zuschauern/ZuschauerInnen<br />
gleichermassen: Die Kamera erfasst<br />
mit Gross- und Nahaufnahmen bloss einen Teil des<br />
Umfeldes. Dadurch wird bewusst zuerst ein sehr einge<br />
engtes Blickfeld präsentiert und das Mienenspiel der<br />
beiden Figuren fokussiert, was deren innere Regungen<br />
und Gefühle erahnen lässt.<br />
Rückt die Kamera noch näher an die Figuren heran,<br />
ergibt das Closeup- Einstellungen. Hierbei geht es nicht<br />
um eine vergrösserte Darstellung des Objektes, sondern<br />
vielmehr um das Verdeutlichen eines seelischen Vorgangs<br />
der Figur.<br />
Am <strong>Film</strong>ende erscheint der Ort des Geschehens durch<br />
Aufnahmen mittels Zoom (Kameraobjektiv mit veränderlicher<br />
Brennweite) immer entfernter, er rückt in den<br />
Hintergrund. Schliesslich wird uns durch die Totale<br />
(filmische Gesamtansicht) bewusst, wie unwichtig und<br />
eigentlich lächerlich die mitverfolgte Eskalation einer<br />
Auseinandersetzung ist. Erst Angesichts der Grösse des<br />
Raumes können wir uns orientieren: Das weit geöffnete<br />
Blickfeld lässt uns andere Möglichkeiten der Konfliktlösung<br />
suchen.<br />
Die entsprechenden <strong>Film</strong> stills finden sich im Video-Teil<br />
oder auch auf der Website.<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong> Seite 8 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
Arbeitsblatt 1 (Primarstufe)<br />
15 Sätze<br />
Hinweis für die Lehrkraft: Das Blatt auf A3-Format vergrössern, Sätze in Streifen schneiden, die einzelnen „Pakete“<br />
mischen und mit Büroklammer zusammenheften.<br />
Zwei Figuren begegnen sich in der Wüste.<br />
Eine Figur ist hell, die andere dunkel und beide haben keinen Mund.<br />
Die helle Figur gibt ein Handzeichen und sagt damit, dass die andere Figur beiseite treten soll.<br />
Die andere Figur geht nicht auf die Seite.<br />
Es kommt zu einem Krach.<br />
Die beiden Figuren stossen sich gegenseitig.<br />
Dann fängt die eine Figur an, mit Backsteinen eine kleine Mauer zu bauen.<br />
Die andere Figur baut auch eine Mauer.<br />
Die erste Figur baut jetzt die Mauer weiter.<br />
Auch die zweite Figur baut ihre Mauer weiter.<br />
Die Mauern werden immer schneller und höher gebaut.<br />
Schliesslich entsteht ein richtiges Labyrinth.<br />
Plötzlich merken die Figuren, dass sie sich selber eingeschlossen haben.<br />
Die eine Figur ruft noch laut „Hallo“.<br />
Am Schluss sieht man, dass die Mauer über die ganze Erdkugel gebaut wurde.<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong>
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
Arbeitsblatt 2 (Sekundarstufe)<br />
Interpretationskette<br />
Auftrag: Kreuze an, was du als richtig erachtest<br />
� 1= Ist mir aufgefallen 2= Ist mir nicht aufgefallen 3= Das sehe ich auch so 4= Das sehe ich nicht so<br />
Bildsprache<br />
Die erste Kameraeinstellung zeigt<br />
den Blickwinkel und die Sicht der<br />
einen Figur<br />
Die eine Figur ist dunkler als die<br />
andere.<br />
Die Figuren haben keinen Mund.<br />
Die Figuren weichen sich nicht<br />
aus, obwohl sie eigentlich viel<br />
Platz hätten.<br />
Ein Bild aus der Vogelperspektive<br />
zeigt, wie sich die beiden<br />
Figuren im Kreis drehen.<br />
Der Bau der Mauer bringt den<br />
weiten Horizont zum Verschwinden.<br />
Die von den Mauern geworfenen<br />
Schatten werden immer länger.<br />
Die Kameraeinstellung wechselt<br />
in die Totale: Zu sehen sind die<br />
beiden Figuren, Rücken an Rücken<br />
sitzend, getrennt durch die<br />
Mauer.<br />
Die Kamera „steigt“ und „steigt“:<br />
Die Erde erscheint als Kugel,<br />
deren Oberfläche sich zu einem<br />
einzigen Labyrinth entwickelt.<br />
Das Bild ist bereits schwarz, als<br />
noch einmal ein sehnsüchtiges<br />
„Hallo“ zu hören ist.<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong><br />
1 2<br />
... und was will der <strong>Film</strong>emacher<br />
damit ausdrücken<br />
Die Figur schaut nur auf ihren Weg<br />
und wird von der Begegnung mit<br />
der anderen Figur überrascht.<br />
Dunkel steht für das Fremde, das<br />
Unbekannte.<br />
Die Figuren bleiben sprachlos, sie<br />
können sich nicht verständigen.<br />
Wer immer nur sich selbst sieht,<br />
der verliert mit der Zeit die Fähigkeit,<br />
mit anderen in Kontakt zu<br />
treten und sich auszudrücken.<br />
Wer nur sich selbst sieht, dem fehlt<br />
der Blick für das Ganze.<br />
Wenn beide Figuren stur bleiben<br />
und keinen Kompromiss eingehen,<br />
dreht sich alles im Kreis: Es gibt<br />
keine Lösungen.<br />
Das Denken ist eng. Es lässt keine<br />
anderen Lösungswege mehr zu,<br />
und es kommt zur Konfrontation.<br />
Die Auseinandersetzung bedroht<br />
zunehmend beide Figuren in ihrer<br />
Existenz.<br />
Die Konfrontation führt zu Isolation<br />
und Einsamkeit.<br />
Die beiden Figuren haben sich<br />
selber ihre Gräber geschaufelt und<br />
werden daran zugrunde gehen.<br />
Die Menschheit igelt sich ein, anstatt<br />
gemeinsam nach Problemen<br />
zu suchen und diese zu lösen.<br />
Mauern schützen nicht: Sie isolieren<br />
und führen in den Abgrund.<br />
Geredet wird oft erst, wenn es zu<br />
spät ist.<br />
In der Not findet der Mensch seine<br />
Sprache.<br />
3 4<br />
Meine Deutung<br />
(freiwillig)
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
Kopiervorlage 2 (Sekundarstufe / Gruppenarbeit «Muster für ein Plakat»)<br />
Die Berliner Mauer<br />
Schandmal oder Kriegsverhinderung?<br />
1. Entstehung, Sinn und Zweck<br />
Die Berliner Mauer wurde 1963 durch die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) quer durch die<br />
Stadt Berlin gebaut. Offiziell sollte sie die «sozialistische» DDR vor Übergriffen aus dem «kapitalistischen» Westen<br />
schützen. In Wirklichkeit wollte die ostdeutsche Regierung verhindern, dass sich DDR-BürgerInnen in die reichere<br />
Bundesrepublik Deutschland (BRD) absetzen konnten.<br />
2. Technische Angaben<br />
Die Mauer war ungefähr 30 Kilometer lang, drei Meter hoch und einen Meter dick. Dahinter gab es ein so genanntes<br />
Niemandsland. Stacheldraht, Wachtürme, Selbstschussanlagen und Minen versperrten den Fluchtwilligen den Weg in<br />
die BRD. Der Mauerbau kostete etwa 100 Millionen Franken, was damals für die DDR ein immenser Betrag und Aufwand<br />
war.<br />
3. Bauzeit<br />
Die Mauer wurde als Rohbau in einer Rekordzeit von drei Monaten erstellt, danach aber laufend verbessert und erweitert.<br />
4. Schicksal der Mauer<br />
Zwischen 1963 und 1989 verloren mindestens 220 Menschen ihr Leben, als sie versuchten, die Mauer zu überwinden.<br />
Am 9. November 1989 erstürmten die DDR-BürgerInnen in einer friedlichen Revolution die Mauer. Diese wurde grösstenteils<br />
abgerissen. Der Mauerfall war der Auftakt zur deutschen Wiedervereinigung, welche bereits am 3. Oktober<br />
1990 besiegelt wurde.<br />
5. Ansichten<br />
Im Westen galt die Mauer als Schande und Symbol der kommunistischen Tyrannei, im Osten feierten sie die Kommunisten<br />
als Mittel zur Verhinderung eines Krieges. Die Bevölkerung der DDR verabscheute sie.<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong>
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
<strong>Film</strong> 1<br />
<strong>Frontière</strong><br />
Aufgaben:<br />
1. Bringe die Bilder in die richtige Reihenfolge!<br />
2. Erzähle die ganze Geschichte und stelle die Fotos in einen Zusammenhang, indem du beschreibst,<br />
was jeweils unmittelbar vor und unmittelbar nach dem Moment der Foto geschieht.<br />
3. Wie sieht das Anfangs-, wie das Schlussbild des <strong>Film</strong>s aus? Skizziere!<br />
Zeichne ein anderes mögliches Schlussbild!<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong>
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
Kopiervorlage 1 (Sekundarstufe)<br />
MEINUNG 1:<br />
Für mich ist die Kernaussage des <strong>Film</strong>s, ...<br />
... dass Grenzen und Mauern keine Lösungen für die Probleme der<br />
Menschheit (der Figuren) sind.Wir müssen Grenzen und Mauern ab-<br />
bauen: in unserer Gemeinde, in unserem Land, auf der Welt. Wir müssen<br />
lernen, miteinander zu leben, ob es uns gefällt oder nicht.<br />
MEINUNG 2:<br />
Für mich ist die Kernaussage des <strong>Film</strong>s, ...<br />
... dass die beiden Menschen (Figuren) sprachlos bleiben.Weil sie nicht<br />
miteinander reden (können, wollen?), beginnen sie sich zu bekämpfen<br />
und anschliessend Mauern zu bauen. Wir müssen lernen miteinander<br />
zu reden, dann werden auch die Mauern überflüssig.<br />
MEINUNG 3:<br />
Für mich ist die Kernaussage des <strong>Film</strong>s, ...<br />
... dass der Egoismus den Menschen (die Figuren) in den Untergang<br />
führt:Wenn man immer nur sich selbst sieht, geht der Blick für andere<br />
Probleme verloren. Und wenn man sich dann mit diesen konfrontiert<br />
sieht, beginnt man Mauern zu bauen. Wir müssen lernen, auch die<br />
Probleme der anderen zu sehen.<br />
MEINUNG 4:<br />
Keine der vorgeschlagenen Kernaussagen entspricht mir. Meiner Meinung<br />
ist die Aussage des <strong>Film</strong>s falsch, denn<br />
.....................................................................................................................................................<br />
.....................................................................................................................................................<br />
.....................................................................................................................................................<br />
.....................................................................................................................................................<br />
.....................................................................................................................................................<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong>
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
Lückentext<br />
<strong>Frontière</strong><br />
Zwei Figuren (aus Knetmasse) ___________ sich in einer kargen Landschaft, unter blauem Himmel bei gleissendem<br />
Sonnenlicht. Sie sind als Menschen zu erkennen, haben aber kein Geschlecht und keinen Mund. Eine der beiden ist<br />
___________ als die andere.<br />
Die Figuren sind erstaunt, sich zu begegnen und wirken etwas ratlos. Dann beginnt die eine der anderen mit<br />
______________ klarzumachen, dass diese auf die Seite treten solle. Die ___________ andere sich. Es kommt zu<br />
___________________. Beide fallen rückwärts auf den Boden. Darauf ergreift eine Figur einen herumliegenden<br />
Backstein und errichtet ______________ eine kleine Mauer zwischen sich und die andere Figur. Diese beginnt nun<br />
ihrerseits eine Mauer zu bauen. Die _____________ Figur ist zuerst erstaunt, treibt dann aber den eigenen Mauerbau<br />
umso heftiger voran. So kommt es zu einem Wettlauf. Beide bauen in _____________ Tempo eine Mauer, die immer<br />
höher und _________________ wird. Die zwei Mauern werden zu einem unübersichtlichen Labyrinth, aus dem es<br />
kein __________________ mehr gibt. Die erste Figur erkennt diese Situation, hastet los und sucht einen Ausgang –<br />
_______________. Darauf ruft sie in ihrer ________________ ein „Hallo“, das aber unbeantwortet verhallt.<br />
Am Schluss sind beide Figuren von ______________ in einer stummen Schattenwelt sichtbar, erschöpft - ohne es zu<br />
wissen - Rücken an Rücken sitzend, ______________ die Mauern getrennt. Der Blickwinkel weitet sich, und schliess-<br />
lich zeigt sich eine _____________, deren Oberfläche aus einem einzigen _______________ besteht.<br />
erste / vergeblich / heller / durch / weigert / oben / Handgreiflichkeiten / rasendem / blitzschnell / Entrinnen / Verzweiflung<br />
/ Erdkugel / unübersichtlicher / begegnen / Labyrinth / Handzeichen<br />
<strong>Film</strong> 1 <strong>Frontière</strong>
Begleitendes Material für den Unterricht zu<br />
„Karlinchen“<br />
Index Seite<br />
<strong>Film</strong>beschreibung............................................................................................................2/5<br />
Hintergrundinformationen................................................................................................2/5<br />
Lernziele.........................................................................................................................2/5<br />
Bezug zum Lehrplan.......................................................................................................3/5<br />
Didaktische Anregungen.................................................................................................4/5<br />
Impulse für den Unterricht..............................................................................................4/5<br />
Link-Tipps......................................................................................................................5/5<br />
Literatur-Empfehlungen..................................................................................................5/5<br />
zusammengestellt von Barbara Waschmann, junge@normale.at<br />
normale.at<br />
gesellschafts- und wirtschaftspolitische<br />
<strong>Film</strong>vorführungen • ZVR 670699419<br />
Kegelgasse 24 / 17<br />
A-1030 Wien<br />
Telefon: +43 (0)676 / 553 6466<br />
info@normale.at • www.nomale.at
<strong>Film</strong>beschreibung<br />
Kurzfilm „Karlinchen“<br />
„Karlinchen“ flieht aus ihrem brennenden Haus. Ganz allein macht sie sich auf, um Hilfe in anderen Ländern<br />
zu finden. Doch niemand nimmt sich ihrer an, weil sie fremd ist...<br />
Der Zeichentrickfilm nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Annegret Fuchshuber (Annette Betz Verlag<br />
Wien/München 1995) wurde vom UNHCR (UN-Flüchtlingshochkommissariat) zur pädagogischen Arbeit<br />
entwickelt, um Kindern Themen wie Exil und kulturelle Unterschiede zu vermitteln.<br />
Er erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, das aus seiner Heimat fliehen muss. Es fühlt sich unsicher<br />
und ausgeschlossen, bis es in einem neuen Zuhause wieder Wärme, Schutz und Zuneigung findet.<br />
Hintergrundinformationen<br />
Jeden Tag werden irgendwo auf der Welt Kinder zu Flüchtlingen. Sie fliehen aus ihren Ländern, weil ihr<br />
Leben in Gefahr ist. Wenn sie bleiben, riskieren sie, aufgrund ihrer Ethnie, Religion, Nationalität oder der<br />
politischen Einstellung ihrer Eltern schlecht behandelt zu werden. Vielleicht fliehen sie, weil ihr Land vom<br />
Krieg zerstört ist. Aber meistens verstehen Kinder die Gründe nicht … sie haben Angst und laufen weg.<br />
Sie nehmen nur mit, was sie tragen können. Oft gibt es keinen Platz für die Dinge, die ihnen am liebsten sind,<br />
und oft bleibt keine Zeit, sie zu holen. Manchmal tragen Flüchtlingskinder bei ihrer Flucht nur ihre Träume<br />
und Hoffnungen mit sich.<br />
Mit 9,2 Millionen Flüchtlingen weltweit wird (2006) die niedrigste Zahl seit 25 Jahren registriert. Dies darf<br />
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das internationale System zur Bewältigung von Flucht und<br />
Vertreibung an einem kritischen Punkt angelangt ist.<br />
Es stellen sich neue Herausforderungen in einer zunehmend globalisierten Welt. Hierzu gehört das Schicksal<br />
von Millionen von Menschen, die innerhalb der Grenzen ihres Heimatlandes geflohen oder vertrieben worden<br />
sind, aber auch die Widersprüche in der öffentlichen Debatte über MigrantInnen und Flüchtlinge sowie eine<br />
restriktive Asylpolitik, verbunden mit wachsender Intoleranz.<br />
UN-Flüchtlingskommissar António Guterres betont in dem Bericht, dass zwischenstaatliche Konflikte heute<br />
weniger weit verbreitet seien als innerstaatliche Konflikte und Bürgerkriege. Deshalb gebe es weniger<br />
Flüchtlinge, die internationale Grenzen überquerten, aber mehr Vertriebene innerhalb ihrer Heimatländer.<br />
Zwar fielen die geschätzten 25 Millionen Binnenvertriebenen nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention.<br />
Gleichwohl bräuchten sie dringend Unterstützung.<br />
Lernziele<br />
aus UNHCR: „State of the World’s Refugees: Human Displacement in the New Millennium."<br />
Die Kinder lernen das Mädchen „Karlinchen“ kennen, das seine Lebensgrundlagen verliert und werden für<br />
lebensnotwendige Grundbedürfnisse sensibilisiert. Sie sollen sich in Gefühle wie Angst, Ausgrenzung und<br />
Ablehnung der Hauptfigur des einfühlen, um so die Fähigkeit des Mitfühlens und Mitleidens entwickeln und<br />
individuell zum Ausdruck bringen zu können.<br />
Die Themen „Flucht“ und „Asyl“ unter Aspekten des globalen Lernens zu behandeln, bedeutet sie neben der<br />
grundlegenden Sensibilisierung für Flüchtlings- und Menschenrechte hinaus auch ethische, soziale,<br />
politische und ökonomische Fragestellungen hin zu beleuchten.<br />
Begleitendes Material für den Unterricht zu „Karlinchen“ Seite 2/5
Bezug zum Lehrplan<br />
Nachstehend finden sich Einstiege ins Thema, Impulsfragen und methodische Anregungen, die unabhängig<br />
von Materialien sind und einfach im Unterricht eingebaut werden können.<br />
Je nach verfügbarem Zeitbudget und der Möglichkeit zu fächerübergreifenden Projektstunden/-tagen werden<br />
die vor genannten Lernziele erreicht.<br />
Um Kinder für grundlegende Bedürfnisse zu sensibilisieren und ihr Mitfühlen schulen zu können, ist es<br />
wichtig, ihnen diese aus einer anderen Perspektive nahe zu bringen.<br />
Mit Hilfe des Zeichentrickfilms hat man die Möglichkeit, ausschließlich bei der Figur des <strong>Film</strong>s zu bleiben und<br />
Kinder können sich eher mit Gleichaltrigen identifizieren.<br />
Zu den einzelnen Bereichen und eingearbeiteten Fragen finden Sie vielfältige Materialien und Medien in<br />
Österreich bei BAOBAB Weltbilder Medienstelle und den regionalen Mediatheken (in allen Bundesländern) www.baobab.at und <br />
www.normale.at <br />
¿ Verkehrte Welt ?<br />
Die Karte in der Petersprojektion stellt die bei uns übliche Weltkarte "auf den Kopf".<br />
Sie lädt dazu ein, neue Welt.Sichten auszuprobieren.<br />
Bezugsquelle: www.welthaus.at/layout/index.php3?scheme=4700 <br />
Begleitendes Material für den Unterricht zu „Karlinchen“ Seite 3/5
Didaktische Anregungen<br />
Im Rahmen der „ Junge Normale“ dient der <strong>Film</strong> als Impuls-Medium zur Ein- oder Hinführung zu den<br />
genannten Themenfeldern und reicht durch eine vertiefende inhaltliche Auseinandersetzung über den<br />
Kinosaal hinaus.<br />
Mit Kindern über das Leben im Exil zu sprechen, ist nicht einfach. Daher wird dem Vorstellungs- und<br />
Ausdrucksvermögen möglichst viel Spielraum gelassen. Die Kinder sollen durch die Bilder im Originalbuch<br />
und im Trickfilm zum Beobachten, Erzählen, Zeichnen, Nachahmen, Verkleiden und vielem anderen mehr<br />
angeregt werden.<br />
Zur nachhaltigen Auseinandersetzung ist es in jedem Fall förderlich, auf Vernetzung, Selbsttätigkeit und<br />
Handlungsorientierung abzuzielen.<br />
Impulse für den Unterricht<br />
Impulsfragen<br />
(auch als Metaplan-Arbeit in Gruppen als Einstieg geeignet)<br />
� „Mein Zuhause ist schön“ – Zur Aktivierung des Vorwissens halten die Kinder ihre Assoziationen zum<br />
Thema „Zuhause“ in Form eines Clusters fest.<br />
� „Auf der Suche nach …“ – Einfühlung und Verbalisierung von Grundbedürfnissen, indem die Kinder<br />
lebensnotwendige Dinge sammeln, malen und aufschreiben und diese auf einen „Baum“ kleben.<br />
� „Wie macht einen guten Menschen aus?“ – Vertiefung des Gefühls von Mitgefühl in Form einer<br />
Collage.<br />
Die Antworten können auch auf Karteikarten gesammelt und zu einem Gesamtergebnis strukturiert werden.<br />
Diese Arbeiten dienen in einer späteren Phase dazu, die eigene Sinneswandlung durch Information zu<br />
dokumentieren.<br />
Reflexion – Reaktion<br />
� Welche Szene des <strong>Film</strong>s hat Dich am meisten berührt und warum?<br />
� Sprich über eine Szene, die Dich persönlich angesprochen hat.<br />
� Blitzlichtfrage „Karlinchen“ hat Angst. Was könnte passiert sein?<br />
� Wie fühlt sich „Karlinchen“ in dieser Situation? Versucht, diese Gefühle zum Ausdruck zu bringen!<br />
Rollenspiele, Dialoge<br />
auch in die Rolle des/der Andersdenkenden schlüpfen!), (Fishbowl-) Diskussionen<br />
www.mediawien.at/unterricht/m/ emac_web/ data/l_diskussion.htm <br />
Medienanalyse<br />
Ein sehr lohnendes, aber zeitaufwendiges Projekt ist eine vergleichende Medienanalyse, die sich ausführlich<br />
mit dem <strong>Film</strong> befasst: Schulbücher, Fernsehsendungen, Zeitungen, Magazine und Webseiten auf Darstellung<br />
von Menschen verschiedener Kulturkreise oder Länder auf Leitfragen überprüfen wie:<br />
� Welche gemeinsamen Problemstellungen sind festzustellen?<br />
� Welche gemeinsamen Interessen teilen verschiedene Völker?<br />
� Wie wichtig ist die Perspektive der <strong>Film</strong>emacher/innen? Ist diese auch kulturell bedingt?<br />
(Blick aus dem Innern der Festung Europa - Blick von Außen auf Europa)<br />
Begleitendes Material für den Unterricht zu „Karlinchen“ Seite 4/5
Link-Tipps:<br />
Online-Spiel der UNHCR, bei dem Du der Flüchtling bist<br />
www.lastexitflucht.org <br />
UN-Kampagne für Flüchtlingskinder<br />
www.ninemillion.org <br />
Materialtipps für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Asyl/Flüchtlinge<br />
www.ekiba.de/Referat-5/images/MATERIALKISTE_Neuauflage_2003_kp.pdf <br />
ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit veranstaltet Workshops an Ihrer Schule<br />
www.zara.or.at/ trainings/ module/ <br />
Globales Lernen / Entwicklungspolitische Workshops kommen zu Euch an die Schule<br />
www.suedwind-agentur.at <br />
Infopool zum Globalen Lernen:<br />
www.globlern21.de <br />
VerNETZte Welt mit Lexikon, Link-Listen<br />
www.mediawien.at/unterricht/m/ emac_web/ data/w_index.htm <br />
Literatur-Empfehlungen:<br />
Flüchtlingskinder: Opfer von Verfolgung und Krieg<br />
Broschüre für Kinder von UNHCR<br />
www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/lehrhefte/Heft_mit_Comic_-_Fluechtlingskinder.pdf <br />
Fuchshuber, Annergert: Karlinchen. Annette Betz, Wien 1995.<br />
Cramer, Gabriele: Karlinchen - oder: Die Kunst, dem anderen zum Nächsten zu werden. Ein Bilderbuch von<br />
Annegert Fuchshuber im Religionsunterricht in der Grundschule. In: Kirche und Schule: Schulpraxis –<br />
Unterrichtshilfen. März/2006<br />
von Braunmühl, Susanne: Karlinchen lief davon, denn Feuer fiel vom Himmel…In: Grundschule Religion.<br />
Weggehen und Ankommen. Heft Nr. 9, 4. Quartal. Kallmeyer Friedrich Verlag, Velber 2004<br />
UNHCR: "State of the World’s Refugees: Human Displacement in the New Millennium." (engl.)<br />
ISBN-13: 978-0-19-929095-6 veröffentlicht am 23. März 2006, 340 Seiten<br />
www.unhcr.at/publikationen/zur-lage-der-fluechtlinge-in-der-welt.html <br />
UNHRC: Global Appeal 2007 (engl. / franz.)<br />
www.unhcr.at/publikationen/global-report.html <br />
Begleitendes Material für den Unterricht zu „Karlinchen“ Seite 5/5
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
<strong>Film</strong> 2<br />
Mohamed<br />
Kurzspielfilm aus der <strong>Film</strong>reihe «Pas d'histoires! 12 regards sur<br />
le racisme au quotidien» («12 Blicke auf den<br />
Rassismus im Alltag»)<br />
Drehbuch Samia Ayeb<br />
Regie Catherine Corsini<br />
Kamera Gilles Henry<br />
Schnitt Sabine Mamou<br />
Produktion L’association «Dire, faire contre le racisme»<br />
(d.f.c.r.), Little Bear, Frankreich 2000<br />
Sprachen Französisch, Deutsch, Italienisch<br />
<strong>Film</strong>länge 5 Minuten<br />
DarstellerInnen Mamadi Touré («Mohamed»); Sokam Njaboy;<br />
Nbero Njaboy; Afchiata Diomambe; Massouho<br />
Dosso<br />
Geeignet Primarstufe, ab 8 Jahren<br />
Zur Regisseurin<br />
Catherine Corsini wurde in Frankreich<br />
geboren und machte eine Ausbildung<br />
zur Schauspielerin in Paris. Mitarbeit an<br />
Kurzfilmen, dann Arbeit als Drehbuchautorin<br />
und Regisseurin verschiedener<br />
Kurz- und Spielfilme.<br />
Zur Autorin des Drehbuchs<br />
Samia Ayeb ist 23 Jahre alt, hat <strong>Film</strong>geschichte<br />
studiert und Dokumentarfilme<br />
realisiert. Zum Szenario ihres Drehbuchs<br />
wurde sie durch die Bekanntschaft mit<br />
einem kleinen Jungen von den Komoren<br />
(ostafrikanische Inselgruppe im Indischen<br />
Ozean) angeregt: Der Knabe wollte<br />
weiss werden; er wünschte sich eine<br />
andere Hautfarbe.<br />
<strong>Film</strong> 2 Mohamed Seite 1 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
Die Regisseurin zu ihrem <strong>Film</strong><br />
«Der Respekt vor der anderen Person ist eine ganz wesentliche Aufgabe<br />
des Menschen – diese andere Person, die so oft wir selbst sind. Ich<br />
denke an Dich, Mamadi. Danke allen.»<br />
Catherine Corsini<br />
Der <strong>Film</strong> im Blickwinkel des Produzenten<br />
«Schwarz wie ein Sack, schwarz wie die Nacht ...»<br />
Unser Familienname trägt unsere Wurzeln in sich, genauer gesagt<br />
diejenigen unserer Vorfahren. Noch näher haftet unser Vorname an<br />
unserer Identität, diejenige, die unsere Eltern bei unserer Geburt bewusst<br />
respektive vorbedacht vorhersehen. Mohamed, er will diesen<br />
Vornamen nicht mehr. Dieser widerspiegle - scheint ihm - nichts Wertvolles,<br />
mit dem was er ausstrahle ... und vor allem hörte er seine Klassenkameraden<br />
sich über Farben ausdrücken und was diese evozieren.<br />
Dann weist ihn ein Grosser - ein wenig herablassend - mit «Negro»<br />
zurecht ... und das Fass läuft über. Der kleine Mohamed träumt davon,<br />
sich Kevin zu nennen – ein Vorname eines Schauspielers, eines amerikanischen<br />
Stars – vielleicht gar derjenige eines grossen Sportlers?<br />
Endlich ein Vorname, der ihn an das erinnert, was er jeden Tag im<br />
Fernsehen sieht.<br />
Seinen Vornamen mehr mit seiner Hautfarbe als mit seiner Religion<br />
verbindend, fühlt sich der kleine Mohamed einsam, selbst im Kreise<br />
seiner grossen Familie. Und er leidet in seiner Haut, weil er keinem<br />
seiner Wunschbilder entspricht. Das äussere Bild bleibt also ein<br />
Hauptnenner der gesamten Identität.»<br />
d.f.c.r.<br />
Deutschsprachige Adaption: Ernst Rieben<br />
<strong>Film</strong> 2 Mohamed Seite 2 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
Inhalt<br />
Mohamed<br />
In einer französischen Grundschule fordert die Lehrerin die Schülerinnen<br />
und Schüler auf, passende Begriffe zur Farbe «Gelb» zu nennen.<br />
Die Kinder beteiligen sich rege am Unterricht. Es fallen Worte wie<br />
«Gold», «Australien» oder «Feuer». Die Lehrerin fragt auch einen<br />
schwarzen Jungen: «Mohamed, hast du noch eine Idee?» Der Knabe<br />
schüttelt den Kopf. Schliesslich fährt die Lehrerin mit der Farbe<br />
«Schwarz» fort. Wieder machen die Kinder viele Vorschläge: «Schwarz<br />
wie eine Kanonenkugel, wie die Trauer, wie England, wie die Magie.»<br />
Jetzt beteiligt sich auch Mohamed am Gespräch. «Die Nacht» und «eine<br />
Fledermaus» kommen ihm bei der Farbe «Schwarz» in den Sinn.<br />
Nach der Schule fährt Mohamed mit seinem Fahrrad nach Hause. Unterwegs<br />
kommt er an einem sandigen Platz vorbei, wo gerade mehrere<br />
junge Männer Fussball spielen. Dabei fliegt der Ball über den Spielfeldrand<br />
an das Vorderrad seines Velos. Er kommt gar nicht dazu, den Ball<br />
zurückzuspielen, als ihn ein dunkelhäutiger Mitspieler ziemlich grob<br />
anfährt: «He, kleiner Negro, spiel den Ball!» Mohamed nimmt sein Rad,<br />
steigt in die Pedale und fährt mit gesenktem Kopf nach Hause. Im Hausgang<br />
wird er von einem Nachbarn wohlwollend mit seinem Namen<br />
«Mohamed» begrüsst. Der Knabe reagiert aber aggressiv und schreit,<br />
dass er nicht mehr Mohamed genannt werden wolle.<br />
Er betritt die Wohnung. Hier herrscht reges Treiben. Viele Erwachsene<br />
sprechen einträchtig miteinander und trinken Tee. Mohamed geht<br />
zuerst zu seiner Mutter, die seine jüngere Schwester frisiert und ihn<br />
deshalb nur kurz beachtet. Auch die Männerrunde nimmt seine Traurigkeit<br />
nicht wahr.<br />
Mohamed zieht sich in sein Zimmer zurück und legt sich dort nachdenklich<br />
auf das Bett. Seine ältere Schwester kommt zu ihm und zieht<br />
ihn in die Höhe. Er bekennt ihr, dass er nicht mehr Mohamed heissen<br />
wolle. Er hätte es lieber, dass man ihn Kevin nennt. Die Schwester streichelt,<br />
tröstet und beruhigt ihn. Sie meint, dass Schwarz eine schöne<br />
Farbe sei, und auch sein Name passe zu ihm.<br />
«Allgemeine Erklärung<br />
der Menschenrechte»<br />
Zur Diskussion im Zusammenhang<br />
mit dem <strong>Film</strong><br />
Artikel 1<br />
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit<br />
Alle Menschen sind frei und gleich an<br />
Würde und Rechten geboren. Sie sind mit<br />
Vernunft und Gewissen begabt und sollen<br />
einander im Geiste der Brüderlichkeit<br />
begegnen.<br />
<strong>Film</strong> 2 Mohamed Seite 3 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
Didaktische Umsetzung<br />
Zeitaufwand<br />
Sekundarstufe 1 bis 3 Lektionen<br />
Primarstufe (2. bis 6. Schuljahr) mindestens 2 bis 4 Lektionen<br />
Allgemeine Vorbemerkungen<br />
Im <strong>Film</strong> «Mohamed» geht es um Identität und Selbstzweifel<br />
- um die Identitätssuche und Verzweiflung über die<br />
eigene Existenz. Und eine gut gemeinte pädagogische<br />
Idee einer Lehrerin, ein unbe-dachtes Wort eines Fussballers,<br />
ein liebenswürdiger Nachbar, der zur falschen<br />
Zeit etwas scheinbar Falsches sagt … einer dieser Tropfen<br />
im Alltag von Mohamed bringt das Fass zum Überlaufen.<br />
Wie immer bei Kinderfilmen geht der Konflikt des Protagonisten<br />
den meisten BetrachterInnen besonders ans<br />
Herz, erfährt etwas existentiell Dramatisches. Das Thema<br />
«Identität» beschäftigt naturgemäss Sekundarstufe-<br />
SchülerInnen sehr stark, egal welcher Nationalität,<br />
Volksgruppe oder Rasse sie angehören. Aber auch Kinder<br />
in der Primarstufe haben ihre Probleme mit der<br />
Selbstfindung, wollen Zugehörigkeit erfahren, «dabei<br />
sein», sich aber auch abgrenzen können. Mit dem kleinen<br />
Mohamed finden sie eine ideale Identifikationsfigur.<br />
Die didaktischen Vorschläge und Lernziele zu diesem<br />
<strong>Film</strong> richten sich deshalb an OberstufenschülerInnen<br />
(Sekundarstufe I) und Kinder des 2. bis 6. Schuljahrs der<br />
Primarstufe.<br />
A) Primarstufe<br />
1. Vorbemerkungen<br />
Das Thema respektive das Problem «Identität» kann<br />
auch bei jüngeren Kindern teilweise dramatische Züge<br />
annehmen, insbesondere bei fremdsprachigen. Jüngere<br />
Kinder äussern sich in der Regel spontaner zu einem<br />
Unwohlsein, dessen Ursachen ihnen möglicherweise gar<br />
nicht bewusst sind.<br />
Die Lehrkraft, die mit jüngeren Kindern arbeitet, schaut<br />
sich den <strong>Film</strong> mit ihnen zusammen an. Ähnlich wie bei<br />
den SchülerInnen der Sekundarstufe versucht sie mit<br />
gezielten Fragen / Impulsen den SchülerInnen mehr<br />
Klarheit bezüglich Inhalt und Ablauf des <strong>Film</strong>s zu vermitteln.<br />
Ein Akzent kann bei den jüngeren SchülerInnen auf die<br />
Bedeutung der Namen gelegt werden. Die Wahl des<br />
Namens durch die Eltern sagt viel über deren Wünsche<br />
und Einstellungen aus und hat einen Einfluss auf die<br />
Identitätsbildung des Kindes. Mohamed will seinen<br />
Namen nicht mehr, denn er verbindet ihn mit seiner<br />
Hautfarbe, die ihn unwohl sein lässt. Den Kindern soll<br />
dieser Konflikt «mit sich selbst» bewusst werden.<br />
Gleichzeitig geht es aber auch darum, den Aspekt des<br />
Namens zu relativieren und darauf hin zu arbeiten, den<br />
Blick für tiefere Ursachen und andere Lösungswege<br />
freizumachen.<br />
2. Lernziele<br />
• Erkennen, weshalb Mohamed plötzlich an seiner<br />
Identität zweifelt.<br />
• Die Symbolik des Vornamens Mohamed im <strong>Film</strong> verstehen<br />
können.<br />
• Sich Gedanken zur Bedeutung des eigenen Namens<br />
machen.<br />
• Erkennen, dass einerseits (Vor-)Namen die eigene<br />
Identität mitprägen, sich aber andererseits auch der<br />
Relativität dieses «Teils von sich selbst» bewusst werden.<br />
• Ein Gefühl dafür entwickeln, dass «Namensveränderungen»<br />
(Spitznamen) erschüttern und verletzen können<br />
- insbesondere bei Angehörigen von Minderheiten<br />
– und dass in dieser Hinsicht Sorgfalt und Rücksichtnahme<br />
erforderlich sind.<br />
<strong>Film</strong> 2 Mohamed Seite 4 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
3. Unterrichtsvorschläge<br />
3.1 <strong>Film</strong>betrachtung<br />
• Die Lehrkraft schaut sich den <strong>Film</strong> mit den Kindern an.<br />
Sie versucht mit gezielten Fragen in einem Klassengespräch,<br />
den Inhalt und die Handlung verständlich zu<br />
machen (siehe auch Sekundarstufe: Unterrichtvorschläge<br />
3.1.). Dabei geht es vor allem darum, dass die<br />
Kinder den inneren Konflikt von Mohamed nachvollziehen<br />
und verstehen können.<br />
• Anregend könnte die Nachfrage der Kinder bei ihren<br />
Eltern sein, weshalb sie ihnen gerade diesen Vornamen<br />
gegeben haben. Da damit allerdings ein Grenzbereich<br />
der Intimitätssphäre der Familie betreten wird,<br />
ist mit der nötigen Sorgfalt und Rücksicht vorzugehen,<br />
beispielsweise, indem es den Kindern freigestellt ist,<br />
darüber zu berichten.<br />
• Mögliche Fragen der Kinder an ihre Eltern:<br />
� Wer kam auf die Idee des Namens?<br />
� Wie habt ihr den Namen gefunden?<br />
� Was war euch dabei wichtig?<br />
� Gab solche, die auf gar keinen Fall in Frage kamen?<br />
� Wann begann die Namenssuche?<br />
� Was bedeutet eigentlich mein Name, eventuell mein Zweitname?<br />
� Habt ihr zwischen mehreren Namen wählen müssen?<br />
� Was waren die drei wichtigsten Gründe für den gewählten<br />
Namen?<br />
3.2 Das Spiel der Namen<br />
• Die Lehrkraft bereitet dicke Karton-Etiketten vor und<br />
teilt die Klasse in 2er- oder 4er-Gruppen ein.<br />
• Jede Gruppe erhält den Auftrag, zu einer vorgegebenen<br />
Menschengruppe bzw. zu einem Menschentypen<br />
etwa 6 bis 10 passende Vornamen zu finden. Dabei<br />
sind sowohl real vorhandene Namen als auch Fantasienamen<br />
erlaubt. Wichtig: Die anderen Arbeitsgruppen<br />
dürfen nicht wissen oder hören, zu welchen Menschengruppen<br />
/-typen Namen gesucht werden. Die<br />
Namen werden auf die Etiketten geschrieben.<br />
• Danach werden die Namen gruppenweise auf dem<br />
Boden ausgelegt.<br />
• Die Klasse geht dann bei jeder Gruppe vorbei, studiert<br />
die Namen und versucht zu erraten, zu welcher Menschengruppen/-typen<br />
diese Vornamen passen.<br />
• Mögliche Beispiele von Menschengruppen/-typen:<br />
� VerbrecherIn, DiebIn oder PanzerknackerIn<br />
� PiratIn<br />
� <strong>Film</strong>schauspielerIn<br />
� HeldIn<br />
� Cowboy / Cowgirl<br />
� IndianerIn<br />
� Eskimo<br />
� Bauer / Bäuerin<br />
� Chinese/Chinesin oder JapanerIn<br />
� KomikerIn<br />
� Comicsfigur<br />
� Fernsehstar<br />
• Im Anschluss an die Rate-Runde versammelt die Lehrkraft<br />
die Klasse in einem Kreis und teilt noch einmal<br />
jedem drei Etiketten aus (für «Änderungen in letzter<br />
Minute» oder Korrekturen).<br />
• Diesmal werden die SchülerInnen ermuntert, sich für<br />
den Rest des Morgens einen neuen Namen auszusuchen.<br />
Dieser Name wird notiert und der Namensschild<br />
sichtbar an den Körper geheftet. Während des ganzen<br />
Morgens behalten die Kinder diesen Namen und werden<br />
von ihren KlassenkameradInnen und der Lehrkraft<br />
auch so angesprochen.<br />
• Daraus könnte auch ein kleines Spiel entstehen – zum<br />
Beispiel wird eine Strichliste geführt und darauf eingetragen,<br />
wer seine Kameradin oder seinen Kameraden<br />
nicht mit dem neuen Namen angesprochen hat.<br />
3.3 Schreibauftrag<br />
Die Lehrkraft erteilt einen Schreibauftrag. Dieser ist<br />
schriftlich formuliert:<br />
Mohamed sitzt am Abend alleine am Tisch und schreibt<br />
die Ereignisse in sein Tagebuch. Versetzt euch in die<br />
Person von Mohamed und denkt euch aus, was er wohl<br />
schreiben wird. Achtung: Ihr müsst nicht alle Geschehnisse<br />
des Tages notieren. Schreibt etwas über seine möglichen<br />
Gefühle.<br />
Zeit 1 Lektion, Umfang: 1 Seite.<br />
3.4 Fremdsprachen-Auftrag<br />
Die Vorschläge für das 3. und 4. Schuljahr können auch<br />
für die Primarstufe mit einer 5. oder 6. Klasse durchgeführt<br />
werden. Da der <strong>Film</strong> in den drei Landessprachen<br />
Deutsch, Französisch und Italienisch vorliegt, wäre es<br />
reizvoll, im Anschluss an den <strong>Film</strong> noch eine sprachliche<br />
Arbeit im Fremdsprachenunterricht anzugliedern. Dabei<br />
ist davon auszugehen, dass die Kinder nicht alle Wörter,<br />
die von den Kindern zu den Farben genannt werden,<br />
auch verstanden haben.<br />
Das Arbeitsblatt / Primarstufe gibt einen Auszug aus dem<br />
<strong>Film</strong> wieder. Dieser Auszug kann im Französisch mit den<br />
SchülerInnen noch einmal angeschaut werden. Diese<br />
erhalten das Arbeitsblatt 1 und versuchen nun, während<br />
einer zweiten <strong>Film</strong>vorführung in der entsprechenden<br />
Fremdsprache diese Begriffe zu übersetzen (auf die freie<br />
Zeile schreiben).<br />
<strong>Film</strong> 2 Mohamed Seite 5 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
B) Sekundarstufe<br />
1. Vorbemerkungen<br />
Die vorgängig aufgeführten allgemeinen Vorbemerkungen<br />
in Bezug auf die didaktischen Vorschläge und Lernziele<br />
zum <strong>Film</strong> «Mohamed» gehen bereits auf die Voraussetzungen<br />
der Sekundarstufe ein. Beachtenswert für<br />
diese Stufe sind aber auch die spezifischen Vorbemerkungen<br />
im Abschnitt «B) Primarstufe».<br />
2. Lernziele<br />
• Sensibilität wecken bezüglich Bemerkungen gegenüber<br />
Minderheiten.<br />
• Nachdenken über die eigene Identität respektive die<br />
Identität anderer (Wer bin ich? Wer sind sie?)<br />
• Wichtige Elemente / Merkmale der (eigenen) Identität<br />
nennen können.<br />
• Sich der besonderen Identitätsprobleme von Angehörigen<br />
anderer Volksgruppen oder Ethnien in einem für<br />
sie fremden Umfeld bewusst werden.<br />
3. Unterrichtsvorschläge<br />
3.1. Gelb wie Gold – Schwarz wie die Nacht<br />
Die Lehrkraft schaut sich den <strong>Film</strong> mit den SchülerInnen<br />
an. Sie lässt den <strong>Film</strong> kurz resümieren. Dann wird ein<br />
Klassengespräch initiiert, dessen Ziel es ist, herauszufinden,<br />
was mit Mohamed passiert ist und welches die<br />
Ursachen seiner Probleme sind. Dabei können folgende<br />
Fragen bzw. Aufforderungen helfen:<br />
• Achtet auf die Begriffe «gelb» und «schwarz». Vergleicht<br />
die Ausdrücke, welche die SchülerInnen bei<br />
der Farbe «Gelb» nennen mit denjenigen, die ihnen<br />
zur Farbe «Schwarz» einfallen. Gold, Feuer, Australien<br />
Zitrone, Ägypten sind positiver besetzt als Nacht, Kanonenkugel,<br />
Kohle, ein Sack oder ein Keller …<br />
• Wie reagiert Mohamed auf diese Begriffe? Mögliche<br />
Antworten: Er wirkt verunsichert, weiss nicht recht, wie<br />
er sich verhalten soll. Bei der Farbe schwarz beteiligt er<br />
sich mit zwei Nennungen: «Fledermaus» und «Nacht».<br />
• Wie verlässt Mohamed die Schule? Es weist nichts auf<br />
eine schlechte Stimmung hin …<br />
• Welches Ereignis bringt das Fass zum Überlaufen? Die<br />
grobe Bemerkung des Schwarzen «Kleiner Negro …»<br />
• Warum könnte ihn diese Bemerkung erschüttern,<br />
kommt sie auch von einem «Dunkelhäutigen»? Die<br />
Bemerkung konfrontiert ihn mit seiner Hautfarbe, seine<br />
Hautfarbe ist schwarz, bei den meisten ist sie weiss.<br />
• Weshalb reagiert Mohamed so gereizt auf den Nachbarn?<br />
Der Nachbar nennt seinen Namen »Mohamed».<br />
Diesen Namen tragen vor allem Schwarze und Moslems.<br />
Somit erinnert ihn dieser Name auch wieder an<br />
seine Hautfarbe, die nicht so ist, wie diejenige der<br />
meisten seiner Mitschülern und Mitschülerinnen.<br />
• Wie ist die Atmosphäre zu Hause, bei seiner Familie?<br />
Farbig, friedlich, gesellig …<br />
• Welche Farben herrschen in der Wohnung vor? Es<br />
sind helle Farben: Die Wände sind gelb, die Kleider der<br />
Frauen hellgrün, diejenigen der Männer weiss …<br />
• Als Mohamed sich zurückzieht, läuft er durch einen<br />
Gang. Welche Farben haben Gang und sein Zimmer?<br />
Der Gang ist grau und dunkel, das Zimmer ebenfalls …<br />
• Was drückt dieser Farbwechsel aus? Er symbolisiert<br />
Mohameds Stimmung, seine Identitätskrise mit seiner<br />
Hautfarbe; er fühlt sich in seiner Haut nicht mehr wohl;<br />
er möchte nicht mehr zu seinem Umfeld gehören …<br />
• Warum möchte Mohamed plötzlich nicht mehr Mohamed,<br />
sondern Kevin heissen? Wie kommt er auf den<br />
Namen Kevin? Vermutungen: Kaum ein Name symbolisiert<br />
die Andersartigkeit in unserer westlichen europäischen<br />
Zivilisation so stark wie Mohamed. Der <strong>Film</strong> ist<br />
zwar vor dem 11. September 2001 entstanden, aber<br />
dennoch polarisierte dieser Name schon damals stark.<br />
Kevin hingegen ist ein Name, der durch einen bekannten<br />
Hollywood-<strong>Film</strong> unglaublich populär wurde und<br />
lange Zeit die Hitliste der Vornamen anführte. Kevin<br />
steht für das Bild des Westens - das Bild, das uns durch<br />
das Fernsehen kolportiert wird …<br />
• Wie reagiert die Schwester auf den Wunsch von Mohamed?<br />
Sie ist sehr lieb mit ihm, fast wie eine Mutter.<br />
Sie sagt ihm, wie schön seine Hautfarbe sei und dass<br />
deshalb auch sein Name gut zu dieser Hautfarbe passe.<br />
• Was beabsichtig die Schwester mit diesen Worten? Sie<br />
will sein Selbstvertrauen stärken, sie will ihn mit Stolz<br />
erfüllen …<br />
• Warum lässt die Regisseurin Mohamed und dessen<br />
Schwester einen Moment lang so stark in das Kameraobjektiv<br />
blicken? ... (SchülerInnen und Lehrkraft äussern<br />
ihre Vermutungen, da die Absicht der Regisseurin<br />
nicht bekannt ist.)<br />
<strong>Film</strong> 2 Mohamed Seite 6 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
3.2. Nachdenken über die eigene Identität<br />
Die Lehrkraft hängt im Schulzimmer A3-Plakate auf, die folgende Identitätsmerkmale enthalten:<br />
Mein Name<br />
sehr zufrieden zufrieden es ist mir gleich nicht zufrieden gar nicht zufrieden<br />
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→<br />
Meine Hautfarbe<br />
sehr zufrieden zufrieden es geht so nicht zufrieden gar nicht zufrieden<br />
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→<br />
Meine Nationalität<br />
sehr stolz darauf stolz darauf es ist mir gleich nicht stolz darauf schäme mich eher<br />
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→<br />
Mein Wohnort<br />
sehr zufrieden zufrieden es geht so nicht zufrieden gar nicht zufrieden<br />
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→<br />
Meine Familie<br />
sehr stolz darauf stolz darauf es geht so nicht stolz darauf schäme mich eher<br />
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→<br />
Mein Lebensstandard<br />
sehr zufrieden zufrieden es geht so nicht zufrieden gar nicht zufrieden<br />
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→<br />
Mit mir selbst<br />
sehr zufrieden zufrieden es geht so nicht zufrieden gar nicht zufrieden<br />
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→<br />
• Die SchülerInnen setzen nun auf der Skala jedes<br />
Blattes einen Strich und zwar an der Stelle, die ihrer<br />
Befindlichkeit entspricht.<br />
• Da sich die Operation im Bereich der Intimsphäre<br />
bewegt, ist Sorgfalt und Rücksichtnahme gefordert<br />
(Prüfen, ob es den SchülerInnen freigestellt werden<br />
soll, bei einzelnen Punkten keine Aussage zu machen.<br />
• Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass jede<br />
Schülerin bzw. jeder Schüler ein Set mit Streifen zu<br />
jedem Merkmal erhält. So können sie ihre Einschätzungen<br />
individuell und geschützt vornehmen. Die<br />
Streifen werden dann nach Merkmalen gesammelt<br />
und die Einschätzungen auf das entsprechende A3-<br />
Blatt übertragen.<br />
• Im Plenum werden die Plakate analysiert und interpretiert:<br />
Wie sind die Striche verteilt? Wie steht es um<br />
die Zufriedenheit in Bezug auf ein bestimmtes Merkmal?<br />
Gibt es Unterschiede? Was kann daraus geschlossen<br />
werden?<br />
Das Hauptziel des Auftrages besteht darin, die SchülerInnen<br />
zum Nachdenken bezüglich bestimmter Merkma-<br />
le ihrer Identität anzuregen. Vielleicht wird es in der<br />
Diskussion gelingen, die Frage der Übereinstimmung<br />
bzw. Diskrepanz zwischen Wunsch und (subjektiv empfundener)<br />
Wirklichkeit vertieft anzugehen. Je nach<br />
Situation kann auch die Frage von Unterschieden zwischen<br />
den Geschlechtern, zwischen Minderheiten und<br />
Mehrheiten, zwischen Angehörigen verschiedener<br />
Volksgruppen oder Nationen thematisiert und der Bogen<br />
zurück zum <strong>Film</strong> geschlagen werden.<br />
3.2. Schreibauftrag<br />
Im Anschluss an die Klassendiskussion kann die Lehrkraft<br />
noch Schreibaufträge zum Thema Identität erteilen.<br />
Die SchülerInnen sollen dabei unter mehreren Themen<br />
auswählen können (Arbeitsblatt / Sekundarstufe - in<br />
Bezug auf den Schreibauftrag Nr. 4 «Das Michael Jackson<br />
Syndrom» sind in den Cineastischen Hinweisen ergänzende<br />
Anmerkungen samt entsprechenden Fotos aufgeführt).<br />
<strong>Film</strong> 2 Mohamed Seite 7 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
<strong>Film</strong>kundliche Aspekte<br />
Eine Kameraperspektive: Augenhöhe<br />
Die Regisseurin Catherine Corsini lässt ihren Kameramann<br />
die Welt des kleinen Jungen fast dokumentarisch<br />
aus dessen Augenhöhe beobachten und bleibt so dicht<br />
an Mohameds Gefühlsebene – ob dieser nun im Klassenzimmer<br />
sitzt, dem Fussballspiel von anderen Jungen<br />
zuschaut oder ganz allein mit seinem Velo vor der Silhouette<br />
der Stadt radelt. Sein Umfeld wird durch das<br />
Kameraobjektiv immer aus seiner Sicht wahrgenommen.<br />
Dadurch nimmt die <strong>Film</strong>emacherin den Jungen als Persönlichkeit<br />
ernst. So entsteht zudem nicht der Eindruck,<br />
dass eine erwachsene Person von der Höhe ihrer Lebenserfahrung<br />
herabblickt auf die doch eigentlich nicht<br />
so weltbewegend scheinenden Probleme eines Kindes<br />
mit seinem Namen und seiner Herkunft.<br />
Vergleiche dazu die <strong>Film</strong> stills im Videoteil.<br />
Identität: Manipulationen ausgesetzt<br />
Der kleine Mohamed hat Probleme mit seiner Identität.<br />
Das lässt ihn seine Umwelt als etwas Fremdes, Bedrohliches<br />
erleben, auch in Situationen, die diese Gedanken<br />
eigentlich nicht aufkommen lassen (im Hausgang, zu<br />
Hause). Bloss: Wer kennt dieses Spielen mit ganz anderen<br />
Identitäten nicht von sich selbst? Wer wünschte sich<br />
nie ein ganz anderes Aussehen, andere Begabungen<br />
oder Lebensbedingungen? Wir können mit Mohamed<br />
mitfühlen, wenn er mit seinem Namen nicht zufrieden ist<br />
und sich eher als Kevin sieht. Wer eine helle Haut aufweist,<br />
lässt sich an der Sonne bräunen, und wer von<br />
dunklem Teint ist, unternimmt alles, um die Haut heller<br />
erscheinen zu lassen.<br />
Foto 1: Bräunungscreme aus einem Kosmetikgeschäft<br />
Foto 2: Hautaufheller<br />
Foto 3: Fixierschaum. Glatte, lange Haare lassen sich<br />
mittels Dauerwellenbehandlung in Locken legen...<br />
Foto 4: ...und gekrauste werden mit entsprechenden<br />
Mitteln gestreckt und gebleicht: Haarbehandlungsset für<br />
Kinder - zum Glätten von gekraustem Haar - aus einem<br />
afrikanischem Kosmetikladen in der Schweiz<br />
<strong>Film</strong> 2 Mohamed Seite 8 | 8
DVD RESPEKT STATT RASSISMUS<br />
Begleitmaterialien für den Unterricht ...................................................................................................................................................................................................................<br />
<strong>Film</strong> 2<br />
Mohamed<br />
Aufgaben:<br />
1. Vor dem <strong>Film</strong>: Erfinde eine Geschichte zu diesen Bildern. Setze einen Titel.<br />
2. Nach dem <strong>Film</strong>: Nun, da du die Geschichte kennst, setze zu jedem Bild einen passenden Titel.<br />
3. Was denkt Mohamed? Formuliere zu jedem Bild einen Satz, der Mohamed in diesem Moment<br />
durch den Kopf geht.<br />
<strong>Film</strong> 2 Mohamed
Wie es ist, ein Flüchtling zu sein<br />
Arbeitsblätter zum Video<br />
„Wie es ist ein Flüchtling zu sein“<br />
für Schülerinnen und Schüler von 9 bis 12 Jahren<br />
Konzept: Sylvie Daillot und Elisabeth Zubriggen<br />
Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
Wie Millionen andere<br />
Menschen, die durch<br />
Krieg oder Verfolgung<br />
bedroht waren,<br />
mussten Mina, Damir,<br />
• Um die Lage dieser<br />
Flüchtlingskinder besser verstehen zu können,<br />
füllt die Tabelle aus.<br />
Medin, John und<br />
Sreisor ihre Heimat Es kann sowohl jeder für sich arbeiten als auch<br />
alle zusammen als Gruppe. Ihr könnt auch je-<br />
verlassen. Sie wurden der ein Kind auswählen. Dann füllt jeder eine<br />
Flüchtlinge.<br />
Spalte aus. Wenn alle Spalten ausgefüllt sind,<br />
tragt eure Ergebnisse zusammen, sodass ihr<br />
eine gemeinsame Tabelle habt. Nun könnt ihr<br />
die verschiedenen Spalten vergleichen<br />
und einige Beobachtungen machen. Wo<br />
stellt ihr Ähnlichkeiten fest?<br />
Heimatland<br />
Aufnahmeland<br />
Art der<br />
Unterkunft<br />
Warum sie<br />
weggingen<br />
Schwierigkeiten<br />
Was sie<br />
machen wollen<br />
Mina John Sreisor Damir und<br />
Medin<br />
2
Macht die Herkunfts- und<br />
Aufnahmeländer<br />
(Asylländer) für jedes<br />
Kind auf einem Globus<br />
ausfindig.<br />
In was für einer<br />
Unterkunft leben Mina,<br />
Damir, Medin, John und<br />
Sreisor? Wenn ihr das<br />
Video angesehen habt,<br />
beschreibt das Leben in<br />
einer Sammelunterkunft<br />
oder einem Lager.<br />
Glaubt ihr, dort ist das<br />
Leben einfach? Warum?<br />
Erklärt, was eurer<br />
Meinung nach das größte<br />
Problem sein könnte.<br />
• Was entdeckt ihr?<br />
Wusstet ihr, dass nur ein Drittel der Flüchtlinge<br />
der Welt in Europa, Australien oder<br />
Nordamerika sind?<br />
Alle anderen leben in Ländern Afrikas, Asiens<br />
oder Lateinamerikas.<br />
• Gibt es in eurer Nachbarschaft<br />
Flüchtlinge? Oder in eurer Stadt? Wie leben<br />
sie?<br />
Nehmt Kontakt zu den Behörden eurer Stadt<br />
auf und schneidet Zeitungsartikel aus, damit<br />
ihr die Situation der Flüchtlinge besser<br />
verstehen könnt.<br />
3
Warum haben<br />
Mina, Damir, Medin, John<br />
und Sreisor ihre Heimat<br />
verlassen?<br />
Fertigt eine Liste der<br />
Schwierigkeiten an,<br />
denen Mina, Damir, Medin,<br />
John und Sreisor<br />
begegneten, als sie ihre<br />
Heimat verlassen mussten.<br />
Wie meint ihr fühlen sich<br />
Menschen, wenn sie aus<br />
ihrer Heimat fliehen<br />
müssen?<br />
• In bestimmten Regionen der<br />
Welt werden die Menschen aufgrund ihrer<br />
Religion, ihrer Zugehörigkeit zu einer<br />
bestimmten Gruppe oder ihrer politischen<br />
Meinung bedroht und verfolgt.<br />
Deshalb müssen Menschen in andere<br />
Länder fliehen.<br />
• Wenn ihr<br />
fliehen müsstet,<br />
was würdet ihr am<br />
meisten vermissen?<br />
Welche Menschen,<br />
Tiere, Orte und<br />
Dinge? Warum?<br />
Vielleicht sind einige von euch schon einmal in eine neue Stadt gezogen und<br />
waren inmitten einer Gruppe von Kindern, die einander schon kannten.<br />
Wie habt ihr euch gefühlt?<br />
Wie könnt ihr einem Neuling das Gefühl geben, dass er in eurer Nachbarschaft<br />
oder in eurer Klasse willkommen ist?<br />
4
John musste den Sudan<br />
Hals über Kopf verlassen.<br />
Alles, was er mitnehmen<br />
konnte, waren seine<br />
Erinnerungen.<br />
Als Damir und Medin ihr<br />
Dorf in Bosnien und<br />
Herzegowina verließen,<br />
konnten sie nur noch ein<br />
Radio mitnehmen, dann ein<br />
paar Fotos und Decken, um<br />
sich nachts warm zu halten.<br />
• Folgende Sachen hat Minas<br />
Mutter eingepackt, als sie Afghanistan<br />
verließen:<br />
- 6 Fladenbrote<br />
- 1 Puppe<br />
- 3 Decken<br />
Ihr Nachbar Kherber nahm folgendes mit:<br />
- 7 Fotos<br />
- 4 Fladenbrote<br />
- 2 Pullover<br />
• Findet heraus, was Najmia, Kherbers Schwester, mitgenommen hat.<br />
Schaut euch dazu genau an, was Minas Mutter und ihr Nachbar eingepackt<br />
haben und seht euch dann die Tabelle mit den Farsi*-Zahlen an.<br />
* Farsi ist eine der Sprachen, die in Afghanistan gesprochen werden.<br />
- ………………………………………………………..<br />
- ………………………………………………………..<br />
- ………………………………………………………..<br />
5
Nun stellt euch vor, ihr<br />
müsstet mit euren<br />
Familien fliehen.<br />
Ihr habt nur ein paar<br />
Minuten Zeit um einige<br />
Dinge einzupacken – nur<br />
das, was wichtig erscheint.<br />
• Versucht, die zwei Übungen auszufüllen.<br />
Schreibt in Spiegelschrift!<br />
• Schreibt eine Liste der Dinge,<br />
die ihr mitnehmen würdet. Vergleicht<br />
diese Liste mit euren Freunden.<br />
6<br />
Als Mina in Dänemark ankam,<br />
musste sie ein neues Alphabet<br />
lernen, um Dänisch schreiben<br />
zu können.<br />
Meint ihr, es wäre schwer für<br />
euch, eure Schreibge-<br />
wohnheiten zu ändern?
Wären John und seine<br />
Mutter in unserem Land<br />
Flüchtlinge, müssten sie<br />
einige ihrer Gewohnheiten<br />
ändern. Das könnte<br />
Probleme bereiten.<br />
• Teilt euch in Gruppen und listet<br />
auf, welche Veränderungen am schwierigsten<br />
sein könnten.<br />
Welche Gewohnheit ist eurer<br />
Meinung nach am schwersten zu<br />
ändern?<br />
• Vielleicht habt ihr einiges mit<br />
diesen Kindern gemeinsam.<br />
Mina liebt es, draußen zu<br />
spielen, Medin und John<br />
Macht eine Liste mit all diesen<br />
Dingen und bezieht euch dabei<br />
auf das, was ihr im Video gesehen habt.<br />
sind begeisterte Schwimmer<br />
und Sreisor geht gerne<br />
7<br />
auf den Markt.<br />
Mina hat eine kleine<br />
Schwester, Damir einen<br />
Neffen und Sreisor einen<br />
großen Bruder.
Nun bekommt ihr<br />
eine Chance, einen<br />
eurer Klassen-<br />
kameraden<br />
besser kennen zu<br />
lernen.<br />
• Tut euch dafür zu zweit zusammen<br />
und füllt die untenstehende Tabelle aus.<br />
In die Mitte schreibt ihr all das, was ihr mit eurem<br />
Klassenkameraden gemeinsam habt.<br />
(Zum Beispiel eine kleine Schwester, gerne Fahrradfahren,<br />
zwei Sprachen sprechen können).<br />
Euer Name: Der Name eures Klassenkameraden:<br />
• In das linke und rechte Feld notiert ihr eure Unterschiede.<br />
Euer Klassenkamerad rechts und ihr selbst links.<br />
Was habt ihr mit eurem Klassenkamerad gemeinsam? Was habt ihr Neues übereinander<br />
gelernt?<br />
8
Wir haben immer etwas mit<br />
unseren Nachbarn<br />
gemeinsam, oder sogar<br />
mit Leuten, die am anderen<br />
Ende der Welt wohnen.<br />
Danach zu suchen, kann<br />
wie ein Spiel sein.<br />
Alle Menschen müssen<br />
• Tut euch in Gruppen zusammen und<br />
fertigt eine Liste mit Gemeinsamkeiten an.<br />
zum Beispiel Essen<br />
oder Trinken.<br />
Um die Liste zu vervollständigen, lest die<br />
nächsten Seiten. Dort könnt ihr einiges aus der<br />
Es gibt noch viele andere<br />
Beispiele.<br />
„Konvention über die Rechte des Kindes“<br />
lesen.<br />
9
Hier sind einige der anerkannten Rechte für Kinder<br />
auf der ganzen Welt zusammengestellt.<br />
Sie stehen in einer Konvention (einem Vertrag), die am<br />
20. November 1989 von mehr als 190 Ländern unterzeichnet wurde.<br />
Einige dieser Rechte sind Grundbedürfnisse.<br />
Welche von ihnen sind das?<br />
Das Recht auf Überleben und Entwicklung<br />
Von Geburt an hat jedes Kind das Recht, mit seiner Familie zu leben, zu essen,<br />
in guter Gesundheit aufzuwachsen und eine Unterkunft zu haben.<br />
Das Recht auf Identität<br />
Jedes Kind hat das Recht auf einen Namen und eine Identität.<br />
Das Recht auf Gesundheit<br />
Wenn ein Kind krank ist, muss es Pflege und medizinische Hilfe erhalten. Behinderte<br />
Kinder haben das Recht auf besondere Behandlung und Fürsorge.<br />
Das Recht auf Bildung<br />
Alle Kinder haben das Recht, Lesen und Schreiben zu lernen.<br />
Sie haben ebenso das Recht auf Erholung und Freizeit und die Teilnahme an<br />
künstlerischen und kulturellen Tätigkeiten.<br />
Das Recht, vor Ausbeutung durch Arbeit geschützt zu werden<br />
Alle Kinder sollten vor Arbeit geschützt werden, die ihre Gesundheit, Bildung<br />
oder Entwicklung bedroht.<br />
Das Recht, vor allen Formen von Gewalt geschützt zu werden<br />
Kein Kind sollte an der Führung eines Krieges beteiligt sein.<br />
Alle Kinder haben das Recht zu leben, ohne jemals erniedrigt, geschlagen oder<br />
von Erwachsenen verlassen zu werden.<br />
Das Recht auf freie Meinungsäußerung<br />
Alle Kinder haben das Recht, ihre Meinung frei zu äußern.<br />
Es muss ihnen in ihrer Familie oder in der Schule erlaubt sein, das auszusprechen,<br />
was sie bewegt.<br />
Das Recht, willkommen zu sein und geschützt zu werden<br />
Flüchtlingskindern, die im Exil leben, muss besonderer Schutz und besondere<br />
Hilfe gewährt werden.<br />
10
Was ihr tun könnt<br />
Freundschaften helfen, sich in einem fremden Land einzuleben.<br />
Damit sich Flüchtlinge in eurer Klasse oder in eurer Nachbarschaft wohl fühlen,<br />
ist es wichtig, dass ihr nett zu ihnen seid.<br />
Oft können Flüchtlingskinder noch nicht gut Deutsch sprechen. Ihr macht es ihnen<br />
leichter, wenn ihr sie fragt, ob sie mit euch spielen oder etwas mit euch unternehmen<br />
wollen.<br />
Es ist sicher interessant zu erfahren, wo die Flüchtlinge herkommen und wie es<br />
in ihrem Heimatland war, bevor sie flüchten mussten. Ihr könnt ja mit ihnen darüber<br />
sprechen. Erzählt euch gegenseitig, was ihr gerne tut und ihr werdet sehen,<br />
dass ihr vieles gemeinsam machen könnt.<br />
Sicher ist es spannend, zum Thema „Wie es ist, ein Flüchtling zu sein“ als Klasse<br />
oder gemeinsam mit anderen Klassen große Plakate zu gestalten. Jeder kann<br />
etwas darauf malen. Ihr könnt sie in eurem Klassenzimmer oder an anderen<br />
Orten in eurer Schule aufhängen.<br />
Wenn ihr den UNHCR unterstützen wollt, Flüchtlingen zu helfen, könnt ihr auch<br />
Spenden sammeln. Das geht ganz einfach:<br />
Macht doch bei eurem nächsten Schul- oder Straßenfest einen Stand, an dem ihr<br />
zum Beispiel Kuchen oder Waffeln verkauft! Erzählt den Leuten, wofür ihr das<br />
Geld verwenden werdet.<br />
Den Erlös könnt ihr auf folgende Konten überweisen:<br />
In Deutschland:<br />
Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe e.V.<br />
Kto.-Nr. 2000 8850<br />
Sparkasse Bonn<br />
BLZ 380 500 00<br />
In Österreich:<br />
UNHCR Wien<br />
Kto.-Nr.: 0958 36003 00<br />
Bank Austria Creditanstalt<br />
BLZ 12000<br />
11
Weitere Materialien für diese Altersgruppe<br />
finden Sie auf unseren Internetseiten<br />
Stationen einer Flucht.<br />
Rollenspiel, um Kinder und Jugendliche im Alter von 9-12 für die Probleme des<br />
Flüchtlingsdaseins zu sensibilisieren.<br />
Anzahl der Spieler: 15-30<br />
Spieldauer: 45 min., Nachbereitung 45-90 min.<br />
(Besonders geeignet für Projekttage)<br />
Infoset: „Menschenrechte, Flüchtlinge und UNHCR“<br />
Das Infoset mit Lehrmaterialien zum Thema „Menschenrechte, Flüchtlinge und<br />
UNHCR“ gibt es für drei Altersstufen (9-11, 12-14, 13-18 Jahre).<br />
„Jugendliche Flüchtlinge – Flucht und Schutz vor Verfolgung und Krieg“<br />
Jugendliche Flüchtlinge – Woher kommen sie? Warum fliehen sie?<br />
Wohin gehen sie?<br />
Schwerpunkte dieser 24-seitigen Broschüre bilden u.a. die Arbeit des UNHCR<br />
und die Genfer Flüchtlingskonvention.<br />
„Flüchtlinge, Kinder“<br />
Sonderausgabe der Zeitschrift „Flüchtlinge“ über das Schicksal von Flüchtlingskindern<br />
.<br />
Einzelne Kinder aus verschiedenen Regionen der Welt erzählen ihre Geschichte.<br />
Daneben wird die Arbeit von UNHCR näher erläutert und Begriffe, die mit der<br />
Flüchtlingsproblematik verbunden sind, erklärt. Landkarten und Bilder veranschaulichen<br />
den Inhalt der Texte.<br />
UNHCR Deutschland UNHCR Österreich<br />
www.unhcr.de www.unhcr.at<br />
12