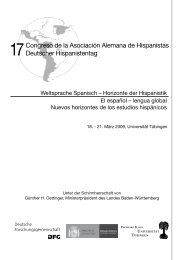Nr. 23 (November 2005) - Deutscher Hispanistenverband
Nr. 23 (November 2005) - Deutscher Hispanistenverband
Nr. 23 (November 2005) - Deutscher Hispanistenverband
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
14<br />
Mitteilungen des Deutschen <strong>Hispanistenverband</strong>es <strong>23</strong> (Oktober <strong>2005</strong>)<br />
Text auf die umfassendere medienhistorische Frage nach der Wechselbeziehung<br />
zwischen schriftmedialer Typographie und theatraler Szenographie<br />
öffnete.<br />
Die Sektion endete mit einer Abschlussdiskussion, im Rahmen derer die<br />
Notwendigkeit betont wurde, im Lichte der Befunde der historischen Einzelanalysen<br />
das eingangs vorgestellte systematische Modell zur Beschreibung der<br />
Medialität von Theatralität zu ergänzen und unterschiedliche (metaphorische<br />
und / oder semantische) Funktionalisierungen theatraler Praktiken sowie die<br />
Kategorie der Fiktionalität stärker einzubeziehen.<br />
Kirsten Kramer und Sabine Friedrich<br />
Sektion 3:<br />
La narración paradójica: "normas narrativas" y el principio de la "transgresión"<br />
Sektionsleitung: Nina Grabe, Sabine Lang, Prof. Dr. Klaus Meyer-Minnemann<br />
Normen markieren Grenzen. Allein über Grenzziehungen kann etwas in<br />
Existenz gebracht werden. Ohne Unterscheidungen gäbe es nichts, auch kein<br />
Nichts, insofern dieses als Gegensatz zu einem Sein gedacht ist. Dabei werden<br />
die Grenzen als solche in der Regel erst beobachtbar, wenn sie überschritten oder<br />
aufgehoben werden und neben dem Einen zugleich das Nicht-Eine in den Blick<br />
gerät. Aus der Sicht der Systemtheorie gründet jene Vergleichzeitigung des<br />
Ungleichartigen wesentlich im Paradoxon. Bezogen auf die Literatur ermöglicht<br />
das Paradoxon gleichsam eine poetologische Selbst-Auseinander-Setzung, durch<br />
welche die Grenzziehungen bewusst gemacht werden, die die Literatur als solche<br />
konstituieren. Gemeint sind hier die Grenzen zwischen Fiktion und Realität, zwischen<br />
den verschiedenen Gattungen, Gattungstraditionen oder den spezifischen<br />
Strukturen eines einzelnen Werks. – Die Sektion hatte sich zum Ziel gesetzt,<br />
den verschiedenen Formen der Grenzziehungen und deren Bewusstmachung<br />
durch Überschreitung und Aufhebung der Grenzen in spanischen und spanischamerikanischen<br />
Erzähltexten des 17. bis 20. Jahrhunderts nachzugehen. Damit<br />
verband sich auch die Absicht, einen Beitrag zu einer (noch zu schreibenden)<br />
Geschichte des "paradoxalen Erzählens" zu leisten.<br />
Auf der Suche nach Definitionskriterien einer narración paradójica vertrat<br />
FÉLIX MARTÍNEZ BONATI (Bremen) im Eröffnungsvortrag die These, Literatur<br />
gründe prinzipiell in einem Akt der transgresión. Entsprechend sei sie nicht<br />
mimesis, sondern metamimesis. Für das Erzählen bedeute dies nichts anderes,<br />
als dass es seine Wahrscheinlichkeit nur dadurch erlange, dass es – ob nun<br />
realistisch oder fantastisch – notwendig unwahrscheinlich sei. SABINE LANG<br />
(Hamburg / Mainz) begriff das paradoxale Erzählen als ein Erzählen, das mit<br />
sich selbst in Widerspruch tritt oder, anders gefasst, das der Doxa als der herrschenden<br />
Auffassung des Erzählens und der aus dieser resultierenden Erwartung<br />
entgegensteht. Gleichzeitig stellte sie eine Typologie des paradoxalen